Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Harmonik
2.1. Neue Wege
3. Gruppentheorie
3.1. In der Anwendung: Nomos Alpha
4. Siebtheorie
4.1. Wandel
5. Wissenschaftskunst
5.1. Technologien & Strategien
6. Realisationen: Philips-Pavillon und UPIC
7. Ausblick
Literatur:
1. Einleitung
„ Je ne veux pas faire une oeuvre qui ne soit que la suite d’une autre“
Iannis Xenakis
Musik ist kein mathematisches Zahlenspiel. Sie ausschließlich darauf reduzieren zu wollen, würde schlicht ihre Vielgestaltigkeit verkennen, kraft derer sie so viele Menschen begeistert mitreißt oder auch vehement abstößt. Diesem Potenzial wird immer eine Art Mythos, ein unerklärlicher Nimbus innewohnen.
Und doch besticht natürlich der Gedanke, die sie konstituierenden Parameter rational aufzuschlüsseln. Eine Erklärung, einen Drücker für ihre Kräfte zu finden, um ihr Geheimnis endgültig zu ergründen oder ihm wenigstens näher zu kommen. Wenn schon keine „Weltformel“, so wenigstens eine „Formelsammlung“ für Musik.
Hier soll allerdings – um Missverständnissen gleich aus dem Weg zu gehen – nicht der Frage nachgegangen werden, ob innerhalb eines Stückes oder, um es weiter zu fassen, auch eines musikalischen Stils dieser Ton, jene Klangfolge eher zu erwarten wäre als eine andere. Dies ist nämlich gar keine Frage, sondern ein Charakteristikum, von dem jede Musik geradezu lebt. Die Erfüllung unserer musikalischen Erwartungshaltung (ob bewusst oder unbewusst) bzw. die Auslotung oder auch Negierung gültiger Konventionen bestimmen ja unsere Affinität zu einer bestimmten Musik. In anderen Worten: die Wahrscheinlichkeit und damit mathematische Bestimmbarkeit, dass beispielsweise in einem „klassischen“ Stück auf eine Dominante die Subdominante folgt (sehr gering), ist genauso wenig ein Mysterium wie, um sogleich den Bogen zur U-Musik zu schlagen, der Vorrang von Parallelfunktionen in jedwedem Popstück (sehr groß). Dass immer weniger in derartigen Kategorien gedacht wird, spielt für den Höreindruck und den Wiedererkennungswert, um den es geht, überhaupt keine Rolle.
Vielmehr soll es um die Frage gehen, ob eine axiomatische Methode gefunden werden kann, um den „Tonraum“, den „Tonvorrat“, das „Material“ oder wie auch immer man das nennen mag, nicht in einem letztendlich willkürlichem System (wie es unsere westliche Harmonik auch ist), sondern einem mathematisch bestimmten und somit allgemein gültigen zu ordnen. Die Tragweite dieser Vision muss man sich erst einmal vor Augen halten: sie bedeutet zunächst, dass man damit sämtliche Tonsysteme der Welt, der Vergangenheit und der Zukunft unter einen Hut – in eine Art „Handbuch“ – bringen könnte. Natürlich hätte man auch damit das „Wesen“ der Musik an sich nicht entschlüsselt: ihre oftmals rätselhaften Wirkungsmechanismen können durch ein Tonsystem, so allgemein anwendbar es auch immer sein mag, nicht erklärt werden, da ein solches immer nur die Organisation der Musik beschreiben kann. Dass diese Organisation aber besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert zunehmend mathematisch gefasst wurde, ist sicher nicht nur dem Kielwasser der so begeistert aufgenommenen Informationstheorie geschuldet. Eine mathematisch-naturwissenschaftliche und damit auf Formeln basierende Klanggestaltung erlaubt nämlich neben ihrer universalen, also kontextunabhängigen Anwendbarkeit auch Rückschlüsse, Querverbindungen und Analogien zur Physik. Somit können auch jene Massenphänomene, die die natürliche Klangwelt beeinflussen – das Rascheln von Blättern im Wind, das Prasseln von Regentropfen – in ihre konstituierenden Momente aufgeschlüsselt und diese Momente für die individuelle Klangrealisation dienbar gemacht werden. Die „Krise des musikalischen Materials“ (Adorno), womit die geschichtlich irgendwann unausweichliche Verknappung der noch bleibenden Alternativen gemeint ist, wäre durch die „freie Beherrschung des Klangs“ (Stockhausen) abgelöst.
Konkret wären der Kunstmusik, die sich eigentlich schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts – heute aber mehr denn je – schwer tut, jungfräuliche Wege zu gehen, völlig neue Perspektiven eröffnet. So müsste niemand mehr befürchten, nur Werke oder Stile eines anderen zu perpetuieren, wie es Iannis Xenakis freilich bitter formuliert.
Xenakis ist denn auch diejenige Künstlerpersönlichkeit, auf die sich unser Fokus quasi automatisch richten wird: kein anderer hat je mit einer derartigen Intensität, mit einer derartigen Fruchtbarkeit mathematische Faktoren in musikalisches Schaffen integriert. Sein Einfluss auf die heutige Kunstmusik ist vermutlich nur mit dem Stockhausens zu vergleichen. Er war es auch, der mit seiner Siebtheorie, die sozusagen die kulminierte Essenz seiner Bemühungen um die Formalisierung der Musik darstellt, ein mögliches Lösungsangebot zur oben genannten Problematik entwickelte und in vielen seiner Projekte die Symbiose von Wissenschaft und Kunst realisierte.
Bevor wir die Siebtheorie als Möglichkeit zur Berechnung von Musik knapp umreißen, wird es sich als unabdingbar erweisen, einige mathematische Grundkenntnisse darzulegen. Selbst beileibe kein Experte auf diesem Gebiet, werde ich versuchen, die nötigen Vorraussetzungen möglichst knapp und verständlich zu erläutern. Dem sei ein überaus kurzer Abriss des Wesens der (westlich-abendländischen) Harmonik vorangestellt, nur um zu zeigen, dass es sich dabei entgegen dem Glauben vieler ebenfalls um ein konstruiertes System handelt.
Anschließend wird es natürlich darum gehen, die oben nur einleitend formulierten Gedanken weiter auszuführen und nach dem Sinn, dem Warum der musikgeschichtlichen Tendenz nach mathematischer Formalisierung zu fragen, und zwar sowohl aus historischer Sicht als auch im Hinblick auf die Zukunft. Natürlich wird es dabei ausschließlich um die Kunstmusik gehen – die Popularmusik oder U-Musik ist von jeher andere Wege gegangen.[1]
Schließlich werden wir uns aus medienwissenschaftlicher Perspektive mit der Frage auseinandersetzen müssen, inwiefern sich diese ganzen Klangwelten als Medienkunst auffassen lassen und dabei natürlich auch den transmedialen Aspekt, mit der sich die Kunst wohl allgemein mehr und mehr konfrontiert sieht, nicht unberücksichtigt lassen. Gerade die Auseinandersetzung mit Iannis Xenakis scheint dafür hoch geeignet, suchte er doch – selbst Architektur und Musik in zahlreichen Projekten vereinigend – zeitlebens nach einer Verbindung nicht nur der Künste untereinander, sondern auch der Künste und der Wissenschaft. Möglicherweise wird sich dann in dieser Verbindung, so sie sich denn als brauch- und fruchtbar erweist, auch das Diktum einer Medienkunst realisieren, die auch als Medientheorie Bestand haben kann.
2. Harmonik
1722 verfasst Jean-Philippe Rameau sein Traité de l’Harmonie mit dem Ansinnen, die zunehmend vielgestaltig werdenden Parameter der mehrstimmigen Klangorganisation zu systematisieren. Dieses namentlich von Hugo Riemann (1893) und Arnold Schönberg (1911) ausgebaute System bildet bis heute die Grundlage beinahe jeder Musik, die wir hören (und was die meisten Menschen betrifft, auch überhaupt kennen).
Es soll hier überhaupt nicht angestrebt werden, dieses System – dessen genaue Kenntnis ein langwieriges Studium erfordert – zu erläutern, was zweifelsohne zu inakzeptablen Verkürzungen führen würde. Schon die vorangegangenen Sätze bewegen sich epistemologisch auf sehr schmalem Grat. Es geht ausschließlich um die „Erkenntnis, daß auch die Harmonik nichts als ein Kunstmittel wie andere auch“[2] ist, trotz des Umstandes, dass sie salopp formuliert die Grundlage für Klassik wie Pop, für philharmonische Konzerte wie für Radiomusik bildet.
In der Tat ist zwar das Verhältnis der Töne untereinander, wie wir sie verstehen (und in der Regel auch „mögen“) von ganzzahligen Brüchen bestimmt: eine Oktave erreicht man durch die Teilung (einer Seite, um hier das anschaulichste Beispiel zu verwenden) 1:2, die Quinte durch die Teilung 2:3 usw. Die Organisation dieser Töne aber um eine Antithese zwischen einzelnen unter ihnen (konkret vor allem Quinte und Quarte), die daraus resultierende „Quintverwandschaft“ sowie alles, was untrennbar damit zusammenhängt, ist ein kulturelles Konstrukt: die „Harmonik war ein System gewesen, das von der akustischen Erscheinung des Tones weitgehend absah.“[3] So ist schon bei Schönberg die Harmonielehre nicht mehr reiner Selbstzweck, sondern wird „zum Dokument der Krise, zum Versuch kompositorischer Selbstfindung“[4], ähnlich wie sich Stockhausen später offenbar getrieben fühlte, ganze Abhandlungen zur Erläuterung seiner Absichten zu schreiben. „In dem Augenblick [aber], da Tonalität[5] nicht mehr als das natürlich tragende Gerüst von Musik gelten konnte, musste Schönberg sich auf die Suche nach etwas Neuem begeben, das Verbindlichkeit gewährte.“[6]
2.1. Neue Wege
Warum aber dieses „Neue“ ausgerechnet – wie Xenakis – in der scheinbar so spröden Mathematik suchen? Wir sollten nicht vergessen, dass heutzutage noch mehr Optionen als damals im wahrsten Sinne des Wortes verbaut sind: schließlich war das „Problem schon der Musik der Jahrhundertwende [zum 20. Jahrhundert …], wie jetzt noch komponiert werden könne.“ Insofern sind „ein Gutteil der Wege, die damals offenstanden, bis ans Ende beschritten, wie der der Wiener Schule“ (Schönberg, Berg, Webern) oder auch die Fruchtbarmachung alter Formen (Reger, Prokoffiew).[7] Außerdem sollte man bedenken, dass Xenakis durch seinen Werdegang als gelernter Ingenieur und langjähriger Architekt im Atelier von Le Corbusier in Paris ganz automatisch ständig von geometrischen, statischen und allerlei anderen mathematischen Problemen eingenommen war. Diese gingen bei ihm als dem Autodidakten, der er Zeit seines Lebens geblieben ist, sowie im Zusammenhang mit seiner starken intuitiven und synästhetischen Gabe auf ganz natürliche Weise in seinen musikalischen Schaffensprozess über. Ohnehin ist, wie wir nun bei näherer Betrachtung sehen werden, „die Idee, ein Klangkontinuum als Zustand statistischer Größen [also der Auffassung Xenakis, Musik nicht als sukzessive Disposition einzelner Teile[8], sondern als massenphänomenologisch geballte Cluster] aufzufassen und auch so zu behandeln, sicher nicht ungewöhnlicher als der Gedanke, eine Klangfläche zum Resultat strenger mikropolyphoner Organisation [also der klassischen Konzeption von Satzlehre, genauer Kontrapunkt & Harmonielehre[9] zu] machen.“[10]
[...]
[1] vgl. Peter Wi>
[2] Klaus Ebbeke: Phasen – Zur Geschichte der elektronischen Musik, Berlin 1984; S. 30
[3] ebd., S. 31
[4] ebd.
[5] Tonalität als dem der Harmonik übergeordneten Prinzip, nach dem die Töne hierarchisch um einen „Grundton“ angeordnet sind.
[6] Ebbeke, S. 31
[7] ebd., S. 5
[8] vgl. „Kontrapunkt“, vom lat. punctus contra punctum, also (einzelne) Note gegen Note
[9] Worauf im Übrigen auch die populären Musikformen basieren.
[10] Randolph Eichert: Iannis Xenakis und die mathematische Grundlagenforschung, Saarbrücken 1994; S. 30
- Arbeit zitieren
- Bruno Desse (Autor:in), 2007, Musik berechnen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111608
Kostenlos Autor werden






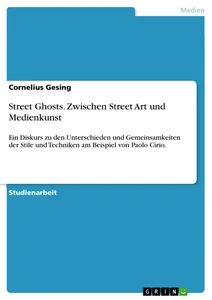













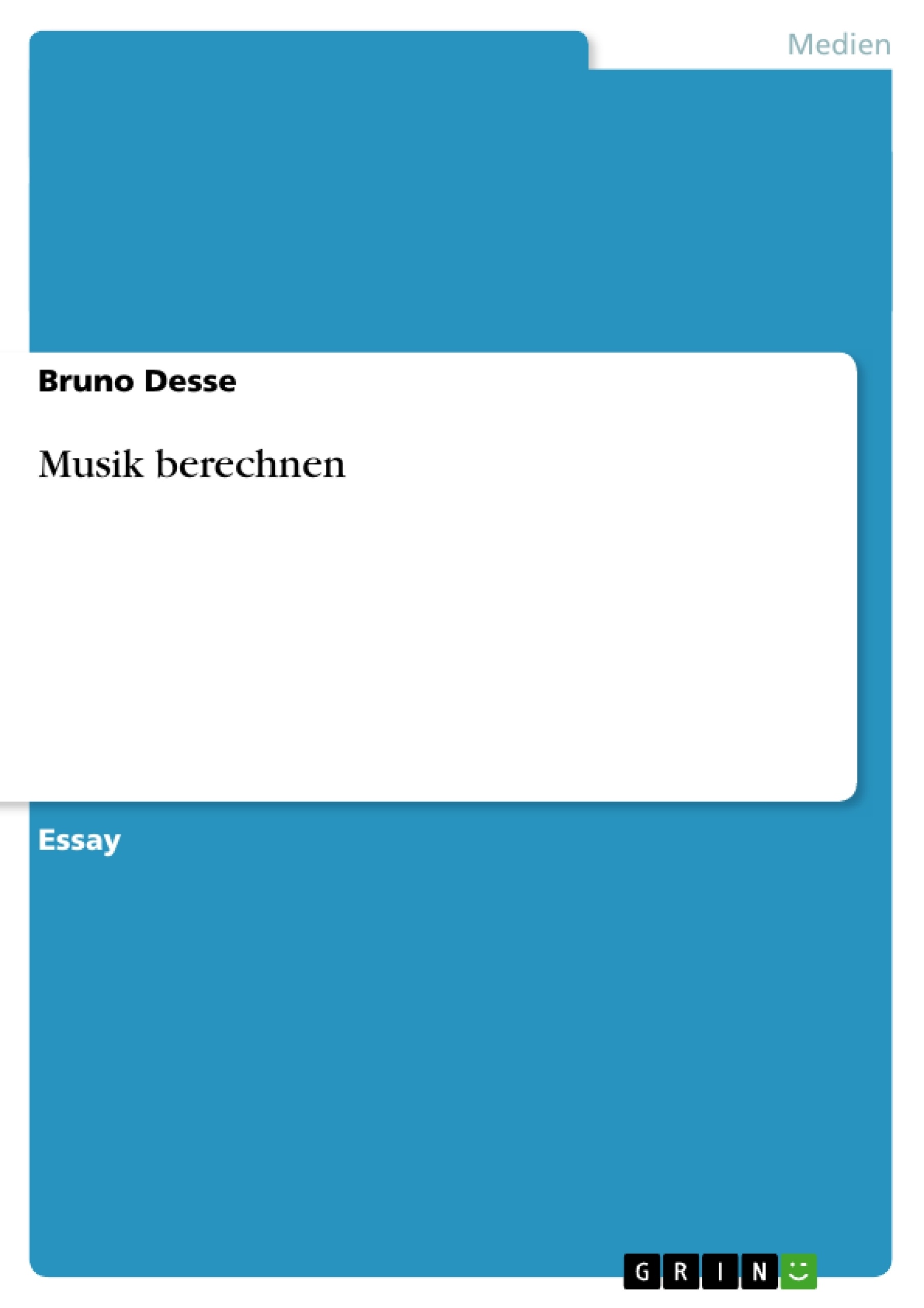

Kommentare