Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
I. Einleitung
I.1. Thema
I.2. Aufbau der Arbeit
I.3. Quellenlage
II. Theorie
II.1. Begriffsabgrenzungen
II.1.1. Region
II.1.2 Regionalismus
II.1.3. Subsidiarität
II.1.4 Föderalismus
II.2. Regionalpolitik
II.2.1. EU-Regionalpolitik
II.2.1.1. Ausgangslage und Ziele
II.2.1.3. Entwicklung
II.2.1.4. Effektivität und Legitimation
II.2.1.5. NUTS
II.2.1.6. Zielgebiete
II.2.1.8. Grundsätze der Planung und Umsetzung
II.2.1.9. Akteure
II.2.1.10. Finanzinstrumente und Mittelverteilung
II.2.2. Zwischenstand
III. Praxis
III.1. EUREGIO e.V
III.1.1. Einleitung
III.1.2. Struktur des EUREGIO-Gebiets
III.1.3. Aufbau der Institution EUREGIO
III.1.4. Ziele
III.1.5. EUREGIO und INTERREG
III.1.6. INTERREG-Förderkriterien
III.2. Systematik der Erfolgskontrolle
III.2.1. Kontrollart
III.2.2. Untersuchungsgegenstand
III.2.3. Rechercheverlauf
III.3. Evaluation von INTERREG I
III.3.1. Projektbeschreibung
III.3.2. Zusammenfassung
III.3.3. Schlussfolgerungen
IV. Fazit
Quellen:
Literatur:
Internet:
Anahang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I. Einleitung
I.1. Thema
Die Grenzregionen hatten es lange nicht leicht. Mit ihrer Randlage befanden sie sich nur in der Bewusstseinsperipherie der nationalstaatlichen Politik. Weitab von den großen wirtschaftlichen Zentren spielten sie insgesamt eine eher untergeordnete Rolle. Erst durch die Schaffung des europäischen Binnenmarktes wurden sie aufgewertet. Sie sollten die Motoren, die neuen Keimzellen des europäischen Integrationsprozesses werden. Seitdem werden Verkehrsnetze ausgebaut, Unternehmen subventioniert und den Bewohnern der Grenzregionen wird erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Besonders deren Qualifikation und Mobilität sollen gesteigert werden. Mit INTERREG (Integration der Regionen im europäischen Raum) schuf die EU ein Förderprogramm, das als Bestandteil des EFRE (Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) für die Zusammenarbeit zwischen Regionen zuständig ist und den Prozess erleichtern soll. Allein für INTERREG III (2000-2006) standen 4,875 Mrd. € zur Verfügung.
Gefördert wird seit Anfang der Neunziger die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit. Für diese Arbeit ist nur die grenzüberschreitende Komponente von Interesse. Durch gemeinsame Entwicklungsstrategien soll nach Angaben der EU das Entstehen grenzübergreifender wirtschaftlicher und sozialer Pole beschleunigt werden. Mittels gezielter Investitionen soll die Wirtschaft in den Grenzregionen belebt und der Lebensstandard der Bewohner angehoben werden. Abwanderung soll außerdem entgegengewirkt werden. Im Sinne eines zusammenwachsenden Europas sollen Regionen entlang der Grenzlinien zusammengeschweißt werden. INTERREG ist dazu da, die dafür erforderlichen Grundlagen zu schaffen, eine Anschubfinanzierung zu leisten, soll aber keine dauerhaften Verantwortungen zu übernehmen. Denn die Projekte und Maßnahmen sollen in der Regel so angelegt sein, dass langfristige Kooperationen daraus erwachsen und diese ohne eine weitere Finanzierung von Seiten der EU bestehen können. Ob das auch in der Praxis der Fall ist, ist Gegenstand dieser Arbeit.
Die EUREGIO eignet sich besonders gut für diese Untersuchung, da sie bereits seit den Fünfzigern grenzüberschreitende Netzwerke auf den verschiedensten Ebenen gebildet hat und aufgrund ihres Erfahrungsschatzes für viele, erst in den Neunzigern gegründete Kooperationen als Vorbild dient. Sie war von Anfang an Nutznießer der Förderung und pflegt sowohl zu anderen Grenzregionen als auch zur EU sehr gute Kontakte. Aufgrund des jahrzehntelangen erfolgreichen Engagements der EUREGIO ist grundsätzlich davon ausgehen, dass sie in der Auswahl und Umsetzung der Projekte solide Arbeit geleistet hat. Jetzt, kurz vor Ablauf der dritten Förderungsphase, lohnt es sich einen Moment inne zu halten und zurückzublicken. Welche Investitionen haben sich gelohnt? Welche Projekte sind gescheitert und warum? Diese Fragen werden, eingebettet in die Ziele der EU-Regionalpolitik, behandelt. Ob die vielfach gepriesene Vorbildfunktion der EUREGIO gerechtfertigt ist, wird in den folgenden Kapiteln auf den Prüfstand gestellt und ermittelt, ob bei der Projektauswahl, -förderung, -begleitung und -nachbereitung Verbesserungsbedarf besteht.
I.2. Aufbau der Arbeit
Die Arbeit besteht grob aus zwei Teilen. Einem theoretischen und einem praktischen. Der erste Teil umfasst Begriffe wie Region, Regionalismus und Subsidiarität. Die Charakteristika einer Grenzregion werden daran gemessen. Anschließend wird die Regionalpolitik der EU umrissen. Diese wird hier nicht erschöpfend, sondern nur in den Bereichen, die von größerer Relevanz für den zweiten Teil sind, behandelt. Die Entwicklung des Politikbereichs und im Speziellen die Ziele der INTERREG-Phasen werden hier thematisiert. Am Ende des ersten Teils wird exemplarisch erörtert, wie die EU-Regionalpolitik legitimiert wird und welche weiteren Mechanismen in die Politik hineinspielen, die nicht unmittelbar mit den Zielsetzungen in Verbindung stehen.
Das Ganze hat zum Ziel, den Rahmen um die Arbeit der EUREGIO im zweiten, empirischen Teil zu ziehen. Nicht die Geschichte des Vereins und auch nicht sein Aufbau sollen im Mittelpunkt stehen, sondern konkret der Verbleib der Gelder. Wie zu Beginn schon angeklungen, liegt das Hauptaugenmerk auf einer Stärken-Schwächen-Analyse, um die – wie es immer so schön heißt – Nachhaltigkeit der Projekte zu überprüfen. Überspitzt formuliert könnte man auch fragen: War es ein bestimmtes Projekt wert Millionen zu investieren und was hat INTERREG tatsächlich für ein Zusammenwachsen der Region gebracht? Dazu wurde der zweite Teil der Arbeit in einen deskriptiven und einen interpretatorischen Teil gegliedert. Im deskriptiven werden alle Projekte aus INTERREG I einer Nachkontrolle unterzogen und exemplarisch einige Höhepunkte und Tiefschläge ausführlicher behandelt. Der interpretatorische Abschnitt zeigt Gesetzmäßigkeiten auf. Hier wird untersucht, welche Schwerpunkte tendenziell erfolgreicher sind, welche Ursachen zu Erfolgen und Misserfolgen führen und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Ergebnisse zu optimieren. Im Fazit wird der Bogen geschlossen und erörtert, was INTERREG für die Region, bzw. was die Region zur Realisierung der INTERREG-Ziele beigetragen hat.
I.3. Quellenlage
Die Grundlagen zur EU-Regionalpolitik und zu einzelnen Finanzierungsinstrumenten sind umfassend in der Literatur bearbeitet. Hier war schnell ein Überblick erstellt. Der empirische Teil erwies sich allerdings als weitaus arbeitsaufwendiger als anfangs gedacht. Informationen über die Projekte im EUREGIO-Gebiet während der Förderphase zu erhalten war das geringste Problem. Dank der sorgfältigen Dokumentation der EUREGIO lassen sich Kooperationspartner, Investitionssummen, Ziele, Resultate und weitere Planungen ermitteln. Einigermaßen überraschend war allerdings die Tatsache, dass die EUREGIO kaum dokumentiert, was nach Ablauf der Projektfinanzierung aus den Maßnahmen geworden ist.[1] In den Endberichten zu den Projekte heißt es oft, es sei eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen eingerichtet oder die Wirtschaftlichkeit verbessert worden, die Besucherzahlen hätten zugenommen oder es sei ein grenzüberschreitendes Netzwerk entstanden. Das klingt gut. Aber ob die Arbeitsplätze erhalten geblieben sind, an welchen Maßstäben Verbesserungen festgemacht wurden und ob die neuen Netzwerke auch tragfähig sind, bleibt leider offen. Ob es überhaupt eine wie auch immer geartete Fortführung der Arbeit gegeben hat, entzieht sich sogar oft gänzlich den Kenntnissen der EUREGIO.
Die Archive der EUREGIO quellen über, was die Anlaufphasen und den Ablauf innerhalb der Projektphasen anbelangt. Nur, was die Anschubfinanzierung tatsächlich geleistet hat, ist unklar. Bisher wurde weder im Auftrag der EUREGIO noch durch andere Instanzen, keine wissenschaftliche Arbeit zu dieser Fragestellung verfasst. Das machte zwar einen besonderen Reiz aus, erhöhte aber auch den Recherche-Aufwand. Bei der Frage nach dem Grund für die fehlende Nachkontrolle hieß es, die personellen Kapazitäten der EUREGIO seien schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Die Genehmigung der Projekte und ihre Abwicklung nehme alle verfügbare Zeit in Anspruch. Das ist verständlich. Eine weitere Erklärung lautete, dass es in den Verträgen nicht vorgesehen sei, eine Evaluation nach Ablauf der Förderung durchzuführen. Die Gespräche mit der EUREGIO ließen den Rückschluss zu, dass das Interesse an einer Evaluation generell nicht sonderlich groß ist. Die Auskunftsbereitschaft hielt sich – aus welchen Gründen auch immer – in Grenzen. Einzelheiten dazu folgen im zweiten Teil der Arbeit.
Es soll hier nicht unterstellt werden, die EUREGIO werfe Steuergelder leichtfertig aus dem Fenster. Wirft man einen Blick auf das umfangreiche Genehmigungsverfahren (siehe III.1.6. Förderkriterien) und die Auswahl der Projekte, wird deutlich, welch enormer Aufwand betrieben wird, um für die Region die sinnvollsten Maßnahmen zu ergreifen. Aber auch nach einem erfolgreichen Abschluss, auch wenn alle Erwartungen sogar übertroffen wurden, ist es sinnvoll eine Evaluation durchzuführen. In Zeiten, in denen die Kosten-Leistungs-Verantwortung – oder neudeutsch: Controlling – eine immer größere Rolle spielt, ein unverzichtbarer Aspekt.
Zur Erfüllung der Aufgabenstellung dieser Arbeit war es zwingend notwendig, die Projektträger und Kooperationspartner um ihre Kooperation zu bitten. Durch zahllose Telefonate und E-Mail-Kontakte konnte so eine zwar nicht lückenlose, aber zufrieden stellende Auswertung erarbeitet werden. Als schwierig erwies sich der Spagat zwischen dem notwendigen zeitlichen Abstand zu den Projekten und der Verfügbarkeit von Ansprechpartnern. Um von langfristigen Effekten zu sprechen, sollten einige Jahre verstrichen sein. Dann besteht allerdings die Gefahr, dass die damals Mitwirkenden inzwischen in anderen Bereichen tätig oder sogar bereits pensioniert sind. Bei der Recherche stellte sich außerdem heraus, dass es müßig ist, Kooperationspartner nach Auskünften zu bitten, da diese meist nur am Rande, in Extremstfällen sogar gar keine Notiz von den Abläufen genommen haben. Hauptansprechpartner waren also die Antragsteller. Von gravierenden nationalen Unterschieden, was die Auskunftsbereitschaft der Projektträger anbelangt, kann nicht gesprochen werden. Sowohl bei den Niederländern als auch bei den Deutschen gab es sowohl Fälle, die man schlimmstenfalls als Verschleierungstaktik werten muss, als auch Beispiele enormer Hilfsbereitschaft.
Bei der Dokumentation der Kontakte ergab sich eine Schwierigkeit. Mehrfach wurde die nachdrückliche Bitte geäußert, nicht namentlich erwähnt zu werden. Deshalb sind in der hier vorliegenden Auswertung nur die Institutionen und das Datum des Kontaktes genannt, nicht aber die Namen der Mitarbeiter. Diese sind nur in der detaillierten Dokumentation eines jeden Gesprächs in den Rechercheunterlagen inklusive Kontaktdaten vermerkt.
Die statistischen Daten, die für Aussagen über die Gesamtentwicklung des grenzüberschreitenden Gebietes von Relevanz sind, konnten dank der Erhebungen des EURES-Zentrums der EUREGIO (European Employment Services) ohne größere Umstände zusammengetragen werden. Ergänzend wurden Informationen einzelner Institutionen wie Tourismusverbände oder Verkehrsgesellschaften eingeflochten.
II. Theorie
II.1. Begriffsabgrenzungen
II.1.1. Region
Bevor man von Regionalismus und Regionalpolitik spricht, stellt sich die Frage, was der Ansatzpunkt ist, was also eine Region ist. Von deutscher Warte aus scheint das leicht erklärt zu sein. Traditionellerweise beanspruchen die Bundesländer den Regionenstatus für sich. Blickt man in die europäische Nachbarschaft, werden schnell Unterschiede in Kompetenzen und Ausformung deutlich. Während die autonomen Gemeinschaften Spaniens und die Regionen Belgiens über Kompetenzen verfügen, die den deutschen Ländern ebenbürtig sind, ist die Stellung der italienischen Regionen deutlich schwächer. Während die Niederlande oder Portugal weitestgehend dezentral angelegt sind, sind Griechenland, Schweden oder Dänemark mehr oder weniger unitarisch einzustufen.[2] Der Begriff Region kennt aber noch ganz andere Dimensionen. In anderen Zusammenhängen werden Zusammenschlüsse wie die EFTA (European Free Trade Association) als Region bezeichnet. Als Kriterium für die Abgrenzung kann an einer Stelle die Struktur oder Funktion, an anderer Stelle die kulturelle Identität gemeint sein. Also was heißt Region eigentlich? Ganz allgemein kann man sagen, dass Regionen Teil eines übergeordneten Raums sind. Hier folgen nun ein paar Beispiele der unzähligen Definitionsarten.
a) Analytischer Ansatz
Eine Unterteilung ist beispielsweise nach dem analytischen Ansatz in homogene, integrative oder funktionale Raumeinheiten möglich: Zur Abgrenzung der homogenen Raumeinheiten werden gleiche oder ähnliche Strukturmerkmale herangezogen. Territorien, die meistens durch ethnische, sprachliche, kulturelle oder auch religiöse Gemeinsamkeiten entstanden sind, fallen darunter. Denkbar sind auch Dialekte, Klima, Topographie oder die regionale Küche. Beispiele sind das Rheinland oder Schwaben. Bei den funktionalen oder integrativen Raumeinheiten hingegen kommt es nicht darauf an, dass besonders viele Merkmale übereinstimmen. Vielmehr liegt der Fokus hier auch auf der Intensität wirtschaftlicher und sozialer Verflechtungen. Im Vordergrund dieser Regionen stehen nicht-administrative Aufgaben. Es geht um Interaktionsverflechtungen wie beispielsweise Pendlerbewegungen zwischen benachbarten Räumen. Oft spielen Gravitationszentren, die Mobilität der Produktionsfaktoren und Güter eine Rolle. Die Art des Zentrums variiert ebenso wie die Art der Beziehungen.[3] Regionen, die durch den integrativen Ansatz definiert sind, sind z.B. die EUREGIO, EuRegio SaarLorLux, Euregio Maas-Rhein oder Euroregion Pro Europa Viadrina. Als Bezeichnungen für den integrativen Ansatz einer geographischen Region wird auch Landschaft (z.B. Oder-Landschaft, Elbtalauen, etc.) oder Konferenz (z.B. Internationale Bodenseekonferenz oder Oberrheinkonferenz) verwendet.
b) Normativer Ansatz
Im Gegensatz zum analytischen Ansatz basiert der normative Ansatz auf Verwaltungsstrukturen. Für die Unterscheidung von den homogenen oder funktionalen Regionen ausschlaggebend sind also administrative Kriterien. Darunter fallen beispielsweise die Bundesländer, Kreise und Kommunen. Hier liegt ein politisches, konkret: föderalistisches Konzept zugrunde. Der politische Gestaltungswille kommt innerhalb der räumlichen Abgrenzung zum Ausdruck. Der Spielraum ist hier allerdings groß. Schindler nennt das Beispiel Brandenburg, das aus besitzstandswahrenden Motiven eine zusätzliche Untergliederung des Territoriums vornahm: Brandenburg Nordost konnte so nach der Osterweiterung Fördermittel sichern, Brandenburg Südwest fiel aus der Förderung heraus. Ohne die Trennung hätte Brandenburg keinerlei Ansprüche mehr auf Regionalmittel gehabt.[4]
Daiva Döring hat den Begriff Region in einen größeren Zusammenhang gestellt und unter dem Gesichtspunkt der Organisationsstruktur gegliedert:
a) National mit dem Ziel der Autonomie, Separation (ETA, IRA)
b) Transnational als grenzüberschreitende Region/Euregion (Arge Alp, Regio Basiliensis)
c) International als Zusammenschluss von Staaten (EFTA, EU).[5]
Zielt die erste Gruppe im Sinne eines Regionalnationalismus auf eine Abspaltung vom Nationalstaat ab, so will die zweite eher zusätzliche Kompetenzen und/oder Leistungen erhalten. Autonomiebestrebungen sind hier nicht das Thema, sondern finanzielle Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation innerhalb der Region. Im Mittelpunkt steht dabei der Wirtschaftssektor. Die dritte Gruppe orientiert sich ebenfalls größtenteils an wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Ziele und Mittel bewegen sich nicht nur geographisch, sondern auch völkerrechtlich gesehen in viel weit reichenderen Dimensionen. Bemühen sich lokale Akteure beispielsweise um eine Kooperation im Rettungswesen, werden auf intergouvernmentaler Ebene geeignete Werkzeuge für gemeinsame Auslandseinsätze geschaffen. In beiden Fällen kommen Akteure vergleichbarer Ebenen zusammen, um über die Grenzen hinweg zu kooperieren. In beiden Fällen wird nicht selten über die juristische Legitimation gestritten.
Peter Alter hat einmal treffend bemerkt, dass die grenzüberschreitenden Kooperationen, die er unter dem Begriff Euregiones zusammenfasst, eine Form des Regionalismus darstellen, dem die historische Dimension weitestgehend fehlt. Es handele sich nicht um einen Regionalismus, der die Strukturen des Staates aufzulösen, sondern die nationalstaatlichen Grenzen zu überwinden sucht und transnationale Zusammenarbeit begründen will. Im Vordergrund stünden gemeinsame, meist wirtschaftliche Interessen benachbarter geographischer Räume. Eine kulturelle und historische Identität lasse sich nur mühsam konstruieren. Im Gegensatz zur Heimatbewegung fehlt den Euregiones also diese Dimension.[6] Euregiones oder Grenzregionen sind lokale oder regionale Gebietskörperschaften, die über die Grenze hinweg Kooperationen eingegangen sind. Namensgeber ist in vielen Fällen die EUREGIO mit Sitz in Glanerbrug, zwischen Gronau und Enschede. Sie wurde 1958 gegründet. Mittels gezielter Investitionen soll die Wirtschaft in den Grenzregionen belebt und der Lebensstandard der Bewohner angehoben werden. Abwanderung soll außerdem entgegengewirkt werden.
Während in den 60ern und 70ern nur allmählich Euregiones entstanden, erlebte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den 90ern einen regelrechten Boom. Die Öffnung der Grenzen und vor allen Dingen mit dem Start des EU-Förderprogramms INTERREG schossen die grenzübergreifenden Zusammenschlüsse wie Pilze aus dem Boden. Die meisten Grenzregionen, davon gibt es in Europa inzwischen rund 200, sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregionen (AGEG). Die AGEG ist eine Lobbyorganisation, die bemüht ist Einfluss auf die Entwicklung der EU-Förderprogramme zu nehmen und sorgt mittels Vernetzung ihrer Mitglieder für Erfahrungsaustausch.
Da Region von Land zu Land unterschiedlich definiert wird, hat die EU zur besseren Vergleichbarkeit und zur Umsetzung ihrer Regionalpolitik „eigene“ Einheiten entwickelt. Die NUTS. Die Nomenklatur der statistischen Gebietseinheiten basiert auf den Verwaltungsstrukturen der Mitgliedstaaten. Sie ist nicht grenzüberschreitend angelegt. (siehe hierzu II.2.1.5 NUTS)
II.1.2 Regionalismus
Mit der Wirtschafts- und Währungsunion, der WWU, und der neuen Integrationsstufe, der Vergemeinschaftung der Währungs- und Geldpolitik, war vorgesehen auch einen Schritt in Richtung politische Union zu unternehmen. Gleichzeitig keimten in Teilen Europas nicht zufällig nationalstaatliche und regionalistische Bewegungen auf.[7] Zum Teil etwas unverhofft besannen sich Regionen ihrer historischen Wurzeln, forderten mehr Mitspracherechte und artikulierten ihren Widerstand gegen die Kompetenzverlagerung von der nationalen auf die europäische Ebene. Ängste übergangen zu werden kamen auf. Neue Ansätze mit Titeln wie Europa der Regionen, europäischer Integrationsprozess von unten[8] oder auch horizontale Integration[9] und Regionalismus erlangten mal als Gegenposition, mal als Bestandteil der Vergemeinschaftung in unterschiedlichsten Schattierungen einen hohen Bekanntheitsgrad. Besonders die Zauberformel Europa der Regionen wurde in den vergangenen zehn Jahren inflationär benutzt. Fleißig wurden da nicht nur Kategorien entworfen und verworfen sondern auch übersteigerte Hoffnungen formuliert. Schwierig am Begriff des Europas der Regionen ist, dass er nicht einheitlich verwendet wird. Es gibt zwei widersprüchliche Modelle. Das erste bezieht sich nur auf die Stärkung des Föderalismus, das zweite zielt auf die völlige Auflösung der Nationalstaaten.[10] Die zweite Lesart soll im Rahmen dieser Arbeit außen vor bleiben.
Aus dem Dickicht der Bedeutungsvielfalt sind nun die dicksten Stränge des Regionalismus- Begriffs herausgelöst:
a) Bei den innerstaatlichen Regionalismen lassen sich folgende Hauptgruppen unterscheiden:
- Separatismus (Bildung eines souveränen Staates)
- Föderalismus (Gliederung in Bund, Länder und Kommunen) und
- Autonomismus (Forderungen nach Autonomie und Dezentralisierung, um regionale Sonderinteressen geltend zu machen)[11]
Entweder steht eine starke, geschichtlich gewachsene Autonomie oder die Antwort auf das Bedürfnis nach Verteilung der staatlichen Funktionen auf einer räumlichen Grundlage, die Dezentralisierung, im Vordergrund.[12]
b) Der transnationale oder grenzüberschreitende Regionalismus kennt unterschiedliche Organisationsformen an Binnen- und Außengrenzen der EU. Sowohl der öffentlich- rechtliche, als auch der privatwirtschaftliche Charakter ist möglich. Meistens werden sachbezogene Lösungen angestrebt, die kooperativ als besser behandelbar angesehen oder deren Effektivität beiderseits der Grenzen vorausgesetzt werden.
Der Regionalismus galt besonders Anfang der Neunziger als Allheilmittel. Allheilmittel gegen Bürokratisierung, Demokratiedefizite und mangelnde Transparenz aber auch als Lösung für Autonomiebestrebungen von Minderheiten. Euphorisch preist Matthias Schulz den Regionalismus „ein Lebenselixier für die vertikale Gewaltenteilung und damit den Föderalismus in Deutschland. Er ist auch ein Lebenselixier für die plurizentrische Struktur des kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Lebens, und damit eine verhältnismäßig gleiche Verteilung von Wohlstand“[13]. Gleiche Lebensstandards für alle – das ist ein Ideal. Eine Utopie. Selbst durch intensive Anstrengungen von Seiten der Nationalstaaten und der EU konnte dieses Postulat bisher nicht erreicht werden und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht realisierbar sein. Fraglich ist auch, ob eine Egalisierung überhaupt wünschenswert ist, bzw. noch einen Schritt zurück gedacht, ob sich Regionen überhaupt vergleichen lassen. Gerade bei nichtpekuniären Elementen wie Freizeit- oder Wohnwerten wird es schwierig.
Die Wiederentdeckung der kulturellen, ethnischen, religiösen, sprachlichen und historischen Eigenheiten wird von Kritikern nur als Untermauerung der eigenen Legitimation und als Grundlage des Anspruchs auf Fördergelder gesehen. Sie ist demnach nur eine Reaktion, keine Aktion und in den meisten Fällen eher eine Instrumentalisierung als eine tatsächliche Wiederbelebung des Heimatbewusstseins. Wenn also regionale Identitäts- und Solidaritätsbezüge bedient werden, um „sich für den Abbau der politischen und ökonomischen Macht der Nationalstaaten einzusetzen“[14], stehen sicherlich vor allem Ängste im Vordergrund marginalisiert zu werden. Ist das verwerflich? Vielleicht, aber es ist menschlich. Mitspracherechte und damit das Überleben der eigenen Region zu sichern, ist zwar egoistisch, aber ob man den Regionen deshalb einen Vorwurf machen darf, ist fraglich. Man muss berücksichtigen, dass die treibende Kraft der meisten Aktionen der eigene Vorteil ist und sich fragen, wo die Ursachen für die Entdeckung der regionalen Identität liegen.
Im Fokus dieser Arbeit werden Regionalismus und das Europa der Regionen als Ausformung der Regionalpolitik der EU betrachtet. Sie sollen im Folgenden nicht den blutigen Beigeschmack des Separatismus, der Verlagerung des Nationalismus auf eine niedrigere Ebene, haben, sondern im Kontext Föderalismus, Subsidiarität und europäische Integration betrachtet werden. Um den europäisierten Regionalismus soll es gehen. Er ist das politische Gegengewicht zur Kompetenzverlagerung auf die supranationale Ebene und das wirtschaftliche Gegengewicht zur Globalisierung. Für all diejenigen eine Lösung, könnte man als Kritiker anmerken, die sich bei Entscheidungen auf europäischer Ebene übergangen oder in ihren Interessen zu wenig berücksichtigt sehen. Ein Sedativum für alle, die von Integration und Globalisierung vor allem Nachteile erwarten.
Es stellt sich dann als nächstes die Frage, was der Regionalismus leisten soll. Sein Ziel ist die Stärkung der Region. Ihr soll ein Spielraum geschaffen werden, um die für sie relevanten Entscheidungen selbst treffen zu können. Das Europa der Regionen ist ein politisches Konzept, das im Kern die Regionen der EU-Mitgliedstaaten fördert und deren Eigenständigkeit unterstützt. Mehr Sachkompetenz und Bürgernähe, eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips sollen mit dem Konzept erreicht werden. Auf drei Ebenen wird das angestrebt: supranational, national und regional.
Aber kann denn der Regionalismus überhaupt für mehr Transparenz, für mehr Gerechtigkeit sorgen und Prozesse demokratischer gestalten? Ohne den Ergebnissen dieser Arbeit vorausgreifen zu wollen: nur bedingt. Unter guten Voraussetzungen könnte Politik tatsächlich „nahe am Bürger“ und transparenter gestaltet werden, können Entscheidungen von den Bürgern mitgestaltet und getragen werden. Das setzt aber den Willen der Bevölkerung zur Einflussnahme und eine ideale Umsetzung der Leitlinien der Regionalpolitik voraus. Und das ist nicht immer der Fall, wie der empirische Teil der Arbeit belegt. Ob die Mittel immer optimal und gerecht eingesetzt werden, ist in einigen Fällen stark zu bezweifeln. Ob man bessere Ergebnisse erzielen würde, wenn eine höher stehende Ebene die Entscheidungen treffen würde, ist aber noch zweifelhafter.
II.1.3. Subsidiarität
Der Regionalismus ist eng verknüpft mit dem Subsidiaritätsprinzip. Das „Subsidiaritätsprinzip erscheint […] als sozialphilosophisches Regulativprinzip für die adäquate Verteilung von gesellschaftlichen Aufgaben bzw. Zuständigkeitsbereichen. Es umfasst restriktive, konditionierende und legitimierende Aspekte der Kompetenzverteilung“[15]. Die Betonung liegt wohl vor allem auf „sozialphilosophisch“. Sieht Isensee schon Ende der 60er Jahre in ihm nichts als „Mythos und Mode“[16], hält sich bei anderen hartnäckig die Vision der „Magna Charta für Europa“[17]. Aus der katholischen Soziallehre entstanden, bezeichnet es die Förderung der Eigenleistung und die Selbstbestimmung sowohl des Individuums (und der Familien) als auch der Gemeinschaften (z.B. der Kommunen). Staatliche Eingriffe oder Eingriffe der EU und öffentliche Leistungen sollen nur dann gewährt werden, wenn die jeweils tiefere hierarchische Ebene (Länder, Kommunen, Familien) nicht in der Lage ist, die erforderliche (Eigen-)Leistung zu erbringen. In der Bundesrepublik spielt das Subsidiaritäts-Prinzip vor allem in der Bildungs- und Sozialpolitik eine wichtige Rolle.[18]
Das Subsidiaritätsprinzip erscheint im Grundgesetz, wenn auch nicht wörtlich, in Art. 72. Später floss es wörtlich in den Vertragsentwurf des Europäischen Parlaments von 1984, in die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986 und schließlich den Maastrichter Vertrag von 1991 ein.[19] Dort ist das Subsidiaritätsprinzip explizit in Art. 5 EGV festgeschrieben. Hiernach soll die Gemeinschaft nur dann gesetzgeberisch aktiv werden, wenn „die Ziele der in Betracht kommenden Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden“. Auch hier lauten wieder die Stichwörter Bürgernähe und Transparenz. Dabei schwingt der Vorwurf mit, könnte man kritisch anmerken, dass der Nationalstaat nur ein einziges Standardprogramm für alle Regionen bereithält.
Ob beim Begriff Regionalismus oder Subsidiarität – schnell wird deutlich, dass hier viel Raum für Interpretationen gegeben ist. Beiden Prinzipien ist gemein, dass sie in der Theorie viele Vorteile für die Bürger mit sich bringen können, in der Praxis aber noch umfassender Verbesserungen bedürfen.
II.1.4 Föderalismus
Während das Subsidiaritätsprinzip ein eher abstraktes Ordnungsideal ist, hat der Föderalismus eine deutlichere Ausformung. „Föderalismus ist ein Ordnungsprinzip, das auf weitgehender Unabhängigkeit einzelner Einheiten beruht, die zusammen aber ein Ganzes bilden (z.B. mehrere Länder und Provinzen einen Staat; mehrere Vereine einen Verband, etc.).“[20] Dabei lassen sich verschiedene Kategorien unterscheiden. Der politische Föderalismus ist eine Ordnung, bei der die staatlichen Aufgaben zwischen Gesamtstaat und Einzelstaaten aufgeteilt werden. Beide politische Ebenen sind für bestimmte Aufgaben selbst zuständig, die in der Verfassung festgelegt sind. Durch die vertikale Gewaltenteilung soll die politische Macht eingeschränkt werden, so dass einerseits mehrere Ebenen der politischen Teilhabe und Einflussmöglichkeiten entstehen und sich andererseits unterschiedliche Formen und Wege der politischen Aufgabenerfüllung ergeben. Außerdem soll der Schutz von Minderheiten gewahrt werden. Der föderale Aufbau des deutschen politischen Systems ist in Art. 20 Abs. 1 GG festgelegt. Der Gesamtstaat, der Bund, entscheidet über alle Fragen von Einheit und Bestand des Ganzen (z. B. Sicherung der Bündnisgrenzen), die Länder haben Selbstbestimmungsrecht in ihren Kompetenzbereichen (in Deutschland z. B. Bildung und Polizei). Als Beispiel für den institutionellen Föderalismus sind Parteien oder auch Vereine zu nennen. Unter der Organisation eines Dachverbands agieren diese in ihren Teilgebieten und gemäß ihrer Kompetenzen eigenständig.
Ohne an dieser Stelle noch weitere Gliederungsmodelle bemühen zu wollen sei noch folgendes erwähnt: zwischen Regionalisierung, Föderalismus, Subsidiarität und Dezentralisierung verwischen oft die Grenzen. Gemeint ist in den meisten Fällen dann nicht die Herausbildung neuer Strukturen, beispielsweise der so genannten dritten Ebene, sondern eine Neuordnung der Kompetenzen – im Falle Deutschlands zwischen EU und Bundesrepublik, Bund und Ländern, Kreisen und Kommunen. In Diskredit geraten Dezentralisierung, respektive der Regionalismus, immer dann, wenn mit wachsenden Aufgaben der unteren Ebenen eine finanzielle Belastung einhergeht, die nicht ausgeglichen wird.
II.2. Regionalpolitik
Wozu sind Regionalpolitiken im Allgemeinen da? Grundsätzlich lässt sich folgendes feststellen: Unter Regionalpolitik ist „die bewusste, von Hoheitsträgern vorgenommene Beeinflussung von Teilgebieten einer Volkswirtschaft zur Optimierung gesamtwirtschaftlicher Zielsetzungen zur verstehen“[21]. Entscheidend ist wohl bei dieser Definition, dass es nicht nur um die Regionen selbst sondern immer auch um einen größeren Sinnzusammenhang geht. Zur Umsetzung der Regionalpolitik werden Regionen zueinander in Beziehung gesetzt, beispielsweise ökonomische oder soziale Auffälligkeiten konstatiert, die beseitigt werden sollen. Bei der Unterteilung gilt – wie das Beispiel Brandenburg gezeigt hat – allgemein: je kleiner der Raum, desto größer die Unterschiede. Was dann letztendlich von der Regionalpolitik konkret in Angriff genommen wird, ist sehr unterschiedlich. Meist soll die staatliche Intervention die ökonomischen Aktivitäten des Raums verändern, um die Konjunktur des gesamten Staates anzukurbeln. Mit Solidarität, die gerne in diesem Zusammenhang genannt wird, hat das streng genommen wenig zu tun.
Je nach Zielorientierung gibt es unterschiedliche konzeptionelle Ansätze:
- Regionale Wirtschaftspolitik: Maßnahmen dienen der regionalen Verwirklichung gesamtwirtschaftlicher Ziele
- Regionalisierende Wirtschaftspolitik, bzw. Raumordnungspolitik: Maßnahmen mit gesellschaftlichen Zielen
- Regional gezielte Wirtschaftspolitik: Maßnahmen ohne regionalpolitische Konzeption
- Wirtschaftspolitik der Regionen: Maßnahmen einer eigenständigen Wirtschaftspolitik der Regionen[22]
In der Regel – und so soll der Begriff auch in dieser Arbeit verstanden werden – steht Regionalpolitik aber für einen Teilbereich der Wirtschaftspolitik, mit dem unter der Berücksichtigung räumlicher Dimensionen eine optimale Wirtschaftsstruktur des Gesamtraumes erreicht werden soll. Im Unterschied zur Raumordnungspolitik nimmt sie nicht nur auf wirtschaftliche Bereiche Einfluss.
Als Legitimation liegen folgende vordergründige Motive vor:
- Räumliche, ökonomische Allokationsmängel (bedingt durch externe Effekte oder Mobilitätshindernisse)
- Räumliche Verteilungs- und Ausgleichsprobleme (beispielsweise unterschiedliche Lebensstandards und möglicherweise dadurch bedingte soziale Spannungen)
- Räumliche Stabilisierungsschwierigkeiten (durch asymmetrische Schocks aufgrund von Strukturkrisen)[23]
Welche weiteren Interessen eine Rolle spielen können, wird der weitere Verlauf der Arbeit zeigen.
II.2.1. EU-Regionalpolitik
II.2.1.1. Ausgangslage und Ziele
Die Grundlage für die Regionalpolitik sind – wie es offiziell so schön heißt – die soziökonomischen Disparitäten innerhalb der EU. Die sollen in ihren unterschiedlichen Ausformungen beseitigt werden. Als Beispiele werden die Unterschiede im Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf genannt, etwa, dass das von Luxemburg doppelt so hoch sei wie das von Griechenland, oder dass Hamburg als wohlhabendste Region Europas ein vier Mal so hohes Pro-Kopf-Einkommen als das im Alentejo aufweist.[24] Diese Disparitäten zwischen den Regionen schadeten dem Zusammenhalt der Union, heißt es als Schlussfolgerung. Und: „Durch die Stärkung des Zusammenhalts fördert die Union nämlich eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, schafft Arbeitsplätze und trägt zum Schutz der Umwelt sowie zur Beseitigung von Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen bei.“[25] Ob das die einzigen Ziele sind oder ob nicht noch andere Interessen eine Rolle spielen, wird im weiteren Verlauf beleuchtet.
II.2.1.2. Handlungsfelder
Zu den Instrumenten der Regionalpolitik der EU zählen die
- Förderfunktion
- Kontrollfunktion und
- Koordinierungsfunktion.[26]
Was in den kommenden Kapiteln behandelt wird, bezieht sich nur auf die aktive Regionalpolitik, die Förderfunktion. Sie umfasst alle finanziellen und regionalpolitischen Maßnahmen, die aus dem Haushalt der EU und gemäß ihrer Zielsetzungen realisiert wurden und werden. Unter Kontrollfunktion ist die Beihilfenkontrolle zu verstehen, unter Koordinierungsfunktion die Abstimmung mit den Regionalpolitiken der Mitgliedsstaaten und den übrigen Politikbereichen der EU.
II.2.1.3. Entwicklung
Die Regionalpolitik der EU hat seit ihrer offiziellen Einführung in den 70ern einen enormen Wandel vollzogen. War sie zu Beginn ein Anhängsel der nationalstaatlichen Regionalpolitik, so hat sich inzwischen das Blatt zu ihren Gunsten gewendet. Die EU hat nun mit einem komplexen Förderinstrumentarium und eigenen Leitlinien den aktiven Part inne. Im Unterschied zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) hat die Regionalpolitik nicht nur einen Themenbereich, sondern eine ganze Reihe von Aufgabenfeldern, die von transeuropäischen Netzen bis zur Bildungspolitik reichen, im Visier. Trotz Reformen decken sich nicht immer die nach außen vertretenen Ziele der EU mit der Praxis. Mit dem Ziel das Wirtschaftswachstum in benachteiligten Regionen zu beschleunigen und die Lebensbedingungen europaweit anzugleichen verfolgt sie eher zweifelhafte Interessen und lebt von sehr vagen Vermutungen über die Auswirkungen ihrer Maßnahmen. Ihr heutiges Instrumentarium ist eher ein zufälliges Ergebnis politischer Entscheidungsprozesse, denn ein logischer Konstrukt, in dem man Förderungssysteme klar formulierten Zielen zuordnen könnte. Setzt man diese Erkenntnis mit dem Finanzvolumen in Zusammenhang, so regen sich Zweifel in Bezug auf die Legitimation.
Der Strukturfonds, die Gemeinschaftsinitiativen und der Kohäsionsfonds machen unter dem Strich rund ein Drittel des Haushaltes der EU aus. Im Zeitraum von 2000 bis 2006 waren 213 Mrd. € für die Finanzierung der Strukturinterventionen der Union vorgesehen. Von diesem Betrag flossen 159 Mrd. € in die Strukturfonds.[27] Damit ist er der zweitgrößte Haushaltsposten nach der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Über die direkte Förderung hinaus vergibt die Europäische Investitionsbank (EIB) zinsgünstige Darlehen.[28]
Eine rechtliche Verankerung kam erst im Laufe der Jahrzehnte zustande. Im EWG-Vertrag von 1957 wurde lediglich in der Präambel festgehalten, dass die Unterzeichnerstaaten willens sind, „ihre Volkswirtschaften zu vereinigen und deren harmonische Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Gebiete verringern.“ Das ist eine Absichtserklärung, keine Legitimierung eines Politikbereichs. In Art. 2 EWGV heißt es nur vage, dass eine „harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft“ gefördert werden soll. Von Regionalpolitik ist nicht die Rede. Auch aus dem Zusatzprotokoll Italiens, worin hingewiesen wird, dass das Land den Ausgleich von Disparitäten innerhalb der eigenen Grenzen anstrebt, lässt sich nichts Konkretes für die damalige EG ableiten. Bei der Gründung der EWG gingen die Mitglieder vielmehr davon aus, dass der gemeinsame Binnenmarkt selbst für einen Ausgleich zwischen den Regionen sorgen wird.[29]
De facto fand allerdings – wenn auch in überschaubarem Umfang – bereits mit der Errichtung des ESF (Europäischer Sozialfonds) und des EAGFL (Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds der Landwirtschaft) ab 1958 eine Regionalförderung statt. Hier wurden keine eigenen Projekte gefördert, sondern Maßnahmen der Mitgliedstaaten bezuschusst. Als Geburtsstunde der Regionalpolitik wird gemeinhin die Errichtung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Jahr 1975 angesehen. Rechtlich fixiert ist er in Art. 130a-130e EGV unter Titel V Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt. Ziel war nicht nur die Förderung der zurückgebliebenen Regionen, sondern auch eine stärkere Abstimmung der nationalen Wirtschaftspolitiken. Mit der Einführung des EFRE konnte noch nicht unbedingt von einem eigenständigen Instrument gesprochen werden, denn zwischen 1975 und 1979 hatte der Fonds immer noch komplementäre Funktionen zu den nationalstaatlichen Regionalpolitiken inne. Die Mittel wurden nach bestimmten Länderquoten quasi nach dem Gießkannenprinzip ausgeschüttet. Vorderrangiges Interesse war also nicht die Bedürftigkeit der Regionen.
Eine erste Abkopplung von den Mitgliedstaaten wurde 1979 vorgenommen. Immerhin 5 % der EFRE-Mittel wurden nach eigenen Kriterien vergeben. Damit wurden dann bestimmte, auf einen mehrjährigen Zeitraum angelegte Sonderprogramme anstelle einzelner Projekte realisiert. Außerdem wurden Erhebungen vorgenommen, welche die Lage in den Regionen der EU widerspiegelten. Für die Entwicklung neuer Förderprogramme war das entscheidend.
Ein deutlicher Schritt nach vorne gelang erst zehn Jahre nach der Errichtung des EFRE: mit der Reform der Regionalpolitik im Jahr 1985. Eine wesentliche Veränderung war der Übergang von Länderquoten zu einem System aus Beteiligungsspannen. D.h., dass den Mitgliedstaaten nur noch eine bestimmte Förderungsuntergrenze zugesagt wurde. Die zweite Veränderung bestand in der Initiierung umfassender Entwicklungsprogramme, die auf ausgewählte Regionen ausgelegt waren. Begünstigte waren beispielsweise Eisen- und Stahlregionen. Mit Art. 130d EGV war die Kommission angehalten, nach Revision der Römischen Verträge und dem Inkrafttreten der EEA die Fonds besser aufeinander abzustimmen und deren einzelne Instrumente zu definieren. Der Trend ging weg von ordnungspolitischen, hin zu interventionistischen Grundsätzen. In Art. 158 und 162 EGV heißt es, die Gemeinschaft verfolge das Ziel, „die Unterschiede im Entwicklungsstand verschiedener Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete oder Inseln, einschließlich der ländlichen Gebiete, zu verringern.“
Das geschieht auf drei Ebenen:
1. regional (Stärkung entwicklungsschwacher Regionen)
2. sektoral (Unterstützung bestimmter Wirtschaftszweige)
3. horizontal (Stärkung bestimmter Bereiche wie Beschäftigungs- oder Bildungspolitik)
Von einer regelrechten Emanzipation von den Regionalpolitiken der Mitgliedsländer kann man erst seit der Reform von 1988 sprechen. Sie ist die Grundlage der Regionalpolitik wie sie – bis auf kleinere Änderungen – bis heute bestand hat. Das Augenmerk liegt nach wie vor auf der Verringerung regionaler Unterschiede. Ende der 80er stattete der Europäische Rat von Brüssel den Strukturfonds mit 68 Mrd. € aus.[30]
Als nächste Etappe wird im Vertrag über die Europäische Union von 1992 der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt neben der Wirtschafts- und Währungsunion und dem Binnenmarkt als eines der Kernziele der Union verankert und der Kohäsionsfonds eingerichtet, der Umwelt- und Verkehrsprojekte in den weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten unterstützt.[31] In Art. 2 und 3 sind die Ziele formuliert. Der Stellenwert des Strukturfonds wird auch im 15. Protokoll über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zum Ausdruck gebracht. Neu hinzu kam außerdem der Ausschuss der Regionen (AdR), der eine Interessenvertretung der Regionen auf europäischer Ebene darstellt. Auf eine detaillierte Schilderung der Kompetenzen des AdR wird aufgrund der Irrelevanz für diese Arbeit verzichtet.
Auf dem Gipfel von Edinburgh im Dezember 1993 beschloss der Rat, für die Kohäsionspolitik knapp 177 Mrd. € bereitzustellen. Das macht rund ein Drittel des Gemeinschaftshaushalts aus. Besonders die Aspekte Umwelt und transeuropäische Netze sollten darin berücksichtigt werden. Neu hinzugekommen war das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF).
Im Zeitraum von 2000 bis 2006 flossen pro Jahr mehr als 30 Mrd. € in die Strukturinterventionen. Das neue strukturpolitische Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt (ISPA) und das neue Instrument für die Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes der Beitrittskandidaten (SAPARD) ergänzen das schon 1989 aufgelegte Programm PHARE. Ihr gemeinsames Ziel ist, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie den Umweltschutz in den Beitrittsländern in Mittel- und Osteuropa voranzubringen. Auf dem Gipfel von Lissabon im März 2000 beschloss der Rat schließlich einen neuen Schwerpunkt: eine auf Beschäftigungsfragen konzentrierte Strategie. Laut EU soll die Union dadurch bis zum Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt werden. Der Rat von Göteborg ergänzte diese Strategie um das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung. Im Februar 2004 stellte die Europäische Kommission dann ihre Vorschläge zur Reform der Kohäsionspolitik für den Zeitraum von 2007 bis 2013 mit dem Titel Eine neue Partnerschaft für die Kohäsion: Konvergenz – Wettbewerbsfähigkeit – Kooperation der Öffentlichkeit vor.
II.2.1.4. Effektivität und Legitimation
Bevor Zielgebiete und Finanzinstrumente beleuchtet werden, folgt ein Überblick über die Hintergründe der Regionalpolitik. Als Ursachen für eine Benachteiligung von Regionen werden oft eine unzureichende Infrastruktur, eine geringe berufliche Qualifikation der Einwohner, der Niedergang bestimmter Wirtschaftzweige (Bergbau, Schiffsbau und Textilindustrie) oder einen schwache Kapitalausstattung der Produktion genannt. Die Indikatoren führen aber je nach Stärke und Kombination zu sehr unterschiedlichen Symptomen. Carsten Rolle und Ulrich van Suntum haben beispielsweise nachgewiesen, dass besonders Langzeitarbeitslosigkeit weniger auf die Lage der Region als auf sektorale und institutionelle Faktoren zurückzuführen ist. Ein anderes Beispiel sind Wanderungsbewegungen. Sicherlich mögen Wohlstandsunterschiede eine Rolle spielen, aber wie steht es dann um den schwer definierbaren Begriff der Lebensqualität oder um den Arbeitsmarkt? Oft stehen hinter den Wanderungsbewegungen viel komplexere Zusammenhänge als der reine Wohlstand.[32]
Die Diskussion über Berechnungsmethoden und darüber, ob sich Regionen überhaupt mittels Kriterien wie das BIP vergleichen lassen[33], einmal außen vor gelassen, stellt sich die Frage, ob die immensen Unterschiede zwischen den Regionen dauerhafter Natur, möglicherweise historisch angelegt und schwer zu verringern sind, oder aber effektiv bekämpft werden können. Verschiedene Modelle sind zu diesem Zweck entworfen worden und nur ein paar Beispiele sollen an dieser Stelle herausgegriffen werden, um die Spannbreite zu illustrieren. Gemäß der lange geltenden neoklassischen Wachstumstheorie ging man davon aus, dass sich regionale Einkommensunterschiede im Laufe der Zeit von selbst regulieren würden. Hintergrund dieser Annahme ist die Abhängigkeit des Outputs pro Kopf von den Faktoren Arbeit und Kapital. Regionen mit niedrigen Löhnen würden demnach durch den Zufluss von Kapital und Abfluss von Arbeitskräften die höchsten Wachstumsraten aufweisen. Sind Arbeitskräfte Mangelware, stiegen wiederum die Löhne und Arbeitskräfte wanderten in die Region zurück. Demnach müssten sich Disparitäten von selbst angleichen. Die Polarisationstheorien wenden sich dagegen von den so genannten vollkommenen Märkten ab. Hier dominiert die Vorstellung, dass sich positive Effekte der Agglomerationen verfestigen können, wenn sie nur entsprechend unterstützt werden. Niedrige Transportkosten oder gut ausgebildetes Fachpersonal sind solche Faktoren.[34] Wo sich florierende Zentren befinden, hat meist historische Hintergründe. Man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an das Ruhrgebiet auf der einen und die neuen Bundesländer auf der anderen Seite. Die regionale Konzentration hat schon während der vorindustriellen Revolution begonnen und sich über die Jahrhunderte hinweg gehalten. Es bedarf einer enormen Kraftanstrengung, solche Strukturen zu verändern.
Betrachten wir die Einflussnahme auf die Wirtschaft, im Speziellen auf die kleinen und mittleren Unternehmen. Von den Befürwortern der Realtransfers wird ins Feld geführt, die KMUs seien inzwischen auf den Absatzmärkten in In- und Ausland mit anspruchsvollen Kunden konfrontiert und benötigten deshalb eine spezielle Unterstützung. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, dass sich die Ansprüche der Kunden immer im Laufe der Zeit geändert haben und hier Unternehmergeist und Flexibilität gefragt sind. Letztendlich sind die Unternehmer für sich selbst verantwortlich. Die Übernahme unternehmerischer Aufgaben birgt die Gefahr, dass das Bewusstsein für diese Eigenverantwortung verloren geht.
[...]
[1] Hier macht die EUREGIO widersprüchliche Angaben. Während die Geschäftsführung erklärte, dass in Einzelfällen die Nachhaltigkeit überprüft werde, sagte der dafür verantwortliche Mitarbeiter, dass generell keine Nachevaluation erfolgt. Aus dritter Quelle ließ sich dann vernehmen, dass in Einzelfällen und auch erst in INTERREG IIIA ein halbes oder ein ganzes Jahr später eine Evaluation erfolgt. Der Erfolg dieser Bemühungen sei aber stark von den Projektträgern und deren Bereitschaft einen solchen Bericht der EUREGIO zukommen zu lassen abhängig.
[2] vgl. Streinz, Rudolf, Europarecht, Heidelberg 62003, S. 68
[3] vgl. Rolle, Carsten, Europäische Regionalpolitik zwischen ökonomischer Rationalität und politischer Macht. Eine föderalismustheoretische und politökonomische Analyse, in: Werner Ernst/Werner Hoppe/Hans D. Jarass/Ulrich van Suntum (Hg,), Beiträge zur Raumplanung und zum Siedlungs- und Wohnungswesen, Bd. 194, Münster 2000, S. 7; Fürst, Dietrich/Paul Klemmer/Klaus Zimmermann, Regionale Wirtschaftspolitik, Tübingen 1976, S. 15 ff; Lauschmann, Elisabeth, Grundlagen einer Theorie der Regionalpolitik, Hannover 1976, S. 16-24
[4] vgl. Schindler, Christian Philipp, Die Regionalpolitik der Europäischen Union. Eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer allokationspolitischen Ausgestaltung und ihrer distributionspolitischen Zielsetzung, in: Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik, Bd. 128, Köln 2005, S. 135-136
[5] vgl. Döring, Daiva, Regionalismus in der Europäischen Union, Berlin 1999, S. 7
[6] vgl. Peter Alter, Regionalismus, Nationalismus und Föderalismus im westlichen Europa: Konflikte und Lösungsansätze, in: Boesler, Klaus-Achim/Günter Heinritz/Reinhard Wiessner (Hg.), Europa zwischen Integration und Regionalismus. (im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Geographie), Stuttgart 1998, S. 89
[7] vgl. Boesler, Klaus- Achim/Günter Heinritz/Reinhard Wiessner (Hg.), Europa zwischen Integration und Regionalismus. (im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Geographie), Stuttgart 1998, S. 9
[8] vgl. Raich, Silvia, Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit in einem „Europa der Regionen“, Dargestellt anhand der Fallbeispiele Großregion Saar-Lor-Lux, EUREGIO und „Vier Motoren für Europa“ – Ein Beitrag zum Europäischen Integrationsprozess, Baden- Baden 1995
[9] vgl. Hrbek, Rudolf/Weyand, Sabine, Betrifft: das Europa der Regionen: Fakten, Probleme, Perspektiven, München 1994
[10] vgl. Schulz (1993), S. 206
[11] vgl. Boesler (1998), S. 50
[12] vgl. Lang, Winfried, Regionen und Grenzen: Auf dem Weg nach Europa, in: Esterbauer, Fried/Peter Pernthaler (Hg.), Europäischer Regionalismus am Wendepunkt. Bilanz und Ausblick, Wien 1991, S. 145
[13] Schulz, Matthias, Regionalismus und die Gestaltung Europas. Die konstitutionelle Bedeutung der Region im europäischen Drama zwischen Integration und Desintegration, Hamburg 1993, S. 82
[14] vgl. Boesler (1998), S. 20 und S. 49
[15] vgl. Schulz (1993), S. 185
[16] Isensee, Josef, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, Berlin 1968, S. 9
[17] Hummer, Waldemar/Sebastian Bohr, Die Rolle der Regionen im Europa der Zukunft – Subsidiarität, Föderalismus, Regionalismus in vergleichender Betrachtung, in: Eisenmann, Peter/Bernd Rill (Hg.), Das Europa der Zukunft. Subsidiarität, Föderalismus, Regionalismus, Regensburg 1992, S. 68
[18] vgl. http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=43XEA0 (29.04.2006, 16.15 Uhr)
[19] vgl. Schulz (1993), S. 138
[20] vgl. http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=UDGM1N (29.04.2006, 16:20 Uhr)
[21] Rolle (2000), S. 27
[22] vgl. Schindler (2005), S. 7
[23] vgl. ebd., S. 37-38
[24] vgl. Anhang 1e
[25] vgl. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l60014.htm (09.04.2006, 13:01 Uhr)
[26] vgl. Rolle (2000), S. 6-7 und S. 27
[27] Eine Gesamtübersicht über den Haushalt der EU und die Ausgaben für den Strukturfonds geben die Anhänge 1a-d wieder.
[28] vgl. http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/g24203.htm (09.04.2006, 13.05 Uhr)
[29] vgl. Schindler (2005), S. 40
[30] vgl. Rolle (2000), S. 29-31
[31] Den Kohäsionsländern (Griechenland, Irland, Portugal) sollte ursprünglich die Einhaltung der Konvergenzkriterien und damit die Teilnahme an der Wirtschafts- und Währungsunion erleichtert werden. Mit der Teilnahme hätte die Förderung eigentlich eingestellt werden müssen.
[32] vgl. Rolle (2000), 50-52
[33] vgl. Schindler (2005), S. 138-141
[34] vgl. Rolle (2000). S. 20-22
- Arbeit zitieren
- Verena Müller (Autor:in), 2006, INTERREG - Eine Erfolgsbilanz am Beispiel der EUREGIO, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111224
Kostenlos Autor werden


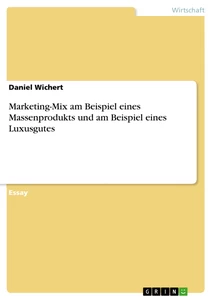


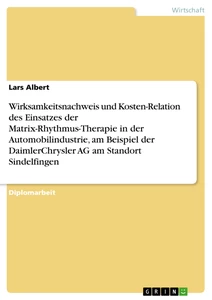




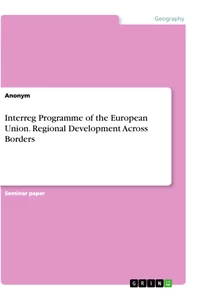


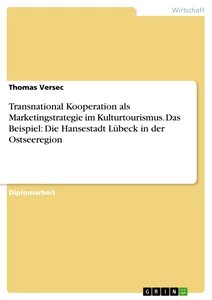





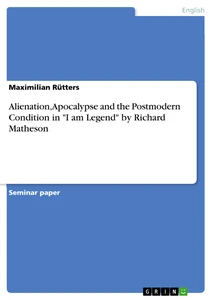


Kommentare