Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Von der Anstaltspsychiatrie zur Gemeindepsychiatrie
2.1 Entwicklung in der BRD: kurzer Überblick
2.2 Die Psychiatrie-Enquête und ihre Folgen
2.3 Gemeindepsychiatrische Versorgung
2.3.1 Konzept und Anfänge der Gemeindepsychiatrie
2.3.2 Gemeindenahe Psychiatrie heute
2.3.3 Positive und nachhaltig wirksame Veränderungen
2.3.4 Mögliche Ursachen für die unvollständige Umsetzung des Konzeptes Gemeindepsychiatrie
2.3.5 Ambulant Betreutes Wohnen
2.3.6 Gemeindepsychiatrische Zukunft
3 Integration und Inklusion
3.1 Begriffsbestimmung Integration
3.2 Inklusion/Exklusion: ein neuer Terminus?
3.3 Inklusion im Kontext der Gemeindepsychiatrie
3.4 Politische, rechtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen für Integration
3.4.1 Gesetzliche Rechtsansprüche für Menschen mit Behinderungen
3.4.2 Notwendige gesellschaftliche Veränderungen
3.4.3 Europäische Entwicklungslinien der Forderung nach Verhinderung von Ausgrenzung
4 Menschen mit psychischen Erkrankungen
4.1 Prävalenz psychischer Störungen
4.2 Chronisch psychische Erkrankung und psychische Behinderung
4.3 Lebenslage psychisch kranker Menschen in der Gemeinde
4.4 Phänomen Massenarbeitslosigkeit und ihr Einfluss auf die Situation von Menschen mit Behinderungen
4.4.1 Bedeutung von Arbeit für die Integration
5 Vorurteile und Stigmatisierung als Ursache sozialer Ausgrenzung sowie Entstigmatisierung durch Öffentlichkeitsarbeit
5.1 Einstellungen
5.1.1 Entstehung und Funktion
5.1.2 Die Rolle der Medien
5.2 Abweichendes Verhalten und Stigma
5.2.1 Was ist abweichendes Verhalten und wie erklärt es sich?
5.2.2 Psychische Erkrankung als Stigma
5.3 Einstellungs- und Verhaltensänderung
5.3.1 Information und Aufklärung als Möglichkeit der Einstellungsveränderung
5.3.2 Einstellungsänderung durch Soziale Kontakte
5.3.3 Handlungsstrategien
5.3.4 Kampagnen im Bereich Psychiatrie
5.3.4.1 Offizielle Antistigmakampagne
5.3.4.2 Anti-Stigma-Kampagne „von unten“
6 Sozialpädagogische Konzepte zur Verbesserung von Integration
6.1 Empowerment – ein integratives Handlungskonzept
6.1.1 Definition
6.1.2 Aktivierung sozialer Ressourcen im Empowermentprozess
6.1.3 Selbsthilfegruppen / Angehörigengruppen
6.2 Netzwerkorientierung und Netzwerkintervention
6.2.1 Soziale Netzwerke
6.2.2 Möglichkeiten der Netzwerkförderung
6.3 Gemeinwesenorientierung
6.3.1 Beschreibung, Theorien und Perspektiven der Gemeinwesenarbeit
6.3.2 Community Care und Community Living
6.3.3 Bürgerschaftliches Engagement in der Gemeindepsychiatrie
6.3.3.1 Begriff und Entwicklung der Bürgerhilfe
6.3.3.2 Organisationen in der Bürgerhilfe
6.3.3.3 Schwierigkeiten und Stellenwert der Bürgerhilfe in der Gemeindepsychiatrie
6.3.3.4 Arbeitsfelder, Umsetzung und Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements
6.4 Lebensweltorientierung in der gemeindepsychiatrischen Betreuung
6.4.1 Das Konzept der Lebensweltorientierung
6.4.2 Relevanz für die sozialpädagogische gemeindepsychiatrische Betreuung
6.5 Soziale Arbeit im Kontext gesellschaftspolitischen Wandels
6.5.1 Soziale Arbeit im Allgemeinen
6.5.2 Sozialpädagogische Psychiatrie: Das Spezifische der Sozialarbeit in der Gemeindepsychiatrie
7 Integrationsförderung in der gemeindepsychiatrischen Einrichtung Kieler Fenster
7.1 Arbeitskreis Integration
7.1.1 Ausgangssituation
7.1.2 Barrieren bei den Integrationsbemühungen
7.1.2.1 Gesellschaftliche Barrieren
7.1.2.2 Barrieren durch MitarbeiterInnen
7.1.2.3 Strukturelle Barrieren
7.1.2.4 Barrieren bei den NutzerInnen und Angehörigen
7.1.3 Integrationsfördernde Handlungsschritte
7.1.3.1 Abbau von Vorurteilen in der Gesellschaft/Öffentlichkeit
7.1.3.2 Vermittlung der Bedeutsamkeit der Integrationsförderung bei den MitarbeiterInnen
7.1.3.3 Strukturelle Verbesserungen
7.1.3.4 Ressourcenerhöhung bei den NutzerInnen
7.2 Darstellung der empirische Untersuchung
7.2.1 Methodisches Vorgehen, Ziel und Fragestellung der Untersuchung
7.2.2 Übersicht über die Interviewfragen
7.2.3 Durchführung der Interviews
7.2.4 Darstellung der Ergebnisse
7.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
7.2.6 Schlussfolgerungen für den Arbeitskreis Integration und Perspektiven für die sozialpädagogische Betreuungsarbeit in der Gemeindepsychiatrie
8 Zusammenfassung und Fazit
9 Allgemeine Daten
9.1 Geschlecht
9.2 Betreutes Wohnen seit
9.3 Betreuungsumfang/ Schlüssel
10 Wohnsituation
10.1 Wo?
10.2 Wohnen Sie alleine oder zu mehreren? Mit welchen Personen?
10.3 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation?
10.4 Gründe für die Zufrieden- bzw. Unzufriedenheit
10.5 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich einer möglichen positiven Veränderung?
10.6 Wäre mehr Unterstützung nötig um eine Veränderung zu erzielen?
11 Arbeitssituation
11.1 Befinden Sie sich im Moment in einem Arbeitsverhältnis/ Beschäftigungsverhältnis oder ähnlichem ?
11.2 Würden Sie gerne einer Beschäftigung nachgehen?
11.3 Wenn ja (bei 3.1.), um was für ein Beschäftigungsverhältnis handelt es sich?
11.4 Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Arbeitssituation?
11.5 Wie gut ist das Verhältnis zu den KollegInnen?
11.6 Treffen Sie sich mit Ihren KollegInnen außerhalb der Arbeitszeiten (Privat)?
11.7 Wie zufrieden sind mit den Kontakten zu Ihren KollegInnen?
11.8 Würden Sie gerne etwas ändern?
11.9 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich einer möglichen Veränderung/Verbesserung?
11.10 Wäre mehr Unterstützung nötig um eine Veränderung zu erzielen? Welche?
11.11 Welche Wünsche haben Sie bezüglich Ihrer Beschäftigungssituation?
12 Soziale Kontakte
12.1 Partnerschaft
12.2 Würden Sie gerne etwas ändern?
12.3 Familie
12.4 Ist diese Situation für Sie befriedigend? Würden Sie gerne etwas verändern?
12.5 Freunde mit Psychiatrieerfahrung/ Mitbetroffene
12.6 Ich hätte gerne mehr Freunde/ Bekannte mit Psychiatrieerfahrung
12.7 Freunde ohne Psychiatrieerfahrung
12.8 Ich hätte gerne mehr Freunde/ Bekannte ohne Psychiatrieerfahrung
12.9 Ich habe ausschließlich enge Kontakte zu anderen Mitbetroffenen
12.10 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich einer möglichen Veränderung/Verbesserung ?
12.11 Wäre mehr Unterstützung nötig um eine positive Veränderung zu erzielen? Welche?
12.12 Hat Ihr/e BetreuerIn Kontakt zu Ihrer Familie, Freunden Bekannten?
12.13 Wie zufrieden sind Sie insgesamt gesehen mit Ihren sozialen Kontakten?
13 Aktivität in der Gemeinde
13.1 Nachbarschaftlicher Kontakte
13.2 Haben Sie andere bedeutsame Kontakte in Ihrem näheren Wohnumfeld? (z.B. VerkäuferInnen, Hausmeister, andere Personen)
13.3 Besuch von öffentlichen sozialen Einrichtungen allgemein
13.4 Wenn ja, welche und wie beurteilen sie die Einrichtung?
13.5 Besuch von gemeindepsychiatrischen Einrichtungen und Gruppenangebote
13.6 Wenn ja, welche und wie beurteilen sie die Einrichtung?
13.7 Teilnahme an Selbsthilfegruppen
13.8 Würden Sie gerne etwas ändern?
13.9 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich einer möglichen Veränderung/Verbesserung ?
13.10 Hat Ihr/e BetreuerIn Kontakte zu Nachbarn, Einrichtungen, Selbsthilfegruppen usw. bzw. versucht sie solche aufzubauen oder zu pflegen?
13.11 Wäre mehr Unterstützung nötig um eine positive Veränderung zu erzielen? Welche?
14 Freizeit
14.1 Teilnahme bzw. Besuch von Vereinen, Sportstätten u.ä.
14.2 Teilnahme oder Besuch von kulturellen Einrichtungen
14.3 Besuch von Gaststätten, Kneipen, Cafes
14.4 Kirchliche, religiöse und spirituelle Einrichtungen
14.5 Teilnahme an Fortbildungen
14.6 Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen
14.7 Aktive Politische Partizipation
14.8 Ökologische Partizipation
14.9 Ehrenamt
14.10 Mit welchen Aktivitäten haben Sie positive Erfahrungen gemacht und warum?
14.11 Würden Sie gerne etwas verändern?
14.12 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich der Teilnahme an Freizeitaktivitäten?
14.13 Wäre mehr Unterstützung wünschenswert um eine positive Veränderung zu erzielen? Welche?
14.14 Welche Aktivitäten würde sie gerne mit Unterstützung ausprobieren?
15 Finanzielle Situation
15.1 Einkommen
15.2 Fühlen Sie sich durch die finanziellen Verhältnisse eingeschränkt?
16 Allgemein
16.1 Wie viel Zeit der Betreuung schätzen Sie umfasst das Besprechen und die Unterstützung Ihres Sozial- und Arbeitsleben (der obengenannten Punkte)?
16.2 In welchem Bereich ist Unterstützung ist für Sie im Moment am bedeutsamsten und welche Art von Unterstützung ist das??
16.3 Wie wichtig schätzen Sie ist Ihrer BetreuerIn das Betreuungsziel „Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ verglichen mit den anderen Zielen?
16.4 Halten Sie eine Begleitung zu verschiedenen Aktivitäten durch Ehrenamtliche oder PraktikantInnen für wünschenswert?
16.5 Wie gut fühlen Sie sich insgesamt gesehen in das Sozialleben integriert (Teilhabe am Leben in der Gesellschaft)?
16.6 Wenn Sie sich nicht gut integriert fühlen welche Gründe auf der persönlichen Seite hat es?
16.7 Gründe, die mit der Umwelt (Gesellschaft, Leute, Strukturen) zu tun haben
16.8 Was sind meine Wünsche und Vorschläge bezüglich Integration?
Literaturverzeichnis
Anhang: Interviewleitfaden
1 Einleitung
Ende der 1970er bis 1980er Jahre wurde die psychiatrische Versorgung in Deutschland reformiert. Psychiatrische Großkrankenhäuser wurden zum großen Teil aufgelöst und ihre PatientInnen in kleinere Wohneinrichtungen oder, wenn möglich nach Hause in eine eigene Wohnung entlassen. Psychisch kranke Menschen sollten nicht länger abgeschoben und ausgegrenzt unter menschenunwürdigen Bedingungen, sondern integriert in ihrer Gemeinde, im Rahmen gemeindepsychiatrischer Versorgungsstrukturen leben. Heutzutage leben die meisten Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen in eigenen Wohnungen oder in betreuten Wohngemeinschaften in ihrer Gemeinde und werden von gemeindepsychiatrischen Institutionen betreut und versorgt. Die Lebenslage chronisch psychisch kranker Menschen hat sich dadurch entscheidend verbessert. Dessen ungeachtet fühlen sich viele dieser Personen nicht integriert und aus wesentlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens exkludiert. Es ist auch die Rede von einem geschaffenen „ambulanten Ghetto“, in dem sich psychisch kranke Menschen befinden. Es kommt also nicht automatisch nur durch Enthospitalisierung und einer räumlichen Integration in der Gemeinde zu einer sozialen Integration, sowie es sozialpsychiatrische Theorien ursprünglich angenommen haben. Im Gegenteil, durch Schaffung immer neuer und speziellerer Institutionen für Menschen mit psychischen Erkrankungen wird zwar deren Isolation entgegengewirkt, gerade dies kann jedoch eine Integration in die „normale“ Gesellschaft auch verhindern. Es sind infolgedessen wesentliche Ziele der Psychiatriereform nicht erreicht worden. Die Gründe, warum diese angestrebte Integration nicht erfolgreich war, sind vielfältig und werden im Rahmen dieser Arbeit gesucht, diskutiert und erörtert.
Soziale Arbeit in der Gemeindepsychiatrie hat die Aufgabe - darauf begründet sich auch die Finanzierung - psychisch kranke Menschen bei einer Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen bzw. vor Ausgrenzungsprozessen zu bewahren. Doch selbst durch langjährige sozialpädagogische Betreuungsarbeit kann am gesellschaftlichen Ausschluss nicht viel gerüttelt werden, die Situation scheint verfestigt zu sein. Durch einen zunehmenden Ökonomisierungsdruck im Sozialbereich könnten sich diese Ausgrenzungsprozesse mit ihren nachteiligen und krankheitsverstärkenden Auswirkungen auf die Betroffenen noch vergrößern. Diese soziale Krise kann und sollte jedoch auch als Chance oder Anlass genommen werden die Methoden sowie das Profil sozialer Arbeit in der Gemeindepsychiatrie zu überdenken und zu überprüfen. Durch eine Umorientierung und Umstrukturierung unter Einbeziehung sowohl „alter“ im sozial- bzw. gemeindepsychiatrischen Konzept eigentlich vorgesehener Maßnahmen als auch einer Neuorientierung mittels Einsatz neuerer Erkenntnisse und Methoden kann dem sozialpädagogischen Auftrag der sozialen Integration von Menschen etwas näher gekommen werden.
Durch meine Tätigkeit in einer gemeindepsychiatrischen Einrichtung, dem Betreuten Einzelwohnen, hatte ich die Möglichkeit Theorie und Praxis zu verbinden und damit sowohl die praktischen Erkenntnisse theoretisch zu begründen als auch die theoretischen Erkenntnisse zu veranschaulichen und zu bestätigen.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Der erste umfangreichere Teil umfasst die Kapitel eins bis sechs, in welchem das weitreichende Thema Integration, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe von unterschiedlichen Seiten theoretisch beleuchtet wird. Teil zwei besteht aus dem Kapitel sieben der Arbeit und beinhaltet einen Praxisbezug zum behandelten Thema.
Das Konzept der Gemeindepsychiatrie mit seiner Entwicklung in der Vergangenheit sowie in der Zukunft wird im zweiten Kapitel thematisiert. Eingegangen wird hauptsächlich auf die gemeindepsychiatrische Institution des Betreuten Einzelwohnens, weil diese insbesondere von SozialpädagogInnen ausgeführte Betreuung im Fokus dieser Arbeit steht.
Die Begriffe Integration und Inklusion werden im Kapitel drei unterschieden. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel politische, rechtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen dargestellt, die eine gelungene Integration erst ermöglichen können.
Das vierte Kapitel beschreibt den Personenkreis der chronisch psychisch kranken Menschen, beinhaltet die Prävalenz psychischer Erkrankungen und unterschiedliche Beschreibungen von chronischen psychischen Erkrankungen, sowie die besondere Lebenslage von den meisten Menschen mit psychischen Erkrankungen. Eingegangen wird an dieser Stelle auch auf die Bedeutung von Berufstätigkeit für die soziale Integration und auf die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit.
Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen durch die Gesellschaft ist mit die Hauptursache von Ausgrenzungsprozessen. Wie Einstellungen, Vorurteile und Stigmata entstehen und welche Bedeutung sie haben und welche Möglichkeiten und insbesondere sozialpädagogische Methoden es theoretisch und konkret gibt diese positiv zu beeinflussen, wird im fünften Kapitel erörtert.
Kapitel sechs stellt zum einen vier sozialpädagogische Handlungskonzepte vor, die geeignet sind um die gesellschaftliche Teilhabe psychisch kranker Menschen zu unterstützen. Die Rede ist von Empowerment, Netzwerkorientierung, Gemeinwesenorientierung mit Bürgerschaftlichen Engagement und Lebensweltorientierung, Konzepte, bei denen die Integration von Menschen im Zentrum steht. Zum anderen werden an dieser Stelle die Rolle der Sozialen Arbeit allgemein sowie speziell in der gemeindepsychiatrischen Arbeit diskutiert.
Schließlich wird im Kapitel sieben das behandelte Thema aus der praktischen Arbeit heraus angegangen. Dargestellt werden zum einen die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe des Kieler Fensters zum Thema Integrationsförderung in einer gemeindepsychiatrischen Einrichtung und zum anderen die Ergebnisse einer durchgeführten empirischen Untersuchung mittels Interviews bei NutzerInnen des Betreuen Einzelwohnens in der o.g. Institution.
Eine Zusammenfassung sowie das Resümee beschließen im Kapitel acht die vorliegende Arbeit.
2 Von der Anstaltspsychiatrie zur Gemeindepsychiatrie
Im folgenden Kapitel wird zunächst die Entwicklung der psychiatrischen Versorgung in der Bundesrepublik beschrieben sowie auf die Psychiatrie-Enquête samt dem Konzept der daraus resultierenden gemeindepsychiatrischen Versorgung eingegangen. Welche Erfolge diese Versorgung brachte, aber auch welche Ziele nicht umgesetzt werden konnten und welche Veränderungen in der Zukunft nötig sind, wird im weiteren Verlauf des Kapitels besprochen. Auf die gemeindepsychiatrische Versorgung durch „Betreutes Wohnen“ wird in Punkt 2.3.5 eingegangen.
2.1 Entwicklung in der BRD: kurzer Überblick
Nach dem 2. Weltkrieg war die psychiatrische Versorgung in Deutschland erst einmal kein gesellschaftspolitisches Thema, es wurde weder von der Psychiatrie selbst noch von der Sozialpolitik aufgegriffen. Die Psychiatrie hielt sich wegen ihrer belasteten Rolle im Nationalsozialismus zurück, und die Sozialpolitik hatte andere Schwerpunkte. Die Versorgung in den bestehenden Großeinrichtungen blieb menschenunwürdig.
Ende der 1960er Jahre entwickelte sich die sozialpsychiatrische Bewegung in mehreren Ländern. Die Sozialpsychiatrie verfolgt das Ziel psychisch kranke Menschen in ihre soziale Realität zu integrieren, vor allem durch eine Eingliederung in das Arbeitsleben, deren Förderung vorrangig sein soll. In der Sozialpsychiatrie begründet ein psychosoziales Krankheitsmodell die Entstehung psychischer Erkrankungen. Gegenstand der Sozialpsychiatrie ist es, den Menschen in seinen umfassenden sozialen Bezügen zu sehen, die wiederum abhängig sind von gesellschaftlichen Wertvorstellungen, Verhaltensmustern und sozialen Bedingungen (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 906).
Nach Finzen (1998, zit. nach Obert 2001, S. 96) führte der Sozialmediziner Southard den Begriff Sozialpsychiatrie im Zusammenhang mit einem Ausbildungsprogramm für SozialarbeiterInnen 1918 in den USA ein.
Die sozialpsychiatrischen Grundsätze und Konzeptionen werden in dem Konzept der Gemeindepsychiatrie weitergeführt.
Die Betreuung und Behandlung psychisch kranker Menschen geriet zunehmend in die Kritik. 1970 fand in der Psychiatrischen Klinik der Universität Hamburg ein sozialpsychiatrischer Kongress, mit dem Leitthema Rückkehr der psychisch Kranken in die Gesellschaft statt. Hier wurden die Positionen der Sozial- bzw. der Gemeindepsychiatrie im Gegensatz zu der bis dahin rein medizinisch geprägten Psychiatrie bestimmt. Kritisiert wurden das medizinisch-biologische Menschenbild, das praktizierende disziplinierende Behandlungsprinzip (Sedierende Medikation, Zwangsmaßnahmen) und das völlig ausgegrenzte Leben in Anstalten mit den bekannten Effekten im Sinne einer „totalen Institution“, wie sie der Soziologe Goffman beschrieb (vgl. Mattner 2000, S. 82ff).
In den USA und auch in einigen europäischen Ländern verbreiteten sich, zum Teil schon etwas früher, vergleichbare sozialpsychiatrische Veränderungen. Die soziale Integration von psychisch Kranken war jedoch das Hauptanliegen aller Psychiatriebewegungen und auch Ziel der im folgenden Punkt dargestellten Psychiatrie-Enquête der Bundesrepublik Deutschland.
2.2 Die Psychiatrie-Enquête und ihre Folgen
Im Jahr1969 hat die damalige Bundesregierung auf Initiative von engagierten BürgerInnen, PolitikerInnen und Fachkräften aus der Psychiatrie, die sich zu dem Verein Aktion Psychisch Kranke e.V. zusammengeschlossen hatten, die Psychiatrie-Enquête in Auftrag gegeben.
1971 wurde eine Expertenkommission einberufen, welche die Aufgabe erhielt, die Lage der Psychiatrie in der BRD zu untersuchen. Bereits 1973 deutete ein Zwischenbericht auf die katastrophalen Zustände hin. Im Jahre 1975 lag der Abschlussbericht der Psychiatrie-Enquête vor, der auf die „katastrophalen menschenunwürdige“ Situation von psychisch kranken Menschen hinwies (vgl. Mattner 2000, S. 84) und u.a. folgende Interventionen forderte (vgl. Eikelmann 1998, S. 4-6):
eine Auflösung der psychiatrischen Großeinrichtungen (Entmuralisierung);
eine gemeindenahe und bedarfsgerechte Versorgung aller psychisch kranken und behinderten Menschen;
die Koordination der Versorgungsdienste;
die Gleichstellung von psychisch und somatisch Kranken.
Die Reform forderte die Errichtung gemeindepsychiatrischer Dienste und Versorgungsstrukturen, insbesondere betreute Wohnformen in „normalen“ gemeindenahen Wohnungen und Wohngebieten. Daraufhin fanden zahlreiche Aktivitäten und Versuche statt, um die Empfehlungen der Enquête zu verwirklichen; an vielen Orten wurden psychosoziale Arbeitsgemeinschaften und psychosoziale Hilfsvereine gegründet, die häufig auch als Träger von Einrichtungen fungierten. Ende der 1970er Jahre führten verschiedene Gegebenheiten zu einer qualitativ gesehen unbefriedigenden Situation: Die Entlassungen aus den Großkrankenhäusern waren oft unzureichend vorbereitet, das Problem der Arbeitslosigkeit wirkte sich besonders auf die berufliche Situation von psychisch kranken Menschen aus, und es entstanden zunehmend zersplitterte örtliche Initiativen, die nicht miteinander koordiniert waren.
Diese Missstände veranlassten die Bundesregierung, die außerklinischen Versorgungsnetze überprüfen und erproben zu lassen: 1979 wurde ein Modellprogramm (Modellprogramm Psychiatrie der Bundesregierung, Bundesminister für Jugend 1988) initiiert, das die psychiatrische Versorgung modernisieren sollte. Nach dem Vorbild der Community Psychiatry aus den USA und aus Großbritannien sollte ein gemeindenahes Versorgungsnetz mit Sozialpsychiatrischen Diensten, therapeutischen Wohngemeinschaften, Tagesstätten, Übergangseinrichtungen und speziellen Angeboten zur beruflichen Integration entstehen.
1988 lagen dann die Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung vor: gefordert wurde die Einrichtung von ausreichenden Angeboten zur Nachsorge, sowie zur sozialen und beruflichen Integration für psychisch kranke Menschen. Die Empfehlungen wurden in die Psychiatriepläne der Bundesländer aufgenommen (vgl. Bundesminister für Jugend 1988, S. 1-19).
Anfang der 1990er Jahre kam die sozialpsychiatrische Modernisierung trotz bestehender Mängel in den alten Bundesländern, weitestgehend zum Stillstand. Das Thema geriet aus dem gesellschaftspolitischen Blickfeld. Verbesserungen und Kritik waren nur noch psychiatrieintern aktuell.
„Die Psychiatrie ist – auf modernisierten Niveau – zur Normalität zurückgekehrt.“ (Kardorff 2005, S. 263)
In den neuen Bundesländern wurde zu diesem Zeitpunkt eine „kleine Psychiatrie-Enquête“ initiiert, zur Modernisierung der dortigen psychiatrischen Strukturen (vgl. Kardorff 2005, S. 264).
2.3 Gemeindepsychiatrische Versorgung
2.3.1 Konzept und Anfänge der Gemeindepsychiatrie
Die Gemeindepsychiatrie war eines der Grundprinzipien, die aus der Psychiatrie-Enquête hervorgegangen sind. Die Idee der Community Care beruht auf sozialepidemiologischen Studien, die ergaben, dass zwischen sozialen Lebenslagen und psychischen Leiden ein enger Zusammenhang besteht (vgl. Dörr 2005, S. 16 ff).
Die Gemeindepsychiatrie ist sozusagen das Zentrum sozialpsychiatrischer Praxis. Im Konzept der Gemeindepsychiatrie wird davon ausgegangen, dass psychisches Leid und Erkrankungen in der Gemeinde entstehen, und dass sie dort geheilt, gelindert und auch getragen werden müssen. Das psychische Leid darf durch Ausgliederung oder Institutionalisierung nicht verlagert oder verstärkt werden. In der Konsequenz bedeutet das für die BürgerInnen ein tiefgreifendes Umdenken. Jede Form der Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Leben steht im Widerspruch zur Grundhaltung der Gemeindepsychiatrie (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 378 ff.).
Die Integration in die Gemeinschaft der Normalbevölkerung war neben der Enthospitalisierung und der neuen Versorgungspraxis die neue Perspektive im Umgang mit psychisch kranken Menschen.
Gemeindepsychiatrie bedeutet idealtypisch eine psychiatrische Intervention im Lebenskontext, unter Berücksichtigung von sozialen Faktoren und unter Benutzung von sozialen Beziehungen, und mit der Perspektive der sozialen Eingliederung in das Alltagsleben einer Gemeinschaft. (zit. nach Friedrichs / Jagodzinsky 1999, in Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 666)
Dieses Konzept wendet sich ebenfalls gegen die Psychiatrisierung von Schwierigkeiten, die aus sozialen Gründen entstanden sind, wie z.B. Arbeits- oder Wohnungslosigkeit sowie gegen die wachsende Zahl von Sondereinrichtungen. Gemeindepsychiatrie befasst sich außerdem mit der Erhaltung und Förderung psychosozialer Gesundheit und verfolgt eine klare Ressourcenorientierung. Die gemeindepsychiatrischen Institutionen und Dienste sollten so minimal wie möglich intervenieren. Die Einbeziehung des familiären, beruflichen und sozialen Umfelds sowie die Ausnutzung der Hilfspotentiale in der Gemeinde sind fester Bestandteil des Konzepts.
Konkret bedeutet das:
Selbsthilfe vor Fremdhilfe,
Nachbarschaftshilfe vor professioneller Hilfe,
ambulant vor stationär,
ein normaler Arbeitsplatz vor einer Beschäftigungs- oder Trainingsmaßnahme,
Selbstständigkeit vor gesetzlicher Betreuung.
Gemeindepsychiatrische Versorgung besteht aus einem multiprofessionellen Team mit psychosozialen Berufsgruppen wie SozialpädagogInnen, PsychologInnen, ärztlichem und Pflegepersonal. Die gemeindepsychiatrischen Institutionen werden dezentral in der Gemeinde verteilt (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 378 und S. 907).
Wie sich die Gemeindepsychiatrie in den letzten ca. 25 Jahren entwickelt hat, wird im folgenden Punkt vorgestellt.
2.3.2 Gemeindenahe Psychiatrie heute
Es hat sich nach ca. 25 Jahren Gemeindepsychiatrie herausgestellt, dass eine Enthospitalisierung und das Wohnen in „normalen“ Wohnungen in der Gemeinde nicht automatisch zur sozialen Inklusion führt und, dass trotz Unterstützung durch sozialpsychiatrische Dienste wie z.B. dem Betreuten Einzelwohnen eine Inklusion nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme ist. Es ist also festzustellen, dass wesentliche Punkte aus der Konzeption der Gemeindepsychiatrie nicht umgesetzt werden konnten. Ein Forschungsbericht aus Großbritannien von 2004, der die sozialen Kontakte von Personen untersucht hat, die gemeindepsychiatrisch betreut werden, ergab, dass 40% ausschließlich Kontakte zu anderen NutzerInnen und BetreuerInnen hat, ein Viertel keine Aktivitäten in der Gemeinde unternehmen und sich 80% gleichzeitig isoliert fühlen (vgl. Eikelmann / Zacharias-Eikelmann / Richter / Reker 2005, S. 673).
Die Gemeinden wurden nach der Enquête auf die Gemeindepsychiatrie kaum vorbereitet und sie hat in der Folge Ablehnung bzw. kaum Akzeptanz in der Bevölkerung hervorgerufen. Der Kontakt mit psychisch Kranken war vorher kaum möglich, weil viele in Großeinrichtungen untergebracht waren. Im Vordergrund stand deshalb und steht auch heute noch, eine allgemeine Verunsicherung und bisweilen auch Angst oder Bedrohung in der Bevölkerung (vgl. Eikelmann 1998, S. 44, S. 69).
Mittlerweile scheint das Konzept der Gemeindepsychiatrie eher in eine wohnortnahe Behandlung und Betreuung überzugehen und müsste zutreffender als gemeindenahe Psychiatrie bezeichnet werden. (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 663).
Die Rede ist auch von der „Psychiatriegemeinde“: Durch die Einrichtung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitstätten für psychisch kranke Menschen, wird für die Betroffenen nur „ein Surrogat des normalen Lebens geschaffen“ anstatt einer tatsächlichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Unumstritten sind diese Einrichtungen für psychisch kranke Menschen wichtig, weil sie einen Schutzraum darstellen, der in der normalen Welt nicht gewährleistet ist, und zumindest Wege aus der Isolation bieten. Eine wirkliche Integration oder Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bedeuten sie definitiv nicht. Auch entsprechen sie nicht den Prinzipien des gemeindepsychiatrischen Konzepts (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 665-667).
In der Praxis ist auch der umgekehrte Fall zu beobachten, dass das Zusammensein mit einer großen Gruppe psychisch Kranker durch die Summierung der Probleme und Störungen der einzelnen Personen nicht als Schutz, sondern als Belastung empfunden wird.
Kardorff (2005, S. 264) verdeutlicht diese Situation:
...ein großer Teil der sogenannten neuen Chroniker befindet sich nach wie vor in Kreisläufen zwischen Klinikaufenthalt, therapeutischer Wohngemeinschaft, betreutem Einzelwohnen, Begleitung und Krisenintervention im Sozialpsychiatrischen Dienst, Tagesgestaltung in einer Tagestätte mit Zuverdienstmöglichkeit, einer Maßnahme der Berufsförderung und wieder der Klinik in einem von der übrigen Gesellschaft kaum bemerkten, weil in ihr selbst durch unsichtbare Grenzen markierten ambulanten Ghetto zirkuliert.
Nur wenigen psychisch kranken Menschen gelingt trotz intensiver medizinischer, beruflicher und sozialer Rehabilitation eine Integration in die Gesellschaft. Die individualisierte Gesellschaft reagiert nicht mit Solidarität und Menschenfreundlichkeit sowie es für eine gelungene Integration nötig wäre (vgl. Kardorff 2005, S. 262 ff.).
Trotzdem dürfen die Erfolge der Gemeindepsychiatrie auf keinen Fall übersehen werden.
2.3.3 Positive und nachhaltig wirksame Veränderungen
Kardorff (2005, S. 260 ff.) weist auf die erreichten Ziele in der Gemeindepsychiatrie hin.
Eine sehr positive Entwicklung haben die Selbsthilfeinitiativen und die psychiatrischen Organisationen zu verzeichnen. Eine aktive Interessenvertretung Psychiatrieerfahrener und Angehöriger wurde durch die Gründung des Bundesverbandes der Psychiatrieerfahrenen und des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker erreicht, die vor allem auf kommunaler Ebene ein Rolle spielt. Ebenso gibt es mittlerweile ein Vielzahl lokaler Initiativen und Verbände, Internetforen für die unterschiedlichsten psychiatrischen Krankheitsbilder und spezialisierte Netzwerke. Übersehen werden darf aber nicht, dass sich nur ein sehr kleiner Teil selbst aktiv einsetzt, während der größte Teil der psychisch Kranken sich nicht für die eigene Rechte einsetzten kann oder will. Die feste Einrichtung der Psychoseseminare ist an dieser Stelle ebenso zu nennen, wie die zunehmende Etablierung des Empowermentkonzeptes. Eine Abwendung von der Pathogenese zur Salutogenese sowie die Orientierung zu ressourcenorientierten Konzepten, wie dem Lebensweltkonzept bedeuten einen Paradigmenwechsel. Außerdem wurde eine Vielzahl von Modellprojekten zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung geschaffen.
Die Verbesserung der rechtlichen Situation zur Partizipation und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in den letzten Jahren darf hier ebenfalls nicht unerwähnt bleiben (vgl.3.4.1).
Nicht in Frage zu stellen sind außerdem die Erfolge, welche die Gemeindepsychiatrie durch die Enthospitalisierung erreicht hat, jedoch kann die ursprünglich angestrebte Integration mit den im Augenblick üblichen Methoden anscheinend nicht erreicht werden.
2.3.4 Mögliche Ursachen für die unvollständige Umsetzung des Konzeptes Gemeindepsychiatrie
Ein Grund dafür, dass wesentliche gemeindepsychiatrische Ziele nicht erreicht wurden, ist die mangelnde Einbindung der Gemeinde und Gesellschaft, was vielfältige Gründe hat und worauf an unterschiedlichen Stellen dieses Textes ausführlich eingegangen wird. Die psychisch Kranken werden an die Familien und an die psychiatrischen Einrichtungen verwiesen, die Gesellschaft, d.h. die einzelnen BürgerInnen, NachbarInnen, ArbeitgeberInnen fühlen sich nicht verantwortlich. Fraglich ist außerdem ob die gemeindepsychiatrischen Dienste sich überhaupt entbehrlich machen wollen und ob nicht die Geschäftsinteressen der eigenen Einrichtung bzw. die Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes im Vordergrund steht (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 667).
Zu klären ist weiterhin, ob die sozialpädagogischen Dienste zum einen tatsächlich die Integration zum Hauptziel haben, oder ob schwerpunktmäßig andere Ziele verfolgt werden und zum anderen, ob geeignete Methoden und Konzepte angewendet werden. Dies ist auch die Fragestellung im Kapitel sieben der vorliegenden Arbeit.
Die rein medizinischen Versorgung im stationären Sektor gewinnt wieder in zunehmenden Maße an Bedeutung, sodass Freiheit, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Förderung und Vernetzung von Selbsthilfeangeboten und sozialen Netzwerken nur eine randständige Bedeutung haben, und infolgedessen Integration auf der Strecke bleibt. Verschärft werden diese strukturellen Probleme durch den zunehmenden Kostendruck und die Ökonomisierung im Sozialsystem (vgl. Weise 2002, S. 30).
2.3.5 Ambulant Betreutes Wohnen
Die betroffenen KlientInnen, die in diesem Text hautsächlich angesprochen sind, werden durch das sog. „Betreute Einzelwohnen“, auch „Ambulant Betreutes Wohnen“ genannt, vorwiegend von SozialpädagogInnen begleitet und betreut.
Ambulante gemeindepsychiatrische Zentren sowie das ambulant betreute Wohnen sind heute wesentliche Bestandteile des gemeindepsychiatrischen Verbundes und werden auch als dessen Herzstück bezeichnet.
Die Rückkehr in die eigene Wohnung und das Wohnen, integriert in die Gemeinde unter Einsatz geeigneter Betreuungsmaßnahmen, war einer der zentralen Forderungen und Ziele der Psychiatrie-Enquête. Gemeint waren hier sowohl das Wohnen in betreuten Wohngemeinschaften, als auch das Betreute Einzelwohnen.
Die eigene Wohnung hat für den psychisch Kranken ... als Gestaltungsraum für beschütztes Wohnen, sei es als Alleinstehender, sei es in Gemeinschaft mit anderen, Vorrang. Die ambulanten Dienste müssen in den Stand gesetzt werden, den Betroffenen die notwendigen konkreten Hilfen bei der Bewältigung des Wohnalltags zu geben. Beschützte Wohnformen (Einzelwohnungen ...) sind so auszugestalten, daß den psychisch Kranken ... die Möglichkeit verbleibt, sich auch mit verminderten Kräften am Leben in der Gesellschaft zu beteiligen. (Bundesminister für Jugend 1988, S. 164)
Das Wohnen „mitten“ in der Gemeinde ist eine strukturelle Grundvoraussetzung für eine mögliche Integration und wird ebenfalls der Forderung von Normalisierung gerecht, wie sie Bengt Nirje (vgl. Antor / Bleidick 2001, S. 82) beschrieben hat. Das Wohnen in der eigenen Wohnung gehört zu den Grundbedürfnissen und zu den Grundrechten eines jeden Menschen.
Die strukturellen Voraussetzungen des Betreuten Einzelwohnens wurde vor allem auch in den letzten zehn Jahren enorm ausgeweitet, u.a. durch die Gesetzesvorlage „ambulant vor stationär“ und einem zunehmenden Ökonomisierungsdruck. Diese positive Entwicklung in der gemeindepsychiatrischen Versorgung führt aber nicht automatisch zu einer wirklichen Integration, immer häufiger ist die Rede vom ambulanten Ghetto. Viele psychisch kranke Menschen haben außer ihrem Betreuungskontakt kaum oder keinen Kontakt zu anderen Personen, nehmen selten am Gemeindeleben teil und fühlen sich nicht sozial integriert (siehe auch Kapitel sieben). An diesem Punkt besteht in der Betreuungsarbeit Reflektionsbedarf, inwiefern das Betreuungsziel Integration verbessert werden kann und welche Veränderungen evtl. erforderlich sind. In Kapitel sechs werden einige sozialpädagogische Konzeptionen erörtert, die dazu beitagen können dem Ziel Integration näher zu kommen. Die Finanzierung erfolgt einzelfallbezogen nach bestimmten Betreuungsschlüsseln, meist durch den zuständigen Sozialhilfeträger (vgl. 3.4.1). Der durchschnittliche direkte Kontakt mit den KlientInnen beträgt zwei mal wöchentlich eine Stunde Betreuungszeit, die nur im Ausnahmefall bei besonders schwerwiegenden Problemen auf drei Kontakte in der Woche ausgeweitet werden kann. Die meist von SozialpädagogInnen ausgeführte Betreuung beinhaltet in erster Linie den KlientInnen ein selbstbestimmtes eigenständiges Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen. Die Hilfe erstreckt sich auf die Lebensbereiche Wohnen, materielle Existenzsicherung, Unterstützung bei lebenspraktischen Problemen (Haushaltsplanung, Umgang mit Geld, Wohnraumgestaltung, Hygiene usw.), Hilfe bei Behördenkontakten, Unterstützung der beruflichen Entwicklung, Unterstützung bei der Krankheits- und Krisenbewältigung, Unterstützung bei der Tages- und Freizeitgestaltung sowie dem Aufbau von sozialen Kompetenzen und sozialen Kontakten. Um diese Aufgaben umzusetzen, müssen Netzwerke, Ehrenamtliche und das Gemeinwesen miteinbezogen werden.
„In und mit der Gemeinde zu arbeiten heißt nicht ausschließlich, einen einzelnen Menschen zu betreuen, sondern Einfluss zu nehmen auf das gesamte soziale Gefüge.“ (vgl. Schlichte 2006, S. 16)
Bereits von der Expertenkommission wurde darauf hingewiesen, dass der Erhalt und die Entwicklung der Selbsthilfekräfte im Gemeinwesen stärker berücksichtigt werden müssen:
Wo immer dies im Einzelfall möglich ist, sind Angehörige, Freunde, Kollegen, Nachbarn und Laienhelfer ... einzubeziehen. Insbesondere ambulante Dienste haben durch systematische Gemeinwesenarbeit die Aufgabe, die natürlichen Hilfspotentiale in der Region zu fördern. (Bundesminister für Jugend 1988, S. 338)
2.3.6 Gemeindepsychiatrische Zukunft
Durch sozialpsychiatrische Forschungen muss herausgefunden werden, wie durch sozialpsychiatrische Interventionen Inklusion in einzelne Teilsystemen funktionieren kann bzw. wie der drohenden Exklusion entgegenwirkt werden kann (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005).
Eikelmann / Reker / Richter (2005, S. 670) schlagen vor, dass mit der sozialen Exklusion psychisch Kranker ein neues Paradigma aus der Sozialforschung existiert, welches dazu beitragen könnte den Stillstand zu überwinden, indem systematische Untersuchungen über die Inklusion in soziale Aktivitäten und Teilsysteme im gesamtgesellschaftlichen Kontext veranlasst werden sollten.
Eine Verbesserung der gemeindepsychiatrischen Zukunft liegt auch in einer Rückbesinnung auf das ursprüngliche gemeindepsychiatrische Konzept, das bedeutet die konsequente Einbindung der Gemeinde und des Umfeldes selbst. Ebenfalls ist eine Hinterfragung und Verbesserung der angewandten sozialpädagogischen Methoden und Handlungskonzepte erforderlich, worauf in Kapitel sechs eingegangen wird.
Auch wenn an dieser Stelle hauptsächlich die Situation psychisch kranker Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung leben, thematisiert wird, darf nicht übersehen werden, dass immer noch ein beträchtlicher Anteil von chronisch psychisch Kranken in Heimen lebt, in denen sie von der Teilhabe in fast allen Bereichen ausgeschlossen sind und ihnen ein weitestgehend normales Leben vorenthalten wird. Handlungsbedarf besteht auch im Ausbau der gemeindepsychiatrischen Strukturen in den neuen Bundesländern und in ländlichen Gebieten (vgl. Kardorff 2005, S. 264).
Maximal-Ziel ist, dass auch noch der letzte psychisch kranke Mensch in einer eigenen Wohnung lebt und einen eigenen Arbeitsplatz hat. „Das ist erreichbar, und erst dann ist die Norm Gemeindepsychiatrie“ erfüllt (Dörner / Plog 1996, S. 436).
3 Integration und Inklusion
In diesem Kapitel wird zunächst eine Begriffserklärung von Integration und Inklusion vorgenommen; anschließend wird der Bezug von Integration und Gemeindepsychiatrie hergestellt. Die gesetzlichen, politischen und gesellschaftlichen Voraussetzung für Integration, auch auf europäischer Ebene sowie die zukünftige Aussichten der Integration von Menschen mit Behinderungen werden am Ende des Kapitels erläutert.
3.1 Begriffsbestimmung Integration
Der Begriff Integration umfasst unterschiedliche Inhalte, sodass es nicht eindeutig ist, was in der konkreten Verwendung gemeint ist.
Integration bedeutet direkt übersetzt „die Wiederherstellung eines größeren Ganzen“ und ist sowohl ein pädagogischer als auch ein psychologischer und soziologischer Begriff.
Integration wird dabei in der Regel als Anpassung an das Normengefüge und den Lebensstil einer Gesellschaft verstanden, wobei abweichende Verhaltensweisen und Orientierungen zugunsten einer Assimilation nach und nach aufgegeben werden sollten (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 489).
Für die gemeindepsychiatrische Arbeit ist jedoch eine solche direkte Bedeutung von Integration nicht umzusetzen und auch nicht anzustreben. Deshalb werden weitere Interpretationen des Integrationsbegriffes als für die Arbeit mit psychisch kranken Menschen anwendbare Begriffe vorgestellt:
Für Bach (1989, zit. nach Cloerkes / Markowetz 1997, S. 191) bedeutet Integration die normale Beachtung der behinderten Menschen, intensive persönliche Kontakte, gemeinsame Tätigkeiten und die gegenseitige Respektierung.
Cloerkes / Markowetz (1997, S. 191) stellt weitere Definitionen des Integrationsbegriffes zusammen, die in der Pädagogik üblich sind:
Kobi (1990): Integration ist als solidarische Kultur des Miteinanders aller aufzufassen.
Eberwein (1990): Integration ist keine Methode, sondern eine Lebens- und Daseinsform, für oder gegen die sich eine Gesellschaft entscheiden kann.
Bleidick (1988): „Integration ist als Schlagwort eine unnötige Worthülse.“
Reiser (1991): Integration ist als Ziel nicht unmittelbar herzustellen. Integrative Prozesse sind der Weg, den Individuen und Gruppen selbst gehen müssen.
Ein weitere soziologische Interpretation besagt, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen Zutritts- und Teilhaberechte haben wie nichtbehinderte Menschen (vgl. Cloerkes / Markowetz 1997, S. 192) und schließlich:
Soziale Integration bezieht sich auf das Vorhandensein und das Ausmaß von Sozialkontakten und umfasst Merkmale wie die Struktur, Größe, Dichte und Homogenität eines sozialen Netzwerkes. (Schwarzer & Leppin 1989, zit. nach Lenz 2002, S. 27)
Aus diesen Gegenüberstellungen unterschiedlicher Definitionen und Aspekten wird deutlich, dass zu einer erfolgreichen Integration immer auch ein Beitrag der Gesellschaft erforderlich ist. Die Integration von Menschen mit Behinderungen darf nicht nur als Assimilation verstanden werden, sozusagen als Normalisierung der Ausgegrenzten. Integration bedeutet Offenheit für das jeweilige Andere und ein Aufeinanderzugehen, das insbesondere von der Gesellschaft ausgeht.
Indem Behinderte in die Gesellschaft wiedereingegliedert werden, wird der Gesellschaft das Leid wieder zurückgegeben, dessen sie sich entledigen wollte, indem sie es aussperrte. Im Umgang mit den Leidenden soll sie selber rücksichtsvoller und toleranter werden gegenüber der menschlichen Natur allgemein. Es bedeutet, der verhängnisvollen Gewohnheit, nach der Menschen benutzt und in Abseits gebracht werden, wenn sie nicht mehr benutzt werden können, entgegenzuwirken. (Mattner 2000, S. 86)
Schuchardt (1982, S. 17) stellt die These auf, dass „der Behinderte die Gesellschaft braucht und die Gesellschaft den Behinderten braucht“. Eine einseitige Abhängigkeit des behinderten Menschen weist auf eine Assimilation hin und nicht auf eine gegenseitige Annäherung. Schuchardts Begründung lautet folgendermaßen:
Die Gesellschaft braucht den Behinderten. Der auf Leistung, Standard, Fortschritt programmierte Nichtbehinderte, der sich selbst in blindem Fortschrittsglauben der gesellschaftlichen wie weltgesellschaftlichen Aufgabe der Umstrukturierung entzieht - sich also gleichermaßen desintegriert - braucht die Herausforderung des Behinderten, der demonstriert, was es heißt, ganz aus sich selbst zu leben, der die Maßstäbe inhumaner Lebensstandards auf Lebensqualität befragt. (Schuchardt 1982, S. 17)
In Anbetracht der gegenwärtigen ausschließlichen Diskussion um verursachte Kosten durch Krankheit und Behinderung im Sozial- und Gesundheitswesen ist diese positive und ressourcenorientierte Sichtweise bemerkenswert.
Vorhandene Strukturproblemen in der Bundesrepublik führen zu einer vermehrten Desintegration von allen potentiellen Randgruppen. Leistungsdruck und Massenarbeitslosigkeit verbunden mit wirtschaftlicher Unsicherheit vermindert die Toleranz und Integrationsbereitschaft der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der starke soziale Spannungen vorliegen, so wie es in zunehmenden Maße zu beobachten ist, ist prinzipiell weniger integrationsfreundlich. Eine egalitäre und sozial befriedete Gesellschaft ist eher auf Integration bedacht (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 487 ff.).
Bosshard / Ebert / Lazarus (2001, S. 83) unterscheiden darüber hinaus funktionale und soziale Integration. Funktionale Integration verweist auf potentiell nutzbare vorhandene Einrichtungen im Stadtteil. Mit sozialer Integration ist die Zugehörigkeit und soziale Identität innerhalb einer Gemeinschaft gemeint, in diesem Sinne wird der Begriff auch im vorliegenden Text gebraucht.
Der Begriff Integration scheint sich umgangssprachlich zu wandeln. Er meint zunehmend nicht mehr unterwerfende Anpassung, sondern eher einen dialogischen Weg wechselseitiger Durchdringung im Sinne von Inklusion. Die relativ neue Unterscheidung von Integration und Inklusion macht deutlich, dass die unterschiedliche Interpretation des Integrationsbegriffes eine Präzisierung erforderlich machte. In der Literatur ist jedoch festzustellen, dass häufig auch eine beliebige Formulierung vorgenommen wird und die Begriffe synonym gebraucht werden.
Im vorliegenden Text ist der Begriff Integration nie im engeren Sinn gemeint, sondern immer im Sinne von Inklusion, d.h. dass die beiden Begriffe mehr oder weniger auch synonym verwendet werden.
Im folgenden Abschnitt wird der Inklusionsbegriff näher erläutert.
3.2 Inklusion/Exklusion: ein neuer Terminus?
Zunehmend werden Integrationsansätze heute mit dem Ansatz der Inklusion dargestellt, weil sie von Vornherein die Orientierung an einer humanen und demokratischen Gesellschaftsform fordern. Historisch betrachtet geht die Entwicklung demnach von der Segregation Ausgesonderter über die Integration im Sinne von Wiedereingliederung hin zur Inklusion mit dem darin eingeschlossenen gesellschaftlichem Prozess der Veränderung von strukturellen Bedingungen (vgl. Stein 2005, S. 309).
Der Inklusionsbegriff ist aus der Kritik des Integrationsgedanken und des Integrationsbegriffes hervorgegangen. Schließlich ist Integration streng genommen im Sinne einer Assimilation nur unter bestimmten individuellen Vorraussetzungen und einem gewissen Maß an Selbstständigkeit überhaupt möglich.
Inklusion ist ein Ansatz, der von Lebenswelten oder auch Teilsystemen ausgeht (Familie, Stadtbezirk, Wohnsiedlung, Arbeitsstätte), in denen alle Menschen, mit oder ohne Behinderung, willkommen sind und die so ausgestattet sein sollten, dass sich jeder darin mit und ohne Unterstützung zurechtfinden, kommunizieren und interagieren, kurzum sich wohlfühlen kann. Inklusion bedeutet in diesem Zusammenhang uneingeschränkte Zugehörigkeit und ist quasi das Fundament für Partizipation. (Theunissen 2002, S. 365)
Ursprünglich hat N. Luhmann (1997) die aus dem Englischen entlehnten Begriffe von Exklusion und Inklusion eingeführt. Unter sozialer Exklusion wird der Ausschluss aus wesentlichen sozialen Teilsystemen wie dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt, der Religion, dem Bildungssystem oder aus der familiären Einbindung verstanden. Inklusion bedeutet dementsprechend die Teilnahme an einem Teilsystem (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005,S. 667-668).
So bedeutet Exklusion keine generelle soziale Ausgrenzung, sondern lediglich, dass ein Mensch nur in einer bestimmten Rolle in ein bestimmtes Teilssystem eingeschlossen bzw. von ihm ausgeschlossen ist. Jedoch hat die Exklusion aus einem bedeutenden Teilsystem, vor allem dem Arbeitsmarkt, häufig Exklusionstendenzen aus anderen Teilsystemen zur Folge. Eine Verschärfung dieser Exklusionstendenzen kann zur Inklusion in das System der Sozialen Arbeit führen, d.h. wenn ein Mensch verstärkt ausgegrenzt wird, benötigt er irgendwann soziale Unterstützung, die eine weitere Inklusion wieder ermöglicht. Gravierende und anhaltende Exklusion kann zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen führen (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 664 ff.).
Inklusion bedeutet auch, dass sich nicht die abweichende Person verändern muss, sondern dass sich der einzelne, die Gesellschaft und die Institution darauf einstellt, d.h. eine Veränderung der Strukturen und Auffassungen erfolgen muss, in der Unterschiedlichkeit von Menschen normal ist. Das bedeutet, dass Inklusion weniger defizitorientiert ist als Integration im eigentlichen Sinn. Nicht der behinderte Mensch verhält sich abweichend und muss sich verändern (vgl. Schablon 2003).
Der Inklusionsbegriff thematisiert die Teilhabe an der komplexen und differenzierten Gesellschaft. Es geht um ein Hereinkommen in die Leistungszusammenhänge der modernen Gesellschaft. Während im Wort Integration eher ein ‘die Mehrheit integriert unter bestimmten Umständen eine besondere Minderheit’ steckt, lässt Inklusion die Verschiedenheit im Gemeinsamen bestehen oder es kommt zu Exklusion, zum Ausschluss aus dem entsprechenden System. (Schablon 2001, S. 2)
Die sozialpädagogischen Methoden um Inklusion umzusetzen sind Aufgabe von Gemeinwesenarbeit, Netzwerkarbeit, Community Care und anderen auch sozialraumorientierten Inklusionskonzepten. Voraussetzung für Inklusion sind zunächst gesellschafts- und sozialpolitische Analysen des Prozesses von Ausschließung und die Herstellung von konkreten Rahmenbedingungen, die Inklusion ermöglichen können, mit dem Ziel eine inkludierende Gesellschaft zu werden. Dies ist jedoch davon abhängig, ob die Mitglieder einer Gesellschaft jeden Menschen unabhängig von Beeinträchtigungen als gleichberechtigt anerkennen und die für eine gesellschaftliche Teilhabe erforderlichen Lebensbedingungen sicherstellen. Eine Reduktion des Menschen auf die Leistungsfähigkeit, so wie es z.Zt. vorherrschender Tenor ist, kann den Anspruch einer inkludierenden Gesellschaft nicht erfüllen (vgl. Stein 2005, S. 317).
Die soziale Exklusion psychisch kranker Menschen ist als neues Konzept zur Erfassung und Beschreibung deren Situation zu betrachten, das über den herkömmlichen sozialpsychiatrischen Ansatz hinaus den Fokus auf die tatsächliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gerichtet hat (vgl. Eikelmann / Zacharias-Eikelmann / Richter / Reker 2005, S. 930).
3.3 Inklusion im Kontext der Gemeindepsychiatrie
Integration besagt oft nur eine räumliche Integration in einen Stadtteil anstatt einer tatsächlichen Inklusion innerhalb einer Gemeinde im Sinne persönlicher Kontakte. Dies ist auch das gängige Muster in der Gemeindepsychiatrie, in der eine räumliche Integration geglückt ist, aber trotzdem kein bzw. kaum Kontakt mit der Außenwelt besteht.
Mehrere Untersuchungen ergaben, dass viele psychisch kranke Menschen unter sich bleiben. „Zusammen mit den Professionellen bilden sie eine geschlossenen Zirkel, und der Kontakt mit der Normalbevölkerung existiert so gut wie gar nicht“. (Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 668)
Die professionelle Betreuung in der Gemeindepsychiatrie ist kein Ersatz für soziale Kontakte. Das Leben im gewohnten alltäglichen Umfeld wird nur positiv und erträglich, wenn eine Inklusion in das Wohnumfeld erfolgt. Das würde aber bedeuten, dass es Aufgabe des sozialen Umfeldes, d.h. der Nachbarn, Familienangehörigen, FreundInnen und Bekannten und anderer ist, Inklusion zu ermöglichen und dadurch dem ambulanten Ghetto, also einer ausschließlichen Inklusion des Betroffenen in die gemeindepsychiatrische Szene, vorzubeugen. Oft besteht die Vorstellung psychisch kranke Menschen können und dürfen ausschließlich von Professionellen betreut werden. Dies könnte ein Grund für die Zurückhaltung gegenüber den Betroffenen sein. Arbeitsschwerpunkt in der sozialpädagogischen Arbeit mit psychisch kranken Menschen muss also das soziale Umfeld sein, in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Entlastung von Kontaktpersonen (vgl. Seibert 2002, S. 175 ff.).
Grundsätzlich ist dem Besuch einer nichtpsychiatrische Einrichtung oder Veranstaltung, aus Integrationsgründen immer der Vorzug gegenüber einer gemeindepsychiatrischen Institution zu geben. Nur wenn dies aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, ist die Inklusion in eine gemeindepsychiatrische Institution wie eine Gruppe oder ein Treffpunkt der Isolation vorzuziehen. Die Subkultur einer gemeindepsychiatrischen Einrichtung bietet zum einen die Möglichkeit in einem geschützten Rahmen aktiv zu werden und andere Menschen kennen zu lernen, mit denen man gemeinsam Ziele verfolgt. Dies bedeutet eine Grundlage für gemeinsame Empowermentstrategien. Trotzdem muss vor Rückschritten der Ausgrenzung gewarnt werden und alle BetreuerInnen müssen sich immer wieder fragen:
Wie viel (Sozial-)Psychiatrie benötigt jemand tatsächlich? Fördert die vereinfachte Erreichbarkeit und Inanspruchnahme professioneller Hilfen Selbstverantwortung und Selbstbestimmung oder verlängert sie die Abhängigkeit? Vermindern diese „geschützten Inseln“ das Selbstvertrauen, das notwendig ist um im Kontakt zur ‘ungeschützten Normalität’ zu bleiben? (Schlichte 2006, S. 78)
Zum anderen birgt eine gut ausgebaute gemeindepsychiatrische „Szene“ immer auch sowohl für Betroffene als auch für Professionelle die Gefahr, allzu leicht vorwiegend diese Einrichtungen in Anspruch zu nehmen oder zu vermitteln.
3.4 Politische, rechtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen für Integration
Im folgenden Gliederungspunkt werden die rechtlichen Voraussetzungen aufgezeigt, die es Menschen mit Behinderungen ermöglich sollen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und ohne Diskriminierungen zu leben. Darauf folgend werden die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen erörtert, die eine tatsächliche Integration erst ermöglichen. Die Forderungen der Europäischen Union zur Verhinderung von fortschreitenden Ausgrenzungsprozessen schließt diesen Gliederungspunkt ab.
3.4.1 Gesetzliche Rechtsansprüche für Menschen mit Behinderungen
Vorausgegangen sind den deutschen Gesetzesänderungen internationale Antidiskriminierungsbeschlüsse, die weltweit einen Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik „vom Fürsorgeempfänger zum Menschenrechtssubjekt“ ausgelöst haben. Nennenswert sind an dieser Stelle die Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen (UNO) zur Herstellung von Chancengleichheit für behinderte Menschen im Jahr 1993 und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Art. 21 Diskriminierungsverbot und Art. 26 Förderung der Integration) aus dem Jahr 2000 (vgl. Mühlum / Gödecker-Geenen 2003, S. 58)
Die Rechtsgrundlage für eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen innerhalb der Gesellschaft ist in verschiedenen Gesetzen vorgegeben. Zunächst heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland seit 1994 (1990 angekündigt, siehe oben): „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Gesetze für Sozialwesen 2004, Art.3 AbS. 3 Satz 2 GG) Die Verankerung des Benachteiligungsverbot im Grundgesetz hatte einen gesellschafts- und sozialpolitischen Perspektivenwechsel zur Folge. Die Teilhabe behinderter Menschen sollte nicht Ausdruck von wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge sein, sondern in erster Linie Ausdruck von Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Der Deutsche Bundestag befindet sechs Jahre nach Einführung des Gesetzes einstimmig, dass die Umsetzung des Benachteiligungsverbot eine „dringliche politische und gesetzgeberische Aufgabe sei, im Mittelpunkt ... stehen nicht mehr die Fürsorge und Versorgung von behinderten Menschen, sondern ihre selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Beseitigung der Hindernisse, die ihrer Chancengleichheit entgegenstehen“ (Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte 2003, S. 63).
In den letzen fünf Jahren sind für Menschen mit Behinderungen zwei weitere wesentliche Gesetze verabschiedet worden. In Anlehnung an das Partizipationsmodell der WHO, nämlich den Anspruch behinderter Menschen auf Unterstützung und Solidarität als Teil universeller Bürgerrechte, wurde das Sozialgesetzbuch (SGB) IX konzipiert. Die Förderung der Teilhabe behinderter und von Behinderungen bedrohter Menschen am gesellschaftlichen Leben durch medizinische, berufliche und soziale Unterstützung ist die Zielsetzung des 2001 in Kraft getretenen Gesetzes.
Mit dem SGB IX wurde auf vier Entwicklungen reagiert (vgl. Kardorff 2005, S. 260):
Sozialstaatliche Geld- und Sachleistungen allein reichen nicht aus um Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern; die Forderung des Bürgerrechts auf Selbstbestimmung für alle Menschen; eine individuelle Förderung von Selbsthilfe und Selbstständigkeit mittels neuer Konzepte wie Empowerment und personenzentrierter Hilfen ist erfolgreich;
zusammen mit dem Gleichstellungsgesetz und mit dem geplanten Anti-Diskriminierungsgesetz wird ein Abbau von Barrieren sowohl materiell als auch gesellschaftlich angestrebt;
Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) folgte im Jahr 2002. Ziel des BGG ist „...die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten...“ (BGG §1). Behinderte Menschen sollen sich möglichst diskriminierungsfrei im Alltag bewegen können. Eine zivilrechtliche Gleichstellung ist jedoch noch nicht gegeben, wobei erst diese eine Einklagbarkeit gegen Verstöße im Einzelfall ermöglichen würde (vgl. Mühlum / Gödecker-Geenen 2003, S. 62 ff.).
Neben der medizinischen und beruflichen Rehabilitation existiert der Leistungskomplex der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der nicht nur andere Maßnahmen ergänzt, sondern auch eigenständig wirksam ist, jedoch nur wenn medizinische und berufliche Maßnahmen nicht möglich oder nicht ausreichend sind. Diese Eigenständigkeit ist in dieser Form im SGB IX neu.
Der Leistungskomplex Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft umfasst weitestgehend sozialpädagogische Leistungen. Gemeint ist eine ganzheitliche Förderung und Ermöglichung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und der Selbstbestimmung, sowie Benachteiligungen zu vermeiden und ihr entgegen zu wirken. Konkret geht es um Hilfen zum Erwerb von erforderlichen und geeigneten praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten, um Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und um allgemeine Hilfen im gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Hinzu kommen Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit Nichtbehinderten, sowie Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.
Der Leistungskomplex Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, d.h. die rein sozialpädagogischen Leistungen werden nur über die Träger der Sozialhilfe finanziert. Hier wäre eine zumindest anteilige Leistung der Krankenkassen erforderlich und ließe sich auch ausreichend begründen. Wenn jedoch ein medizinischer Leistungsanteil nicht als solcher isoliert werden kann, kommt eine Leistungspflicht der Krankenkassen rein gesetzlich nicht in Betracht und macht die HilfeempfängerInnen entweder zu SozialleistungsempfängerInnen oder zu SelbstzahlerInnen, was bei längerer Inanspruchnahme zu großen finanziellen Einbußen und zu Armut führen kann. Insgesamt 90% dieser Leistungen werden sozialhilfefinanziert. Dies bedeutet eine Schlechterstellung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil sie vermehrt auf soziale Rehabilitation angewiesen sind. Grund dafür ist auch hier eine rein medizinische Sichtweise der Krankheitsentstehung und Therapie (vgl. Mrozynsky 2002,S. 148 ff.).
Die notwendigen Rechtsgrundlagen zur Ermöglichung von Teilhabe sind demzufolge im Wesentlichen in den deutschen Gesetzen verankert, lediglich ein zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz steht noch aus.
3.4.2 Notwendige gesellschaftliche Veränderungen
Mühlum / Gödecker-Geenen (2003, S. 64) sehen die Ausgestaltung der Sozialrechte und speziell der Antidiskriminierung als „Einstellungswandel von historischer Bedeutung“.
Die gesetzlichen Grundlagen allein reichen jedoch nicht aus, um die Ansprüche auch umsetzen zu können. Integration ist ein wechselseitiger Prozess, an dem sich auch Menschen ohne Behinderung beteiligen müssen.
Hierzu meint Waller (2003, S. 207):
Das ist nur in einer Umwelt möglich, die sich solch einer Teilhabe öffnet; das Verbot der Benachteiligung behinderter Menschen ist daher nicht als Umgang mit individuellen Problemen Betroffener, sondern als Frage an das Selbstverständnis einer ganzen Gesellschaft zu begreifen.
Fraglich ist, ob es genügt wenn sich eine Gesellschaft nur „öffnet“ oder inwieweit sie sich in der Pflicht sieht mit ihren Möglichkeiten Hilfen anzubieten, die behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen (vgl. Waller 2003, S. 207).
Die sogenannten „gesellschaftlichen relevanten Kräfte“, wie Kirchen und Verbände, Gewerkschaften und Unternehmen, Parteien, Medien usw. bekennen sich zum Recht der vollständigen Teilhabe behinderter Menschen am sozialen Leben. Umso verwunderlicher ist es, dass die Umsetzung der Rechte so große Probleme bereitet und sich viele behinderte Menschen von einer Teilhabe ausgeschlossen oder zumindest in der Teilhabe eingeschränkt fühlen. Dass eine Umsetzung gelingen kann und behinderte Menschen am sozialen Leben teilhaben können und so normal wie möglich leben können, dafür muss die Gesellschaft sich insgesamt verantwortlich fühlen, letztlich jeder einzelne Mensch. Der Staat kann und muss als Steuerungsorgan und durch Steuerfinanzierung Wiedereingliederungsprozesse unterstützen und fördern, z.B. durch die Unterstützung von Sozialer Arbeit. Einer gelingende Teilhabe kann jedoch nur die Gesellschaft selbst durch Menschlichkeit und Solidarität erfüllen. Hier ist die Idee einer Zivilgesellschaft gefragt, um zu einer Humanisierung des Zusammenlebens beizutragen, in der sich alle Menschen für das Soziale in einer Gesellschaft verantwortlich fühlen (vgl. Mühlum / Gödecker-Geenen 2003, S. 59-62).
Darüber hinaus besteht jedoch zur Zeit eine ernsthafte Gefahr, dass die rechtlichen und politischen Erfolge der letzten Jahre für die Menschen mit Behinderungen durch den parallelen Abbau von Sozialleistungen insbesondere der Gesundheitsversorgung, Arbeitsförderungen und Sozialhilfe unterlaufen werden (vgl. Kardorff 2005).
3.4.3 Europäische Entwicklungslinien der Forderung nach Verhinderung von Ausgrenzung
Die EU Kommission fordert in verschiedenen Berichten Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung in den Mitgliedstaaten.
... in Anbetracht dieser Überzeugungen sind die Einschränkungen mit denen behinderte Menschen konfrontiert sind, nicht länger an ihre Behinderung an sich gekoppelt, sondern der Unfähigkeit der Gesellschaft, ihren Bürgern Chancengleichheit zu ermöglichen ...(EU-Arbeitspapier 2000, S. 7 zit. nach Stein 2005 S. 312).
In den Mitteilungen der EU-Kommission Auf dem Weg zu einem Europa ohne Hindernisse für Menschen mit Behinderungen im Jahr 2000 werden in Bezug auf Integration und Inklusion die insgesamt 37 Millionen Menschen mit Behinderungen in Europa als die am stärksten benachteiligte Gruppe der Gesellschaft angesehen, die mit erheblichen Barrieren konfrontiert sind, die es ihnen nicht möglich macht sich an wesentlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu beteiligen. Die Barrieren sind aber weniger störungs- oder behinderungsbedingt, also persönlich bedingt, sondern es sind Umweltbarrieren. Es wird eine neue Behindertenpolitik gefordert, in denen verlangt wird in allen Lebensbereichen die Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen (vgl. Stein 2005, S. 312 ff.).
...die soziale Ausgrenzung ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Volkswirtschaften und Gesellschaften ... Dabei besteht die Herausforderung nicht nur darin, den Ausgegrenzten (oder von Ausgrenzung Bedrohten) bessere Unterstützungsleistung zu gewähren, sondern auch aktiv gegen strukturelle Hindernisse vorzugehen, die der sozialen Eingliederung entgegenstehen, um so das Auftreten sozialer Ausgrenzung einzudämmen. (EU-Kommission 2000, S. 4 zit. nach Stein 2005, S. 312)
An dieser Stelle muss sich die Soziale Arbeit, insbesondere in der Arbeit mit behinderten Menschen in der Bundesrepublik auch angesprochen fühlen, um gemeinsam mit Politik, Recht und Gesellschaft Integrationsforderungen und -bestrebungen zu unterstützen und umzusetzen.
4 Menschen mit psychischen Erkrankungen
In diesem Kapitel wird der Personenkreis , um den es in der vorliegende Arbeit geht, eingehend beschrieben. Zunächst geht es um die Häufigkeit psychischer Erkrankungen im Allgemeinen, dann um die spezielle Situation der chronischen erkrankten bzw. behinderten Menschen. Daraufhin geht es um die spezifische Lebenslage der Betroffenen sowie um den Einfluss von Arbeit und Arbeitslosigkeit auf deren Inklusion bzw. Exklusion.
4.1 Prävalenz psychischer Störungen
Der Anteil der psychischen Erkrankungen im Allgemeinen stieg in den vergangenen Jahren stetig an. Im Folgenden verdeutlichen aktuelle Zahlen die Situation in Deutschland (vgl. WHO Report 2001, zit. nach Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 665 u. Kardorff 2005, S. 254-255):
32,1% (15,6 Mio.) der Bevölkerung im Alter von 18-65 Jahren leiden subjektiv an psychischen Störungen, davon hatten 36% im Jahr zuvor Kontakt zu Fachdiensten und 10% erhielten eine Behandlung (medikamentös oder psychotherapeutisch)
Bei 18% aller Arztbesuche sind psychische Störungen der Anlass (ausgenommen die Behandlung von Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie).
41% aller Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen gehen auf psychische Störungen zurück.
Auch bei Kindern und Jugendlichen beträgt der Anteil derer, die an psychischen Störungen leiden 17,5%; ein Viertel davon sind in Behandlung.
Bei Personen über 65 Jahren beträgt der Anteil psychisch Erkrankter 23%.
Das Lebenszeitrisiko psychisch zu erkranken liegt bei 42,6%, bei Frauen etwas darüber (48,9%) und bei Männern etwas darunter (36,8%), wobei bei ihnen der Anteil an Suchterkrankungen höher ist.
Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen durch psychische Erkrankungen ist zwischen 1997 und 2001 um 50% gestiegen. Frühberentungen stiegen seit 1983 um 50% bei Männern und um 300% bei Frauen (!).
Dies macht deutlich, dass ein zunehmender Teil der Bevölkerung unter psychischen Störungen leidet, von denen ein Teil davon gefährdet ist chronisch zu erkranken und dadurch von dauerhaftem gesellschaftlichen Ausschluss bedroht ist. Der rapide Zahlenanstieg lässt sich zum einen aufgrund der zunehmenden Arbeitslosigkeit und Armut erklären, aufgrund zunehmender Leistungsanforderung sowie aufgrund zunehmender Individualisierung und Pluralisierung, und zum anderen auf eine zunehmende Sensibilisierung und vielleicht auch Offenheit gegenüber psychischen Erkrankungen. Zumindest eine kurzzeitige depressive Episode ist heute eingeschränkt „gesellschaftsfähig“.
4.2 Chronisch psychische Erkrankung und psychische Behinderung
Mit chronisch psychisch kranken oder psychisch behinderten Menschen sind im vorliegenden Text die Menschen gemeint, die aufgrund psychischer Störungen längerfristig und schwerwiegend in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens beeinträchtigt sind und deshalb ganz massiv von Exklusion bedroht sind.
Eine allgemein gültige Definition von psychischen Störungen erweist sich als schwierig. Psychische Erkrankungen sind generell nicht so eindeutig zu beschreiben und zu definieren wie die meisten körperlichen Störungen. Ab wann ein psychische Störung Krankheitswert hat, als abweichendes Verhalten interpretiert wird oder Hilfe von außen erforderlich wird, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zudem relativ und subjektiv. Im ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) wird deshalb nicht von Erkrankung oder Behinderung gesprochen, sondern von Störung. Die psychische Störung wird immer in Zusammenhang mit den individuellen und sozialen Auswirkungen gesehen. „Soziale Abweichung oder soziale Konflikte allein, ohne persönliche Beeinträchtigung sollten nicht als psychische Störung im hier definierten Sinne angesehen werden.“ (Dilling 1993, zit. nach Waller 2003, S. 210)
Besteht eine psychische Störung länger als sechs Monate ist (in Deutschland) von einer seelischen Behinderung die Rede (vgl. Schlichte 2006, S. 25).
Bosshard / Ebert / Lazarus (2001, S. 31) definiert psychische Behinderungen als individuelle Beeinträchtigungen, die mehrere psychische Funktions-, Verhaltens- und Leistungsbereiche umfassen und die voraussichtlich in einem Zeitraum von zwei Jahren nicht dem Regelbereich anzugleichen sind.
Als behindert im Sinne des Gesetzes definiert das Sozialgesetzbuch IX Behinderung folgendermaßen:
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. (SGB IX, §2, Abs. 1, Gesetze für Sozialwesen 2004)
In dieser Definition wurden wesentliche Aspekte des neuen Behinderungskonzeptes der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1998 aufgenommen. In diesem jetzt ressourcenorientierten Konzept gilt als funktional gesund, wenn der körperlich, geistige und seelische Gesundheitszustand allgemein anerkannten (statistischen) Normen entspricht (Stichwort: Schädigung/impairment) wenn ein Mensch alles tun kann, was von einem gesunden Menschen erwartet wird (Stichwort: Aktivität/activity) wenn ein potentieller Zugang zu allen Lebensbereichen besteht und in diesen Bereichen die gleichen Teilhabemöglichkeiten bestehen wie es von Menschen ohne Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes und ohne Beeinträchtigung der Aktivitäten erwartet wird (Stichwort: Teilhabe/participation)
Eine psychische Behinderung bedeutet eine Beeinträchtigung in allen drei Bereichen, d.h. dass zugleich eine Schädigung vorhanden ist sowie die Aktivität eingeschränkt und die Teilhabe beeinträchtigt sind (vgl. Schlichte 2006, S. 25-26).
Die Psychiatrie-Enquête nimmt keine Definition von psychischen Störungen vor, aber die Expertenkommission definiert:
Anders als körperlich Kranke und Behinderte ... sind psychisch Kranke und Behinderte ... aufgrund von Störungen des Wahrnehmens, Fühlens, des Denkens, Wollens und der Erlebnisverarbeitung nicht nur in ihren Fertigkeiten eingeschränkt, ihre unmittelbaren Lebensbedürfnisse aus eigener Kraft zu befriedigen, sondern vor allem auch ihr Vermögen soziale Beziehungen aufzubauen, zu unterhalten und sozialer Rollen zu erfüllen. (Bundesminister für Jugend 1988, S. 112)
Die Expertenkommission weist im Einzelnen auf die konkreten Bedingungen und Umstände einer psychischen Behinderung hin (vgl. Bundesminister für Jugend 1988, S. 111):
sie sind in Entstehung, Verlauf und Ausprägung abhängig von den persönlichen und sozialen Bedingungen
sie vermindern die Fähigkeit, die von der Umwelt erwarteten soziale Rollen auszuüben
sie sind starken Schwankungen unterworfen
sie bedürfen einer längeren Rehabilitationszeit
sie sind schwer messbar
es besteht eine große Gefahr der sozialen Ausgrenzung und Vereinsamung
sie führen häufig zu negativen Auswirkungen in allen Lebensbereichen und dadurch zu sozialem Ausschluss
Es wird davon ausgegangen, dass 1% der Bevölkerung als chronisch psychisch krank bzw. behindert gilt. Ca. 20% der psychischen Erkrankungen werden chronisch (vgl. Eikelmann 1998, S. 24).
Chronisch psychisch kranke Menschen sind mehr als andere Menschen abhängig von einem unterstützenden sozialen Netzwerk. Ist das nicht gewährleistet sind professionelle Unterstützungsangebote nötig, um eine psychische Dekompensation und lange Klinikaufenthalte zu verhindern, insbesondere sog. gemeindepsychiatrische Komplementärangebote wie u.a. das betreute Wohnen. Für NutzerInnen des Betreuten Wohnen, ist zwingend eine ärztliche Diagnose nach ICD 10 erforderlich sowie eine psychische Behinderung bzw. die Bedrohung durch eine solche.
4.3 Lebenslage psychisch kranker Menschen in der Gemeinde
Der Eintritt einer psychischen Behinderung ist fast immer mit sozialem Abstieg, mit Status- und Rollenverlust, mit Arbeitslosigkeit, ungünstigen Wohnverhältnissen, Armut und Isolation verbunden. Die Isolation betrifft gerade auch die Menschen, die in einer eigenen Wohnung leben. Diese ineinandergreifenden Problembereiche, verbunden mit eingeschränkten psychosozialen Kompetenzen, können verstärkend aufeinander wirken und zu einer Ausgrenzungsspirale führen.
„Hospitalisierung, Marginalisierung und Funktionslosigkeit gibt es nicht nur innerhalb der Anstaltsmauern, sondern auch draußen in der sozialen Gemeinschaft.“ (Dörr 2005, S. 68)
Tritt die Erkrankung frühzeitig auf wurde noch keine Ausbildung absolviert, bei späterem Krankheitseintritt und folgendem Krankheitsausfall muss der Arbeitsplatz oft aufgegeben werden. Durch diese weitgehende Exklusion aus dem Arbeitsleben in einer Gesellschaft, die sich weitgehend über Arbeit und Leistung definiert, tritt gezwungenermaßen eine soziale Ausgrenzung ein. Für die Betroffenen bedeutet das nicht mehr gebraucht zu werden, sich nicht mehr selbst finanzieren zu können und dadurch im gesellschaftlichen Abseits zu stehen (vgl. Obert 2001, S. 6).
Die eingetretene Armut wirkt sich bei psychisch behinderten Menschen besonders krass auf die Teilhabemöglichkeiten aus. Die Auswirkungen der Erkrankung an sich bewirken bereits eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten, die sich in der Folge noch verstärken (vgl. Bundesminister für Jugend 1988, S. 86).
Die Ausgrenzungsspirale, in der sich psychisch kranke Menschen z.T. befinden, ist deutlich zu erkennen: Durch die Behinderung ist die Kontakt- und Arbeitsfähigkeit eingeschränkt, dadurch entsteht ein Isolationsgefühl, was wiederum die Krankheitsauswirkungen verstärkt.
Durch zunehmende Arbeitslosigkeit und einen stetig fortschreitenden Abbau der Sozialleistungen wird die Situation für Menschen mit Behinderungen immer prekärer.
Die ambulanten psychosozialen Hilfeformen müssen ihre Arbeitsweisen und Konzepte kritisch reflektieren und hinterfragen: „... für das Gelingen der sozialen Unterstützung ... dürfen sozialstrukturelle Ungleichheiten und populationsbezogene Faktoren wie das Sozialkapital als bedeutungsvolle Wirkfaktoren nicht vernachlässigt werden ...“ (Dörr 2005, S. 72).
4.4 Phänomen Massenarbeitslosigkeit und ihr Einfluss auf die Situation von Menschen mit Behinderungen
Durch die anhaltende Massenarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik sind immer mehr Menschen potentiell von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht. Die Forderung behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt mit einzubeziehen „wird schon als Zumutung empfunden“ (Stein 2005, S. 315).
Lediglich ca. ein Viertel der psychisch kranken Menschen ist beruflich integriert (vgl. Stein 2005, S. 315); eine Umfrage des Bundesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker e.V. ergab ein noch niedrigeres Ergebnis, hier waren lediglich 12% in Beschäftigung (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 668). Bei einer Untersuchung von Obert (2001, S. 36) ergaben sich ebenfalls niedrigere Zahlen, hier waren 95% der langfristig vom sozialpsychiatrischen Dienst betreuten Menschen arbeitslos bzw. nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
Eine Befragung in Betrieben ergab, dass kaum Bereitschaft von betrieblichen Entscheidungsträgern besteht psychisch kranke ArbeitnehmerInnen einzustellen, aus Sorge vor Unberechenbarkeit im sozialen Verhalten und mangelnder Leistungsfähigkeit (vgl. Schubert, zit. nach Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 667).
Die zunehmende rein gewinnorientierte Perspektive in Betrieben verhindert, dass auf ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen Rücksicht genommen wird und dass solche ArbeitnehmerInnen „mitgetragen“ werden. Selbst in nicht privatwirtschaftlichen Betrieben dominiert heutzutage eine ökonomische Sichtweise und ermöglicht auch dort keine Eingliederung mehr (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 666).
Viele Arbeitgeber kommen der Gesetzesforderung nicht oder unzureichend nach, Menschen mit Behinderungen einzustellen und zu integrieren, sie kaufen sich mit geringen Beträgen von ihrer gesellschaftlichen Verantwortung frei. Diesem Zustand sollte entgegen gewirkt werden, sowohl politisch mit veränderten Gesetzen, aber auch von sozialpädagogischer gemeindepsychiatrischer Seite. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und enge Kommunikation und Zusammenarbeit mit potentiellen Arbeitgebern könnten Verbesserungen erzielt werden.
4.4.1 Bedeutung von Arbeit für die Integration
Grundsätzlich gehört das Arbeits- und Berufsleben zu den zentralen Teilsystemen unserer Gesellschaft. Von ihm exkludiert zu sein bedeutet erhebliche negative Konsequenzen für die Betroffenen, die sich nicht auf die finanziellen Einbußen beschränken. In diesem Text kann auf die Bedeutung von Arbeit in unserer Gesellschaft nur am Rande und als Bedingung für wirkliche gesellschaftliche Teilhabe eingegangen werden, obwohl zweifelsohne ein angemessener „normaler“ Arbeitsplatz für viele Betroffene entscheidend zu einer Integration und somit zu einer deutlichen Verringerung ihrer Probleme führen würde.
Für den Großteil der Betroffen bleiben nur die Angebote der Werkstätten und beruflichen Rehabilitationseinrichtungen. Für viele stellt das ein Stigma dar und ist keine wirkliche Inklusion im Arbeitsmarkt, sondern lediglich eine Inklusion in die gemeindepsychiatrische Szene (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 666ff.).
Derzeit ist sogar zu beobachten, dass voll leistungsfähige und -willige psychisch kranke Menschen mit absolvierten Ausbildungen in Werkstätten vermittelt werden, um die Negativeffekte der Arbeitslosigkeit abzumildern und Sozialkontakte aufrecht zu erhalten, und um so eine weitere Isolierung zu verhindern. Dies wiederspricht einerseits den sozialrechtlichen Bedingungen, von Wiedereingliederungsmaßnahmen und andererseits den Integrationsbestrebungen der Gemeindepsychiatrie.
Aufgrund der mangelnden Möglichkeiten einer Wiedereingliederung auf dem Ersten Arbeitsmarkt wurden in den letzten Jahren Werkstätten und Trainingseinrichtungen für psychisch kranke Menschen massiv erweitert. Um auf die Grundprinzipien der Gemeindepsychiatrie zurückzukommen ist hier klar erkennbar, dass wesentliche Ziele nicht erreicht wurden. In Deutschland liegt der Schwerpunkt der beruflichen Wiedereingliederung auf der Schaffung von Sonder- und Trainingseinrichtungen. Dies widerspricht dem Integrationsprinzip. Hier sollen die Betroffenen im besten Falle fit gemacht werden für den Ersten Arbeitsmarkt, nach dem Motto „train and place“ als möglichen Ansatz für die Arbeitsrehabilitation. Effektiver und vor allem integrationsfördernder erscheint mir der „place und train“-Ansatz, bei dem mit Hilfe eines „Job Coachs“ ein „normaler“ Arbeitsplatz angetreten wird, und die Betroffenen vor Ort psychosozial betreut und trainiert werden (vgl. Eikelmann / Reker / Richter 2005, S. 666ff.).
5 Vorurteile und Stigmatisierung als Ursache sozialer Ausgrenzung sowie Entstigmatisierung durch Öffentlichkeitsarbeit
Wie es zu Ausgrenzungsprozessen und Stigmatisierungen kommt und wie man diese Prozesse begrenzen und aufhalten kann wird in den folgenden Gliederungspunkten angesprochen. Um die Gesellschaft durch effektive Öffentlichkeitsarbeit positiv zu beeinflussen und Vorurteile abzubauen, ist es wichtig sich mit der Entstehung von Einstellungen und Stigmatisierung auseinander zusetzen. Ein Grund der Stigmatisierung ist die Zuschreibung des abweichenden Verhaltens durch die Gesellschaft. Danach werden allgemeine Möglichkeiten der Änderung von negativen Einstellungen vorgestellt. Am Ende dieses Kapitels werden konkrete Erfahrungen mit Antistigmaarbeit in der Psychiatrie thematisiert.
5.1 Einstellungen
5.1.1 Entstehung und Funktion
Entscheidend für den Erfolg der sozialen Wiedereingliederung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist, inwieweit sie von anderen Menschen akzeptiert werden und diese deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gegenüber aufgeschlossen sind. Das Wohnen von Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Gemeinde ist ein zentrales Element der Psychiatriereform. Menschen mit psychischen Erkrankungen sehen sich jedoch immer noch mit Befürchtungen und Vorurteilen in der Gemeinde konfrontiert. In der Gesellschaft ist die Erkrankung/Behinderung der Person das entscheidende Beurteilungsmerkmal und nicht, wie üblicherweise nach den tatsächlichen Eigenschaften einer Person. Aufgrund der negativen Bewertung von psychischen Krankheiten wird automatisch auf ungünstige Eigenschaften der Personen geschlossen, ohne sie persönlich zu kennen (vgl. Tröster 1996, S. 188-195).
Vorurteile sind Einstellungen gegenüber Personen oder Gruppen, die extrem starr und negativ sind und sich einer Beeinflussung weitgehend widersetzen.
Tröster (1996, S. 188) betrachtet soziale Einstellungen als ...eine dauerhafte, zeit- und situationsinvariante Disposition auf Menschen mit Behinderungen mit positiven oder negativen Gefühlen zu reagieren, vorteilhafte oder unvorteilhafte Meinungen über sie zu vertreten und sich in zugewandter oder ablehnender Weise ihnen gegenüber zu verhalten.
Unterschieden werden drei Komponenten einer Einstellung und zwar die kognitive Einstellung (Wissenskomponente), die konative Einstellung (Handlungskomponente) und die affektive Einstellung (Gefühlskomponente), wobei die Gefühlskomponente als Kern einer sozialen Einstellung die relevanteste ist, vor allem was die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen betrifft (vgl. Tröster 1996, S. 189).
Geistigen und psychischen Behinderungen gegenüber bestehen die größten Vorbehalte, die geringste Akzeptanz und die größte soziale Distanz. Auch eine Zuschreibung von Selbstverantwortlichkeit für den Zustand spielt eine Rolle („wenn er/sie nur wollte“), ähnlich wie bei Suchterkrankungen. Die Akzeptanz verringert sich, je enger die soziale Beziehung möglicherweise sein soll. Einstellungen sind sehr eng mit der psychischen Struktur eines Individuums verwoben und tragen zum psychischen Funktionieren und zur „Ich-Verteidigungsfunktion“ bei, d.h. eine abwertende Haltung anderen gegenüber dient dazu eigene Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren. Das eigene Selbstbild wird dadurch bestätigt, dass man psychisch kranke Menschen für weniger leistungsfähig hält. Ferner haben Einstellungen eine Wissens- und Erkenntnisfunktion: Sie tragen dazu bei, die eigene Umwelt zu verstehen, soziale Phänomene in ein zusammenhängendes Weltbild zu integrieren und sich somit in einer komplexen Welt zu orientieren. Ein weiterer Grund ist eine angenommene Bedrohlichkeit und Gefährlichkeit für andere (vgl. Tröster 1996, S. 187 ff.).
Die Verbreitung von Vorurteilen gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen ist bei Männern etwas höher als bei Frauen, und bei über fünfzigjährigen Personen etwas höher als bei Jüngeren. Höhere Bildung, besserer sozioökonomischer Status in Verbindung mit Faktenwissen über Behinderungen und Krankheiten führt nicht zu einer positiveren Einstellung. Ein Grund könnte sein, dass in dieser Gruppe eine stärkere Leistungsorientierung als in anderen Bevölkerungsgruppen vorherrscht. In einer weiteren Studie wurden die Einstellungen gegenüber psychisch Kranken je nach Berufszugehörigkeit untersucht. Gefährlich und belastend empfanden vor allem PolizeibeamtInnen und praktische ÄrztInnen psychisch kranke Menschen, die geringste Gefahr und Belastung wurde von psychiatrischem Pflegepersonal und SozialarbeiterInnen vermutet (vgl. Grausgruber 1989, zit. nach Eink 1999, S. 1)
Eine Untersuchung von Angermeyer 1992, kommt zu dem Ergebnis, dass jedem dritten Bundesbürger psychisch Kranke unheimlich sind und jeder vierte sie für gefährlich hält (vgl. Eink 1999, S. 2).
Der direkte Kontakt mit psychisch Erkrankten führt nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung der Einstellung, ist aber ein wichtiger Einflussfaktor. Es scheint, dass Einstellungen und Haltungen gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen im Allgemeinen sehr starr und grundlegend sind (vgl. Cloerkes / Markowetz 1997).
Objektiv gesehen ist das Gewaltrisiko von psychisch kranken Menschen so hoch wie bei gesunden jungen Männern mit Hauptschulabschluss. Etwas häufiger sind lediglich aggressive Handlungen bei jüngeren Männern mit schizophrenen Psychosen innerhalb von psychiatrischern Kliniken, die jedoch auch auf die Institution bezogen, und weniger auf die psychische Störung zurückzuführen sein können (vgl. Angermeyer / Schulze 1998, zit. nach Eink 1999, S. 2).
In großen Teilen der Bevölkerung besteht nach wie vor ein Wissensdefizit bzw. falsches Wissen über psychische Erkrankungen (vgl. Eink 1999, S. 4-7).
Ein großer Teil psychisch kranker Menschen lebt in seinem sozialen System so lange bis dieses persönliche Netzwerk überfordert ist und als Folge eigener Überforderung nicht mehr fähig ist, sich um die psychisch erkrankte Person zu kümmern, auch als Selbstschutz. Psychische Störungen können für die Umgebung eine schwere Belastung darstellen. Die Expertenkommission (Bundesminister für Jugend 1988,S. 83) warnt deshalb davor, die Probleme zu verharmlosen:
Wer die überlebensnotwendige Abwehrhaltung als Vorurteil diskriminiert, verniedlicht die Probleme, verkennt das Anderssein der Betroffenen und verbaut damit Chancen, ihnen durch Akzeptanz und Berücksichtigung dieses dauernden oder vorübergehenden Anderssein einen angemessenen Platz in der Gesellschaft zu schaffen.
Weiter meint die Expertenkommission, dass anerkannt werden muss, dass jede/jeder, auch Gruppen, das Recht haben sich gegen Menschen zu wehren, die Umgangsregeln anhaltend und belastend verletzen. Nur unter dieser Vorraussetzung könnte ein realistisches Fundament für ein befriedigendes Miteinander gesunder, kranker und behinderter Menschen geschaffen werden.
Die Ursachen von Vorurteilen und Stigmatisierung liegt nicht zuletzt in der Psychiatrie selbst:
„Die Vorurteile von heute sind die Fehler der Psychiatrie von gestern.“ (Bock 2000, S. 16)
5.1.2 Die Rolle der Medien
An der negativen Einstellung gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen ist die übliche Berichterstattung der Massenmedien mitverantwortlich, die fast ausschließlich negativ ist. Grund dafür ist eine Profit- und Kundenorientierung und weniger die Vermittlung von seriösen objektiven Berichten. Die Macht der Medien bedeutet für die Öffentlichkeitsarbeit in der Psychiatrie kontinuierlichen Gegenwind. Die Darstellung psychisch Kranker hat nur wenig mit der Realität zu tun, sie bestätigt und festigt jedoch negative Einstellungen. Das von den Medien vermittelte Bild hat sowohl gesellschaftspolitisch als auch gesundheitspolitisch eine immense Bedeutung. Die Berichte sind reißerisch und auf Sensation aus. 85-90% der Berichte über psychisch kranke Menschen berichten von aggressiven Handlungen, Suizid oder Tötung (vgl. Eink 1999, S. 4-7).
An dieser Stelle ist auch der negative Einfluss des Privatfernsehens zu bedenken, der die öffentlichrechtlichen Sender noch weit über bietet, und an einem objektiven Bild von Menschen mit psychischen Erkrankungen kein vornehmliches Interesse hat.
5.2 Abweichendes Verhalten und Stigma
5.2.1 Was ist abweichendes Verhalten und wie erklärt es sich?
Psychische Erkrankungen werden durch Zuschreibung von außen als abweichendes Verhalten dargestellt. Dies ist ein weiterer Grund der Ausgrenzungsprozesse von psychisch Kranken und deren Außenseiterrolle.
Jede Gesellschaft verfügt über bestimmte für alle geltende Normen, die wie folgt definiert werden:
Normen sind Verhaltensregeln, die in Gruppen oder Gesellschaften Geltung haben. Normen beziehen sich nicht nur auf Verhalten, sondern auch auf Denken und Wahrnehmen, ja auch auf nicht bewusst gesteuerte Körpervorgänge oder Gefühle. (Feldmann 2001, S. 71)
Unsere Gesellschaft orientiert sich am gesunden und vollhandlungs- sowie leistungsfähigen Menschen, das ist die Norm. Schwere Krankheiten (physische und psychische) werden als Rollenverletzungen und Normenüberschreitungen angesehen und bilden somit eine besondere Form abweichenden Verhaltens. Der kranke oder behinderte Mensch verhält sich nicht im engeren Sinn abweichend, aber er ist anders als man ihn erwartet. Bei psychischen Erkrankungen kann ein tatsächlich abweichendes Verhalten noch hinzu kommen (Feldmann 2001, 70 ff).
Wird gegen anerkannte und verbreitete gesellschaftliche Normen längerfristig oder massiv verstoßen, wird dieses Verhalten als abweichendes Verhalten eingestuft, und die Menschen zu Außenseitern abstempelt. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft scheint es bis zu einem gewissen Grad notwendig zu sein erwünschtes Verhalten zu fördern, und unerwünschtes also abweichendes Verhalten zu verurteilen (vgl. Finzen 2000b, S. 32).
Bestimmte Formen der Regelverletzung werden, treten sie langfristig oder gehäuft auf, unter dem Etikett „Psychische Krankheit“ zusammengefasst. Wenn eine Person daraufhin als psychisch krank etikettiert wird, wird sie von der Gesellschaft in die Rolle des Abweichlers gedrängt und kann so zum Außenseiter werden (vgl. Schramme 2003, S. 62).
Verhält sich ein Mensch erstmalig abweichend oder psychisch auffällig, wird vom näheren Umfeld (Familie, ArbeitskollegInnen) zunächst versucht das Verhalten zu negieren, zu normalisieren oder auch zu tolerieren. Bis zur Etikettierung als psychiatrischer Fall wird der/die Betroffene als Faulenzer, Querulant oder schwierige Person hingestellt. Für die Umwelt und für die psychisch kranke Person selbst kann die Diagnose zunächst eine Entlastung bedeuten, weil sich das Verhalten erklärt und der psychisch Kranke für sein Verhalten nicht voll verantwortlich ist. Langfristig gesehen ist das aber auch der Anfang einer Stigmatisierung (vgl. Bundesminister für Jugend 1988).
Es liegen verschiedene Theorien vor, die die Entstehung von abweichendem Verhalten erklären. Eingehen möchte ich auf die Etikettierungstheorie, auch labeling approach oder prozessualer Ansatz genannt, und zwar deshalb, weil sie an dieser Stelle die plausibelste Erklärungstheorie ist. abweichendes Verhalten erklärt sich bei dieser Theorie im wesentlichen aus sozialen Reaktionen: Entscheidend ist, wie die Umwelt den Abweichenden definiert. Die Etikettierung ist eine der wichtigsten Ursachen für die Übernahme der Rolle des psychisch Kranken.
Psychische Störungen werden bei dieser Theorie als
... Verhaltensergebnisse einer Abweichungskarriere verstanden, die bei geringfügigen Normverletzung ihren Ausgang nimmt und sich aufgrund der Reaktionen der Umgebung ... schließlich zu manifesten psychisch abweichenden Verhaltensweisen stabilisiert. (Waller 2003, S. 221)
Abweichendes Verhalten ist demnach zunächst nicht eine Persönlichkeitseigenschaft oder ein Merkmal eines Individuums, sondern ein Phänomen, das durch Zuschreibung von außen entsteht und von anderen etikettiert wird (vgl. Mattner 2000, S. 104).
Dazu meint Becker, (zit. nach Cloerkes / Markowetz 1997, S. 140):
Abweichendes Verhalten ist jedes Verhalten, das die Leute so etikettieren. Folglich bestimmt die Gesellschaft was auffälliges Verhalten ist, das Verhalten ist nicht von sich heraus auffällig. Jede Identität bestimmt sich letztlich aus sozialen Etikettierungen, Typisierungen und Bewertungen. Die Rolle des psychisch kranken oder behinderten Menschen ist das Resultat sozialer Reaktionen, nicht objektiv begründbar, widersprüchlich und hat stigmatisierenden Charakter.
Abweichendes Verhalten wird durch Etikettierung zum Stigma.
5.2.2 Psychische Erkrankung als Stigma
Der Soziologe Goffman (1967) hat den Begriff Stigma aufgebracht und folgendermaßen definiert:
Mit Stigma bezeichnet man eine Eigenschaft einer Person, die zutiefst diskreditierend ist. (zit. nach Cloerkes / Markowetz 1997, S. 146)
Eine weitere Definition führt Hohmeier (1975) aus:
Ein Stigma ist ... ein Sonderfall eines sozialen Vorurteils gegenüber bestimmten Personen, durch das diesen negative Eigenschaften zugeschrieben werden. (zit. nach Cloerkes / Markowetz 1997, S. 147)
Bei psychisch Kranken tritt das Stigma i.d.R. erst durch die Krankheit im späteren Leben auf, im Gegensatz zu angeborenen Stigmata bei körper-, geistig- oder sinnesbehinderten Menschen. Der psychisch erkrankte Mensch wird des weiteren als „Klient von speziellen Organisationen“ in die Rolle des Stigmatisierten sozialisiert (vgl. Cloerkes / Markowetz 1997, S. 150).
Unabhängig davon, dass psychische Störungen oft nicht sichtbar sind, entwickelt sich ein Stigma. Der vorher gesunde nicht stigmatisierte Mensch hat wie alle „gelernt“ Vorurteile und Vorbehalte gegenüber psychisch Erkrankten aufzubauen, er ist quasi damit aufgewachsen. Wenn der erkrankte Mensch dann selbst stigmatisiert wird, entwickelt sich meist eine Abneigung gegen sich selbst, die mit Einbußen des Selbstwertgefühls einhergeht, je stärker die gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber der Krankheit sind, und je intensiver der Erkrankte von Desintegration und Zurückweisung betroffen ist (vgl. Finzen 2000b, S. 34).
Die Folgen von Stigmatisierung sind für die Erkrankten tiefgreifend und schwer zu revidieren und auf der Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe droht Exklusion und Isolation. „Die sozialen Folgen der Stigmatisierung müssen als zweite Krankheit verstanden werden.“ (Finzen 2000b, S. 178)
Finzen (2000b, S. 178) zweifelt angesichts „des polarisierenden Charakters unserer Mediengesellschaft“ am Erfolg von breitangelegten Entstigmatisierungskampagnen und setzt deshalb nicht primär auf Entstigmatisierung, sondern auf die Befähigung der Erkrankten zur Stigmabewältigung (Stigmamanagement). Eine gelungene soziale Integration führt automatisch zu einer Entstigmatisierung des einzelnen Menschen.
Die theoretischen Grundlagen, die zum Abbau von Vorurteilen durch eine Veränderung der sozialen Einstellungen führen und dadurch zu einer Entstigmatisierung beitragen, werden im nächsten Punkt aufgezeigt.
5.3 Einstellungs- und Verhaltensänderung
Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Störungen erweisen sich häufig als resistent gegenüber Versuchen sie zu ändern. Wenn angestrebt wird Einstellungen zu verändern, z.B. im Sinne einer Antistigmakampagne muss man sich über die Funktionen von Vorurteilen bewusst sein.
Tröster (1996, S. 193-196) schlägt zur Einstellungsänderung drei möglichen Strategien vor:
1. Information und Aufklärung
2. soziale Kontakte
3. Simulation und Rollenspiel
Die dritte Strategie wird in diesem Zusammenhang nicht näher ausgeführt, weil er eher für den Arbeitsbereich der körper- bzw. sinnesbehinderten Menschen praktikabel ist. Biographien oder Lebensberichte von psychisch kranken Menschen bieten jedoch einen guten Ansatzpunkt. Auf die ersten beiden Strategien wird in den folgenden zwei Abschnitten eingegangen.
Im Weiteren wird eine Handlungsstrategie vorgeschlagen, die sich aus den vorliegenden Theorien ergibt. Konkrete Antistigmakampagnen im psychiatrischen Bereich sind im letzten Punkt dieses Kapitels Thema.
5.3.1 Information und Aufklärung als Möglichkeit der Einstellungsveränderung
Mangelndes Wissen über Behinderungen oder über psychische Erkrankungen im Speziellen kann zu Vorurteilen und zu Diskriminierungen führen, d.h. im Umkehrschluss, dass Aufklärung und Information zu einem Abbau von Vorurteilen führen kann. Zahlreiche Untersuchungen, die diese These belegen wollten, kommen jedoch zu anderen Ergebnissen: Eine reine Faktenvermittlung führt nicht zu einer Einstellungsänderung. Positive Veränderungen werden nur erzielt wenn z.B. in anschaulicher Weise konkret über Lebensbedingungen psychisch Kranker berichtet wird oder Betroffene selbst die Möglichkeit haben mitzuwirken. Massenmediale Aufklärungskampagnen erreichen häufig nur diejenigen, die psychisch kranken Menschen bereits aufgeschlossen gegenüber stehen, während bei denen, die eine ablehnende Einstellung haben, eine sehr geringe Wirkung zu erwarten ist. Grund dafür ist die Tendenz zur sog. selektiven Wahrnehmung: Informationen die mit der eigenen Meinung übereinstimmen werden bevorzugt aufgenommen während Informationen die den Einstellungen widersprechen, ausgeblendet werden (vgl. Tröster 1996, S. 192 ff.).
Untersuchungen weisen daraufhin hin, dass die Effektivität von massenmedialen Informationsprogrammen „... insgesamt nur als sehr gering einzustufen ist ... sie dürften bestenfalls als ergänzende Maßnahme ihre Berechtigung haben. Es wurden sogar gegenteilige Effekte erzielt.“ (Cloerkes / Markowetz 1997, S. 118)
5.3.2 Einstellungsänderung durch Soziale Kontakte
Soziale Einstellungen werden durch Kontakte mit behinderten Menschen positiv beeinflusst, das besagt die sog. Kontakthypothese. Ihr liegen folgende Annahmen zugrunde (vgl. Cloerkes / Markowetz 1997, S. 120):
1. Kontakte können zur Korrektur von Vorurteilen führen.
2. Menschen bevorzugen vertraute Personen und Situationen gegenüber fremden Personen und unbekannten Situationen, und neigen dazu vertaute Personen als positiv und fremde oder unbekannte als negativ zu beurteilen. Durch Kontakte entsteht Vertrautheit, die in der Folge zu einer positiven Einschätzung führt. Diese Annahme wird als Gleichgewichtstheorie bezeichnet.
3. Kontakte zu unbekannten Personen oder Situationen werden eher vermieden und Kontakte zu vertauten Personen werden eher intensiviert.
Aus diesen Grundannahmen lässt sich schlussfolgern, dass es günstig ist Kontakte herzustellen, die dann intensiviert werden, und somit zu einem positiven Einstellungswandel führen können.
Tröster (1996, S. 191) stellt fest, dass die wichtigste Vorraussetzung eine positive persönliche Begegnung ist, bei der der Kontakt möglichst gleichberechtigt ist, und sich die psychisch kranke Person nicht in einer abhängigen Rolle befindet.
Dies erklärt auch die nachweislich vorhandenen Vorurteile bestimmter Berufsgruppen, die mit psychisch Kranken arbeiten. Festgestellt wurde, dass vor allem medizinisches Personal, trotz Fachwissen und Kontakten, die gleichen Vorurteile wie Laien haben, gefolgt von pädagogischen Berufsgruppen vor allem an Regelschulen. Am positivsten waren die Einstellungen bei Berufsgruppen, die im sozialen Bereich gearbeitet haben, z.B. in Beratungsstellen und Werkstätten (vgl. Cloerkes / Markowetz 1997, S. 124).
Eine australische Umfrage ergab, dass die Vorbehalte von PsychiaterInnen gegenüber Schizophrenieerkrankten, im Hinblick auf Gefährlichkeit, größer sind als bei der übrigen Gesellschaft. Dies bestätigt die Frage, ob nicht die Psychiatrie selbst ihren Teil dazu beiträgt, dass Vorurteile weiterhin gebildet, bestätigt und gefestigt werden (vgl. Finzen 2000a, S. 4-6).
Vielversprechend sind dementsprechend Kontakte, bei denen gemeinsame Ziele oder gemeinsame Interessen vorliegen, d.h. bei Kontakten im Bereich Schule, Beruf, Bildungsangebote und Freizeit (vgl. Tröster 1996, S. 193).
5.3.3 Handlungsstrategien
Aus den vorliegenden Theorien und Untersuchungen lässt sich feststellen, dass kombinierte Strategien die größte Wirksamkeit erzielen können. Die Kontakte sollten daher gut strukturiert werden, und gleichberechtigt sein. Informationen und Faktenwissen werden am besten von glaubwürdigen selbst betroffenen Personen in persönlichen Kontakt präsentiert. Medien wie z.B. Videos, die eine positive Darstellung übermitteln, können ergänzend verwendet werden, ebenso Autobiographien oder Lebensberichte von Betroffenen. Aufklärung und Information ist hilfreich, reale Kontakte machen es jedoch leichter Barrieren abzubauen und Ausgrenzung zu verhindern und sind deshalb vorzuziehen.
Wesentlich ist, dass psychisch kranke Menschen sich selbst kompetent und aktiv für den Abbau von Stigmatisierung und Vorurteilen einsetzen. Eine sozialpädagogische Hauptaufgabe in der Betreuung von psychisch kranken Menschen ist deshalb die Handlungskompetenzen von Betroffenen in einem Empowermentprozess zu stärken (vgl. Cloerkes / Markowetz 1997, S. 128)
5.3.4 Kampagnen im Bereich Psychiatrie
5.3.4.1 Offizielle Antistigmakampagne
Aufgrund der auch nach 20-jähriger gemeindepsychiatrischer Erfahrungen vorhandenen Vorurteile und Stigmatisierung gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen wurde 1999 von der World Psychiatry Association (WPA), eine offizielle Antistigma-Kampagne initiiert mit dem Titel Open the doors. Die Kampagne richtete sich auch an Berufsgruppen, die mit psychisch erkrankten Menschen zu tun haben. Resultierend aus verschiedenen empirischen Untersuchungen entstanden folgende Strategien zur Intervention:
1. Öffentlichkeitsarbeit durch Aufklärung in Form von lokalen Veranstaltungen sowie den Einsatz von Massenmedien
2. Information der Rehabilitationsträger, Arbeitgeber und anderer Institutionen
3. aktive Einflussnahme auf Einstellung und Verhalten erklärter Zielgruppen in Form von Begegnungen, Vorträgen und Workshops (JournalistInnen, PolizistInnen, Schule, und den in der Psychiatrie tätigen Berufsgruppen)
In Deutschland wird die Kampagne von einigen ProfessorInnen getragen. Kritisiert wird, dass die Kampagne weniger ein soziologisches oder psychosoziales Krankheitsmodell von psychischen Erkrankungen als Grundlage hat, sondern vielmehr ein medizinisch geprägtes. Schwerpunktmäßig werden deshalb medizinische Aspekte berücksichtigt sowie auf die Wirkung von Medikamente hingewiesen, was auch durch die Mitfinanzierung der Kampagne durch Pharmafirmen erklärt wird. Open the doors hat in der Zwischenzeit den Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrenen und den Bundesverband der Angehörigen in die Kampagne miteinbezogen, dies ist aber nicht von Anfang an geschehen. In Kooperation mit Open the doors entstanden auch verschiedene Schulprojekte (vgl. Informationskampagne Irre menschlich Hamburg 2004, S. 318 ff.).
Im Jahr 2000 wurde in Leipzig der Verein für Öffentlichkeitsarbeit in der Psychiatrie Irrsinnig menschlich im Rahmen der Antistigmakampagne der (WPA) von Betroffenen und ihren Angehörigen, MitarbeiterInnen der Psychiatrie, JournalistInnen und PolitikerInnen gegründet. Ziel des Vereins ist, dass über psychische Krankheiten genauso offen gesprochen werden kann wie über andere Krankheiten. Es soll über psychische Erkrankungen informiert werden und Kontakte hergestellt werden. Verschiedene Zielgruppen (z.B. JournalistInnen) sollen ermutigt werden, sich mit dem Thema Psychiatrie objektiv zu befassen (vgl. Richter-Werling 2000, S. 31)
5.3.4.2 Anti-Stigma-Kampagne „von unten“
„Eine einseitige Anti-Stigma-Kampagne von oben kann keinen nachhaltigen Erfolg haben - erst recht nicht , wenn sie sich weitgehend auf einzelne einmalige Hochglanzveranstaltungen beschränkt“ meint Bock (2000, S. 17) bezugnehmend auf die Kampagne Open the doors.
Erfolgsversprechender ist eine „Antistigma-Kampagne von unten“. Aus dem trialogischen Kontext heraus ist die Beteiligung von Psychoseerfahrenen und Angehörigen bei einer effektiven Antistigmakampagne von unten unerlässlich. Die persönliche Begegnung mit psychoseerfahrenen Personen hat die größte und nachhaltigste Überzeugungskraft.
Anti-Stigma-Kampagne von unten meint die vielen kleinen Aktionen, die zum großen Teil von den Psychiatrieerfahrenen und deren Angehörigen selbst - oder mitinitiiert wurden. Hierzu zählen auch die 130 Psychoseseminare in Deutschland und die Trialogforen, die in den letzten 15 Jahren zunächst innerhalb des Psychiatriepersonals entstigmatisierende Arbeit geleistet haben. Die Voraussetzung für erfolgreiche Gemeinwesen- und Öffentlichkeitsarbeit ist zunächst, dass die Berufsgruppen sich selbst über ihre Vorurteile bewusst werden. Auch in der „Kampagne von unten“ wurden JournalistInnen und andere Multiplikatoren in die Seminare eingeladen, um die Öffentlichkeit besser zu erreichen (vgl. Informationskampagne Irre menschlich Hamburg 2004, S. 320ff).
Bei dem bundesweiten Psychoseseminartreffen im Jahr 2000 entstand die Idee in einem trialogischen Kontext Kampagnen an Schulen zu initiieren, also Betroffne und Angehörige mit einzubeziehen. Das Schulprojekt unter dem Motto Irre menschlich wurde zunächst an Hamburger Schulen initiiert, ist aber mittlerweile in vielen Städten verwirklicht, unter anderem auch an mehreren Kieler Schulen. Ausgangspunkt war, dass besonders Jugendliche die Beschäftigung mit menschlicher Vielfalt und Verrücktheit spannend und bereichernd finden, sowie in ihrer Meinung noch nicht so gefestigt und vorurteilsbeladen sind. Ein Nebeneffekt ist, dass diese Antistigmakampagne auch präventiv wirkt. Eventuelle Symptome psychischer Erkrankungen und eigene Krisenanfälligkeit können selbst frühzeitiger gedeutet werden und entsprechend eher kann auch eine Intervention erfolgen. Inhalte des Schulprojekts sind die Konfrontation mit dem Thema Verrücktsein, Anders sein, psychische Erkrankung und Lebenskrisen unter Einbeziehung von Filmen, Broschüren und Erlebnisberichten. In den höheren Klassen werden auch Kontakte zu gemeindepsychiatrischen Einrichtungen vermittelt (vgl. Bock 2000, S. 18).
Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit setzt bei den Psychoseerfahrenen einen erstaunlichen Empowermentprozess in Gang und bedeutet einen großen Schritt in die gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion. Psychiatrieerfahrene müssen befähigt werden Stigmatisierungen und Diskriminierungen zu erkennen und sich darüber bewusst zu werden, Bewältigungsstrategien zu entwickeln und sich dagegen zu wehren.
Der direkte Kontakt und die Begegnung mit psychoseerfahrenen Menschen leistet einen großen Beitrag dazu, vorhandene Ängste abzubauen, wirkt Vorurteilen entgegen, und schärft den kritischen Blick für stigmatisierende Medienberichte (vgl. Informationskampagne Irre menschlich Hamburg 2004)
Es ist eine gesamtgesellschaftliche und eine politische Aufgabe durch Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung vorzugehen. Gefordert sind die Verbände und Interessenvertretungen von Psychiatrie, Angehörigen und vor allem die Psychiatrieerfahrenen selbst. Zu bedenken ist jedoch, so meint Finzen (2000a, S. 6)
... dass sich in den letzten 30 Jahren nicht viel geändert hat, und durch psychiatrische Öffentlichkeitsarbeit und Antistigmakampagnen wenig bewirkt wurde. Es ist jedoch wichtig die Hände nicht in den Schoß zu legen und kontinuierlich und vor allem mit langem Atem weiterzuarbeiten.
In diesem Sinne geht es darum zielgerichtet weiterhin langfristig und ausdauernd eine Antistigmaarbeit zu forcieren. Vorurteile und Stigmatisierungen, die sich über lange Zeit aufgebaut und entwickelt haben, wie es bei psychisch kranken Menschen der Fall ist, benötigen einen langen Atem und effektive professionelle Konzepte.
6 Sozialpädagogische Konzepte zur Verbesserung von Integration
Im folgenden Kapitel werden vier der bedeutsamsten sozialpädagogischen und gemeindepsychiatrischen Konzepte bzw. Methoden, die eine Inklusion in gesellschaftliche Teilsysteme und eine bessere Integration von Menschen mit psychischen Erkrankung entscheidend unterstützen, vorgestellt und erläutert. Es handelt sich hierbei um das Empowermentkonzept, die Netzwerkorientierung, Gemeinwesenarbeit und Lebensweltorientierung. Am Ende dieses Kapitel werden in Punkt 6.5 die erforderliche Veränderung der Rolle der sozialen Arbeit zunächst im allgemeinen Handlungsfeld der sozialen Arbeit beschrieben und im 6.5.2 die spezielle Rolle in der Gemeindepsychiatrie diskutiert.
6.1 Empowerment – ein integratives Handlungskonzept
6.1.1 Definition
Empowerment lässt sich mit „Selbstbemächtigung“ übersetzen und bedeutet die Gewinnung bzw. Wiedergewinnung von Stärke, Ausdauer, Autonomie und Phantasie als Voraussetzung, das eigene Leben aktiv zu gestalten. Die Ursprünge des Empowermentkonzeptes kommen aus den USA der 1960er Jahre und sind eng verbunden mit der Bürgerrechtsbewegungen, der Frauenbewegung und den Selbsthilfebewegungen im Allgemeinen. Empowerment ist keine sozialpädagogische Methode im engeren Sinn, sondern eine professionelle Haltung. Für die Soziale Arbeit bedeutete das Empowermentkonzept einen Perspektivenwechsel, von der Defizitorientierung weg, hin zur Ressourcen- und Stärkenorientierung, von der Einzelförderung zur Stärkung von Individuen in Gruppen und politischen Kontexten, und von der Beziehungsarbeit zur Netzwerkförderung (vgl. Galuske 2002, S. 263-269 und Deutscher Verein 2002, S. 262).
Im gemeindepsychiatrischen Kontext, insbesondere in der ambulanten „Einzelbetreuung“, ist dieser sinnvolle Paradigmenwechsel nicht leicht umzusetzen. Die Fokussierung auf die psychische Erkrankung bedeutet grundsätzlich eine Defizitorientierung, die Einzelbetreuung ist sozusagen strukturell vorgegeben, und die Beziehungsarbeit ist wiederum die Bedingung für ein Vertrauensverhältnis bei den oft von Misstrauen erfüllten Menschen.
Zu berücksichtigen ist, dass der „Ausgangspunkt von Empowerment-Prozessen stets das Erleben von Machtlosigkeit und Fremdbestimmung ist – die Erfahrung also, ausgeliefert zu sein, „mit dem Rücken an der Wand zu stehen, die Fäden der eigenen Lebensgestaltung aus der Hand zu verlieren“ (Herriger 2002, S. 52). Dies trifft exakt auf die Lage psychisch kranker Menschen zu, wenn sie z.B. nach einem längeren Klinikaufenthalt oder einer psychischen Krise „Betreutes Wohnen“ als Unterstützung in Anspruch nehmen.
Folgende sehr treffende Kurzdefinition hat Stark (1993, S. 41 zit. nach Lenz 2002, S. 13) vorgeschlagen:
Empowerment beschreibt als Prozess im Alltag eine Entwicklung für Individuen, Gruppen, Organisationen oder Strukturen, durch die die eigenen Stärken entdeckt und die soziale Lebenswelt nach den eigenen Zielen (mit-)gestaltet werden kann. Empowerment wird damit als Prozess der Bemächtigung von einzelnen oder Gruppen verstanden, denen es gelingt, die Kontrolle über die Gestaltung der eigene Lebenswelt (wieder) zu erobern.
Empowerment findet auf vier Ebenen statt (im Kontext der Gemeindepsychiatrie; vgl. Deutscher Verein 2002, S. 263):
1. Individualebene
Hier werden individuelle psychologische (z.B. Selbstwertgefühl, Kontrollbewusstsein, geringe Selbstabwertungstendenz) und soziale Ressourcen berücksichtigt und erschlossen sowie das konkrete Bewältigungsverhalten gestärkt. Die Betroffenen sollen in dem Bewusstsein ermutigt werden, dass sie selbst Einfluss auf ihre persönliche Situation nehmen können (Selbstwirksamkeit).
2. Soziale Netzwerkebene
Netzwerke müssen (wieder-)aufgebaut, unterstützt und begleitet werden. Hierunter fällt auch der Aufbau oder die Vermittlung/Unterstützung von gemeinschaftlichen Selbsthilfemöglichkeiten wie den Selbsthilfegruppen. Wenn Betroffene sich mit anderen Betroffenen in Gruppen zusammenschließen, kann sich das Bewusstsein, Einfluss nehmen zu können, besonders positiv entwickeln.
3. Institutionsebene
Institutionen müssen sich reformieren und für Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe öffnen. Psychisch kranke Menschen müssen Einfluss nehmen können auf die Gestaltung von sozialer Dienstleistern z.B. in Form von NutzerInnenbeteiligung.
4. Politische Ebene
Psychiatrieerfahrene werden bei politischen Belangen und Entscheidungen, die sie selbst betreffen, als ExpertInnen in eigener Sache beteiligt. Die Beteiligung an Psychiatrieplänen, Antistigmakampagnen, Bürgerinitiativen und der Zusammenschluss in Verbänden, sowie die Mitbestimmung bzgl. ihrer sozialräumliche Umwelt zählen hierzu.
Konkret bedeutet dies, dass die gemeindepsychiatrische Betreuung im Sinne einer Empowermenthaltung, nicht auf eine Ebene begrenzt wird, sondern parallel an möglichst allen Ebenen angesetzt werden sollte. Individuelle Betreuung wird mit gruppen- und gemeinschaftsfördernden Prozessen verbunden, eingebettet in ein Gemeinwesen unter Berücksichtung politischer Zusammenhänge. Durch diese komplexe Vernetzung und wechselseitige Beeinflussung der Ebenen wird die größte Effektivität erreicht, weil sowohl die personalen als auch die sozialen, ökologischen und politischen Bedingungen und Kontexte von Bedeutung sind (vgl. Lenz 2002, S. 29).
Die berufliche Rolle der BetreuerInnen ändert sich dahingehend, dass ein gleichberechtigtes Verhältnis angestrebt wird und die Expertenmacht ablöst. KlientInnen werden nicht als hilflose FürsorgeempfängerInnen angesehen, sondern als PartnerInnen mit denen Arbeitskontakte in beiderseitiger Verantwortung ausgehandelt werden (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 263).
6.1.2 Aktivierung sozialer Ressourcen im Empowermentprozess
Die psychologische und psychotherapeutische Unterstützung fokussiert insbesondere die Intervention auf der Ebene der personalen Ressourcen (emotionale und kognitive Widerstandskräfte), mit dem Ziel individuelle Prozesse zu fördern. Lediglich bei psychologisch-systemischer Sichtweise werden Familienmitglieder miteinbezogen. Sozialpädagogische Betreuung - und das entspricht auch einer gemeindepsychiatrischen Perspektive - sollte darüber hinaus Ressourcen, die aus dem sozialökologischen Kontext und aus den außerfamiliären Netzwerken gebildet werden fokussieren.
Vieles spricht ... dafür, dass bei einer Reihe von Problemlagen [gemeint sind unter anderem Probleme und Krisen, die im Zusammenhang mit reduzierten bzw. stark kontrollierenden und sanktionierenden Beziehungen stehen, Anm. der Verf.] eine gezielte und systematische Aktivierung kontextbezogener Ressourcen den Erfolg und die Stabilität psychotherapeutischer bzw. psychologisch - beraterischer Vorgehensweise erhöhen kann. (Lenz 2002, S. 29)
Empowerment impliziert ausdrücklich sowohl soziale Integration als auch Solidarität:
Auf der Ebene von sozialen Netzwerken, Gruppen und Organisationen stößt Empowerment soziale Begegnungen, gemeinsames Planen und Gestalten oder eine gemeinsame Suche nach eigenbestimmten Lebensräumen und Lebensperspektiven an und stiftet damit gegenseitige Unterstützung, Integration und Solidarität. Auf der strukturellen Ebene ermutigt Empowerment sich einzumischen und lokale Lebenskontexte mit zu prägen, an sozial relevanten Entscheidungen in der Gemeinde aktiv mitzuwirken oder sich über Initiativen Strukturen mit dem Ziel zu schaffen, die Lebensbedingungen im Stadtteil zu verbessern. (Lenz 2002, S. 29)
Soziale Ressourcen bedeuten das Vorhandensein eines sozialen Netzwerkes, welches für eine Integration und Teilhabe entscheidend ist: „Soziale Integration und vor allem die verschiedenen Formen von sozialer Unterstützung gelten als die wichtigsten gesundheitsfördernden Potentiale sozialer Netzwerke“ (Lenz 2002, S. 27).
Die Wichtigkeit und zentrale Bedeutung sozialer Unterstützung in Bewältigungsprozessen haben eine Reihe von Untersuchungen belegt. Zum einen können psychische Störungen erst entstehen, wenn es nicht oder nicht ausreichend möglich ist entsprechende Ressourcen zu mobilisieren. Zum anderen werden chronische Erkrankungen besser ertragen, Depressionen treten seltener auf oder werden schneller überwunden, und schwere Lebensereignisse werden leichter bewältigt. Durch eine Wechselwirkung von personalen und sozialen Ressourcen werden chronische Krankheiten leichter ertragen, Selbstwertgefühle erhöht, die Funktionsfähigkeit im Alltag gefördert und weitere positive Veränderungen erzielt. Vorhandene soziale und personale Ressourcen können sich gegenseitig verstärken und bereits vorhandene Ressourcen mobilisieren offensichtlich weitere, „Ressourcen haben also offensichtlich die Tendenz zu kumulieren“ (Lenz 2002,S. 28). Auch Aaron Antonowsky weist in seinem salutogenetischen Modell auf die Relevanz von sozialen Ressourcen (soziale Unterstützung, sozialer Rückhalt) als „generalisierte Widerstandressourcen“ hin (siehe Lenz 2002, S. 28).
Da psychisch kranke Menschen oft über eher geringe personale und soziale Ressourcen verfügen, sind am Beginn des Empowermentprozesses die kumulativen und synergetischen Effekte der Ressourcen zu berücksichtigen.
Im folgenden Gliederungspunkt werden die Selbsthilfegruppen in der Gemeindepsychiatrie als charakteristische Empowermentstrategie dargestellt.
6.1.3 Selbsthilfegruppen / Angehörigengruppen
Selbsthilfegruppen für psychisch kranke Menschen haben sich in den letzten drei Jahrzehnten fest etabliert. Sie haben eine außerordentlich große Bedeutung und wichtige Funktionen.
Ganz im Sinne eines Empowermentprozesses ist Geislinger (2002, S. 93) optimistisch:
Eines ist sicher: Die Selbsthilfe wird mehr und mehr ihren Platz innerhalb der psychiatrischen Versorgung erobern, und diese Entwicklung wird auch nicht aufzuhalten sein. Freuen wir uns auf den Tag, an dem Selbsthilfegruppen regelmäßig auf die psychiatrischen Stationen und in die Einrichtungen kommen und dort ihre Arbeit vorstellen.
Die Tatsache, dass psychische Erkrankungen nach wie vor oft zu Ausgrenzungen führen, lassen psychisch kranke Menschen mit ihren Problemen alleine dastehen. In einer Selbsthilfegruppe besteht die Möglichkeit in einem geschützten Rahmen ebenfalls Betroffene kennen zu lernen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen und zu reflektieren, alltagsbezogene Hilfeleistungen zu bekommen, Vertrauen und Solidarität zu erfahren und dadurch das eigene Selbstvertrauen wieder aufzubauen.
Eine weitere wichtige Funktion von Selbsthilfegruppen ist, eigene Anliegen und Belange gegenüber der Öffentlichkeit, den Professionellen und den politischen Entscheidungsträgern zu vertreten.
Für die Gründung von neuen Gruppen in organisatorischen und strukturellen Angelegenheiten (Raumvermittlung usw.), bei Problemen und Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe sowie für die Vernetzung und den Erhalt von psychosozialen Fachinformationen ist eine professionelle Unterstützung zweckmäßig (vgl. Geislinger 2002, S. 83 ff.).
Zur effizienteren politischen Interessenvertretung wurde 1992 der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V. (BPE) gegründet, der heute rund 650 Mitglieder in 80 Selbsthilfegruppen hat. Der BPE verfolgt das Ziel eine gleichberechtigte Beteiligung der Psychiatrie-Erfahrenen an der Planung, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Einrichtungen im psychiatrischen Bereich, eine bessere soziale Stellung sowie den Abbau von Vorurteilen in der Gesellschaft zu erreichen. Der BPE sowie die 13 Landesverbände veranstalten deshalb Fortbildungen und Kongresse für die Öffentlichkeit, die Politik sowie für Professionelle (vgl. Voelzke 2002, S. 261).
Ernst (1998, S. 31) sieht die größte Wirkung der Selbsthilfeinitiativen auf die Öffentlichkeit sowie auf die Professionellen: Eine Veränderung des Sprachstils trägt dazu bei, psychiatrische Krankheitsbilder „gesellschaftsfähig“ zu machen, „das enttabuisierte, unverblümte Reden und Schreiben über Psychopathologie und Verhaltensstörungen unterstützt den langsamen Prozess der abnehmenden Diskriminierung psychisch Kranker in der Öffentlichkeit“.
Er weist auch auf Nachteile von Selbsthilfegruppen hin: Die Atmosphäre des Zusammengehörigkeitsgefühl führt unter Umständen auch „...zur Abkapselung von der ‘Normalwelt’...“ (S. 22).
Im Ganzen gesehen sind allerdings nur ein kleiner Teil der psychisch erkrankten Menschen in Selbsthilfegruppen organisiert, vielen ist eine Selbsthilfegruppe für ihr jeweiliges Anliegen nicht bekannt. Je schwerer der Leidensdruck durch die Krankheit ist, desto seltener finden die Betroffenen den Weg in eine Selbsthilfegruppe.
Ebenfalls Ende der 1970er Jahre entstanden die ersten Angehörigengruppen, anfangs unter fachlicher Anleitung und eher als Informationsgruppen konzipiert, in denen psychiatrisches Fachwissen vermittelte werden sollte. 1985 gründete sich der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.V., dem sich die meisten der heute ca. 300 Gruppen angeschlossen haben (vgl. Clausen / Dresler / Eichenbrenner 1997, S. 253). Angehörigengruppen haben zwei wichtige Funktionen. Zum einen erzielen sie ebenfalls erhebliche Öffentlichkeitswirkung und zum anderen ist die Familie häufig das letzte Netz, das psychisch kranke Menschen haben, das „nicht durch Überstrapazierung vorzeitig und endgültig reißen darf“. (Ernst 1998, S. 27)
Angermeyer (1989, zit. nach Ernst 1998, S. 26) stellte in einer Studie über das soziale Netzwerk und Schizophrenie fest, „dass Schizophreniekranke fast nie ein neues Beziehungsnetz aufbauen können, wenn das alte einmal zerstört worden ist.“
In zunehmenden Maße entstanden in den letzten Jahren Selbsthilfeforen im Internet. Auch diese Gruppen leisten einen wichtigen Beitrag zur Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe.
Die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen ist ein wesentliches Zukunftskonzept der sozialen Arbeit auch in Anbetracht der verstärkten Ökonomisierung: „Die zunehmende Isolation der Menschen, das Ansteigen psychosozialer Notlagen, ... Entwicklung zu mehr Selbstbestimmung und Demokratisierung verstärken den Druck zu solchem Vorgehen.“ (Deutscher Verein 2002, S. 822)
Im nächsten Punkt wird die Netzwerkorientierung als ein weiteres integratives Handlungskonzept diskutiert, wobei viele Parallelen zum Empowermentkonzept zu erkennen sind, quasi die Netzwerkarbeit einer Empowermenthaltung entspricht.
6.2 Netzwerkorientierung und Netzwerkintervention
6.2.1 Soziale Netzwerke
Die folgenden Ausführungen basieren im Wesentlichen auf den Ausführungen des Lexikons des Deutschen Vereins (2002 S. 664-665) und Hartung (2000, S. 170-179).
Zum sozialen Netzwerk einer Person gehören zunächst alle Personen, zu denen Kontakt besteht und die ihr subjektiv etwas bedeuten. Soziale Netzwerke bedeuten für Menschen eine notwendige Schutz-, Unterstützungs- Bewältigungs- und Entlastungsfunktion. Das Eingebunden sein in ein Netzwerk sozialer Beziehungen stellt eine zentrale Ressource dar. Soziale Netzwerke werden unterschieden nach natürlichen, sozusagen gewachsenen Netzwerken wie etwa Verwandtschaft und Nachbarschaft, und künstlichen Netzwerken, die sich auf der Basis gemeinsamer Interessen oder verbindender Betroffenheit entwickelt haben. Soziale Problemlagen werden zunehmend auf künstliche Netzwerke verlagert, zum einen auf künstliche Netze der Solidar- und Selbsthilfe und zum anderen auf professionell organisierte Hilfesysteme (vgl. Deutscher Verein 2002 S. 664-665).
Eine ähnliche Unterscheidung bzw. Strukturierung nehmen Bullinger / Nowak (1998, S. 125) vor. Hier wird das primäre auch als persönliches oder mikrosoziales Netzwerk bezeichnet (Familie, Verwandte, freundschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen), das sekundäre auch als institutionelles oder makrosoziales Netzwerk (Beruf, Schule, Behörden, Freizeit) und schließlich ein tertiäres bzw. intermediäres Netzwerk wie beispielsweise Selbsthilfegruppen und Soziale Arbeit unterschieden, deren Aufgabe es ist vermittelnden Beziehungen zwischen dem primären und dem sekundären Netzwerk zu schaffen.
Die Integration in ein soziales Netz wirkt sich nachweislich auf das psychische und physische Wohlbefinden positiv aus, und hat zusätzlich einen „Puffereffekt“: Belastungen z.B. durch kritische Lebensereignisse oder Krankheiten werden abgemildert (Hartung 2000, S. 170).
Soziale Unterstützung gilt als emotionsregulierende und problemlösungsorientierte Copingstrategie (vgl. Hartung 2000, S. 172).
Soziale Unterstützung erfolgt in unterschiedlichen Bereichen:
instrumentelle Unterstützung (materielle und lebenspraktische Hilfe)
emotionale Unterstützung (Anteilnahme, Zuspruch, Wertschätzung)
Unterstützung durch Informationsvermittlung
Vermittlung eines Identitäts- und Zugehörigkeitsgefühls (Inklusionsgefühl)
Anhand von sog. Struktur- und Beziehungsmerkmalen kann festgestellt werden, wie unterstützend ein soziales Netz wirkt und somit eine Netzwerkanalyse erstellt werden. Zu den Strukturmerkmalen gehören beispielweise die Anzahl der Personen, aus welchen Bereichen die Personen kommen (Familie, KollegInnen, professionelle HelferInnen usw.), und inwieweit die Netzwerkmitglieder untereinander Kontakt haben (Dichte). Die Beziehungsmerkmale beschreiben die Kontakthäufigkeit, die Intensität und Form der Unterstützung, die Reziprozität und die Konfliktbelastetheit des Netzwerkes. Die Netzwerkanalyse kann mittels einer sog. Netzwerkkarte (vgl. Bullinger / Nowak 1998, S. 173-184) ermittelt werden.
Prinzipiell ist ein größeres Netzwerk mit Personen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und einer mittleren Dichte am günstigsten. Für psychisch kranke Menschen kann jedoch gerade in akuten Phasen ein homogenes dichtes Netzwerk günstiger sein und mehr Vertrauen und Geborgenheit vermitteln. Sehr kleine Netzwerke - und diese Situation ist bei psychisch kranken Menschen häufig - können bei großer Belastung schnell überfordert sein, insbesondere wenn kein Kontakt und kein Austausch untereinander vorhanden ist. Hinzu kommt, dass Reziprozität zumindest phasenweise nicht gewährleistet ist, die Unterstützung also einseitig ist und konfliktbeladen sein kann. In solch einer Phase ist die Gefahr, dass die positive Wirkung eines Netzwerkes sich wandelt und Unterstützung von außen erforderlich wird und zwar sowohl zur Unterstützung des Netzwerkes als auch zur zusätzlichen Unterstützung für die Person selbst (vgl. Pearson 1997, S. 185).
Gerade bei Menschen mit psychischen Erkrankung liegt die Ursache der Störung häufig in der Familie selbst, z.B. durch Gewalt- und Missbrauchserfahrung oder Vernachlässigung. Auch einengende und vorwurfsvolle familiäre Netze können für psychisch kranken Menschen nachteilige Wirkungen haben. In der Netzwerkanalyse muss also festgestellt werden, welche Netzwerke stärkend wirken um diese anzuerkennen, zu fördern und neu zu beleben, und welche einen Negativeffekt haben.
Hamel / Windisch (1993, zit. nach Bullinger / Nowak 1998, S. 79) führten eine Untersuchung zur sozialen Integration durch und verglichen die sozialen Netzwerke von Menschen mit und ohne Behinderungen: Das Netzwerk von Menschen mit Behinderungen war insgesamt kleiner, hatte vor allem einen niedrigeren Anteil an freundschaftlichen Beziehungen, jedoch auch an nachbarschaftlichen Beziehungen und an Kontakten zu Vereinsmitgliedern. Auch das „Unterstützungsnetzwerk für die Bewältigung von persönlichen und psychischen Problemen und Belastungen“ war nur etwa ein Viertel so groß im Vergleich mit dem von Menschen ohne Behinderungen.
Die Gründe, warum soziale Netzwerke fehlen oder unzureichend ausgebildet sind, können sowohl klientenbezogen sein als auch von anderen Personen ausgehend oder kontextbezogen sein. Zu den Gründen innerhalb der Gesellschaft gehören Vorurteile und Stigmatisierung, innerhalb des potentiellen primären Netzwerkes spielen Überforderung, Konflikte, Inkompetenz, Ängste, Egoismus, organisatorische Gründe und räumliche Trennung eine Rolle (vgl. Pearson 1997, S. 180-210).
Die Verhinderungsgründe auf Seiten der psychisch kranken Menschen sind meist auf die Krankheit zurückzuführen. Es wurde festgestellt, dass es Personen leichter fällt ein soziales Netzwerk aus- und aufzubauen, wenn sie (vgl. Hartung 2000, S. 172):
über soziale Kompetenz verfügen
sozial attraktiv erscheinen
über Bewältigungsstrategien und Ressourcen verfügen
eine internale Kontrollüberzeugung aufweisen
Stress als Herausforderung sehen
ihre eigenen Probleme kennen und auch äußern können
bereit sind ihren Unterstützungsbedarf zu äußern
und bereit sind auch Unterstützung durch das Netzwerk anzunehmen und nicht denken sie müssen alles alleine lösen.
Die Lage von psychisch kranken Menschen ist hier deutlich erschwert, weil sie diese Kriterien in der Regel nicht erfüllen. Hinzu kommen Ängste und Misstrauen sowie Angst vor Abhängigkeit und Zurückweisung. Vereinzelt wird auch in maßloser und aggressiver Weise Unterstützung gefordert, was zur Folge hat, dass sich Personen aus dem Netzwerk zurückziehen. Diese prekäre Situation hat zur Folge, dass viele chronisch psychisch kranke Menschen über ein sehr kleines Netzwerk aus Angehörigen und Mitbetroffenen verfügen. Im unerfreulichsten Fall sind die Professionellen die einzigen, die im Netzwerk übrig bleiben. Die Menschen leben also völlig isoliert, was unbedingt vermieden werden sollte.
Durch systematische professionelle Intervention mittels Beratung, Gesprächen, Motivation und Unterstützung, aber auch durch Gruppenangebote wie soziales Kompetenztraining und Psychoedukation kann dem entgegen gewirkt werden. Im folgenden Punkt wird diese Netzwerkintervention und -förderung vorgestellt.
6.2.2 Möglichkeiten der Netzwerkförderung
Die Förderung des sozialen Netzwerkes bzw. die Netzwerkintervention kann sowohl personenbezogen als auch strukturbezogen erfolgen (vgl. Hartung 2000, S. 174-175).
Pearson (1997, S. 139-260) unterscheidet Interventionen, die auf die „Indexperson“ bezogen sind und solche die sich auf Abschaffung und Verminderung von äußere Barrieren beziehen.
Bullinger / Nowak (1998, S. 130-170) schlagen sechs verschiedene Verfahren vor, wie das Handlungsmodell soziale Netzwerkarbeit umgesetzt werden kann: netzwerkorientierte Beratung, Selbsthilfeunterstützung, Empowermentkonzept, Vernetzung sozialer Dienste, das institutionelle Setting und netzwerkorientierte Gemeinwesenarbeit.
Die personenbezogene Netzwerkförderung setzt direkt an der Person an, deren Netzwerk entlastet, stabilisiert oder erweitert werden soll, und zwar zunächst mit einer Analyse der vorhandenen Ressourcen sowie auch der Konflikte oder Belastungen.
Voraussetzung für eine Netzwerkintervention ist selbstverständlich das Einverständnis (Aufklärung über das Verfahren und die möglichen Konsequenzen) und die enge Zusammenarbeit mit der betreuten Person und die Beachtung von Chancen aber auch von Gefahren, die eine Veränderung des bestehendes Netzwerkes zur Folge haben kann. Insbesondere die Netzwerkanalyse stellt einen Eingriff in die Lebenswelt und in die Privatsphäre dar (vgl. Bullinger / Nowak 1998, S. 133).
Anschließend werden gemeinsam mit Betreuungsperson und der/dem Betroffenen Perspektiven, Veränderungen und Erweiterung entwickelt und erschlossen. Evtl. ist die Kontaktaufnahme zusätzlicher „künstlicher“ Netzwerke, in Form von Selbsthilfegruppen oder anderen Kontaktstellen förderlich. In manchen Fällen ist es sinnvoll Netzwerkmitglieder professionell zu unterstützen und evtl. Netzwerkmitglieder zusammenzuführen. Auch für die Angehörigen kann die Einbeziehung von künstlichen Netzwerken eine Entlastung bedeuten und netzwerkstabilisierend wirken (vgl. Hartung 2000, S. 176 ff).
Eine netzwerkorientierte Beratung definiert Nestmann (1991) folgendermaßen:
In netzwerk- und unterstützungsorientierten Beratungsperspektiven wird nicht nur das betroffene Individuum als Träger von Problemen und Stärken angesehen, an denen es anzuknüpfen gilt, sondern auch sein oder ihr soziales Netzwerk. Soziale Netzwerke sind mögliche Belastungsquellen und Problemursachen, aber ebenso auch Bewältigungsressourcen und Hilfequellen oder sie können zu solchen entwickelt werden. (Nestmann 1991 zit. nach Bullinger / Nowak 1998, S. 139)
Die Selbsthilfeunterstützung als weiteres Verfahren der sozialen Netzwerkarbeit, wurde im Gliederungspunkt 6.1 Empowerment bereits eingehend erörtert, sie ist jedoch auch eng verbunden mit der Netzwerkintervention:
Das Empowermentkonzept impliziert die Selbstorganisation von Klienten und bedeutet Vernetzung der Individuen und ihrer Unterstützungspotentiale. Das Empowermentkonzept lässt sich als wichtigstes Prinzip der sozialen Netzwerkarbeit bezeichnen. Allerdings ist zu bedenken, dass es an den Klienten einen (fast zu) hohen Anspruch stellt, wenn es von der Ermächtigung von Subjekten redet. In vielen Fällen werden Klienten zunächst konkrete Fremdhilfe brauchen, um auf dieser Grundlage durch eine Netzwerkarbeit auf der Basis des Empowerments ihr Leben wieder selbst zu gestalten. (Bullinger / Nowak 1998, S. 149)
Soziale Dienste eines Klienten zu vernetzen kann „synergetische Produktivitätseffekte“ hervorbringen, auch hier ist jedoch die Aufklärung und das Einverständnis unbedingt zu beachten, um Nachteile zu vermeiden.
Als institutionelles Setting bezeichnen Bullinger / Nowak (1998, S. 153-157) die bewusste Herstellung und Gestaltung von netzwerkförderlichen Bedingungen in Institutionen, wie es beispielsweise in psychosozialen Kontaktstellen und Begegnungsstätten der Fall ist. Für die gemeindepsychiatrische Betreuung haben die Kontaktstellen und Begegnungsstätten einen zentralen Stellenwert für die Erweiterung des Netzwerkes und die (temporäre) Inklusion in die Subkultur Psychiatrieszene. Die aktive Partizipation der NutzerInnen an wichtigen Entscheidungsprozessen ermöglicht es direkten Einfluss zu nehmen und dadurch basisdemokratische Erfahrungen zu machen. Auch die Verbindung von Selbsthilfe und professioneller Hilfe bietet eine ideale Bedingung für die aktive Netzwerkarbeit.
Zur strukturbezogenen Netzwerkförderung gehört neben der Erweiterung des Netzwerkes durch künstliche Strukturen, eine Intervention, die das Gemeinwesen betrifft und dort versucht unterstützende Netzwerke aufzubauen. Soziale Arbeit kann im Gemeinwesen dazu beitragen „... ein Klima der sozialen Verantwortung, der Solidarität, des bürgerschaftlichen Engagements und der demokratischen Partizipation fördern.“ (Hartung 2000, S. 175)
Gemeinwesenarbeit beinhaltet die Vermittlungsarbeit zwischen der Lebenswelt der KlientInnen und der Systemwelt der gesellschaftlichen Institutionen. Primäre Netzwerke müssen mit Angeboten des sekundären (insbesondere öffentliche Einrichtungen) Netzwerkes verknüpft werden. Das bedeutet, dass sich die professionellen HelferInnen in beiden Welten auskennen müssen, also das sekundäre Netzwerk des entsprechenden Stadtteils (Gemeinde) kennen müssen, um sozusagen als „Drehpunktpersonen“ Aktivitäten im lokalen Beziehungsnetz zu verbinden. (vgl. Bullinger / Nowak 1998, S. 157-161).
Netzwerkintervention bedeutet für die Soziale Arbeit einen Perspektivenwechsel vom einseitigen „individualisierten Fallbezug zu sozialökologischer Feldorientierung“ (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 665).
Der nächste Punkt konkretisiert die Gemeinwesenarbeit für die Gemeindepsychiatrie und die Integrationsverbesserung für psychisch kranke Menschen.
6.3 Gemeinwesenorientierung
6.3.1 Beschreibung, Theorien und Perspektiven der Gemeinwesenarbeit
Im Gegensatz zu der früheren Dreiteilung sozialer Arbeit, in der Gemeinwesenarbeit als dritte Methode der Sozialen Arbeit neben der Einzelfallhilfe und sozialer Gruppenarbeit galt, versteht sich Gemeinwesenarbeit (GWA) heute als allgemeines, übergreifendes Arbeitsprinzip, das durch unterschiedliche Methodenanwendung umgesetzt werden kann.
Mit dem Begriff der Gemeinde ist der soziokulturelle, sozioökonomische und ökologische Lebenskontext eines Individuums in einem umfassenden Sinn gemeint.
Das Prinzip der Gemeinwesenarbeit ist „den Klienten in seinen sozialräumlichen Bezügen mit seinen Ressourcen und Problemen zu sehen „ (Galuske 2002, S. 108).
Die Gemeindeorientierung als Grundhaltung und Fokus wird aus sozialpädagogischer Sichtweise als GWA bezeichnet, und aus sozialpsychiatrischer Sichtweise als Gemeindepsychiatrie. Daraus folgt, dass in einer „sozialpädagogischen Gemeindepsychiatrie“ die Gemeinwesenorientierung zentral sein muss (vgl. Keupp 2001a, S. 326-329).
Für Keupp (2001a, S. 326) bedeutet die Gemeindeperspektive die Überwindung des „klinischen Blickes“, der die Individuen von ihrem gesellschaftlichen Kontext trennt. Kritisiert wird somit das biomedizinische Krankheitsmodell (vgl. Waller 2003, S. 15) von psychischer Krankheit.
Bosshard / Ebert / Lazarus (2001, S. 80) beschreiben die Gemeindeorientierung folgendermaßen:
Das Prinzip der Gemeinwesenorientierung betont das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und richtet den Blick auf die Strukturen des Gemeinwesens ... Dieses Prinzip verweist darauf, dass psychosoziale Problemlagen im Kontext der sozialen, ökonomischen und politischen Strukturen einer Gesellschaft entstehen und somit die sozialräumlichen Bedingungen der jeweiligen Lebenswelten zu berücksichtigen sind, da diese das Maß möglicher Integration oder aufgenötigter Desintegration für einzelne Menschen oder Gruppen wesentlich mitbestimmen.
Die wesentlichen Gesichtspunkte von Gemeinwesenarbeit sind (vgl. Oelschlegel 1992, zit. nach Galuske 2002, S. 99):
die Fokussierung des sozialen Netzwerkes,
das Erkennen und Bearbeiten sozialer Konflikte und Probleme im Netzwerk,
Abkehr von der Individualisierung sozialer Probleme hin zu einer gesellschaftlichen Perspektive, trägerübergreifende Vernetzung,
Methodenintegration (d.h. auch Einzelfallhilfe umfasst Gemeinwesenarbeit),
Aktivierung der Bevölkerung, um die Gemeinschaft als Ressource zur Bewältigung psychosozialer Probleme hinzu zu ziehen,
Bildung und Qualifizierung der Gemeinschaft, multiprofessionelle Teamarbeit.
Die folgenden „traditionellen“ Theorien zur Gemeinwesenarbeit stammen aus den 1960er - 1980er Jahren, bieten aber dennoch wertvolle Anregungen für die heutige Arbeit. Eingegangen wird an dieser Stelle auf fünf Konzepte, die sich hinsichtlich ihrer grundlegenden Zielrichtung unterscheiden (vgl. Galuske 2002 S. 101–104 und Rausch 1998, S. 190-191).
wohlfahrtsorientierte Gemeinwesenarbeit ist an traditionellen Hilfemustern ausgerichtet und bietet z.B. diverse Freizeit- und Geselligkeitsangebote an. Dazu zählen auch bauliche Anpassungen und infrastrukturelle Verbesserungen. Es geht weniger um eine Aktivierung der Bevölkerung zur politischen Einflussname innerhalb des Gemeinwesens, die Initiative geht von der Sozialen Arbeit selbst aus. integrative Gemeinwesenarbeit setzt auf Integration und auf eine weitgehend gerechte Gesellschaft, mit dem Ziel einer vermehrten Identifizierung mit dem Gemeinwesen und einer verstärkten Teilhabe an gemeinschaftlichen Angelegenheiten (vgl. Ross 1968, zit. nach Bosshard / Ebert / Lazarus 2001, S. 86).
aggressive Gemeinwesenarbeit geht von grundlegenden gesellschaftlichen Widersprüchen aus, die nicht durch „Appelle an den guten Willen aller Beteiligten überwunden werden“ (Rausch 1998, S. 191). Ausgegrenzte Personengruppen müssen sich zur Durchsetzung ihrer Interessen politisch einmischen. Diese Gemeinwesenarbeit regt die Bildung von Bürgerorganisationen an, unterstützt und fördert sie.
radikaldemokratische Gemeinwesenarbeit arbeitet darauf hin, dass sich benachteiligte Gruppen emanzipieren und organisieren, und unterstützt sie darin. Der Unterschied zur aggressiven Gemeinwesenarbeit ist, dass die Organisation von der Gesellschaft ausgeht und auch von dieser getragen wird, also einer demokratischen Sichtweise entsprechend.
katalytisch-aktivierende Gemeinwesenarbeit ist ein Kompromiss aus den genannten Ansätzen. Ihr Ziel ist eine solidarische Gesellschaft ohne Unterdrückung und die Selbstbestimmung aller Personen. Die konkrete Arbeit beinhaltet die Initiierung und Stützung von Selbsthilfe, die Installierung von „Verbindungsleuten“ und die Förderung politischer Partizipation. Die Soziale Arbeit wird nicht für die Betroffenen aktiv, sondern fördert Eigenaktivität und ist parteilich.
Die Konzepte der heutigen GWA greifen einerseits auf die traditionellen Theorien zurück und knüpfen andererseits an neuere Konzepte, wie an die Lebensweltorientierung, die Netzwerkarbeit, eine „ökosozialen Ressourcenorientierung“ (Wendt 1990, S. 60) und das Empowermentkonzept an. Das Normalisierungsprinzip von Nirje (1969, zit. nach Cloerkes / Markowetz 1997), die Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement und das Casemanagement zählen ebenso dazu wie Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Sozialmanagement und Stadtteilmanagement. Aus verschiedenen Konzepten werden passende und realisierbare Methoden herausgenommen und zusammengefügt, jedoch geht es „im Kern ... stets um eine alltagsorientierte gemeinschaftliche Gestaltung von Lebensräumen, den Sozialraumbezug, um die aktive Einbeziehung möglichst vieler unmittelbar oder potentiell Betroffener und um die Entfaltung und Vernetzung lokaler Ressourcen.“ (Rausch 1998, S. 195)
Die Bedeutung von GWA für die Zukunft der Gemeindepsychiatrie nimmt zu. Durch die gesamtgesellschaftlichen Individualisierung- und Pluralisierungsprozesse, durch zunehmende Leistungsanforderungen und Arbeitslosigkeit sind immer mehr und insbesondere psychisch kranke Menschen von verstärkter Ausgrenzung bedroht. Der potentielle Bedarf an Hilfen und Unterstützungsleistung steigt also an, bei gleichzeitiger Finanzkrise der öffentlichen Hand. Um zu gewährleisten, dass nicht eine weitere Verschlechterung der Lebenssituation von psychisch kranken Menschen eintritt, sondern im Gegenteil psychisch kranke Menschen, die jetzt von Isolation bedroht sind, wieder mehr teilhaben können, bietet Gemeinwesenarbeit eine gute Chance. Durch Gemeinwesenarbeit wird erreicht, dass psychisch kranke Menschen nicht nur in der Gemeinde „wohnortnah“ leben, sondern sich als Teil der Gemeinde fühlen und diese aktiv mitgestalten.
Aus diesem Grund haben sich in den letzten Jahren spezifische Konzepte der Gemeinwesenarbeit entwickelt. Eines davon ist Community Care, welches im nächsten Unterpunkt vorgestellt wird.
6.3.2 Community Care und Community Living
Community Care heißt ein spezifisches Konzept der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen durch die Gesellschaft. Es wurde ebenso wie Gemeindepsychiatrie im Zusammenhang mit den Auflösungsprozessen von Großeinrichtungen entwickelt. Community Care kommt schwerpunktmäßig aus der Behindertenpädagogik, ist aber auf den Bereich Gemeindepsychiatrie direkt übertragbar. Konkret geht es um eine Neugestaltung der Lebensorte. Eine mögliche deutsche Übersetzung lautet: „Hilfe in der Gemeinde – durch die Gemeinschaft“. Die Solidarität für Mitmenschen muss angeregt werden. Solidarität setzt voraus, dass Menschen mit Behinderungen nicht defizitorientiert auf ihre Behinderung reduziert werden, sondern vor allem auf deren Potentiale und Fähigkeiten gesetzt wird (vgl. Schablon 2003).
Dörner (2003, S. 38) versteht unter Community Care eine Deinstitutionalisierung, jedoch insofern positiv ausgedrückt, dass die Sorge (Care) aus dem Exil wieder zurück in das Gemeinwesen kommt, d.h., dass die „Sorge wieder in jedem einzelnen Bürger zu verlebendigen ist.“
Community Care existiert in Schweden, in einigen US-Bundesstaaten und in England. Community Care geht davon aus, dass Menschen mit Behinderungen genau wie andere am Leben in der Gesellschaft teilnehmen möchten, dass sie den Wunsch haben dort zu wohnen, zu arbeiten und ihre Freizeit zu verbringen, wo andere Personen es auch tun. Dieses Konzept lehnt also jegliche Separierung grundsätzlich ab. In Deutschland steckt Community Care noch in den Kinderschuhen (vgl. Reimers 2000).
Die Gemeinweseneinbindung aller Menschen durch die primäre Mithilfe der MitbürgerInnen ist das Ziel von Community Care. Verloren gegangen ist diese Sichtweise laut Dörner (vgl. Schablon 2003) dadurch, dass „Institutionen zu Monopolisten der sozialen Sorge geworden sind“ und MitbürgerInnen gar nicht auf die Idee kommen sich verantwortlich zu fühlen, abgesehen von ihrer Steuerpflicht und gegebenenfalls durch Spenden. Institutionen kümmern sich um hilfsbedürftige Personen, so lautet das Versorgungsverständnis unserer Gesellschaft. Hieran sind die Professionellen mitbeteiligt, sie haben dazu beigetragen dieses Verständnis in der Gesellschaft aufkommen zu lassen und zu verstärken.
Die Unterstützung im Community Care Modell soll also vorrangig vom eigenen sozialen Netzwerk geleistet werden. Erst wenn das nicht möglich ist, sollen reguläre Einrichtungen und Dienste eingebunden, und erst dann durch spezifische Dienste ergänzt werden, um in erster Linie die Regeldienste zu unterstützen (vgl. Schablon 2001, S. 1).
Um Community Care zu verwirklichen, müssen sich deshalb die Einstellungen der Professionellen ändern, die sozialpädagogische Arbeit muss sich stärker an dem Ziel Gemeinweseneinbindung orientieren und auf die Unterstützung der Netzwerke konzentrieren (vgl. Schablon 2003).
Die statistischen Durchschnittsbürger sind es, die das unerschöpfliche Sorgepotential einer lebendigen Kommune ausmachen. Die professionellen Hilfen sollten sich deshalb wieder vermehrt auf diese Zielgruppe von sozialer Arbeit konzentrieren.
„Hier haben wir wieder all das zu lernen, was uns einmal für kurze Zeit, um 1970 herum, als ‘Gemeinwesen-Arbeit’ motiviert hat, bis alle Sozialpädagogen nur noch therapieren wollten. (Dörner 2003, S. 39)
Die soziale Bedeutung, die sowohl die „hilfsbereiten“ BürgerInnen durch die Sorge (Care) um MitbürgerInnen erlangen, als auch umgekehrt, die soziale Bedeutung die Menschen mit Behinderungen für ihre ÜnterstützerInnen erlangen, zählt neben dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung zu einem Grundbedürfnis von Menschen (vgl. Dörner 2003, S. 38).
Schablon (2001, S. 1) stellt folgende These auf: „Community Care ist als philosophische Grundhaltung im Sinne von Inklusion und Integration eine Möglichkeit zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen in marginalisierten Positionen.“
Community Care umfasst alle Lebensbereiche, überall sollen Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt teilhaben. Sie wohnen wenn möglich in einer „normalen“ Wohnung, arbeiten wenn irgend möglich auf dem Erster Arbeitsmarkt, so wie es auch die Ursprünge der Gemeindepsychiatrie gefordert haben. Voraussetzung hierfür ist eine Veränderung der strukturellen Bedingungen.
Community Care ist die Vorraussetzung für eine wirkliche gesellschaftliche Teilhabe und soziale Inklusion und beugt der Gefahr der sozialen Vereinsamung und Isolation vor.
Laut Knust-Potter (1999, S. 1) wird Community Care ziemlich gleichbedeutend auch als Community Living (gemeinwesenintegriertes Leben) bezeichnet. Auch Begriffe wie „Care in the Community“ und „Supported Living“ sind gebräuchlich. Zunehmend scheint sich auch der Begriff Community Living durchzusetzen, weil er „den Fokus des gemeinwesenintegrierten Lebens der Menschen in Randpositionen am ehesten reflektiert.“ Community Living versteht sich als anwendungsbezogene pragmatische Bewegung, die sich auf alle von Aussonderung bzw. Institutionalisierung bedrohten Gruppen bezieht (vgl. Knust-Potter 1999).
Die Förderung von bürgerschaftlichen Engagement in der Gemeindepsychiatrie ist deshalb Voraussetzung dafür, um Modelle wie Community Care zu realisieren, worauf im Folgenden eingegangen wird.
6.3.3 Bürgerschaftliches Engagement in der Gemeindepsychiatrie
6.3.3.1 Begriff und Entwicklung der Bürgerhilfe
In der Psychiatrie-Enquête und in den Expertenberichten (vgl. Bundesminister für Jugend 1988, S. 327) wurde die ehrenamtliche Arbeit als Laienhilfe bezeichnet, später hat der Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. (vormals Dachverband psychosozialer Hilfsvereinigungen e.V.) den Begriff Bürgerhilfe favorisiert. Darüber hinaus sind die Termini bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, Bürgerbeteiligung gängige Begriffe und werden synonym verwendet.
Es wurde bereits in der Psychiatrie-Enquête darauf hingewiesen und von der Expertenkommission konkretisiert, dass die Gemeinde selbst wichtigster Bestandteil der Gemeindepsychiatrie ist: Durch eine Übernahme der Verantwortung für psychisch Kranke durch Professionelle können sich die Betroffenen und ihre Angehörigen mehr und mehr entmündigt fühlen, und bei der Öffentlichkeit kann der Eindruck entstehen, dass zum richtigen Umgang mit psychisch kranken Menschen nur ExpertInnen fähig sind, was wiederum zu einer „Entpflichtung“ des natürlichen Hilfesystems führen könne. Nur wenn „Laienhilfe“ tatsächlich überfordert ist, soll professionelle Hilfe geleistet werden und sie muss so ausgerichtet sein, dass die Fähigkeiten der Betroffenen und ihres Umfeldes dahingehend gefördert werden, ihre Probleme wieder eigenständig zu bewältigen (vgl. Bundesminister für Jugend 1988, S. 327 ff.).
Seibert (2000, S. 366) stellt fest, dass mit dem zunehmenden Ausbau und der Professionalisierung der Sozialarbeit die Bürgerhilfe in den Hintergrund getreten ist, obwohl die Social-Work-Modelle (Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit), die nach 1945 in der Sozialarbeit richtungsweisend waren, auch die Freiwilligensozialarbeit (voluntary action) vorsahen, sozusagen als vierte Säule. Dies ist in Deutschland „angesichts des alles dominierenden Professionalisierungsgedankens glatt unterschlagen worden“ (Seibert 2000, S. 366).
Gemeinsamer Grundkonsens der Bürgerhilfe ist, dass ihre Unterstützung freiwillig und ohne Bezahlung (abgesehen von einer Aufwandsentschädigung) erfolgt. BürgerhelferInnen sollen eine Brücke zwischen dem natürlichen und dem künstlichen Hilfesystem bilden und, sozusagen als „künstlich geschaffene Nachbarschaftshelfer“ einspringen, wo kein natürliches Bezugssystem mehr vorhanden ist (vgl. Bundesminister für Jugend 1988, S. 328).
Die Bürgerhilfe in der Psychiatrie hat nach einer Blütezeit in den 1970er und 80er Jahren kontinuierlich an Bedeutung verloren, mit dem kontinuierlichen Aufbau und Ausbau der gemeindepsychiatrischen Institutionen mit Professionellen ist eine Einbeziehung der Bürgerhilfe scheinbar nicht oder nicht ausreichend gelungen (vgl. Matern / Schäfer / Zechert 2005, S. 8).
6.3.3.2 Organisationen in der Bürgerhilfe
1975 wurde der Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. von Vertretern der ersten bürgerschaftlichen Hilfsvereine gegründet. Seine damalige These, dass eine „Wiedereingliederung in die Gesellschaft ohne die Gesellschaft nicht möglich ist“ (Matern / Schäfer / Zechert 2005, S. 7), ist auch derzeit hochaktuell. Heute ist der Dachverband ein Interessenverband von Bürgerhelferinitiativen, sozialpsychiatrischer Trägerorganisationen, Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigen, in dem jedoch inzwischen die Professionellen überwiegen. Eine „quadrologische“ Struktur im Kern des Vereins, aus Betroffenen, Angehörigen, Bürgerhilfe und Professionellen ist jedoch gesichert. Der Verband setzt sich für eine dauerhafte soziale Integration und eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ein (vgl. Psychiatrienetz 2006).
Der gemeinnützige Verein Aktion psychisch Kranke e.V. ist ebenfalls überwiegend der Initiative von BürgerhelferInnen zu verdanken. Der Verein gibt Publikationen heraus, führt Fachtagungen durch und leistet einen aktiven Beitrag zur Gesundheitspolitik.
6.3.3.3 Schwierigkeiten und Stellenwert der Bürgerhilfe in der Gemeindepsychiatrie
Obwohl die Bürgerhilfe in anderen Bereichen (Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren) in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt hat, gab es bei der ehrenamtlichen Arbeit mit „Randgruppen“ wie psychisch kranken Menschen, Drogenabhängigen, Obdachlosen und AsylbewerberInnen nur wenig ehrenamtliches Engagement. Offensichtlich spiegeln sich auch in der Bürgerhilfe die gesellschaftlichen Diskriminierungen wieder (vgl. Dachverband Psychosozialer Hilfsvereinigungen e.V. 1999, S. 4ff.).
Die Bedeutung von Bürgerhilfe für die psychisch Kranken ist immens. Durch häufige Gefühle von Angst und Misstrauen bei psychisch kranken Menschen, in Verbindung mit einer Stigmatisierung, geraten die Menschen allzu leicht in eine Isolationssituation. Hieraus entsteht der Teufelskreis. Die notwendigen Sozialkontakte beschränken sich auf Beziehungen zu Professionellen, vor allem wenn zur Familie kein Kontakt mehr besteht. Sie können jedoch keine Freunde oder Bekannte ersetzen, es ist riskant und kann ein Abhängigkeitsverhältnis erzeugen, wenn sie der einzige Kontakt sind. BürgerhelferInnen sind an dieser Stelle das Bindeglied zwischen dem psychisch erkrankten Menschen und der Gesellschaft.
Eine Psychiatrie ohne das Engagement ehrenamtlicher Kräfte ist eine Psychiatrie, der wichtige Kontakte zur Gesellschaft fehlen und die ihrer Aufgabe, die psychisch Erkrankten zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu bewegen nur sehr eingeschränkt nachkommen kann. (Nouvertne / Schöck 2002, S. 316)
Wenn BürgerhelferInnen nicht in die Versorgung mit einbezogen werden bleibt das sog. „ambulante Ghetto“ für viele psychisch kranke Menschen, welches von manchen Professionellen als wichtige Schutzvoraussetzung legitimiert wird (vgl. Nouvertne / Schöck 2002, S. 318). Die psychisch Kranken müssen sozusagen vor dem „normalen“ Leben und vor „normalen“ Menschen, vor dem gefährlichen „Draußen“ geschützt werden, obwohl im Sinne einer „Normalisierung“ das Gegenteil erfolgen müsste.
6.3.3.4 Arbeitsfelder, Umsetzung und Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements
Schöck (2004) sieht in der Psychiatrie verschiedene Arbeitsfelder bürgerschaftlichen Engagements. So ist das Hauptarbeitsfeld der direkte Kontakt, indem durch gemeinsame gestaltete Zeit Lebensqualität vermittelt und dadurch Isolierung und Vereinsamung entgegengewirkt wird. In Frage kommen beispielweise Besuchs- und Begleitdienste, Gruppenangebote, Freizeitangebote, Mithilfe in Begegnungsstätten und Hilfestellungen bei der Bewältigung des Alltags. Die Abgrenzung zur professionellen Hilfe ist, dass die Begegnung nicht zielgerichtet ist. Ein weiteres Arbeitsfeld ist das sozialpolitische und gesellschaftliche Engagement für von Ausgrenzung bedrohte Personen. Grundlage für bürgerschaftliches Engagement ist Solidarität und Anteilnahme an der Situation psychisch kranker MitbürgerInnen.
Es hat sich als günstig erwiesen, die Bürgerhilfe durch Professionelle zu organisieren und zu koordinieren, eine Einführung in psychiatrische Krankheitsbilder zu geben, um Verhaltensweisen erklärbar und verständlich zu machen, eine wertschätzende und anerkennende Haltung und vor allem eine kontinuierliche Begleitung in Form von Supervisionen oder anderen Gesprächsangeboten um eine Kontinuität und Stabilität zu erhalten, andernfalls können die BürgerhelferInnen schnell an ihre Grenzen kommen (vgl. Ernst 1998, S. 22-32).
Wie sich die Bürgerhilfe in der Gemeindepsychiatrie entwickeln soll, dazu haben Matern / Schäfer / Zechert (2005, S. 8-9) drei Thesen formuliert:
1. Alltagsorientierung und Normalität sind nach wie vor wichtige Inhalte von Gemeindepsychiatrie und Bürgerhilfe, die es weiter zu vermitteln gilt. Vorgeschlagen wird eine Integration in den Verbund der gemeindepsychiatrischen Hilfen, beispielweise in einen gemeindepsychiatrischen Besuchsdienst, der professionell begleitet wird.
2. Es werden neue Begriffe, neue Inhalte und neue soziale Räume des Engagements gebraucht, um auch die junge Generation anzusprechen und zu motivieren. Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es die Gesellschaft zu solidarisieren und auf die Verelendung und Isolation der Betroffenen aufmerksam zu machen, denn „die psychische Not spielt sich nicht mehr im 40-Bettensaal ab, sondern in der Einsamkeit eines Einraumappartements im 8. Stock“ (Matern / Schäfer / Zechert 2005, S. 9).
3. Die gemeindepsychiatrischen Einrichtungen müssen Bürgerhilfe fest institutionalisieren, und zwar möglichst konkret und projektbezogen. Die Bürgerhilfe muss in Beiräten, Vorständen und Kommissionen beteiligt werden.
Im Sinne einer gelingenden und tatsächlichen Gemeindepsychiatrie mit ihrem Hauptanliegen der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sowie im Zusammenhang mit dem fortschreitenden „Rückzug“ des Sozialstaats, kommt der Bürgerhilfe eine immer größere Rolle zu. Sie hat auch eine wichtige Wirkung beim Abbau von Vorurteilen, denn Ehrenamtliche vermitteln einen unbefangenen normalen (normalisierenden) Umgang mit psychisch kranken MitbürgerInnen in der Gesellschaft. Gegenüber der Gesellschaft bzw. Gemeinde wirken BürgerhelferInnen als sehr gute Multiplikatoren. Erforderlich ist eine Solidarisierung von Betroffenen, Angehörigen, Professionellen und BürgerhelferInnen.
Schon von der Expertenkommission (Bundesminister für Jugend 1988, S. 338 ff.) wird ausdrücklich gewarnt - und das gilt heute unverändert, notwendige fachliche Hilfe durch nichtprofessionelle Bürgerhilfe zu ersetzen, dies würde selbstverständlich zu einer Qualitätsminderung und Verschlechterung führen. Bürgerhilfe muss grundsätzlich als Ergänzung gesehen werden, darf aber nicht als Lückenbüßer missbraucht werden. Bürgerhilfe und Professionelle sollten also nicht in Konkurrenz, sondern in enger Kooperation miteinander stehen. Erforderlich ist hierfür ein gegenseitiges Rollenverständnis und eine offene respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit.
Als viertes Handlungsprinzip wird im nächsten Gliederungspunkt die Lebensweltorientierung als weitere integrationsunterstützende Arbeitsweise beschrieben.
6.4 Lebensweltorientierung in der gemeindepsychiatrischen Betreuung
6.4.1 Das Konzept der Lebensweltorientierung
In der Sozialen Arbeit hat sich der Lebensweltansatz in den 1970er Jahren herausgebildet. Das Konzept basiert auf phänomenologischen, geisteswissenschaftlichen und interaktionistischen Ansätzen sowie auf einer kritischen Alltags- und Gesellschaftstheorie.
Der Begriff Lebensweltorientierung stammt ursprünglich von dem Philosophen E. Husserl: Er stellte vor ca. einem Jahrhundert die These auf, dass sich die Wissenschaft „in den Fundamenten der Lebenswelt begründet“ und leitete hiermit eine neue Epoche der Wissenschaftsphilosophie ein. Der Begriff wurde in verschiedenen Wissenschaften weiterentwickelt, differenziert und spezialisiert u.a. von A. Schütz und J. Habermas. Für Habermas ist die Lebensweltorientierung der Rahmen, indem sich soziale Integration vollzieht (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 609 und Thiersch 2003, S. 6ff.).
Menschen werden in ihren Verhältnissen, die historisch und sozial bedingt sind, gesehen und darin, wie sie Wirklichkeit erfahren, d.h. mit ihren subjektiven Deutungs- und Handlungsmustern, und in ihren Anstrengungen um Lebensbewältigung (vgl. Thiersch 2003, S. 6).
Innerhalb dieser Verhältnisse aus der Erfahrung der dort gegebenen Probleme und Ressourcen heraus, sucht lebensweltorientierte Soziale Arbeit Menschen zu einem ‘gelingenderen Alltag’ zu verhelfen, also zu gerechteren und aushaltbaren Strukturen und Kompetenzen einer Lebensbewältigung im Zeichen von Anerkennung. (Thiersch 2003, S. 6)
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit stützt sich auf primäre Hilfesysteme, auf die regionale Infrastruktur und gemeinwesenorientierte Arbeit, auf allgemeine soziale nicht spezialisierte Hilfen, auf die Priorität von Prävention und auf ambulante und nach Möglichkeit niedrigschwellige Hilfen (vgl. Deutscher Verein 2002, S. 609).
Die Ziele und Intentionen des Lebensweltansatzes zeigen zu anderen Konzepten deutliche Parallelen, nämlich zum Normalisierungsprinzip, zum Konzept der Salutogenese und zum gemeinde- bzw. sozialpsychiatrischen Konzept (vgl. Thiersch 2003, S. 4-6). Ebenso beinhaltet das Konzept viele Element und Leitsätze aus dem Empowermentprinzip, beispielweise eine konsequente Ressourcenorientierung (vgl. Dörr 2005, S. 85).
Obert (2001, S. 137) stellt fest, dass sowohl die Ansätze als auch die Ziele aus den Konzepten Sozial-/Gemeindepsychiatrie und Lebensweltorientierung gewissermaßen Deckungsgleichheit aufweisen. Folglich können die sozialpsychiatrischen Ziele und Leitlinien in den übergreifenden theoretischen Rahmen des Lebensweltansatzes integriert werden.
Nach dem Lebensweltansatz entstehen Lebensprobleme (psychische und physische Gesundheitsprobleme) sowie mangelnde Bewältigungsstrategien dann, wenn Diskrepanzen auftreten zwischen einerseits Bedürfnissen und Fähigkeiten und andererseits den sozialen, ökonomischen und physikalischen Umweltgegebenheiten. Ziel ist es diese Diskrepanzen durch Steigerung der personalen Ressourcen oder durch Steigerung der Umweltressourcen (soziale, ökonomischen, kulturelle und physikalische) zu reduzieren sowie durch Förderung der Fähigkeiten diese Ressourcen optimal zu nutzen (vgl. Schubert 1994, S. 185).
Bei psychisch kranken Menschen sind diese Diskrepanzen besonders groß. Armut, gesellschaftliche Ausgrenzung, ungenügende soziale Bezüge, zusätzliche Erkrankungen, unzureichende Bewältigungsstrategien führen zu einem wenig „gelingenden Alltag“ und gegebenenfalls auch zu ungünstigen gegen sich selbst gerichtete Bewältigungsstrategien wie sozialen Rückzug und Isolation.
Diese Leidenszustände sind als Folge des Zusammenwirkens von schwieriger und unzumutbarer werdenden gesellschaftlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, unsicherer und belastender werdenden Lebenswelten und individuell erschwerter Voraussetzungen aufgrund organischer Disposition zu betrachten. (Obert 2001, S. 127)
6.4.2 Relevanz für die sozialpädagogische gemeindepsychiatrische Betreuung
Das Konzept der Lebensweltorientierung praktisch umzusetzen bedeutet herauszufinden, welche Möglichkeiten die Lebenswelt eines Einzelnen bereit hält, und dabei das gesamte potentielle Umfeld und Netzwerk mit einzubeziehen bzw. zu erweitern oder zu erneuern. Es gilt ebenso herauszufinden, welche Anteile aus der Lebenswelt von KlientInnen sich negativ auswirken und diese dann einzudämmen oder wenn nötig auszuschalten. Die sozialpädagogische Aufgabe besteht also darin, die Lebenswelt der NutzerInnen mitzugestalten und zu optimieren (vgl. Schubert 1994, S. 170 ff.).
Der Ansatz verlässt die Sichtweise einer „individuumsorientierten, am offensichtlichen Problem und Leid fixierten Denk- und Handlungsweise“ (Schubert 1994, S. 170).
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit beinhaltet verschiedene Leitsätze u.a. Prävention, Regionalisierung/Vernetzung und Alltagsnähe.
Die Strukturmaxime (Leitsatz) der Regionalisierung und Vernetzung zielt auf eine konsequente sozialräumliche Orientierung ab. Hierzu zählt auch das bürgerschaftliche Engagement sowie die Vernetzung unter den institutionellen Hilfsangeboten zu gewährleisten.
Integration und Partizipation als weitere Grundsätze der Lebensweltorientierung „verweisen auf die kritische, sozialethische Dimension, auf die Gestaltung der Arbeit in den Lebensverhältnissen im Zeichen sozialer Gerechtigkeit“ (Grunwald / Thiersch 2004, S. 26).
Der Lebensweltansatz geht davon aus, dass Probleme nicht prinzipiell durch das Verschulden oder durch Defizite der Betroffenen entstehen, deshalb ist ein auf das Individuum zentrierte Hilfsangebot unzureichend und auch nicht erfolgreich. Der integrative Ansatz im Lebensweltkonzept bedeutet die Lebenswelt entsprechend positiv zu verändern. Nur wenn das nicht möglich ist, oder die Umweltstrukturen ausschließlich negativ sind, sollen Menschen gänzlich aus ihrem momentan Lebensumfeld ausgegrenzt werden (vgl. Schubert 1994, S. 207).
Integration bedeutet somit, sozialpädagogische Konzept- und Strategieentwicklung zum Abbau von Behinderungen zur Entfaltung von persönlichen und Umwelt-Ressourcen in Einzelfällen wie auch von Lebenswelten generell, um Ausgrenzung zu verhindern oder zu vermeiden. Dazu gehören z.B. gemeinwesenorientierte Ansätze, Solidarisierung von Menschen in Stadtteilen wie auch die Entwicklung von befriedigenden und stabilisierenden zwischenmenschlichen Beziehungsstrukturen ... (Schubert 1994, S. 207).
Integration in der Lebensweltorientierung bedeutet Gleichheit in den Grundansprüchen und das Recht auf Verschiedenheit anzuerkennen, d.h. dass die Gesellschaft zu mehr Offenheit und Toleranz ermuntert werden sollte (vgl. Grunwald / Thiersch 2004, S. 26). Die Integration und Partizipation von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist eng verbunden mit den Forderungen nach Einmischung und der Vernetzung (vgl. Thiersch 2002, zit. nach Dörr 2005, S. 85). Der Grundsatz der Einmischung beinhaltet, dass Soziale Arbeit eine Anwaltfunktion für sozial benachteiligte Menschen einnimmt, um lebenswerte Lebenswelten zu erhalten oder wieder herzustellen. Dies geschieht durch Einmischung in gesellschafts- und kommunalpolitische Bereiche und Strukturen, Stadtteilentwicklung, Wohnungspolitik, sowie in Gesundheits- und Sozialpolitik. „Einmischungsstrategien bedeuten also, die Wächterfunktion für die Lebenswelten und die Anwaltsfunktion für die darin lebenden Menschen und sozialen Gruppen zu übernehmen.“ (Schubert 1994, S. 205)
Dörr (2005, S. 86) betont, dass derzeit häufig „lebensweltliche Arrangements hingenommen werden“, wohingegen es notwendig ist den Hintergrund der Entstehung sozialer Lebenslagen zu sehen, z.B. durch gesellschaftliche Ausgrenzungsmuster und sozioökonomische Umstände.
Die psychische Erkrankung nimmt – unabhängig davon welche Krankheitsmodelle zur Erkrankung bestehen - in der lebensweltorientierten gemeindepsychiatrischen Arbeit eine besondere Bedeutung ein. Es ist deshalb erforderlich eine medizinische und psychosoziale Sichtweise in den Lebensweltansatz zu integrieren und somit sozialpsychiatrisches Handeln in den Lebensweltansatz zu verankern (vgl. Obert 2001, S. 137).
Mit dieser Verankerung wird „die berufliche Identität und das Selbstbewusstsein der SozialpägogInnen/-arbeiterInnen in der Sozialpsychiatrie unterstützt und gefördert“ (Obert 2001, S. 138).
Die derzeitige zunehmende Tendenz zur Spezialisierung und Professionalität in der Sozialen Arbeit macht das Konzept der Lebensweltorientierung riskant. Auch kann die lebensweltorientierte Arbeit gefährlich und überfordernd werden, weil sich die/der Professionelle der Lebenswelt der Betroffenen quasi aussetzt. (vgl. Grunwald / Thiersch 2004).
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit in der gemeindepsychiatrischen Betreuung, schafft die notwendigen Voraussetzungen um die Leitziele Inklusion, Integration und gesellschaftliche Teilhabe zu unterstützen und zu fördern.
6.5 Soziale Arbeit im Kontext gesellschaftspolitischen Wandels
In diesem Gliederungspunkt werden nötige Veränderungen und Anpassungen sozialer Arbeit diskutiert, zunächst allgemein auf die gesamte Soziale Arbeit und schließlich auf die spezielle Situation Sozialer Arbeit in der Gemeindepsychiatrie bezogen.
6.5.1 Soziale Arbeit im Allgemeinen
Die Ausführungen in diesem Gliederungspunkt basieren weitestgehend auf Böhnisch (1994, S. 10-20). Aufgrund einer gesellschaftlichen und politischen Umbruchsituation, hin zu einer postsozialstaatlichen Konsumgesellschaft ist eine Veränderung von sozialer Arbeit erforderlich.
Der Sozialstaat hat seine öffentliche, wohlfahrtsstaatliche Kraft eingebüßt und das warme sozialintegrative Klima der 70er und 80er Jahre ist merklich abgekühlt. (Böhnisch 1994, S. 15)
Die Schwächung des Sozialstaats hat auch eine Verschiebung des sozialpädagogischen Paradigmas der sozialen Integration zur Folge. Darauf hat die Soziale Arbeit nicht adäquat reagiert, nötig wäre sich gesellschaftspolitisch einzumischen. Es ist jedoch festzustellen, dass sich die Sozialpädagogik abschottet, sich nach innen orientiert und sich an ihre Institutionen und an die „bewährten“ professionellen Methoden „festklammert“. Wenn die Soziale Arbeit sich nicht selbst gesellschaftspolitisch gesehen reflektiert, besteht die Gefahr die „eigene disziplinäre Substanz“ zu verlieren, denn eigentlich ist „die soziale Arbeit in der sozialintegrativen Spannung von Individuum und Gesellschaft angesiedelt“ (Böhnisch 1994, S. 10). Die Gesellschaft braucht die Soziale Arbeit als gemeinschaftsbildende Kraft, dies kann ein Weg aus der Sackgasse der Individualisierung im Sinne von Vereinzelung sein. Soziale Arbeit muss „diese (Sozialintegration) zentrale Dimension des Gemeinschaftlichen“ selbst mitentwickeln. Die Soziale Integration muss wieder in den professionellen Fundus zentral miteinbezogen werden. Im Moment sieht es so aus als ob die Soziale Arbeit einen Schritt zurückgegangen, es wird wieder mehr separiert und abweichendes Verhalten therapiert. In der „vorsozialstaatlichen“ Sozialarbeit des 19.Jh. war die Soziale Arbeit nur auf abweichendes Verhalten und Verwahrlosung festgelegt, außerhalb der gesellschaftliche Normalität. „Abweichler“ wurden separiert. Der Anspruch der Sozialen Arbeit nach einer gesellschaftlichen Integration wurde erst mit der Errichtung eines demokratischen Sozial- und Wohlfahrtsstaat aktuell. Die Soziale Arbeit wurde seinerzeit aus dem „Stigma der Randgruppenarbeit“ (Böhnisch 1994, S. 19) herausgelöst. Die Soziale Arbeit führte abweichendes Verhalten und soziale Integration zusammen. Auch wurde eine gesellschaftliche Verantwortung für Menschen mit abweichenden Verhalten öffentlich. Durch diese Vergesellschaftung wurde Soziale Arbeit zur „Kerndisziplin der Sozialintegration“ (Böhnisch 1994, S. 20).
Mitte der 1990er Jahre, nachdem die sozialen Ausgrenzungen sich immer mehr zuspitzten, kam die sozialwissenschaftliche Diskussion von Inklusion und Exklusion in Gange. Ausschließungsprozesse und soziale Ungleichheit sollten wieder zum zentralen Gegenstand Sozialer Arbeit werden.
6.5.2 Sozialpädagogische Psychiatrie: Das Spezifische der Sozialarbeit in der Gemeindepsychiatrie
Die Psychiatrie-Enquête forderte für die gemeindepsychiatrische Versorgung eine großen Anteil an SozialarbeiterInnen in einem multiprofessionellen Team. Aufgabe der Sozialen Arbeit in der Gemeindepsychiatrie ist zum einen die Verwirklichung beratender und rehabilitativer Aufgaben sowie die emotionale Unterstützung und die Stärkung des Ichs. Zum anderen heißt es:
Ihm (dem Sozialarbeiter) kommt die Aufgabe zu, soziale Belastungsfaktoren in der Gesellschaft zu erkennen, diese, so weit es ihm möglich ist auszuschalten, besonders dadurch gefährdetete Personengruppen ausfindig zu machen und mit ihnen auf die Beseitigung dieser Faktoren hinzuarbeiten ... um ihnen einen Wiedereinstieg in die Gesellschaft zu ermöglichen. ( Psychiatrie-Enquête 1975, S. 316)
Eine weitere zentrale Aufgabe ist die existentielle Sicherung durch die Durchsetzung und Geltendmachung von Rechtsansprüchen. Von besonderer Bedeutung sind die Bereiche Arbeiten, Wohnen, soziale Sicherung und Familie. Die Autonomie der psychisch kranken Menschen in ihren Lebenszusammenzuhängen zu wahren bzw. zu erlangen ist ebenfalls zentrale Aufgabe (vgl. Blanke 1995, S. 165-167).
Clausen / Dresler / Eichenbrenner (1997, S. 110) beschreiben die Aufgabe der psychiatrischen Sozialarbeit im multiprofessionellen Team „besonders auf das Soziale zu achten“. Das bedeutet konkret, einen Eindruck zu erhalten wie KlientInnen ihre Rolle als soziales Wesen innerhalb ihrer Umgebung erfüllen können. Und noch konkreter die Entschlüsselung und Verstärkung des sozialen Netzwerkes mittels geeigneter Methoden.
Man könnte den Eindruck haben, als näherten sich in der gemeindeintegrierten Psychiatrie die anderen Berufsgruppen den Sozialarbeitern zunehmend an, als rückten sie ihnen auf die Pelle. Je wichtiger das Soziale wird, je stärker alle Kollegen sozialtherapeutisch tätig sind, desto besser sollte die Berufsgruppe der Sozialen Arbeit ihr Handwerk beherrschen.“(Clausen / Dresler / Eichenbrenner 1997, S. 111)
Das bedeutet jedoch, dass die Soziale Arbeit ihre eigenen beruflichen Paradigmen, Theorien und Handlungskonzepte selbst gut kennen muss, um sie erstens umzusetzen und zweitens anderen Berufsgruppen überzeugend zu vermitteln. Gefordert werden in diesem Zusammenhang auch eine zunehmende Professionalisierung und sozialpsychiatrische Zusatzausbildungen für SozialpädagogInnen, um ein „klar erkennbares Kompetenzprofil“ (Crefeld 2003, S. 27) in der gemeindepsychiatrischen Sozialarbeit festzustellen und dies auch durchsetzen zu können (vgl. Crefeld 2003. S. 26-29).
Die Auffassungen von SozialarbeiterInnen, was eine psychiatrische Sozialarbeit bzw. sozialpädagogische Psychiatrie explizit ausmacht gehen weit auseinander (vgl. Knoll 2000, zit. nach Crefeld 2005, S. 59).
Die Sozialpädagogik hat zu stark versucht, andere therapeutische Berufe zu imitieren, anstatt sich auf ihren eigenen Gegenstand zu berufen.
Die Therapeutisierung der Sozialpädagogik, genauer müsste man sagen die Psychotherapeutisierung, hat in diesem Arbeitsfeld ein unvertretbares Ausmaß angenommen. Die psychiatrische Sozialpädagogik sollte diese Weichenstellung korrigieren. (Ansen 2002, S. 242)
Originäre sozialpädagogische Ansätze, die sozialpsychiatrischen Ansätzen gewissermaßen entsprechen, müssen in die gemeindepsychiatrische Soziale Arbeit eingebracht werden. Hierzu zählen aus sozialer Sicht die Sicherung der materiellen Existenz, die soziale Integration und den Abbau von Stigmatisierung, aus pädagogischer Sicht die Befähigung zu einer selbständigen Lebensführung, z.B. durch Unterstützung in der Haushaltsführung und in der Freizeitgestaltung sowie eine Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten. Die Orientierung an vorgestellten Handlungskonzepten, insbesondere Lebensweltorientierung und das Empowermentkonzept sind hier entscheidend. Sozialpsychiatrie kann im Prinzip nur durch psychiatrische Sozialpädagogik und deren Handlungskonzepte umgesetzt werden. Für die Zukunft der Sozialpädagogik in der Gemeindepsychiatrie ist es entscheidend ein eigenständiges Profil zu entwickeln und die Breite der Sozialpädagogik einzubringen (vgl. Ansen 2002, S. 242-249).
Den ersten Entwurf einer sozialpädagogischen Psychiatrie in Form eines Lehrbuches für SozialpädagogInnen in psychiatrischen Arbeitsfeldern machte Bosshard / Ebert / Lazarus (2001) im Jahr 1999. Hier wird der Gegenstand von Sozialpädagogik, als der Ausgleich sozialisationsbedingter Benachteiligung beschrieben. Die Sozialpsychiatrie hat in den 1960er Jahren Prinzipien aufgenommen, die die Soziale Arbeit bereits 60 Jahre vorher entwickelt hat, wie die Durchsetzung des Normalisierungsprinzips und die Integration (vgl. Bosshard / Ebert / Lazarus 2001, S. 13, 15, 51ff.).
Sozialpädagogen sind die Spezialisten für die Umsetzung des ... Rechts von psychisch kranken ... Menschen auf Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Bosshard / Ebert / Lazarus 2001, S. 17)
Die Psychiatrie ist heute keine Thema mehr, das größeres öffentliches Interesse beansprucht, gerade deshalb ist es notwendig darauf aufmerksam zu machen, dass keinesfalls alle Probleme gelöst sind. Diskriminierung, Armut, mangelhafte Autonomie und Partizipation und gesellschaftlicher Ausschluss sind bei psychisch kranken Menschen mehr die Regel als eine Ausnahme. Die Psychiatrie ist wieder dabei sich von der Gemeinde weg zu bewegen, dahin wo soziale Randlagen gewöhnlich ihren sozialen Ort haben: in jenes modernen Gesellschaften arbeitsteilig delegierte Abseits professioneller Problembearbeitung ... indem Fachkräfte, Patienten und Angehörige gemeinsam eine Parallelwelt schaffen, die sich auch als ambulantes ... Ghetto beschreiben ließe. Gleichwohl existieren eine Vielzahl sozialpsychiatrischer Reforminseln in denen ... gelungene Formen der Integration praktiziert werden und die Wege aus einem solchen Ghetto weisen. Für die Sozialarbeit in der Psychiatrie gibt es noch viel zu tun. (Kardorff 2003, S. 303)
Wenn nicht die Soziale Arbeit, wer soll dann daraufhin wirken, die Rechtsansprüche auf Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wirklich umzusetzen, und als Menschenrechtsprofession für Menschen mit Behinderungen und andere benachteiligte Menschen zu gelten.
7 Integrationsförderung in der gemeindepsychiatrischen Einrichtung Kieler Fenster
Das vorliegende Kapitel beinhaltet einen praxisbezogenen Teil und konkretisiert damit das Thema dieser Arbeit und stellt einen Theorie-Praxis-Bezug her. Zunächst geht es um die angestrebte Verbesserung der sozialen Integration der NutzerInnen einer gemeindepsychiatrischen Einrichtung mittels einer gezielten Verbesserung der professionellen Arbeitsmethoden. Um diese Ziele zu realisieren wurde von der Einrichtung ein spezieller Arbeitskreis gegründet. Aufgearbeitet und dargestellt werden die Ergebnisse aus dem Arbeitskreis Integration in der Institution Kieler Fenster, dem Verein zur Förderung sozialpädagogischer Initiativen, dem größten Träger gemeindepsychiatrischer Einrichtungen in Kiel. Zum Kieler Fenster gehören derzeit zehn Institutionen in den Bereichen „Wohnen“, „Arbeit/Beschäftigung“, „Freizeit“ und „psychosoziale Beratung / Gruppen / Selbsthilfegruppen“. Der Arbeitskreis arbeitet umfassend für alle Abteilungen des Kieler Fensters.
Während meiner Praxissemester war ich im Ambulant Betreuten Wohnen tätig und in diesem Zusammenhang Mitglied des Arbeitskreises. Hieraus entstand die Idee NutzerInnen zu ihrer sozialen Integration direkt zu befragen, um dadurch Daten zu erhalten, durch die die Arbeit des Arbeitskreises direkt unterstützt wird. Dies ist der zweite Teil dieses Kapitels. Ziel der Befragung war herauszufinden wie NutzerInnen des Ambulant Betreuten Wohnen in die Gesellschaft integriert bzw. in Teilsysteme inkludiert sind, wie sie darin unterstützt werden, in welchen Bereichen sie exkludiert sind und welchen Unterstützungsbedarf sie benötigen, um ihre Situation positiv zu verändern. Es wurden zehn Interviews bei KlientInnen aus dem Ambulant Betreuen Wohnen durchgeführt. Die Arbeit des Ambulant Betreuten Wohnens steht auch in diesem Kapitel im Fokus.
Der folgende Gliederungspunkt thematisiert die Inhalte des Arbeitskreises und basiert z.T. auf dessen Protokollen und erarbeiteten Thesenpapieren (vgl. Kieler Fenster 2006, S. 1-6).
7.1 Arbeitskreis Integration
7.1.1 Ausgangssituation
Ein Leitziel des Kieler Fensters ist die Integration von psychisch kranken Menschen in die Gesellschaft. So heißt es beispielweise im Informationsblatt für MitarbeiterInnen der sozialtherapeutischen Wohngruppen:
Ziel der Betreuung ... ist ein möglichst selbstständiges Leben und eine weitgehende Integration in die Gesellschaft (Kieler Fenster o.J.)
Das Ambulant Betreute Wohnen formuliert als sein Arbeitsziel:
... ein lebenswertes eigenständiges Leben in der Gemeinde zu ermöglichen. ...Das Ziel ist nicht vorrangig die rehabilitative Veränderung, sondern primär das akzeptieren des gegenwärtigen Gesundheitszustandes und dessen Folgen für den Betroffenen unter Berücksichtigung einer bestmöglichsten Integration in die Gesellschaft. (Kieler Fenster 2001)
In einer speziellen Konzeption für Menschen mit einem erhöhten Betreuungsbedarf wird das Ziel konkreter formuliert
Ziel ist es, dass es auch psychisch erkrankten Menschen mit einem erhöhten Betreuungsbedarf ermöglicht wird in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld verbleiben zu können, und soweit es den Betroffenen möglich ist und es ihnen wünschenswert erscheint, am Leben in der Gemeinde teilzunehmen. (Kieler Fenster 1997)
In einem Konzept zur Qualitätsüberprüfung (EFQM-Projekt) des Kieler Fensters 2004 sollte erarbeitet werden, in wieweit dieses Leitziel umgesetzt wird. Der Auftrag war „exemplarisch zu erarbeiten, inwieweit KlientInnen in Regeleinrichtungen und in Regelangebote integriert werden können“. Ausgangspunkt war, dass in der Praxis deutlich zu beobachten war, dass NutzerInnen zum einen Teil völlig isoliert leben und zum anderen Teil fast ausschließlich in gemeindepsychiatrischen Einrichtungen inkludiert sind und eine „wirkliche“ Teilhabe im Sinne von Normalisierung häufig nicht stattfindet. Die Rede ist auch hier von einer eher gemeindenahen Psychiatrie als von einer Gemeindepsychiatrie im Sinne einer Integration der psychisch kranken Menschen in das Gemeinwesen unter Einbeziehung der Gesellschaft, d.h. der Menschen aus der Gemeinde.
Aus dem EFQM- Projekt ging der Arbeitskreis (AK) Integration hervor, dessen Ziel es ist unter Zuhilfenahme der Ergebnisse des EFQM- Projektes die soziale Integration von NutzerInnen des Kieler Fensters zu erleichtern und zu fördern bzw. eine Inklusion in gesellschaftliche Teilsysteme zu erreichen. Hauptaufgabe des Arbeitskreises ist die Erstellung eines Grundkonzeptes sowie die Ableitung konkreter Handlungsschritte für die gemeindepsychiatrische Arbeit allgemein und konkret.
Die Voraussetzung eines Handlungskonzeptes ist eine Bestandsaufnahme bzw. eine Situationsanalyse. Die Analyse bezog sich auf potentiell vorhandene Barrieren, die Integrationsbemühungen verhindern.
Im folgenden werden von der Arbeitsgruppe entwickelte Thesen vorgestellt, welche Barrieren für eine verhinderte Inklusion von psychisch kranken Menschen verantwortlich sein können.
7.1.2 Barrieren bei den Integrationsbemühungen
Barrieren, die es erschweren, das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten sind auf verschiedenen Seiten vorhanden. Zum einen auf Seiten der Gesellschaft und der Öffentlichkeit, zweitens auf Seiten der MitarbeiterInnen des Kieler Fensters, drittens liegen strukturelle Gründe vor z.B. mangelnde zeitliche Kapazitäten und letztlich auf Seiten der KlientInnen, die über eingeschränkte Ressourcen verfügen.
Exkurs: Eine und die Hauptursache, warum psychisch kranke Menschen sich nicht gut integriert fühlen, ist die fehlende Teilhabe am beruflichen Leben. Wie an anderer Stelle ausgeführt (vgl. Kap.4.4), befinden sich über 90% der psychisch behinderten Menschen nicht in einem Beschäftigungsverhältnis auf dem Ersten Arbeitsmarkt. Hier besteht von Seiten der direkten Betreuungsarbeit im Augenblick eher wenig Spielraum um zu intervenieren, weil es sich zum Großteil um ein strukturelles Problem handelt. Trotzdem ist es auch für psychisch kranke Menschen nicht völlig aussichtslos einen Arbeitsplatz zu bekommen. Es darf von professioneller Seite auf keinen Fall voreilig mangels normaler Arbeitsmöglichkeiten ein Platz in einer Werkstatt vermittelt werden. Der Bereich „Arbeit“ ist aber wegen fehlender zeitlicher Möglichkeiten nicht Inhalt des Arbeitskreises.
7.1.2.1 Gesellschaftliche Barrieren
In der Gesellschaft sind nach wie vor große Vorbehalte bzw. Vorurteile und Berührungsängste gegenüber psychisch kranken Menschen festzustellen. Ein Grund dafür könnte die unzureichende Information über psychische Erkrankungen sein. Im direkten Kontakt von Menschen mit und ohne Behinderung fehlt z.T. die Bereitschaft „abweichendes Verhalten“ zu akzeptieren und zu tolerieren. Eine gesellschaftliche Verantwortung für alle Menschen unabhängig von Behinderung ist nur unzureichend erkennbar.
7.1.2.2 Barrieren durch MitarbeiterInnen
Integration, als vorrangig angestrebtes Betreuungsziel wird z.T. nicht konsequent genug umgesetzt. Möglicherweise werden nicht die dafür erforderlichen oder geeigneten Methoden angewendet. Gemeinwesenarbeit wird in den einzelnen Abteilungen nicht ausreichend umgesetzt und ist z.T. nicht in den entsprechenden Konzeption verankert. Nur einige Abteilungen befassen sich ganz konkret mit dem Integrationsgedanken und suchen nach Möglichkeiten, wie sie die Integration bei ihren KlientInnen verbessern können.
Einige MitarbeiterInnen bevorzugen für die NutzerInnen zu schnell den geschützten Rahmen einer gemeindepsychiatrischen Einrichtung, u.a. weil sie Bedenken haben, dass eine Förderung der Inklusion in „normale“ Angebote, Institutionen oder Teilsysteme eine Überforderung sein könnte.
Das soziale Umfeld und Netzwerk wird nicht ausreichend einbezogen. Regelangebote und Regeleinrichtungen sowie Vereine, Kirchen usw. werden zu wenig mit in die Betreuung involviert.
7.1.2.3 Strukturelle Barrieren
Integration konkret zu fördern und zu unterstützen ist mitunter zeitintensiv (z.B. die konkrete Begleitung zu einem Verein oder das Herausfinden von potentiellen Freizeit- oder Arbeitsmöglichkeiten). Dieser zusätzliche Zeitaufwand ist bei der sowieso knapp bemessenen Betreuungszeit oft nicht übrig.
7.1.2.4 Barrieren bei den NutzerInnen und Angehörigen
Ein Hauptgrund dafür , dass bestimmte Angebote, die eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, nicht genutzt werden, sind fehlende finanzielle Ressourcen.
Reduzierte persönliche Ressourcen bei den NutzerInnen wie eingeschränkte soziale Kompetenzen, Ängste, niedriges Selbstbewusstsein, nicht ausreichendes Durchhaltevermögen, verminderte Frustrationstoleranz und durch die psychische Erkrankung eingeschränkte Belastbarkeit stellen zusätzliche Barrieren da, die eine Integration erschweren und eine Unterstützung in diesem Bereich erfordern.
7.1.3 Integrationsfördernde Handlungsschritte
In den folgenden Gliederungspunkten werden Möglichkeiten, Optionen und Handlungsschritte aufgezeigt, die die Arbeitsgruppe herausgearbeitet hat, auf welche Weise die Einrichtung Kieler Fenster eine Integration von NutzerInnen in die Gesellschaft unterstützen um somit die Lebenslage der Betroffenen entscheidend zu verbessern. Die entsprechenden Handlungsschritte setzen dort an, wo Barrieren vorhanden sind, d.h. an der Gesellschaft/Öffentlichkeit/Gemeinde, an den BetreuerInnen (MitarbeiterInnen), sowie an strukturellen Verhältnissen und an den NutzerInnen.
7.1.3.1 Abbau von Vorurteilen in der Gesellschaft/Öffentlichkeit
Die bereits vorhandene Öffentlichkeitsarbeit des Kieler Fensters muss noch intensiver betrieben werden. Im Moment umfasst die Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen im Ambulanten Zentrum, regelmäßige Psychoseseminare, Schulprojekte, Teilnahme an Gesundheitstagen und Presse- und Medienarbeit. Zusätzlich wird angestrebt Ombuds- bzw. Mittelsmänner zu gewinnen, z.B. Kontaktpersonen von Sportvereinen, die gezielt angesprochen und informiert werden. Sie könnten bei der Eingliederung eines psychisch kranken Menschen unterstützend tätig sein.
7.1.3.2 Vermittlung der Bedeutsamkeit der Integrationsförderung bei den MitarbeiterInnen
Ziel ist, dass das Leitziel Integration in allen Abteilungen sowohl in der Theorie (Konzeption) als auch in der praktischen Umsetzung mehr Bedeutung und Relevanz erreicht. Ziel ist, ebenfalls bei den MitarbeiterInnen eine positive Einstellung gegenüber Integrationsbemühungen hervorzurufen. Um diese Ziele zu erreichen wurden folgende Vorschläge erarbeitet:
interne Fortbildungen über Integration (z.B. gemeinwesenorientierte Arbeit);
teaminterne Erarbeitung von Methoden, Konzepten und Möglichkeiten, um Integrationsbemühungen zu verstärken;
gesteigerte Thematisierung in den Qualitätszirkeln und Supervisionen mit dem Schwerpunkt einer gemeinwesenorientierter Arbeit.
7.1.3.3 Strukturelle Verbesserungen
Der zusätzlichen Zeitaufwand, der für eine intensive Integrationsförderung aufgebracht wird, sollte berücksichtigt werden. Denkbar sind die verstärkte Einbindung von PraktikantInnen und Ehrenamtlichen, wenn es um konkrete Begleitungen z.B. zu Gruppen oder Vereinen geht, sowie die bereits erwähnte Einbindung von Ombudsmännern. Der zusätzliche Zeitaufwand könnte z.T. auch durch eine Verlagerung der Schwerpunkte in der Betreuungsarbeit selbst kompensiert werden. Durch eine Einstellungsveränderung der MitarbeiterInnen, im Hinblick auf das Selbstverständnis von Integrationsbemühungen ist ein zusätzlicher Zeitaufwand nicht zwangsläufig erforderlich. Es ist aber vorstellbar, dass vom Kieler Fenster zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um abteilungsübergreifende personelle Kapazitäten zu schaffen.
Die Ehrenamtsarbeit sollte abteilungsübergreifend intensiviert werden. Ziel ist eine bestimmte Anzahl von Ehrenamtlichen zur Verfügung zu haben, die sowohl in „Mini-Fortbildungen“ geschult werden (auch zum Thema Integration) und von den Professionellen kontinuierlich begleitet, unterstützt und angeleitet werden. Dies gilt ebenfalls für PraktikantInnen des Kieler Fensters.
7.1.3.4 Ressourcenerhöhung bei den NutzerInnen
Die eingeschränkten finanziellen Ressourcen, die von vielen NutzerInnen als Grund geäußert werden, dass bestimmte teilhabefördernde Angebote (z.B. Bildungs- und Sportangebote) nicht wahrgenommen werden können, sollten erhöht werden. Es wird von Seiten des Arbeitskreises vorgeschlagen, dass vom Kieler Fenster finanzielle Zuschüsse (in realistischem Umfang) angeboten werden, die für Teilhabeaktivitäten zur Verfügung stehen. Diese Zuschüsse könnten evtl. mittels eines Spendenfonds (Sozialsponsoring) beschafft werden oder im Rahmen einer speziellen Projektarbeit (z.B. EU-Förderprojekt).
Die Förderung der sozialen Ressourcen der NutzerInnen sollte auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden. In Einzelgesprächen wird Integration verstärkt thematisiert, und dadurch demonstriert und herausgearbeitet, welche Ressourcen vorliegen und wo konkreter Unterstützungsbedarf besteht. Eine weitere Ebene ist der Ausbau von sozialer Gruppenarbeit. Hierzu zählen sowohl Gruppen, die das Thema Integration direkt fokussieren (soziales Kompetenztraining), als auch Sport- und Freizeitgruppen sowie Bildungsangebote wie z.B. PC- und Sprachkurse. Durch die Teilnahme an zunächst internen Gruppen sollen die NutzerInnen ermutigt und befähigt werden auch externe Gruppen und Angebote aufzusuchen.
Im folgenden Gliederungspunkt wird die durchgeführte empirische Untersuchung dargestellt. Es werden die geführten Interviews vorgestellt und ausgeführt, in denen einzelne NutzerInnen aus dem Kieler Fenster zu ihrer persönlichen Situation befragt wurden, um dadurch detailliertere, ausführlichere und durchaus auch neue Erkenntnisse über die soziale Integration der NutzerInnen des Kieler Fensters zu gewinnen und daraus Schlussfolgerungen für den Arbeitskreis bzw. für die gemeindepsychiatrische Arbeit insgesamt zu ziehen. Die in diesem Gliederungspunkt vorgeschlagenen Handlungsschritte sollen dadurch begründet, belegt und möglicherweise erweitert werden. Es besteht die Option dieses Leitfadeninterview im Rahmen der Arbeit des Arbeitskreises bei weiteren NutzerInnen durchzuführen.
7.2 Darstellung der empirische Untersuchung
Die folgende empirische Untersuchung erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität sondern zeigt lediglich die Situation einer kleinen Anzahl psychisch kranker Menschen. Die Variablen, die zur Auswahl der an der Untersuchung Teilnehmenden führte, bezog sich lediglich auf eine mindestens zweijährige Betreuung im Kieler Fenster sowie auf ein relativ ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter. Viele der von mir interviewten Personen besuchen in regelmäßigen Abständen die Begegnungsstätte des Kieler Fenster. Insofern ist davon auszugehen, dass der Durchschnitt der KlientInnen aus dem Betreuten Wohnen, die nicht in eine gemeindepsychiatrische Einrichtung inkludiert sind, evtl. noch mehr von Ausgrenzung und ihren Folgen beeinträchtigt sind, als die von mir Befragten.
Die Motivation für die Befragung war, Informationen von Nutzerinnen über deren soziale Integration sowie über die integrationsfördernde Unterstützung durch die BetreuerInnen und den gewünschten Unterstützungsbedarf zu erhalten. Diese Interviews sollen die Integrationsförderung des Kieler Fensters, durch denkbare neue oder detailliertere Erkenntnisse über Integration, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe von gemeindepsychiatrisch betreuten Personen unterstützen.
Im Folgenden wird auf das Interview als empirische Methode bzw. Erhebungsmethode eingegangen, welche angewendet wurde um Ansichten, Meinungen und Daten von KlientInnen aus dem Ambulant Betreuten Wohnen zu erheben. Im Anschluss werden die Durchführungsweise der Interviews und die Interviewfragen vorgestellt. Am Ende des Kapitels werden die Ergebnisse der Interviews aufgeführt sowie die denkbaren Schlussfolgerungen für die gemeindepsychiatrische Betreuung gezogen.
7.2.1 Methodisches Vorgehen, Ziel und Fragestellung der Untersuchung
Im Rahmen der Befragung zur Gewinnung von Daten über bestimmte Bereiche sind das Interview als persönliche Einzelbefragung und die schriftliche Befragung mit Hilfe eines Fragebogens von Bedeutung, wobei der Fragebogen als typisch quantitative Erhebungsmethode gilt und das Interview als gängige qualitative Methode (vgl. Badry / Knapp / Hans-Gerhard 2002, S. 189).
Aus zwei Gründen wurde das Leitfadeninterview als Untersuchungsmethode ausgewählt. Zum ersten können hiermit sowohl quantitative als auch qualitative Daten erfragt werden und zum zweiten weist das Interview gegenüber anderen Erhebungsmethoden bestimmte Vorteile auf. Stimmungen, „wunde Punkte“ und evtl. Verständlichkeitsprobleme können gezielter aufgefangen und berücksichtigt werden. Ich erwartete in einem Interview sowohl mehr Motivation als auch weniger Oberflächlichkeit in den Antworten. Verwendet wurden sowohl offene als auch geschlossene Fragen sowie Erfahrungs- und Verhaltensfragen, Meinungs- und Wertefragen und Gefühlsfragen. Der Vorteil geschlossener Fragen ist eine bessere Vergleichbarkeit bei der Auswertung. Bei den offenen Fragen werden Antworten zugelassen, die nicht vorgefertigt sind und somit auch unvermutete Aussagen ermöglicht (vgl. Moser 2003, S. 96).
Der Leitfaden des Interviews war standardisiert und entsprach in gewisser Weise einem Fragebogen, der persönlich mittels Interview abgefragt wurde. Es wurden zehn Interviews durchgeführt, wobei jedes Interview 30-40 Minuten beanspruchte. Acht InterviewpartnerInnen warten mir aus der Begegnungsstätte und aus dem Betreuten Wohnen des Kieler Fensters bekannt, diese bat ich persönlich um ein Interview. Zwei Personen wurden mir von deren BetreuerInnen vermittelt. Voraussetzung für die Auswahl der InterviewpartnerInnen war, dass diese seit mehr als zwei Jahren betreut wurden, um einerseits die „Effektivität“ der Betreuung in Bezug auf Integration herauszufinden und anderseits den Personenkreis der langfristig chronisch psychisch kranken bzw. psychisch behinderten Menschen zu erfassen.
Ziel meiner Befragung war herauszufinden, wie gut integriert psychisch kranke Menschen sind (subjektiv und objektiv), die in ihrer eigenen Wohnung leben und sozialpädagogisch betreut werden und ob, ggf. wie intensiv und in welcher Form sie darin unterstützt werden können, um die soziale Integration zu verbessern, bzw. ob eine Unterstützung überhaupt gewünscht oder erforderlich ist. Erfragt wurden auch mögliche Barrieren, die eine Integration einschränken sowie Situationen und Möglichkeiten, wo Integration positiv bzw. gelungen ist.
Die Fragestellung (Hypothese) lautete wie folgt:
Chronisch psychisch kranke Menschen sind trotz sozialpädagogischer Betreuung nur unzureichend sozial integriert, leben häufig isoliert oder ihre Kontakte begrenzen sich auf die Psychiatrieszene. Sozialpädagogische integrationsfördernde Methoden und Konzepte (Gemeinwesenarbeit, Netzwerkarbeit, Lebensweltorientierung usw.) werden noch nicht gezielt genug und ausreichend eingesetzt.
Ferner sollte auch erfasst werden, in welchen Bereichen gute Erfahrungen gemacht wurden und welche konkreten Gründe Integration verhindern.
7.2.2 Übersicht über die Interviewfragen
Der Leitfaden des Interviews bestand aus sieben Leitthemen, in denen versucht wurde, die Bedeutung des umfassenden Begriffes Integration zu operationalisieren und Indikatoren zu bestimmen, die den Integrationsbegriff kennzeichnen. Erfragt wurden darüber hinaus die Zufriedenheit der psychisch kranken Menschen sowie die erhaltene (subjektiv gesehene) sozialpädagogische Unterstützung in den einzelnen Bereichen. Im folgenden werden die einzelnen Leitthemen, die zwischen zwei und vierzehn Fragen enthalten, vorgestellt.
0. Allgemeine Daten: Geschlecht, Dauer der Betreuung, Betreuungsumfang
1. Wohnsituation: Stadtteil, Wohnung, alleine oder zu mehreren, Zufriedenheit, Unterstützung durch die Betreuung
2. Arbeits- bzw. Beschäftigungssituation: Art und Dauer der Beschäftigung, Dauer der Arbeitslosigkeit, Zufriedenheit, Verhältnis zu den ArbeitskollegInnen und Zufriedenheit, Veränderung, Wünsche
3. Soziale Kontakte: Partnerschaft, Familie, Freunde und Bekannte mit und ohne Psychiatrieerfahrung, Zufriedenheit, Veränderungswünsche und Unterstützung durch die Betreuung
4. Aktivität in der Gemeinde: Nachbarschaft, Kontakte im Wohnumfeld, Besuch von regulären, öffentlichen und speziell gemeindepsychiatrischen Einrichtungen, Teilnahme an Selbsthilfegruppen, Zufriedenheit, Veränderungswünsche und Unterstützung durch die Betreuung
5. Freizeit: Vereine, sportliche Aktivitäten, kulturelle Aktivitäten, Besuch von Gaststätten und Cafes, Besuch von religiösen Einrichtungen und öffentlichen Veranstaltungen, Bildungsangebote, aktive politische und ökologische Partizipation, Ehrenamt; positive Erfahrungen, Zufriedenheit, Veränderungswünsche und Unterstützung durch die Betreuung
6. Finanzielle Situation: Einkommen und mögliche Einschränkung
7. Sonstiges: Schwerpunkt in der Betreuung, Begleitung von Ehrenamtlichen und PraktikantInnen, subjektives Integrationsgefühl, eigene Erfolge und Möglichkeiten, persönliche und gesellschaftsbedingte und strukturelle Barrieren, Wünsche
7.2.3 Durchführung der Interviews
Die Interviews wurden in der zweiten Februarhälfte 2006 durchgeführt, z.T. in den Räumlichkeiten der Begegnungsstätte des Kieler Fensters oder in den Wohnungen der Befragten, je nach Wunsch.
Zu Beginn des Interviews wurden die Interviewten über den Kontext der Befragung und über die Zeitdauer informiert, um ihnen eine Orientierung zu vermitteln und die Grundlage für eine positive Atmosphäre zu schaffen (vgl. Moser 2003).
Im speziellen Fall der Personengruppe von psychisch instabilen Menschen wurde anfangs darauf hingewiesen, dass Fragen nicht beantwortet werden müssen, wenn dies aus bestimmten Gründen Probleme bereitet. Ebenfalls wurde die Gelegenheit einer Pause bzw. eines Abbruchs des Interviews thematisiert, was aber in keinem Fall erforderlich war. Das Interview wurde in chronologischer Reihenfolge gemäß dem Leitfaden geführt. Die Fragen wurden den Befragten vorgelesen, die Antworten wurden während der Befragung in den Interviewbögen protokolliert. Bei der Beantwortung der offenen Fragen, die einen Entfaltungsspielraum der befragten Personen zugelassen haben, wurden die Aussagen in den zentralen Passagen z.T. wörtlich festgehalten und zum Teil umschrieben.
7.2.4 Darstellung der Ergebnisse
Beschreibung der befragten Personen
Es wurden jeweils fünf Männer und fünf Frauen befragt.
Von den zehn Befragten wurde die Hälfte seit mehr als fünf Jahre betreut, die anderen fünf zwischen zwei und fünf Jahren.
Die meisten Befragten wurden mit einem Betreuungsschlüssel von 1:8 (eine BetreuerIn auf acht KlientInnen) betreut, das entspricht einer Betreuungszeit von ca. drei Stunden wöchentlich, wobei sich der face-to-face- Kontakt auf ca. 60% der Zeit beläuft. Lediglich eine Person wurde „intensiv“ betreut, d.h. wöchentlich mit rund fünf Stunden Betreuungszeit. Drei Personen wurden mit einem Schlüssel von 1:12 betreut, das entspricht einem wöchentlichen Direktkontakt von ca. einer Stunde.
Leitthema 1: Wohnsituation
1. Angabe und Beurteilung des Wohngebietes
Neun Befragte kamen aus Kiel, eine Person aus Kronshagen.
Die Gemeinde Kronshagen wurde als insgesamt positives Umfeld beschrieben, indem es ruhig und alles vorhanden ist, andererseits aber „hier nichts los ist“.
Vier Personen kamen aus Kiel Mitte (Südfriedhof und Schreventeich). Sie schilderten ihr Wohnumfeld z.T. als ruhig und sehr schön und fanden es in Ordnung.
Zwei Befragte wohnten im Stadtteil Gaarden. Dieses Wohnumfeld wurde beide Male als „negativ und gefährlich“ eingestuft.
Zwei Befragte wohnten im Stadtteil Elmschenhagen. Das Wohnumfeld wurde einmal als „nett, bietet gute Einkaufsmöglichkeiten und alles ist gut zu erreichen“ geschildert und das zweite Mal als „mäßiges, nicht zentrales“ Wohnumfeld eingestuft.
Eine Person lebte in Ellerbek, auch hier wurde lediglich die dezentrale Lage als ungünstig bewertet.
2. Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen
Acht Personen wohnten alleine. Zwei Personen wohnten zu zweit.
3. Zufriedenheit mit der Wohnsituation
Zwei Personen waren mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden, vier waren zufrieden, drei waren unzufrieden und eine Person war sehr unzufrieden.
4. Gründe der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit
Die Gründe der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit wurden wie folgt geschildert: Vier Personen waren wegen ihrer schönen Wohnung sehr zufrieden oder zufrieden, eine Person gab das schöne Haus als Grund an. Das Wohnen zu zweit wurde als Grund für Zufriedenheit angegeben, ebenso wie das Wohnen allein (von einer Person). Drei Personen gaben das Wohnen allein als Grund für Unzufriedenheit an, weil man niemanden zum Reden hat und sich nicht sicher fühlt. Zweimal wurde der Stadtteil für die Unzufriedenheit verantwortlich gemacht, einmal wegen der Gefährlichkeit (Gaarden) und einmal wegen mangelnder Freizeitmöglichkeiten (Elmschenhagen). Die schlechte und beängstigende Wohnsituation in einem Hochhaus wurde von einer Person als Grund der extremen Unzufriedenheit genannt.
5. Unterstützung durch die Betreuung
Fünf Personen benötigten im Moment keine Unterstützung durch die BetreuerInnen im Bereich Wohnen, drei Personen gaben an ausreichende Unterstützung zu erhalten und zwei erhielten eher wenig Unterstützung.
6. Unterstützungsbedarf im Bereich Wohnen
Um eine Veränderung zu erzielen bräuchten drei Personen mehr Unterstützung in diesem Bereich und sieben Befragte gaben an nicht mehr Unterstützung zu benötigen.
Leitthema 2: Arbeitssituation
1. Vorhandensein eines Beschäftigungsverhältnisses
Acht Befragte befanden sich in einem Arbeits- bzw. Beschäftigungsverhältnis, zwei Personen nicht.
2. Wünsche der Personen ohne Beschäftigungsverhältnis Eine Person wünscht sich eine Beschäftigung, die andere Person derzeit nicht.
3. Art des Beschäftigungsverhältnisses
Es handelte sich in fünf Fällen um ein Arbeitsverhältnis in einer Werkstatt (bzw. Arbeitstrainingsmaßnahme oder berufliche Rehabilitation). Eine Person absolvierte ein Fernstudium, eine weitere Person hatte einen Minijob und eine Person besuchte eine Tagesstätte. Keine Person verfügte über einen sozialversicherungspflichtigen „normalen“ Arbeitsplatz.
4. Zufriedenheit mit dem Beschäftigungsverhältnis
Die Zufriedenheit mit dem Arbeits- und Beschäftigungssituation, haben eine Person als sehr zufriedenstellend, fünf Personen als zufriedenstellend und zwei Befragte als unbefriedigend beschrieben.
5. Beurteilung des kollegialen Kontaktes
6.
Eine Person beurteilte das Verhältnis zu den ArbeitskollegInnen als sehr gut, fünf Personen als gut und eine Person als befriedigend. Drei Personen hatten keine ArbeitskollegInnen.
7. Intensität des kollegialen Kontaktes
Über die Arbeit hinaus besteht bei zwei Personen ein seltener Kontakt zu ArbeitskollegInnen und bei sechs Personen kein Kontakt.
8. Ausbau des kollegialen Kontaktes
Drei Befragten genügte der wenige Kontakt zu KollegInnen, drei hätten gerne mehr Kontakt und zwei möchten keinen Kontakt außerhalb der Arbeitszeit.
9. Veränderungswünsche bezüglich. der Beschäftigungssituation
Die Hälfte der Befragten würde an ihrer Situation im Bereich Arbeit/Beschäftigung gerne etwas verändern, z.B. mehr Kontakte zu KollegInnen haben. Die andere Hälfte möchte nichts verändern.
10. Unterstützung durch die Betreuung
Sechs Befragte gaben an, im Bereich Arbeit/Beschäftigung keine Unterstützung zu benötigen, zwei erhalten eher wenig Unterstützung und zwei Personen gaben an ausreichend Unterstützung zu erhalten. Einer Person war die Art und Weise der Unterstützung zu unkonkret und sie konnte erhaltene Tipps nicht umsetzen.
11. Unterstützungsbedarf
Sieben Personen gaben an nicht mehr Unterstützung zu benötigen, drei Personen bräuchten mehr Unterstützung um eine Veränderung zu erzielen. Eine Person würde gerne ein Arbeitstraining im landwirtschaftlichen Bereich finden, eine andere Person eine Tagestätte besuchen. Zwei Personen wünschten sich konkretere Unterstützung und Begleitungen auch zu „normalen“ Arbeitgebern.
12. Wünsche bzgl. der Beschäftigungssituation
Auf die Frage, was sich die Interviewten bezüglich ihrer Beschäftigungssituation wünschen, wurden folgende Antworten gegeben:
Fünf Personen gaben an gerne einen „normalen“ Arbeitsplatz zu haben. „Mein Ziel ist der Erste Arbeitsmarkt, mit vernünftigem Lohn“, eine andere Person „hätte gerne einen Halbtagsjob auf dem Ersten Arbeitsmarkt, um unabhängig vom Amt zu sein“. Zwei Personen wünschten sich „mehr Geld in der Werkstatt, um auch motivierter zu sein“.
Leitthema 3: Soziale Kontakte
1. Partnerschaft
Von den Befragten hatten neun Personen keine/n feste/n PartnerIn, eine Person lebte in Partnerschaft.
2. Wunsch nach Partnerschaft
Sechs Personen möchten nicht, dass sich daran etwas ändert, vier Personen wünschten sich ein/n PartnerIn.
3. Familiäre Kontakte
Zu mindestens einem Familienmitglied hatten drei Personen engen Kontakt, vier Personen regelmäßigen Kontakt, eine Person sporadischen Kontakt und zwei Personen hatten zu niemandem aus der Familie Kontakt.
Eine genauere Aufschlüsselung der einzelnen Familienmitglieder ergab, dass der engste Kontakt zu den Geschwistern bestand. Hier hatten drei Personen engen Kontakt, zwei regelmäßigen, zwei sporadischen und zwei keinen Kontakt (eine Person hatte keine Geschwister). Ein enger Kontakt zu den Eltern bzw. einem Elternteil bestand in einem Fall, in einem weiteren Fall war der Kontakt regelmäßig, bei fünf Personen sporadisch und drei hatten keinen Kontakt (wobei bei einer Person beide Eltern verstorben waren).
4. Zufriedenheit mit den familiären Kontakten
Sechs Personen empfinden ihre familiäre Situation als befriedigend, vier Personen als unbefriedigend. Drei Personen würden gerne etwas verändern, sieben Personen möchten nichts verändern.
5. Kontakte zu Mitbetroffenen
Enge Kontakte zu Mitbetroffenen hatten vier, regelmäßigen Kontakt eine Person , zwei hatten sporadischen und drei keinen Kontakt zu ebenfalls psychisch kranken Menschen. Es handelte sich häufig um den Kontakt zu mehreren Personen.
6. Ausbau des Kontaktes mit Mitbetroffenen
Vier Personen würden ihre Kontakte „innerhalb der Psychiatrieszene“ gerne aufbauen (drei) bzw. (eine) ausbauen, sechs möchten nicht mehr Kontakte haben.
7. Kontakte zu Nichtbetroffenen
Engen Kontakt zu Nichtbetroffenen hatten vier Personen, eine Person hatte regelmäßigen, fünf sporadischen Kontakt. Es handelte sich zum großen Teil nur um eine oder zwei Personen aus dem Freundeskreis der „Nichtbetroffenen“.
8. Ausbau des Kontaktes zu Nichtbetroffenen
Neun Befragte hätten gerne mehr und intensiveren Kontakt zu Nichtbetroffenen, eine Person gab an mit Nichtbetroffenen „nichts anfangen zu können, die verstehen mich nicht“.
9. Ausschließliche Kontakte zur Psychiatrieszene Nur eine Person hatte ausschließlich Kontakte zu Psychiatrieerfahrenen.
10. Unterstützung Bei der Unterstützung bezüglich der sozialen Kontakte gab eine Person an sehr viel Unterstützung zu erhalten, vier Personen erhielten ausreichend Unterstützung, eine Person eher wenig und drei Personen gaben an wenig Unterstützung zu erhalten. Eine Person benötigte keine Unterstützung. Geäußert wurde in zwei Fällen, dass die Unterstützung nicht konkret genug erfolgte, sondern nur thematisiert wurde.
11. Unterstützungsbedarf
Sieben Personen gaben an nicht mehr Unterstützung zu brauchen, wobei drei davon sagten, dass sie auch nicht wüssten wie die Unterstützung aussehen könnte „Sie kann ja keine Freunde für mich finden“. Drei Personen hätten gerne mehr Unterstützung, davon gab eine Person an sie bräuchte „ eine andere Unterstützung, die es nicht gibt.“
12. Kontakte der BetreuerInnen zu Angehörigen
Keine der zuständigen BetreuerInnen hatte nach Aussage der befragten Personen engen oder regelmäßigen Kontakt zur Familie oder zu Freunden. Zwei Personen gaben den Kontakt mit „eher wenig“ an, „sie hat einmal mit meiner Mutter telefoniert“ und „sie redet eben mit meiner Freundin, wenn sie auch zuhause ist“. Acht BetreuerInnen hatten überhaupt keinen Kontakt zur Familie oder zu FreundInnen ihrer Betreuten.
13. Zufriedenheit mit den Sozialkontakten
Insgesamt gesehen waren zwei Befragte mit ihren Sozialkontakten zufrieden, vier Personen nicht ganz zufrieden, drei Personen unzufrieden und eine Person sehr unzufrieden.
Leitthema 4: Aktivität in der Gemeinde
1. Nachbarschaftlicher Kontakt
Die nachbarschaftlichen Kontakte basierten in vier Fällen auf stabiler nachbarschaftlicher Hilfe, drei Personen gaben an sich gegenseitig zu akzeptieren, zwei hatten keinen Kontakt und eine Person äußerte Ängste vor Nachbarn.
2. Kontakte im Wohnumfeld
Bedeutsame Kontakte in ihrem direkten Wohnumfeld (z.B. mit VerkäuferInnen, Hausmeister, Friseure o.ä.) hatte nur eine Person. Hier war ein türkischer Ladenbesitzer gemeint, mit dem mehrmals die Woche ein längeres Gespräch geführt wird. Neun Personen hatten keine bedeutsamen Kontakte im Wohnumfeld.
3. Besuch von nicht gemeindepsychiatrischen Einrichtungen
Öffentliche soziale Einrichtungen allgemein (z.B. Arbeitslosentreff, Frauentreff, Stadteilcafes) wurden lediglich von einer Person ab und zu besucht, neun Personen besuchten nie eine solche Einrichtung, „ich wüsste gar nicht was es da gibt“.
4. Erfahrungen mit nichtpsychiatrischen Einrichtungen und Regeleinrichtungen
Der Arbeitslosentreff (einzige besuchte Einrichtung) wurde als „gute Möglichkeit mal andere Leute zu treffen“ beschrieben.
5. Besuch von gemeindepsychiatrischen Einrichtungen
Gemeindepsychiatrische Einrichtungen besuchten drei Personen in wöchentlichem Turnus, fünf Personen monatlich und zwei Personen ab und zu.
6. Beurteilung der gemeindepsychiatrischen Einrichtungen
Alle zehn Personen nahmen ausschließlich Angebote aus dem Kieler Fenster wahr, insbesondere die Begegnungsstätte und die Gruppenangebote. Sechs Personen beurteilten die Begegnungsstätte als gut. Einer Person ist der Treff „zu voll und zu groß, war früher besser“. Ebenfalls als empfehlenswert wurde die ambulante Ergotherapie eingestuft „sehr gut, man kann selbst entscheiden was man machen möchte und man lernt nette Leute kennen“. Die Malgruppe und die Bastelgruppe wurden ebenfalls von je einer Person mit gut bewertet.
7. Besuch einer Selbsthilfegruppe
Zwei Personen besuchten eine Selbsthilfegruppe, wobei einmal das Psychoseseminar gemeint war, welches die Person regelmäßig besuchte. Acht Personen besuchten keine Selbsthilfegruppe. Eine Person würde gerne eine Selbsthilfegruppe besuchen, findet aber keine passende.
8. Veränderungswünsche
Vier Befragte würden gerne etwas verändern, was ihre Aktivitäten in der Gemeinde anbelangt. Sechs möchten nichts verändern.
9. Unterstützung
Unterstützung durch die BetreuerInnen bezüglich eines Ausbaus ihrer Aktivitäten in der Gemeinde erhielten fünf Personen ausreichend, drei Personen eher wenig, eine Person wenig und eine Person benötigte keine Unterstützung.
10. Kontakte der BetreuerInnen im sozialen Umfeld
Neun Personen gaben an, dass ihr/e BetreuerIn keinen Kontakt zu NachbarInnen, Einrichtungen, Selbsthilfegruppen oder andern Gemeindeeinrichtungen hat bzw. aufbaut. Eine Person gab an, dass ihr/e BetreuerIn den Kontakt zu einer Gruppe (soziales Kompetenztraining) aufgebaut hat.
11. Unterstützungsbedarf
Die Hälfte gab an, dass sie mehr Unterstützung bräuchten um einen Ausbau ihrer Aktivitäten in der Gemeinde zu erzielen.
Welche Unterstützung es sein sollte wurde folgendermaßen formuliert:
Eine Person wollte lernen „wie man mit Leuten redet“ und eine andere mehr Informationen erhalten („ich weiß nicht, wo was ist und was es gibt“). Hilfe bei der Entscheidungsfindung bräuchte eine Person („sie soll schauen was für mich in Frage kommt“) und zwei Personen bräuchten mehr Begleitung. Eine Person meinte, dass mit Unterstützung die Kontakte in der Nachbarschaft ausgebaut werden könnten.
Die anderen fünf Befragten benötigten nicht mehr Unterstützung.
Leitthema 5 Freizeitaktivitäten
1. Teilnahme an sportlichen Aktivitäten
Keiner der Befragten nahm wöchentlich an sportlichen Aktivitäten im weitesten Sinn (Vereine, Sportstätten, Schwimmbädern, Saunen, Entspannungsgruppen, selbstständige sportliche Aktivitäten) teil, zwei Personen waren monatlich sportliche aktiv (jedoch alleine), zwei Personen betätigten sich ab und zu (seltener als monatlich) sportlich, wobei eine Person, die Saunabesuche nennt, angibt: „ich würde gerne öfters gehen, aber es scheitert am Geld.“ Die übrigen sechs Befragten gaben an nie Sport zu treiben, wobei vier angaben, dass sie Lust dazu hätten. „Ich würde im Sommer gerne Fußballspielen, wenn es eine Fußballgruppe gäbe“. Zwei Personen würden gerne an einer Nordic-Walking bzw. Gymnastikgruppe teilnehmen, und eine Person möchte zusammen mit anderen gerne mehr Radfahren.
2. Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen
Kulturelle Veranstaltungen (z.B. Kino, Musik, Theater auch Teilnahme an einer Theatergruppe, Chor, Tanz, Diskothek) besuchten drei Personen wöchentlich, drei Personen monatlich, zwei Personen ab und zu und zwei Personen nie. Als Grund nur selten oder nie eine kulturelle Veranstaltung zu besuchen oder selbst daran teilzunehmen wurde eine fehlende Begleitung genannt. Geäußert wurde: „alleine macht das keinen Spaß“ und „ich trau mich nicht alleine irgendwo hinzugehen“. Zwei Personen interessierten sich für einen Kulturaustausch mit „fremden“ Kulturen: „Ich würde gerne mehr mit Moslems und Türken machen, sie sind sehr freundlich“ oder „ich interessiere mich für Zigeunermusik und die Kultur von Sinti und Roma.“
3. Besuch von gastronomischen Betrieben
Eine Person besuchte wöchentlich gastronomische Betriebe (Gaststätten, Kneipen, Cafes), sechs Personen monatlich, zwei Personen ab und zu und eine Person nie. Angegeben wurde auch hier, dass sie Lust hätten z.B. häufiger in ein Cafe zu gehen, aber nicht alleine.
4. Besuch von religiösen und spirituellen Einrichtungen
Religiöse und spirituelle Einrichtungen besuchten zwei Personen wöchentlich, keine monatlich, eine Person ab und zu und sieben Personen nie. Eine Person, die regelmäßig z.T. mehrmals wöchentlich Kontakt zu einer religiösen Einrichtung hat, hat in anderen Bereichen so gut wie keine Kontakte und gibt deshalb an „ich hole meine ganze Kraft und Hoffnung aus dieser Einrichtung (die Person möchte nicht, dass die Art der Einrichtung genannt wird) und „ich bin deshalb nicht so viel alleine“. Eine Person berichtete, dass sie gerne Kontakt zu einer religiösen Einrichtung bzw. Gruppe hätte und dazu Informationen bräuchte.
5. Besuch von Bildungsveranstaltungen
Acht Personen gaben an nie Bildungsveranstaltungen wie Volkshochschulveranstaltungen, andere Fortbildungen und Kurse zu besuchen. Eine Person sagte aus, ab und zu einen Kurs besucht zu haben, und eine Person berichtete selten Bildungsveranstaltungen zu besuchen. Es wurde aber bei den acht Personen, die nie eine derartige Veranstaltung besuchten, durchaus Offenheit dafür erkennbar: „dazu hätte ich Lust, das wurde von meiner Betreuerin nie angesprochen“, „ich würde gerne in einen Sprachkurs gehen oder klöppeln“, „darauf bin ich selbst nicht gekommen, vielleicht würde ich das gerne mal versuchen“. Eine Person gab an, dass es aus Kostengründen nicht in Frage kommt.
6. Besuch von öffentlichen Vergnügungsveranstaltungen
Öffentliche Veranstaltungen wie Kieler Woche, Jahrmarkt etc. wurden von sechs Befragten ab und zu besucht, von einer Person selten und von drei Personen nie. Als Grund nie zu einer derartigen Veranstaltung zu gehen wurde angegeben: „das ist mir zuviel Trubel“ bzw. „ich mag das nicht“.
7. Politische Partizipation
Zwei Personen gaben an sich aktiv politisch zu beteiligen. Meine Fragestellung umfasste auch die politische Partizipation in der Psychiatrieszene. Eine Person gab an alleine „halböffentliche“ Infoveranstaltungen über ihre Krankheit abzuhalten z.B. für BesucherInnen der Begegnungsstätte oder für eine Gruppe von KrankengymnastInnen. Diese Person und eine andere waren jeweils aktive NutzersprecherInnen von Einrichtungen des Kieler Fensters. Sie berichteten positiv über ihre Partizipation „hier macht man was für andere“ und „man kann sich einsetzen“. Acht Personen beteiligten sich nicht aktiv und gaben meist die zusätzliche Anstrengung als Hinderungsgrund an. Eine Person gab an ab und zu bei Demonstrationen teilzunehmen, alles andere würde ihr zuviel Verantwortung bedeuten.
8. Ökologische Partizipation
Eine ökologische Partizipation, wobei z.B. die Teilnahme bei Umwelt- und Naturschutzvereinigungen gemeint ist, bejahte eine Person. Neun Personen verneinten eine Teilnahme. Zwei Personen gaben an „dazu hätte ich aber Lust“ bzw. „ich würde gerne Unterschriften sammeln.“
9. Bürgerschaftliches Engagement
Die Frage nach eigenem bürgerschaftlichem Engagement (Ehrenamt) bejahten drei Personen. Hierzu wurde jede Tätigkeit gezählt, die ab und zu unentgeltlich, ohne einen „direkten Eigennutz“, für andere verrichtet werden. Eine Person berichtete einmal monatlich eine „Kinovorführung“ in der Begegnungsstätte zu veranstalten, „ich würde das gerne noch öfters machen, weil es Spaß macht“. Zwei andere Personen halfen älteren Nachbarn beim Einkaufen und bei der Hausordnung. Sieben Personen beantworteten die Frage mit nein, wobei bei zwei Personen das Engagement als NutzersprecherIn ebenfalls als Ehrenamt gezählt werden kann. Das würde heißen, dass sich die Hälfte der Befragten im weitesten Sinn bürgerschaftlich engagieren.
10. Positive Erfahrungen im Freizeitbereich
Auf die Frage nach positiven Erfahrungen mit Aktivitäten im Freizeitbereich wurde wie folgt geantwortet:
„Ich habe sehr positive Erfahrungen mit der integrativen Theatergruppe gemacht. Man lernt Leute kennen, auch mal nicht psychisch Kranke und es macht Spaß.“
„Ich schreibe selbst und halte ab und zu Lesungen, z.T. veröffentliche ich auch Gedichte. Dies steigert mein Selbstwertgefühl und ich habe den Eindruck dabei zu sein.“
„In der Frauen-Lesbenkneipe lernt man schnell Leute kennen, die Frauen sind sehr offen.“
„Ich singe bei einem Chor für psychisch Kranke mit, das ist nett aber manchmal ist das Niveau zu niedrig.“
„Spaziergänge in der Natur tun mir gut“ bzw. „ich gehe viel und ausgiebig spazieren.“
„In meiner (religiösen) Gruppe habe ich im Moment den einzigen Rückhalt.“
„Ich habe eine Moschee besucht, das fand ich sehr schön.“
„Mit Ausländern habe ich nur gute Erfahrungen gemacht, die sind nett.“
„Die Malgruppe ist für mich unheimlich wichtig.“
11. Veränderungswünsche
Sieben Personen würden an ihrer Situation bezüglich ihrer Freizeitgestaltung gerne etwas ändern, drei Personen möchten nichts verändern.
12. Unterstützung
Eine Person wurde von der/dem BetreuerIn sehr unterstützt, drei Personen ausreichend, zwei Personen eher wenig und drei Personen wenig. Eine Person benötigte keine Unterstützung
13. Unterstützungsbedarf
Vier Personen wünschten sich mehr Unterstützung z.B. in der Form, dass Freizeitbeschäftigung öfters thematisiert wird. Sechs Personen reichte die erhaltene Unterstützung aus.
14. Wünsche
Auf die Frage, welche Aktivität sie gerne mal ausprobieren würden, wurden die folgenden Aussagen gemacht.
„Ich würde gerne in die Disco gehen, aber alleine trau ich mich nicht.“
„Zu einer türkischen Hochzeit gehen.“
„Ich möchte alles ausprobieren.“
„Sport“
„mehr Sport treiben“
„Gymnastikgruppe“
„Kanufahren, aber mit Begleitung“
„bei attac in der Pumpe mal dabei sein und zuhören, ich trau mich aber nicht alleine“.
Leitthema 6: Finanzielle Verhältnisse
1. Einkommen
Neun Befragte hatten ein Einkommen von unter 500 € (abzüglich Miete und Heizkosten) zur Verfügung, eine Person hatte zwischen 500€ und 650€.
2. Einschränkung durch niedriges Einkommen
Durch die finanziellen Verhältnisse fühlten sich die Hälfte in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe sehr stark eingeschränkt, eine Person ziemlich, drei Personen wenig eingeschränkt. Nur eine Person fühlte sich nicht eingeschränkt.
Leitthema 7: Sonstige Fragen
1. Verwendete Betreuungszeit zur Integrationsförderung
Drei Personen gaben an, dass 75 % der Betreuungszeit für das Leitziel Integration im umfassenden Sinn (Unterstützung in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Soziale Kontakte, Freizeitgestaltung, Leben in der Gemeinde) verwendet wird. Bei vier Personen umfasste das Thema ca. die Hälfte der Betreuungszeit, bei zwei Befragten ca. ein Viertel der Zeit und bei einer Person weniger.
2. Primär gewünschtes und wichtigstes Thema in der Betreuung
Vier Personen berichteten, dass Ihnen das Besprechen ihrer psychischen Erkrankung und Probleme sowie die Unterstützung der therapeutischen Arbeit in der Betreuungsarbeit am wichtigsten ist. Ebenso viele Personen fanden das Leitziel Integration am wichtigsten. Für zwei Personen waren enge Gespräche und Vertrauen der wichtigste Bereich in der Betreuung.
3. Von den Befragten eingeschätztes wichtigstes Ziel der BetreuerIn
Welches das wichtigste Ziel ihrer/ihres BetreuerIn/s sein könnte, wurde folgendermaßen eingeschätzt: Zwei Personen schätzten, dass Integration das wichtigste Ziel der/des BetreuerIn/s sei, sechs schätzten es so wichtig wie die anderen Ziele ein, und zwei Personen gaben an, dass sie glauben, es sei der/dem BetreuerIn weniger wichtig als die anderen Ziele.
4. Begleitung durch Ehrenamtliche oder PraktikantInnen
Eine Beleitung durch Ehrenamtlichen oder PraktikantInnen hielten sechs Personen für sehr wünschenswert und gut vorstellbar. Drei Personen gaben an eine solche Begleitung nicht zu benötigen. Eine Person verneinte die Frage, ob sie eine Begleitung von Ehrenamtlichen etc. wünschenswert findet.
5. Subjektives Gefühl der sozialen Integration
Insgesamt gesehen fühlen sich drei Personen gut in die Gesellschaft integriert, drei Personen mäßig, drei Personen nicht so gut und eine Person schlecht.
6. Vorliegende Gründe der unzureichenden Integration bzgl. der eigenen Person
Die Gründe, warum sich die Personen nicht „gut“ integriert fühlen und integrieren können, hatte in sieben Fällen mit Angst und Misstrauensgefühlen zu tun, sieben Personen gaben ein niedriges Selbstbewusstsein/Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen an, sechs Personen nannten finanzielle Gründe. Häufig wurde Müdigkeit/Erschöpfung, Schamgefühle und Schüchternheit angegeben. Bei zwei Personen spielten die fehlende Mobilität sowie Probleme bei der Beschaffung von Informationen über Angebote eine Rolle. Genannt wurden außerdem Interesselosigkeit, Frust, Stimmenhören und die Angst davor andere Leute zu belästigen.
7. Vorliegende Gründe der unzureichenden Integration, die in der Umwelt liegen
Die in der Umwelt liegenden Integrationsbarrieren d.h. durch die Gesellschaft und strukturelle Bedingungen verursacht werden, erlebten die nicht „gut“ integrierten Personen wie folgt: Vier Personen gaben an sich stigmatisiert und diskriminiert zu fühlen, von fünf Personen wurde Desinteresse, Unsicherheit und Ablehnung bei Mitmenschen erlebt. Strukturell gesehen beklagten mehrere Personen ein mangelndes Angebot an integrativen Angeboten sowie an öffentlichen Regelangeboten im Allgemeinen.
8. Wünsche zu Integration
Die Wünsche und Vorschläge der einzelnen Befragten , bezüglich Integration wird in kurzen Worten zitiert:
„Eine Integrationsgesellschaft ist aber Utopie, hier ist es faschistisch und rassistisch, man müsste eben auswandern.“
„Ich möchte nicht mehr soviel Kontakt zu psychisch Kranken, vor allem nicht in der Arbeit, das schadet mir und stresst mich. Ich möchte in einer „normalen“ Putzfirma mit normalen Leuten arbeiten, vielleicht mal ein psychisch Kranker dazwischen.“
„Ich führe ein Nischendasein und habe mich damit arrangiert, ich wünsche mir nichts, das ist unrealistisch.“
„Ich wünsche mir mal wieder einen Urlaub, um mich zu erholen, so wie andere Leute es auch haben.“
„Ich wünsche mir, dass psychisch Kranke besser behandelt werden.“
„Ich wünsche mir Arbeit und mehr Geld, und mehr Leute die ich kenne, und dass die Grenze zwischen normal und unnormal weniger wird.“
7.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung kurz zusammengefasst und interessante Erkenntnisse herausgestellt.
Wohnen
Der Stadtteil Gaarden (Sozialer Brennpunkt) erwies sich als ungünstig und angstauslösend, und war ebenso wie das Wohnen in einem Hochhaus für die Unzufriedenheit verantwortlich. Acht von zehn Personen wohnten alleine, wobei drei gerne zu mehreren wohnen würden und ebenfalls drei Personen mehr Unterstützung in diesem Bereich bräuchten.
Arbeit/Beschäftigung
Keiner der Befragten verfügte über ein „normales“ sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Lediglich eine Person hatte einen Minijob, allerdings auch im Kieler Fenster. Keiner der Befragten hatte mit den ArbeitskollegInnen außerhalb der Arbeitszeit regelmäßig Kontakt, wobei fast die Hälfte gerne mehr Kontakt hätte. Die Hälfte der Befragten würde an ihrer Arbeitssituation gerne etwas verändern und hätte gerne einen Arbeitsplatz auf dem Ersten Arbeitsmarkt. Drei Personen bräuchten mehr Unterstützung in diesem Bereich.
Soziale Kontakte
Neun von zehn Personen hatten keine/n feste/n PartnerIn, wobei sich die Hälfte davon eine feste Partnerschaft wünscht. Niemand hatte eine eigene Familie gegründet. Zwei Personen hatten zu keinem aus der Herkunftsfamilie Kontakt. Der engste Kontakt zur Familie bestand zu Geschwistern, zu den Eltern hatten nur zwei regelmäßigen Kontakt. Fast die Hälfte empfand ihre familiäre Situation als unbefriedigend.
Drei Personen gaben an keinen engen oder regelmäßigen freundschaftlichen Kontakt zu Mitbetroffenen zu haben und vier gaben an, dass sie ihre Kontakte innerhalb der Psychiatrieszene gerne aus- bzw. aufbauen wollten. Die Hälfte der Befragten hatte keinen regelmäßigen freundschaftlichen Kontakt zu Nichtbetroffenen, wobei neun Befragte diesen Kontakt aus- bzw. aufbauen möchten. Vier gaben an bzgl. ihrer Sozialkontakte eher wenig oder wenig Unterstützung zu erhalten, wobei nur drei mehr Unterstützung wünschten. Lediglich ein Fünftel war mit seinen sozialen Kontakten zufrieden.
Keine der BetreuerInnen hatte regelmäßig Kontakt zur Familie oder Freunden.
Aktivitäten in der Gemeinde
Vier von zehn gaben an über stabile nachbarschaftliche Hilfe zu verfügen. Nur von einer Person wurden soziale Regeleinrichtungen genutzt. Gemeindepsychiatrische Einrichtungen wurden von allen regelmäßig bzw. ab und zu besucht, jedoch ausschließlich Einrichtungen des Kieler Fensters. Eine Selbsthilfegruppe besuchten lediglich zwei Personen. Vier Personen erhielten „eher wenig“ bzw. „wenig“ Unterstützung und die Hälfte der Befragten gab an mehr Unterstützung zu benötigen, um eine Veränderung zu erzielen. Neun Personen gaben an, dass ihrer BetreuerInnen keinen Kontakt zu Personen oder Einrichtungen aus der Gemeinde hat.
Freizeitaktivitäten
Acht der Befragten betrieben nie oder seltener als einmal im Monat Sport bzw. Maßnahmen zur körperlichen Gesunderhaltung. Ebenfalls acht besuchten nie eine Bildungsveranstaltung. Politisch und ökologisch aktiv beteiligten sich eine Person bzw. zwei der Befragten. Sieben Personen würden ihre Freizeitsituation gerne verändern. Die Hälfte gab an, wenig oder eher wenig unterstützt zu werden, und vier wünschten sich mehr Unterstützung.
Finanzielle Situation
Sechs der Befragten gaben an durch ihre finanzielle Situation ziemlich bis sehr stark eingeschränkt zu sein.
Sonstiges
Durchschnittlich die Hälfte der Betreuungszeit wurde für die abgefragten Bereiche aufgewendet. Für sechs der zehn Befragten waren die Themen „psychische Erkrankung und persönliche Gespräche“ am wichtigsten, vor den Bereichen, die eine bessere Integration (direkt) zum Ziel haben. Eine Begleitung und Mitarbeit durch Ehrenamtliche konnten sich sechs von sieben Personen für sich gut bis sehr gut vorstellen.
Drei Personen fühlten sich gut in die Gesellschaft integriert, knapp drei Personen mäßig, und vier Personen nicht gut. Der am häufigsten genannte Grund, was Integration auf der persönlichen Seite verhindert bzw. einschränkt waren Ängste und Misstrauen, gefolgt von niedrigem Selbstbewusstsein (Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl). Vier Personen fühlten sich stigmatisiert und diskriminiert, und fünf Personen beklagten Desinteresse und Unsicherheit bei Mitmenschen.
7.2.6 Schlussfolgerungen für den Arbeitskreis Integration und Perspektiven für die sozialpädagogische Betreuungsarbeit in der Gemeindepsychiatrie
In Punkt 7.1.3 wurden bereits erforderliche Konsequenzen für die gemeindepsychiatrische Arbeit im Kieler Fenster vorgeschlagen. Diese Handlungsschritte können durch die vorgenommene empirische Untersuchung alle unterstützt und bestätigt werden. Durch die Ergebnisse der Interviews konnten einige weitere Konsequenzen zur Verbesserung einer integrationsfördernden Betreuungsarbeit erzielt werden.
Die Untersuchung zeigt, dass eine unbefriedigende Wohnsituation wie das Wohnen in einem subjektiv empfundenen beängstigendem Stadtteil, oder eine angstauslösende Wohnung, sowie ungewolltes „Alleine wohnen“ eine Integration in das Gemeinwesen (in das Haus, in den Stadtteil) grundsätzlich blockieren kann. Die Zufriedenheit mit Wohnung, Stadtteil und spezieller Wohnsituation gehört zu den elementaren Voraussetzungen und Bedingungen für eine mögliche Integration bzw. Inklusion und ist bei der gemeindepsychiatrischen Betreuung gewichtig zu berücksichtigen.
Sowohl für die Suche nach Beschäftigung in einer gemeindepsychiatrischen Einrichtungen, als auch bei der Suche von Arbeit auf dem Ersten Arbeitsmarkt ist für einige Betroffene gesteigerte Hilfe erforderlich. Die konkrete Unterstützung bei der Suche von Arbeit könnte auch in Gesprächen mit potentiellen ArbeitgeberInnen liegen, also einer intensiven Gemeinwesenarbeit entsprechen.
Ein weiterer Wunsch einiger Befragter war der Ausbau von Kontakten mit den ArbeitskollegInnen außerhalb der Arbeitszeit. Eine strukturelle Verbesserung könnte hier von den Werkstätten selbst ausgehen, beispielweise mit dem Initiieren eines regelmäßigen Stammtisches oder anderer gemeinsamer Aktionen. Die meisten Personen, die einer Beschäftigung nachgingen, schilderten ihre Beschäftigungssituation als zufriedenstellend, das spricht für die Beschäftigung in gemeindepsychiatrischen Einrichtungen. Allerdings hatten die Hälfte der Personen als Ziel die Wiedereingliederung in den Ersten Arbeitsmarkt, unter anderem um unabhängiger von sozialen Leistungen zu sein und ein Leben oberhalb der „relativen“ Armutsgrenze führen zu können.
Bei den sozialen Kontakten besteht Unterstützungsbedarf sowohl in dem Ausbau der familiären als auch der freundschaftlichen bzw. partnerschaftlichen Kontakte, vor allem mit nicht psychisch kranken Personen, aber auch mit Mitbetroffenen. Eine Form der Unterstützung wäre vermehrte Angehörigenarbeit und Angehörigenunterstützung (auch mit FreundInnen und PartnerInnen), die fester Bestandteil des gemeindepsychiatrischen Konzeptes ist und ebenso Vorraussetzung für eine gelungene Integration ist, jedoch von keiner/keinem BetreuerIn nach Aussage der Befragten erfolgte. Eine weitere Möglichkeit besteht im Einsatz von Ehrenamtlichen, der ebenfalls fest zum gemeindepsychiatrischen Konzept gehört.
Nur zwei Personen waren mit ihren sozialen Kontakten zufrieden, dies muss ernstgenommen und verbessert werden. Überraschend war der häufig positive nachbarschaftliche Kontakt.
Durch eine verstärkte Zusammenarbeit und Miteinbeziehung sozialer Regeleinrichtung kann zum einen das Angebot für KlientInnen erhöht werden, und zum anderen gibt es dort die Möglichkeit andere, nicht psychisch erkrankte Menschen zu treffen.
Im Sinne des Empowermentprinzipes, wäre es für viele Betroffene günstig eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. In den Interviews wurde deutlich, dass z.T. falsche Erwartungen und große Vorbehalte gegenüber solchen Gruppen bestehen, z.B. die Angst sich noch mehr Probleme aufzuladen, während die Vorteile der Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, wie der Austausch gemeinsamer Erfahrungen, gegenseitige Solidarität und Hilfe sowie Verständnis und soziale Kontakte kaum deutlich wurden.
Ein Ausbau der Gemeinwesenarbeit und Netzwerkarbeit ist im Bereich der „Aktivitäten in der Gemeinde“ eine gute und unerlässliche Möglichkeit um eine potentielle Integration zu verbessern. Hier geht es um eine bessere Kenntnis über den Stadtteil und die dortigen potentiellen Teilhabemöglichkeiten, sowie die Herstellung von Kontakten innerhalb der Gemeinde.
Erforderlich sind darüber hinaus die Unterstützung bzw. vermehrte Angebote zur Aufnahme von sportlichen bzw. körperlichen Aktivitäten. Auch von Seiten der Betroffenen wurde diesbezüglich große Offenheit und Interesse sichtbar und konkrete Wünsche geäußert. Sportliche Aktivitäten, vor allem in der Gruppe, sind sowohl sozial gesehen bedeutungsvoll, als auch im Sinne einer ganzheitlichen Sichtweise von Gesundheit und Krankheit (häufig besteht schon eine Komorbidität) enorm wichtig. Der Vorschlag des Arbeitskreises Integration „Mittelsmänner“ in Sportvereinen oder ähnlichen Einrichtungen zu gewinnen, sollte ebenso verfolgt werden wie gegebenenfalls weitere „sportliche“ gemeindepsychiatrische Angebote zu initiieren. Auch der Einsatz von Ehrenamtlichen / PraktikantInnen als Begleitungen ist zu empfehlen.
Ebenso kann eine Steigerung der Beteiligung an Bildungsangeboten zu einer besseren Integration und Partizipation der Betroffenen führen. In Frage kommen hier zuerst die Inanspruchnahme von Regelangeboten, als auch von vorhandenen integrativen Angeboten (z.B. an der Volkshochschule) ,sowie Angebote in gemeindepsychiatrischen Einrichtungen um gewisse Kompetenzen zu erlernen, die wiederum für eine Teilnahme eines „normalen“ Bildungsangebot erforderlich sind (z.B. die Überwindung von Angst und Schüchternheit, Durchhaltevermögen). Die Offenheit der Interviewten gegenüber einer Einbeziehung von Ehrenamtlichen war deutlich. Das sollte zum Anlass genommen werden die Ehrenamtsarbeit gemäß den gemeindepsychiatrischen Grundsätzen auszubauen und somit die Erfolge der gemeindepsychiatrischen Betreuung und der Lebensqualität jeder/s Einzelnen zu erhöhen.
Für die Mehrheit der Befragten waren Gespräche über ihre psychischen Erkrankung sowie enge Gespräche in der Betreuungsarbeit insgesamt wichtiger als „integrationsfördernde“ Maßnahmen. Unumstrittener Weise ist die Bedeutung der psychischen Erkrankung mit ihren (auch und insbesondere sozialen) Auswirkungen, ihren Krisen, dem möglichen Bewältigungsverhalten usw. in der sozialen Arbeit mit psychisch kranken Menschen eminent wichtig und zentraler Bestandteil der Betreuungsarbeit. Jedoch muss die Rolle und Funktion der sozialen Arbeit klar sein und darf nicht zu einer pseudopsychotherapeutischen Arbeit und überwiegenden Beziehungsarbeit verwischen. Möglicherweise ist in einigen Fällen eine kompetente zusätzliche psychotherapeutische bzw. ärztlich-psychiatrische Versorgung notwendig und gegebenenfalls auch effektiver oder der Versuch der Wiederherstellung eines sozialen Netzwerkes, indem vertrauensvolle Mitmenschen als verständnisvolle GesprächspartnerInnen fungieren.
Angstgefühle und ein niedriges Selbstbewusstsein sind sowohl Ursachen von ungenügender sozialer Inklusion als auch Folgen von fehlenden sozialen Kontakten und sozialem Rückzug, entsprechend einer Abwärtsspirale, die durchbrochen werden muss. Durch eine intensive Integrationsarbeit beispielweise in Form von sozialer Gruppenarbeit und sozialen Kompetenztraining kann versucht werden diesen Aufschaukelungsprozessen entgegen zu wirken. Knapp ein Drittel der Befragten bräuchte mehr Unterstützung in den aufgeführten Bereichen, um seine soziale Integration verbessern zu können, dieser Wunsch ist in der sozialpädagogischen Betreuungsarbeit zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Interviews bestätigen, dass die Soziale Arbeit auch in der Gemeindepsychiatrie als Menschenrechtsprofession und Anwaltschaft für psychisch kranke Menschen außerordentlich wichtig ist. Die massiven finanziellen Einschränkungen für Menschen mit Behinderungen und die dadurch entstehenden reduzierten Teilhabemöglichkeiten müssen ernst genommen werden. Politische Arbeit (Einmischung), Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere Antistigmaarbeit, Initiierung von Sozialsponsoring oder Spendenaufrufe sind neben vielem anderen mögliche Interventionsmöglichkeiten.
Um auf die Ausgangshypothese zurückzukommen ist festzustellen, dass die Selbsteinschätzung der eigenen Situation besser ist als es die Ergebnisse und Rückschlüsse der gestellten Fragen zulassen würden. Immerhin fühlen sich drei der zehn Personen gut integriert und nur vier eher schlecht. Was die sozialpädagogischen Methoden anbelangt so wird die aufgestellte Hypothese weitestgehend verifiziert.
8 Zusammenfassung und Fazit
Ziel der vorliegenden Arbeit war die soziale Integration psychischer kranker Menschen sowie die Möglichkeiten und Verbesserungen der Unterstützung durch sozialpädagogische Handlungsschritte näher zu erörtern. An das Thema wurde von verschiedenen Seiten herangegangen um dadurch die Dimensionen und Auswirkungen von sozialer Integration bzw. Ausgrenzung herauszuheben.
Dank der Psychiatriereform Ende der 1970er Jahre änderte sich die psychiatrische Versorgung in der BRD grundlegend und es entstanden gemeindepsychiatrische Versorgungsstrukturen, wodurch die Lebenslage psychisch kranker Menschen entscheidend verbessert wurde. Ein großer Teil der Betroffenen lebt in eigenen Wohnungen zwar räumlich integriert in die Gemeinde, dennoch fühlen sich viele von ihnen nicht sozial integriert. Das gemeindepsychiatrische Konzept konnte nicht in der Weise umgesetzt werden, wie es ursprünglich gefordert war und nötig gewesen wäre. Die Gemeinde selbst wurde nur unzureichend einbezogen oder ließ sich nur unzureichend miteinbeziehen, sodass heute eher von einer gemeindenahen psychiatrischen Versorgung durch Institutionen gesprochen werden kann als von einer Gemeindepsychiatrie, in der der psychisch kranke Mensch (aktives) Mitglied der Gemeinde ist und am gesellschaftlichen Gemeindeleben teilnimmt.
Soziologische und pädagogische Definitionen des Begriffes Integration fordern immer eine gegenseitige Annäherung und keine einseitige Anpassung des ausgegrenzten Menschen an die Gesellschaft, im Sinne einer Assimilation. Seit mehreren Jahren hat deshalb auch der konkretere Terminus „Inklusion“ den Integrationsbegriff abgelöst bzw. ergänzt. Unter Inklusion wird zum einen eine erforderliche gesellschaftliche Veränderung verstanden und zum anderen, dass in der heutigen individualisierten und pluralisierten Gesellschaft jeder Mensch nur in bestimmte Lebenswelten und Teilsystemen integriert sein kann. Eine Exklusion aus wesentlichen Teilsystemen wie Arbeit kann jedoch Ausschlüsse in anderen Teilsystemen nach sich ziehen und somit zu enormen Ausgrenzungsprozessen führen, wie es bei Menschen mit psychischen Erkrankungen festzustellen ist. Eine Inklusion beschränkt auf den Psychiatriebereich kann ebenfalls nachteilige Folgen haben.
Die rechtlichen Voraussetzungen für eine soziale Integration von behinderten Menschen sind vorhanden, hier wurden in den letzten Jahren viele Verbesserungen erzielt und Grundlagen geschaffen. Die Implementierung dieser Gesetze ist jedoch in unbefriedigender Art und Weise erfolgt. Große Teile der Gesellschaft scheinen daran kein Interesse zu haben und auch keine Verpflichtung zu sehen, dies wird u.a. sichtbar bei den vielen Arbeitgebern, die keine Menschen mit Behinderungen einstellen. Auch die EU-Kommission appelliert an die Staaten die Ausgrenzungen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind, zu begrenzen.
Psychische Erkrankungen und Behinderungen nehmen in unserer Gesellschaft zu. Die Betroffenen sind stärker als körperlich Erkrankte durch Beeinträchtigungen in ihren sozialen Fähigkeiten gekennzeichnet und sind deshalb auf Unterstützung durch ein soziales Netzwerk angewiesen. Mit dem Auftreten einer chronischen psychischen Erkrankung sind der soziale Abstieg, Arbeitslosigkeit, Armut und Isolation fast immer vorprogrammiert.
In der Gesellschaft existieren nach wie vor negative Einstellungen und massive Vorurteile gegenüber psychisch kranken Menschen, die u.a. von vielen Massenmedien verstärkt werden. Dies führt zu einer Stigmatisierung dieser Personengruppe mit den Folgen der sozialen Ausgrenzung und Isolation und dadurch zu Verstärkung des abweichenden Verhaltens aufgrund sozialer Zuschreibungsprozesse. Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen ist einer der Hauptursachen für eine verhinderte soziale Integration.
Vorhandene soziale Einstellungen und Vorurteile sind grundsätzlich schwer zu verändern, es gibt jedoch Möglichkeiten einer positiven Beeinflussung. Durch Information und Aufklärung auf der einen Seite verbunden mit der Möglichkeit von gleichberechtigten Kontakten mit psychisch Kranken können Stigmatisierungen abgebaut werden. Durch Antistigmakampagnen kann eine höhere Akzeptanz, Toleranz und Solidarität erreicht werden. Effektiver ist die Antistigmaarbeit jedoch, wenn Betroffene selbst in einer Antistigmakampagne von unten mitwirken. Hierzu zählen Öffentlichkeitsarbeit durch Projekte in Schulen und Psychoseseminaren, bei denen sowohl Erkrankte als auch Angehörige und Professionelle beteiligt werden.
Verschiedene sozialpädagogische Konzepte sind geeignet insbesondere die Integration in der gemeindepsychiatrischen Betreuungsarbeit zu verbessern und somit den Zielsetzungen der Gemeindepsychiatrie näher zu kommen und die Lebenslage der Betroffen zu verbessern. Eingegangen wurde auf das Empowermentkonzept, wobei besonderer Wert auf die Bedeutung von Selbsthilfegruppen gelegt wurde, sowie auf das Konzept der Netzwerkorientierung. Die Gemeinwesenorientierung ist fester und unerlässlicher Bestandteil der gemeindepsychiatrischen vor allem sozialpädagogischen Arbeit. Durch neue Konzepte in der Gemeinwesenarbeit wie Community Care und Community Living sowie einer Förderung des bürgerschaftliche Engagements könnten entscheidende Fortschritte in der Integration erzielt werden. Die Lebensweltorientierung wurde ebenfalls als integratives Handlungskonzept vorgestellt.
Alle diese Konzepte beinhalten im Kern eine Hinwendung zur sozialpädagogischen Arbeit mit der Umwelt der Betroffenen und eine Abwendung einer vorwiegend individuumszentrierten Tätigkeit. Dies ist in Anbetracht des Rückzugs des Sozialstaats in den letzten Jahren erforderlich. Soziale Arbeit sollte die soziale Integration (wieder) als zentralen Bestandteil der Arbeit aufnehmen und sich abwenden von Separierungen und dem Therapieren von abweichendem Verhalten. Denn die Sozial- bzw. Gemeindepsychiatrie kann letztlich nur durch eine psychiatrische Sozialpädagogik und ihre (geeigneten) Handlungskonzepte umgesetzt werden.
Schließlich wurde im letzten Punkt der Arbeit Bezug genommen auf die konkrete Integrationsförderung in einer gemeindepsychiatrischen Einrichtung. Hier wurde durch eine kleinere empirische Untersuchung in Form von Interviews die behandelte Problematik in der praktischen Arbeit dargestellt und verdeutlicht. Auch an dieser Stelle wurde offensichtlich, dass viele NutzerInnen der Institution von wesentlichen Teilsystemen der Gesellschaft ausgeschlossen sind, insbesondere aus dem System Arbeit. Die sozialpädagogische Unterstützung im Hinblick auf die Förderung von Inklusion in einzelne Teilbereiche wie beispielweise Arbeit, Wohnen, Familie, Gemeinde, und Aktivitäten wurde von knapp einem Drittel der Befragten als nicht ausreichend angegeben. Die gewonnen Erkenntnisse sollten zum Anlass genommen werden, die gemeindepsychiatrische Betreuungsarbeit zu reflektieren und vermehrt originäre sozialpädagogische Ansätze in die Arbeit einzubringen, um zum einen die soziale Integration zu verbessern und zum anderen dazu beizutragen Stigmatisierung abzubauen.
Fazit
30 Jahre nach der Psychiatrie-Enquête sind für psychisch kranke Menschen wesentliche Verbesserungen erzielt worden, hieran besteht kein Zweifel. Der Auf- und Ausbau der gemeindepsychiatrischen Versorgungsstrukturen in Form von Begegnungsstätten, Ambulant Betreutem Wohnen und betreuten Wohngemeinschaften, Tageskliniken, psychiatrischen Institutsambulanzen, Einrichtungen der Beruflichen Rehabilitation usw. sind zumindest in den alten Bundesländern und in den städtischen Gebieten gut vorangeschritten und gelungen. Dies brachte für die Betroffenen erhebliche Verbesserungen. So gesehen sind die Betroffenen „ganz gut versorgt“. Doch gemeindepsychiatrische Versorgungsstrukturen sind nicht identisch mit einer wirklichen Gemeindepsychiatrie, in der die Betroffenen integriert in ihrer Gemeinde leben und sowohl von dieser unterstützt werden als auch ihren Beitrag zum Gemeindeleben leisten (dürfen/können). Dieses Merkmal von Gemeindepsychiatrie konnte nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden. Eine Gemeindepsychiatrie ohne Bürgerbeteiligung funktioniert nicht und ohne Bürgernähe kann keine Gemeindenähe entstehen. Die Zukunft sozialpädagogischer gemeindepsychiatrischer Arbeit ist also genau hier anzusetzen, um weiteren z.T. von professioneller Seite selbst produzierten Separierungen entgegenzuwirken. SozialarbeiterInnen sind die ExpertInnen für die Förderung und Umsetzung des Integrationszieles und ein Großteil der MitarbeiterInnen im sog. gemeindepsychiatrischen Komplementärbereich ist aus dieser Berufsgruppe. Die vorgeschlagenen Handlungskonzepte wie Empowerment, Netzwerkorientierung, Gemeinwesenarbeit und Lebensweltorientierung bieten hier geeignete Ansatze, um Inklusion zu fördern und weiteren Exklusionsprozessen entgegenzuwirken. Öffentlichkeitsarbeit und effektive Antistigmaarbeit zusammen mit den Betroffenen und ihren Angehörigen sind ebenfalls unverzichtbare Bestandteile einer gelingenden Gemeindepsychiatrie, in der integrationsverhindernde Vorurteile der Gesellschaft zugunsten einer solidarischen Haltung aufgegeben werden. SozialpädagogInnen müssen sich in der Gemeinde, der von ihnen betreuten Personen auskennen; sie sollten deren Umfeld möglichst gut kennen um hier Netzwerke aufzubauen und zu stabilisieren. Intensive Kontakte zu kommunalpolitischen Einrichtungen als auch zu soziokulturellen und Gesundheitsorganisationen, zu ArbeitgeberInnen und Firmen, zu Vereinen, Kirchen, Schulen usw. sind als Grundlage für gemeinwesenorientierte Konzepte unerlässlich. So kann m.E. nach nur eine Schwerpunktverlagerung in der gemeindepsychiatrischen Betreuungsarbeit nachhaltige Verbesserungen für die Betroffenen erzielen, hin zur Einbeziehung der Gemeinde und der dort vorhandenen Strukturen. Sie sollte sich wegorientieren von der individuumszentrierten und auf Beziehungsarbeit konzentrierten Arbeitweise und auf den Ausbau weiterer aussondernder Spezialeinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen verzichten.
In Anbetracht der erfolgten und noch bevorstehenden Kürzungen im Sozialbereich sowie einer wieder zunehmenden Dominanz der medizinischen Sichtweise von psychiatrischen Erkrankungen und daraus resultierenden Stärkung der ärztlichen Behandlung, als auch einer anhaltenden angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt und der damit verbundenen Ausgrenzungsprozessen bleiben Zweifel an der Möglichkeit der Umsetzung von Integration. Die derzeitigen politischen Diskussionen in den Medien über die Integration von MigrantInnen in Zusammenhang mit Einbürgerungstests, Gewalt und Bedrohung durch MigrantInnen und dem Schüren von Vorurteilen durch die Bundesregierung und die Landesregierungen selbst lässt mich ebenfalls daran zweifeln, „dass es normal ist verschieden zu sein“. Zumindest wird dies nicht durchweg politisch unterstützt und getragen. Toleranz und Solidarität von politischer Seite gegenüber allen von Ausgrenzung bedrohten Personengruppen sind Voraussetzung dafür, dass sich auch das gesellschaftliche Klima positiv verändern kann. Personen, die die erwarteten Leistungen nicht erfüllen können - und zu denen zählen in hohen Maße kranke Menschen - sind davon besonders bedroht. Umso mehr ist es deshalb erforderlich, dass sich Soziale Arbeit (wieder) politisch und gesellschaftlich einmischt und sich stark macht für die von Exklusion bedrohten Personengruppen, um dadurch existente und erkämpfte Rechtsansprüche und Grundrechte wie die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für die Betroffenen nicht zu untergraben und nicht wie in „vorsozialstaatlichen“ Zeiten Menschen mit abweichenden Verhalten und Randgruppen „professionell“ zu separieren.
Zunächst bieten Zukunftswerkstätten, Fortbildungen und Workshops für die MitarbeiterInnen von gemeindepsychiatrischen Einrichtungen Möglichkeiten um angewandte Arbeitweisen zu hinterfragen, und dahingehend anzupassen die Integration von psychisch kranken Menschen als Hauptbestandteil des gemeindepsychiatrischen Konzeptes intensiv zu fördern, zu unterstützen und in den Mittelpunkt zu rücken. Denn genau das ist die zentrale Aufgabe von Sozialer Arbeit in der Gemeindepsychiatrie.
Literaturverzeichnis
Ansen, Harald. 2002. „Neuere Handlungsansätze in der psychiatrischen Sozialpädagogik“. In: Soziale Arbeit 51 (7), S. 242-250.
Antor, Georg / Bleidick, Ulrich (Hrsg.). 2001. Handlexikon der Behindertenpädagogik. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
Badry, Elisabeth / Knapp, Rudolf / Hans-Gerhard, Stockinger. 2002. Arbeitshilfen für Studium und Praxis der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4. Aufl. Neuwied, Kriftel: Luchterhand.
Blanke, Uwe. 1995. „Rahmenbedingungen von Sozialarbeit in Psychiatrie und Gesundheitswesen“. In: Blanke, Uwe (Hrsg.). Der Weg entsteht beim Gehen: Sozialarbeit in der Psychiatrie. Bonn: Psychiatrie-Verlag. S. 149-167.
Bleidick, Ulrich. 2001. „Abweichendes Verhalten“. In: Antor, Georg / Bleidick, Ulrich (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer. S. 173-176.
Bock, Thomas. 2000. „Gemeinsam gegen Vorurteile“. In: Soziale Psychiatrie 24 (4), S. 16-18.
Bock, Thomas / Weigand, Hildegard (Hrsg.). 1996. Hand-werks-buch Psychiatrie. 3. Aufl. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Bock, Thomas / Weigand, Hildegard (Hrsg.). 2002. Hand-werks-buch Psychiatrie. 5. Aufl. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Böhnisch, Lothar. 1994. Gespaltene Normalität: Lebensbewältigung und Sozialpädagogik an den Grenzen der Wohlfahrtsgesellschaft. Weinheim, München: Juventa.
Bosshard, Marianne / Ebert, Ursula / Lazarus, Horst. 2001. Sozialarbeit und Sozialpädagogik in der Psychiatrie: Lehrbuch. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Bremer, Fritz / Hansen, Hartwig / Blume, Jürgen (Hrsg.). 2001. Wie gehts uns denn heute? Sozialpsychiatrie zwischen alten Idealen und neuen Herausforderungen. Neumünster: ParanuS.
Bullinger, Hermann / Nowak, Jürgen. 1998. Soziale Netzwerkarbeit: Eine Einführung. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte, e.V. (Hrsg.). 2003. Die Rechte behinderter Menschen und ihrer Angehörigen. 31. Aufl. Bad Homburg: BAGH.
Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.). 1988. Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur Reform der Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeutischen/psychosomatischen Bereich auf der Grundlage des Modellprogramms der Psychiatrie der Bundesregierung. Bonn: BMJFFG.
Clausen, Jens / Dresler, Klaus-D. / Eichenbrenner, Ilse. 1997. Soziale Arbeit im Arbeitsfeld Psychiatrie. 2. Aufl. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Cloerkes, Günther. 2001. „Stigma, Stigmatisierung“. In: Antor, Georg / Bleidick, Ulrich (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer. S. 218-219.
Cloerkes, Günther / Markowetz, Reinhard. 1997. Soziologie der Behinderten: Eine Einführung. Heidelberg: Winter.
Crefeld, Wolf. 2003. „Ein neues Selbstbewusstsein tut Not! Die Rolle der Sozialarbeit in der Gemeindepsychiatrie“. In: Soziale Psychiatrie 27 (2), S. 26-29.
Crefeld, Wolf. 2005. „Psychiatrische Sozialarbeit - Realität, Utopie oder Programm?“ In: psychosozial 28 (3), S. 59-66.
Dachverband Psychosozialer Hilfsvereinigungen e.V. (Hrsg.). 1999. „Was nichts kostet, ist unbezahlbar!“: Bürgerhilfe in der Psychiatrie - europäische Perspektiven. Tagungsdokumentation. Irsee: Dachverband Psychosozialer Hilfsvereinigungen e.V.
Deutscher Verein (Hrsg.). 2002. = Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Fachlexikon der sozialen Arbeit. 5. Aufl. Stuttgart, Köln: Kohlhammer.
Dörner, Klaus. 2002. „Ende der Veranstaltung“. In: Siemen, Hans-Ludwig (Hrsg.): GeWOHNtes Leben-Psychiatrie in der Gemeinde. Neumünster: Paranus. S. 48-66.
Dörner, Klaus. 2003. „Community Care vom Bürger her“. In: Soziale Psychiatrie 27 (2), S. 38-39.
Dörner, Klaus / Plog, Ursula. 1996. Irren ist menschlich. Bonn: Psychiatrie Verlag.
Dörr, Margret. 2005. Soziale Arbeit in der Psychiatrie. München: Reinhardt.
Eikelmann, Bernd. 1998. Sozialpsychiatrisches Basiswissen: Grundlagen und Praxis. 2. Aufl. Stuttgart:
Eikelmann, Bernd / Reker, Thomas / Richter, Dirk. 2005. „Zur sozialen Exklusion psychisch Kranker - Kritische Bilanz und Ausblick“. In: Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie 73 (11), S. 664-673.
Eikelmann, Bernd / Zacharias-Eikelmann, Barbara / Richter, Dirk / Reker, Thomas. 2005. „Integration psychisch Kranker: Ziel ist Teilnahme am „wirklichen“ Leben“. In: Deutsches Ärzteblatt 102 (16), S. 929-932.
Eink, Michael. 1999. „Oh Gott, wieviel Verrückte laufen frei herum? Psychisch Kranke und Gefahren im Bild der Öffentlichkeit“. In: Soziale Psychiatrie 24 (3), S. 1-7.
Ernst, Klaus. 1998. Psychiatrische Versorgung heute: Konzepte, Konflikte, Konsequenzen. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
Feldmann, Klaus. 2001. Soziologie kompakt. 2. Aufl. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Finzen, Asmus. 2000a. „Die Psychiatrie, die psychisch Kranken und die öffentliche Meinung: Beobachtungen zu einer gestörten Kommunikation“. In: Soziale Psychiatrie 24 (4), S. 4-6.
Finzen, Asmus. 2000b. Psychose und Stigma. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Galuske, Michael. 2002. Methoden der sozialen Arbeit. 4. Aufl. Weinheim, München: Juventa.
Geislinger, Rosa. 2002. „Hilfe zur Selbsthilfe: Professionelle Unterstützung von Psychiatrie- und Psychoseerfahrenen im Rahmen der Selbsthilfe“. In: Siemen, Hans-Ludwig (Hrsg.): GeWOHNtes Leben - Psychiatrie in der Gemeinde. Neumünster: ParanuS. S. 81-93.
Gesetze für Sozialwesen. 2004. Regensburg: Walhalla.
Grunwald, Klaus / Thiersch, Hans. 2004. „Das Konzept Lebensweltorientierte Soziale Arbeit-einleitende Bemerkungen“. In: Grunwald, Klaus / Thiersch, Hans (Hrsg.): Praxis Lebenswertorientierter Arbeit: Handlungszugänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Weinheim, München: Juventa. S. 13-39.
Hartung, Johanna. 2000. Sozialpsychologie. Stuttgart, Berlin Köln: Kohlhammer.
Herriger, Norbert. 2002. Empowerment in der Sozialen Arbeit: Eine Einführung. 2. Aufl. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
Homfeldt, Hans Günther / Schulze-Krüdener, Jörgen (Hrsg.). 2003. Handlungsfelder der sozialen Arbeit. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Informationskampagne Irre menschlich Hamburg. 2004. „Gemeinsam gegen Vorurteile und Diskriminierung: Aufklärung und Information zum Beispiel an Schulen“. In: Bock, Thomas / Dörner, Klaus / Dieter, Naber (Hrsg.): Anstöße. Zu einer anthropologischen Psychiatrie. Bonn: Psychiatrie-Verlag. S. 318-328.
Kardorff, Ernst von. 2003. „Sozialpädagogisches Handeln in Sozial- und Gemeindepsychiatrie“. In: Homfeldt, Hans Günther / Schulze-Krüdener, Jörgen (Hrsg.): Handlungsfelder der Sozialen Arbeit. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. S. 287-309.
Kardorff, Ernst von. 2005. „Kein Ende der Ausgrenzung: Ver-rückter in Sicht?“ In: Anhorn, Roland / Frank, Bettinger (Hrsg.): Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 253-271.
Keupp, Heiner. 2001a. „Gemeindeorientierung“. In: Antor, Georg / Bleidick, Ulrich (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer. S. 326-329.
Keupp, Heiner. 2001b. „Lernschritte in Psychiatriereform: Von der ‘Fürsorglichen Belagerung’ zu einer Empowerment-Perspektive“. In: Bremer, Fritz / Hansen, Hartwig / Blume, Jürgen (Hrsg.): Wie gehts uns denn heute? Sozialpsychiatrie zwischen alten Idealen und neuen Herausforderungen. Neumünster: Paranus. S. 64-82.
Kieler Fenster. 1997. Einzelwohnen für psychisch kranke Menschen mit hohen Betreuungsbedarf. Manuskript.
Kieler Fenster. 2001. Konzept Betreutes Wohnen. Manuskript.
Kieler Fenster. 2006. Thesenpapier des AK Integration. Manuskript.
Kieler Fenster. o.J. Informationen über die Wohngruppen des Kieler Fensters für BetreuerInnen und TherapeutInnen. Kiel: Manuskript.
Knuf, Andreas / Ulrich, Seibert. 2000. Selbstbefähigung fördern: Empowerment und psychiatrische Arbeit. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Knust-Potter, Evemarie. 1999. „Community Living“. In: Lexikon. Wissenswertes zur Erwachsenenbildung. http://www.bilbo.de/lexikon/begriffe/communit.htm, gelesen am 5.1.2006.
Lenz, Albert. 2002. „Empowerment und Ressourcenaktivierung - Perspektiven für die psychosoziale Praxis“. In: Lenz, Albert / Stark, Wolfgang (Hrsg.): Empowerment: Neue Perspektiven für psychosoziale Praxis und Organisation. Tübingen: dgvt-Verlag. S. 13-55.
Matern, Waltraud / Schäfer, Brunhilde / Zechert, Christian. 2005. „Integrierte Versorgung ohne Bürger?“ In: Psychosoziale Umschau 2005 (1), S. 7-9.
Mattner, Dieter. 2000. Behinderte Menschen in der Gesellschaft. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
Moser, Heinz. 2003. Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Zürich: Lambertus.
Mrozynsky, Peter. 2002. „Die Bedeutung des SGB IX für die psychiatrische Versorgung“. In: Recht und Psychiatrie 20 (3), S. 139-149.
Mühlum, Albert / Gödecker-Geenen, Norbert. 2003. Soziale Arbeit in der Rehabilitation. München: Reinhardt.
Nouvertne, Klaus / Schöck, Gustav. 2002. „Bürgerhilfe in der Psychiatrie - so notwendig wie schwierig“. In: Bock, Thomas / Weigand, Hildegard (Hrsg.): Hand-werks-buch Psychiatrie. 5. Aufl. Bonn: Psychiatrie-Verlag. S. 315-327.
Obert, Klaus. 2001. Alltags- und lebensweltorientierte Ansätze sozialpsychiatrischen Handelns. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Pearson, Richard E. 1997. Beratung und soziale Netzwerke: Eine Lern- und Praxisanleitung zur Förderung sozialer Unterstützung. Weinheim und Basel: Beltz.
Psychiatrienetz. 2006. Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V. Wir stellen uns vor. http://www.psychiatrie.de/dachverband/wir/article/wir_stellen_uns_vor.html, gelesen am 12.2.2006.
Rausch, Günter. 1998. Gemeinschaftliche Bewältigung von Alltagsproblemen: Gemeinwesenarbeit in einer Hochhaussiedlung. Münster: LIT.
Reimers, Stephan. 2000. Integration statt Aussonderung: Wege zur Achtung von Menschen mit Behinderungen im 21.Jahrhundert. http:/www.ekd.de/bevollmächtigter/berlin/print/ Stellungnahmen_integration_statt_ausgrenzung.html, gelesen am 5.1.2006.
Richter-Werling, Manuela. 2000. „‘Irrsinnig menschlich e.V.’“. In: Soziale Psychiatrie 24 (4), S. 31-32.
Röhrle, Bernd / Sommer, Gert / Nestmann, Frank (Hrsg.). 1998. Netzwerkintervention. Tübingen: Dgvt-Verlag.
Schablon, Kai-Uwe. 2001. Inclusionspädagogik als Konsequenz auf die Community Care Philosophie. http://www.rauheshaus.de, gelesen 9.1.2006.
Schablon, Kai-Uwe. 2003. Sorge statt Ausgrenzung: Die Idee der Community Care. http://www.rauheshaus.de, gelesen am 9.1.2006.
Schlichte, Gunda. 2006. Betreutes Wohnen - Hilfen zur Alltagsbewältigung. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Schöck, Inge. 2004. Zukünftige Arbeitsfelder bürgerschaftlichen Engagements in der Psychiatrie. http://www.psychiatrie.de/dachverband/zukunft/article/Zukunft_buergersch_ Engagements_Schoeck.html, gelesen am 12.2.2006.
Schramme, Thomas. 2003. „Psychische Behinderung: Natürliches Phänomen oder soziales Konstrukt“. In: Cloerkes, Günther (Hrsg.): Wie man behindert wird: Texte zur Konstruktion einer sozialen Rolle und zur Lebenssituation betroffener Menschen. Heidelberg: Winter. S. 53-81.
Schubert, Franz-Christian. 1994. „Lebensweltorientierte Sozialarbeit“. In: Klüsche, Wilhelm (Hrsg.): Professionelle Identitäten in der Sozialarbeit, Sozialpädagogik. 2. Aufl. Mönchengladbach: Fachhochschule Niederrhein, Fachbereich Sozialwesen. S. 163-211.
Schuchardt, Erika. 1982. Soziale Integration Behinderter. 2. Aufl. Braunschweig: Westermann.
Seibert, Horst. 2000. „Das soziale Ehren-Amt: Eine Hochkonjunktur, ihre Gründe und Formen“. In: Soziale Arbeit 49 (10-11), S. 364-368.
Seibert, Ulrich. 2002. „Gemeindepsychiatrie ist mehr als Betreutes Wohnen“. In: Siemen, Hans-Ludwig (Hrsg.): GeWOHNtes Leben: Psychiatrie in der Gemeinde. Neumünster: Paranus. S. 175-188.
Siemen, Hans-Ludwig (Hrsg.). 2002. GeWOHNtes Leben - Psychiatrie in der Gemeinde. Neumünster: ParanuS.
Stein, Anne-Dore. 2005. „Be-Hinderung und Sozialer Ausschluss“. In: Anhorn, Roland / Frank, Bettinger (Hrsg.): Sozialer Ausschluss und Soziale Arbeit. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 307-318.
Theunissen, Georg. 2002. „Behindertenarbeit im Zeichen einer Umorientierung: Inclusion, Partizipation und Empowerment“. In: Soziale Arbeit 51 (Okt.-Nov.), S. 362-370.
Thiersch, Hans. 2003. „Wohnwelten-Lebenswelten“. In: Soziale Psychiatrie 27 (2), S. 4-7.
Tröster, Heinrich. 1996. „Einstellungen und Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderungen“. In: Zwierlein, Eduard (Hrsg.): Handbuch Integration und Ausgrenzung. Berlin: Luchterhand. S. 187-195.
Voelzke, Wolfgang. 2002. „Selbstorganisation und gemeinsame Selbsthilfe“. In: Bock, Thomas / Weigand, Hildegard (Hrsg.): Hand-werks-buch Psychiatrie. 5. Aufl. Bonn: Psychiatrie-Verlag. S. 259-279.
Waller, Heiko. 2003. Sozialmedizin: Grundlagen und Praxis. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
Weise, Klaus. 2002. „Woran krankt die Sozialpsychiatrie?“ In: Sozialpsychiatrische Information 32 (2), S. 28-32.
Wendt, Wolf Rainer. 1990. Ökosozial denken und handeln: Grundlagen und Anwendungen in der Sozialarbeit. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Wocken, Hans. 2001. „Integration“. In: Antor, Georg / Bleidick, Ulrich (Hrsg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer. S. 76-79.
Fragebogen / Interview
für NutzerInnen des Betreuten Wohnens
über die Teilhabe am sozialen und kulturellen und gesellschaftlichen Leben sowie am Arbeitsleben
9 Allgemeine Daten
9.1 Geschlecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9.2 Betreutes Wohnen seit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9.3 Betreuungsumfang/ Schlüssel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10 Wohnsituation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.1 Wo?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Stadtteil
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.2 Wohnen Sie alleine oder zu mehreren? Mit welchen Personen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.3 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.4 Gründe für die Zufrieden- bzw. Unzufriedenheit z.B. Stadtteil, Wohnform, Haus, Wohnung, andere Gründe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.5 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich einer möglichen positiven Veränderung?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.6 Wäre mehr Unterstützung nötig um eine Veränderung zu erzielen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11 Arbeitssituation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.1 Befinden Sie sich im Moment in einem Arbeitsverhältnis/ Beschäftigungsverhältnis oder ähnlichem ?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.2 Würden Sie gerne einer Beschäftigung nachgehen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.3 Wenn ja (bei 3.1.), um was für ein Beschäftigungsverhältnis handelt es sich?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.4 Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Arbeitssituation?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.5 Wie gut ist das Verhältnis zu den KollegInnen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.6 Treffen Sie sich mit Ihren KollegInnen außerhalb der Arbeitszeiten (Privat)?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.7 Wie zufrieden sind mit den Kontakten zu Ihren KollegInnen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.8 Würden Sie gerne etwas ändern?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.9 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich einer möglichen Veränderung/Verbesserung?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.10 Wäre mehr Unterstützung nötig um eine Veränderung zu erzielen? Welche?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.11 Welche Wünsche haben Sie bezüglich Ihrer Beschäftigungssituation?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12 Soziale Kontakte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.1 Partnerschaft
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.2 Würden Sie gerne etwas ändern?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.3 Familie Eltern, Kinder, Geschwister, Verwandte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.4 Ist diese Situation für Sie befriedigend? Würden Sie gerne etwas verändern?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.5 Freunde mit Psychiatrieerfahrung/ Mitbetroffene
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.6 Ich hätte gerne mehr Freunde/ Bekannte mit Psychiatrieerfahrung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.7 Freunde ohne Psychiatrieerfahrung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.8 Ich hätte gerne mehr Freunde/ Bekannte ohne Psychiatrieerfahrung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.9 Ich habe ausschließlich enge Kontakte zu anderen Mitbetroffenen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.10 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich einer möglichen Veränderung/Verbesserung ?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.11 Wäre mehr Unterstützung nötig um eine positive Veränderung zu erzielen? Welche?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.12 Hat Ihr/e BetreuerIn Kontakt zu Ihrer Familie, Freunden Bekannten?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.13 Wie zufrieden sind Sie insgesamt gesehen mit Ihren sozialen Kontakten?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13 Aktivität in der Gemeinde
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.1 Nachbarschaftlicher Kontakte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.2 Haben Sie andere bedeutsame Kontakte in Ihrem näheren Wohnumfeld? (z.B. VerkäuferInnen, Hausmeister, andere Personen)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.3 Besuch von öffentlichen sozialen Einrichtungen allgemein z.B. AWO Servicehaus, Arbeitslosentreff, Frauentreffs u.ä
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.4 Wenn ja, welche und wie beurteilen sie die Einrichtung?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.5 Besuch von gemeindepsychiatrischen Einrichtungen und Gruppenangebote
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.6 Wenn ja, welche und wie beurteilen sie die Einrichtung?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.7 Teilnahme an Selbsthilfegruppen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.8 Würden Sie gerne etwas ändern?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.9 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich einer möglichen Veränderung/Verbesserung ?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.10 Hat Ihr/e BetreuerIn Kontakte zu Nachbarn, Einrichtungen, Selbsthilfegruppen usw. bzw. versucht sie solche aufzubauen oder zu pflegen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13.11 Wäre mehr Unterstützung nötig um eine positive Veränderung zu erzielen? Welche?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14 Freizeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.1 Teilnahme bzw. Besuch von Vereinen, Sportstätten u.ä. z.B. Schwimmbad, Sauna, Fitnesscenter, Entspannung, Jogging-/Walkinggruppe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.2 Teilnahme oder Besuch von kulturellen Einrichtungen z.B. Kino/Film, Musik, Theater, Theatergruppe, Chor, Tanz, Disco, offener Kanal Kiel)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.3 Besuch von Gaststätten, Kneipen, Cafes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.4 Kirchliche, religiöse und spirituelle Einrichtungen Gottesdienste, Kirchenchor, Gesprächsgruppen u.a.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.5 Tdochschulkurse, Computerkurse, Sprachkurse usw.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.6 Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (Kieler Woche, Jahrmarkt usw.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.7 Aktive Politische Partizipation (Parteien, Politische Gremien, Ausschüsse, auch gemeindepsychiatrische Gremien,)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.8 Ökologische Partizipation (Umweltschutz, Naturschutz)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.9 Ehrenamt
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.10 Mit welchen Aktivitäten haben Sie positive Erfahrungen gemacht und warum?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.11 Würden Sie gerne etwas verändern?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.12 Wie viel Unterstützung erhalten Sie von Ihrer/ Ihrem BetreuerIn bezüglich der Teilnahme an Freizeitaktivitäten?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.13 Wäre mehr Unterstützung wünschenswert um eine positive Veränderung zu erzielen? Welche?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
14.14 Welche Aktivitäten würde sie gerne mit Unterstützung ausprobieren?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
15 Finanzielle Situation
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
15.1 Einkommen (nur für eine Person gerechnet) abzüglich der Miete und Heiz- +Nebenkosten ca.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
15.2 Fühlen Sie sich durch die finanziellen Verhältnisse eingeschränkt?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16 Allgemein
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16.1 Wie viel Zeit der Betreuung schätzen Sie umfasst das Besprechen und die Unterstützung Ihres Sozial- und Arbeitsleben (der obengenannten Punkte)?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16.2 In welchem Bereich ist Unterstützung ist für Sie im Moment am bedeutsamsten und welche Art von Unterstützung ist das??
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16.3 Wie wichtig schätzen Sie ist Ihrer BetreuerIn das Betreuungsziel „Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ verglichen mit den anderen Zielen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16.4 Halten Sie eine Begleitung zu verschiedenen Aktivitäten durch Ehrenamtliche oder PraktikantInnen für wünschenswert?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16.5 Wie gut fühlen Sie sich insgesamt gesehen in das Sozialleben integriert (Teilhabe am Leben in der Gesellschaft)?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16.6 Wenn Sie sich nicht gut integriert fühlen welche Gründe auf der persönlichen Seite hat es?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16.7 Gründe, die mit der Umwelt (Gesellschaft, Leute, Strukturen) zu tun haben
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
16.8 Was sind meine Wünsche und Vorschläge bezüglich Integration?
- Arbeit zitieren
- Bettina Stallbaum (Autor:in), 2006, Inklusion, Integration und gesellschaftliche Teilhabe psychisch kranker Menschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111113
Kostenlos Autor werden

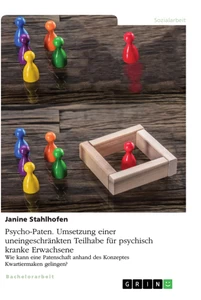










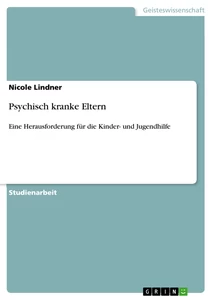




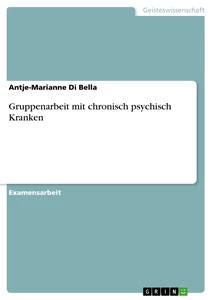


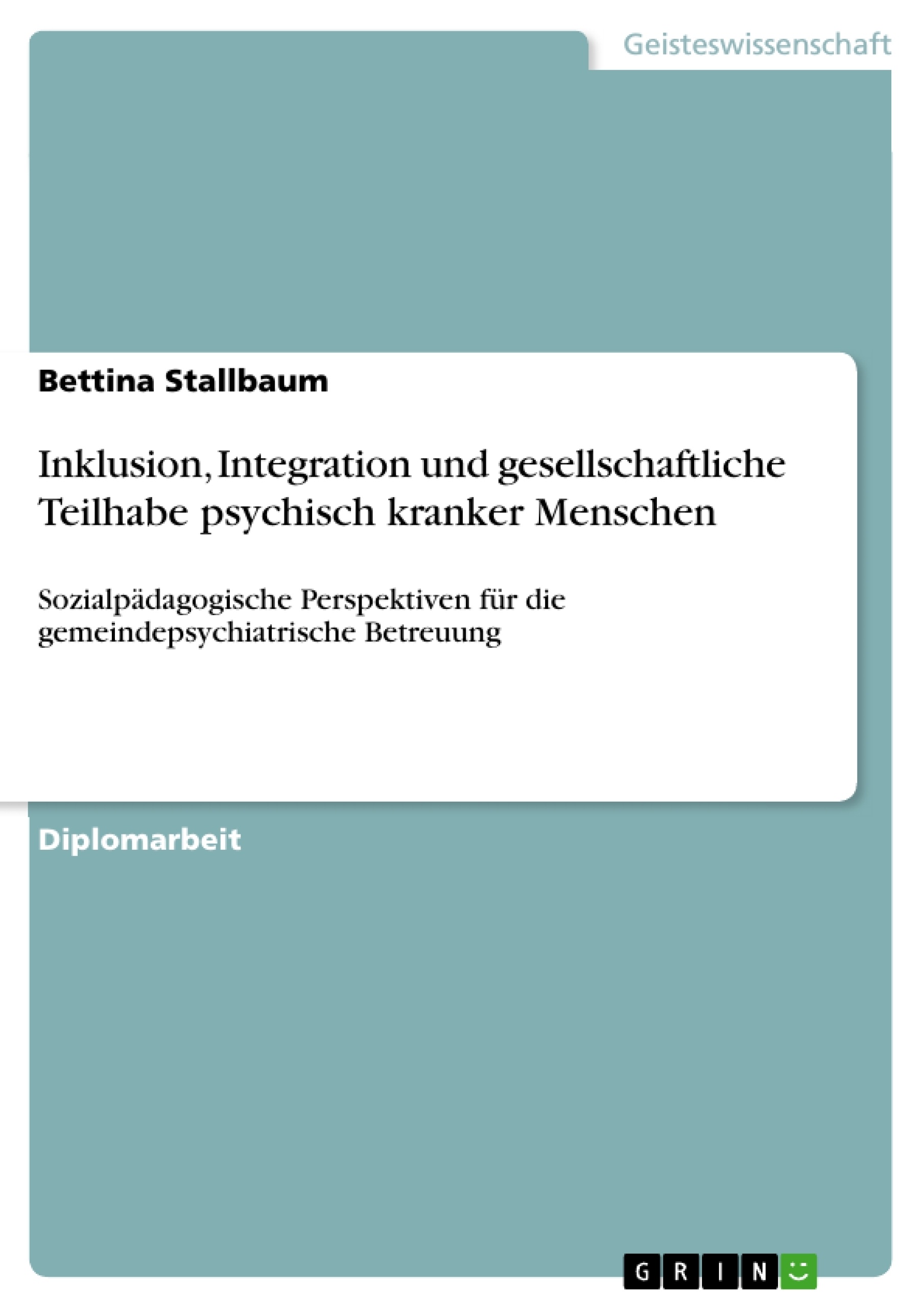

Kommentare