Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Was sind Computerspiele?
1. 2. Wesensmerkmale von Computerspielen
1. 2. 1. Spielerische Merkmale
1. 3. Faszination von Computerspielen
2. Gewalt und Aggression
2. 1. Gewalt
2. 2. Beliebigkeit des Gewaltbegriffs
2. 3. Formen von Gewalt
2. 3. 1. Physische Gewalt
2. 3. 2. Psychische Gewalt
2. 4. Gewalt in Ego- Shootern
2. 5. Aggression
2. 6. Enge Definition
2. 7. Aggression wertend oder feststellend verwendet?
2. 7. 1. Aggressionstypen
2. 8. Aggression ist nicht gleichbedeutend mit Gewalt
3. Aspekte medialer Gewaltdarstellung
3. 1. Medientheoretische Aspekte
3. 1 .1. Katharsis- These
3. 1. 2. Anstiftungsthese
3. 1. 3. Stimulus- Response- Ansatz
3. 1. 4. Uses- and- Gratifications- Ansatz
3. 2. Psychologische Theorien
3. 2. 1. Frustrations- Aggressions- Hypothese
3. 2. 2. Experimentelle Studien
3. 3. Thesen zur Wirkungsweise von Computerspielen auf die Rezipienten
3. 3. 1. Computerspiele sind ein Vermittlungsmedium
3. 3. 2. Computerspiele erfordern „emotionslose“ Spieler
3. 3. 3. Computerspiele machen gegenüber ihren Inhalten gleichgültig
3. 3. 4. Computerspiele wirken verstärkend auf vorhandenen Tendenzen
3. 4. Kinder und Jugendliche sind prädestiniert für mediale Gewaltdarstellung
3. 5. Kritik
4. Transfer zwischen virtueller Gewalt und realer Gewalt
4. 1. Exkurs: Erfurt und die Diskussion um Counter-Strike
4. 1. 1. Die Rolle der BPjPS/BPjM
4. 2. Konstruktion von Wirklichkeiten
4. 2. 1. Die reale Welt
4. 2. 2. Die „virtuelle“ Welt
4. 2. 3. Die Welt der Fantasie
4. 3. Transfer zwischen virtueller Welt und realer Welt
4. 3. 1. Rahmungskompetenz
4. 4. Fantasie und Wunscherfüllung
4. 5. Wahrnehmung von Gewalt in Computerspielen
4. 6. Empathie
5. Abschließende Betrachtungen
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
7. 1. Bilder
7. 2. Glossar
Einleitung
„Es gibt nur ein Ziel: Töte deine Gegner!“ Sind die einleitenden Worte eines Frontal 21 Berichtes vom 09.11.2004 mit dem bezeichnenden Titel: „Video-Gemetzel im Kinderzimmer“. Es handelt sich beim dem so bezeichneten Titel um Doom 3, einem Ego-Shooter dessen Spielablauf tatsächlich darin besteht verschiedene Gegner (Zombies, Monster aus der Hölle und letztendlich den Urheber für die Ereignisse „Dr. Krieger“) zu „töten“. Welche Ereignisse? Der Beitrag von Frontal 21 verschweigt die Tatsache, dass bei Doom 3 die Spielhandlungen in eine Rahmenhandlung eingebunden sind. Der namenlose Marine, der vom Rezipienten gesteuerter Charakter, landet auf einer Forschungsstation auf dem Mars, die von „Dr. Krieger“ geleitet wird, und auf der sich kurz nach Spielbeginn Tore zur Hölle öffnen, aus denen verschieden Monster in die Einrichtung eindringen und alle Mitarbeiter „töten“. Die Aufgabe des Spielers besteht darin von der Anlage zu entkommen und das zentrale Verbindungstor zwischen Hölle und Mars zu schließen. Da in der Anlage kaum Lichtquellen vorhanden bzw. zerstört wurden, ist es stockdunkel und der Spieler muss häufig eine Taschenlampe benutzen um zu sehen wo Gegner sind und welchen Weg er nehmen muss. Wenn der Rezipient seine Taschenlampe benutzt, kann er keine Waffe benutzen. Das Spiel nutzt diese Elemente dazu aus, in Verbindung mit einer bedrohlichen Musikuntermalung, den Rezipienten möglichst oft zu „erschrecken“. Es kreiert demnach eine Atmosphäre ähnlich der von Horrorfilmen und biete somit mehr Elemente, als das reine Abschießen von Gegnern, wie es etwa bei Online- Ego- Shootern der Fall ist. „Das Horrorspiel ist nicht indiziert und gilt als nicht jugendgefährdend, und das mit staatlichem Stempel“ - stellt der Bericht nach den einleitenden Worten und Szenen von Doom 3 fest und richtet sich damit direkt gegen die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), welche eine gesetzlich verpflichtende Altersfreigabe für Computer- und Videospielen vergibt. Jedes Spiel, das in Deutschland veröffentlicht werden soll muss vorher durch die USK geprüft werden. Die Altersfreigaben staffeln sich in: Freigegeben ohne Altersbeschränkung, Freigegeben ab 6, 12, 16 Jahren und Keine Jugendfreigabe. Keine Jugendfreigabe bedeutet: „In allen Spielelementen reine Erwachsenenprodukte. Der Titel darf nur an Erwachsene abgegeben werden. Bei Verstoß drohen Ordnungsstrafen bis 50.000 Euro. Der Inhalt ist geeignet, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen“[1]. Doom 3 hat keine Jugendfreigabe bekommen - worauf ich gleich zurückkommen möchte. Weiterhin wird der USK unterstellt 3500 Spiele geprüft zu haben, wovon nur 23 Spiele keine Freigabe bekommen haben. Richtig ist: Allein in den Jahren 2003 (Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, aus der FSK- Freiwillige Software Selbstkontrolle wird USK- mit eben gesetzlich verpflichtenden Altersfreigaben) und 2004 (Zeitpunkt des Beitrags) hat die USK 4371 Spiele geprüft, wie viele davon, in dem genannten Zeitraum, keine Freigabe bekamen, ist aus der Homepage nicht zu erschließen.
(Quelle: http://www.usk.de/94_Statistik.htm)
Weiterhin wird das Verfahren der USK als wirkungslos bezeichnet: „Die Alterbeschränkungen sind fast wirkungslos, der Jugendschutz wird auf die einzelnen Verkäuferinnen verlagert. Eine Stichprobe ergibt: Gleich im ersten Geschäft kann der 14-jährige Ken das Killerspiel "Doom 3" kaufen, es ist ab 18 freigegeben“. Mit diesen Erkenntnissen wird Jürgen Hilse, der Vertreter der Obersten Jugendbehörden der Länder bei der USK konfrontiert. Hilse ist sehr bemüht eine differenzierte Sichtweise von Computerspielen seinem Gesprächspartner näher zu bringen, allerdings mit wenig Erfolg. Auch sein Hinweis, dass sie über Spiele reden, die nur für Erwachsene zugelassen sind „wir reden […] über Erwachsene und nicht über eine Jugendgefährdung, ich muss dass noch mal sagen, weil Sie immer wieder sagen, ja das beinhaltet dieses und jenes, es ist die Frage: Darf man diesen Inhalt Erwachsenen zumuten?“, wird mit dem Hinweis, „aber die Spiele werden beworben in genau den Zeitschriften, die primär von Jugendlichen gelesen werden, die Spiele liegen aus in den Geschäften und man kann ja nicht den Verkäufern zumuten, dass sie die Arbeit leisten, die eigentlich der Jugendschutz leisten müsste“ übergangen. Seine Antwort fällt dann auch resigniert aus: „Das ist aber genau die Aufgabe, na… natürlich“. Man muss Hilse in allen Punkten zustimmen Die Verantwortung für die Einhaltung von gesetzlichen Altersbestimmungen liegt bei den Verkäufern, welche auch beim Verkauf von Alkohol darauf achten müssen. Unterschiedliche Auffassungen können nur vertreten werden, wenn davon ausgegangen wird, wie es Frontal 21 macht, dass Spiele dazu verleiten, dass entsprechende Spielhandlungen in die „Realität“ übernommen werden, und dies nicht nur für Jugendliche, so, dass Spiele mit „gewalthaltigen Inhalten“ per se nicht erst hergestellt werden dürften. Auch bei Doom 3 handelt es sich um ein Spiel nur geeignet für Erwachsene, und die Tatsache, dass Jugendliche das Spiel kaufen können, kann weder dem Hersteller noch der USK angelastet werden, zumal die USK gar nicht für eine Indizierung oder ein Verbot von Computerspielen zuständig ist, das ist Aufgaben der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM). Der Hinweis mit den Zeitschriften dagegen greift ebenfalls etwas kurz. Jedes Spielmagazin mit DVD oder CD Beigabe und - das sind alle Magazine, muss vor dem Verkauf eine Altersfreigabe von der USK bekommen, so dass bestimmte Spielvideos nur auf Datenträgern enthalten sind, die ab 18 Jahren freigegeben sind, also das Siegel „Keine Jugendfreigabe“ enthalten. Im Laden liegen Zeitschriften aus, die ab 16 Jahren freigeben sind. Für eine Ab-18-Fassung, muss man bei allen Zeitschriften ein Abo abschließen und eine Kopie seines Personalausweises an den Verlag senden.
Der Beitrag endet mit einem Interviewausschnitt mit Jörg Schönbohm, der alarmiert von dem Frontal 21 Bericht erklärte: "Dass nunmehr durch die unabhängige Selbstkontrolle Filme und solche Spiele nicht indiziert und damit verboten werden, ist nicht akzeptabel. Was umso schwieriger ist, wenn man sich überlegt, dass die Vorgängerspiele von einer ähnlichen Brutalität und Grausamkeit schon von der Bundesprüfstelle verboten wurden und jetzt nicht. Hier muss eingegriffen, hier muss etwas geändert werden." Folgerichtig, im Sinne des Beitrags, betonte Schönbohm abschließend sich für ein generelles Herstellungsverbot solcher Spiele einzusetzen. Im laufe der Zeit folgten weiter Fernsehbeiträge, welche alle in ähnlicher Weise mit dem Thema umgingen, auf die hier aber nicht näher eingegangen werden soll. Die Resonanz auf solche Berichte blieb, auf Dauer gesehen, verhalten. Auch wenn Computerspieler im Frontal 21- Forum ihre Meinung äußerten, der Server dem hohen Ansturm nicht gewachsen war und die Verbindung zusammenbrach. Bis die Ereignisse von Emsdetten eine erneute Debatte über Computerspiele auslöste. Was war geschehen?
Am Montag 20. November 2006 betrat der 18 jährige Sebastian B. mit Rohrbomben, Rauchbomben und vier Gewehren bewaffnet seine ehemalige Schule (Geschwister-Scholl-Realschule in Emsdetten) und verletze 37 Menschen, fünf von ihnen durch Schüsse. Anschließend tötete er sich selbst. Sebastian B. hatte die Tat vorher auf seiner Homepage angekündigt und einen Abschiedsbrief online gestellt. Die Seite wurde kurz nach der Tat gesperrt. Der Abschiedsbrief ist in mehreren Foren aufgetaucht und kann unter http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/24032/1.html eingesehen werden. In den Medien tauchte bald der Hinweis auf, dass Sebastian B. gerne Counter-Strike gespielt habe, dabei reichten die Bezeichnungen von „spielte häufig Counter-Strike“ bis „war ein fanatischer Counter-Strike- Spieler“. Daneben war er aktiver Softair* Spieler und wohl auch ein „Waffenliebhaber“, sollte er doch am Dienstag wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht erscheinen. Weiterhin war er ein „Verehrer“ der Columbine High School-Täter, denen er als Gedenken ein Video auf You Tube (Seite um z.B. eigene Videos online zugänglich zu machen) widmete. Trotz der öffentlich zugänglichen Zeugnisse, die Sebastian B. hinterlassen hat, und die seine Motivation für diese Tat näher beleuchten könnten – insbesondere der Abschiedsbrief gibt einige Hinweise, in welchem Zusammenhang Sebastian B. die Tat, seine Lebensverhältnisse und die gesellschaftlichen Verhältnisse sieht, kreiste die öffentliche Debatte hauptsächlich um „gewalttätige“ Computerspiele und deren kausalen Anteil an solchen Taten. Besonders betont wurde auch hier der Schutz der Jugend, ungeachtet der Tatsache, dass Sebastian B. 18 Jahre alt war. Wie schon nach den Ereignissen von Erfurt, so geriet auch hier besonders der Online- Ego- Shooter „Counter-Strike“ in den Fokus der Berichterstattung, worauf in Punkt 4. 1. eingegangen wird. Das Muster der öffentlichen Debatten um Emsdetten ist das gleiche wie im oben erwähnten Beispiel von Frontal 21, wenn es auch einige differenzierte Beiträge gibt, die aber kaum beachtet wurden.
Wenn man dem bisher Erörterten folgt, werden die Einwände von Computerspielern, ihr „Hobby“ würde nur auf das Töten von „Menschen“ reduziert und sie selbst würden als potentiell „gewalttätig“ eingestuft, verständlicher. Ebenso die Berührungsängste von Eltern, die das „Hobby“ ihres/ihrer Kindes/Kinder nicht verstehen bzw. nachvollziehen können, geht es ja aus einer Außenperspektive betrachtet nur ums „Töten“, wie in den Berichten dargestellt. Es gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit dem Thema beschäftigen und negative Auswirkungen von „gewalthaltigen“ Computerspielen auf deren Nutzer belegen, in Form einer Anstiftung zu „Gewalthandlungen“, Steigerung von „Aggression“ oder dem Verlust von Empathie. Solche Studien wurden bisher in jeder Diskussion als Beweise angeführt, dass „gewalthaltige“ Computerspiele schädlich sind und verboten werden müssen. Diese Untersuchungen vernachlässigen einige Punkte, die ihn dieser Arbeit berücksichtigt werden sollen. Zunächst fällt auf, dass viele Untersuchungen nicht genauer angeben, was mit den Begriffen „Gewalt“ und „Aggression“ überhaupt gemeint ist. Vielfach werden beide Begriffe deckungsgleich verwendet und definiert als, „solches Verhalten, das darauf abzielt, eine andere Person zu verletzen“[2]. Hierbei fällt auf, dass beide Begriffe von den verschiedenen Autoren „im vorbeigehen“ abgehandelt werden. In der Auseinandersetzung mit „gewalthaltigen“ Computerspielen ist es aber notwendig einen genaueren Blick auf beide Begriffe zu werfen, geht es doch darum, herauszufinden, welchen Anteil an möglichen „realen“ Taten diese Spiele haben.
Weiterhin wird z.B. kaum der Frage nachgegangen, in welcher Form Transfers von „virtuellen“ Inhalten in die „Realität“ überhaupt sinnvoll übernommen werden können. Viele Untersuchungen gehen in diesem Punkt davon aus, dass „virtuelle“ Inhalte ohne Brechungen eine Entsprechung in der „Realität“ haben. Daran anknüpfend stellt sich die Frage: Was ist gemeint, wenn von „Realität“ und „virtueller“ Welt die Rede ist? Gibt es Kriterien für beide Welten, mit deren Hilfe wir entsprechende Inhalte zuordnen können? Welche Bedeutung hat „Gewalt“ in Computerspielen für deren Nutzer und wie wird „virtuelle“ „Gewalt“ von diesen interpretiert. Bieten Computerspiele die Möglichkeit von Transferleistungen, die außerhalb der „Realität“ liegen? Damit sind mögliche Anknüpfungspunkte im Bereich der Fantasie gemeint, so dass Computerspiele vielleicht eher die Möglichkeit des Auslebens von „Fantasien“ bieten. Diese Fragen berühren die wichtigsten Punkte, welche es zu berücksichtigen gilt. Dabei müssen einige Einschränkungen gemacht werden:
Es gibt viele verschieden Arten von Computerspielen zum Beispiel Ego-Shooter, Sportspiele, Rollenspiele, Online- Shooter, Online- Rollenspiele oder Strategiespiele, um nur einige Genres zu nennen. In dieser Arbeit liegt der Fokus besonders auf einem Genre, welches häufig im Zusammenhang zwischen „virtueller und realer Gewalt“ auftaucht. Genauer: Wenn in den Medien über einen Mord berichtet wird, und sich herausstellt, dass der Täter Computerspiele gespielt hat, geraten gerade die vermeintlich „gewalttätigen“ Spiele in den Fokus der Aufmerksamkeit. Diese sind fast alle im Genre der Ego- Shooter angesiedelt. Andere Genres werden in soweit berücksichtigt, wie sie aufgrund der verschieden Theorien über Computerspiele und in Hinblick auf Laborexperimente von Bedeutung sind.
Nun zu der Frage: Was soll untersucht werden?
Wie dem Titel zu entnehmen ist, geht es vor allem um den Zusammenhang zwischen „virtueller Welt“ und „realer Gewalt“. Folgende Leitfragen gilt es zu beantworten: Besteht ein Zusammenhang zwischen virtueller Gewalt und realen Gewalthandlungen gegenüber Mitmenschen? Fördern gewalthaltige Computerspiele die Gewaltbereitschaft? Verlieren die Rezipienten ihre empathischen Fähigkeiten? Das Ziel der Arbeit soll sein herauszuarbeiten, ob gewalttätige Computerspiele ein signifikanter, ursächlicher Faktor für mögliche reale Gewalthandlungen sind.
Die Arbeit gliedert sich folgendermaßen:
Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den grundlegenden Mechanismen von Computerspielen. Es darum herauszuarbeiten, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten die verschiedenen Kategorien von Computerspielen aufweisen, welche Anforderungen an die Nutzer gestellt werden, welche Besonderheiten Computerspiele gegenüber anderen Medien aufweisen und woraus sich eine mögliche Faszination für Computerspiele ableiten lässt.
Im zweiten Abschnitt wird der Versuch unternommen den Gewalt- und Aggressionsbegriff ausdifferenzieren. Es stellt sich die Frage, welche Form von Gewalt findet in Computerspielen statt. Handelt es sich hierbei z.B. um physische oder psychische Gewalt. Macht eine Unterscheidung in physische, psychische Gewalt überhaupt Sinn, wenn es um Computerspiele geht? Inwieweit muss zwischen Aggression und Gewalt unterschieden werden? Die Ziele in diesem Abschnitt bestehen darin, wenn möglich, einen Gewaltbegriff herauszuarbeiten, welcher dem Phänomen annähernd gerecht werden kann und durch die Differenzierung der beiden Begriffe die Theorien im dritten Abschnitt besser überprüfbar zu machen, d.h. herauszuarbeiten welche Rolle Aggression und Gewalt in den jeweiligen Theorien spielen.
Der dritte Abschnitt widmet sich den verschiedenen theoretischen Aspekten medialer Gewaltdarstellung, welche zum Teil aus der traditionellen Medienwirkungsforschung entspringen, jedoch oftmals unverändert auf Computerspiele übertragen werden. Hierbei werden besonders zwei Ansätze der klassischen Medienforschung untersucht, die als gegensätzliche Eckpfeiler der Medienforschung angesehen werden können. 1. Der Stimulus- Response- Ansatz, mit sehr starkem Fokus auf das jeweils untersuchte Medium an sich. 2. Der Uses- and- Gratifications- Ansatz, der sich stärker auf die Rezipienten von Medien konzentriert. Mit beiden Ansätze ist das Feld der klassischen Medienwirkungsforschung natürlich nur punktuell abgedeckt, aber gerade die „Untersuchung der Anwendbarkeit dieser beiden gegensätzlichen Theorien auf Computerspiele macht die Anforderung an einen speziellen Wirkungs- und Nutzungsansatz für Computerspiele […]besonders deutlich […]“[3].
Der vierte Abschnitt besteht in der Klärung von Besonderheiten von „virtuellen“ Erfahrungswelten, also der Frage: Wodurch zeichnen sich diese aus, und welche Unterschiede zur „realen“ Welt bestehen? Hier wird der Versuch gemacht die „reale“ Welt mit der „virtuellen“ Welt zu vergleichen. So kann man zum Beispiel Manuel Ladas Buchc entnehmen, das es drei Kriterienklassen gibt, nach denen das menschliche Gehirn entscheidet ob ein Wahrnehmungseindruck der „realen“ Welt zuzuordnen ist oder nicht:
Syntaktische Wirklichkeitskriterien: Sinneseindrücke, die besonders stark wahrgenommen werden, führen dazu, dass diese Eindrücke als „real“ eingestuft werden.
Semantische Wirklichkeitskriterien: Objekte, denen eine Bedeutung zugeordnet werden kann erscheinen eher als „real“.
Pragmatische Wirklichkeitskriterien: Wenn Objekte in Ursachen- Wirkungszusammenhänge einbezogen werden können, entsteht leichter der Eindruck sie als „real“ zu empfinden. In der „virtuellen“ Welt sind diese Kriterien wirksam, um bestimmte Objekte z.B. das virtuelle Abbild eines Menschen auch als Menschen identifizieren zu können. Es gibt aber Besonderheiten gegenüber der „realen“ Welt, welche ich herausarbeiten möchte.
Weiterhin geht es um einen Vergleich von „realer und virtueller“ Gewalt. Insbesondere um mögliche Transferleistungen zwischen „virtueller und realer“ Gewalt. Welche möglichen Auswirkungen von „virtueller“ Gewalt auf die Rezipienten gibt es, welche Formen der Einflussnahme werden angenommen, und wie werden diese im Einzelnen begründet. Von Interesse ist dabei auch, wie Gewalt in Computerspielen von den Rezipienten bewertet wird. Ein weiterer Aspekt besteht darin, die möglichen Auswirkungen von „virtueller“ Gewalt auf das empathische Empfinden zu untersuchen, da ein Verlust von Empathie von verschiedenen Studien als Tatsache proklamiert wird. „Nahezu unbestritten ist aber die Wirkung von Gewalt- Videospielen auf die Empathie eines Menschen. […] So dokumentieren Studien bei intensivem Konsum von blutigen Filmen oder brutalen Videospielen eine steigende Teilnahmslosigkeit von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Leid und Not von Dritten“[4]. Dabei ist zu prüfen, ob trotz der verzerrten Darstellung der „Realität“ in Computerspielen eine Gewöhnung an Gewalt stattfindet - eine Gewöhnung, die lehrt, dass Gewalt folgenlos und Töten unproblematisch ist - und ob diese Erkenntnisse von den Spielern auf die reale Welt zurückprojiziert werden.
Abschließend eine Anmerkung zum Begriff „Computerspiele“: Mit „Computerspiele“ sind im Folgenden sowohl Spiele, die für die Benutzung auf herkömmlichen Computersystemen, also auch solche, die für Spielkonsolen entwickelt wurden gemeint, da sich die Spiele bis auf die unterschiedlichen technischen Voraussetzungen nicht unterscheiden.
1. Was sind Computerspiele?
Im folgenden Unterpunkt steht die Frage im Mittelpunkt, welche Mechanismen in Computerspielen immanent sind. Dabei wird nicht der Versuch unternommen für verschiedene Gattungen von Spielen entsprechende Kategorien zu entwickeln, da es zum einem, eine solche Einteilung bereits gibt, welche unabhängig von bisherigen Untersuchungen bereits existiert und sich praktisch bewährt hat, und zum anderen geht es mir darum die grundlegenden Mechanismen von Computerspielen herauszuarbeiten, die in jedem Computerspiel vorhanden sind, und zwar unabhängig vom Genre. Allerdings ist es für ein besseres Verständnis von Computerspielen teilweise notwendig einzelne Kategorien von Computerspielen zu differenzieren, da es innerhalb der jeweiligen Kategorien tendenziell unterschiedliche Ausrichtungen in der Spielmechanik gibt, wodurch die Grundprinzipien zwar gleich bleiben, die Anforderungen an die Spieler aber etwas variieren. Weiterhin erleichtert der Bezug auf bestehende Kategorien von Spielen das Verständnis von Untersuchungen, die in der Arbeit berücksichtigt werden, da hierbei ein Verweis auf das Genre genügen sollte. Um dies zu gewährleisten gilt es, die verschiedenen Genres zu differenzieren.
Wenn in dieser Arbeit über einzelne Genres von Computerspielen gesprochen wird, dann bezieht sich die Skizzierung der einzelnen Genres auf die einstimmigen Unterscheidungen in einschlägigen PC- und Konsolen- Magazinen. Im Gegensatz zu z.B. Fritz, der den Versuch gemacht hat anhand eines Dreiecks mit den Eckpunkten Geschichten, Denken und Action einzelne Computerspiele einzuordnen, wird in dieser Arbeit darauf verzichtet. Ungeachtet des Dreiecks kommt auch Fritz bei seiner Zuordnung auf fast synonyme Unterscheidungen von Computerspielen, wie sie in den einschlägigen Magazinen benutzt werden und weiterhin halte ich die Kategorien in den Magazin für adäquat genug um damit arbeiten zu können.
Welche Unterscheidungen gibt es? Anlehnend an den PC- Magazinen GameStar, PC Powerplay, PC Action und PC Games gilt es folgende Genres zu differenzieren, wobei nur die Spielkategorien berücksichtigt werden, die für dieser Arbeit von Bedeutung sind, bei Interesse für alle möglichen Unterscheidungen von Spielen siehe z.B. (zusätzlich zu den Magazinen): Manuel Lades: Brutale Spiele(r)? oder Jürgen Fritz: Handbuch Medien.
Action: Hierunter fallen Spiele, die von ihrem Aufbau her darauf ausgerichtet sind, dass die Spieler unmittelbar (in Echtzeit, Real-Time), ohne ein Abwarten von Handlungen, reagieren bzw. agieren müssen. Somit gestaltet sich der Spielablauf dynamisch, wodurch der Spieler nicht regungslos an einer Stelle verweilen darf, um z.B. Handlungsoptionen zu überdenken, da in einem solchen Fall die eigene Figur „ernsthaft“ in Gefahr ist zu „sterben“. Die Handlung besteht hauptsächlich darin die gegnerischen Spielfiguren oder technische Hindernisse (z.B. Fahrzeuge oder Selbstschussanlagen) zu „beseitigen“. In diesem Genre ist die Spielhandlung stark auf einen kämpferischen Aspekt fokussiert: es fehlen schwere Rätsel - damit sind Schwierigkeiten (Stellen in einem Spiel an denen man nicht sofort weiterkommt, da man die Tür nicht aufbekommt und der Schlüssel abgebrochen ist und man ihn irgendwie reparieren muss, siehe Abenteuer) gemeint die ein längeres Überlegen erfordern - und der Handlungsablauf ist geradlinig - meistens gibt es nur einen möglichen Weg den Level zu beenden. Weiterhin zeichnen sich Action-Spiele durch eine mehr oder weniger ausgefeilte Hintergrundgeschichte aus, die durch Vorspann, Zwischensequenzen und Abspann erzählt wird. Die Geschichte dreht sich explizit um die vom Rezipienten gesteuerte Figur, welche zumeist eine einzigartige „Heldenfigur“ darstellt, ohne deren Eingreifen entweder die gesamte Welt zerstört wird oder das unmittelbare Umfeld der Spielfigur (Der Spieler muss mit seine Freunde alle Gefahren überstehen, wobei es allein auf seine Fähigkeiten ankommt oder er muss sich selbst aus „Lebensgefahr“ retten) nicht überleben kann. Weiterhin wird die Spielfigur mit rudimentären Charaktereigenschaften ausgestattet, um die „Identifikation“ zu erleichtern, und um die Handlungen zu untermauern. Kurz: Eine mögliche Identifikation und rudimentären Charaktereigenschaften erleichtern die kommenden Schiessereien, mit „tödlichem“ Ausgang. Ein gutes Beispiel sind die beliebten Zweite- Weltkriegsspiele, in denen man immer auf amerikanischer oder russischer Seite allein oder im Team seine Aufträge erledigen muss, primär um den Krieg zu überleben. Die Geschichte dreht sich zumeist um die Schicksale einer Einheit, die eher unfreiwillig in den Krieg zieht. Das heißt: die vom Spieler geführte Figur ist aus individuellen Gründen der Armee beigetreten, ohne genau zu wissen was sie erwartet und möchte eigentlich nur den Krieg überleben. Oder die Verhältnisse zwingen sie zu handeln, weil ihr eigenes Weltbild sie zwingt, den Kampf gegen das Böse (Deutschland) anzutreten, um die Freiheit zu bewahren. Nicht selten ist in diesem Genre die Geschichte von Pathos durchtränkt. Das dabei der Krieg entscheidend durch den Spieler beeinflusst wird und er für Spezialaufgaben eingesetzt wird, ändert er an der Hintergrundgeschichte nichts, stellt aber einen Kontrast zur „ich bin nur ein einfacher Soldat“ Geschichte dar. Kurz und bündig: Die Spielfigur ist eine Figur, die alle zentralen Eigenschaften von „Rambo“ hat oder im Laufe der Geschichte erwirbt. Sie ist eine „Ein-Mann- Armee“, die „gerechterweise“ alles „erschießt“, was nicht rechtzeitig flüchten kann. Und da Computerfiguren so gut wie nie flüchten (außer in Skript-Sequenzen erklären!) und es Zivilisten in Zweite- Weltkriegsspielen des Action- Genres nicht gibt, sind das praktisch alle, als „menschlich“ erkennbaren Figuren, der gegnerischen Seite. Die Identifikation wird in diesen Shootern durch die „einfache Mann“ Geschichte und durch das Spielen auf alliierter Seite erreicht. Es gibt keinen Weltkriegs- Shooter indem auf deutscher Seite gespielt werden kann, was nicht nur an dem Ausgang des Krieges liegt. Eine Identifikationsmöglichkeit auf „deutscher“ Seite zu schaffen wäre mit erheblichen Aufwand verbunden, und wäre im diesem Setting (Zweiter Weltkrieg) schwer zu vermitteln. Das eine „Identifikation“ mit der Spielfigur nicht so einfach geschieht, wie hier vielleicht anklingen mag, wird im vierten Kapitel näher beleuchtet.
Eine Ausnahme von dem bisher Angeschnittenen stellen reine Online-Spiele in diesem Genre dar, die sich durch Fehlen einer Hintergrundgeschichte und Charakterisierung der Spielfigur (etwa Counter-Strike) auszeichnen. Es gibt hier, wenn überhaupt, nur einen Darstellung des folgenden Levels in schriftlicher Form, welche die Ausgangslage beschreibt (z.B. Battlefield 2). Hier wird auch deutlich, dass es in der Kategorie Action verschiedene Sub-Kategorien gibt, die populärste Sub-Kategorie sind:
Ego-Shooter/ First-Person-Shooter: Der Name bezeichnet schon den grundlegenden Unterschied zu anderen Action-Spielen. Der Spieler steuert die Spielfigur aus dessen Perspektive heraus, er sieht die Spielwelt mit den Augen der Spielfigur.
Alle weiteren Aspekte von Ego-Shootern folgen dem bereits gesagten.
Online- Ego-Shooter/ First-Person-Shooter: Der Unterschied zu anderen Ego-Shootern besteht darin, dass die Online- Ableger allein auf die kämpferische Auseinandersetzung mit anderen menschlichen Spielern ausgelegt sind. Dazu benötigt man eine schnelle Internet Verbindung, mit deren Hilfe man verschiedenen Servern beitreten und darauf spielen kann. Während es in den oben erwähnten Ego-Shootern um ein Durchqueren verschiedener Level geht, wodurch auch die Spielgeschichte vorangetrieben wird und die Auseinandersetzung mit computergesteuerten Figuren erfolgt, fehlt der Aspekt einer Spielgeschichte bei Online-Ego-Shootern fast gänzlich. Die Spielgeschichte wird, sofern vorhanden, in schriftlicher Form präsentiert. Ebenso fehlen Zwischensequenzen und Abspann gänzlich, ein Vorspann existiert manchmal in Form einer Präsentation des Spielablaufes, also quasi eine Präsentation davon, was den Spieler erwartet. Zwar bieten die Spiele oftmals auch die Möglichkeit ohne menschliche Mitspieler zu spielen - dann spielt man gegen computergesteuerte Figuren (Bots), doch bietet dieser Modus aufgrund einer nicht vorhandenen Spielgeschichte und mangelnden Fähigkeit der Bots kaum ein befriedigendes Spielerlebnis (siehe 1.3.). Der am meisten gespielte Online-Ego-Shooter ist Counter-Strike. Da Counter-Strike vielfach für Amoktäter als vermeintliches Trainingsspiel dienen sollte und in dieser Arbeit noch weiter thematisiert wird, (Exkurs: Erfurt 4.1.) folgt an dieser Stelle eine kurze Charakterisierung des Spiels. Worum geht es in diesem Spiel?
Counter-Strike: In diesem Spiel treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Die eine Seite besteht aus Terroristen, deren Ziel es ist entweder eine Bombe an zwei möglichen Punkten einer Karte zu legen, oder zu verhindern, dass Geiseln, die von ihnen bewacht werden, befreit werden. Auf der anderen Seite versuchen die Counter-Terroristen zu verhindern, dass die Bombe gelegt werden kann bzw. dieses zu entschärfen (nachdem die Bombe gelegt wurde startet ein Countdown bis zur Explosion), oder die Geiseln zu befreien und an einem Punkt auf der Karte zu bringen. Es gibt somit in Counter-Strike zwei Spielmodi mit unterschiedlichen Karten, der „Bomben-Legen-Entschärfen- Modus“ und der „Geisel-Bewachen-Befreien-Modus“. Jede Seite startet am Anfang der Runde an unterschiedlichen Punkten auf der Karte und muss sich von seinem Geld erst einmal Ausrüstungsgegenstände (z.B. Schusssichere Weste) und Waffen kaufen. Geld bekommt jeder Spieler durch Frags („töten“ von gegnerischen Spielfiguren) Entschärfung der Bombe, Befreiung der Geiseln bzw. deren erfolgreiches Legen oder Verteidigung. Sollte ein Spieler „gefragt“ werden, so muss er das Ende einer Runde abwarten, um wieder am Spiel teilnehmen zu können; während der Wartezeit kann er anderen Spielern beim Spielen zuschauen. Weiterhin gilt es in beiden Spielmodi die jeweiligen Ziele innerhalb eines Zeitlimits zu erfüllen. Eine Seite gewinnt, wenn alle gegnerischen Spielfiguren „getötet“ wurden oder das eigene Spielziel erreicht wurde. Dazu hat jeder Spieler die Möglichkeit sich im Chat mit anderen Spielern auszutauschen. Bei Ablauf des Zeitlimits gewinnt das Team, das erfolgreich das Bomben Legen oder Geiseln befreien verhindert hat.
In Counter-Strike gibt es weder Vorspann, Zwischensequenzen, Abspann und auch keinerlei Beschreibungen zum Spielverlauf. Eine Charakterisierung der Spielfiguren fehlt ebenso. Der Fokus liegt hier in der „reinen“ Form eines kämpferischen Kräftemessens. Rein deshalb, da nicht der Versuch gemacht wird die Auseinandersetzungen durch eine Spielgeschichte oder Charakterisierungen von Spielfiguren zu „legitimieren“.
Strategie: Hauptkennzeichen von Strategiespielen ist die Perspektive, die der Spieler einnimmt, und das der Spieler nicht nur eine Figur oder eine kleine Gruppe von Figuren steuert, sondern ganze Armeen kontrolliert. Die Perspektive, aus der ein Rezipient das Spielgeschehen steuert, ist vergleichbar mit dem Blick auf eine detaillierte Landschaftskarte. Wenn man sich die Ansicht von Google-Earth vor Augen führt, kommt man sehr nahe an die Spielperspektive heran. Der Rezipient kann in das Spielgeschehen bis zu einem gewissen Grad hinein- und herauszoomen. Welche Aufgaben gilt es zu erfüllen? Zunächst geht es bei den meisten Spielen dieser Kategorie darum, die Versorgung seiner Untertanen zu gewährleisten. Dazu müssen vom Spieler Rohstoffgebäude gebaut werden, um das damit erworbene Geld, Holz und Stein in andere Gebäude, hauptsächlich zur Produktion von Kampfeinheiten zu investieren. Vorrangiges Ziel ist überwiegend das erstellen einer „schlagkräftigen“ Armee, mit der dann der Gegner besiegt werden kann. Auch hier besteht die Haupthandlung in kämpferischen Auseinandersetzungen mit computergesteuerten Opponenten, welche in Echtzeit und damit dynamisch ablaufen. Die Möglichkeiten der Auseinandersetzungen sind dabei vielfältiger als bei den Ego-Shootern, weil hierbei die Breite der möglichen Aktionen größer ist und gleichzeitig der Ausbau der eigenen Siedlung beachtete werden muss. Die Spielgeschichte wird analog zu Ego-Shootern anhand von Vorspann, Zwischensequenzen, Skript-Sequenzen und Abspann erzählt. Charakterisierungen von Figuren erfolgen meist überhaupt nicht, oder nur in rudimentärer Form.
Neben den auf kriegerische Auseinandersetzung ausgelegten Echtzeit- Strategiespielen existieren noch eine Reihe von Aufbau- Strategiespielen (ebenfalls in Echtzeit), in denen es vorwiegend darum geht als Stadthalter oder Herrscher den Wohlstand seine Untertanen zu sichern und sein Reich zu verschönern. Kriegerische Spielhandlungen kommen hier nur am Rande vor und es existiert zumeist die Möglichkeit auf kämpferische Auseinandersetzungen zu verzichten. Auch hier wird die Spielgeschichte in gewohnter Weise erzählt.
Neben den Echtzeit-Strategiespielen gibt es eine Reihe von Spielen, die von diesem Schema abweichen, aber dennoch hierunter gefasst werden könne. Von Interesse sind in dieser Arbeit die sogenannten Denkspiele. Das sind Spiele, welche ohne eine Geschichte auskommen und in der Regel auch keine Charaktere beinhalten. Ein klassisches Denkspiel ist z.B. Tetris, von dem andere Denkspiele zumeist nur Variationen darstellen. Aufgrund des Bekanntheitsgrades von Tetris sollte sich eine weitere Differenzierung erübrigen.
Abenteuer: Hierunter fallen insbesondere die Subkategorien Adventure, Rollenspiel und Online- Rollenspiel. Für diese Arbeit sind nur die Adventures von Interesse.
Adventures zeichnen sich durch eine ausgefeilte Charakterisierung der vom Rezipienten gesteuerten Figur aus, deren einzelne Facetten im Laufe der Geschichte immer weiter ausgebaut werden. Die Spielgeschichte wird in der üblichen Weise erzählt, nur sind die Geschichten ausgefeilter und mit mehr Wendungen versehen, wodurch sie sehr stark an filmische Narration erinnern. Der Spieler steuert seine Figur indirekt mit der Maus durch verschiedene Bereiche. Indirekt heißt: Er klickt mit der Maus auf einen Punkt auf dem Bildschirm und die Figur läuft dann zu eben diesem Punkt. Somit sieht der Spieler die Spielfigur häufig von der Seite. Bei wenigen Spielen (Myst) steuert der Rezipient seine Figur aus der Ego-Perspektive durch die Spielwelt. Spielerisch besteht die Herausforderung darin, verschiedene „logische“ Rätsel zu lösen. Bei dem oben angesprochenen defekten Schlüssel etwa gilt es herauszufinden wie dieser z.B. mit einem Seil, Lack und einem Feuerzeug reparieren werden kann (Ich überlasse es dem Leser sich eine Möglichkeit zu überlegen, wie und ob das realisierbar ist). Dabei steht der Spieler nicht unter Zeitdruck, er kann also so lange überlegen wie er will. Der Spielablauf gestaltet sich demnach nicht dynamisch. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Dialoge mit anderen Spielfiguren, wobei der Rezipient die Wahl zwischen verschiedenen Antworten oder Fragen hat, wodurch oftmals nicht direkt die Handlung vorangebraucht wird aber sehr viel über die Spielwelt und die einzelnen Charaktere in Erfahrung gebracht werden kann.
Auf kämpferische Auseinandersetzungen wird komplett verzichtet.
Sport: Hierunter fallen alle Spiele, die jede erdenkliche Sportart simulieren und bei der Präsentation stark an den vom Fernsehen gewohnten Übertragungen angelehnt sind. Sportspiele sind bis auf eine Ausnahme für diese Arbeit nicht von Bedeutung. Bei der Ausnahme handelt es sich um die so genannten Prügelspiele, die häufig nur auf Konsolen gespielt werden können.
Prügelspiele bieten eine rudimentäre Spielgeschichte, es gibt einen Vorspann indem die einzelnen Charaktere vorgestellt werden und einen Abspann für jede einzelne Figur. Der Spielablauf besteht darin, in einem Zweikampf über drei Runden gegen einen menschlichen oder computergesteuerten Spieler zu gewinnen. Dazu kann der Spieler aus einer Reihe von Kämpfern mit unterschiedlichen Fähigkeiten wählen. Daraus ergibt sich eine ausschließlich auf Kampf ausgelegte, dynamische Spielhandlung. Eine Charakterisierung erfolgt zumeist im Handbuch anhand eines Textes, der die jeweilige Motivation der einzelnen Kämpfer beschreibt an den Kämpfen teilzunehmen. Populärste Vertreter dieser Gattung sind Street Fighter 2 (aufgrund seines Alters kaum noch gespielt, aber wichtig für die Untersuchung von Rita Stecke) von dem es sehr verschiedne Varianten gibt, Tekken 4, Mortal Kombat, Virtua Fighter 4 und Soul Calibur 3.
Mit der Skizzierung der Sportspiele ist die Darstellung der verschiedenen Genres abgeschlossen, so dass ich nun zur Klärung der Wesensmerkmale von Computerspielen komme. Zur Erinnerung: Welche Mechanismen sind immanent in Computerspielen vorhanden?
1. 2. Wesensmerkmale von Computerspielen
Augenfälligstes Merkmal aller Computerspiele, wodurch sie sich von anderen audiovisuellen Medien abgrenzen, ist die unabdingbare Notwendigkeit der Steuerung durch den Nutzer. Der Nutzer steuert, je nach Genre, immer etwas, sei es eine Spielfigur oder verschiedene Objekte. Rezipienten interagieren somit immer mit einem Computerspiel, welches ohne Interaktivität nicht „existieren“ kann. Das heißt: Ohne Interaktion gibt es kein Vorankommen im Computerspiel und auch keine Spielgeschichte, die sich entfalten kann. Somit ist das Computerspiel im Gegensatz zum z.B. Fernsehen kein passives Medium. Was kennzeichnet den Begriff Interaktivität?
Zwei Definitionsversuche:
Im Buch „Schlüsselbegriffe der Soziologie“ lässt sich unter Interaktion folgende Definition nachlesen: „[…] [E]in wechselseitiges soziales Handeln von zwei oder mehr Personen, wobei jeder der Partner sich in seinem Handeln daran orientiert, dass der andere sich in seinem Handeln auf das vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Verhalten des anderen bezieht“[5].
Michael Jäckel kennzeichnet mit Interaktivität eine „Beziehung zwischen zwei oder mehr Personen, die sich in ihrem Verhalten aneinander orientieren und sich gegenseitig wahrnehmen können“[6].
Die zweite Definition ist in ihrer Elementarität ungeeignet auf Computerspiele übertragen zu werden, sie vernachlässigt den nicht unwesentlichen Teil des Bezugs auf vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftiges Verhalten, wie er in der ersten Definition zum Ausdruck kommt. Weshalb ist dies von Bedeutung, da doch beide Definitionen ähnliche Aspekte beinhalten?
Dazu ein einfaches Beispiel: Wenn ein Spieler online spielt und sich mit seinem Nick eine „Identität“ gibt und dann anfängt zu cheaten oder eigene Teammitglieder zu „töten“, wird dieser Spieler eventuell vom Server verbannt und sein Nickname, welcher in Verbindung mit seiner Spielweise steht, wird durch verschiedene Foren bekannt oder er trifft bei zukünftigen Spielen öfter auf die gleichen Mitspieler, dann kann es sein, dass er jedes Mal von den verschiedenen Servern verbannt wird, da er sich einen „Ruf“ erworben hat und auch dann sanktioniert wird, wenn sich seine Spielweise verändert hat. Oder er entschuldigt sich für sein vergangenes Verhalten und die Entschuldigung wird akzeptiert, wodurch der betreffende Spieler allerdings unter „Beobachtung steht“ und die Skepsis gegen seine „Person“ nur durch zukünftiges korrektes Spielen ablegen kann. Auch wenn das Beispiel banal anmuten mag, so ist der „Ruf“ von Spielern gerade im Profi- Bereich von großer Bedeutung, da sich mittlerweile mit dem Spielen von Computerspielen Geld verdienen lässt.
An dem Beispiel wird auch ein Defizit der Definitionen deutlich.
Beide Definitionen können die Interaktion im Computerspiel nicht treffend bezeichnen, da zumindest im Einzelspieler- Modus keine andere Person „unmittelbar“ involviert ist, und damit eine Interaktion des Spielers nach diesen Definitionen höchstens mit einem Zuschauer möglich währen. Der Begriff muss demnach erweitert werden, um die Austauschbeziehung zwischen Rezipienten und Computer mit zu berücksichtigen. Die Informatik bezeichnet Interaktivität als „das Verhältnis und den Austausch zwischen Mensch und Maschine“[7].
Unter Berücksichtigung der Definitionen von Bahrdt und der Informatik kann die Interaktion im Computerspiel treffend bezeichnet werden. „So wird die Forderung der Informatik nach einem Austausch zwischen Mensch und Maschine bereits durch die optoakustisch rückgekoppelte Steuerung des Spiels (Maschine) durch den Nutzer (Mensch) erfüllt. In der Welt des Computerspiels selbst kommt es dann – insbesondere bei Spielen mit ausgeprägter Story, z.B. Adventures – oftmals zu einem Kontakt mit virtuellen Charakteren, welcher die von Soziologie […] definierte Interaktion zumindest auf einem sehr primitiven Niveau simuliert: Die vom Spieler gesteuerte Figur interagiert mit den computergenerierten Charakteren des Spiels auf eine Weise, die eine Interaktion von Mensch zu Mensch in Ansätzen nachstellt“[8]. Es handelt sich hierbei jedoch um sehr beschränkte Imitation einer Mensch-Mensch-Interaktion, da die Simulationsmöglichkeiten der heutigen Programme stark limitiert ist und diese Art der Interaktion nur einer mechanisch-regelhaften Spielfunktion dienen, also allein im Kontext des Vorankommens im jeweiligen Spiel existieren, wodurch nur begrenzte Kommunikationsangebote für den Rezipienten bestehen. Näher an eine „echte“ Interaktion kommen Online-Spiele, in denen der Computer als Vermittler von Interaktion zwischen Menschen dienen kann.
Gibt es noch weitere Charakteristika? Wenn auch Interaktivität ein Kernelement von Computerspielen darstellt, so gibt es noch eine Reihe von Grundmustern, die Jürgen Fritz (Macht, Herrschaft und Kontrolle im Computerspiel, in: Handbuch Medien, S. 193) herausgearbeitet hat. Wobei man hierbei Interaktivität als Unterbau betrachten kann, auf dem alle anderen Elemente von Computerspielen aufbauen. Folgende Grundmuster durchziehen nach Fritz alle Computerspiele, unabhängig welchem Genre sie zugeordnet werden:
a) Kampf, b)Erledigung, c) Bereicherung, d) Verbreitung, e)Ziellauf, f)Prüfung und Bewährung und g) Ordnung.
Die Grundmuster verweisen nach Fritz immer auf bestimmte Aspekte in den Lebensthematiken und kulturell- gesellschaftlichen Verhaltensmustern der Rezipienten. In ihrer lebensweltlichen Entsprechung bedeutet dies:
a)Auseinandersetzungen führen und Konflikte mit anderen Menschen austragen, b)Aufgaben zur Zufriedenheit erledigen, c)reicher werden, an Fähigkeiten und Möglichkeiten wachsen, d) den eigenen Wirkungskreis erweitern, die Einflusszonen vergrößern, e) als Erster eine Aufgabe erfüllen und ans Ziel gelangen, f) Prüfungs- und Bewährungssituationen bestehen, g) Elemente des Lebens in eine sinnvolle (brauchbare, nützliche) Ordnung bringen.
Das heißt: Auch Computerspiele existieren nicht losgelöst von den persönlichen Präferenzen der Rezipienten, die hinsichtlich ihrer Spielauswahl nicht wahllos ein Spiel herauspicken, sondern die Wahl im eigenen sozialen Kontext treffen. Nach Fritz haben die bevorzugten Spielinhalte oftmals einen deutlichen Selbstbezug. „Spieler, die sich in aggressiv getönten Lebenskontexten zurechtfinden müssen, greifen häufig zu Spielen, bei denen es um körperliche Auseinandersetzungen geht [Actionspiele, kriegerische Strategiespiel, Prügelspiele]. Menschen, die viel organisieren müssen, bevorzugen Spiele, in denen gerade diese Fähigkeit verlangt wird [Aufbau-Stategiespiele]“[9].
Der Selbstbezug spielt sicherlich eine Bedeutung bei der Spielauswahl, allerdings übersieht Fritz in seinen Überlegungen zwei nicht unwesentliche Punkte: 1. Spieler, die in aggressiven Lebenskontexten leben, müssen deswegen nicht per se Spiele mit körperlichen Auseinandersetzungen präferieren. Vorstellbar wäre auch, dass Menschen in solchen Lebenskontexten bewusst auf Spiele zurückgreifen, die konträr zu ihrer Lebenswelt stehen. 2. Welches Genre von Computerspielen genutzt wird, hängt auch von der gerade vorherrschenden Stimmung ab. Die Auslegung der Grundmuster könnten aber den Eindruck erwecken, dass die Rezipienten ihrer Lebensumwelt in Bezug auf Computerspiele ausgeliefert sind und die Auswahl von Spielen allein davon abhängig ist, ohne, dass der Spieler eine wirkliche „Wahl“ zu haben scheint. Wenn auch mit den genannten Einschränkungen, so wäre es schlichtweg falsch, würde man den Lebenskontext komplett ausblenden. Es gibt kein von seinem Lebenskontext losgelöstes Subjekt. Ein nur durch diesen Kontext „definiertes“ Subjekt allerdings auch nicht. Für das Thema ist es wichtig, den Nutzer nicht vollkommen isoliert zu betrachten (wie in vielen Medientheoretischen Ansätzen und einigen Psychologischen), sondern ihn auch als selbst bestimmendes Subjekt zu begreifen. Dessen bewusst (eine eingehende Beschäftigung damit folgt in Kapitel 3.5.), folgt zunächst die Betrachtung der Grundmuster nach möglichen Gemeinsamkeiten und deren spielerischen Bedeutungen.
1. 2. 1. Spielerische Merkmale
„Von anderen Massenmedien unterscheiden sich Computerspiele dadurch, dass sie Spielenden die Möglichkeiten geben, Kontrolle auszuüben und Fertigkeiten zu entwickeln“[10]
Die Gemeinsamkeiten der Grundmuster bestehen in ihrer Ausrichtung auf ein Ziel, und damit dem Erhalt eines „Bleiberechts“ in der Spielwelt. Die Anforderungen von Spielen an die Nutzer bestehen zunächst darin, dass die Nutzer in der Lage sein müssen in dieser Welt zu „überleben“, sich in ihr zurechtzufinden. „Dazu muß der Spieler über das Spiel und damit über sich selbst die Kontrolle erlangen“[11]. Die Kontrolle kann ein Rezipient über die Beherrschung der dem Spiel immanenten Regeln erlangen. Woraus bestehen diese?
Die Regeln der spielerischen Welt bestehen aus einfachen funktionalen Wirkungszusammenhängen. Zumeist geht es darum alle Gegner zu beseitigen, um erfolgreich das nächste Level oder die nächste Spielstufe zu erreichen. Vermieden werden muss dabei, dass die eigene Spielfigur getroffen wird, was mit „Lebensentzug“ oder dem Abziehen von „Lebensenergie“ bestraft wird. Eine „Vernachlässigung“ dieses Prinzips hat einen Misserfolg, in Form eines Spielabbruchs oder eines Wiedereinsteigens beim letzten Speicherstand zur Folge, da es nur begrenzt viele „Spielleben“ und „Energie“ gibt. Vielfach gilt auch: „Das Aktivieren einer Maschine in Raum A mit einem Schlüssel aus Raum B öffnet eine Tür in Raum C, wodurch der Spieler sich Zugang zu weiteren Räumen erschließt, in denen ähnliche Aufgaben auf ihn warten“[12]. Dabei dürfen die Anforderungen den Rezipienten nicht überfordern, um Misserfolge zu vermeiden, und ein Abbruch des Spiels zu verhindern. Gleichwohl darf sich der Spieler nicht unterfordert fühlen, damit das Interesse am jeweiligen Spiel und dadurch auch die Beschäftigung mit demselben nicht abnimmt. Gelingt eine erfolgreiche Spielkontrolle treten die inhaltlichen Aspekte des jeweiligen Spiels ein Stück weit in den Hintergrund. So äußerten nach Fritz gerade erwachsene Spielerinnen häufig eine starke Ablehnung aller Spiele mit deutlichen kriegerischen, „gewalthaltigen Inhalten“, welche dann nochmals verstärkt betont wurde, wenn sich kein Erfolg bei solchen Spielen einstellen wollte. Dabei stellte sich heraus, dass Studentinnen ihre Bewertung dieser Spielthematiken änderten, wenn sie in der Lage waren ein Spiel solchen Inhalts zu kontrollieren und sich dadurch Erfolgserlebnisse einstellten (vgl. Jürgen Fritz/ Wolfgang Fehr, Handbuch Medien: S.69).
Somit könnte eine erste Vermutung dahingehend geäußert werden, dass der spielerische Inhalt nicht primär einen Motivationsanreiz zum Weiterspielen gibt, sondern es vielmehr auf die Kontrollierbarkeit ankommt, wodurch auch Frustrationsmomente minimiert werden, welches wichtig ist, damit sich ein „Flow“ einstellen kann. Zu berücksichtigen bleibt dabei aber, dass der erste „Kontakt“ mit einem Spiel sehr stark von den inhaltlichen Erwartungen der potentiellen Spieler abhängt. Die Studentinnen hätten sich wahrscheinlich nicht ohne die Auforderung von Fritz mit Actionspielen beschäftigt. Erst danach tritt das Inhaltliche ein Stück weit in den Hintergrund, da selbst das inhaltlich „perfekte“ Spiel für einen Spieler nicht von diesem weitergespielt wird, wenn es zu schwer und dadurch nicht kontrollierbar ist und sich keine Erfolgserlebnisse einstellen.
Die Studentinnen lehnten auch Spiele ab, die als zu hektisch empfunden wurden, weil sie bei den Spielerinnen unangenehme Gefühle auslösten, wie bei folgender Studentin: „Ich lehne Actiongames hauptsächlich wegen der Hektik ab. Die macht mich dann selber hektisch. Es ist weniger das Spiel, als mehr so das rein Visuelle. Es ist ja auch auf dem Bildschirm alles so hektisch. Und da werde ich hinterher selber so ganz kribbelig. Ich meine, es ist nicht das Spiel an sich“[13]. An der Aussage wird deutlich, dass die Studentin den Anforderungen des Spiels nicht gewachsen war und dadurch keine Erfolgserlebnisse „verbuchen“ konnte. Durch den anhaltenden Misserfolg stellte sich bei der Probandin eine Hilflosigkeit ein, dergestalt, dass sie nicht wusste wie sie die Spielaufgaben meistern sollte, wodurch sie nun selber immer hektischer wurde. Hieraus ergibt sich nun ein Kreislauf, der sich gegenseitig verstärkenden Aspekte, an deren Ende nur ein Spielabbruch stehen kann. Die Studentin war nicht in der Lage eine immanente Forderung von Computerspielen an deren Nutzer zu erfüllen, wie sie in Punkt 3.3 erörtert wird. r den Prozess der Zivilisation), zwei Tendenzen konstatieren. Nach Elias wies physische Gewalt in mittelalterlichen Gesellschaften andere Konnotationsfelder auf als heute. Das Verhältnis zu physischen Gewalthandlungen zeichnete sich durch eine gewisse Unbekümmertheit aus, sie waren weit verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert. Die positive Wertung von physischer Gewalt wandelte sich im Laufe des Zivilisationsprozesses, zu einer negativen Wertung körperlicher Gewalt. Eine Tendenz besteht in der allmählichen Durchsetzung eines Verzichts auf physische Gewalthandlungen. Die zweite Tendenz lässt sich schon an den Höhlenmalereinen in Altmaria und Lascaux erkennen. Die Malereinen „erzählen […] von einer ersten mentalen Auseinandersetzung und gelungenen ästhetischen Brechung des Schreckens, der Grausamkeit und der Vergewaltigung, die die Erfahrung der Sexualität, des Todes und des Blutopfers im Bewusstseinshaushalt jener Lebewesen damals hinterlassen haben muss“[44]. Jene Höhlenmalereien sind frühste Kennzeichen einer Umleitung unmittelbar erlebter physischer und psychischer Gewalthandlungen in Zeichen und Bilder. Hierin manifestiert sich die zweite Tendenz, die Ästhetisierung von Gewalt. Wie sind beide Tendenzen genau zu verstehen?
1. Durchsetzung eines Verzichts auf physische Gewalthandlungen
Eine neue Auffassung physischer Gewalthandlungen setzt nach Elias in etwa mit d Urteile über Chaos Engine ohne Erfolgserlebnisse: Studentin: „Das Spiel ´Chaos Engine´ fand ich doof. Das war unheimlich schnell und ich wurde eher erschossen, als ich schießen konnte. Und dann war es noch blöd, daß ich nur in vier verschiedenen Richtungen schießen konnte und nicht quer. Also, ich weiß nicht, ob man das kann. Aber ich hab das jedenfalls nicht rausgekriegt, ob man diagonal schießen kann. Darum bin ich dauernd gestorben und das fand ich nicht so erfreulich“[15].
Mit Erfolgserlebnissen: Studentin: „Hauptsache Aufpassen, daß du nicht von einer Kugel getroffen wirst. Wobei das jetzt schon viel besser war, als wir das im Seminar gespielt haben. Da war ich immer nur tot. Also ich konnte jetzt besser den Kugeln ausweichen, und das hat mir auch ein bißchen mehr Spaß gemacht, als ich dann auch einmal um die Ecke gekommen bin“[16]. Werde die Spielerfolge größer und die Kontrolle über das Spiel besser, änderten sich die Einstellungen der StudentInnen gegenüber dem Spiel, zu Beginn reagierten alle ablehnend. Wieder eine Studentin: „Ja, ´Chaos Engine´, das hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich erst eine Abneigung dagegen hatte. Aber das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Mir hat gefallen, daß man doch nach einiger Zeit wußte oder sich ausrechnen konnte, auf was man achten muß, und wie es dann so weitergeht, und dann eben Punkte machen. Fand ich also ganz gut! Beim ersten Mal hat mich das Chaotische sehr gestört. Dieses Peng- Peng fand ich dann aber lustiger, weniger störend, mehr lustig! Und wenn man das dann so raus hat!“[17].
Auch die von vielen Studentinnen negativ bewertete Spielhandlung des Abschießens und Tötens erhielt bei Erfolgserlebnissen eine andere Ausprägung: „Es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht, einfach so draufloszuballern. Ich weiß auch nicht […] So draufloszuballern kann einerseits sehr entlastend sein, aber andererseits, ja wenn es dann nicht klappt, ist man schon wieder rappeliger“[18]. Der oben genannte Kreislauf beginnt in einem solchen Fall wieder von neuem. Interessant an der Aussage: „Ich weiß auch nicht“ ist, dass sich die Studentin in einem Zwiespalt zwischen Faszination und eigener moralischen und auch gesellschaftlich intendierter Vorstellung befindet, dass solche Art der „Gewaltdarstellung“ eigentlich negativ zu bewerten ist. Ich werde drauf im Laufe der Arbeit noch näher eingehen.
Wie gehen Produzenten von Computerspielen damit um?
Produzenten von Computerspielen wissen um eine solche Notwendigkeit und bieten von vornherein bei den meisten Spielen verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl an. In der Regel kann der Nutzer zwischen einem leichten, mittleren und schweren Schwierigkeitsgrad wählen. Besteht eine solche Möglichkeit nicht von vornherein, besteht von Seiten der Produzenten die Möglichkeit das Spiel per Patch zu entschärfen. So hat z.B. der Produzent von Half Life 2: Episode One (Valve) den Schwierigkeitsgrad per Patch gesenkt, da Valve herausgefunden hat, dass nur 47% der Nutzer das Spiel durchgespielt haben. Wie haben sie dies herausgefunden? Valve entwickelte für Half Life 2 einen eigenen Online- Vertriebsweg, eine Software mit dem Namen „Steam“, über den das Spiel direkt heruntergeladen werden kann. Ebenso muss man Steam installieren, wenn man das Spiel im Laden kauft, da einige Daten benötigt werden, die nur über Steam heruntergeladen werden können. Dazu ist es weiterhin notwendig sich bei Valve online zu registrieren, wodurch Valve wiederum einige Informationen über seine Nutzer sammelt. Um nun herauszufinden, wie viele Spieler Episode One durchgespielt haben wurde über Steam eine Befragung darüber durchgeführt und anhand der Daten beschlossen einen Patch zu entwickeln. Es gibt leider keine öffentlichen Daten darüber, wie viele Spieler daran teilgenommen haben, sodass nicht belegt werden kann, ob wirklich nur 47% der Spieler bis zum Ende gespielt haben. Dennoch kann dieses Vorgehen zur Stützung der Überlegungen über die Wichtigkeit der Spielkontrolle berücksichtigt werden.
Welche weitere Bedeutung hat die Beherrschung der Spielregeln?
Über „reine“ Erfolgserlebnisse hinaus kann sich beim Rezipienten auch ein Gefühl von „Macht“ entwickeln, welches unmittelbar mit Spielkontrolle zusammenhängt. Die Bedeutung von „Macht“ und auch „Ohnmacht“ hat Fritz (Macht, Herrschaft und Kontrolle im Computerspiel, in: Handbuch Medien: Computerspiele) herausgearbeitet. Wie sieht der Zusammenhang zwischen „Macht“ und auch „Ohnmacht“ im Kontext von Computerspielen aus?
„Macht“ und „Ohnmacht“ im Spiel: Im Spiel haben „Macht“ und „Ohnmacht“ die gleichen Entsprechungen wie im Leben aller Menschen. Die Erfahrungen und Kenntnisse die sich aus Situationen ergeben, die jeder einmal erlebt hat, dass in konkreten Lebenssituationen mein Gegenüber über mehr oder weniger „Macht“ verfügt als ich selbst und dieser Situation ausgeliefert zu sein, ohne sie zu meinen Gunsten beeinflussen zu können („Ohnmacht“), haben ihre Entsprechung im Computerspiel, wenn meine eigene „Macht“ (Spielkontrolle) nicht mehr ausreicht, um mein Überleben im Spiel zu sichern. „Was „Macht“ letztlich „machtvoll“ „macht“ hängt von vielen Faktoren ab: eigene Fähigkeiten und Kräfte, situative Bedingungen, wechselseitige Erwartungen und vieles andere“[19]. An die Erfahrungen von „Ohnmacht“ und „Macht“ knüpfen Computerspielen an, in deren „virtuellen“ Räumen der Spieler auf unterschiedlichen Ebenen und zu unterschiedlichen Themenbereichen „Macht“ entwickeln und sich gegen gegnerische „Macht“ behaupten muss. Anhand von Erfolgserlebnissen und Spielkontrolle erwirbt der Spieler ein Gefühl von „Macht“, also ein Gefühl, jede Herausforderung des Spiels zu bewältigen und auf dem eingeschlagenen spielerischen Weg selbstbewusst voranzuschreiten. „Insofern kann das Spiel zu einer „Selbstmedikation“ gegen das Gefühl werden, den Forderungen des Lebens nicht zu genügen, weil die Macht zu ihrer Erfüllung nicht ausreicht“[20].
Demnach knüpft der Aspekt der Spielkontrolle ebenfalls an eigene lebensweltliche Erfahrungen an und bietet darüber hinaus eine Möglichkeit eines Rollentausches an, dergestalt, dass im Computerspiel der Rezipient, wenn auch nur innerhalb der vorgegebenen Spielwelt mit verkürzten Handlungsmöglichkeiten, die alleinige Entscheidungsinstanz ist. Genauer: Auch wenn er die Spielregeln und das Design nicht verändern kann, so bietet ein Computerspiel doch gewisse Freiheitsgrade, die es dem Spieler erlauben, verschiedene Handlungsrollen und Perspektiven einzunehmen, somit neue Spielsituationen zu kreieren oder höhere Level zu erreichen. Und innerhalb dieses Rahmens braucht sich der Nutzer nicht einer übergeordneten „Erscheinung“ unterordnen, sondern er selbst ist diese Erscheinung. Damit ist ein Aspekt angesprochen, dem gerade in den Überlegungen über computerspielende Kinder und Jugendliche weiter nachgegangen werden soll, und der somit in 3.4. weiter besprochen wird.
Die in der Reflexion zu „Macht“ und „Ohnmacht“ bereits anklingenden Motive und mögliche Faszinationen, die Computerspiele ausüben, werden im Folgenden eingehender betrachtet.
1. 3. Faszination von Computerspielen
Das japanische Wort „hamaru“, wird von Spielern in Japan verwendet um ihrer Leidenschaft des Spielens Ausdruck zu verleihen. „Hamaru“ bedeutet sinngemäß übersetzt „an etwas kleben bleiben“ oder „in etwas hineinfallen“. Im Kontext von Videospielen wird der Begriff von den Spielern verwendet um auszudrücken, dass ein Spiel so faszinierend ist, dass man nicht mehr damit aufhören kann. „Die Handlungen der Spieler und die Echtzeitreaktion auf dem Bildschirm erzeugt eine Art Datenzirkulation oder Feedbackschlaufe. Spieler werden in dieser Schlaufe gefangen und ihr Geist bleibt darin hängen“[21]. Insbesondere jünger SpielerInnen berichten über derartige Erfahrungen. Zwei Aussagen von Schülerinnen, 16 und 17 Jahre alt.
„Das zieht einen irgendwie immer an. Das ist das Spiel! […] Jedesmal, wenn ich nach der Schule nach Hause kam, hab ich direkt gespielt. Ich war irgendwie süchtig“[22].
„Ich weiß nicht, also ich will irgendwann nicht mehr aufhören, ich will immer weiter. Ich weiß, daß ich irgendwann ans Ziel komme und dann nichts mehr zu lösen ist“[23].
Beide Spielerinnen bereichten darüber, dass ein Spiel sie so sehr in Anspruch genommen hatte, dass sie mit dem Spielen nicht mehr aufhören konnten, ohne sich erklären zu können, warum das so war. Einen Ansatzpunkt zur Erhellung der Frage nach einer möglichen Faszination bieten die Überlegungen von Jürgen Fritz (Warum Computerspiele faszinieren?. Weinheim und München 1995).
In seinen Interviews beschrieben die Probanten ihren Aufenthalt in der „virtuellen“ Welt des Computerspiels mit Begriffen wie: ausklingen, mich vergessen, abtauchen, fesseln, reinversetzen, reinfinden, drin sein, ausleben, verfallen, ganz dabei sein, abschalten, vertiefen. Mit anderen Worten: Die Rezipienten fordern von Computerspielen, dass diese Welt ihnen eine Erfahrung, Erlebnis bieten, welche einerseits so „glaubwürdig“ erscheint, wie ihre eigene Lebenswelt und anderseits muss die „virtuelle“ Welt Erlebnisse bieten, die sich klar von der „realen“ Welt der Rezipienten abgrenzt. Wie schon gezeigt wurde, bieten Computerspiele diese Möglichkeit, wenn die Spieler in der Lage sind, die Spielkontrolle zu erlangen, wodurch sich Erfolgserlebnisse einstellen. Erweitert werden müssen die bisherigen Überlegungen aber um einen weiteren Aspekt, den Computerspiele an deren Nutzer stellen. Durch die auf Leistung, Kontrolle und Herrschaft aufgebaute Welt mit ihren internen Strukturen, werden die Nutzer nur dann in der Lage sein diese Welt zu „beherrschen“, wenn ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration für das jeweilige Spiel aufbringen, was wiederum einen intensiven Aufenthalt in der jeweiligen Welt begünstigt. Der Ausgangspunkt für solch ein intensives Spielerlebnis ist nach Fritz die Erfahrung der eigenen Kompetenz. Kompetenz bedeutet hier: Das Gefühl, etwas wirklich zu können und dafür eine Bestätigung zu bekommen. Dieses Gefühl ist für manche Jungen und Mädchen so befriedigend, dass sie es möglichst lange genießen wollen. Woraus sich dann eine Sogwirkung auf die Spieler entwickelt, welche sie selbst an sich beobachten können, wie in den obigen Zitaten anklingt. Um das Gefühl der Kompetenz vollends genießen zu können, müssen die Spieler bereit sein ganz in die Tätigkeit des „Computerspielens“ einzutauchen und sich nicht ablenken zu lassen. Wie ein 17jähriger Schüler berichtet. „Eigentlich ist das reizlos, wenn man zuviel Abstand hat vom Computerspielen, finde ich. Es verliert eigentlich jeden Reiz. Wenn man sich da wirklich hinsetzt und denkt: Ja das ist irgend ein blödes Spiel, da läuft jetzt irgend ein blödes Teil rum, du steuerst das irgendwie von ganz außen, dann wird es irgendwo uninteressant. Für mich liegt auf jeden der Reiz darin, sich da reinzuversetzen und zu versuchen, sozusagen in die Welt einzutauchen. Und eben, wenn das richtige Spiel kommt, dann sitze ich dann halt auch da wie so ein Depp, stundenlang. Spiele halt die Nacht durch oder so. Weil ich da total drin gefesselt bin, würde ich sagen“[24].
Fritz vermutet, dass die Verminderung der Distanz für viele Spieler einen „Reizschutz“ schafft. Seine Überlegungen zu folge schirmen die Spiele den Spieler von seiner „mentalen“ Welt ab, indem sie das Reizniveau des Spiels so sehr anheben, dass der Spieler auf keine anderen Gedanken, die sich nicht mit dem Spiel beschäftigen, mehr kommt. Der eigentliche Spielreiz besteht dann in der Notwendigkeit sich konzentrieren zu müssen. „Mir gefällt, daß ich, wenn ich ein Spiel spiele, immer nur an das Spiel denken muß und nur mit dem Spiel verbunden bin und gar nichts anderes. Ich konzentriere mich nur auf das Spiel (Schüler, 13 Jahre)“[25].
Folgt man den bisherigen Überlegungen beinhaltet die Faszinationswirkung von Computerspielen vier Aspekte: Spielkontrolle, Erfolgserlebnisse, Kompetenz und Eintauchen in die „virtuelle“ Welt. Durch die Bewältigung der Grundmuster von Computerspielen stellen sich bei den Rezipienten Erfolgserlebnisse ein, wodurch die Nutzer ein Gefühl von Macht erlangen und gleichzeitig vom Spiel signalisiert bekommen, dass sie sich in diesem Gebiet auskennen (kompetent sind). Die Voraussetzung für ein solches Empfinden liegt in der Bereitschaft der Nutzer sich vollständig auf ein Spiel einzulassen, in dieses einzutauchen. Dabei schirmen die Spiele den Spieler von seiner „mentalen“ Welt, laut Fritz, ab. Jedoch steht genau diese Abgrenzungserscheinung noch zur Disposition, da es nicht eine unmittelbare Folge von Spielerfahrungen sein muss. Unter Berücksichtigung von Flow- Erlebnissen ist es denkbar, dass Spieler ein Spiel so gut beherrschen, dass sie sich keine Gedanken mehr um den Spielablauf und die vom Spiel ausgehenden „Signale“ machen müssen, sondern alle relevanten Handlungen automatisch vollziehen. Dadurch brauchen sich derartige Spieler in ihren Gedanken nicht mit der Spielwelt beschäftigen und können in dieser abschweifen. Eine derartige „Spielkontrolle“ tritt allerdings erst dann zu Tage, wenn der Nutzer das entsprechende Spiel schon „in und auswendig“ kennt und damit auch von vornherein weiß, wann er wie handeln muss. Wodurch jener Aspekt von Fritz nur marginal abgeschwächt wird, die wenigsten Spieler beschäftigen sich mit Spielen, die sie bereits durchgespielt haben. Viel bedeutender ist jedoch, dass Computerspiele den Rezipienten auch explizit die Möglichkeit bieten „mentale“ Erlebnisse zu artikulieren.
Einige Beispiele lassen sich im Internet finden, etwa verschiedene Videos bei You Tube (etwa das Battlefield 2 Video „Mine“). Eine weitere Behandlung des „mentalen“ Aspekts findet in 4.4. statt.
Das bisher Erörterte macht den Versuch zu zeigen, wie Spiele die Nutzer „beeinflussen“ können und welche Folgerungen sich daraus schließen lassen. Die Frage, welche bislang nur am Rande erwähnt wurde, und der jetzt nachgegangen wird lautet: Mit Hilfe welcher Mittel setzt sich der Spieler zu einem Spiel in Beziehung? Gleichsam umfasst die Frage auch die vorherigen Überlegungen und bietet eine Zusammenfassung des Erörterten.
Nach Fritz (Warum Computerspiele faszinieren) setzt sich der Spieler mit Hilfe von 4 miteinander verwobenen Funktionskreisen zu einem Spiel in Beziehung. 1. Die sensumotorische Synchronisierung, 2. die Bedeutungsübertragung, 3. die Regelkompetenz, 4. der Selbstbezug. „Diese vier Funktionskreise könnte man als „Gelenkstücke“ ansehen, die das Motivierungspotential der Bildschirmspiele mit den Persönlichkeitsmerkmalen der Spieler (Interessen, Wünsche, Vorlieben, Fähigkeiten) und dessen Lebenskontext in Beziehung setzt. In den Funktionskreisen entfalten sich die Leistungsanforderungen der Bildschirmspiele“[26].
Sensumotorische Synchronisierung (pragmatischer Funktionskreis): Sensumotorische Synchronisierung bezeichnet das Ineinssetzen der eigenen Körperbewegung mit den Bewegungs- und Handlungsschemata der Spielfigur. Um erfolgreich an der Spielwelt teilnehmen zu können, muss der Spieler versuchen seine Körperbewegungen zu „automatisieren“ und dadurch den funktionalistischen Ansatz der Spiele zu verinnerlichen, um somit besonders bei Ego- Shootern „ohne Nachdenken“ richtig, daher erfolgreich, zu handeln. Gerade bei jüngeren Spielern oder Spielern die nicht vertraut mit einem Spiel sind kann man häufig mimetische Reaktionen auf das Spielgeschehen beobachten, welche eher hinderlich sind, da sie nicht zum Spielerfolg beitragen. „Der Spieler legt sich beispielsweise mit seinem ganzen Körper in die Kurve, wenn er mit seinem „Auto“ auf dem Bildschirm die Kurve scharf nehmen will; er springt mit hoch, wenn die „elektronische Marionette“ über ein Hindernis springen soll“[27]. Somit ist in diesen Beispielen die „sensumotorische Synchronisierung“ noch nicht vorhanden. Mit wachsender Spielerfahrung kommt es zu einem Abbau der mimetischen Körperreaktionen, auch bei neuen Spielen, die die gleichen funktionalen Anforderungen an den Spieler stellen, wie ein vorher erfolgreich absolviertes Spiel. Durch eine erfolgreiche „sensumotorische Synchronisierung“ entsteht beim Spieler das befriedigende Gefühl, die Spielfigur ebenso gut beherrschen zu können, wie den eigenen Körper.
Bedeutungsübertragung (semantischer Funktionskreis): Übertragungen von Bedeutungen sind immer gekoppelt mit kulturellen Erfahrungen, moralischen Bewertungen und der eigenen Sozialisation. Kurz: Sie sind an die eigene Lebenswelt, den eigenem Habitus gekoppelt. Das gilt auch für Bedeutungsübertragungen auf Computerspiele. Spieler entscheiden sich aus unterschiedlichen Gefühlen und Einstellungen für oder gegen ein Spiel. Wenn, beispielsweise „stark aggressive Bildobjekte das Spiel dominieren und damit bei manchen Spielern (auf dem Hintergrund kultureller Normierungen) negative Einstellungen dem Spiel gegenüber auslösen“[28], kann dies dazu führen, dass solche Spiele gemieden, oder aber auch, dass solche Spieler als „gefährlich“ angesehen werden. Wenn die anfängliche Skepsis gegenüber Spielen überwunden wird und sich Erfolgserlebnisse einstellen kann die negative Einstellung ein Stück weit weichen, wie in 1. 2. 1. gezeigt wurde. Das Gefühl der Ablehnung kann sich allerdings auch festigen, wie folgendes Zitat einer 24jährigen Studentin verdeutlicht:
„Ich habe noch nie mit einem Computer gespielt. Vor einem halben Jahr spielte ich zum ersten Mal 5 Minuten Gameboy bei einer Bekannten. Ein paar Monate später griff ich nach dem Gameboy einer Freundin, als diese kurz zur Toilette ging. Wir spielten dann zusammen weiter. (…) Ich nahm den Gameboy am selben Abend mit nach Hause und spielte so lange `Tetris´, bis um ca. 4 Uhr die Batterien versagten. Ein starkes Gefühl der Abhängigkeit und Sucht stellte sich ein, fast beängstigend, denn eigentlich halte ich diese Spiele für stupide, unkommunikativ und teilweise für Kinder und Jugendliche gefährlich“[29].
Eine kleine Anmerkung zu dem Zitat:
Durch ihre Erlebnisse mit Tetris hat die Studentin erfahren, dass Computerspiele eine Faszination ausüben, der sie sich ungeachtet ihrer kritischen Einstellung nicht entziehen konnte. Gleichzeitig wird sie in ihrer Ablehnung diesem Medium gegenüber bestärkt, da sie nun selbst die Wirkung von Spielen erlebt hat. Wenn schon bei ihr sich suchtähnliche Erlebnisse einstellen, wie sollte es dann erst bei Spielern sein, die sich gerne mit dem Medium beschäftigen. Es scheint, als ob sich der Faszination von Computerspielen nur Diejenigen entziehen können, die gar nicht erst anfangen zu spielen, bzw. rechtzeitig ihre „Gefährdung“ erkennen und das Spielen beenden. In diesem Zitat wird ein Aspekt deutlich, der grade in Hinblick auf „gewalthaltige“ Spiele herangezogen wird, um das Gefährdungspotential von Computerspielen zu verdeutlichen. Kurz: Durch die „Verschmelzung“ mit einem Spiel und der „zwanghaften“ Beschäftigung mit einem Spiel (Sucht) verschwindet die Grenze zwischen „Realität“ und „Virtualität“, woraus ein Gefährdungspotential für die Spieler entsteht. Dies stellt eine Vorstellung vom Spielerlebnis dar, welche häufig in den Medien sowie in verschieden Theorien anzutreffen ist, quasi als Vorannahme gilt und nur noch bestätigt werden muss. In welcher Weise diese Annahme behandelt wird und ob eine solches Verschmelzungserlebnis berechtigterweise angenommen werden kann, ist Teil der Überlegungen in den Abschnitten 3 und 4.
Welche Bedeutung im Hinblick auf Computerspiele hat nun der semantische Funktionskreis?
„Der semantische Funktionskreis hat einen Bezug zu den Symbolspielen. Das Symbolspiel gewinnt seinen Reiz aus der Verwandlung: der Spielgegenstand kann eine andere Bedeutung, der Spieler eine andere Rolle annehmen. Das Geschehen erhält eine andere Bedeutung und dadurch einen für den Spieler besonderen Reiz“[30].
Das heißt: Der Spieler belebt im semantischen Funktionskreis seinen „Stellvertreter“ durch die Bedeutung, die er ihm aufgrund seiner Lebenswelt und Habitus gibt, und dadurch bekommt der „Stellvertreter“ eine eigene bedeutsame Rolle für den Spieler, dem so ermöglicht wird in andere Rollen zu schlüpfen (z.B. als Ork, Zauberer, Kaiser, Flugkapitän oder auch Widerstandskämpfer und „Retter der Menschheit“ oder eben auch „Vernichter der Menschheit“).
Regelkompetenz (syntaktischer Funktionskreis): Im syntaktische Funktionskreis werden Leistungsanforderungen an den Spieler gestellt und Spannungselemente aufgebaut, welche gefühlsmäßige Reaktionen des Spielers in Hinblick auf den Spielverlauf und das Spielerlebnis auslösen. Dazu gehören: Freude, Stolz, Enttäuschung, Verärgerung, Überraschung. Gleichzeitig mit der Spannung des Spiels steigt auch die Anspannung der Spielers selbst, die nun, um dieser Anspannung „Herr zu werden“ versuchen müssen die Regeln der virtuellen Welt zu verstehen, die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu kennen und daraus angemessene Strategien für das Spiel zu entwickeln, ansonsten steigt die Anspannung weiter, wodurch die Handlungen nicht mehr adäquat umgesetzt werden können und somit ein Weiterkommen im Spiel, wie auch Erfolgserlebnisse ausbleiben.
Selbstbezug (dynamischer Funktionskreis): „Der pragmatische, der semantische und der syntaktische Funktionskreis schaffen die Voraussetzung, daß sich die Spieler mit dem Bildschirmspiel überhaupt in Beziehung setzen können. Die Kraft und Energie, mit der sie es tun, erklärt der dynamische Funktionskreis. Die (motivationale) Kraft erwächst dadurch, daß Thematiken, Rollenangebote, Skripte, Episoden und einzelne Szenen des Spiels zum eigenen Lebensbereich, seinen kulturellen Hintergründen, Rollen, Lebensthematiken, einzelnen Episoden und Szenen in Beziehung gesetzt wird“[31].
Welche Bedeutung haben nun die 4 Funktionskreise? Analog zu den bisherigen Überlegungen über Spielkontrolle, Erfolg, Kompetenz und Eintaucherlebnissen weisen auch die Funktionskreise auf ähnliche Muster hin. Im pragmatischen Funktionskreis lernt der Spieler die Regeln des Spiels zu beherrschen und seine anfänglichen „unbedarften“ motorischen Reaktionen einzuschränken; unbedarft deshalb, da sie dem Rezipienten keine bessere Kontrolle über das Spiel gewähren. Das Aufstehen beim z.B. Autofahren einen Hügeln hinauf verbessert nicht die Sichtweise des Rezipienten auf das Spielgeschehen. Im syntaktischen Funktionskreis können sich durch die erlernte Kontrolle Erfolgserlebnisse und Kompetenz einstellen. Wenn dies gelingt kann sich ein Gefühl von Macht einstellen, bei Nichtgelingen besteht die „Gefahr“ des Spielabbruchs und negativer gefühlsmäßiger Reaktionen. Im semantischen Funktionskreis werden Rollenangebote an den Nutzer gestellt, welche ein Eintauchen in die Spielwelt begünstigen. Der dynamische Funktionskreis stellt den verbindenden Teil zwischen Spielanforderungen und Nutzerinteressen dar und die daraus resultierende Motivation sich mit einem Spiel in Beziehung zu setzen. Anhand der 4 Funktionskreise wurde sich der Antwort auf die Frage nach der Faszination von Computerspielen ein Stück weit genähert. Es lässt sich allerdings konstatieren, dass diese Erörterungen nur Einzelspieler- Spiele treffend bezeichnen. Eine Abweichung von diesem Muster bilden die reinen Online- Titel, insbesondere die Ego-Shooter. Welche Besonderheit tritt hier zu Tage?
Online-Ego-Shooter: Zunächst geht es auch bei dieser Spielart um Spielkontrolle, Erfolgs- und Kompetenzerlebnisse. Nur besteht hier weniger die Möglichkeit Rollenangebote, wie im semantischen Funktionskreis beschrieben wahrzunehmen. Genauer: Zwar bieten auch diese Titel eine Auswahl verschiedener Rollen, nur ist deren „Ausfärbung“ nicht sehr ausgeprägt. Wie schon beschrieben gibt es bei diesen Titeln keine Geschichte und vor allem keine Charakterbeschreibung. Es wird nicht der Versuch gemacht eine mögliche Identifikation mit den Spielfiguren zu erleichtern. Durch die Fokussierung auf einen reinen kämpferischen Aspekt geht es in Online- Shootern allein um das Bleiberecht in der Spielwelt, ohne jedoch die Möglichkeit zu bieten im Spiel voranzukommen, da es weder eine Geschichte noch verschiedene Level gibt. Zwar bietet etwa Counter-Strike durch seine Aufgabenstruktur im Kern ein Element, welches zumindest in Ansätzen ein Voranschreiten im Level, ähnlich der Aufgabenstruktur bei Einzelspieler-Spielen, nachstellt, nur müssen sich die Spieler nicht daran halten. Im Gegensatz zum Einzelspieler, der sich zwar auch nicht an die Struktur halten muss, dadurch aber nicht in der Geschichte weiterkommt und auch keine „anderen“ Herausforderungen meistern kann, wenn er einfach nicht im Level fortschreitet, bietet Counter-Strike auch die Möglichkeit sich an einem beliebigen Punkt einer Karte zu verschanzen und auf „Gegner“ zu warten. Gerade auf öffentlichen Servern kann man beobachten, wie Spieler z.B. am Startpunkt auf „Gegner“ warten. Nicht selten ist eine Runde vorbei, ohne dass eine Seite ihr jeweiliges Ziel erfüllt hat. Durch diese Mechanismen besteht, so ist zu vermuten, der Reiz dieser Spiele vor allem auf dem wettbewerbsähnliche „Kräftemessen“ mit von Menschen gesteuerten Spielfiguren und dadurch dem Erwerb einer möglichst positiven Fragrate. Ein weiteres Indiz dafür sind die Kommentare im Chat, welche oftmals Begriffe enthalten, wie z.B. „Noob“ oder „Owned“, als „Ausrufe“ der Überlegenheit über gegnerische Spieler.
Einschränkend bleibt hierbei zu berücksichtigen, dass es sich hierbei allein um eine stärkere Ausprägung der Spielkontrolle mit den genannten Aspekten (Macht, Kompetenz und Erfolgserlebnisse) handelt, wodurch die Möglichkeit der „Rollenübernahme“ ebenso abgeschwächt wird, wie „Eintaucherlebnisse“. Die stärkere Betonung der Spielkontrolle bedeutet aber nicht, dass die theoretischen Darlegung der möglichen Faszinationsprozesse von ihrem Ansatz her diese Art von Spielen ausklammern, da die Möglichkeiten der „Rollenübernahme“ und „Eintaucherlebnisse“ weiterhin existieren. Es gilt aber die Besonderheit dieser Gruppe von Spielen zu beachten, wenn es um „Gewalt“ in Computerspielen geht.
Es wurde schon mehrfach der Begriff „Gewalt“ genannt, ohne diesen näher zu beleuchten, weshalb als zweite Vorarbeit zum eigentlichen Kern der Arbeit nun geklärt werden soll, welchen Bezug der Gewaltbegriff zu Computerspielen hat. Es geht um die Frage: Wenn von „Gewalt“ die Rede ist, was ist damit eigentlich gemeint? Darüber hinaus ist es weiterhin notwendig, auf den Aggressionsbegriff einzugehen, da in vielen Untersuchungen die beiden Begriffe „Gewalt“ und „Aggression“ deckungsgleich verwendet werden. Daraus ergibt sich eine weiter Frage, welcher nachgegangen werden soll: Bezeichnen beide Begriffe gleiche, mögliche Verhaltensweisen, weshalb sie synonym verwendet werden können, oder muss zwischen „Gewalt“ und „Aggression“ unterschieden werden?
2. Gewalt und Aggression
2. 1. Gewalt
Bei der Beschäftigung mit dem Thema Computerspiele gelangt man unweigerlich an den Punkt, an dem die verschiedenen Autoren versuchen den Gewaltbegriff näher zu spezifizieren. Einige Beispiele:
„Ich begreife Gewalt als vermeidbare Beeinträchtigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse oder, allgemeiner ausgedrückt, des Lebens, die den realen Grad der Bedürfnisbefriedigung unter das herabsetzt, was potentiell möglich ist. Die Androhung von Gewalt ist ebenfalls Gewalt“[32].
„Gewalt ist die gezielte Anwendung von Zwang, um einem Menschen oder Tier Schaden zuzufügen. Das Ergebnis ist eine Verletzung – physischer oder psychischer Natur, tödlich oder nicht tödlich“[33].
„Aggression is defined in a minimal way as a behavior thats is aimed at harming or injuring another person or persons“[34].
Alle genannten Definition machen eines deutlich: Der Begriff „Gewalt“ bleibt auch an dieser Stelle merklich undifferenziert. Der erste Definitionsversuch geht davon aus, dass jegliche Beeinträchtigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse oder des Lebens ein Akt von „Gewalt“ ist, auch wenn die Einschränkung gemacht wird, die Beeinträchtigung müsse soweit gehen, dass die Bedürfnisbefriedigung potentiell unmöglich gemacht wird. Dabei bleibt unklar was grundlegende menschliche Bedürfnisse überhaupt sind und wer der Urherber einer möglichen Beeinträchtigung sein soll. Weiterhin wird hier davon ausgegangen, dass jeder Mensch die gleichen Grundbedürfnisse hat und sich diese ebenfalls konstant halten. Vereinfacht lässt sich in dieser Definition festhalten: Ein Akt von Gewalt ist immer dann vorhanden, wenn das Leben eines anderen Menschen in irgendeiner Form von irgendeiner Seite aus beeinträchtigt wird. Die Bandbreite von Verhaltensweisen, welche als Gewalt tituliert werden können ist dadurch so groß, dass jegliches Verhalten als Form von Gewalt interpretiert werden kann, wodurch eine Differenzierung zwischen möglichem gewalttätigen und nicht- gewalttätigen Verhalten unmöglich wird. In der zweiten Definition wird Gewalt auf Handlungen beschränkt, die darauf abzielen Menschen oder Tiere zu verletzen, wobei die Art der Verletzung, physischer oder physischer Art, unerheblich für den Autor ist. Auch hier bleibt der Urheber bzw. Anwender von Zwang unbekannt. Gewalt ist hier die Anwendung von Zwang, Jemandem oder einem Tier gegen seinen Willen? (Fragezeichen da nicht weiter in der Definition erörtert) etwas anzutun, um ihm zu schaden. Auch diese Definition lässt einen großen interpretatorischen Spielraum. Die dritte Definition folgt größtenteils der Zweiten, wobei die Verletzungen sich auf Menschen beschränken. Eine Unterscheidung zwischen physischer oder psychischer Verletzung wird nicht benannt. Interessant ist hierbei, dass in dieser Definition nicht „Gewalt“ näher erläutert werden soll, sondern „Aggression“, wobei die Definition sich nicht wesentlich von den Anderen unterscheidet. Damit ist ein Punkt angesprochen, der sich durch die Literatur zum Thema Computerspiele zieht und von einigen Autoren konstatiert wurde. So schreibt z.B. Ladas: „Die Definition des Begriffes „Gewalt“ ist in der bisherigen Literatur als weitgehend deckungsgleich mit [der] Definition von „Aggression“ anzusehen […]“[35]. Auch wenn die genannten Definitionen nur einen subjektiven Auszug darstellen, so zeigen sie doch auf, dass es Schwierigkeiten gibt, zwischen „Aggression“ und „Gewalt“ zu differenzieren und diese Begriffe enger zu umfassen. Ein Versuch der näheren Bezeichnung soll nun folgen. Zunächst geht es um den Gewaltbegriff und um folgende Frage:
Woran liegt es, dass „Gewalt“ so schwierig zu bestimmen ist?
2. 2. Beliebigkeit des Gewaltbegriffs
Das Problem bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Gewalt, auf die in der öffentlichen Diskussion oft rekurriert wird, krankt, folgt man Karsten Webers Ausführungen (Gewalt und Medien, Gewalt durch Medien, Gewalt ohne Medien?, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt, S. 38), unter anderem daran, dass das, was mit dem Ausdruck Gewalt überhaupt bezeichnet wird, gar nicht klar ist. Wie die im letzten Abschnitt aufgeführten Definitionen gezeigt haben, wird der Begriff in einer Weise verhandelt, dass im Prinzip jeder „unter Gewalt verstehen [kann], was er will: Der eine nur offensichtliche Phänomene wie Töten und Schlagen, der andere verbale Phänomene wie Beleidigen, der dritte subtile Phänomene wie Missachtung und Manipulation, der vierte schließlich gesellschaftliche Phänomene wie ungleiche Bildungschancen. Die Konsequenz: man redet und denkt aneinander vorbei, da der Begriff Gewalt so vielfältige Phänomene bezeichnen kann, daß ohne weitere Konkretisierung eine gemeinsame Ausgangslage nicht zu erreichen ist“[36]. Dass der Begriff so „undifferenziert“ verhandelt wird, liegt auch daran, dass die angesprochene Konkretisierung oftmals gar nicht gewollt ist. Das heißt: Keiner der Autoren ist nicht in der Lage seine „Gedanken“ zum Gewaltbegriff näher zu spezifisieren und dadurch einzuschränken. Das Ziel besteht eher darin, eine allgemeine Definition für Gewalt zu finden, die dadurch auf alle Bereiche, welche mit „Gewalt“ in Berührung kommen angewendet werden kann. Diese Vorgehensweise hat durchaus ihren Vorteil, da solche Definitionsversuche sich oftmals an der Alltagssprache orientieren, woraus sich „keinerlei“ Verständnisschwierigkeiten ergeben, da jede Person die bestehenden Lücken in der Interpretation von „Gewalt“ mit eigenen Assoziationen füllen kann und dadurch zumindest erahnt was der Begriff „Gewalt“ bezeichnet. In einem solchen Zusammenhang wird „Gewalt“ aus einer interpretativen, konstruktivistischen Perspektive betrachtet, die der Interpretation durch Täter, Opfer und Dritter unterliegt. Der Kompromiss, der hierbei eingegangen wird bedeutet aber auch, dass solche Analysen ihrem jeweiligem Gegenstand nicht gerecht werden, da sie eventuelle Besonderheiten ausklammern. Im Zusammenhang mit Computerspielen bedeutet dies, dass „Gewalt“ in Spielen, ungeachtet ihrer Eigenheiten (siehe 2.4.) so behandelt wird, als würde es sich um „real“ praktizierte „Gewalt“ handeln.
Bevor auf die spezifischen Besonderheiten von „Gewalt“ in Computerspielen eingegangen werden soll, ist es nötig zunächst den Gewaltbegriff näher einzugrenzen. Von Interesse für diese Arbeit ist die Unterscheidung zwischen physischer „Gewalt“ und psychischer „Gewalt“. Notwendig wird eine Unterscheidung aufgrund der bereits genannten Definitionen, in denen physische „Gewalt“ oder psychische „Gewalt“ immer mit anklingt, wenn gleich auch nicht explizit darauf eingegangen wird. Weiterhin bezieht sich der mediale Umgang mit „Gewalt“ in Computerspielen immer auf physische „Gewalt“, jedoch ohne dies zu benennen. Die mediale Berichterstattung greift auf ein alltagssprachliches Verständnis von „Gewalt“, explizit physischer „Gewalt“ zurück, mit allen genannten Schwierigkeiten die sich daraus ergeben. Zu diesem Verständnis gehört auch eine Unterscheidung zwischen physischer und psychischer „Gewalt“, die jeder Mensch interpretatorisch erfasst. Um aber genau diesen interpretatorischen Spielraum einzugrenzen, scheint es mir notwendig diese beiden Begriffe näher zu spezifizieren.
2. 3. Formen von Gewalt
2. 3. 1. Physische Gewalt
Wie versucht wurde zu zeigen, ist die Definition von „physischer Gewalt“ eng angelehnt an einem alltagssprachlichen Verständnis von „Gewalt“. Das heißt, immer wenn in einem gesellschaftlichen Diskurs über die Taten eines z. B. computerspielenden Amokläufers (eigentlich immer wenn „Gewalt“ medial aufgearbeitet wird, z. B. in den Nachrichten, Printmedien) gesprochen wird, in dem dann der Begriff „Gewalt“ auftaucht, ist damit eigentlich physische „Gewalt“ gemeint. Wie lässt sich der interpretatorische Spielraum eines alltagsprachlichen Verständnisses eingrenzen? Die Antwort auf die Frage mutet banal an, da sie bereits ein Kennzeichen einer möglichen Definition ist und in dem Begriff bereits mitschwingt, aber dennoch so gut wie nie betont wird. Es geht darum das Physische, also die Körperlichkeit stärker hervorzuheben. Geschieht dies, kann eine präzisere Definition wie folgt aussehen:
Jegliche Formen von Handlungen, die in erster Line gegen den Körper eines anderen gerichtet sind, wobei die Schädigung/en von einer anderen Person/en ausgeht, welche aktiv beteiligt ist. Einige Autoren wie z.B. Willfried Gottschalch (siehe Buch: Männlichkeit und Gewalt) erweitern die Definition um den Aspekt einer körperlichen Überlegenheit des Täters/Täter über die Opfer, welche physische Gewalt voraussetzt. Dieser Aspekt ist kein unmittelbares Kennzeichen physischer Gewalt, da körperliche Schädigungen auf vielfältige Art geschehen können, z.B. durch Gift, Waffen und allerhand mehr. Entscheidend ist letztendlich, dass die Schädigung aktiv von einer oder mehreren Personen ausgeht und auf den Körper anderer abzielt.
2. 3. 2. Psychische Gewalt
Eine Definition von psychischer „Gewalt“ zu erarbeiten ist erheblich schwieriger, da psychische „Gewalt“ sich nicht unmittelbar an bestimmten Aspekten festmachen läst. Im Gegensatz zur physischen Gewalt, deren Indizien sich an den Körper der Opfer abzeichnen, woraus man schließen kann, dass hier physisch auf das Opfer eingewirkt wurde, fehlt ein solches Indiz bei psychischer „Gewalt“. Ein weiteres Problem besteht in der nicht direkten Abgrenzbarkeit beider Begriffe. Psychische „Gewalt“ kann in physische Gewalt umschlagen. Dennoch muss der Versuch einer begrifflichen Abgrenzung gemacht werden (siehe 2. 2.), da sie eben nicht austauschbar sind. Klarer wird der Begriff durch die Betrachtung von Äußerungen durch Personen, die Erfahrungen gemacht haben, die nicht unmittelbar als physische Gewalt (nach obiger Definition) erfahren wurde. Häufig werden diese Erfahrungen als Demütigung empfunden und gleichzeitig mit einem Gefühl von Scham mit der eigenen Person gekoppelt. Demnach kann psychische Gewalt als nicht unmittelbare Schädigung des Körpers eines Menschen/ mehrer Menschen durch andere Menschen verstanden werden, deren Ziel darin besteht die Psyche, das Selbstwertgefühl zu verringern. Natürlich kann psychische Gewalt physischer vorausgehen und ist daher eben nicht so klar abgrenzbar, aber psychische Gewalt muss nicht zwangsläufig in physischer Gewalt enden und daher ist eine Unterscheidung hilfreich.
Inwieweit sind diese Überlegungen in Bezug auf Computerspiele von Bedeutung?
2. 4. Gewalt in Ego- Shootern
„Killerspiele animieren Jugendliche, andere Menschen zu töten. Das sind völlig unverantwortliche und indiskutable Machwerke, die in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen“[37].
Wie in der Einleitung bereits angesprochen, bezieht sich die mediale Berichterstattung über Computerspiele in gleichförmiger Weise auf Ego-Shooter, besonders auf Counter-Strike, denen ein besonders „jugendgefährdendes“ Potential unterstellt wird. Gleichförmig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Computerspiele zumeist dann in den Fokus der Berichterstattung geraten sobald eine „Amoktat“ bekannt geworden ist und sich bei dem Täter Computerspiele finden lassen, unter denen sich in der Regel auch einige Ego-Shooter befinden, und in den Berichterstattungen sogleich einstimmig die Bezeichnung „Killerspiele“ mit ihren vermuteten negativen Effekten übernommen wird, ohne auf einzelne Titel näher einzugehen. Das sich unter nahezu jeder Computerspielesammlung einige Ego-Shooter befinden ist dabei nicht weiter verwunderlich, handelt es sich doch um eines der beliebtesten Genres. Von nicht unerheblicher Schwierigkeit ist die Klärung des Begriffs: „Killerspiele“, da an dem Begriff an sich nicht klar wird, was er eigentlich bezeichnet. Eine mögliche Klärung des Begriffs konnte, nach den Ereignissen in Emsdetten, aus der anschließenden Flut von Stellungsnahmen herausgelesen werden. Wie im Zitat am Anfang des Kapitels wurde auch in den Stellungsnahmen einer Kennzeichnung von „Killerspielen“ getroffen, die zusammengefasst folgende Definition intendiert: „Killerspiele“ animieren deren Nutzer andere Menschen zu töten, und bieten auch eine entsprechende „Trainingsmöglichkeit“.
Interessant an diesem Zitat ist die Einschränkung auf Jugendliche, die in einem Konsens mit Untersuchungen steht, die sich mit Computerspielen befassen, ohne zu hinterfragen ob Jugendliche „tatsächlich“ in dieser Weise „animiert“ werden und Erwachsene demnach nicht, auch hier verweise ich auf Kapitel 3.4 meiner Arbeit. Weiterhin schwingt in solchen Aussagen immer auch ein Hinweis auf eine mögliche Form von Gewalt mit. Das Gefährdungspotential wird deshalb so hoch eingestuft, da angenommen wird, dass die Gewalt in Computerspielen ohne eine Form der Brechung dieselbe ist wie in der „Realität“. Das bedeutet: Die Handlungen, die im Spiel unternommen werden, werden gleichsam in ähnlicher Weise auch in der „Realität“ unternommen. Die Form der Gewaltanwendung besteht in der Weise, wie sie unter physische Gewalt definiert wurde. Und darin wird das Besorgniserregende von „Killerspielen“ gesehen und eine Verbotsforderung abgeleitet. Dass, das Gefährdungspotential hier höher eingestuft wird, als z.B. bei Filmen, die mit physischen Gewalthandlungen auch nicht grade sparsam umgehen, liegt an der Besonderheit dieses Mediums, denn trotz oberflächlichen Gemeinsamkeiten in der optischen Darstellung von physischer Gewalt in Computerspielen und anderen Medien unterscheidet sich gespielte physische Gewalt von anderen Formen der Darstellung schon allein dadurch, dass physische Gewalt im Computerspiel interaktiv vom Spieler selbst ausgeübt und nicht nur betrachtet wird. Der Interaktivität, wie in 1.2.1 definiert, kommt demnach eine Schlüsselrolle bei der Bewertung von Computerspielen zu.
Gerade aber bei der Interaktivität von Computerspielen muss berücksichtigt werden, dass sie nicht gleichsam eine Annäherung an reale physische Gewalt bedingt, da sie streng an die internen Funktionszusammenhänge (siehe 1.2.1.) des Computerspiels gebunden sind, und nicht real verletzen kann. Real verletzen kann kein Computerspiel, da auch Computerspiele in erste Linie Spiele sind und nicht interaktive Narration. Gleichsam leben alle Arten von Spielen davon, mit ihren Regeln einen Handlungsraum zu umschreiben, der gerade so komplex ist, um genug Aktionsmöglichkeiten zu bieten, um interessant zu sein, dabei aber gleichzeitig im Gegensatz zur „realen“ Welt determiniert und überschaubar genug bleiben, um ein Gefühl der Kontrolle (vgl. 1.2.1., 1.3.) zu vermitteln. In Spielen gibt es keine undefinierten Zustände und keine unkalkulierbaren Konsequenzen. Es gibt klare Regeln der Belohnung und Strafe, welche keine Zweideutigkeiten kennen und allen Teilnehmern bekannt sind. Damit hat jede Wirkung eine erkennbare Ursachen und umgekehrt.
„Das ist es auch, was normalen Gamern erlaubt, im Spiel ohne ständiges schlechtes Gewissen zu »töten«, obwohl sie im realen Leben einen völlig intakten Sinn für Ethik und Moral und keinerlei Mordpläne haben: das Wissen, sich in einen fiktiven Raum zu begeben, in dem solch ethisch- moralische Fragen a priori ausgeschaltet sind, in dem es ein genau umschriebenes Set an Regeln und Möglichkeiten gibt, auf die man sich einlässt. Besonders die so sehr in Verruf geratenen Online- Shooter wie Counterstrike gleichen in ihrer Struktur nichts so sehr wie einer Sportdisziplin“[38].
Aber, so könnte man einwerfen, beim Sport wird nicht der Tod immer und immer wieder durchgespielt. Zunächst stellt der „virtuelle“ Tod auf einer billigen und perfiden Ebene nichts weiter dar, als eine konsequente Weiterentwicklung eines der urältesten und am weitesten verbreiteten Spielprinzipien überhaupt, dem Wettkampf mehrerer Akteure, zur Ermittlung des Siegers. Und das Eliminieren der gegnerischen Spielfigur stellt eines der simpelsten und effektivsten Methoden dar, den eigenen Fortschritt und Erfolg der eigenen Spielfigur zu markieren. „Ein Kill bei Quake [Online-Ego-Shooter] ist in gewisser Hinsicht nicht mehr als die technisch aufgebrezelte Version eines »Und raus bist du!«. Der binäre Sprung von der »1« des Lebens zur »0« des Todes hat eine für Spielzwecke berückende Einfachheit, Zählbarkeit, Logik, ist für ein vergleichsweise einfach konstruiertes Regelwerk die naheliegendste Art, keine weiteren Fragen aufkommen zu lassen“[39].
Bei der Frage um die möglichen „Effekte“ von Computerspielen auf deren Rezipienten, in Hinblick auf die dargestellte Form der Spielgewalt, geht es in erster Line, so lässt sich aus dem bisher Erörterten herausziehen, darum, wie in einem Spiel „getötet“ wird. Das vermeintlich Problematische besteht demnach in der Art der möglichen „Tötungsvarianten“ und deren „Häufigkeit“. Also: Dem „Töten“ von menschenähnlichen Charakteren quasi im vorbeigehe; taucht eine Spielfigur auf, beginnt sie sogleich den Spieler zu attackieren und muss vom Spieler beseitigt werden. Der Rezipient hat in der Regel nicht die Wahl, zumindest bei Ego-Shootern, anders auf die sich ihn in den Weg stellenden Figuren zu reagieren (siehe 1.). Die Handlung, welche der Rezipient ausführen muss, um erfolgreich zu sein, ist, andere Spielfiguren zu „töten“ und damit eine Form von physischer Gewalt auszuüben, welche auch in der optischen Darstellung als solche erkennbar ist. Handelt es sich bei der Gewaltausübung und Darstellung somit um physische Gewalt? In gewisser Weise ja, allerdings müssen die bereits gemachten Einschränkungen berücksichtigte werden, wodurch deutlich wird, dass die Gewalt in Computerspielen nicht „real“ verletzen kann und zumindest in Online-Ego-Shootern einen wettbewerbsähnlichen Charakter hat, wodurch ein Sieger im Sinne von Willmanns Äußerung „keine weiteren Fragen mehr“ aufkommen lässt. Die Intention von Gewalt in Computerspielen ist demnach eine andere, als die realer physischer Gewalt und ähnelt dennoch der „realen“ physischen Gewalt. Dies ist jedoch ein entscheidender Punkt, da die Spielegewalt der „Realen“ ähnelt handelt es sich um eine Simulation realer physischer Gewalt, die als solche erkennbar ist. Gewalt in Computerspielen ist demnach in erster Linie:
Die Simulation von Handlungen, die in erster Line gegen das Abbild einer/mehrer menschenähnlichen Figur/en gerichtet sind, wobei die Schädigung/en von einer/mehrer menschenähnlichen Figur/en ausgeht, die von einer anderen Person/en gesteuert wird, welche aktiv beteiligt ist/sind.
Diese Definition scheint mir geeigneter zu sein, den Besonderheiten von Spielegewalt gerecht zu werden, da hier deutlicher hervorgeht, dass die Schädigungen nicht auf reale Menschen abzielen.
Deutlich wird auch, dass die Diskussionen um mögliche Auswirkungen sich fast immer um die Art von physischen Gewalthandlungen und deren Übertragungen in die „Realität“ drehen. Andere mögliche Formen von Gewalt werden kaum verhandelt. In Anbetracht der überwiegenden Handlungsmöglichkeiten und Strukturen von Ego-Shootern (siehe 1.) ist dies allerdings nicht weiter verwunderlich. Dennoch eine Anmerkung zur psychischen Gewalt:
In Online-Ego-Shootern gibt es die Möglichkeit über ein Chat- Fenster zu kommunizieren und dabei fällt auf, dass häufig Äußerungen getätigt werden, die zumindest den Anschein machen, dass eine reale Person gezielt von einer anderen gedemütigt und eindeutig im Selbstwertgefühl herabgesetzt werden soll und demnach also dem entspricht, was versucht wurde unter psychische Gewalt zu spezifizieren. Ein Phänomen, welches sich nicht auf Online-Ego-Shooter beschränkt, sondern für alle Arten von Online-Spielen gilt, sowie jegliche Form der semi- anonymen (Ein Nickname ist zumeist etwas, dass man direkt ansprechen kann) Kommunikation. Man denke hierbei z.B. an verschiedene Foren oder Gästebucheintragungen im Internet, besonders auf den Seiten, die einem Spezialthema gewidmet sind (Herr der Ringe, Auto- Tuning, Spieleseiten…). Eine Untersuchung über dieses Phänomen wäre begrüßenswert, da meiner Vermutung nach die Semi- Anonymität den alleinigen Grund dafür nicht liefern kann. In meiner Arbeit bleibt dieser Aspekt allerdings unberücksichtigt, da solches Verhalten sich nicht allein auf Computerspiele zurückführen lässt.
Ich möchte im Folgenden das Gefährdungspotential von Computerspielen und deren Auswirkungen auf die Empathie und mögliche reale Gewalthandlungen, wie sie in der Debatte um „Killerspiele“ anklingen behandeln.
Dazu gehört auch die Klärung des Aggressionsbegriffes.
2. 5. Aggression
Vielfach wird in den Analysen von Auswirkungen der Computerspiele auf die Rezipienten nicht klar zwischen physischer Gewalt und Aggression differenziert. Gerade in Laborexperimenten (z. B. Anderson, Craig A./ Karen E. Dill: Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings, and Behaviour in the Laboratory and in Life, 2000) die ursächlich zu klären versuchen, ob es bei Computerspielern zu einer Aggressionssteigerung kommt, ergibt sich in der Interpretation der Ergebnisse die Schwierigkeit, ob die Aggressionssteigerung an sich problematisch ist, oder mögliche Konsequenzen aus dieser, welche eine Gewalthandlung begünstigen. Weiterhin muss auch die Versuchsanordnung kritisch betrachtet werden (siehe 3. 2. 1.). Bevor darauf genauer eingegangen wird, stellt sich zunächst die Frage: Was kennzeichnet der Begriff Aggression? Das Wort Aggression ist vom lateinischen Verb „aggredi“ abgeleitet, was soviel bedeutet wie auf jemanden losgehen, angreifen oder überfallen. Auf jemanden „losgehen, angreifen oder überfallen“ bezieht sich im Kontext von Aggression auf eine unmittelbare Tat, die allerdings vorher durch verschiedene „Signale“ angedeutet wurde. Gerade wenn Aggression untersucht wird, kommt es auf die vorgelagerten Aspekte an, die einer unmittelbaren Handlung vorausgehen. Daher weist der Begriff Aggression eine gewisse Affinität zur Psychologie, genauer zur Psychoanalyse auf.
„Vor allem in der Psychoanalyse werden die Gefühle der Bosheit, des Hasses, der Rache und der Sucht, andere und sich zu quälen, der Aggression zugeordnet“[40]. Eine mögliche Definition von Aggression kann folgendermaßen aussehen:
„Aggression nennen wir ein in Tat, Wort oder auch Wortlosigkeit sich ereignendes Verhalten, welches eine Person- und zwar eine andere Person oder auch den Täter selbst- oder eine Sache (welche eventuell als Surrogat oder Person dient) verletzt, schädigt, ausbeutet (auch sexuell ausbeutet), kränkt, beleidigt, herabsetzt, erniedrigt, entwertet, beraubt, behindert, ins Unrecht setzt, in seinen Lebensmöglichkeiten und seiner Entfaltung einengt, vertreibt oder gar tötet“[41].
Das Zitat zeigt deutlich das Dilemma auf, wenn versucht wird eine allgemeingültige Definition von Aggression herauszuarbeiten. Um möglichst alle Aspekte zu berücksichtigen, ist die Definition so weit gefasst, dass „praktischerweise“ jedes Verhalten als aggressiv bezeichnet werden kann. Eine solche weite Definition von Aggression, die den Begriff als Synonym von Aktivität verwendet, wird von der Psychologie nicht verwendet, da bei dieser Deutung nicht klar wird, welche Erscheinungen im weiteren untersucht werden sollen. „Egal, wie man sich verhält, man ist praktisch immer aggressiv“[42].
In der Psychologie wird daher eine engere Definition von Aggression verwendet.
2. 6. Enge Definition
Enge Definitionen: Aggression ist eine zielgerichtete Handlung, zur Schädigung, Beeinträchtigung und Schmerzzufügung anderer. Auffallend ist hier die nahezu gleiche Definition wie bei der physischen Gewalt. Woraus der Schluss gezogen werden kann, dass die beiden Begriffe gerechtfertigter Weise synonym verwendet werden können, und die Kritik an den Laborstudien ins Leere läuft.
Auf den Zusammenhang bzw. Unterschied zwischen Gewalt und Aggression gehe ich in Punkt 2.8. ein. Zunächst ist es wichtig den Aggressionsbegriff weiter zu differenzieren.
2. 7. Aggression wertend oder feststellend verwendet?
Aggression im alltagssprachlichen Gewand wird meistens in einem wertenden Sinn gebraucht. Das heißt: Jemanden als aggressiv zu bezeichnen, bedeutet dieser Person einen Vorwurf zu machen. Dabei wird das Verhalten anderer Menschen eher als „aggressiv“ bezeichnet, als das eigene. Sieht man z. B. schmerzzufügendes Verhalten als legitimes Mittel der Erziehung an, dann wird dieses selten als Aggression angesehen.
Psychologisch wird Aggression als Feststellung eines definierten Sachverhalts, „eine Handlung zur zielgerichtete Schädigung Anderer“ verstanden, ohne Wertung, im Sinne von gerechtfertigt oder nicht.
Hieraus haben sich ergeben sich mehrere Aggressionstypen.
2. 7. 1. Aggressionstypen
Vergeltung: Zielgerichtetes Schmerzzufügen, um etwas heimzuzahlen.
Abwehr- Aggression:
Instrumentelle Aggression zum Schutz, Abwehr von etwas. Mit Schmerzzufügung der „Bedrohung“.
Erlangungs- Aggression: Instrumentelles Verhalten, durch die Schmerzzufügung als Nutzeffekt zur Ereichung eines Ziels dient (Annerkennung, Wunscherfüllung- Wutausbrüche bei Kindern-…).
Spontane Aggressionslust:
Keine Reaktion auf etwas, sondern gilt der emotionalen Befriedigung z.B. sadistischer Neigungen. Diese ist allerdings kaum erforscht.
Jeder Aggressionstyp, mit Ausnahme der spontanen Aggressionslust, geht von der engen Definition aus und bezieht sich auf einen feststellbaren Sachverhalt. Hieraus ergeben sich verschiedene Fragen, welche im Folgenden behandelt werden. Ist Aggression ein Begriff, der von der Psychologie/ Psychoanalyse verwendet wird und nichts weiter bezeichnet, als einen fachspezifischen Ausdruck für physische Gewalt, so wie in 2.3.1 definiert? Oder: Gibt es Unterschiede zwischen beiden Begriffen? Bezeichnen beide Begriffe den gleichen Sachverhalt?
2. 8. Aggression ist nicht gleichbedeutend mit Gewalt
„Auch Gewalt wird, wie Aggression, gewöhnlich als zielgerichtetes Schädigen und Beeinträchtigen verstanden. Insofern liegen beide Begriffe nahe beieinander. Aber: Von Gewalt sprechen wir meist nur bei schwereren, insbesondere körperlichen Aggressionen, doch beispielsweise nicht bei Beschimpfungen oder bösen Blicken. Insoweit ist Gewalt eine Unterform von Aggression“[43].
Abgesehen davon, dass in dieser Untersuchung der Gewaltbegriff in zweierlei Hinsicht behandelt wurde und deswegen bei der hier angesprochenen „körperlichen Schädigung“ nicht von Aggression ausgegangen werden würde, sondern als ein Kennzeichen von physischer Gewalt, wobei dies dann auch nicht als „körperlicher Aggression“ bezeichnet würde, sondern als körperlicher Schädigung, die eine oder mehrere Personen gegen eine oder mehrere andere Personen richtet, zeigt das Zitat, dass es einen Unterschied macht, ob „Beschimpfungen oder böse Blicke“ auch unter Gewalt fallen, und es gibt zu bedenken, dass Aggression eventuell eine vorgelagerte Form von Gewalt ist bzw. von physischer Gewalt, welche eigentlich in dem Zitat gemeint ist, wenn von Gewalt die Rede ist. Hieraus ergibt sich eine erste Differenzierung: Im Gegensatz zur physischen Gewalt, welche direkt eine körperliche Schädigung impliziert, liegt eine solche Implikation nicht unmittelbar bei aggressiven Verhalten vor. Wie im Zitat angedeutet kann ein „böser“ Blick als aggressives Verhalten betrachtet werden, ohne, dass man daraus direkt auf eine den Körper eines anderen schädigende Handlung schließen kann. Die Möglichkeit einer solchen Handlung lässt sich dadurch allerdings nicht ausschließen, sie bleibt als Unterform, aus der Gewalthandlungen entstehen können, bestehen. Bezeichnet der Begriff Aggression demnach andere Verhaltensweisen, als physische Gewalt? Aus dem bis hier erläuterten lautet die Antwort auf diese Frage zunächst: Ja, der Begriff bezeichnet andere Verhaltensweisen. Daraus ergibt sich aber ein Problem:
Im Punkt 2.7.1 wurden verschieden Aggressionstypen dargestellt, deren zentrales Kennzeichen immer eine Schmerzufügung ist, woraus man ableiten kann, dass mit Schmerzufügung höchstwahrscheinlich der Körper eines anderen Menschen gemeint ist, wodurch Aggression dann nichts weiter ist, als der fachspezifische Ausdruck der Psychologie/ Psychoanalyse für physische Gewalt. Für diese Deutung spricht auch der Hinweis, dass sich alle Aggressionstypen auf einen feststellbaren Sachverhalt beziehen. Das Feststellen von körperlichen Schädigungen (Verletzungen), die eine Person von einer anderen erhalten hat, nachdem diese einen z.B. Wutanfall hatte, lässt wohl als eindeutiger Sachverhalt interpretieren. Also beziehen sich beide Begriffe auf das Gleiche? Nein, dass tun sie nicht. Um den Unterschied genauer zu beschreiben ein kleines Beispiel:
Eine Person x spielt ein Computerspiel und bekommt dabei Probleme. Nehmen wir an x kommt an einer Stelle nicht weiter, egal was sie versucht. Daraus erwächst bei x das Bedürfnis mit den Produzenten des entsprechenden Spiels „mal ein Wörtchen über den Schwierigkeitsgrad“ zu sprechen. Da x die entsprechende Stelle aber unbedingt schaffen will, um das Spiel, was im bis hierhin sehr gefallen hat zu schaffen, versucht x es immer wieder. Nach einiger Zeit steigt bei x die Wut auf die Produzenten und x fängt an zu schreien, das Spiel zu verfluchen und die Produzenten gleich mit. In seiner Fantasie fängt x an sich vorzustellen, was er alles mit den Produzenten anfangen würde, wenn sie gerade jetzt bei ihm wären. Einige Zeit später ist x so aufgebracht, dass er seine Maus gegen die Wand schleudert und dadurch das Spiel zunächst beendet ist, bis x eine neue Maus hat.
Die Person in diesem Beispiel hat sich so sehr in das Spiel hereingesteigert, dass ihre Maus gegen die Wand geschleudert wurde und sie am liebsten die Produzenten entsprechend ihre momentanen Wut behandelt hätte. Wir können davon ausgehen, dass ein Töten der Produzenten noch zu milde wäre, ein qualvoller Tod wäre angemessen. Durch das Schreien werden z.B. die Eltern (nehmen wir an diese sind zu Hause bei x) auf x aufmerksam und wundern sich, was da los ist. Gehen die Eltern der Sache auf den Grund, sind sie wahrscheinlich sehr verwirrt über die Reaktion von x und wundern sich was x da spielt. Sie sehen ja nur ihr Kind, welches außer sich ist und das Computerspiel, von dem sie höchstwahrscheinlich nichts wissen (Unwissenheit über das Genre und deren Besonderheiten). Wenn die Eltern sich in einer solchen Situation an einige Beiträge über „Killerspiele“ erinnern, dann würden sie vielleicht denken, dass diese Art von Spielen tatsächlich sehr gefährlich ist und gewalttätiges Verhalten initiieren. Jedoch ist das Verhalten von x nicht als ein gewalthaltiges Verhalten zu interpretieren, welches darauf abzielt real zu verletzen. Auch wenn x anfängt herumzuschreien und sich mental vorstellt andere Menschen zu verletzen, so bedeutet es nicht, dass x in einer realen Situation so handeln würde, wie in seiner Vorstellung. Sein Verhalten ist als aggressiv zu bewerten, bietet aber kein hinreichenden Indizien für physische Gewalt. Die Aggressionstypen gehen zwar von einer Schmerzufügung aus, aber diese muss nicht per se in der „Realität“ verhaftete sein, sie kann mental „ausgelebt“ werden ohne in die „Realität“ hinzuwirken. Hier kann eingewendet werden, dass mentale Schmerzufügung wohl kaum ein feststellbarer Sachverhalt ist. Zweifellos richtig. Aber ein Wutanfall oder das Anschreien eines Gegenübers kann als Sachverhalt angesehen werden der Schmerzen zufügen soll. Und das lässt sich feststellen, z.B. wenn einer Person eine andere beleidigt und die beleidigte Person anfängt zu weinen. Körperliche Schmerzufügung ist somit keine Grundbedingung für Aggressivität, wohl aber für physische Gewalt. Bestehen bleibt weiter die Möglichkeit, dass Aggressivität in physische Gewalt umschlägt.
Halten wir fest: Unter Bezug auf die einleitenden Fragen zu diesem Unterpunkt in 2.7.1 lassen sie sich wie folgt beantworten. Wie an dem Beispiel mit Person x versucht wurde herauszuarbeiten, bezeichnen die Begriffe: Gewalt und Aggression jeweils unterschiedliche Sachverhalte. Aggression ist kein austauschbarer Begriff, der synonym für physische Gewalt verwendet werden kann, da Aggression nicht unmittelbar in physische Gewalt umschlagen muss. Einschränkend bleibt festzuhalten, dass Aggression in physische Gewalt umschlagen kann. Es ist aber wichtig zu bedenken, dass ein Umschlagen in physische Gewalt eine Möglichkeit sein kann, aber keine Bedingung einer aggressiven Handlung ist. Beide Begriffe sind nicht unmittelbar miteinander verknüpft.
Mit Hilfe der Überlegungen über die verschiedenen Aspekte von Gewalt und Aggression können nun die Theorien über Wirkungszusammenhänge zwischen Computerspielen und Rezipienten angegangen werden, und sie können besser hinsichtlich ihrer Annahmen über Aggression und Gewalt überprüft werden. Aus der Vorarbeit lässt sich nun genauer bestimmen, in welcher Form Aggression und Gewalt in den jeweiligen Theorien behandelt wird.
Als Einstieg ins Kapitel dient ein Exkurs über die Faszination von Gewalt.
3. Aspekte medialer Gewaltdarstellung
Exkurs: Geschichtlicher Abriss über die Faszination von Gewalt
Wenn die Zivilisationsgeschichte unter psychischen Gesichtspunkten betrachtet wird, welche eine Veränderung des unmittelbaren physischen Auslebens von Gewalthandlungen bewirkt, dann lassen sich, folgt man Norbert Elias Ausführungen (Über den Prozess der Zivilisation), zwei Tendenzen konstatieren. Nach Elias wies physische Gewalt in mittelalterlichen Gesellschaften andere Konnotationsfelder auf als heute. Das Verhältnis zu physischen Gewalthandlungen zeichnete sich durch eine gewisse Unbekümmertheit aus, sie waren weit verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert. Die positive Wertung von physischer Gewalt wandelte sich im Laufe des Zivilisationsprozesses, zu einer negativen Wertung körperlicher Gewalt. Eine Tendenz besteht in der allmählichen Durchsetzung eines Verzichts auf physische Gewalthandlungen. Die zweite Tendenz lässt sich schon an den Höhlenmalereinen in Altmaria und Lascaux erkennen. Die Malereinen „erzählen […] von einer ersten mentalen Auseinandersetzung und gelungenen ästhetischen Brechung des Schreckens, der Grausamkeit und der Vergewaltigung, die die Erfahrung der Sexualität, des Todes und des Blutopfers im Bewusstseinshaushalt jener Lebewesen damals hinterlassen haben muss“[44]. Jene Höhlenmalereien sind frühste Kennzeichen einer Umleitung unmittelbar erlebter physischer und psychischer Gewalthandlungen in Zeichen und Bilder. Hierin manifestiert sich die zweite Tendenz, die Ästhetisierung von Gewalt. Wie sind beide Tendenzen genau zu verstehen?
1. Durchsetzung eines Verzichts auf physische Gewalthandlungen
Eine neue Auffassung physischer Gewalthandlungen setzt nach Elias in etwa mit dem Beginn der Neuzeit ein, und reichte bis ins 18 Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung hinein. In den patriarchalischen und feudalen Gesellschaften der frühmittelalterlichen Kultur gehörte, je nach Stellung, in verschiedener Form Gewalttätigkeit gegenüber Angreifern, Fremden, Wegelagerern, Frauen, Kindern und Gesinde zu den tragenden Prinzipien der gesellschaftlichen Existenz und zu den Erfordernissen des alltäglichen Lebens und Überlebens. „Raub, Kampf, Jagd auf Menschen und Tiere, das alles gehörte hier unmittelbar zu den Lebensnotwendigkeiten, die dem Aufbau der Gesellschaft entsprechend, offen zutage lagen“[45]. Die mittelalterliche Gesellschaft war eine Kriegergesellschaft, in der physische Gewalthandlungen nicht nur aus rein funktionalistischen Prinzipen, zur Existenzsicherung, erfolgten, sondern auch zu den Freuden des Lebens gehörten. Nicht nur die einfache Bevölkerung, auch die gesellschaftlich mächtige Führungsschicht erfreute sich an Kampf und Totschlag.
Die weltliche Oberschicht des Mittelalters führte nach Elias das Leben von Bandenführern. Deutlich wird dies an der Lebensweise von Rittern. „Er verbringt sein ganzes Leben damit, zu plündern, Kirchen zu zerstören, Pilger anzufallen, Witwen und Waisen zu unterdrücken. Er gefällt sich besonders darin, die Unschuldigen zu verstümmeln“[46]. Über den Kampf heißt es weiter: Der Ritter „liebte den Kampf nicht nur, er lebt darin. Er verbrachte seine Jugend damit, sich auf Kämpfe vorzubereiten. […] Er führte so lange Krieg, als es seine Kräfte nur irgend erlaubten, bis ins Greisenalter hinein“[47].
„Der gesellschaftlichen Bedeutung von Gewalt entsprach deren psychisches Erleben als durchaus erstrebenswerte und positiv bewertete Angriffslust“[48]. Diese Bedeutung wandelte sich als die Ressourcen, welche die Grundlage der Macht und der Subsistenz der mittelalterlichen Oberschicht ausmachte, der Besitz an Grund und Boden knapp wurde. „Wer kein Territorium sein eigen nannte oder nicht imstande war, es zu verteidigen, war nicht im Besitz seiner vollen Rechte. Persönliche Autonomie war gleichbedeutend mit der Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten, und das wiederum war gleichbedeutend mit Grundbesitz.
Herrschaft war zuallererst Herrschaft über ein eigenes Territorium, Leibeigene, Frauen und Kinder“[49] [7 ]. Die Expansionsmöglichkeiten der vorwiegend auf einer Agrarwirtschaft beruhenden mittelalterlichen Gesellschaft waren im späten 11. und 12. Jahrhunderts nahezu erschöpft, so dass es immer schwere wurde, den wachsenden Bedarf an Grund und Boden durch Rodung neuer Gebiete zu bewältigen. Gleichzeitig vergrößerte sich die Kriegsbevölkerung beständig. „Auf jeder Seite der Chroniken dieser Zeit werden Ritter, Barone, große Herrn erwähnt, die acht, zehn, zwölf männliche Kinder haben und noch mehr. Es wird für alle Krieger im Innern dieser Gesellschaft immer schwerer, neuen Boden hinzuzugewinnen und ihr Besitztum zu vergrößern. Die Besitzverhältnisse versteifen sich. Der Aufstieg wird immer schwerer. Und dementsprechend versteifen sich auch die Standesunterschiede zwischen den Kriegern“[50].
Es entsteht ein zunehmendes Konkurrenzverhältnis welches dazu führt, dass kleinere, weniger mächtige Grundbesitzer sich unter den Schutz größerer Landsherren stellen, welche wiederum Krieger einstellen, die ihr Territorium verteidigen und mit der Zuteilung von Land entlohnt werden. Daraus entstehen differenzierte Verhältnisse einer Unter- und Überordnung, unter denen sich zusehends ein mehrschichtiges Kollektiv aus Menschen mit abgestuften Rechten und Pflichten zusammenfinden, deren Zusammenleben durch immer komplizierte ökonomische und soziale Vorgänge geregelt wird, die der ursprünglichen Lebensführung einer mittelalterlichen Kriegergesellschaft zuwiderlaufen. „Ein Grundherr darf seinem Leibeigenen nicht mehr umstandslos den Schädel einschlagen, wenn ihm danach ist, sondern muß, weil der Landsherr die Halsgerichtbarkeit an sich gezogen hat, mit den gewalttätigen Affekten, die bislang sein souveränes Recht waren, auf den nächsten Hof- und Gerichtstag warten und dort vielleicht auch noch seine Sache in einer gegen ihn schon verselbständigten, kodifizierten Form vortragen. Es müssen Verhaltensweisen geschaffen werden, die es den Männern ermöglichen, daß nicht jeder beim geringsten Ärger den Tischnachbarn erschlug oder sich der nächsten Frau bemächtigte“[51].
Diesen allmählich einsetzenden gesellschaftlichen Prozess der Einschränkung physischer Gewalthandlungen bezeichnet Elias als „Verhöflichung der Krieger“. Gerade die mittelalterlichen Höfe sind jene Plätze, an denen die Veränderungen besonders sichtbar werden. Hier beginnen soziale Zentren zu wachsen, in denen immer mehr Menschen zusammenlebten, die sich hinsichtlich ihres Rangs unterschieden und sich ihrerseits von nichtadeligen Klerikern und Bauern abgrenzten. In derart gestalteten Lebensräumen ist es notwendig, dass eine Distanz aller hier Lebenden zum absolut herrschenden Feudalherrn hergestellt wird, genauso wie eine Distanz der Edelleute unterschiedlichen Rangs untereinander. Im höfischen Zusammenleben war die Distanz nicht mehr durch die Integrität territoriale Grenzen garantiert und musste deswegen als verpflichtende Anleitung von unmittelbaren Verhaltensformen in sämtlichen Lebensbereichen etabliert werden. „In einer mehrstufigen feudalen Gesellschaft hatten sich alle dem obersten Herrn unterzuordnen, jeder hatte für ihn seine besondere Funktion und verletzte im Falle eines Fehltritts sein Recht. Persönliche wie soziale Konflikte durften nicht weiter im offenen Kampf unter Gleichen oder durch den gewaltsamen Zugriff auf untergeordnete entschieden werden, sondern ausschließlich über die Vermittlung zentraler Instanzen, des Grundherrn, der regionalen Herrschaft und letztendlich des Königs“[52]. Eine bis dato eher ungekannt Verhaltenskontrolle wurde von den Menschen der höfischen Gesellschaft gefordert, sie mussten „Höflichkeit“ erlernen.
Im Laufe der Zeit differenzierten sich die gesellschaftlichen Funktionen stärker und „je mehr sie sich differenzierten, desto größer wird die Zahl der Funktionen und damit der Menschen, von denen der Einzelne bei all seinen Verrichtungen, bei den simpelsten und alltäglichsten ebenso, wie bei den komplizierteren und selteneren, beständig abhängt“[53]. Das Verhalten der Menschen musste aufeinander abgestimmt, die einzelnen Aktionen straff durchorganisiert und strukturiert werden, damit die einzelne Handlung ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen konnte. Das vormals herrschende Modell der unmittelbaren Durchsetzung der unmittelbaren Bedürfnisse durch affektgeladene Handlungen konnte in diesem Modell nicht erfolgreich eingesetzt werden, da es nicht mehr praktikabel war. „Dem Umbau der Gesellschaft dem Wandel der zwischenmenschlichen Beziehung entsprechend, baut sich auch der Affekthaushalt des einzelnen um“[54]. Ein Teil der Spannungen und Leidenschaften, die vormals im Kampf zwischen Mensch und Mensch ausgelebt wurden, mussten nun im eigenen Ich bewältigt werden. Genauer: Im freudianischen Sinne, bildeten sich im Über- Ich Strukturen, welche beständig daran arbeiteten die Spannungen und Leidenschaften des Kampfes umzuformen oder zu unterdrücken. Diese Strukturen konnten sich nur dann langsam festigen, wenn die gelernten Krieger sich ein Stück weit von ihrem Körper und den Körpern der anderen distanzierten. Ein Indiz hiefür sind die verschiedenen Manierenvorschriften, welche sich auf alle Bereiche des Lebens erstrecken (siehe Elias Bd1 S. 174- 218, 219- 229) und Anleitungen sowie Anordnungen enthalten, die den erforderlichen Gewaltverzicht ermöglichten. Schaut man sich die Anleitungen für die Handhabung des Messers bei Tisch an wird die partielle Distanzierung der Körper voneinander deutlicher. Das Messer ist ursächlich eine Waffe, die der Tötung von Angreifern und Feinden oder Schlachtung und Zerlegung von Tieren diente. Im Rahmen der allgemeinen Entwöhnung von unmittelbaren physischen Gewalthandlungen musste das Messer in seiner ursprünglichen Funktion umgewandelt werden, da es nun zum Essen benutzt wurde. Die Handhabung des Messers bei Tisch durfte ebenfalls keine Gesten enthalten, die als Angriffe interpretiert werden könnten. In einem Manierbuch um 1560 heiß es: „Wenn du jemanden ein Messer übereichst, nimm die Spitze des Messers in die Hand und presentiere ihm den Griff: denn es wäre nicht anständig, es anders zu machen“[55]. Ebenfalls soll der Gebrauch des Messers auf das Nötigste reduziert werden: „Halte das Messer nicht immerfort in der Hand, wie das die Leute auf dem Dorfe machen, sondern nimm es nur dann, wenn du es gerade brauchst“[42]. Die Anleitungen für die Handhabung von Messern bei Tisch gehen nicht auf die Gefahr eines missbräuchlichen Gebrauchs des Messers als Waffe zurück. Sie stellen vielmehr eine soziale Komponente dar, die jegliche Geste der Verwendung des Messers als Waffe oder auch nur die reine Interpretierbarkeit einer solchen Geste verbieten. „Der […] Tischgenosse darf bei Tisch keine dem Kampf ähnliche Geste vollführen, auch dann nicht, wenn er gar keinen Angriff beabsichtigt“[56]. Die Verhaltensanleitungen in den Manierbüchern sind jene ersten Züge, der Etablierung einer Verhaltenskontrolle, welche eine Distanzierung zwischen den Körpern der Menschen bedurfte, die heutzutage als innere Hemmungen oder Schamgefühle begriffen werden. „Jene unsichtbare Mauer von Affekten, die sich gegenwärtig zwischen Körper und Körper der Menschen, zurückdrängend und trennend, zu erheben scheint, der Wall der heute bereits bei der bloßen Annäherung an etwas spürbar ist, das mit Mund oder Händen eines anderen in Berührung gekommen ist“[57].
Der Verzicht auf Gewalt im privaten Rahmen, die Änderung des psychischen Haushalts der Menschen führte nicht zu einem Ende von Gewaltanwendungen, die Erlaubnis lag nun aber nicht mehr beim Einzelnen, sondern wurde von staatlichen Machthabern monopolisiert. Die Einschränkung individueller physischer Gewalthandlungen bewirkte aber nach Elias eine Verringerung des gesellschaftlichen Gewaltpotentials und führte dazu, das Zusammenleben der Menschen friedlicher wurde. Diese Einschätzung von Elias ist stark umstritten. Goedart Palm zufolge verfehlt die Theorie von Elias aber einen wichtigen Punkt, sie kann nicht erklären, warum Gewalt und Grausamkeiten seit den Zeiten des Neandertalers bis zur Spätmoderne nicht zurückgehen, wenn sich auch die Formen der Gewaltanwendung und die Verteilung gesellschaftlicher wie individueller Gewalt verändert haben. Für ihn spricht viel dafür, dass physische Gewalt in modernen Gesellschaften noch exzessiver als in vormodernen Zeiten praktiziert wird, bedenkt man die Auswirkungen beider Weltkriege und die viel zitierten Kollateralschäden, so kann dieses als Beleg genommen werden, dass das von Elias entworfenen Gefüge der Zivilgesellschaft sehr zerbrechlich ist. „Die von Elias beschriebene Genese sozialer und psychologischer Kontrollmechanismen stößt in der späten Neuzeit auf viele gegenläufige Tendenzen, die sich mit den Stichworten »Modernisierungsdruck«, »Überbevölkerung«, »Stress« und »Individualisierung« umreißen lassen und besondere Gewalttätertypen wie Amokläufer, Terroristen oder »lebende Bomben« zeitigen, die eher ohne historische Präzedenzen auftreten“[58].
Die Kritik ist sicherlich berechtigt, es besteht aber die Möglichkeit einer anderen Lesart. Betrachtet man die Theorie als eine mögliche Erklärung der Etablierung von psychischen Verhaltenskontrollen, die unmittelbare Gewaltimpulse unterdrücken, ohne diese zu beseitigen, dann zeigt Elias Ansatz eine Möglichkeit auf, wie die Gewalttätigkeit nicht verringert aber verlagert wurde. Die Theorie kann nicht erklären, warum sich physische Gewalthandlungen nicht verringert oder nach Palm gesteigert haben, sie bietet aber einen Ansatz dafür, wie Gewaltfantasien entstehen können, und damit zusammenhängend eine Möglichkeit der ästhetischen Auseinandersetzung mit physischer Gewalt. In unserer Gesellschaft ist Gewalt negativ besetzt, ein unmittelbares Ausleben mit Sanktionen belegt und die Beschäftigung mit Gewalt in die Psyche verlagert. Mögliche Formen der Auslebungen von Gewalt bestehen in einer Ästhetisierung. Was genau ist damit gemeint?
2. Ästhetisierung von Gewalt am Beispiel des Epos, Drama, Circus
Die Verarbeitung von Gewalt in medialer Form (Theater, Bilder, Literatur, in neuerer Zeit: Filme, Computerspiele, Internet, Magazine…) gab es natürlich schon lange vor dem Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Wie die bereits erwähnten Höhlenmalereinen zeigen. Welche Funktionen erfüllen die mediale Verarbeitung von Gewalt? Ein Blick auf die älteste literarische Ästhetisierung von Gewalt, das homerische Epos und deren Beschreibung der Taten von Achilles (Ilias).
Achilles wird als Prototyp eines Helden dargestellt, seinen Taten ausführlich in allen Einzelheiten beschrieben. Die detaillierte Beschreibung der Schlachten um Troja, in welchen Achilles sich rauschartig durch die Reihen der Gegner „schnetzelt“, dienen der Durchsetzung einer Ideologie des Sieger in das Bewusstsein der Allgemeinheit. Physische Gewalt soll in der Wahrnehmung als unausweichliche Bedingung für Heldentaten manifestiert werden. Eine Grundbedingung, die von jedem einzelnen griechischen Bürger gefordert wird, wenn es darauf ankommt sein Land zu verteidigen oder den Einfluss des griechischen Reiches zu erweitern. Homer „erzählt also von mehr als einer gewonnenen Schlacht. Er erzählt vom Entstehen eines Gruppenbewußtseins jenseits der bloßen Bindung an die Sippe, vom Erwachen einer kollektiven Identität aus der kämpferischen Auseinandersetzung. Die ursächliche Bindung des Wir- Gefühls an die Existenz und Überwindung eines gegnerischen „Sie“ ist eine der Grundprämissen unseres geschichtlichen Ursprungs. Der Sieg vereinheitlicht die Unterlegenen als verabscheuungswürdige Feinde und die Sieger als ruhmreiches Staatsvolk“[59]. Die Darstellungen erfüllten einerseits die Funktion der Volkserziehung in einem Zeitalter, welches durch Kriege geprägt war, deren Siege der Erhaltung und Herstellung von Macht dienten. Anderseits ging es um eine „Ins- Recht- Setzung der Sieger“[60], der Anerkennung des Tötens als legitimes Mittel der Sieger und damit um die kollektive Erfahrung von Taten einzelner Helden und deren stellvertretende Teilnahme. Damit ist nicht ein stellvertretendes Ausleben von physischer Gewalt durch die Leser gemeint, sondern eine Etablierung notwendigen Verhaltens, welches von jedem einzelnen Bürger gefordert werden kann, wenn es nötig ist. Letztendlich ging es um die Legitimierung staatlicher Machtansprüche, Krieg und damit auch physische Gewalt als Mittel von Politik. Homers Ilias steht so für den Beginn einer langen Tradition von Kriegsberichterstattungen.
Der Bedarf an Gewaltverherrlichung vermindert sich im Laufe der griechischen Geschichte, es kam zu einem Punkt an dem die unmittelbare Notwendigkeit einer allzeit zu körperlichen Gewalthandlungen bereiten Gesellschaft nicht mehr praktikabel war. Denn genauen Punkt kann ich nicht rekapitulieren, da er sich nicht so klar festmachen lässt. Nach Ratmayr wird der Bedarf an Gewaltverherrlichung mit Einführung demokratischer Elemente in die griechische Politik verringert und innerhalb der demokratischen Gesellschaftsform tritt der Gewaltbegriff komplexer und verdeckter in Erscheinung als in der Frühzeit. Ob oder wie dies geschieht ist nicht eindeutig zu belegen, wohl aber, dass mit der Zeit Menschenopfer durch Tieropfer, und vor allem reale Gewaltakte durch Bühnendarstellungen (Drama, Tragödie) ersetzt wurden, worauf es mir ankommt. Wie auch in der ersten Tendenz gezeigt, verschwindet Gewalt nicht vollständig, wenn kein gesellschaftlicher Bedarf mehr da ist, sie verlagert sich in die Psyche der Individuen. Das Drama dient nun als ein Ort für das Ausleben von Gefühlen, die im Alltag obsolet geworden sind. Aristoteles wies darauf hin, dass die Anschauung von Gewalthandlungen auf der Bühne beim Zuschauer eine reinigende Wirkung (Katharsiseffekt) hätte und auf diese Weise dem Zuschauer ermöglichte seine im Inneren aufgestauten Gelüste in sozial akzeptierte Form zu kanalisieren (Eine genauere Untersuchung des Katharsiseffekt folgt in Punkt 3.1.1.). Weiterhin ist das Drama geeignet Empathie beim Zuschauer hervorzurufen und die darin enthaltene Gewalt in einen Kontext zu stellen, um somit reale Gewalt zu verhindern (Genauer siehe 4. 6.).
Einem anderen Zweck dient der Circus Maximus: Hier geht es weder um die Verherrlichung noch um die Kontrolle der Gewalt, sondern um den Erhalt der öffentlichen Ordnung. „Die ästhetischen Prioritäten haben sich umgekehrt. Während das Epos die Grausamkeit möglichst drastisch in die Vorstellung bringen (Homer) und das Drama sie möglichst intensiv in Gefühle verwandeln will, setzt der Circus sie möglichst realistisch in die Tat um“[61]. Hier handelt es sich nicht mehr um eine Ästhetisierung von körperlicher Gewalt, sondern um eine Realinszenierung, deren gesellschaftlicher Hintergrund in den Fundamenten des imperialen Rom zu finden ist. Die halbe Welt wurde in Eroberungszügen dem Imperium unterworfen, Völker versklavt „von Cäsar bis Domitian nur eine Minderheit der Kaiser des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, die nicht durch politischen Mord oder Selbstmord ums Leben kamen- der Machtpolitik nach außen entsprachen nicht minder grausame Machtkämpfe im Innern, die häufig blutig ausgetragen wurden. […] Der römische Staat gründete sich wie kein anderer auf die ständige, unmittelbare und uneingeschränkte Präsenz von Gewalt als Prinzip […]“[62].
Damit sich der Kaiser der Loyalität seiner Bürger sicher sein konnte, mussten die Bürger zu der Einsicht gelangen, „daß der Krieg nach außen und im Innern, vorgeführt in der Realistik der Schaukriege und in der Gnadenlosigkeit der Gladiatorenkämpfe, Ausdruck einer politischen und ökonomischen Potenz war, die die unerläßliche Voraussetzung für ihre private Wohlfahrt darstellte, daß jener der bessere Kaiser war, der die meisten Länder erobert, die meisten Paläste gebaut und die grausamsten Spiele veranstaltet hatte […]. Die im Theater der Gewalt angezielten Gefühlskategorien waren nicht Jammer und Schrecken, sondern Lust an Leid und Tod der Opfer. Und sie sollten nicht durch Katharsis beseitigt, sondern durch ständig neue Zufuhr stimuliert werden als tragfähiger Grundkonsens für die Gewaltpolitik des imperialen Staates“[63].
Es gibt, so lässt sich festhalten, immer eine positive Wertung physischer Gewaltanwendung, wenn diese vom Staat ausgeführt wird und eine negative Wertung, wenn physische Gewalt vom Einzelnen ausgeht. Das erste ist eine legitime Form der Anwendung, das andere ist wenn nicht direkt illegitim (akzeptiert ist noch die Anwendung von Gewalt zur Selbstverteidigung) so doch unerwünscht bzw. wird sanktioniert. Die Bedingungen unter denen physische Gewalt verabscheuungswürdig und unter denen sie notwendig ist treten, nach Rathmayr, besonders in den öffentlichen Hinrichtungen zutage.
In Form einer unkontrollierten Leidenschaft des Einzelnen, der einer Tat überführt wurde und deshalb hingerichtet wird, stellt gewalttätiges Handeln eine Gefahr dar. Die Ausführung der Hinrichtung durch die Justiz ist eine gerechte Form körperlicher Gewalt, und sie ist erwünscht. Ebenso das Ansehen der Hinrichtung, als Vorbereitung auf ein sittliches Leben. Die drohende Strafe, die hierbei visuell zu betrachten ist, dient dazu die öffentliche Moral und den Respekt vor himmlischer und irdischer Autorität zu bestärken. Die öffentliche Hinrichtung ist ein lehrreiches Schauspiel: „Wenn man aber in der Jugend sich zu einem gesetzten Wesen gewöhnt, und seinem Herzen Gewalt antut, mit einer gewissen Standhaftigkeit ein solches Schauspiel anzusehen; so erspart man sich gewiß manche Qual auf Lebenszeit“[64].
Dass öffentliche Hinrichtungen alles andere als geeignet waren, die öffentliche Moral und den Respekt vor himmlischer und irdischer Autorität zu bestärken zeigt sich schon allein daran, dass es während der Zeremonie oftmals zu Ausschreitungen kam, in denen die Zuschauer aufeinander einschlugen oder den Henker lynchen wollten. (Bei Interesse siehe: Martschukat, Jürgen, Inszeniertes Töten: Eine Geschichte der Todesstrafe- Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Köln, Weimar, Wien, Böhlau 2000) Ebenso gab es Hinrichtungen, die jeweils auf die Tat des Delinquenten abgestimmt waren, so wurden z.B. Diebe gehängt, was als entwürdigende Art des Todes gedeutet wurde und damit komplementär zur Tat stand. Im Laufe der Zeit änderten sich die Bedingungen für eine Todesstrafe ebenso wie die Ausführung selbst. Es wurde nur noch Mord mit dem Tode bestraft und die Exekutionsmethode war bei allen gleich. Alle Delinquenten sollten durch die Guillotine geköpft werden, da diese Methode geeignet zu sein schien unnötige Qualen beim Delinquenten zu vermeiden und dem Zuschauer nicht durch das Ansehen derselben zu stimulieren (siehe Martschukat). Die Funktion der Hinrichtungen bleibt durch diese Verschiebung allerdings die Gleiche: Physische Gewalt ist ein legitimes Mittel staatlicher Justiz und darf nur von dieser angewendet werden. Die psychische Funktion öffentlicher Hinrichtungen ist trotz der Guillotine eine andere: Die öffentliche Hinrichtung, wie auch der Spiele im Circus haben beide die gleiche psychische Funktion, durch die Vorführung einer Gewalttätigkeit, die Lust am Grauen, welche den Zuschauer nicht mehr aus dem Kopf will, zu manifestieren Die einzige Unterscheidung zwischen dem Circus und der Hinrichtung ist die Legitimation.
Zusammenfassend: „In der Antike, im Mittelalter und am Beginn der Neuzeit gab es unterschiedliche Entwicklungen von derselben Struktur: Reale, in Alltag und Politik allgegenwärtige Gewalt wird zunächst legitimiert und glorifiziert, später aber, wenn friedliches Verhalten der Bürger zum gesellschaftlichen Normalfall und Gewalt ein Monopol staatlicher Vollzugsorgane werden soll, aus der Alltagsrealität verbannt und in die verschiedenen Formen eines Theaters der Gewalt und in das Reich der Phantasie umgesiedelt“[65]. Auf das Epos, Drama und den Circus bezogen: Im Epos konnte man die Gewalt nacherleben (Homer), im Drama ging es um das Wegerleben/ Ausleben (Empathie/Katharsis) und im Circus konnte man miterleben.
In der nachmittelalterlichen Zeit, ging es um die Unsichtbarmachung von Gewalt, aus der neue Imaginationen hervortreten. Dadurch wurde Gewalt nicht abgebaut, sondern von der Realität auf die Bühne der Ästhetik verschoben. Der jederzeit gewaltbereite Mensch nimmt nun die Rolle des jederzeit empfangsbereiten Hörers oder Zuschauers künstlicher Gewaltinszenierungen an. Durch die Inszenierung wird Gewalt nicht mehr als todbringende Realität erlebt, sondern als Fiktion, welche Lust erzeugen kann und die als spannende Unterhaltung, oder außergewöhnliche Aufregung erfahrbar wird. Nach Ratmayr ist dies der Beginn des Zusammenhangs zwischen Gewaltmedien und realer Gewalt. Im Folgenden wird dieser Zusammenhang betrachtet, mit einem Fokus auf Computerspiele.
3. 1. Medientheoretische Aspekte
3. 1 .1. Katharsis- These
Die im Exkurs dargestellte Tendenz, das „Rohe“ und „Ungekochte“ durch ihre öffentliche Performance in kulturell vertretbare Formen und Kanäle zu lenken, ließ schon Aristoteles zu folgender These kommen:
Das Anschauen von heftigen Bildern befreit den Geist des Menschen von latenten Aggressionen und gewalttätigen Gelüsten.
Demzufolge hinterlassen Gewaltdarstellungen auf der Bühne, Leinwand oder dem Bildschirm beim Zuschauer die Wirkung, seine verdrängten „Gewaltbedürfnisse“ ausleben zu können (Katharsiseffekt). Medial vermittelte Gewalt wird so zu einem Ventil, um inneres, auf- oder angestautes Bedürfnis, stellvertretend und in sozial akzeptierter Weise auszuleben.
Dieses Modell ist sehr umstritten, „da weder Bilder und Zeichen noch Verbote oder Tabus in der Lage seien, dem menschlichen Drang nach rückhaltloser Verausgabung einen Riegel vorzuschieben, könne das Begehren vom Imaginären gar nicht vollständig absorbiert werden. Stets bleibe ein Rest, der traumatisch, fantasmatisch oder halluzinatorisch wiederkehre, den Betroffenen in emotionale Zwangslagen stürze und zu Ersatzhandlungen zwinge“[66]. Gerade für mögliche Ersatzhandlungen gibt es Bereiche, die in einem wechselvollen Spiel aus Verbot und Überschreitung eingerichtet wurden, in denen die „Gewalttätigen“, „Ruinösen“ und „Tumultuösen“ vom Zeit zu Zeit Gelegenheit haben, ihre Bedürfnisse auszuleben. Das sind neben der Erotik, dem Spiel und dem Opferfest, in modernen Gesellschaften vor allem die Massenspektakel (Brot und Spiel, Demonstrationen, Straßenpartys, Karneval, Chatroms…). Entstanden sind diese Freiräume aus der Erkenntnis, dass moralische und sittliche Hürden, die Gruppen und Gemeinschaften gegen diese Wünsche errichten, letztendlich eher stimulierend wirken bzw. einer möglichen stimulierenden Wirkung nicht, durch ein alleinigendes Betrachten von heftigen Bildern, entgegengewirkt werden kann. Darüber hinaus geht die Katharsis-These von einer monokausalen Wirkungsweise von gewalttätigen Inhalten auf die Rezipienten aus, ohne zu berücksichtigen bzw. zu fragen aus welchen Gründen einzelne Personen entsprechende Medien konsumieren. Der Rezipient wird isoliert von seinem sozialen Umfeld, seinen eigenen Interpretations- und Selektionsprozessen betracht und ist der Wirkung derartiger „Zurschaustellung“ von Gewalt ausgeliefert. Die Wirkung von derart vorgeführter Gewalt kann der Zuschauer nur als eine Befreiung von seinen verdrängten „Gewaltbedürfnissen“ empfinden. Die Katharsis-These kann somit keine Erklärung der Wechselwirkungen zwischen gewalttätigen Inhalten und Rezipienten geben. Zumindest nicht für die bis hier dargestellten Medien. Gilt das auch für Computerspiele?
Manuel Ladas vermutet, dass die Katharsis- These, durch die Interaktivität von Computerspielen neuen Aufschwung bekommen kann, da Computerspiele den Spielern in einer aktiven Form ermöglichen ihre angestauten Impulse abzubauen. Der Grund, der für einen möglichen Katharsis- Effekt spricht, liegt also in der Interaktivität des Mediums. Der Rezipient muss nicht wie beim Film zusehen „wie ein Held sich abreagiert“, er kann es in virtueller Form selber tun. Dabei ist aber zu beachten, „dass die Interaktivität in Computerspielen nicht nur kathartisches, sondern auch Frustrations- Potential besitzt. Dieses ist jedoch […] nicht auf aggressive Inhalte, sondern vielmehr auf Misserfolge durch einen zu hohen Schwierigkeitsgrad zurückzuführen – unabhängig davon, ob das Spiel Gewalt enthält oder nicht“[67]. Theoretisch besteht die Möglichkeit im Computerspiel angestaute Impulse abzubauen, allerdings nur unter der Prämisse, dass die Spieler erfolgreich die Kontrolle über ein Spiel gewonnen haben, und sich dadurch Erfolgserlebnisse einstellen (vgl. 1.2.1. / 1.3.). Gelingt es nicht diese Prämisse zu erfüllen, ist es, wie gezeigt wurde, wahrscheinlicher, dass ein Spiel abgebrochen wird und der Rezipient sich frustriert vom Spiel distanziert, oder sich so in die vom Spiel ausgelöste Frustration hinein steigert, dass er ähnlich reagiert, wie im Beispiel mit Person x, wodurch ein Katharsis- Effekt ausbleibt.
Auch wenn das Medium Computer gegenüber dem klassischen Medium Fernsehen mit einem Interaktivitäts- Aspekt aufwartet, so bedeutet dies nicht, dass dadurch die oben genannten Verknappungen der Katharsis- These relativiert werden, sie gelten auch für Computerspiele.
Der Frage, ob eine Zurschaustellung von Gewalt nicht eher den gegenteiligen Effekt der Katharsis- These bewirkt versucht die Anstiftungsthese zu klären.
3. 1. 2. Anstiftungsthese
Die Anstiftungsthese geht, wie auch die Katharsis- These, von einer direkten Wirkung vorwiegend medial vermittelter Inhalte auf deren Rezipienten aus. Im Unterschied zur Katharsis- These wird angenommen, dass, z.B. das Ansehen von medialer Gewalt direkt die Bereitschaft zur Ausübung von Gewalt bei den Rezipienten steigert. Ein Zusammenhang, der häufig in öffentlichen Diskussionen über Computerspiele vermutet und als Beleg für die „Gefahren“ des Spielens angebracht wird. Hierbei ist es grade die Interaktivität des Mediums Computer, die besonders hervorgehoben, der mehr „Gefahrenpotential“ zugesprochen wird als dem klassischen Medium Fernsehen. Dadurch, dass der Rezipient aktiv in das Geschehen eingreift und nicht nur zusieht, ist es gleichsam er selbst, der „tötet“, und womöglich durch das Spielen so aufgeputscht wird, dass er nach dem Spielen immer noch in der Spielwelt verhaftet ist, und Mühe hat sein Verhalten der „Realität“ anzupassen. Im Bezug auf die Interaktivität ist es, in Abgrenzung zu Ladas Vermutung über Katharsis- Effekte, theoretisch ebenso denkbar, dass „anachronistische“ Impulse nicht abgebaut, sondern gesteigert werden. Allerdings treten auch bei der Anstiftungsthese die gleichen Verknappungen zu Tage, wie bei der Katharsis- These, sie gelten für beide. Auffällig an der Anstiftungsthese ist die Argumentation mit der sie vorgetragen wird.
Die Argumentation für die These enthält häufig ein hohes Maß an subjektive Empörung und moralischer Ablehnung gegenüber Mediengewalt, wobei die Tatsache der Anstiftung von vornherein als erwiesen gilt (siehe Einleitung). So führt z.B. Werner Glogauer jahrzehntealte und vielfach methodisch kritisierte Experimente (Charlton 1974/ Bandura 1979) und Langzeitstudien (Lefkowitz 1977/Sonesson) als Belege an, um nachzuweisen, dass Kinder nach zehn Jahren umso aggressiver waren, „je mehr Gewalt die Fernsehprogramme enthielten, die die Kinder in der dritten Klasse bevorzugten“[68]. Die Mängel, welche schon in der Katharsis- These zum Ausdruck kommen und die auch in der Anstiftungsthese vorhanden sind, werden dabei ebenso übergangen, wie“ die alles entscheidende Frage, ob der Medienkonsum die Aggressivität der Kinder bewirkt hat, oder die anderweitig bewirkte Aggressivität den erhöhten Konsum gewalthaltiger Medienprodukte“[69].
Weiterhin drängt sich in der Argumentation für die Anstiftungsthese der Verdacht auf, dass die Tatsache, dass es so viele Menschen gibt, die so viel Zeit mit Medienkonsum verbringen viele Forscher dazu verleitet, voreilig anzunehmen, dass es einfach Effekte geben müsse, wodurch sie sich von ihrer eigenen Abscheu und dem Wunsch, die Allgemeinheit zu schützen, zu übertriebenen Behauptungen verleiten lassen.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Stimulus- Response- Ansatz.
3. 1. 3. Stimulus- Response- Ansatz
Beim Stimulus- Response- Ansatz wird von einer direkten Wirkung von Stimuli auf den Rezipienten ausgegangen. Der Wirkungszusammenhang wird hierbei ebenso monokausal vermutet, wie in der Katharsis- These und der Anstiftungsthese. Auch beim Stimulus- Response- Ansatz gilt: Sobald der Rezipient sich mit, in unserem Fall, einem Computerspiel beschäftigt entsteht eine einseitige Wirkung durch das Spiel auf den Rezipienten, in Form einer Änderung von „ Verhaltensweisen, Einstellungen, Meinungen und Kenntnissen“[70]. Philiströser bezeichnet die Theorie, dass Stimuli direkt auf den Rezipienten übertragen werden, um dann bei ihm eine Reaktion zu bewirken, dies wird auch als Transitivität bezeichnet. Die Reaktion des Rezipienten wiederum verhält sich proportional zu den Stimuli, daher - je stärker der Stimulus, desto stärker die Reaktion ( Proportionalität ). Zwischen der Transitivität und Proportionalität wird eine Kausalität angenommen, wodurch der Rezipient wiederum (vgl. 3.1.1/ 3.1.2) nichts weiter darstellt als ein „leeres Blatt“, welches den Einwirkungen des von ihm benutzten Mediums ausgesetzt ist. Für eine Untersuchung über Gewalt in Computerspielen und deren Auswirkungen auf die Nutzer würde es nach dem Stimulus- Response-Ansatz vollkommen ausreichen einen Stimulus z. B. die Mengen an dargestelltem Blut in einem Computerspiel zu untersuchen, um auf die Wirkung auf den Rezipienten schließen zu können (- wobei die Frage bleibt, wie der einzelne Forscher den Blutgehalt bewertet). Entscheidend ist, dass durch die Bewertung des Blutgehaltes eine Wirkung auf den Nutzer von Spielen mit der Darstellung von Blut konstruiert wird, welche dann in gleicher Form, daher mit gleicher Wirkung, auch für alle anderen Nutzer von „blutigen“ Spielen gilt, ohne dass ein Rezipient bei der Bewertung anwesend sein muss oder bei der Bewertung überhaupt eine Rolle spielt. Dadurch erübrigt sich die Untersuchung des Rezipienten vollständig, „da nach diesem Modell alle Rezipienten identisch und voneinander isoliert sind und die Stimuli ungefiltert aufnehmen“[71].
Auch Stimulus- Response- Ansatz ist zu einseitig bei der Bewertung der Wirkung von Inhalten auf deren Nutzer, so dass sich letztlich für alle monokausalen Ansätze Folgendes konstatieren lässt:
Jeder monokausale Ansatz, der eine für alle Individuen gleiche Wirkung eines Medieninhaltes auf deren Nutzer nachweisen will, vernachlässigt eine Vielzahl von Faktoren, die in der jeweiligen Situation des Medienkonsums zusammenwirken. Dazu gehören: „Die Lebensgeschichte und die Persönlichkeit der Rezipienten; ihre sozialen Beziehungen; die Kommunikationsvorgänge, die den Medienkonsum begleiten und auf ihn folgen; das Ausmaß des Medienkonsums; politisch- soziale Bedingungen der Lebenswelt und vor allem die Art und Weise, wie Gewalt und ihre Darstellung in der jeweiligen Gesellschaft bewertet und reguliert wird- das alles und noch mehr wirkt auf den Medienkonsumenten und müsste von der Medienwirkung klar isoliert werden, wollte man exakt diese feststellen“[72]. Wenn auch klar sein sollte, dass die genannten Aspekte wahrscheinlich nicht klar isoliert werden können, so ist es dennoch hilfreich, wenn zumindest der Versuch gemacht wird mehrere dieser Aspekt zu berücksichtigen, auch auf die Gefahr hin, nie eindeutig zu klären, wie Medien deren Nutzer „beeinflussen“ und umgekehrt.
Als Abkehrung vom Stimulus- Response- Ansatz kann der Uses- and- Gratifications- Ansatz gelten, welcher 1974 von Blumler und Katz entwickelt wurde.
3. 1. 4. Uses- and- Gratifications- Ansatz
Im Gegensatz zum Stimulus- Response- Ansatz handelt es sich beim Uses- and- Gratifications- Ansatz um ein handlungstheoretisches Modell über den Zusammenhang zwischen Medien und deren Rezipienten, das den aktiven Mediennutzer in den Vordergrund stellt. Infolgedessen geht es nicht darum monokausale Wirkungszusammenhänge zu untersuchen bzw. herzustellen. Im Rahmen dieses Ansatzes geht es primär darum die Funktionen oder den Nutzen der einzelnen Medien für deren Konsumenten herauszufinden. Daher besteht die Grundannahme auch darin, dass Menschen, aufgrund bestehender Motive oder Bedürfnisse, Medieninhalte gezielt daraufhin auswählen, ob sie sich eine Gratifikation versprechen oder nicht. Dabei steht die Wahl eines Mediums in einem Konkurrenzverhältnis zu anderen Medien und Alternativen. So hängt die Wahl z.B. jetzt Computer zu spielen auch davon ab, ob gratifikationsversprechende Alternativen zur Verfügung stehen oder nicht. Die Auswahl erfolgt nach Kriterien, welche am besten geeignet sind die Bedürfnisse des Rezipienten zu befriedigen. In Abgrenzung zu monokausalen Ansätzen wird der Konsument hier nicht als „ isoliertes, willenloses Opfer der Medien“[73] verstanden, da er Medien gezielt und dadurch aktiv nach seinen Bedürfnissen auswählt. Durch die aktive Auswahl der Medien besteht von Seiten des Rezipienten eine Erwartungshaltung an das Medium, da sonst seine Bedürfnisse nicht befriedigt werden können. Diese werden unter dem Begriff Gratifikation zusammengefasst. Aus bisherigen Untersuchungen haben sich folgende Gratifikationsmerkmale für klassische Medien herauskristallisiert:
Information, Unterhaltung, Eskapismus (Flucht aus dem Alltag), Identifikation, Ratschläge, Interaktionseffekte, Lust, Beziehung und Orientierung. Für eine genauere Klärung der verschiedenen Merkmale siehe Ladas: „Brutale Spiele(r)“. Die Gratifikationen sind allerdings nicht als starr anzusehen, sondern ändern sich mit jedem neuen Medium.
Für die Untersuchung von hoch interaktiven Medien wie Computerspielen scheint der Ansatz gut geeignet zu sein, da der Computerspieler sich nicht passiv den Medien aussetzt, sondern steuernd in das Geschehen eingreift, wodurch er ganz im Sinne des Ansatzes ein aktiver Mediennutzer ist. Durch die unterschiedlichen Genres mit ihren spezifischen Eigenschaften (siehe 1.) kann der Rezipient dasjenige Spiel auswählen, welches zu seinen jeweiligen Bedürfnissen passt. Verstärkt wird dieser Aspekt dadurch, dass die Anforderungen von Computerspielen eine Konzentration auf das Spielgeschehen erfordern, wodurch ein Eintauchen in die Spielewelt begünstigt wird (siehe 1.3.). Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Elemente (Rollenangebote, Kontrolle, Erfolge) von Computerspielen und deren Gratifikationsmöglichkeiten (Eintauchen, Macht/Ohnmacht, Kompetenz) kann der Ansatz also ermitteln zu welchem Zwecke Computerspiele am meisten genutzt werden, vernachlässigt dadurch aber deren Wirkungszusammenhänge. Genauer: Eine Aussage über mögliche Wirkungen kann der Ansatz nicht erfassen, da er von seiner Konzeption her nur vorgelagerte Aspekte untersucht. So kann der Ansatz z.B. nur eingeschränkt auf gewalthaltige Computerspiele eingehen, da hier lediglich festgehalten werden kann, dass Spieler y ein Bedürfnis hat Spiel z zu spielen, ohne zu fragen, welchen möglichen Effekte das Spielen nach sich zieht. Baut der Spieler z.B. eventuelle Spannungen ab oder auf (Katharsis/Anstiftung), begünstigen Computerspiele von ihrer Konstitution her überhaupt einen Spannungsabbau/Aufbau. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Aspekte die der Ansatz vernachlässigt. „ Die Wirklichkeitskonstruktion durch Medien und Mediennutzer, deren Interpretations- und Reflexionsprozesse bei der Mediennutzung, also letztlich die Sinn- und Bedeutungszuweisung zur Handlung des Medien- Nutzens, werden nicht berücksichtigt“[74]. Nicht erschlossen werden weiterhin alle Vorrausetzungen des Rezipienten, die aus dem Rahmen einer funktionalistischen Kosten- Nutzen- Rechnung fallen. Wie etwa der gesamte soziale, gesellschaftliche Kontext bei Nutzung des Mediums oder die lebensweltliche Situation des Rezipienten.
Zur Beschreibung von Wirkungszusammenhängen ist der Uses- and- Gratifications- Ansatz ebenso ungeeignet wie monokausale Ansätze. Traditionelle Medienforschung kann den Besonderheiten von Computerspielen, so lässt sich festhalten, nicht gerecht werden und ist daher für eine Untersuchung über dieses Phänomen ungeeignet.
3. 2. Psychologische Theorien
3. 2. 1. Frustrations- Aggressions- Hypothese
Im Laufe der Arbeit wurde schon mehrfach erwähnt (vgl. Erfolgserlebnisse 1. 2. 1./ Bedeutung der Funktionskreise 1. 3.), dass Computerspiele deren Nutzer eventuell so stark ansprechen, dass diese sich in eine negative emotionale Haltung (klassisches Beispiel ist der Wutanfall) hineinsteigern und diese durch entsprechende Äußerungen und Handlungen kundtun. In welcher Form so etwas stattfinden kann wurde im Beispiel mit Person x angesprochen (vgl. 2. 8.). Hintergrund für die Reaktion von Person x, aufgrund derer er seine Maus zerstörte, war der zu hohe Schwierigkeitsgrad des Spiels, welcher ein Weiterkommen im Spiel verhinderte. Wodurch man zu dem Ergebnis kommen kann, dass die Ursache für das aggressive Verhalten von Person x in den anhaltenden Frustrationserlebnissen liegt. Ob eine derartige Vermutung zutrifft oder nicht versucht die Frustration- Aggression- Hypothese zu klären. Die Konzeption der Frustration- Aggressions- Hypothese lässt sich auf Freuds Überlegung zur Aggression zurückführen. Darin wurde Aggression verstanden, als die Folge einer Verhinderung von Triebbefriedigungen. Diese Grundidee wurde mit einer Modifikation in den Ansatz übernommen.
Denn anders als in reinen Treibtheorien wird Aggression in der Frustrations- Aggressions- Theorie „nicht als ein im Organismus festgelegter Trieb konzipiert, sondern entsteht reaktiv als Folge einer Zielbehinderung oder Frustration“[75]. Hieraus leiten sich die zwei Postulate der ursprünglichen Konzeption ab:
1. Aggression ist immer die Folge von Frustration. 2. Jede Frustration führt zur Aggression
Insbesondere das zweite Postulat stellte sich schnell als unhaltbar heraus und erfuhr früh eine Modifizierung durch verschiedene Forscher (z.B. Dollard, J., Doob, L., Miller, N. E., Mowrer, H. O. & Sears, R. R., Frustration and aggression. New Haven 1939). Hierin wird nun eingeräumt, dass jede Frustration grundsätzlich mehrere Reaktionsmöglichkeiten bietet, neben einer aggressiven Reaktion auch solche Reaktionen wie z.B. Resignation. Somit wurde Frustration in der Neuformulierung nur noch als eine von mehreren Reaktionsmöglichkeiten angesehen. Das erste Postulat blieb aber bestehen, wodurch auch in der Revision der F- A- Hypothese weiterhin unberücksichtigt bleibt, dass Aggression auch ohne Frustration auftreten kann und umgekehrt. „Wenn aggressives Verhalten auftritt, so ist dies nicht immer eine Reaktion auf eine Frustration; es kann auch andere Gründe haben. Es gibt z.B. Gewalthandlungen auf Befehl, die gedankenlose Nachahmung in einer Gruppe usw.“[76]. Die Konzeption der F- A- Hypothese lässt diese Möglichkeit außer acht, wodurch Aggression immer aus einer Frustration entsteht, was wiederum bedeutet, dass man sich in einer Umwelt, die auch Frustrationen erzeugt, nie anders als aggressiv verhalten kann. „Im entwicklungspsychologischen Kontext betrachtet bedeutet dies letztendlich, daß Kinder in einer frustrationsfreien Umwelt aufwachsen müßten, damit keine aggressiven Tendenzen ausgebildet werden.
Abgesehen davon, daß eine solche Umwelt nie existieren kann, bleibt zu bedenken, daß große Nachgiebigkeit und Toleranz ebenfalls zu gesteigerter Aggression führen kann“[77].
Beide Konzeptionen, die ursprüngliche und deren Revision, lassen die Frage offen, unter welchen Umständen Frustration tatsächlich zu aggressivem Verhalten führt, selbst wenn man der Annahme folgt, dass Aggression aus Frustration entsteht, obwohl auch diese Annahme, wie gezeigt wurde, mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Ein Hinweis darauf, wie Frustration in Computerspielen entstehen kann, und wie damit umgegangen wird, zeigen die Äußerungen von Spielern, die durch Fritz/ Misek- Schneider befragt wurden. Dabei wird wieder deutlich, wie wichtig eine erfolgreiche Spielkontrolle ist. Einige Aussagen:
Schülerin, 16: „Ich reg` mich meistens total auf. Könnte mich lieber in die Ecke klatschen, wenn es nicht klappt. Wenn ich es so oft probiert habe, da krieg` ich Wut. Das geht mir besonders beim Videospielen so“[78]. Schülerin, 14 Jahre: „Wenn es nicht weitergeht, hau ich dann immer die Maus auf den Tisch, und dann mach` ich aus. Mich wundert` s, daß die Maus noch nicht kaputt gegangen ist. Die lebt also noch“[79]. Schüler, 13 Jahre: „Wenn ich bei einem Spiel sofort am Anfang verliere oder fünfmal hintereinander, dann werde ich auf einmal sauer. Dann fang ich an, zu dem Spiel Schimpfwörter zu sagen“[80].
Die Äußerungen stehen exemplarisch für Reaktionsweisen bei Kontrollverlust im Spiel, in der Untersuchung von Fritz und Misek- Schneider. Hier zeigt sich auch, dass es keinen wesentlichen Unterschied in den Empfindungen im Bezug auf einen Kontrollverlust zwischen Jungen und Mädchen gibt. Wobei Jungen in der Untersuchung häufiger in eine Frustrations- Aggressions- Spirale geraten, als Mädchen, wenn sie trotz aller Bemühungen nicht in der Lage waren, Kontrolle über ein Spiel auszuüben.
Dabei kann aber nicht generell davon ausgegangen werden, dass Jungen eher in diese Spirale geraten als Mädchen, da der Anteil von männlichen Spielen um ein vielfaches höher ist als der von Spielerinnen.
Zwei weitere Beispiele: Schüler 11 Jahre: „Wenn ich etwas im Spiel nicht schaffe, dann mache ich immer weiter, bis ich es schaffe. (…) Das geht an die Nerven. Ich hab schon einmal einen Gameboy von mir kaputt gehauen, weil ich nervös war“[81].
Schüler 17 Jahre: „Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da teilweise einen Ausflipper, daß ich dann, was weiß ich, wenn irgend etwas nicht geht, dann schmeiße ich das Joypad in die Ecke oder so etwas in der Art. Aber bis jetzt hat` s noch alles überlebt eigentlich. Und meine Mitmenschen ärgern sich, daß ich mal wieder das ganze Haus unterhalten würde, wenn ich dann etwas meinen Ausflipper habe, aber na gut“[82].
Der Ausweg aus dieser Form einer Frustration- Aggressions- Spirale besteht in dem Erwerb der Spielkontrolle, wodurch aus Frust wieder Lust wird. Um dieses zu erreichen gibt es vielfältige Hilfsangebote, seinen es Freunde, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen, eventuell schwierige Passagen für einen selbst überwinden, oder Internet- Foren, diverse Magazine für Spiele (Gamestar, PC Games, PC Action, Maniac …) und nicht zuletzt die Möglichkeit, Cheats oder Trainer herunterzuladen. Aus Frust: „Ich rege mich fast bei jedem Spiel auf am Anfang, wenn man nicht reinkommt. Besonders bei der Hubschraubersimulation am Anfang. Da bin ich andauernd nach 5 Minuten schon abgeschossen worden. […] Da habe ich echt so einen Hals gekriegt“. Wird wieder Lust: „Wenn ich das Spiel anfange zu beherrschen, ja, dann spiele ich damit ziemlich lange. Also mit der Hubschraubersimulation habe ich jeden Tag zwei bis drei Stunden gespielt, so am Anfang, und nachher hat es auch nachgelassen“[83]. Beide Aussagen stammen von einem 18-jährigen Schüler.
Betrachtet man die Aussagen, zeigt sich, dass die Reaktion auf die mögliche Frustration durch ein Computerspiel immer zwei Variablen enthält. Entweder es wird sofort ein für das Spiel notwendiges Gerät in irgendeiner Form beschädigt, oder der Unmut über die bestehende Situation wird verbal artikuliert. Wobei beide Reaktionen auch gleichzeitig in variabler Reihenfolge vorkommen können. Die Aussagen zeigen aber auch, dass sich die SpielerInnen bewusst sind, wie ihre Reaktion möglicherweise aufgefasst wird, wodurch sie gleichsam zeigen, dass sie nicht in der „virtuellen“ Welt verhaftet sind - vielmehr sind sie auch in der Lage, sich selbst reflektiert zu betrachten: „Und meine Mitmenschen ärgern sich, daß ich mal wieder das ganze Haus unterhalten würde, wenn ich dann etwas meinen Ausflipper habe, aber na gut“. Diese Selbstreflektiertheit ist zumindest ein Aspekt der nicht nur verhindert, dass die SpielerInnen nicht zwischen „Realität“ und „Virtualität“ unterscheiden können, sie bietet ein Stück weit auch die Gewissheit für die Eltern, dass sie, wenn sie aus dem Kinderzimmer „Krach“ hören und der Sache nachgehen, keine Angst um ihre körperliche Unversehrtheit haben müssen.
Somit kann festgehalten werden: Das Computerspiele durchaus Frustrationen erzeugen und Aggressionen hervorrufen können, nur bleibt dabei zu berücksichtigen, dass es sich nicht um die einzige Reaktionsmöglichkeit handelt, dass also Frustration nicht aggressives Handeln per se bedingt. Selbst wenn Computerspiele Frustrationen erzeugen, so bleibt ungeklärt, ob Computerspiele direkt eine Auswirkung auf die Aggressionsbereitschaft haben. Eine Reihe von Laborstudien versuchen dies im Hinblick auf gewalthaltige Computerspiele zu klären. Dabei geht es zunächst um die Frage: Steigern gewalthaltige Computerspiele (damit sind Spiele gemeint, die physische Gewalt als überwiegende Spielhandlung beinhalten- hauptsächlich sind damit Ego- Shooter gemeint) die Aggressionsbereitschaft? Und: Wenn ja welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ableiten? Stellvertretend für Laborstudien wird im Folgenden die Studie von Anderson und Dill herangezogen, wobei zunächst auf die allgemeine Herangehensweise von Laborstudien eingegangen wird.
3. 2. 2. Experimentelle Studien
Typische Herangehensweisen von Laborstudien die sich mit den Wirkungen von Computerspielen auf Rezipienten befassen: Es werden zwei Gruppen gebildet, die eine Gruppe der Versuchspersonen spielt ein gewalthaltiges Spiel, die andere ein gewaltfreies Computerspiel. „Vorher und nachher wird bei beiden Gruppen die Aggressionsneigung und/oder das empathische Empfinden [zur Empathie siehe 4. 6.] gemessen“[84].
Die Ergebnisse aus bisherigen Studien, welche einen experimentellen Teil mit zwei Spielen beinhalteten, sind sehr unterschiedlich. So hat z.B. Werner Sacher die Ergebnisse von 17 experimentellen Studien zur Wirkung von Gewalt in Computerspielen analysiert (siehe: Jugendgefährdung durch Video- und Computerspiele, in Zeitschrift für Pädagogik 39. 1993). Von den 17 Studien konnten 5 Studien eine Aggressionssteigerung nachweisen, 12 Studien fanden keine Hinweise auf eine mögliche Aggressionssteigerung nach dem Spielen. Bei der Bewertung der Studien konnte Sacher in den meisten einen Designfehler feststellen, der in erster Line den experimentellen Teil hinsichtlich der Spielauswahl betraf, der aber die Ergebnisse der Untersuchungen verfälschte, da die Spiele sich zu sehr unterschieden. „Um tatsächlich nur die Wirkung der Gewalt im Spiel zum messen, dürfen sich die verwendeten Spiele auch nur in der Stärke der Gewalthaltigkeit unterscheiden, und nicht bezüglich anderer Merkmale, wie z.B. „Action, Spannung, (Fehlen von) Pausen, Schwierigkeit, Spaß, Unterhaltungswert, Frustrationserzeugung ect.“[85]. Gerade gewaltfreie Spiele zeichnen sich oftmals durch ein Fehlen von reaktionsschnellen Handlungszwängen aus, sowie einer Musikuntermalung, die dazu geeignet ist den Spieler ständig unter einer „Anspannung“ zu halten. Eine ungeeignete Spielauswahl kann dazu führen, dass die gemessene Aggressionssteigerung nicht etwa mit der Gewalt im Spiel zusammenhängt, sondern damit, dass die Gruppe mit dem gewalthaltigen Spiel in größerem Maße „erregt ist“, also quasi „unter Strom“ steht, während die Gruppe mit dem gewaltfreien Spiel in aller Ruhe spielen kann, wodurch das „Erregungspotential“ den Ausschlag für die Aggressionssteigerung geben würde. Ebenso kann der Schwierigkeitsgrad von Spielen eine Ursache für eine eventuelle Steigerung von Aggression sein. Ein Beispiel hiefür ist die Studie von Anderson/Dill.
Untersuchung von Anderson/Dill*
Anderson und Dill führten 2000 eine Experimental- Studie mit 210 Psychologiestudenten durch. Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden ob gewalthaltige Computerspiele bei den Probanten einen Aggressivitätsanstieg zur Folge haben. Der Aufbau bestand aus einer Spielphase, in der jeder Proband eine gewalthaltiges (Wolfenstein 3D- Ego- Shooter) oder gewaltfreies (Myst- Adventure) Computerspiel, für jeweils 15 Minuten, spielte und einem „Testteil“ bestehend aus drei Tests: 1. Ein Fragebogen zu gegenwärtigen Aggressionsgefühlen. 2. Eine Messung der Reaktionszeiten auf aggressive und nicht- aggressive Wörter, die auf einem Bildschirm erschienen und möglichst schnell vorgelesen werden sollten. Der Test diente als Indikator für einen schnellen Zugriff auf aggressive Gedanken. 3. Ein klassischer „Bestrafungstest“ als Indikator für aggressives Verhalten. Beim „Bestrafungstest“ konnte einer anderen Versuchsperson, die nicht real anwesend war, im Rahmen eines Spiels (dabei handelte es sich nicht um ein Computerspiel) durch laute Geräusche über einen Kopfhörer „Schaden“ zugefügt werden. Die Länge und Intensität der Geräusche konnte die Versuchsperson selbst bestimmen.
Ergebnis: „Zwei der drei Tests in der Hauptuntersuchung ergaben signifikante Unterschiede zwischen Probanden, die Wolfenstein 3D gespielt hatten und solchen, die Myst gespielt hatten: Der Test bezüglich aggressiver Gedanken sowie der „Bestrafungstest“ (aggressives Verhalten) zeigten höhere Werte für die Wolfenstein- Spieler“[86]. Die Gültigkeit dieser Ergebnisse ist jedoch nicht ohne weiteres gegeben, da zum einen die Laborsituation (die Versuchspersonen saßen in Boxen und erhielten Anweisungen über Kopfhörer) nicht ohne weiteres auf die „Realität“ übertragen werden kann, ein generelles Problem von Laboruntersuchungen, zum anderen lässt der „Bestrafungstest“ innerhalb seines Spielrahmens keinerlei Schlussfolgerungen auf „reale“ Aggression zu, da „die Motivation, einen Gegner im Spiel zu „bestrafen“ … eine andere [ist][,] als im Rahmen des „realen“ Lebens“[67][87]. Weitere Probleme ergeben sich aufgrund der getätigten Spielewahl. Beide Spiele unterscheiden sich erheblich in ihrer Dynamik, Steuerung, Soundkulisse, Geschichte, sowie in den Anforderungen an die Probanten. Da der unterschiedliche Anteil von Gewalt nicht die einzige Unterscheidung darstellt, können die unterschiedlichen Reaktionen in den zwei beschriebenen Tests auch auf andere Faktoren zurückgeführt werden. Zum Beispiel auf eine unterschiedlich starke Erregung, Frustration der Spieler. Oder „auf Störfaktoren wie z. B. Gewöhnung an die laute Geräuschkulisse bei Wolfenstein 3D, die eventuell zu unvorsichtigerem Umgang mit den Tonstößen im anschließenden „Bestrafungstest“ führen könnten“[88].
Auch bleibt die Frage, warum Wolfenstein 3D gewählt wurde, da sich einige Spieler an dem Setting stören könnten (Nationalsozialismus), auch wenn dieses persifliert dargestellt wird. Ein Spiel mit diesem Setting ist eher geeignet vorhandene Ablehnungen von Spielern nochmals zu verstärken, zumal Hitler in einem Panzer der Endgegner ist. Allerdings ist das Spiel in 15 Minuten nicht zu bewältigen.
Kurz: „Die Schlussfolgerung, dass Gewalt in Computerspielen direkt Aggression fördert, ist anhand dieser Studie also unzulässig“[89]. Und selbst wenn ein erhöhtes Aggressionspotential nachgewiesen werde könnte, wäre noch nicht geklärt, welche Bedeutung dieser Erhebung beizumessen wäre: Wären diese Rezipienten dann zu mehr in der Lage als Anderen laute Geräusche „anzutun“? Würden sie eine real anwesende Person möglicherweise eher physisch angreifen? Werden Studien, die eine Aggressionssteigerung durch gewalthaltige Computerspiele belegen, herangezogen um die Gefährlichkeit der Spiele zu betonen? Dann geht es aber nicht mehr um eine Aggressionssteigerung, sondern darum, dass diese Spiele dadurch, dass sie die Aggression steigern, gleichzeitig die Gewaltbereitschaft der Rezipienten erhöhen. Eine Unterscheidung zwischen Aggression und Gewalt findet dann, wenn überhaupt, nur insofern statt, dass, das Eine das Andere bedingt. Die generellen Schwierigkeiten von Laborstudien werden dabei übergangen.
Zusammenfassend: Jede der hier vorgestellten Thesen, Theorien und experimentellen Untersuchungen bieten keine ausreichende Erklärung für die Wirkzusammenhänge zwischen Computerspielen und deren Rezipienten. Woran liegt das? Alle Ansätze umgehen Aspekte, die auf die Rezipienten einwirken und welche unmittelbar mit den Besonderheiten des Mediums „Computerspiele“ zusammenhängen. Jürgen Fritz hat mehrer Thesen über die Wirkungsweise von Computerspielen auf die Rezipienten erarbeit (Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988), die die Besonderheiten dieses Mediums unterstreichen. Hierbei werden bereits genannte Punkte wieder aufgenommen und in einen direkten Wirkungszusammenhang gebracht. Weiterhin werden verschiedene Aspekt angesprochen, die ab Punkt 4.2. stärker herausgearbeitet werden.
3. 3. Thesen zur Wirkungsweise von Computerspielen auf die Rezipienten
3. 3. 1. Computerspiele sind ein Vermittlungsmedium
Zunächst lässt sich konstatieren, dass Menschen in verschiedenen Wirklichkeitssphären leben, welche ineinander verschlungen sind und in einem ständigen Austausch stehen. Eine Sphäre betrifft die Innenwelt des Menschen, welche hauptsächlich gekennzeichnet ist durch Gefühle, Vorstellungen, Impulse, Erwartungen, Handlungstendenzen und Wertevorstellungen. Konträr dazu gibt es die Sphäre der Außenwelt, welche bestimmt ist durch den Umgang mit Objekten und Menschen und die in Erwartungen und Handlungsstrukturen mit der Umwelt ihren Ausdruck findet. Beide Sphären sind Bereiche im menschlichen Erleben, die sich wechselseitig durchdringen. Die Innenwelt steckt den Rahmen ab für das, was ich mit welcher Intensität wahrnehme, und wie ich diese Wahrnehmung bewerte. Die Außenwelt wiederum wirkt direkt, in verschiedener Gestalt, etwa durch Bezugspersonen, auf die Innenweltstruktur ein.
Zwischen beiden Bereichen bildet sich eine dritte Sphäre, der intermediäre Raum. In diesen fließen das innere Erleben und die äußere Realität ein. In der intermediären Sphäre kann sich das Individuum ausruhen von der Aufgabe innere- und äußere Realität voneinander zu trennen und sie doch wechselseitig in Verbindung zu halten. (Eine Trennung ist notwendig, da eine Person, die nur in ihrer „Innenwelt“ lebt große Schwierigkeiten bekommt, sich in unsere Gesellschaft zurechtzufinden, man bedenke die mannigfaltigen psychischen Krankheitsbilder. Eine Verbindung ist notwendig, um z.B. zu lernen verschiedene eigene Handlungsweisen und deren Auswirkungen abzuschätzen) Der intermediäre Bereich umfasst das Spiel, die Fantasie und Tagträume, in denen wir mit der Innen- und Außenwelt spielen können. „Innere und äußere Realität stehen hier in einem ständigen Austausch. Mit Hilfe des intermediären Raums kann das Kind und später auch der Erwachsenen zu vorläufigen Einigungsformeln zwischen Innen- und Außenwelt gelangen, die sein Überleben in der Umwelt optimieren helfen“[90].
Zu der Innen- und Außenwelt, die den intermediären Raum füllen, tritt ein weiteres Element hinzu, das Spielmedium (z.B. ein Brettspiel). Das Spielmedium ist ein Vermittlungsmedium, da es sowohl zwischen Innen- und Außenwelt, als auch zwischen den am Spiel Beteiligten vermittelt. „Die Struktur des Spielmediums steckt den Rahmen der Einigungsformeln zwischen Innenwelt und Außenwelt ab- weniger die Formel selbst. Es ermöglicht vieles, regt zu vielem an, grenzt anderes aus. Was der Spieler schließlich »erspielt«, ist eine subjektive und situative Einigungsformel zwischen seiner inneren und äußeren Realität“[91].
Das Computerspiel ist ebenfalls ein Spielmedium und mit dem Starten des Spielprogramms begibt sich der Spieler selbst in einen intermediären Raum. Im Computerspiel findet der Spieler ein breites Spektrum an Vermittlungsmöglichkeiten zwischen Innenwelt und Außenwelt. „Es geht im Videospiel um Macht und Ohnmacht, Beherrschen und Beherrschtwerden, Verfolgen und Verfolgtwerden, Wirkung und Wirkungslosigkeit, Angriff und Verteidigung, Erfolg und Misserfolg. Diese spieldynamischen Elemente haben zahllose Entsprechungen in der Lebenssituation der Spieler: Macht und Ohnmacht in Familie, Schule und Freundeskreis; Beherrschen von Menschen, Sachen, Situationen; Beherrschtwerden von bestimmten Ereignissen, Interessen und Menschen; Ziele und die Erfüllung von Aufgaben verfolgen, aber auch von Erwartungen, Aufgaben und Notwendigkeiten verfolgt werden. Erlebnissen, mit Handlungen und Überzeugungen Erfolg gehabt zu haben, stehen solche gegenüber, bei denen sich Misserfolge einstellten; jeder hat Verhaltensmuster von Angriff und Verteidigung ausgebildet: handgreiflich- körperlicher Art oder auf einer symbolisch- argumentativen Ebene“[92]. Es gibt im Computerspiel ein „heimliches Lernziel“, welches die Erfahrung vermittelt, durch Training, Ausdauer, Reaktionsfähigkeit und Stressbeherrschung Positives erreichen zu können (vgl. 1. 2- 1. 3.).
Das Computerspiel lässt viele Vermittlungsmöglichkeiten zu, die eine Spiegelung bestimmter Aspekte der inneren und äußeren Wirklichkeit darstellen und gleichzeitig einen Rahmen für die Vermittlung von innerer und äußerer Wirklichkeit abstecken. Innerhalb dieses Rahmens werden nicht nur Vermittlungsmöglichkeiten zugelassen, es werden gleichwohl sehr viele ausgegrenzt. Nach Fritz und vor allem Manuel Ladas lassen Computerspiele gerade solche Dinge wie Mitgefühl, Liebe, Zärtlichkeit und Ruhe nicht zu. Von dem genau abgesteckten Rahmen der Vermittlungsmöglichkeiten, also was im Computerspiel möglich ist und was nicht, gehen Wirkungen auf den Spieler aus. Genauer: „Man kann nicht sagen, daß ein Videospiel kriegerischen Inhalts grundsätzlich den Spieler aggressiv mache. Ein Spieler, der diese Spiele bevorzugt, bemüht sich »Einigungsformeln« zwischen seiner Innenwelt und Außenwelt zu finden. Welche Wirkung diese »Einigungsformeln« auf sein äußeres Verhalten haben, hängt von vielen Faktoren und ihrem Zusammenspiel ab. Empirische Forschung kann lediglich hinreichend seriös untersuchen, welchen generellen Wirkungen vom Vermittlungsrahmen der Videospiele ausgehen. Aussagen, in welcher Form und wie stark diese generellen Wirkungen im Einzelfall zum Ausdruck kommen, erfordern die Betrachtung von Wechselwirkungsprozessen. (Spieler) befinden sich in einem Feld unterschiedlicher Einflußgrößen: von innerpsychischen Strukturen und Prozessen über lebensgeschichtliche Hintergründe bis zu aktuellen situativen Kontexten“[93].
Der Rezipient von Computerspielen ist auch hier nicht mehr nur ein passiver Konsument, sondern er begibt sich in ein aktives Verhältnis, indem das Medium bewusst eingesetzt wird, um bestimmten Bedürfnissen einen Ausdruck zu geben.
3. 3. 2. Computerspiele erfordern „emotionslose“ Spieler
Computerspieler stehen durch die Mechanismen von Computerspielen, mit Ausnahme von Adventures und einigen Denkspielen, unter einem ständigem Erfolgsdruck, sie sind permanent gestresst, ein Fehler und das Spiel ist vorbei –diese Problematik ist dank der „Quicksave“- Option entschärft. Dadurch muss sich ein Spieler Verhaltensweisen aneignen, die häufigen Misserfolge ohne große innere Beteiligung hinzunehmen. Er muss lernen mit dem Stress, der sich aus der Spielsituation ergibt, umzugehen. „Er muss seine Gefühle kontrollieren, darf sich keine Gefühlsausbrüche erlauben, muß gleichwohl wach und konzentriert sein und die für das Spiel notwendigen Handgriffe mit traumwandlerischer Sicherheit beherrschen“[94]. Der Computerspieler ist somit einer großen Stressbelastung ausgesetzt, da jederzeit die Gefahr besteht durch einen „Fehler“ im Spiel nicht weiterzukommen oder den letzten Speicherstand laden zu müssen.
Durch eine Quicksave- Funktion, wird die Stressbelastung verringert. Es gibt aber noch eine Reihe von Ego- Shootern (Far Cry, Call of Duty 2, sowie generell bei Konsolenspielen) die nur an vorgesehenen Stellen automatisch speichern, wodurch der Spieler beim Ableben oft viele Stellen noch einmal spielen muss oder so weit zurückgesetzt wird, dass er einige Zeit spielen muss, um wieder die „Stelle“ im Spiel zu erreichen, an der er zuletzt „gestorben“ ist und womöglich wieder nicht „weiterkommt“. Die Belastungen in Form von Stress sind hier sehr hoch. Bei Online Shootern (Counter-Strike, Battlefield- Reihe) sind es eher die Versuche das Spiel zu gewinnen und das Erzielen einer positiven „Death-Kill-Ratio“, welche Stress verursachen.
Der Spieler steht demnach die meiste Zeit unter „Spannung“ und darf sich dennoch nicht emotionalisieren lassen und dadurch die „Spannungen“ umleiten, denn dadurch kann die Konzentration gestört werden und das Spiel ist vorbei. „Die Spieler müssen mit dem Computer verschmelzen. […] jeder abschweifende Gedanke führt unweigerlich zum Ende der Spielsequenz. Innerlich ganz gelassen, cool zu sein, ist der Schlüssel zum spielerischen Erfolg. In diesem Zustand fühlt und denkt der Spieler nichts, er ist innerlich leer. […] Der Spieler darf sich nicht allzu sehr freuen oder ärgern. Am besten, er fühlt nichts und denkt nichts dabei. Und genau diese Verminderung der Gefühlsintensität ist auch die Hauptwirkung der Videospiele- insbesondere bei älteren Spielern (ab etwa 14 Jahren). Gefühle wie Heiterkeit, Fröhlichkeit, Zufriedenheit, Ruhe ließen deutlich nach“[95].
In Fritz Untersuchungen hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen für ältere Spieler das Computerspiel eine Widerspiegelung ihrer stressbelasteten Umwelt ist. Im intermediären Raum des Computerspiels aktivieren sie ihre Stressbereitschaft und können damit besser den Anforderungen ihrer Umwelt gerecht werden. Die Dynamik des Spiels spiegelt die gesellschaftlichen Handlungserwartungen in der Schule, Familie und Beruf wieder. Auch hier gilt es zuverlässig, stressresistent zu sein und nach Perfektion zu streben. Ebenso wie im Computerspiel sind Gefühle in den hochtechnisierten Abläufen der Verwaltung, Produktionsstätten und militärischen Institutionen verpönt. Das Problem besteht nun darin, dass sich Gefühle nicht unterschlagen lassen und sich somit ein Bereich entwickelt hat, der unterhalb einer rationalen Ebene, ein Ausleben von Gefühlen ermöglicht. „ Auch der coole Videospieler besitzt diese Gefühlswelt, nur darf sie sich nicht mehr in der Auseinandersetzung mit der Realität entfalten, sondern sie wird abgedrängt in Phantasiewelten: Tagträumereien, Spielfilme, Trivialliteratur. In der Entmischung von Gefühl und Handeln wird das Handeln blind und das Gefühl folgenlos. Diese Blindheit und Folgenlosigkeit vermindern das Engagement des Menschen, lassen ihn in Gleichgültigkeit verharren“[96].
3. 3. 3. Computerspiele machen gegenüber ihren Inhalten gleichgültig
Wie gezeigt wurde, ist es notwendig sich schnell und richtig zu verhalten um in Computerspiel zurechtzukommen. Die Wahrnehmung wird dadurch auf reine Überlebensreize reduziert, die fürs das jeweilige Spiel hilfreich sind. Dadurch entsteht eine rein funktionale Form der Wahrnehmung, welche die Inhalte überlagert, weil es sonst zu einem Abbruch des Spiels kommt. Das hängt eng mit dem funktionalistischen Prinzip von Computerspielen zusammen.
„Nach unse0-000000ren Untersuchungen haben die Inhalte eines Videospiels keine Bedeutung für die Wirkung. Ein aggressives Kriegsspiel [hiermit sind Spiele mit physischer Gewalt gemeint- Ego- Shooter in denen das „töten“ von Figuren Bestandteil der Handlung sind] kann ähnliche Wirkungen im Hinblick auf Spielfreude, Anstrengung, Streßempfinden haben wie ein lustiges, comicartiges Spiel“[97]. Das Problem ist nach Fritz, das Computerspieler, die gewalthaltige Spiele spielen und deren Inhalten gleichgültig gegenüberstehen, auch eine Gleichgültigkeit gegenüber realer Gewalt, Kriegen und Aggressionen entwickeln. Dazu muss angemerkt werden: Aggression und physische Gewalt können nur in sozialen Kontexten als problematisch betrachtet werden, wobei auch dann eine Gleichgültigkeit in einem realen Kontext nicht zu vermuten (siehe 4. 6.).
3. 3. 4. Computerspiele wirken verstärkend auf vorhandenen Tendenzen
„Die Wirkungen des Videospiels auf Kinder und Jugendliche sind vielschichtig, die einzelnen Wirkkomponenten des intermediären Raumes Videospiel lassen sich auf einen wesentlichen Punkt hin verdichten: Videospiele verstärken das, was bereits vorhanden ist“[98]. Im Sinne des Uses- and- Gratifications- Ansatz wählen Kinder und Jugendliche diejenigen Spiele aus, welche ihnen die erwarteten Bestätigungsergebnisse liefern. „So wählen männliche Kinder und Jugendliche aus einem sozialen Umfeld, das Durchsetzungswille, aggressive [physische] Machtdemonstration und Männlichkeitsvorstellungen betont, auffallend häufig solche Spiele aus, in denen das »Abschießen« die wesentliche spielerische Bestätigung ist“[99]. Auf diese Weise versucht Fritz auch zu erklären, warum der Anteil der weiblichen Spieler bei Ego-Shootern so gering ausfällt. „Mädchen, die sehr viel stärker Aggressionstabus [auch hier gemeint als physisches Durchsetzungsvermögen] im Laufe ihrer geschlechtspezifischen Sozialisation aufgebaut haben, lehnen aggressiv [physisch] anmutende Videospiele in den meisten Fällen ab: Sie sind ihnen nicht gemäß, weil sie sich in ihnen nicht wiederfinden“[100].
Das ist leider eine Vorstellung, die in vielen Forschungen zum Ausdruck kommt. Dabei ist es nicht so ohne weiteres klar, ob ein derart angenommenes, belastendes soziales Umfeld bei männlichen Spielern eine Neigung zu Ego-Shootern determiniert. Die Zusammensetzung der Computerspieler ist bei weitem nicht so homogen, wie das Zitat vermuten lässt (siehe Manuel Ladas S. 270). Es stimmt natürlich, dass Computerspiele im Allgemeinen, und besonders Ego-Shooter hauptsächlich vom männlichen „Geschlecht“ gespielt werden, aber eben nicht bevorzugt von sozialen „Problemkandidaten“. Auch die Annahme im zweiten Zitat kann nicht so einfach bestätigt werden; es lässt sich nur feststellen, dass das weibliche „Geschlecht“ kaum Computerspiele spielt. Warum dies bei Computerspielen so ist, ist die Frage einer anderen Arbeit.
Insgesamt betrachtet beinhalten die Thesen von Fritz dennoch einige Aspekte, die als Einstieg in Untersuchungen von Computerspielen berücksichtigt werden sollten, da eine Forschung, die einseitig, auf Auswirkungen von (gewalthaltige) Inhalten in Computerspielen auf deren Nutzer fokussiert bleibt keine nennenswerten Ergebnisse liefern kann: sowohl die Nutzer, als auch das Medium wären in einem solchen Fall austauschbar bzw. sind sie es in den genannten Theorien/ Thesen (3.1- 3. 2. 2.). Bevor in 3. 5. ein kurzes Fazit zum 3 Kapitel gezogen und das weitere Vorgehen skizziert werden soll, möchte ich im Folgenden noch auf einen mir wichtig erscheinen Punkt eingehen. Vielfach wird angenommen, dass Kinder und Jugendliche besonders empfänglich für Computerspiele sind und ihr Umgang mit diesem Medium von einer gewissen „Naivität“ geprägt ist, wenn es um negative Auswirkungen von Spielegewalt geht. Kindern und Jugendlichen wird unterstellt, dass sie viel eher nicht in der Lage sind zwischen „Virtualität“ und „Realität“ zu unterscheiden, und deswegen eher gezeigtes Verhalten „transferieren“. Auch erwachsene Spiele betonen häufig, dass Computerspielen für sie kein Problem ist, dass sie damit gut umgehen können, bei Kindern und Jugendliche aber ein „Gefährdungspotential“ sehen. Gründe dafür finden sich viele. Einige Beispiele: Kinder suchen doch nach Vorbildern, die sie in ihrem Verhalten nachahmen können; wer kennt nicht aus seine eigenen Jugend das Nachahmen von z. B. Handlungen aus Spielfilmen oder Serien (bei mir unter anderem Miami Vice), woraus ein nicht „wünschenswertes“ soziales Handeln entstehen kann, da z.B. in Action- Filmen fragwürdige Verhaltensweisen der Konfliktlösung glorifiziert werden. Zu dieser Nachahmungsbereitschaft gesellt sich die Vermutung das Kinder erst soziales Verhalten lernen müssen (kein Einspruch meinerseits), dieses jedoch nicht durch Computerspiele vermittelt bekommen können, hier könne man nur das Töten lernen (Einspruch). Weiterhin gehen Kinder und auch Jugendliche - mit zunehmenden Alter seltener - viel unbeschwerter mit Beschreibungen über Computerspiele um, so dass sie z.B. äußern, dass sie gänzlich in ein Spiel eintauchen, sich quasi mit der Spielfigur vereinigen und ihr Abenteuer bestehen. Erwachsene, die um das öffentliche Bild von Computerspielern wissen, halten sich in der Regel mit solchen Äußerung zurück. So war es auch für Daniel Hoffmann und Volker Wagner, die im Rahmen ihrer Diplomarbeit eine Untersuchung über Computerspiel- Motivationen und Erlebnisformen bei Erwachsenen (zu Finden in: Fritz, Jürgen, Warum Computerspiele faszinieren, S. 158) schrieben, schwierig Erwachsene zu Finden, die darüber Auskunft geben wollten. Vielfach stießen sie auf die Frage: Wollt ihr mich als Idioten darstellen? Erst durch mehrmalige Betonung, dass sie niemanden als Idioten darstellen wollten, und auch selbst auf dem Computer spielen würden, konnten sie 20 Interviewpartner finden. In Bezug auf ein „Gefährdungspotential“ bestätigten die Interviewpartner die vorherrschende Meinung. Daher zunächst einige Überlegungen zur Frage:
Besteht ein erhöhtes „Gefährdungspotential“ bei Kindern und Jugendlichen?
3. 4. Kinder und Jugendliche sind prädestiniert für mediale Gewaltdarstellung
„Meine Söhne sind inzwischen 17 und 19 Jahre alt. Während ihrer Kindheit versuchte ich einerseits, sie zu schützen, und sagte deshalb oft Nein zu ihrem Wunsch nach gewaltverherrlichenden Videospielen, Kino- und Fernsehfilmen. Andererseits ermutigte ich sie gleichzeitig, diese Gewaltdarstellungen zu hinterfragen. Ich versuchte, ihre Unschuld so lange wie möglich zu erhalten und wollte, dass sie von Anfang an wissen, wie viel klüger und kreativer als das Fernsehen und die Videospiele sie selbst sind“[101]. In der Aussage von DeGaetano kommt der nachvollziehbare Wunsch zum Ausdruck ihre Kinder in einer konfliktfreien Umwelt aufwachsen zu lassen, und die Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu fördern(Konflikte mit den Eltern gab es mit Sicherheit). Dennoch bleibt die Frage, wie ihrer Kinder mediale „Gewaltdarstellungen“ hinterfragen sollen, wenn sie nie welche erlebt haben? Man kann jedoch davon ausgehen, dass ihre Kinder nicht vollkommen isoliert von Gleichaltrigen aufgewachsen sind und z.B. in der Schule Gespräche über Filme und Spiele mitbekommen haben, woraus sich auch ein Wunsch nach Konsumierung von derartigen Medien ableiten lässt. Interessant wäre auch, wie ihre Kinder die Verbote aufgenommen haben und welche Konsequenzen sie daraus zogen. Meine Vermutung wäre, dass sie, zumindest in ihrer Fantasie, ihre Eltern „verflucht“ hätten. Verbote gegen etwas, was man gerne möchte und nicht bekommen kann, weil man sich einer „Autorität“ unterordnen muss, sind immer schwierig zu akzeptieren, auch wenn die Begründung „logisch“ ist. Schwieriger zu akzeptieren sind Begründungen, die Kinder öfter ertragen müssen: „Weil ich das Sage!“ oder „Das macht man einfach nicht!“ Solche Erfahrungen macht jedes Kind im laufe seiner Entwicklung und es muss lernen damit umzugehen. Aus solcher Zurückweisung kann Wut auf die Eltern entstehen und es können Bedürfnisse entstehen, diese physisch auszudrücken. Was aber tun, wenn die Eltern doch geliebt werden? Durch reale Rache und Vergeltung können die geliebten Personen zerstört werden, obwohl man noch existentiell von ihnen abhängig ist. Als Ausweg bietet sich die Verschiebung der Vergeltungs- und Racheimpulse auf symbolische, im weitesten Sinne fantastische Objekte an. Sei es im Bereich der Fantasie, der klassischen „Kinderspiele“ (selbsterfundene Schulhofspiele), Fernsehen oder Computerspiele. Wie Rathmayr betont (Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996) brauchen Kinder solche Möglichkeiten ihre aggressiven und auf Vergeltung ausgerichteten Tagträume, ihre feindseligen Gefühle auszuleben, ohne ihre nächsten Angehörigen (ohne überhaupt jemanden) direkt zu verletzten. Sie erschaffen sich imaginäre Ersatzfiguren, über die sie ihren Alltagsfrust bewältigen, ihre Ängste und Wünsche auslebbar machen können. Ersatzfiguren können aber auch aus einem vorhandenen Fundus entnommen werden, wozu eben auch Computerspiele gehören. Auch wenn darin Handlungen bereits abgesteckt sind kann man mit Hilfe der Fantasie deren Bedeutung erweitern (Übertragung des Erlebten auf die Figuren- Bösewicht steht stellvertretend für ein Elternteil, oder einfach nur die Umkehrung der Machtverhältnisse- siehe 1.2.1/1.3). Weiterhin bietet z.B. Counter-Strike die Möglichkeit für Jugendliche auf eine große Auswahl von Karten zurückzugreifen oder eigene zu erstellen, die einige Bereiche der eigenen Lebenswelt berühren (z.B. die nach Emsdetten diskutierte Karte der Schule). Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Filmen, die mit Hilfe von Computerspielen gedreht werden (dazu mehr unter 4.4.). Dabei ist nicht zu befürchten, dass gespielte Gewalt in reale Gewalt umschlägt.
„Ob gespielte Gewalt in reale Gewalt umkippt, hängt von Faktoren ab, die mit dem Spiel nur wenig zu tun haben. Reale Gewalt ist nämlich immer der Ausdruck eines Widerstandes gegen Verhältnisse, sei der Widerstand nun rational begründet oder nicht. Gespielte Gewalt dagegen beläßt die Impulse in dem Raum der Phantasie, den andere, zum Beispiel Mitspieler, zu teilen bereit sind. Es ist vorstellbar, daß dann Gewaltphantasien in Realitäten umgesetzt werden, wenn weder der Raum für Wünsche und Bedürfnisse im Hier – und – Jetzt ausreicht, noch durch die Phantasie erweitert werden kann. Da eine Vielzahl von Einschränkungsmöglichkeiten ebenso vorstellbar ist wie eine Vielzahl von Möglichkeiten, neue Räume zu eröffnen, ist es wahrscheinlich wieder vom Einzelfall abhängig, ob und wann eine Gewaltphantasie in Gewaltrealität umschlägt. Es ist allerdings zu bedenken, daß aus der kindlichen Perspektive Gewalt durchaus als ein legitimes Mittel (der Erwachsenen) erlebt wird, persönlich (und gesellschaftliche) Grenzen zu überschreiten, ohne daß die moralische Verurteilung solcher Überschreitungen wirklich konsequent durchgeführt würde“[102]. Was man als Gewalt in Spielen erkennt, ist auch immer abhängig von der moralischen Wertung des Geschehens. Daher sollten: „Erwachsene, also auch Pädagogen und Politiker, nicht eigene Kindheitserfahrungen als normal und Norm sehen, wenn sie über heutige Kindheit zu befinden haben. Viele Kinder gehen erstaunlich selbstsicher und unkompliziert mit neuen Medien und Techniken um. Dem Versuch, die eigene kulturelle Identität (einschließlich der Medien-, Spiel- und Unterhaltungskultur) von vornherein als wertvoller anzusehen, sollten wir Erwachsenen widerstehen“[103]. Grade an der zunehmenden Technisierung der Kinderzimmer zeigt sich, dass eigentlich weniger die Kinder selbst ein Problem mit den technischen Spielzeugen haben, bieten sie doch eine Reihe von Möglichkeiten um „ihre feindseligen Gefühle auszuleben“, als vielmehr die Erwachsenen. Dazu kommt die nicht unerhebliche Erfahrung für Kinder, dass sie sich im Bereich der technischen Spielzeuge (dazu gehört auch der Computer) besser Auskennen als ihre Eltern, wodurch die Verhältnisse einmal umgekehrt sind, so dass z.B. die Eltern bei Problemen mit dem Internet ihre Kinder um Hilfe fragen müssen. Im Bereich von gewalthaltigen Computerspielen sind Eltern in der Regel vollkommen „hilflos“, sie wissen nicht viel über die Mechanismen der einzelnen Genres, sondern sehen nur ihre spielenden Kinder und können die öffentliche Diskussion um „Killerspiele“ verfolgen, welche darauf ausgelegt ist Ängste zu schüren bzw. zu verstärken. Die Bereitschaft der Eltern, einmal selbst mit ihren Kindern am Computer mitzuspielen, deren Erfahrungen ein Stück weit zu teilen und sich danach über die gewonnenen Eindrücke beim Spielen mit ihren Kindern auszutauschen, wird durch die öffentliche Diskussion eher behindert. Warum sich mit Computerspielen auseinandersetzen, wenn eine bestehende Skepsis so eindrucksvoll untermauert wird. Natürlich ist eine kritische Einstellung gegenüber Computerspielen nicht per se eine falsche, nur „ist es zum einen inkonsequent und pädagogisch sinnlos, bei Kindern zu verurteilen, was Erwachsenen zugestanden wird (z.B. Fernsehen oder Krieg »spielen«), und zum anderen illusionär zu glauben, durch Verbote könne man eine heilere und bessere Welt schaffen“[104].
Um auf die Eingangsfrage einzugehen: Es ist nicht ohne weiters davon auszugehen, dass bei Kindern und Jugendlichen ein erhöhtes „Gefährdungspotential“ durch gewalthaltige Computerspiele vorhanden ist. Zum einen sind Kinder, worauf in der Arbeit bereits hingewiesen wurde, durchaus in der Lage zwischen gespielter und realer Gewalt zu unterscheiden, zum anderen werden Computerspiele von Kindern und Jugendlichen bewusst eingesetzt um bestimmten Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Weiterhin bezieht sich die Argumentation von Erwachsenen häufig auf eigene moralische Vorstellungen einer „heilen“ Welt, wie es sie in ihrer Kindheit vermeintlich gegeben hat und in denen zum Ausdruck kommt, dass gerade das besonders gefährlich für Kinder und Jugendliche ist, was es in ihrer eigenen Kindheit kaum gegeben hat und von dem sie nicht viel wissen. Das auch erwachsene Spieler eine Gefährdung für Kinder sehen, liegt, meiner Ansicht nach, an der Vorstellung über kindliche Entwicklung, wie sie in 3. 3. 4. im letzen Absatz anhand einiger Beispiele skizziert wurde. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass gewalthaltige Computerspiele einen stärkeren Effekt auf Kinder und Jugendliche haben, nur mit Sicherheit nicht in Form einer stärkeren Ausprägung und Übertragung möglicher gewalthaltiger Handlungen in der „Realität“. Dazu gehören vielfältige Aspekt, die zusammenspielen müssen, und nicht das Spielen gewalthaltiger Spiele allein. Vielleicht kommt in der Bewertung von Computerspielen auch jenes Phänomen zur Geltung, welches Bettelheim anhand des Fernsehens konstatierte. Bettelheim führt die Tatsache, dass Eltern, Erzieher und andere moralische Instanzen sich besorgt über den Schaden, welches das Fernsehen besonders den Kindern antut, drauf zurück, dass das jeweils jüngste Medium immer unter besonderen moralischen Druck gerät. „Moralisten neigen von Natur aus dazu, über die neuste jeweils vorherrschende Form der Unterhaltung besorgt zu sein“[105].
Als Stütze für Bettelheims Behauptung lässt sich die historische Bedeutung des Buches heranziehen. Heute gilt die pädagogische Erziehung zum Lesen, als erstrebenswert – der Wert und die Wichtigkeit von Büchern ist anerkannt. Im 15. Jahrhundert war das gedruckte Buch umstritten. Der venezianische Dominikanermönch Filippo di Strata hebt eine andere Facette von Büchern und der Fähigkeit zu Lesen hervor: „[Der Buchdruck und die Texte] die in schlampigen Editionen und allein aus Profitgründen auf den Markt geworfen werden; korrumpiert den Geist durch Verbreitung unmoralischer und heterodoxer Texte, die sich der Kontrolle durch die Kirchenbehörden entziehen; und er korrumpiert die Bildung selbst, befleckt sie, weil er sie den Ungebildeten öffnet“[106].
3. 5. Kritik
Fassen wir zusammen: Vielfach werden die Auswirkungen von Computerspielen auf Kinder und Jugendliche diskutiert, Erwachsene werden bisher kaum berücksichtigt. In welcher Form Computerspiele Kinder und Jugendliche, hinsichtlich ihrer Aggressionsbereitschaft oder physischen Gewaltbereitschaft, oder auch einer Auslebung von „Gewaltbedürfnissen“ beeinflussen, kann keine der genannten Thesen/Theorien belegen. Wie gezeigt wurde sind diese Versuche eine eindeutige Wirkung der Medien auf die Rezipienten zu konstruieren mit Schwierigkeiten verbunden, betrachten sie doch die Nutzer zu isoliert, „angesichts der Vielfalt intervenierender Variablen, angesichts der Menge der einströmenden Reize und Erfahrungen, der „Multimedia- Welt“, in der Kinder leben“[107]. Ebenso sind Laborexperimente, die versuchen Auswirkungen von gewalthaltigen Computerspielen zu untersuchen und damit eine „Annäherung“ an eine „realitätsnahe“ Spielsituation, damit ist eine vergleichbare Situation mit dem Computerspielen zu Hause gemeint, herzustellen und durch diese Spielsituation empirische Erkenntnisse zu gewinnen, deren Ergebnisse fundierter erscheinen, als in den genannten Thesen/Theorien, problematisch. Aus solchen Experimenten wird im Rahmen der Medienforschung ex post facto geschlossen, dass der Konsum entsprechender Medieninhalte Wirkungen habe. Das heißt: Aus einem beobachteten oder erfragten Konsum bestimmter Computerspiele wird ein kausaler Zusammenhang zwischen ausgeübter Gewalt und konsumierter Gewaltdarstellung konstruiert. Diese Konstruktion im Rahmen von empirischen Studien ist auch notwendig, da auf eine andere Art die Hypothesen gar nicht geprüft werden können. Es wäre sinnlos, das Medienkonsumverhalten in Relation zu aggressiven oder gewalttätigen Handlungen zu setzen wenn kein Wirkungszusammenhang angenommen werden würde. Dennoch sind solche Studien in ihrer Aussagekraft sehr eingeschränkt. Neben den bereits genannten Problemen gibt es noch eine Reihe weiterer: So gibt „es nur wenige Langzeituntersuchungen, die Zahl der Probanden ist meist zu gering (Problem der Repräsentativität), Laborexperimente sind künstlich und kurzfristig, es gibt kaum vergleichende Studien für verschiedene Medien, inhaltsanalytische Studien haben Probleme mit Abgrenzungskriterien (z.B. bei Gewalt), Theorien sind oft kontextfrei (in welchem Kontext sind z.B. Gewaltdarstellungen »schlecht« im Sinne einer negativen Wirkung auf die Rezipienten oder »gut« im Sinne einer möglichen Aufklärungswirkung)“[108].
Welche Konsequenzen lassen sich daraus ziehen? „Wir müssen vor allem von der traditionellen Wirkungsforschung wegkommen, die so tut, als seien die Kinder und Jugendlichen nur passive Auftreff- Flächen für Medien, und die häufig simplifizierende monokausale Erklärungsmodelle unterlegt, die uns nicht wirklich weiterbringen. Statt dessen müssen wir verstärkt Nutzungsforschung betreiben, welche primär nach den Nutzungsmustern und ihren historischen Veränderungen fragt, nach den Gründen für die Mediennutzung und nach dem (funktionalen) Nutzen der durch die Medien vermittelten Inhalte und Erfahrungen für die Jugendlichen sucht, welche schließlich auch die Jugendlichen selbst stärker als aktive, auswählende, interpretierende und produktive Nutzer von Medien sieht und davon ausgeht, daß Medienwirkung in erster Linie von den Motiven der Rezipienten und ihrem Umgang mit den Medien und erst in zweiter Linie von Inhalt und Struktur der Medien bestimmt werden“[109].
In dieser Arbeit wurde bereits der Versuch gemacht Gründe und Nutzen von Computerspielen (vgl. Was sind Computerspiele) näher zu erörtern und dadurch die Rezipienten im Sinne des Zitates als „aktive, auswählende, interpretierende und produktive Nutzer“ von Computerspielen zu begreifen. In den Thesen von Fritz wurde weiterhin deutlich gemacht, dass Computerspiele in einer Weise auf die Rezipienten wirken, die über monokausale Erklärungsansätze hinausgeht. Dabei wurden die spezifischen Eigenschaften von Computerspielen ebenso berücksichtigt, wie die Rezipienten, welche gleichsam nicht als isoliert von dem Medium betrachtet wurden. Im weiteren Verlauf der Arbeit ist es nun notwendig genauer auf mögliche Transferleistungen von „virtueller“ Gewalt und „realer“ Gewalt einzugehen, da dies bisher nur am Rande geschehen ist. Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: Zunächst folgt ein Exkurs über Erfurt in deren Verlauf sich zeigt, dass zumindest die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. den Forderungen im Zitat nachkommt. Danach geht es um die Bestimmung von „Realität“, „Virtualität“ und Fantasie, da es erst einmal nötig ist zu bestimmen, was überhaupt mit den Bereichen gemeint ist, bevor auf mögliche Transfers eingehen werden kann. Fantasie wurde bereits mehrfach genannt, soll nun aber näher spezifiziert werden. Nach den Erörterungen der drei Bereiche stellt sich die Frage: Welche Mechanismen müssen wirken, damit überhaupt ein Transfer von einem Bereich in einen anderen möglich wird? Welche Transfers sind dabei anzunehmen? Ebenso werden Aussagen von Spielern interpretiert, die sich unmittelbar mit der Wahrnehmung von Gewalt in Computerspielen beschäftigt, welches bisher unberücksichtigt blieb. Abschließen stellt sich die Frage: Verhindern gewalthaltige Computerspiele das empathische Empfinden der Rezipienten? Die Auseinandersetzung mit Empathie ist wichtig, da angenommen wird, dass Empathie ein wichtiger Faktor ist um gewalttätiges Verhalten zu verhindern.
4. Transfer zwischen virtueller Gewalt und realer Gewalt
4. 1. Exkurs: Erfurt und die Diskussion um Counter-Strike
Vor dem Amoklauf in Emsdetten und nach jenem an der Columbine High School (Littleton, Colorado) wurde die Diskussion um gewalthaltige Ego-Shooter auch in Deutschland, durch die Ereignisse in Erfurt, verstärkt geführt bzw. gerieten gerade diese Spiele besonders in den Fokus der öffentlichen Debatten, wenn es um die Beantwortung der Frage ging, wie solche Taten geschehen konnten. Wie auch in Emsdetten und Littleton ging es in der öffentlichen Debatte darum zu zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten und den Spielen existierte. Entweder in Form einer direkten Übertragung der Spielhandlungen in die „Realität“ oder insofern, als dass diese Spiele als Trainingsmöglichkeit für mögliche „Gewalttaten“ dienten. Häufig wurde einer der vermuteten Auswirkungen mit einem Hinweis auf vielfache Studien belegt, die belegen sollten, dass gewalthaltige Computerspiele die Aggressionsbereitschaft der Rezipienten förderten und gleichsam die empathischen Fähigkeiten schwächten - beides vermeintliche Grundbedingungen für mögliche Gewalttaten. Eine weitere Regel in der öffentlichen Debatte lag darin, die erwähnten Studien nicht näher zu benennen, sowie vielfach Computerspiele zu beschreiben, die besonders grausame Taten als Spielablauf beinhalteten (etwa die Behauptung es gäbe Spiele, deren Ablauf darin besteht Frauen zu foltern und zu vergewaltigen) ohne auch diese Spiele zu benennen, was schwierig werden würde, da solche Spiele zumindest in Deutschland nicht gekauft werden können, ob sie überhaupt existieren bleibt ebenfalls fragwürdig. Gerade die Bild- Zeitung zeigte ihre Kompetenz, im Hinblick auf Computerspiele darin, dass sie ein Bild von Counter-Strike veröffentlichte, in dem eine Spielfigur ohne Arme und Beine gezeigt wurde. Rote Pfeile lenkten den Blick des Betrachters dabei auf die fehlenden Gliedmaßen. Das es sich bei dem Bild – das als Auszug aus Counter-Strike untertitelt war - um ein Bild aus „Soldier of Fortune“ handelte, welches in Deutschland indiziert ist und deshalb weder beworben werden noch im Laden in einem Regal stehen darf, und nur auf Nachfrage an Erwachsene verkauft werden kann, wurde dabei nicht erwähnt.
Was geschehen war und warum geriet gerade Counter-Strike so sehr ins Zentrum der Debatte geraten war. Ersteres ist ohne Schwierigkeiten darstellbar:
Am 26. April 2002 tötete Robert Steinhäuser im Gutenberggymnasium 12 Lehrer, eine Sekretärin, zwei Schüler und anschließend sich selbst.
Nach der Tat fand man im Zimmer von Robert Steinhäuser mehrer Computerspiele, darunter Quake 3 (ein in Deutschland aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung indizierter Ego- Shooter) und eben auch Counter-Strike. Warum sich die Aufmerksamkeit gerade auf Counter-Strike richtete, lässt sich, auf Grundlage meiner Quellen nicht mehr rekapitulieren. Fakt ist: Counter-Strike geriet in den Fokus der Berichterstattung, obwohl sich im Bezug auf die Darstellung von physischer Gewalt eher Quake 3 geeignet hätte. Wurde doch vor allem dieser Aspekt von Counter-Strike hervorgehoben, obwohl gerade dieses Spiel in der Darstellung von physischer Gewalt äußerst „sparsam“ ist - es können weder Gliedmassen abgeschossen werden, noch wird exzessiv „Blut vergossen“. Der Eindruck, den man erhielt, wenn man die Debatte verfolgt hat, ist der Gleiche, der sich auch im Zuge von Emsdetten einprägte: Das Urteil über die Ursachen wurde, sowohl von den Experten, die sich zu Wort meldeten, als auch von Politikern bereits im Vorfeld gefällt. Die Medien (am Rande wurden auch Musiker mitverantwortlich gemacht- z.B. die Band „Slipknot“, deren CDs sich bei Steinhäuser fanden) und ihre Inhalte, insbesondere deren Gewaltdarstellungen, sowie Counter-Strike, sind Schuld an dem Amoklauf. Differenziertere oder ablehnende Meinungen kamen in der Regel nicht zu Wort, oder wurden auf Kanäle und Sendeplätze gelegt, die nur wenige Menschen erreichen. „Dabei muss über die in den Medien geführte Diskussion ebenso wie über die Statements der Politiker gesagt werden, dass die Rede von den gesicherten Ergebnissen der Forschung über Medienwirkungsprozesse mehr als problematisch ist, da sie in dieser Form gar nicht existieren“[110]. Ob es gesicherte Befunde gibt oder wie im Zitat festgehalten eben nicht, ist dabei ohne Bedeutung, wie auch Gerhard Schröder in einem offenen Brief nach den Ereignissen in Erfurt betonte: „Wir werden wohl nie über einen unmittelbaren wissenschaftlichen Beweis für einen direkten Zusammenhang von Taten wie dieser und der Darstellung von Gewalt verfügen. Aber ist das überhaupt notwendig?“[111]. Anscheinend nicht in einem Fall wie Erfurt, in dem, so ist zumindest mein Eindruck, ein gewisser Erwartungsdruck und Handlungsdruck auf politischen „Entscheidungsträgern“ lag, welchem, zumindest kurzfristig, durch das Benennen von auslösenden Faktoren und gleichzeitiger Versprechungen Maßnahmen zu ergreifen entgegengewirkt werden konnte- es wurde der Eindruck vermittelt „die Lage erkannt zu haben“ und alles dafür getan zu haben eine Wiederholung einer solchen Tat zu verhindern. Dafür bieten sich gewalthaltige Computerspiele, als ein Gegenstand, der greifbar und feststellbar ist, auf den z.B. mit Gesetzen eingewirkt werden kann, an. Andere Faktoren, die ebenfalls eine Rolle für mögliche Amoktaten sind, insbesondere solche, die sozial bedingt und in einem Gesellschaftsgefüge verstrickt sind, sind sehr komplex und deshalb schwieriger greifbar zu machen – ganz abgesehen von der großen Schwierigkeit hier handelnd einzugreifen. Ein Verbot gewalthaltiger Computerspiele ist allerdings ein Mittel, eben jene Handlungsbereitschaft zu signalisieren. Folglich wurde ein Antrag auf Indizierung von Counter-Strike an die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (jetzt BPjM), durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, gestellt.
4. 1. 1. Die Rolle der BPjPS/BPjM
Charakterisierung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.
Was genau ist die BPjM/BPjS?
Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM, ehemals Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften- BPjS) ist eine deutsche Bundesoberbehörde mit Sitz in Bonn, welche dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nachgeordnet ist. Ihr Aufgabenbereich liegt in der Prüfung und einer eventuell aus der Prüfung entstehenden Aufnahme von Medien in die Liste der jugendgefährdenden Medien, welche alle indizierten Medien enthält. Sie dient dem medialen Jugendschutz. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wurde am 18. Mai 1954 gebildet, nachdem am 9. Juni 1953 ein Gesetz über die Verbreitung von jugendgefährdenden Schriften verabschiedet worden war. Ziel der BPjS (gilt auch für die BPjM) ist: „Der Schutz der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen […], [was beinhaltet]dass Einflüsse ferngehalten werden, die ihren Reifungsprozess negativ beeinflussen können“[112]. Im Juni 2002 nach den Ereignissen in Erfurt wurde ein neues Jugendschutzgesetz verabschiedet, welches das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit ersetzte und am 1. April 2003 in Kraft trat. Die Prüfungskompetenz der BPjS wurde erweitert und beinhaltet in ihrer jetzigen Form auch die neuen Medien, wie etwa Webseiten. Computerspiele fielen bereits unter das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Aufgrund der erweiterten Prüfungskompetenz wurde die Behörde in „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ (BPjM) umbenannt.
Wer kann Anträge stellen?
„Ein Verfahren der Bundesprüfstelle kann auf zwei Wegen zustande kommen: Durch den Antrag einer Stelle, die vom Gesetz dazu besonders ermächtigt worden ist und durch die Anregung einer Behörde bzw. eines anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe.
Während ein Antrag die Bundesprüfstelle dazu verpflichtet, ein Prüfverfahren durchzuführen, ist dies bei der Anregung nicht zwingend der Fall: Hier hat die Bundesprüfstelle einen Ermessensspielraum - sie kann also tätig werden, wenn sie das im Interesse des Jugendschutzes für geboten hält, sie muss es aber nicht in jedem Fall. Eine besondere Antragsberechtigung besitzen in Deutschland rund 800 Stellen. Sie erstreckt sich auf die Obersten Jugendbehörden der Länder, die Landesjugendämter, die Jugendämter, die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz (Kommission für Jugendmedienschutz, KJM) und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“[113].
Bearbeitung der Anträge:
Wird ein Antrag auf Indizierung bei der BPjS eingereicht, erfolgt eine Prüfung des jeweiligen Gegenstands durch ein 12er- oder 3er-Gremium (vereinfachtes Verfahren bei einer offensichtlichen Jugendgefährdung).
Für eine Indizierung muss eine zwei Drittel Mehrheit stimmen (12er Gremium), beim 3er-Gremium muss die Votierung einstimmig sein. Eine Ablehnung des Indizierungsantrages kann allerdings nur durch das 12er-Gremium erfolgen.
Soweit die Charakterisierung der BPjM.
Am 16. Mai 2002 erfolgte die Prüfung des Indizierungsantrags von Counter-Strike durch ein 12er-Gremium der BPjS. Im Vorfeld der Prüfung entscheid sich die BPjS erstmals in ihrer Geschichte für ein abweichendes Verfahren. Die LAN-Party Liga „PC-Action WWCL“ („Als zentraler Verband, ähnlich der aus dem Tennis bekannten Dachorganisation ATP, setzt die PC ACTION WWCL die Rahmenbedingungen für ein multinationales Ranking vieler LAN-Party-Spieler und kürt die Champions der beliebtesten Multiplayer-Games“[114].) wurde von der Bundesprüfstelle beauftragt zwei Counter-Strike Spieler zu ermitteln, welche stellvertretend für die Counter-Strike- Community am Prüfungstag vor dem 12er-Gremium über das Spiel referieren sollten, entgegen der üblichen Vorgehensweise lediglich die Hersteller oder Vertreiber eines Verfahrensgegenstandes zur Anhörung einzuladen. Die Auswahl der zwei erfolgte über eine demokratische Wahl bei der die Szene selbst entschied, wer sie vertreten sollten. Die größten Clans, Community- Websites und Portale wurden kontaktiert und konnten jeweils drei Namens-Vorschläge einreichen. Über die in der Vorauswahl am häufigsten genannten Spieler wurde noch einmal innerhalb von zwei Wochen abgestimmt, so dass sich am Ende zwei Spieler fanden (Rami Allouni, Systemadministrator/ Sven Spilker, Polizist), die am Prüfungstag über Counter-Strike referierten. Der Ablauf der Prüfung verlief folgendermaßen: Dem 12er-Gremium wurden zunächst wesentliche Teile des Spieles „Counter-Strike“ vorgeführt: ein Mitarbeiter der BPjS spielte das Spiel auf einem zufälligen öffentlichen Server. Anschließend folgte ein ca. 20-minütiger Vortrag der beiden Counter-Strike- Spieler, der sowohl auf die Entwicklung des E-Sports im Allgemeinen (insbesondere auch auf die altersmäßige Zusammensetzung der Community) als auch auf die jugendschutzrelevanten Besonderheiten des Spieles „Counter-Strike“ einging.
Die beiden Vertreter der Counter-Strike- Community konnten das Gremium offenbar überzeugen, da die BPjS entschied, dass eine Indizierung von Counter-Strike aus Gründen der Jugendgefährdung nicht erforderlich sei. Der Antrag wurde somit abgelehnt. In einer anschließenden Presseerklärung erörterte die BPjS die Gründe, die gegen eine Indizierung sprachen. „Im Wesentlichen wurde die Argumentation der CS-Spieler nachvollzogen, dass sehr wohl neben dem Spielen selbst auch der Kommunikationsaspekt eine große Rolle spiele. Counterstrike böte Spielern, die nur »aktionale Inhalte und Formen suchen«, nicht genug Anbindungsmöglichkeiten“[115]. Die BPjS betonte aber auch, dass Counter-Strike für Kinder und jüngere Jugendliche nicht geeignet sei, da es für diese Altersgruppe beeinträchtigende Elemente aufweise. Unter der Annahme, das Kinder und jüngere Jugendliche auf der Suche nach einem differenzierten Normen- und Wertesystem sind, kann Counter-Strike durch seine kampforientierte Handlung eben jene Suche negativ beeinflussen. Bei älteren Jugendlichen geht die BPjS davon aus, dass dieses Normen- und Wertesystem bereits vorhanden ist und sie gleichfalls zwischen Realität und Spiel unterscheiden können. Counter-Strike ist gesetzlich verbindlich freigegeben ab 18 Jahren.
Das Vorgehen der BPjS im Falle von Counter-Strike zeigte, dass es durchaus notwendig ist, die Frage der Wirkungszusammenhänge zwischen „virtueller“ Gewalt und „realer“ Gewalt näher zu beleuchten, da, ein generelles Verbot solcher Spiele nicht zwangsläufig dazu führt, „Amoktaten“ zu verhindern. Ein solchermaßen konstituierter Zusammenhang zwischen Spielen und anschließendem, eventuell zeitversetztem Handeln, müsste signifikant mehr Gewalttaten von Computerspielern hervorrufen - allein angesichts der Größe der Gruppe von Computerspielern. Auch bleibt unklar ob Computerspiele von potentiellen Amoktätern genutzt werden um hierin mögliche Taten zu visualisieren, daher von der Fantasie auf den Bildschirm zu transferieren, oder ob die Spiele erst potentielle Möglichkeiten und Anreize für Amoktaten liefern, wie gerne behauptet wird. Die BPjS entschied sich jedenfalls für eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Spiel „Counter-Strike“ und erfüllte durch die Einladung der beiden Spieler die Forderung von Werner Sacher (siehe Zitat 80) nach verstärkter Nutzungsforschung. Wenn auch nur im Rahmen der Auseinandersetzung mit Counter-Strike. Es wird sich zeigen, ob die regelmäßige Einladung von Spielern eine Praxis in der Bearbeitung von Indizierungsanträgen von Computerspielen wird.
Ungeachtet der abweichenden Verfahrensweise der BPjS zeigt die Diskussion um Counter-Strike, dass es auch weiterhin nicht notwendig zu sein scheint, der Frage nach dem, was eigentlich mit den Begriffen „Virtuelle Welt“ und „Realität“ gemeint ist, nachzugehen. Die „Virtuelle Welt“ wird einheitlich als die Welt der Computerspiele beschrieben, ohne näher zu bezeichnen, welche Besonderheiten diese womöglich aufweist und die „Realität“ bleibt als Begriff, der nur intuitiv und individuell sehr verschieden das Gemeinte erfasst, bestehen. Um aber Auswirkungen zwischen Computerspielen und Rezipienten im Sinne möglicher Gewalthandlungen zu prüfen, ist es notwendig die beiden Begriffe zu spezifizieren. Im Hinblick auf anzunehmende Transferleistungen bedarf es auch einer näheren Auseinandersetzung mit dem Bereich der Fantasie.
4. 2. Konstruktion von Wirklichkeiten
Wie können wir zwischen „Realität“, Fantasie und „Virtualität“ unterscheiden? Im alltäglichen Leben gehen wir davon aus, dass wir uns in der „Realität“ bewegen; jeglicher Erfahrungsaustausch beruht auf Prämissen, die wir beim Gegenüber annehmen, so dass nicht geklärt zu werden braucht, wenn wir z.B. über einen Traum berichteten, was die Kennzeichen eines Traums sind, oder es notwendig wird zu betonen, dass ein Traum kein „reales“ Ereignis ist. Unsere Berichte sind subjektive Konstrukte von Erlebnissen, denen verschiedene Elemente beigemischt werden. Wenn wir über etwas berichten, dann berichten wir dies immer aus unserer Perspektive heraus, so dass sich Berichte zweier Subjekte über gleiche Erlebnisse immer auch ein Stück weit unterscheiden. Das Berichte über erlebte Ereignisse unterschiedlich ausfallen liegt daran, dass das was wir als „real“ empfinden eine subjektive Konstruktion ist. Gleichermaßen gilt dies auch für den Bereich von Wirklichkeiten: sie sind nicht objektiv, sondern individuell konstruiert, wenn auch eingeschränkt, da die Folgen z.B. eines Autounfalls auch objektiv feststellbare Knochenbrüche beinhalten können. In welcher Form findet dies statt? „Der Konstruktionsprozess läuft über die Wahrnehmung eines Menschen. Im Prozess der Wahrnehmung werden die von den Sinnesorganen gelieferten Sinneseindrücke in Nervenimpulse übersetzt“[116]. Das heißt: Die Sinneseindrücke, welche im Gehirn entstehen, sind verarbeitete Empfindungen der Sinnesorgane. Diese Eindrücke werden vom Gehirn nach eigenentwickelten Kriterien bewertet und gedeutet. Die Folge besteht nun darin, dass unsere, aus sinnlicher Wahrnehmung erschlossene Welt eine Konstruktionsleistung unseres Gehirns ist und es somit „eigentlich“ keine wirkliche/objektive Realität gibt. Realität erscheint uns als solche, „weil das Gehirn seine „Elemente“ zu „unserer“ Realität zusammengefügt hat [und] wir gelernt haben, diese Konstrukte, in Übereinstimmung mit anderen Menschen, als „wahr“ zu nehmen“[117]. In Bezug auf die Begriffe „reale Welt“ oder „Realität“ bedeutet dies:
„Wenn Menschen von „realer Welt“ oder „Realität“ sprechen […], dann meinen sie eine Wahrnehmung, die sie der Außenwelt zuordnen und der sie den Status der „Realität“, also des tatsächlich Existierenden und sich Ereignenden außerhalb von sich selbst zuordnen“[118].
Es gibt verschiedene Kriterien für eine Zuordnung von Wahrnehmungen, welche helfen das was allgemein mit dem Begriff „Realität“ gekennzeichnet wird zu spezifizieren.
4. 2. 1. Die reale Welt
Stadler und Kruse (siehe: Über Wirklichkeitskriterien, in: Riegas, Volker/ Christian Vetter, Zur Biologie der Kognition. Frankfurt am Main 1990, S. 133) unterscheiden drei Kriterienklassen, nach denen das menschliche Gehirn entscheidet ob ein Wahrnehmungseindruck der „realen“ Welt zuzuordnen ist oder nicht.
Syntaktische Wirklichkeitskriterien: Wenn Sinneseindrücke, etwa Helligkeit, Farbe, Kontrast, besonders stark wahrgenommen werden, führen diese Eindrücke dazu, das Objekt als „real“ einzustufen. Entscheidend ist die Intensität der Eindrücke, also scharfe Konturen und Kontraste, hohe Helligkeit, strukturelle Vielfalt und Dreidimensionalität. Im Zusammenspiel mit anderen Sinnesempfindungen, Hören, Riechen, Sehen…, entsteht der Eindruck von „Realität“.
Semantische Wirklichkeitskriterien: Objekten, denen eine Bedeutung zugeordnet werden kann erscheinen eher als „real“. So erscheint z. B. ein Flugzeug leichter als ein „reales“ Objekt, als ein Ufo.
Pragmatische Wirklichkeitskriterien: Wenn Objekte in Ursachen- Wirkungszusammenhänge einbezogen werden können, entsteht leicht der Eindruck von „Realität“. Wichtig ist dabei, dass die Objekte spürbar auf Handlungen reagieren, etwa durch ihre Struktur oder Gewicht. Weiterhin von Bedeutung ist die Interaktion zwischen Menschen, die gleiche Erfahrungen mit dem Objekt gemacht haben. Also ein Wahrnehmungsaustausch zur gegenseitigen Absicherung der Eindrücke.
Wie unterscheidet sich die reale Welt von der „virtuellen“ Welt?
4. 2. 2. Die „virtuelle“ Welt
Mit „virtueller“ Welt sind in dieser Arbeit die „Erlebnisräume“ von Computerspielen gemeint, also die von den Programmierern geschaffene Welt, welche durch die Rezipienten beeinflusst werden kann. In ihrer Grundkonstruktion ähnelt die virtuelle Welt der realen, wenn auch verschiedene Möglichkeiten innerhalb der virtuellen Welt bestehen, welche in der realen nicht möglich wären; so kann man beispielsweise die Spielfigur in Zeitlupe bewegen oder die Gesetze der Physik, ohne Hilfsmittel, außer Kraft setzen. „ Die Konstruktionen der „realen“ Welt können als verbindlich und folgenreich angesehen werden, wohingegen die Konstruktionen der Spielwelt flüchtig und unverbindlich sind. […] Hierbei kann die „reale“ Welt in gewisser Weise imitiert werden, der Spielende kann sich aber auch parodierend über sie hinwegsetzen“[119]. Daneben gibt es noch zwei Hauptunterschiede zwischen realer und virtueller Welt: 1. Der Spieler kann die „virtuelle“ Welt jederzeit durch Ausschalten des Computers verlassen und 2. Handlungen in der virtuellen Welt sind begrenzt (siehe 1.2.1). Weiterhin kann der Spieler nach seinem Bildschirmtod seine Figur per Tastendruck wieder in die virtuelle Welt zurückholen. Die virtuelle Welt bietet somit zum einen Handlungsmöglichkeiten, wie sie in der Realität nicht realisierbar sind (siehe 1.3.) und zum anderen einen gewissen Grad an experimentellen Freiheiten, welche ohne unmittelbare Konsequenzen für den eigenen Körper ausprobiert werden können.
Die virtuelle Welt weist in Bezug auf ihre Handlungsmöglichkeiten eine starke Ähnlichkeitsbeziehung zur Welt der Fantasie auf.
4. 2. 3. Die Welt der Fantasie
„Wenn Menschen sich geistig etwas vorstellen, das nicht zur aktuellen Wahrnehmung gehört, befinden sie sich in der mentalen Welt“[120].
Die mentale Welt betritt der Mensch, ebenso wie die virtuelle Welt, in dem vollen Bewusstsein und Wollen, sich jetzt in die jeweilige Welt zu begeben. Die Realität kann nicht bewusst betreten werden, da sie per se schon immer vorhanden ist; man kann versuchen sie zu hinterfragen, oder auch zu verlassen (Tod), jedoch nie in der Form und Gewissheit mit der man die virtuelle Welt oder mentale Welt betreten, verlassen oder manipulieren kann.
Auch in der mentalen Welt existieren Handlungsfreiräume, welche außerhalb der Erfordernisse der Realität liegen. Im Gegensatz zur virtuellen Welt können wir in der mentalen Welt, aufgrund dieser Freiräume, unsere Welt eigenverantwortlich gestalteten. Genauer: Die mentale Welt kann nach eigenen Vorstellungen nach Wunsch konzipiert, weiterentwickelt oder modifiziert werden. Grenzen in Form einer möglichen „Zensur“ gibt es nur, wenn sie selbst bestimmt werden. „Die Tagphantasie startet wie der Nachttraum mit Wünschen, aber führt sie radikal zu Ende, will an den Erfüllungsort“[121]. In der mentalen Welt kann man sich verlieren oder „von den weitesten Ausschweifungen sogleich zurückkommen und [an] anderer Stelle an dieser Welt weiterweben“[122]. Weiterhin ist die von jedem einzelnen entworfene mentale Welt kommunizierbar, sie kann anderen Menschen aufgrund ihrer Wunschorientierung und Offenheit verständlich gemacht werden. „Ja, sie können zum Impuls werden, diese Welt in einem Spiel mit Leben zu füllen. Insofern schafft die mentale Welt wirkungsvolle Übergangzonen zur Spielwelt: zu Rollenspielen, zu Phantasiereisen, zu Strategiespielen“[123]. Und eben auch zu Computerspielen.
Ich möchte zunächst auf die vielfach postulierte „Verwischung“ zwischen Realität und Virtualität eingehen, bevor ich auf mögliche, und, dies sei vorweggenommen, sehr viel wahrscheinlichere Transfers zwischen Fantasie und virtueller Welt eingehe.
4. 3. Transfer zwischen virtueller Welt und realer Welt
Der Begriff „Transfer“ bezeichnet die Übertragung von gelernten Verhaltensweisen, welche sich in früheren Situationen bewert haben, auf andere Situationen und Aufgaben. Dabei geschieht die Übertragung des Gelernten, aus einem situativen Kontext in einen anderen, nicht ohne einen Transformationsprozess. Das heißt: Während der Übertragung können verschiedene Anpassungen vorgenommen werden, damit der Transfer in einen neuen situativen Kontext reibungsloser vonstatten geht. Der Begriff beinhaltet somit neben der Komponente des Bewegungsablaufs, von einem situativen Kontext in einen anderen, auch immer einen Transformationsprozess. Dabei geschehen Transferprozesse nicht einfach so, sondern immer auf der Grundlage der Lebenswelt eines Menschen und damit auch immer innerhalb eines Rahmens. Die Lebenswelt des Menschen bildet den Rahmen, innerhalb dessen die Handlungen und Wahrnehmungen geordnet werden. „Sie [die eigene Lebenswelt] bildet kein umfassendes Ganzes, sondern gliedert sich in sich in ein Netz von Welten, die nicht für sich existieren, sondern wechselseitig aufeinander bezogen sind. Neben der realen Welt existieren für Menschen die Traumwelt, die mentale Welt, die Spielwelt, die mediale Welt und schließlich die virtuelle Welt. Diese verschiedenen Welten bezeichnen „Orte“, in denen spezifische Umgehensweisen mit den Reizeindrücken stattfinden.
Die Welten sind Ergebnis sozialer Vereinbarungen, wie im menschlichen Gehirn die Reizeindrücke zuzuordnen sind: Was zur jeweiligen Welt gehört, wie es zu verstehen ist, woran man erkennt, daß man sich in der Welt aufhält und das man sie wieder verlässt“ [vgl. 4.2.][124].
Hierbei wird zwischen intra- und intermondialen Transfers unterschieden.
Intramondialer Transfer: Um bestimmte Situationen mit Erfolg zu bewältigen, lernen Menschen Schemata zu entwickeln, die erfolgreiches Handeln ermöglichen. Führt ein Handeln in einer Situation zum Erfolg, werden die Schemata verstärkt, wenn ähnliche Situationen auftreten. Das gleiche passiert, wenn Menschen mit ähnlichen Reizeindrücken konfrontiert werden: sie werden gemäß eines ausgebildeten Schemas wahrgenommen und es wird danach gehandelt, solange bis sich kein Erfolg mehr einstellt - dann müssen die Schemata modifiziert werden. Die Übertragung von Schemata innerhalb einer Welt wird als „intramondialer Transfer“ bezeichnet. „Mit zunehmender Erfahrung entwickelt sich der Bestand an Schemata und der Grad ihrer Differenziertheit, so daß der Mensch in der Lage ist, viele unterschiedliche Situationen sowohl angemessen wahrzunehmen als auch wirkungsvoll zu handeln“[125].
Ein „intermondialer Transfer“ liegt dann vor, wenn Schemata, die für eine bestimmte Welt Gültigkeit und Bedeutung haben, auf eine andere Welt übertragen werden.
„Was für den intramondialen Transfer gilt, hat eine entscheidende Bedeutung auch für Übertragungsprozesse im intermondialen Bereich: Um transferieren zu können, muß transformiert werden- und zwar in Schemata, die von den konkreten Einzelfällen und ihren Besonderheiten abstrahieren und dafür Strukturen bereitstellen, die Ähnlichkeitserlebnisse zulassen“[126]. Derartige Transformationen ermöglichen erst Transfers zwischen den Welten, weil die in einer Welt erlangten Reizeindrücke erst dadurch eine Bedeutung für andere Welten erlangen können.
Intermondialer Transfer: Nach Fritz (Zwischen Transfer und Transformation, in: Handbuch Medien: Computerspiele) lassen sich fünf Ebenen unterscheiden, die in Bezug auf mögliche Transferprozesse von einer Welt in eine andere von Bedeutung sind: Die Fact- Ebene, die Skript- Ebene, die Print- Ebene, die metaphorische Ebene und die dynamische Ebene. Für diese Untersuchung sind im speziellen die Skript- Ebene und die Print- Ebene wichtig.
Skript- Ebene: Mit den Begriff „Skripts“ bezeichnet man Schemata, die für bestimmte Ereignisabläufe gelten, in denen Verhaltensweisen in vertrauten Situationen schematisch (modellhaft, mit einer ungefähren Gewissheit) vorgegeben sind. Wie ein Skript aussehen kann zeigt das Beispiel eines Restaurant- Skripts. „Das Verhalten der Menschen in dieser Situation folgt bestimmten Regeln, Erwartungen und Standards, so daß der Rahmen vorhergesagt werden kann, in dem sich das konkrete Verhalten realisiert. In der Regel verhalten sich die Beteiligten im Rahmen dieses Skripts und durchbrechen es nicht“[127]. Nach mehreren Restaurantbesuchen haben Menschen dann dieses Skript gelernt, und können es auf ähnliche Situationen transferieren, etwa den Besuch eines Restaurants in Amerika, statt in Deutschland.
Durch das Erlernen von Skripts wird es möglich, den verschiedenen Handlungsanforderungen der Lebenswelt „einigermaßen“ gerecht zu werden. „Das Konzept der Skripts erklärt viel besser als alle anderen theoretischen Ansätze, warum Kinder sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Spiels relativ früh Handlungsketten richtig durchführen. Ihr Wissen, vor allem das der sozialen Konventionen, wird in Skripts organisiert. Man denke nur daran, wie frühzeitig Kinder das Begrüßen und Verabschieden gelehrt wird, wie bald sie die Essensregeln und den gesamten Ablauf der Tischzeit kennenlernen“[128]. Somit sind auch Kinder in der Lage die in einem Skript zusammengefassten Handlungsketten auf ähnliche Situationen anzuwenden und gegebenenfalls zu modifizieren. Für Computerspiele bedeutet dies nun, dass Kinder wissen, wann sie sich in der realen Welt befinden und wann in der virtuellen Welt, da sie mit der „Skriptfähigkeit“ auch eine „Rahmungskompetenz“ erlangen.
Bei der Analyse von intermondialen Transferprozessen müssen, besonders in Hinblick auf mediale und virtuelle Welten, zwei Seiten Berücksichtigung finden: 1. Skriptangebote, die von der medialen und virtuellen Welt ausgehen und 2. die Skriptinteressen der Subjektseite.
1. Skriptangebote umfassen nicht nur verschiedene Handlungsfolgen und Handlungsmuster, sondern auch verschiedene „Stile“ oder spezielle Requisiten, welche in einen Erlebniszusammenhang integriert und multimedial umgesetzt werden. Somit beziehen sich Skripts nicht nur direkt auf Handlungsanforderungen der Umwelt, sondern sind auch ein Angebot zur äußerlichen Gestaltung von Identitätswünschen.
2. „Das „Skriptinteresse“ auf der Subjektseite ist darauf gerichtet „Drehbücher“ für Prozesse der selbstgesteuerten Sozialisation zu erlangen. Diese „Drehbücher“ gewinnen in den Aneignungsprozessen der Gleichaltrigen spezifische Konturen. Sie sind nichts Endgültiges, sondern als Skripts „Kristallisationen alters- und generationsspezifischer Interessen, Vorlieben, Deutungs- und Aktivitätsmuster. Sie sind geschlechts- und gruppenspezifisch differenziert“[129]. Es werden also Handlungsmuster aus den Skriptangeboten entnommen, die einem „weiterhelfen“ eigene Skripts zu modifizieren. Skriptangebote bieten somit nötige Impulse zur Modifizierung eigener Skripts.
Das in der virtuellen Welt enthaltene Skriptangebot bietet wenige Impulse zur Modifizierung der eigenen Skripts an, die in der realen Welt hilfreich sein könnten. Die virtuellen Skripts sind eher geeignet die Wunsch- und Fantasiewelt zu stimulieren.
Print- Ebene: „Löst sich das Schema von dem konkreten inhaltlichen und sozialen Bezug und orientiert sich nur mehr an den Funktionen eines einfachen Handlungsmusters, befinden wir uns auf der Print- Ebene “[130]. Bei Ego-Shootern besteht der Print in der Handlungserfordernis „alles abzuschießen was sich bewegt“ - ausgenommen eigene Gefährten und falls vorhanden Zivilisten. Ein Transfer „virtueller Prints“ in die reale Welt ist auch bei Kindern sehr unwahrscheinlich, weil sie „sehr rasch und sehr früh die für sie wichtigen Prints (erlernen): „Auf einen Stuhl klettern“, „einen Gegenstand wegschieben“ […], und sie lernen es auch, diese Prints in andere Kontexte zu transferieren und in Skripts zu integrieren“[131].
Transfer von Prints in die mentale Welt: „So wird nach Abschießspielen vom Impuls berichtet, Passanten oder Tiere, denen man in der realen Welt begegnet, „abzuschießen“. Mit anderen Worten: Der Spieler löst in der Realität den Handlungsimpuls nicht real aus, sondern führt ihn, bezogen auf die unmittelbar vorhandenen Objekte in der realen Welt, lediglich in Gedanken (oder spielerisch imitativ) aus“[132].
„Unter diesem Gesichtspunkt könnten gewaltorientierte Spiele dann problematisch werden, wenn sie sich in ihrem grafischen Erscheinungsbild immer stärker den Reizen (und Sehperspektiven) angleichen, die man normalerweise als zugehörig zur realen Welt „rahmt“. Dies Bedenken gilt insbesondere dann, wenn die Spieler über eine unzureichende „Rahmungskompetenz“ verfügen, also Schwierigkeiten haben, Transferprozesse zu kontrollieren und die Reizeindrücke den jeweiligen Welten angemessen zuzuordnen“[133].
Kommt es somit bei gewalthaltigen Computerspielen zu einem intermondialen Transfer? Unter Berücksichtigung der erörterten Transferprozesse lautete die Antwort: Nein, solange unterstellt wird, dass virtuelle Handlungsweisen ungeprüft transferiert werden. Eine ungeprüfte Übernahme würde sich „Schemata [bedienen], die „eigentlich“ nicht passen können. Der strukturellen Koppelung droht ein Fiasko. Man denke nur an einen Autofahrer, der im realen Auto am Straßenverkehr teilnimmt und die Verkehrssituation mit assimiliert, die aus dem Computerspiel stammen“[134]. Hier könnte eingewendet werden, dass gewaltorientierte Computerspiele dann problematisch werden, wenn die Rahmungskompetenz der Rezipienten unzureichend ist und es dann eben doch möglicherweise zu einem intermondialen Transfer kommt, wie ja bereits das Zitat anklingen lässt.
4. 3. 1. Rahmungskompetenz
Rahmungskompetenz bedeutet, dass der Mensch eine Situation, Reizkonfiguration den „richtigen“ Wirklichkeiten zuordnen kann, um anschließend auf die jeweils angemessenen Handlungs- Schemata zurückgreifen zu können. Gegen eine Schwächung der Rahmungskompetenz bei Computerspielern sprechen die Aussagen von Spielern in den mir zugänglichen Untersuchungen. So stellt Fritz fest: „In allen unseren Befragungen bestand ein Großteil der Personen explizit auf einer strikten Trennung zwischen „ virtueller Welt“ und „ realer Welt“. Es bleibt die Frage, ob diese Trennung wirklich so gut gelingt und ob nicht (vielleicht auch unbemerkt) spezifische Elemente von der einen in die andere Welt wandern“[135]. Die Rezipienten fordern für sich klar zwischen Realität und Virtualität unterscheiden zu können und damit auch über eine ausreichende Rahmungskompetenz zu verfügen. Das solchen Antworten kritisch betrachtet werden, ist einerseits notwendig, anderseits stellt sich die Frage, inwiefern Aussagen von Interviewpartnern ernst genommen werden, auch wenn sie nicht den erwünschten entsprechen. Antworten die der eigenen Fragestellung helfen werden leider nicht immer so kritisch hinterfragt. Ebenfalls gegen eine Verwischung der Realitäten spricht die Tatsache, „ dass der Nutzer sich bewusst ist, gerade ein Computerspiel [zu] spielen, hat er es doch zuvor selbst gestartet“[136].
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Verwischung zwischen virtueller und realer Welt, und damit ein intermondialer Transfer, aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse nicht zu erwarten ist. Dadurch ist es auch eher unwahrscheinlich dass ein Rezipient aufgrund von Computerspielen anfängt seine Mitmenschen zu töten.
Computerspiele bieten eher, so scheint es, die Möglichkeit eigene Fantasien oder Wünsche Auszuleben.
4. 4. Fantasie und Wunscherfüllung
Im Unterpunkt 4.2.3 wurden Aspekte genannt, die vermuten lassen, dass es einige Überschneidungen zwischen virtueller und mentaler Welt gibt. Unter Berücksichtigung der Überlegungen im ersten Kapitel bezüglich der Wesensmerkmale und Faszination von Computerspielen und unter der Annahme, dass die zentralen Themenbereiche im Leben eines Jugendlichen, die der Identitätsfindung, der Auseinandersetzung mit Autoritäten und der Ausbildung einer eigenen Sexualität sind, kann angenommen werden, dass Computerspiele in vielfacher Hinsicht die Möglichkeit bieten bewusste Bedürfnisse zu befriedigen. Dadurch erfüllen Computerspiele „Wünsche nach Selbstbestätigung und Anerkennung, lassen Erfahrungen zu, die das reale Leben nicht mehr bieten kann (Mangelsituation bzw. Ersatzbefriedigung), machen die Jugend unabhängig von der Kontrolle der Erwachsenenwelt und eröffnen – da Bestandteil der Jugendkultur – den Zugang zu dieser. Der Drang nach Entfaltung und Freiheit und die Abhebung von Masse können befriedigt, Omnipotenzgefühle und Entdeckerwünsche ausgelebt werden“[137]. Es handelt sich hierbei zwar um Wünsche, die aus realen Situationen heraus entstehen, also aus Erfahrungen der eigenen Lebenswelt, welche Handlungsbedingungen an die Individuen stellt und dadurch Handlungsalternativen erschwert, die aber in der Fantasie eine Brechung erleben und im Computerspiel manifestiert werden können. Als Manifestation der im Zitat deutlich gekennzeichneten Erfüllungen von Wünschen, wenngleich auch der Rahmen bzw. Gestaltungsrahmen für dieses Erfüllen von Wünschen im Computerspiel endlich ist. Das heißt: Die Fantasie kennt keine Grenzen, das Computerspiel gibt einen Rahmen vor, den man bis zu einem gewissen Grad „dehnen“ kann. Man kann sich anders Verhalten, als vom Spiel vorgesehen, z.B. Gegenstände verschieben um an Bereiche zu kommen, die vom Spielablauf her nicht vorgesehen sind oder eben Gegenstände anderweitig zu verwenden, als vorgesehen, nur bleibt die Spielwelt immer die gleiche, wie auch die möglichen Bewegungsabläufe der eigenen Spielfigur, sowie die Perspektive des Betrachters. Auch die vom Computer gesteuerten Figuren verhalten sich immer gleich und Skript- Sequenzen werden ebenfalls immer an der gleichen Stelle ausgelöst. Ein Beispiel für das Zweckentwenden von Gegenständen sind die sogenannten Speed Run- Videos in denen versucht wird ein Spiel in Rekordzeit zu bewältigen. Im Internet gibt es eine Reihe solcher Videos, die zeigen, dass ein Computerspiel, welches eigentlich viele Stunden Beschäftigung verspricht auch in einigen Minuten bewältigt werden kann, wenn man die Grenzen des Spiels auslotet. Darüber hinaus lassen sich Computerspiele gezielt einsetzen, um Ideen bzw. mentale Wünsche zu artikulieren. Erreichen lässt sich dies aufgrund der Möglichkeit mit Hilfe von Construction- Kits, Programme die es ermöglichen ein bestehendes Grundgerüst eines Computerspiels zu verändern, eigene Spiele, Welten zu entwerfen. Dabei wird unterschieden zwischen einer einfachen Erweiterung z.B. eigenen Karten für Counter-Strike zu entwerfen oder sogenannten Total- Conversions, welche mit dem Computerspiel, dessen Grundgerüst verwendet wird, nicht mehr viel gemeinsam haben. Das bekannteste Beispiel für eine Total- Conversion ist Counter-Strike, welches auf der Grundlage des Computerspiels Half Life (Single Player Ego- Shooter) entstanden ist. Construction- Kits ermöglichen Spielern durch ihre relativ einfache Handhabung die Verwirklichung eigener Ideen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Filmen, die auf der Basis eines Computerspiels erstellt wurden, ohne auf Construction- Kits zurückgreifen zu müssen. Die Filme, es handelt sich hierbei in der Tat um Produkte, die alle Kennzeichen von Kurz- oder Spielfilmen aufweisen, verändern an der grundlegenden visuellen Gestaltung eines Computerspiels nicht sehr viel - zum Teil werden z.B. Schwarz- Weiß Filter verwendet, aber Figurenmodelle und Landschaftsgrafik bleiben meist erhalten, sie können aber als Belege angesehen werden, dass es über das reine Spielen hinaus verschiedene Möglichkeiten der Artikulation von mentalen Wünschen gibt. Ein Aspekt der in der Auseinandersetzung mit Computerspielen häufig verloren geht, da kreative Möglichkeiten nicht mit der allgemeinen Vorstellung von Computerspielen konvergieren, auch wenn sie zweifellos vorhanden sind. Eines der bekanntesten Film- Beispiele ist der Film „Mine“ welcher auf der Grundlage von Battlefield 2 entstanden ist und verschiedene Kurzfilme enthält, so werden z.B. Monty Python Sketche nachgestellt.
Computerspiele können aber auch als Grundlage dienen sich in anderer Form mit dem eigenen Spielen und mit den, mit dem Spielen verbundenen „Klischees“ auseinanderzusetzen. Auf der Seite: http://bender.vault-tech.de gibt es eine Reihe von Comics, die sich auf Counter-Strike beziehen und in denen der Zeichner sich parodierend mit den Klischees von Computerspielern auseinandersetzt, sowie gleichfalls mit dem Spiel und dessen Spielern an sich.
Die genannten Beispiele können als Indizien dafür angesehen werden, dass Transfers zwischen Fantasie und virtueller Welt, aufgrund ihrer Verknüpfungspunkte, eher angenommen werden können, als Transfers zwischen Realität und virtueller Welt.
Die Unwahrscheinlichkeit einer Übernahme virtueller Handlungen in die Realität, und damit auch möglicher gewalttätiger Handlung, zeigt sich nochmals deutlich, wenn über die Wahrnehmung von Gewalt in Computerspielen reflektiert wird.
4. 5. Wahrnehmung von Gewalt in Computerspielen
Gewalt (wie unter 1.3. definiert) in Computerspielen unterscheidet sich von realer Gewalt dadurch, dass sie keinen außerhalb des Spiels liegenden Zweck verfolgt und keine realen Schäden erzeugen kann. Weiterhin ist sie praktisch immer sauber. Damit ist gemeint, dass virtuelle Gewalt keine tiefergehenden psychologischen Konflikte erzeugt. Jedoch wird virtuelle Gewalt in Spielen eindeutig als Gewalt wiedererkannt. Dass Gewalt in Spielen als solche wiedererkannt wird liegt an den, im vorigen Kapitel untersuchten Konstruktionszusammenhängen. Demnach erkennt das menschliche Gehirn aufgrund der optischen Ähnlichkeiten die äußerliche Gewalt in Spielen, reale Gewalt in andern Medien, sowie Gewalt in der Realität. Ungeachtet der Ähnlichkeiten gibt es deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung von realer Gewalt und virtueller Gewalt.
Anhand von Studien lässt sich feststellen, dass die Wahrnehmung von Spielgewalt, im Gegensatz zu anderen Medien, und realer Gewalt, völlig „moralfrei“ erfolgt. Sie wird vielmehr als ästhetisch und affektiv empfunden. „ Die Spiele werden nicht moralisch bewertet und überdacht, sie sollen lediglich gut aussehen und Spaß machen“[138]. Weitere Bestätigungen lassen sich zum Beispiel bei Heike Esser/ Tanja Witting (Transferprozesse beim Computerspiel) oder Daniel Hoffmann/ Volker Wagner (Erwachsene beim Computerspiel) finden.
Eine moralische Bewertung von Gewalt in Computerspielen würde auch dem funktionalistischen Prinzip der Spiele zuwiderlaufen. In Computerspielen ist die Gewalt eingebetet in einen mechanischen- regelhaften Kontext und ein moralisches „Innehalten“ während des Spiels würde ein Weiterkommen blockieren.
Ebenfalls einer moralfreien „Einstellung“ beim Computerspiel entgegen steht die Tatsache, dass die technische und stilistische Umsetzung von Gewalt bis ins groteske, comichafte überzeichnet wird. Zur Verdeutlichung einige Zitate von Rezipienten:
„ Es sieht lustig aus, wenn du sie am Nacken packst und ihnen den Kopf abreißt, und dann das Rückgrat baumeln siehst“.
„ Wenn du einmal auf einen Menschen schießt, wird er wahrscheinlich sterben, aber in Doom musst du ihn etwa 12 Mal erschießen.“
„ Ich habe Mortal Kombat gespielt. Weißt du, es ist brutal, aber es ist irgendwie lustig…- die Art und Weise, wie sie ihre Köpfe abhacken. Du lachst einfach, weil es so verrückt und lustig ist… du weißt, das passiert nicht wirklich“[139].
Die Wahrnehmung von Gewalt erfolgt somit völlig moralfrei, wie etwa bei der Betrachtung von Itchy & Scratchy (Die Simpsons).
Wenn, wie versucht wurde zu zeigen, die Gewalt ästhetisch, belustigend und letztendlich moralfrei empfunden wird, können sich dann überhaupt empathische Fähigkeiten „zurückbilden“?
4. 6. Empathie
Wie bereits betont wurde ist ein intermondialer Transfer zwischen Virtualität und Realität unwahrscheinlich. Eine weitere Frage im Zusammenhang mit gewalttätigen Computerspielen bleibt davon aber unberührt: Hemmen gewalttätige Computerspiele das empathische Empfinden? Werden die Rezipienten solcher Spiele gleichgültig gegenüber realer Gewalt?
Kritiker werfen Entwicklern von Computerspielen vor, dass ihre Spiele durch die kurze, schmerzlose und folgenlose Darstellung von Gewalt dazu beitragen, die Spieler zu verrohen. Deshalb gehöre diese Sorte von Spielen verboten. Die Annahme lautet: Durch die verzerrte Darstellung der Realität findet eine Gewöhnung an Gewalt statt, die lehrt, dass Gewalt folgenlos ist und töten nicht weh tut. Diese Erkenntnisse werden sodann von den Spielern auf die reale Welt zurückprojiziert. Anders formuliert: Die Rezipienten stumpfen ab, ihr empathisches Empfinden kann sich nicht entwickeln.
Unter Empathie versteht man eine angeborene und durch spätere Erziehung weiterentwickelte Emotion, die ein Betrachter mit einem (zumindest gedanklich) vorhandenen anderen Betrachter teilt. Dabei spielt die Fähigkeit sich in die Gefühle des anderen hineinzuversetzen, sich emotional auf diesen einzustellen und somit die Emotionen des anderen selbst zu empfinden, eine zentrale Rolle. Ohne die Fähigkeit des Hineinversetzens in Dritte kann es keine Identifikation mit realen oder fiktionalen Personen/Figuren geben. Kurz: Empathie ist die Fähigkeit des Mitleidens. Im Gegensatz zu den bisherigen Überlegungen liegt der Fokus der Untersuchungen über Empathie und Computerspiele nicht darin, zu zeigen, ob gewalthaltige Computerspiele direkt zu Gewalthandlungen animieren, sondern darin zu prüfen, ob vorgelagerte Effekt (Gewöhnung an Gewaltdarstellungen) möglicherweise dazu führen, reale und virtuelle Gewalt gleichermaßen wahrzunehmen und realen Gewaltsituationen gleichgültig gegenüber zu stehen, oder eben Gewalt gleichgültig selbst einzusetzen, da man gelernt hat, dass Gewalt „folgenlos“ ist, sowohl für die eigene Person, als auch für Andere. Denn: „Nur wenn wir diese [Menschen, denen Gewalt angetan wird] – auch emotional – kennen, können wir etwas dagegen tun. Andererseits besteht die Gefahr, dass wir abstumpfen, wenn gezeigt wird, wie jeden Tag Tausende von Menschen durch Unfälle, Katastrophen, Verbrechen oder Kriege qualvoll sterben oder leiden müssen“[140].
Wie eine Studie über Empathie und Computerspiele aussehen kann soll exemplarisch anhand der Studie von Rita Steckel (Aggression in Videospielen: Gibt es Auswirkungen auf das Verhalten von Kindern?) gezeigt werden. Die Ausgangsfrage der Studie lautet: Nimmt die physische Gewalttätigkeit von Kindern zu?
Ausgehend von der Befragungsstudie von Schwind* an der 1000 Schüler, 208 Lehrer und 111 Schulleiter teilnahmen, und die ergab, dass in den letzten 5 Jahren, die körperlichen Auseinandersetzungen an den Schulen gestiegen sind, wobei diese Einschätzung 50% der Schulleiter und 75% der Lehrer zu Protokoll gaben und 72, 3% der Schüler„Freude an der Gewalt“ als Ursache für die häufigeren körperlichen Auseinandersetzungen angaben, kommt Steckel zu der Ansicht, dass physische Gewalthandlungen aller Wahrscheinlichkeit nach in den letzen Jahren zugenommen haben. „Angesichts solcher, auch durch empirische Daten belegten Tatsachen wird deutlich, daß es sich hier um eine ernstzunehmende und beängstigende Entwicklung handelt, und die Frage nach den Ursachen stellt sich immer dringlicher“[141]. Seit den 60er Jahren und damit den Beginn der Fernsehwirkungsforschung werden Gewaltdarstellungen in den Medien auch daraufhin untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Darstellung physischer Gewalt und „[der] zunehmenden Brutalisierung der Kinder“[105] gibt. Die beiden Haupteffekte der Medienwirkung sind z. B. nach Parke und Slaby (Parke, R/Slaby, R. G. The development of aggression: In P. H. Mussen Handbook of Child Psychology, Vol. IV: Socialization, personality and social development. New York, 1983):1. Der Anstieg von Aggression als Folge des passiven Konsums von Gewalt. 2. Die dadurch herabgesetzte Sensibilität gegenüber realer Gewalt.
Das Aufkommen von Computer- und Videospielen und deren Verbreitung ist nach Steckel ein inzwischen größeres Problem, wenn es um die hierin enthaltenen physischen Gewaltdarstellungen geht, als in den klassischen Medien. Der Grund liegt an der Interaktivität des Computerspiels: „Hier liegt nicht mehr nur passives Konsumieren von Gewalt vor, sondern durch aktives Eingreifen in das Geschehen am Bildschirm wird die Involviertheit des Spielers entscheidend erhöht“[142]. Und da gerade die Spielinhalte zum größten Teil gewaltorientiert sind, „es geht um das Überleben des Stärksten, Grausamsten, Brutalsten“ und Gefühle, wie Trauer oder Mitleid für die Opfer, keine Rolle spielen, kann angenommen werden, dass die Auswirkungen, welche nach Steckel für die klassischen Medien als fundiert betrachtet werden können (Anstieg von Aggression, Herabsetzung von Empathie), bei Spielern verstärkt hervortreten.
Rita Steckel versucht somit im Rahmen ihrer Studie die verhaltenswirksamen Mechanismen von virtueller Gewalt in Computer- und Videospielen aufzuzeigen und die aggressionsanregende Wirkung und die Beeinträchtigung des empathischen Empfindens nachzuweisen.
Ziel der Untersuchung: Nachweis kurzfristiger Effekte aggressionshaltiger Videospiele, mit möglichen langfristigen Folgen. Prüfung der kurzfristigen Effekte auf 2 Ebenen.
1. Der Umgang mit einem gewalthaltigen Videospiel bewirkt als unmittelbaren Effekt eine Aktivierung des Aggressionsmotivs.
2. Darüber hinaus führt der Umgang mit einem solchen Spiel zu einer Herabsetzung der emotionalen Sensitivität.
Rita Steckel untersuchte 167 Kinder zwischen 7 und 14 Jahren bezüglich ihrer Persönlichkeit. Die Kinder spielten einige Tage lang entweder 20 Minuten Joshi´s Cookie- Tetris- Clone oder Street Fighter 2 (Prügelspiel). Nach dem Spielen betrachteten die Kinder einen gemischten Satz aus emotional anregenden Bildern (Labormaus, misshandeltes Kind….) oder neutralen Bildern (Blumen, Landschaften, Meer…). Danach wurden verschiedene Reaktionen anhand einer Reihe von Faktoren (Mimik, Äußerungen, Anzahl und Betrachtungszeit der Bilder, physiologische Parameter) gemessen.
Ergebnisse: Eine unmittelbare Anregung des Motivsystems durch den Umgang mit Street Fighter 2 konnte nicht nachgewiesen werden. Einen wesentlichen Einfluss auf die durch das Spiel aktualisierte Motivation übte nach Steckel eine Ausprägung der Disposition aus, nach der gerade Kinder, die langfristige Erfahrungen mit gewalthaltigen Spielen hatten, eine höhere Motivierung aufwiesen. Hoch aggressive Kinder (durch ihre Sozialisation geprägte Kinder), wiesen unabhängig von den experimentellen Bedingungen eine höhere Motivierung auf, als niedrig aggressive Kinder. Die höchste Motivanregung zeigten hoch aggressive Kinder, die Erfahrungen mit Kampfspielen hatten.
„Während in den Phantasiegeschichten niedrig aggressive Kinder, die über keine oder nur wenig Erfahrung mit aggressionsorientierten Videospielen verfügten, eher selten körperliche Auseinandersetzungen thematisiert wurden, finden sich in den Geschichten hoch aggressiver Kinder mit hoher Gewaltspielerfahrung viele solcher Geschichtenelemente und dies wiederum unabhängig davon, ob sie zuvor mit dem Gewalt- oder dem Sportspiel konfrontiert worden waren“[143]. Bei hoch aggressiven Kindern mit Gewaltspielerfahrungen zeigt sich Steckel zufolge eine deutliche Verminderung der Aggressions-Hemmungs- Komponente, deren Folgen eine Veränderung des Normen und Wertesystems des Kindes ist, die die Akzeptanz und Kontrolle von Gewalt betrifft. „Die häufige Konfrontation mit Gewalt und Aggression im Spiel kann die Einstellung gegenüber Gewalt verändern und ihre Akzeptanz stärken. Die primären Hemmmechanismen können eine Abschwächung erfahren und im realen Leben werden immer stärker aggressive Mittel zur Konfliktlösung eingesetzt. Ein solches Verhalten mag dann zu weiterer Zurückweisung durch weniger aggressive Altersgenossen führen. Hier setzt dann ein zirkulärer Prozeß ein. Das zurückgewiesene und in der Schule frustrierte Kind wird sich vielleicht noch verstärkt dem Videospiel widmen, was dann eine weitere Abschwächung der Hemmechanismen für aggressives Verhalten nach sich zieht“[144].
Einschränkung: „Es kann nicht unbedingt davon ausgegangen werden, daß nur hoch aggressive Kinder sich verstärkt dem Bildschirmspiel zuwenden und nur bei diesen Kindern die negativen Effekte aggressionshaltiger Spiele greifen. Auch Kinder, deren Aggressionsmotiv nicht durch ungünstige Erfahrungen in der frühen Kindheit bereits relativ stark ausgeprägt ist und eine gewisse Stabilität aufweist, kommen mit diesen Spielen in Kontakt. Auch hier besteht die Gefahr, daß das noch im Aufbau befindliche Norm- und Wertesystem durch den Umgang mit Gewaltspielen eine Veränderung erfährt, die sich ebenfalls langfristig in einer veränderten Einstellung und Akzeptanz zeigen wird“[145].
„Wenn auch in der vorliegenden Untersuchung kein direkter Nachweis dafür erbracht werden konnte, daß aggressionsorientierte Videospiele bei allen, auch bei niedrig aggressiven Kindern, unmittelbare Effekte auf die Aggressionsmotivierung ausüben, so kann daraus nicht verallgemeinernd geschlossen werden, daß dies grundsätzlich nicht geschieht“[146].
Ein Anstieg der Aggressionsbereitschaft lässt sich demnach nur bei Kindern feststellen, die bereits durch ihre Sozialisationsbedingung häufigen Umgang mit Aggression und Gewalt haben und dadurch selbst „hoch aggressiv“ sind. Da es sich hierbei offensichtlich um einen Zirkel- Schluss handelt, muss dieses Ergebnis kritisch betrachtet werden. Eindeutigere Ergebnisse lieferten die Messungen zur Empathie.
Empathieverlust: In der Analyse der emotionalen Reaktion auf die Bilderserie zeigte sich eine unmittelbare Wirkung von gewalthaltigen Spielen auf die Kinder, welche niedriges empathisches Verhalten zeigten. „Kinder, die nach ihren eigenen Angaben über viel Erfahrung mit Gewaltspielen verfügten, und insbesondere auch die Kinder, die die Gewaltelemente im Kampfspiel besonders schätzten, zeigten eine geringere Ausprägung der dispositionellen Empathie. Ebenso wurde deutlich, daß Kinder, die von ihrer Disposition her als niedrig empathisch einzustufen sind, nach dem Kampfspiel beim Anschauen der Bilder wenig Anzeichen von Anspannung zeigten, während hoch empathische Kinder, die mit dem gleichen Spiel umgegangen waren, zwar auch keine Betroffenheit erkennen ließen, doch ein höheres Ausmaß an Anspannung aufwiesen“[147].
Kritisch muss dazu angemerkt werden, dass die empathische „Absenkung“ nur auf mediale Reize (Bilder) und nicht auf „reale“ Situationen erfolgte. Weiterhin ist die Gültigkeit der Ergebnisse nur in der Laborsituation gegeben, wodurch keine Rückschlüsse auf identische Wirkungen außerhalb des Labors gezogen werden können. Betrachtet man Computerspiele genauer stellt sich schnell heraus, dass Empathie vollkommen unangemessen ist. Zwischen den Rezipienten und Computercharakteren findet eine rein funktionale Interaktion statt. Die Charaktere erfüllen lediglich Funktionen und sind daher nicht empathisch besetzt. Sie stellen Opfer für den Spieler da und haben keine psychologisch tiefgründige Komponente. Aufgrund der vorhandenen Reiz- Reaktion- Schemata in Spielen stellen die Charaktere Inventar dar, welches beseitigt werden muss um weiter zu kommen. Das führt auch dazu, dass eine Identifikation mit der Spielfigur erheblich erschwert wird, wodurch empathische Empfindungen noch überflüssiger werden. Weshalb erschwert der funktionalistische Ansatz von Computerspielen eine Identifikation mit den Spielcharakteren? Ein Beispiel:
Beim Fernsehen lassen sich oft quasi- soziale Interaktionen feststellen. Zum Beispiel können die Charaktere von „Gute Zeiten- Schlechte Zeiten“ für den Rezipienten gute Bekannte werden, ohne, dass diese tatsächlich mit dem Mediennutzer interagieren könnten. (Allerdings sollte mit so einer Annahme vorsichtig umgegangen werden, da dieses leicht als eine Machtfunktion des Fernsehens im Sinne einer Kontrolle über den Rezipienten verstanden werden kann. Es ging mir hierbei aber nur um eine Veranschaulichung zum nun Folgenden.) Die einseitige Interaktion beim Fernsehen weicht beim Computerspielen einer, wenn auch recht simplen, zweiseitigen sozialen Interaktion des Spielers (der seine Spielfigur(en) steuert) mit anderen die Spielwelt bevölkernden Charakteren (sowohl vom Computer gesteuert, als auch von Menschen). Allerdings fehlen bei Computerspielen im Gegensatz zum Fernsehen die emotionalen Komponenten, welche bei der quasi- sozialen Interaktion vorhanden sind. Computerspiele sind einfach nicht in der Lage die Komplexität von Filmen, geschweige denn Schauspielern wiederzugeben. Das gesamte Spektrum an menschlichen Gefühlen wirkt auf dem Computer, um es klar auszudrücken, einfach nur lächerlich, zumal die meisten Hintergrundgeschichten bei Spielen sehr simpel gestrickt sind. Dadurch wird eine Identifikation mit der Spielfigur um einiges schwerer gemacht (auch bei starken Interesse für ein Spiel), als bei unserem Beispiel mit „ Gute Zeiten- Schlechte Zeiten“.
Wo Empathie gar nicht empfunden werden kann, kann es auch nicht zu einer Abstumpfung kommen. „ Vorrausetzung für eine solche Abstumpfung wäre, dass die Gewaltspiele überhaupt regelmäßig als mitleiderregend oder auch durch ein Mitfühlen mit den Akteuren als angstauslösend wahrgenommen würden. Dies ist jedoch mangels psychologisch tiefgehender Opferdarstellung in diesen Spielen und mangels einer Wahrnehmung der virtuellen Gewalt als `bedrohlich´ sehr unwahrscheinlich“[148].
Thomas Willmann gibt letztendlich zu Bedenken, dass, wenn es so etwas wie Lesekompetenz gibt, es sie auch für Gewaltdarstellungen geben kann und gerade „diejenigen, die mit den ästhetischen Konventionen einer bestimmten Schule von Gewalt- Ikonographie nicht vertraut sind, […] entsprechende Werke mit quasi »pornographischem« Blick [betrachten]- und unterstellen diesen auch dem Stammpublikum: Der dargestellte Gewaltakt wird als starkes Stimulans wahrgenommen, das die Barriere zwischen Fiktion und Realität zu transzendieren scheint, das unmittelbar körperliche Erregung hervorruft, das sämtliche Schutzwälle der distanzierten Betrachtung durchbricht: Diese Wirkung schwächt sich mit wiederholtem Ansehen einer speziellen Art von Gewalt- Ästhetik ab: Man lernt mit der entsprechenden Darstellungsform umzugehen, ihren Inhalt nicht mehr als einzigen und unkalkulierbar starken Reiz zu empfinden. Es ergibt sich eine Normalisierung des Blicks, der gezeigte Gewaltakt wird zum Element in einem größeren, komplexeren Kontext“[149]. Diese Normalisierung des Blicks ist aber etwas anderes als ein Gewöhnungseffekt im Sinne einer Desensibilisierung, es betrifft nicht unmittelbar die Wahrnehmung von Gewalt an sich. Die Sensibilisierung für die Regeln, Codes und Konventionen der Darstellungsweise ist eine Sensibilisierung für die Fiktionalität der Darstellung oder ihrer Medialität. Dafür gibt es einfache Beispiele: Die Darstellung von sterbenden oder verhungernden Kindern in den Nachrichten, welche genauen Abbildungsregeln entsprechen, sehen wir als Rezipienten mit einer überlebensnotwendigen Distanz, ohne „dass irgendjemanden von uns der reale Anblick eines sterbenden Menschen, eines verhungernden Kindes auch nur annähernd kalt lassen würde“[150].
5. Abschließende Betrachtungen
Im ersten Abschnitt wurden, die für diese Arbeit zu berücksichtigenden Genres von Computerspielen skizziert und deren jeweilige Besonderheiten herausgearbeitet. Anschließend wurden die charakteristischen Wesensmerkmale aller Computerspiele erörtert. Jedes Genre hat, neben dem allgemeinen Abgrenzungskriterium (Gegenüber anderen Medien) der „Interaktivität“, fünf Grundmuster, die immer auch auf bestimmte Aspekte in den Lebensthematiken und kulturell- gesellschaftlichen Verhaltensmustern der Rezipienten verweisen. Im weiteren wurde auf die Wichtigkeit der Spielkontrolle eingegangen, welche unmittelbar an Erfolgserlebnisse gekoppelt ist und Erfahrungen von Macht oder Ohnmacht ermöglichen, die wiederum ähnliche Entsprechungen in der Lebenswelt von Rezipienten haben. Also an Erfahrungen anknüpfen, die jeder einmal gemacht haben dürfte. Hieran anknüpfend gab es bereits einige Hinweise auf die Frage nach der Faszination von Computerspielen. Die Faszinationswirkung von Computerspielen lässt sich an vier möglichen Aspekten festmachen: Spielkontrolle, Erfolgserlebnisse, Kompetenz und Eintauchen in die virtuelle Welt. Folgende Verknüpfungen konnten angenommen werden: Durch die Bewältigung der Grundmuster von Computerspielen stellen sich bei den Rezipienten Erfolgserlebnisse ein, wodurch die Nutzer ein Gefühl von Macht erlangen und gleichzeitig vom Spiel signalisiert bekommen, dass sie sich in diesem Gebiet auskennen (kompetent sind). Die Voraussetzung für ein solches Empfinden liegt in der Bereitschaft der Nutzer sich vollständig auf ein Spiel einzulassen, in dieses einzutauchen. Neben diesen spielzentrierten Aspekten gibt es noch verschiedene Mittel, mit denen sich der Rezipient zu einem Computerspiel in Beziehung setzt. Anhand von vier miteinander verwobenen Funktionskreisen (Sensumotorische Synchronisierung, Bedeutungsübertragung, Regelkompetenz und Selbstbezug) wurde diese Beziehung näher erörtert. Mit dem Ergebnis, dass, analog zu den Überlegungen über Spielkontrolle, Erfolg, Kompetenz und Eintaucherlebnisse, auch die Funktionskreise auf ähnliche Muster hinweisen. Im pragmatischen Funktionskreis lernt der Spieler die Regeln des Spiels zu beherrschen und seine anfänglichen „unbedarften“ motorischen Reaktionen einzuschränken. Im syntaktischen Funktionskreis können sich durch die erlernte Kontrolle Erfolgserlebnisse und Kompetenz einstellen. Wenn dies gelingt kann sich ein Gefühl von Macht einstellen, bei Nichtgelingen besteht die „Gefahr“ des Spielabbruchs und negativer gefühlsmäßiger Reaktionen. Im semantischen Funktionskreis werden Rollenangebote an den Nutzer gestellt, welche ein Eintauchen in die Spielwelt begünstigen. Der dynamische Funktionskreis stellt den verbindenden Teil zwischen Spielanforderungen und Nutzerinteressen dar und die daraus resultierende Motivation sich mit einem Spiel in Beziehung zu setzen.
Das zweite Kapitel beschäftigte sich mit den beiden Begriffen: Aggression und Gewalt. Die in der Einleitung skizzierten Fragen können nun beantwortet werden. Zur Erinnerung: Inwieweit muss zwischen Aggression und Gewalt unterschieden werden? Wie sich gezeigt hat ist es notwendig zwischen beiden Begriffen zu differenzieren, da oftmals beide Begriffe deckungsgleich verwendet werden, obwohl sie, wie gezeigt wurde, unterschiedliche Verhaltensweisen kennzeichnen. Handelt es sich hierbei z.B. um physische oder psychische Gewalt. Macht eine Unterscheidung in physische, psychische Gewalt überhaupt Sinn, wenn es um Computerspiele geht? Eine Unterscheidung in physische und psychische Gewalt in Computerspielen macht nur eingeschränkt Sinn. Sie ist dann sinnvoll, wenn es um mögliche Transferleistungen in die Realität geht, also in dem Fall, dass angenommen wird, dass ein Rezipient in einer Weise handelt, nachdem er ein Spiel gespielt hat, welches Assoziationen bei einem Beobachter hervorrufen, welche möglicher Weise mit dem Ausdruck: „Komm mal runter!“ kommentiert werden. Dann ist es notwendig genauer zu differenzieren, welche Form von Handlungen hier stattfinden. Allerdings muss hierbei auch der Aggressionsbegriff berücksichtigt werden. Man könnte nun einwerfen, dass für den Beobachter „herzlich“ egal ist, welcher Art die beobachteten Handlungen sind. Das ist sicherlich richtig, es geht hierbei vielmehr um eine Veranschaulichung und eine Forderung an Forschungen über Computerspiele, die genau unterscheiden sollten welche Form von Handlungen nach dem Spielen stattfinden, um nicht wie so häufig aggressives Verhalten mit physischer Gewalttätigkeit zu verwechseln. Zwischen allen diesen möglichen Reaktionen ist der kausale Zusammenhang nicht zwingend anzunehmen. Eine Unterscheidung zwischen physischer und psychischer Gewalt in Computerspielen macht dann keinen Sinn, wenn ein Spiel an sich betrachtet wird, weil sie im Computerspiel nicht in der Form auftritt, wie wir sie in der Realität verorten. Wie gezeigt wurde gibt es in Computerspielen nur eine Form von physischer Gewalt, welche nicht in der Realität existiert. Zur Erinnerung: Gewalt in Computerspielen ist die Simulation von Handlungen, die in erster Line gegen das Abbild einer/mehrer menschähnlichen Figur/en gerichtet sind, wobei die Schädigung/en von einer/mehrer menschenähnlichen Figur/en ausgeht, die von einer anderen Person/en gesteuert wird, welche aktiv beteiligt ist/sind.
Im dritten Kapitel wurden verschiedene medientheoretische und psychologische Aspekte behandelt, die alle ungeeignet sind auf Computerspiele angewendet zu werden, da sie alle eklatante Mängel in sich tragen. Weiterhin wurde der Frage nachgegangen, ob für Kinder und Jugendliche ein erhöhtes „Gefährdungspotential“ besteht, wenn sie sich mit gewalthaltigen Computerspielen beschäftigen. Es wurde herausgearbeitet, dass Kindern und Jugendlichen nicht ohne weiteres ein erhöhtes „Gefährdungspotential“ durch gewalthaltige Computerspiele attestiert werden kann, da Kinder und Jugendliche, durchaus in der Lage sind zwischen gespielter und realer Gewalt zu unterscheiden, und Computerspiele von Kindern und Jugendlichen auch bewusst eingesetzt werden, um bestimmten Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen.
Das abschließende Kapitel bezieht sich direkt auf die Leitfragen, welche nun beantwortet werden können: Besteht ein Zusammenhang zwischen virtueller Gewalt und realen Gewalthandlungen gegenüber Mitmenschen? Die Überlegungen zu Konstruktion von Wirklichkeiten haben gezeigt, dass zwischen beiden Sachverhalten kein Zusammenhang zu vermuten ist. Unter Berücksichtigung möglicher Transferprozesse kann davon ausgegangen werden, dass es nicht zu einer ungeprüften Übernahme von Schemata kommt, die „eigentlich“ nicht passen können. Zumal es bei Rezipienten nicht zu einer belegbaren Schwächung der Rahmungskompetenz kommt. Ein intermondialer Transfer ist demnach höchst unwahrscheinlich. Die Überlegungen haben gezeigt, dass es aufgrund der Anknüpfungspunkte zwischen virtueller Welt und mentaler Welt wahrscheinlicher ist, hier einen intermondialen Transfer zu vermuten. Am häufigsten wird es allerdings bei intramondialen Transfers bleiben.
Fördern gewalthaltige Computerspiele die Gewaltbereitschaft? Es ist aufgrund der Ergebnisse nicht davon auszugehen, dass gewalthaltige Computerspiele direkt die Gewaltbereitschaft fördern. Es kann im Bereich der gewalthaltigen Computerspiele zu einer gesteigerten Aggressivität bei den Rezipienten kommen, nur bedeutet dies, wie versucht wurde zu erörtern nicht, dass dadurch die Bereitschaft zu physischen Gewalthandlungen steigt. Beide Begriffe bezeichnen unterschiedliche Sachverhalte.
Verlieren die Rezipienten ihre empathischen Fähigkeiten? Aufgrund der herausgearbeiteten Besonderheiten von Computerspielen und den Äußerungen von Nutzern, zeigt sich deutlich, dass die Rezipienten in keinerlei Weise eine Schwächung ihrer empathischen Fähigkeiten zeigen. Vor allem, da gewalthaltige Computerspiele keinerlei empathisches Empfinden ermöglichen. Somit gilt: Wo Empathie gar nicht empfunden werden kann, kann es auch nicht zu einer Abstumpfung kommen. „Vorrausetzung für eine solche Abstumpfung wäre, dass die Gewaltspiele überhaupt regelmäßig als mitleiderregend oder auch durch ein Mitfühlen mit den Akteuren als angstauslösend wahrgenommen würden. Dies ist jedoch mangels psychologisch tiefgehender Opferdarstellung in diesen Spielen und mangels einer Wahrnehmung der virtuellen Gewalt als `bedrohlich´ sehr unwahrscheinlich“[151].
Ziel der Arbeit war es herauszuarbeiten, ob gewalttätige Computerspiele ein signifikanter, ursächlicher Faktor für mögliche reale Gewalthandlungen sind. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass gewalthaltige Computerspiele kein signifikanter, ursächlicher Faktor für mögliche reale Gewalthandlungen sind. Auch wenn nicht mit absoluter Bestimmtheit ausgeschlossen werden kann, ob gewalthaltige Computerspiele nicht doch einen Anteil an realen Gewalthandlungen haben können. Als – wie vielfach öffentlich diskutiert - Kausalverknüpfung existiert ein solcher Zusammenhang mit Sicherheit nicht. Er kann demnach nicht monokausal hergeleitet werden. Jedoch haben die Überlegungen dieser Arbeit gezeigt, dass die Einflussgröße gewalthaltiger Computerspiele tendenziell äußerst gering ist, so dass sie eine zu vernachlässigende Größe bei der Bewertung von Gewalttaten sind. Um einen möglichen Einwand vorwegzunehmen, welcher vielleicht argumentiert: Vielleicht nicht für „normale“ Menschen, was aber wenn jemand psychische Probleme hat und nicht mehr zwischen Realität und seiner Welt unterscheiden kann? Da mir öfter ähnliche Argumente begegnet sind, möchte ich zum Abschluss noch darauf eingehen. Zunächst handelt es sich hierbei um die Darstellung einer Person, die keinerlei greifbare Eigenschaften aufweist, anhand derer man argumentieren kann. Warum? Die der Person zugesprochenen Eigenschaften sind wandelbar, je nachdem wie argumentiert wird hat die Person andere psychische Probleme. Allerdings lässt sich hieran eine Frage anknüpfen: Wenn diese Person solche Realitätsprobleme hat, warum sollte sie in einen Laden gehen, ein Spiel kaufen, den PC anschalten, das Spiel installieren (wahlweise, die Konsole einschalten, Spiel einlegen), ein Profil anlegen, Optionen auswählen, das Spiel starten und den Handlungen auf dem Bildschirm folgen können? Weiter: Warum sollte gerade die „Realität“ im Spiel mit seiner „Realität“ übereinstimmen?
6. Literaturverzeichnis
Bahrdt, Hans P.: Schlüsselbegriffe der Soziologie: Eine Einführung mit Lehrbeispielen. München 1984, S. 37
Bettelheim, B.: Eines Kindes Garten ist die Fantasie, in: Salzburger Nachrichten 1989, S. 5
Bloch, Ernst: Tagtraum und Nachttraum, in: Bartels, Martin: Traumspiele, Junius Verlag, Hamburg 1994
Büttner, Christian: Gewalt im Spiel, in: Fritz, Jürgen: Programmiert zum Kriegspielen: Weltbilder und Bilderwelten im Videospiel. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag, 1988, S. 94- 109
Büttner, Christian/ Elschenbroich, Donata/ Ende, Aurel: Kinderkulturen: Neue Freizeit und alte Muster. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 1992
Elias, Norbert: Über den Prozess der Zivilisation Band 1. Frankfurt am Main 1975, S. 266, 267, 269
Elias, Norbert, Über den Prozess der Zivilisation Band 2. Frankfurt am Main 1975, S. 313
Esser, Heike/Witting, Tanja: Transferprozesse beim Computerspiel, in: Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 247- 254
Faddagh- El, Mahha/Nagenborg, Micheal: Gewalt ist eine Lösung – leider, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 44- 47
Felten Von, Mirjam: „…aber das ist noch lange nicht Gewalt“: Empirische Studie zur Wahrnehmung von Gewalt bei Jugendlichen: Leske & Budrich, 2000
Fritz, Jürgen: Programmiert zum Kriegspielen: Weltbilder und Bilderwelten im Videospiel. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag, 1988
Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997
Fritz, Jürgen: Warum Computerspiele faszinieren: Empirische Annäherungen an Nutzung und Wirkung von Bildschirmspielen. Weinheim und München: Juventa Verlag, 1995
Fritz, Jürgen: Was sind Computerspiele, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 81- 86
Fritz, Jürgen: Modelle und Hypothesen zur Faszinationskraft von Bildschirmspielen, in: Warum Computerspiele faszinieren: Empirische Annäherungen an Nutzung und Wirkung von Bildschirmspielen. Weinheim und München: Juventa Verlag, 1995, S. 11- 35
Fritz, Jürgen/Misek- Schneider, Karla: StudentInnen im Sog der Computerspieler, in: Warum Computerspiele faszinieren: Empirische Annäherungen an Nutzung und Wirkung von Bildschirmspielen. Weinheim und München: Juventa Verlag, 1995, S. 43- 45
Fritz, Jürgen/Misek- Schneider, Karla: Computerspiele aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen, in: Warum Computerspiele faszinieren: Empirische Annäherungen an Nutzung und Wirkung von Bildschirmspielen. Weinheim und München: Juventa Verlag, 1995, S. 89- 120
Fritz, Jürgen: Wie wirken Videospiele auf Kinder und Jugendliche, in: Programmiert zum Kriegspielen: Weltbilder und Bilderwelten im Videospiel. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag, 1988, S. 201- 213
Fritz, Jürgen: Lebenswelt und Wirklichkeit, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 13- 30
Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang: Computerspieler wählen lebenstypisch, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 67- 73
Fritz, Jürgen: Macht, Herrschaft und Kontrolle im Computerspiel, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 183- 193
Fritz, Jürgen/ Hönemann, Heike /Misek-Schneider, Karla /Ohnemüller, Bernd: Vielspieler am Computer, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 197- 205
Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang: Langeweile, Stress und Flow: Gefühle beim Computerspiel, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 209- 213
Fritz, Jürgen: Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 229- 245
Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang: Gewalt, Aggression und Krieg, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S 277- 288
Fromm, Rainer: Digtial spielen – real morden? Shooter, Clans und Fragger: Computerspiele in der Jugendszene. Marburg: Schüren Presseverlag, 2002
Fromme, Johannes: Pädagogische Reflexionen über Computerspielkultur der
Heranwachsenden. Bonn 1997, S. 305
Fromme, Johannes: Von Old Shatterhand zu Super Mario Land? Die Spiel- und Unterhaltungswelten der >>Game Boy<<- Generation, in: Büttner, Christian/ Elschenbroich, Donata/ Ende, Aurel: Kinderkulturen: Neue Freizeit und alte Muster. Weinheim und Basel 1992, S. 76, 77
Gieselmann, Hartmut: Aktion > Sauberer Bildschirm<, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 50- 56
Glogauer, Werner: Die neuen Medien verändern die Kindheit: Nutzung und Auswirkungen des Fernsehens, der Videospiele, Videofilme u. a. bei 6- bis 10jährigen Kindern und Jugendlichen. Weinheim 1993, S. 120
Gottschalch, Wilfried: Männlichkeit und Gewalt. Weinheim und München: Juventa Verlag, 1997
Grassmuck, Volker: Der elektronische Salon, in: Rötzer, Florian: Schöne neue Welten? Auf zu einer neuen Spielkultur. München: Klaus Boer Verlag, 1995, S. 51, 52
Grossmann, Lt. Col. Dave/ DeGeatano, Gloria: Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht? Ein Aufruf gegen Gewalt in Fernsehen, Film und Computerspielen. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, 2002
Hoffmann, Daniel/Wagner, Volker: Erwachsene beim Computerspiel- Motivationen und Erlebnisformen, in: Fritz, Jürgen: Warum Computerspiele faszinieren: Empirische Annäherungen an Nutzung und Wirkung von Bildschirmspielen. Weinheim und München: Juventa Verlag, 1995, S. 158, 159
Höflich, Joachim R.: Menschen, Computer und Kommunikation: Theoretische Verortungen und empirische Befunde. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2003
Jäckel, Michael: Interaktion: Soziologische Anmerkungen zu einem Begriff, in: Rundfunk und Fernsehen 43 (1995), S. 463
Jörns, Gerald: Counterstrike aus Sicht des Jugendschutzes, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003
Kauke, Marion: Veni, vidi, vici- er kam, sah und siegte, in: Rötzer, Florian: Schöne neue Welten? Auf zu einer neuen Spielkultur. München: Klaus Boer Verlag, 1995, S. 303- 305
Kolfhaus, Stephan: Bilanz von Wirkungsstudien zum Videospiel, in: Fritz, Jürgen Programmiert zum Kriegspielen: Weltbilder und Bilderwelten im Videospiel. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag, 1988, S. 189- 193
Kolfhaus, Stephan: Umgang Jugendlicher mit Videospielen, in: Fritz, Jürgen Programmiert zum Kriegspielen: Weltbilder und Bilderwelten im Videospiel. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag, 1988, S. 167- 180
Konrad, H-J, Trends und Lage der gegenwärtigen Aggressionsforschung, in: Aggression und Frustration als psychologisches Problem. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992, S. 513
Ladas, Manuel: Brutale Spiele(r)? Wirkung und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der Wissenschaft, 2002
Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aggression und Gewalt. Stuttgart, Berlin, Köln: W. Kuhlhammer Verlag, 1993
Lischka, Konrad: Schöne Spiele, falsche Freunde, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 66
Maresch, Rudolf: Medien der Gewalt – Gewalt der Medien, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 169- 183
Masuyama: Soziologie des Videospiels, in: Rötzer, Florian: Schöne neue Welten? Auf zu einer neuen Spielkultur. München: Klaus Boer Verlag, 1995, S. 39
Nolting, Hans- Peter: Kein „Erklärungseintopf“ –Aggression aus psychologischer Sicht, in: Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aggression und Gewalt. Stuttgart, Berlin, Köln: W. Kuhlhammer Verlag, 1993, S. 9- 54
Oerter, Rolf: Lebensthematik und Computerspiel, in: Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 60- 63
Parke, R/Slaby, R. G.: The development of aggression: in P. H. Mussen Handbook of Child Psychology, Vol. IV: Socialization, personality and social development. New York, 1983
Palm, Goedart: Die Geburt der Zivilisation aus dem Geist des Totschlägers, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 166, 167
Rathmayr, Bernhard: Die Rückkehr der Gewalt: Faszination und Wirkung medialer Gewaltdarstellung. Wiesbaden: Quelle und Meyer Verlag, 1996
Rötzer, Florian: Schöne neue Welten? Auf zu einer neuen Spielkultur. München: Klaus Boer Verlag, 1995
Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003
Rötzer, Florian: Wirklichkeit, Realismus und Simulation, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 112- 117
Rutschky, K.: Schwarze Pädagogik. Berlin 1993, S. 7
Sacher, Werner: Jugendgefährdung durch Video- und Computerspiele?, in: Zeitschrift für Pädagogik Heft 2 1993, S. 313
Scharfetter, C: Aggression und Aggressivität im therapeutischen Umgang. TW Neurologie, Psychiatrie 6, 1992, S. 58
Schwind, H- D./ Roitsch, K./ Ahlborn, W./ Gielen, B.: Gewalt in der Schule am Beispiel Bochum. Mainz: Weißer Ring Verlagsgesellschaft, 1995
Selg, Herbert: Fördern Medien die Gewaltbereitschaft?, in: Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aggression und Gewalt. Stuttgart, Berlin, Köln: W. Kuhlhammer Verlag, 1993, S. 74- 82
Steckel, Rita: Aggression in Videospielen: Gibt es Auswirkungen auf das Verhalten von Kinder?. Münster, Berlin, New York: Waxmann Verlag GmbH, 1998
Stegemann, Thorsten: Amoktaten haben Vorbildcharakter, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 97
Swoboda, Wolfgang H.: Zur Veränderung des Medienalltags, in: Fritz, Jürgen: Programmiert zum Kriegspielen: Weltbilder und Bilderwelten im Videospiel. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag, 1988, S. 43- 62
Swoboda, Wolfgang H.: Bilanz von Wirkungsstudien zum Videospiel, in: Fritz, Jürgen Programmiert zum Kriegspielen: Weltbilder und Bilderwelten im Videospiel. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag, 1988, S. 189- 190
Theunert, Helga: Gewalt in den Medien- Gewalt in der Realität. 1996, S. 43
Weber, Karsten: Gewalt und Medien, Gewalt durch Medien, Gewalt ohne Medien?, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 36- 40
Wegener- Spöhring, Giesela: Spiel und Aggressivität, in: Fritz, Jürgen/Fehr, Wolfgang: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 264
Wehling, Hans- Georg: Landeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aggression und Gewalt. Stuttgart, Berlin, Köln: W. Kuhlhammer Verlag, 1993, S. 11
Willmann, Thomas: Death’s a game, in: Rötzer, Florian: Virtuelle Welten- reale
Gewalt. Hannover: Verlag Heinz Heise GmbH & Co KG, 2003, S. 131- 141
7. Anhang
7. 1. Bilder
Vergleich Counter –Strike (Bild 1)- Soldier of Fortune (Bild 2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Spiele der Experimental- Studie von Anderson und Dill
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Wolfenstein 3D)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Myst)
Studie von Rita Steckel (gewalthaltiges Spiel „Street Fighter 2“- Bild 1/gewaltfreies Spiel „Joshi´s Cookie“ – Bild 2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. 2. Glossar
Cheat/ Cheaten/ Trainer: Als Cheat (englisch für Betrug, Schwindel) wird die Möglichkeit bezeichnet, in einem Computerspiel selbst oder durch externe Programme [Trainer] den Spielverlauf in einer nicht dem gewöhnlichen Verlauf entsprechenden Weise zu beeinflussen. Es handelt sich dabei beispielsweise um Tricks, mit denen für manche Spieler zu schwere Abschnitte eines Levels übersprungen werden können. Aber auch das Verschaffen von zum Beispiel unendlicher Lebensenergie, mehr Munition oder weiterer Einheiten werden meist von Cheats abgedeckt. In der Regel sind diese Funktionen zu Testzwecken für die Entwicklungsphase des Spiels einprogrammiert.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Cheaten)
Construction- Kit: Programme, die in einem Spiel enthalten sind, und mit deren Hilfe die Möglichkeit besteht das jeweilige Computerspiel zu manipulieren. Bsp. Die optische Darstellung zu verändern.
E- Sport: Der Begriff E- Sport (elektronischer Sport; weitere Schreibweisen im deutschsprachigen Raum sind eSport, e-Sport, E-Sports, eSports und e-Sports) bezeichnet das wettbewerbsmäßige Spielen von Computer- oder Videospielen im Mehrspielermodus und ist damit ein Überbegriff für Sportdisziplinen, deren Spielfelder und Regeln durch die entsprechende Software und Wettkampfbestimmungen (z. B. das Reglement der E-Sportligen) vorgegeben werden.
(http://de.wikipedia.org/wiki/E-sport)
Flow: Der Begriff „Flow“ bezeichnet einen Zustand, indem, nach einer inneren Logik, welche kein bewusstes Eingreifen von Seiten des Handelnden zu erfordern scheint, Handlung auf Handlung folgt. Dieser Prozess wird als ein einheitliches 'Fließen' von einem Augenblick zum nächsten erlebt, wobei der Handelnde „Meister“ seines Handelns ist und kaum eine Trennung zwischen sich und der Umwelt, zwischen Stimulus und Reaktion, oder zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verspürt. „Der Handelnde geht völlig in seiner Aktivität auf. […]
Im Flow-Erlebnis kann der Mensch die jeweils nötigen Fähigkeiten voll ausschöpfen und erhält dabei klare Rückmeldungen auf die Wirkungen seines Handelns“. (Fritz, Jürgen: Langeweile, Stress und Flow: Gefühle beim Computerspiel, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997)
Frag: Mit Frag bezeichnet man in Ego- Shootern den Abschuss einer gegnerischen Spielfigur. Üblicherweise wird der Begriff nur bei Online- Ego- Shootern bzw. deren Online-Spielvarianten verwendet, da hierbei die Frags die Position der einzelnen Spieler in einer Rangliste bestimmen.
LAN- Party: LAN ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung: „Local Area Network“. Bei einer LAN- Party werden mehrere Rechner miteinander Verbunden, um miteinander oder gegeneinander spielen zu können. Im Gegensatz zum Internet sind bei einer LAN- Party alle beteiligten Personen mit ihrem Computer physisch Anwesend. Grundsätzlich kann man zwischen privaten und öffentlichen LAN-Partys unterscheiden. Die private LAN-Party ist meist ein Treffen unter Freunden in eigenen oder gemieteten Räumen mit ausschließlich eigenem Equipment. Die öffentliche LAN-Party wird von einem offiziellen Veranstalter organisiert, ist meist kostenpflichtig und geht über mehrere Tage (üblicherweise ein Wochenende) mit mehreren hundert Teilnehmern.
Lebensenergie: In den meisten Computerspielen wird anhand eines Balkens angezeigt, wie viel „Lebensenergie“ die eigene Spielfigur noch besitzt. Der Spieler muss darauf achten, dass der Balken möglichst „voll“ bleibt, da ansonsten die Spielfigur „stirbt“. Wird auch verwendet um bei gegnerischen Spielfiguren deren „Lebensenergie“ anzuzeigen.
Level: Ein Level ist ein Abschnitt des Spiels, den der Spieler bewältigen muss, um in den nächsten Abschnitt zu gelangen.
Nickname: Ist ein, vom Spieler, selbst gewählter Spitzname.
Noob: Bezeichnung für einen nicht lernwilligen bzw. ignoranten Neuling, wird aber auch als Beleidigung für erfahrene Spieler verwendet, die das Verhalten eines Neulings an den Tag legen oder schlichtweg Anfänger-Fehler machen.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Computerspieler-Jargon#Noob)
owned/pwend: (engl. own besitzen) frei übersetzt „Erwischt!“ oder „Dominiert“, auch pwned geschrieben. (http://de.wikipedia.org/wiki/Owned#O)
Patch: Ein Patch (engl. Flicken) ist eine Korrekturauslieferung um z.B. bei Computerspielen bislang nicht vorhandene Funktionalität nachzurüsten oder neue Inhalte ins Spiel zu transferieren.
Quicksave: Quicksave (engl. Schnellspeichern) ist die Möglichkeit in Computerspielen seinen aktuellen Fortschritt im Spiel festzuhalten, um bei einem erneuten Spielen an genau der gleichen Stelle weiterzuspielen. Allerdings kann immer nur ein Quicksave- Speicherstand angelegt werden, der nach einem erneuten Speichern überschrieben wird. Beim Quicksave besteht nur die Möglichkeit an der aktuellen Stelle, an der man eine Quicksave- Speicherstand angelegt hat, weiterzumachen.
Respawn: Bezeichnet den Wiedereinstieg ins Spielgeschehen, nachdem man „gestorben“ ist.
Server: Zentraler Rechner, der anderen Rechnern (Clients) Daten zugänglich macht. Fast alle Dienste des Internet basieren auf diesem Client/Server-Prinzip. (
www.werboffice.de/extras/lib.htm)
Skript- Sequenzen: Automatisch ablaufenden Ereignisse (z.B. das Auftauchen eines Hubschraubers, der den Spieler abholt), die ausgelöst werden sobald im Computerspiel einer imaginäre „Linie“ überschritten wird. Das anschließende Ereignis bleibt dabei jedes Mal gleich.
Speicherstand: Gleiche Funktion wie Quicksave, mit dem Unterschied, dass man mehrere Speicherstände anlegen kann, wodurch beliebig zwischen den Levels gewechselt werden kann.
Zwischensequenzen: Zwischensequenzen (engl. cutscenes) sind in Computerspielen verwendete Filmsszenen, die zumeist dazu dienen, ohne Beteiligung des Spielers Handlung zu vermitteln. Während einer Zwischensequenz ist der Spieler in den passiven Zustand eines Zuschauers versetzt, oft wird dabei auch der im eigentlichen Spielverlauf vom Spieler gelenkte Spielercharakter als eigenständig handelnder Charakter gezeigt (und somit die Einheit von Spieler und Spielercharakter vorübergehend aufgelöst). Um sofort zu zeigen, dass keine Eingaben mehr stattfinden müssen, und, um an das Kino zu erinnern, werden bei 4:3-Ausgabeformen gelegentlich schwarze Balken eingeführt oder eingeblendet (Letterbox). Im Unterschied zur Zwischensequenz spricht man von einem Scripted Event, wenn eine szenische Handlung während des eigentlichen Spielverlaufs stattfindet und der Spieler dabei aktiv innerhalb des Geschehens bleibt.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischensequenz)
[...]
[1] http://www.usk.de/90_Die_Alterskennzeichen.htm
* Airsoft (auch: Softair) ist ein sportives, taktisches Geländespiel, welches mit sog. Airsofts gespielt wird. Dabei ist das Grundprinzip ähnlich wie bei Paintball: Ein gegnerischer Spieler kann aus dem Spiel befördert werden, indem man ihn trifft. Anstatt der farbigen „Paintballs“ werden bei Airsoft Plastikkugeln verwendet. Das setzt bei Spielen einen hohen Grad von Fairness voraus, da man Treffer nicht anhand von Farbflecken nachweisen kann. ASG (Airsoftgun) sind vom Aussehen her echten Waffen nachempfunden, bestehen aber größten Teils aus Plastik. Höherwertige Modelle hingegen werden aus Metall hergestellt und wiegen das Gleiche wie eine originale Waffe. Bei solchen Modellen wird bei der Herstellung auch mehr auf Details geachtet. Bei vielen Airsoftspielern gehört das Tunen ihrer „Waffen“ dazu. Hierbei werden Teile mit höherer Qualität und Leistung verbaut, oder Zubehör wie z. B. Zielvisiere oder andere Schulterstützen etc. angebracht. (http://de.wikipedia.org/wiki/Airsoft) Aus einem Interview in der „GameStar 02/2007“ mit einem Softair- Spieler, der Sebastian B. über Softair- Foren „kennen gelernt“, geht hervor, dass Sebastian B. aktiver Spieler war.
[2] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkung und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 125
[3] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkung und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 62, 74-75
[4] Fromm, Rainer, Digital spielen- real morden?. Marburg 2002, S. 11
[5] Bahrdt, Hans P., Schlüsselbegriffe der Soziologie: Eine Einführung mit Lehrbeispielen. München 1984, S. 37
[6] Jäckel, Michael, Interaktion: Soziologische Anmerkungen zu einem Begriff. In: Rundfunk und Fernsehen 43 (1995), S. 463
[7] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkung und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 59
[8] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkung und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 61
[9] Fritz, Jürgen, Macht, Herrschaft und Kontrolle im Computerspiel in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 193
[10] Durkin/Aisbett, in: Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r). Frankfurt am Main 2002, S. 38
[11] Fritz, Jürgen, Macht, Herrschaft und Kontrolle im Computerspiel, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 193
[12] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkung und Nutzung von Gewalt in: Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 38
[13] Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang, Computerspieler wählen lebenstypisch, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S.69
[14] Misek- Schneider, Karla/ Fritz, Jürgen, StudentInnen im Sog der Computerspiele, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 39
[15] Misek- Schneider, Karla/ Fritz, Jürgen, StudentInnen im Sog der Computerspiele, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 44-45
[16] ebd.
[17] ebd.
[18] Misek- Schneider, Karla/ Fritz, Jürgen, StudentInnen im Sog der Computerspiele, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 44-45
[19] Fritz, Jürgen, Macht, Herrschaft und Kontrolle im Computerspiel, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 183, 184
[20] ebd.
[21] Masuyama, Soziologie des Videospiels, in: Schöne neue Welten?. München 1995, S. 39
[22] Fritz, Jürgen, Was sind Computerspiele?, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 86
[23] Fritz, Jürgen, Was sind Computerspiele?, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 86
[24] Fritz, Jürgen, Was sind Computerspiele?, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 86
[25] Fritz, Jürgen, Was sind Computerspiele?, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 86
[26] Fritz, Jürgen, Modelle und Hypothesen zur Faszination von Bildschirmspielen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 28
[27] Fritz, Jürgen, Modelle und Hypothesen zur Faszination von Bildschirmspielen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 29,
[28] Fritz, Jürgen, Modelle und Hypothesen zur Faszination von Bildschirmspielen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 30
[29] Fritz, Jürgen/ Fehr, Wolfgang, Langeweile, Streß und Flow: Gefühle beim Computerspiel, in Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 213
[30] Fritz, Jürgen, Modelle und Hypothesen zur Faszination von Bildschirmspielen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 31
[31] Fritz, Jürgen, Modelle und Hypothesen zur Faszination von Bildschirmspielen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 33
[32] Galtung, Johan, in: Aggression und Gewalt. Stuttgart, Berlin und Köln 1993, S. 53
[33] Grossmann, Lt. Col. Dave/DeGeatano, Gloria, Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht?. Stuttgart 2002, S. 127
[34] Parke, R. D./Slaby, R. G., in: Wegener- Spöhring, Gisela, Spiel und Aggressivität, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 264
[35] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?. Frankfurt am Main 2002, S. 125
[36] Theunert, Helga, Gewalt in den Medien- Gewalt in der Realität. 1996, S. 43
[37] Stoiber, Edmund, in einer Mitteilung der CSU über den „Amoklauf“ in Emsdetten 20.11.06
[38] Willmann, Thomas, Death’s a game, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 140, 141
[39] ebd.
[40] Gottschalch, Wilfried, Männlichkeit und Gewalt. Weinheim und München 1997, S. 16
[41] Scharfetter, C., Aggression und Aggressivität im therapeutischen Umgang. 1992, S.58
[42] Nolting, Hans- Peter, Kein „Erklärungseintopf“ – Aggression aus psychologischer Sicht. Berlin, Köln 1993, S. 10
[43] Wehling, Hans- Georg, Aggression und Gewalt. Stuttgart, Berlin, Köln 1993, S. 11
[44] Maresch, Rudolf, Medien der Gewalt- Gewalt der Medien, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 169
[45] Elias, Norbert, Über den Prozess der Zivilisation Band 1. Frankfurt am Main 1975, S. 266, 267, 269
[46] Elias, Norbert, Über den Prozess der Zivilisation Band 1. Frankfurt am Main 1975, S. 266, 267, 269
[47] ebd.
[48] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 40
[49] ebd.
[50] F. Cardini 1990, S. 94
[51] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 41
[52] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 42
[53] Elias, Norbert, Über den Prozess der Zivilisation Band 2. Frankfurt am Main 1975, S. 313
[54] Elias, Norbert, Über den Prozess der Zivilisation Band 1. Frankfurt am Main 1975, S. 313, 166, 168
[55] Elias, Norbert, Über den Prozess der Zivilisation Band 1. Frankfurt am Main 1975, S. 313, 166, 168
[56] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 44
[57] Elias, Norbert, Über den Prozess der Zivilisation Band 1. Frankfurt am Main 1975, S. 89
[58] Palm, Geodart, Die Geburt der Zivilisation aus dem Geist des Totschlägers. Hannover 2003, S.167
[59] Wertheimer, 1986, S. 19
[60] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 48
[61] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 53- 56
[62] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 53- 56
[63] ebd.
[64] Rutschky, K., Schwarze Pädagogik.Berlin 1993, S. 7
[65] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 64
[66] Maresch, Rudolf, Medien der Gewalt- Gewalt der Medien, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 170- 171
[67] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkung und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 138- 139
[68] Glogauer, Werner: Die neuen Medien verändern die Kindheit: Nutzung und Auswirkungen des Fernsehens, der Videospiele, Videofilme u. a. bei 6- bis 10jährigen Kindern und Jugendlichen. Weinheim 1993, S. 120
[69] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 25
[70] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 63
[71] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 63
[72] Rathmayr, Bernhard, Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 23- 24
[73] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 63
[74] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 68- 69
[75] Steckel, Rita, Aggression in Videospielen: Gibt es Auswirkungen auf das Verhalten von Kindern?. Münster, Berlin, New York 1998, S. 15
[76] Wehling, Hans- Georg, Aggression und Gewalt. Stuttgart, Berlin, Köln 1993, S. 14
[77] Konrad, H-J, Trends und Lage der gegenwärtigen Aggressionsforschung, in: Aggression und Frustration als psychologisches Problem. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1992, S. 513
[78] Misek- Schneider, Karla/ Fritz, Jürgen, Computerspiele aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 100
[79] ebd.
[80] ebd.
[81] Misek- Schneider, Karla/ Fritz, Jürgen, Computerspiele aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 101, 102
[82] ebd.
[83] Misek- Schneider, Karla/ Fritz, Jürgen, Computerspiele aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 101, 102
[84] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 117
[85] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 117
* Anderson, Craig A./ Karen E. Dill: Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings, and Behaviour in the Laboratory and in Life, 2000
[86] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 121
[87] ebd.
[88] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 121, 122
[89] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 121, 122
[90] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegsspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 202, 203
[91] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegsspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 202, 203
[92] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 203- 204
[93] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 203- 204
[94] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 208
[95] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 209, 210
[96] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 209, 210
[97] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 213, 214
[98] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 213, 214
[99] ebd.
[100] Fritz, Jürgen, Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 214
[101] Grossmann, Lt. Col. Dave/ DeGaetano, Gloria, Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht?. Stuttgart 2002, S. 20
[102] Büttner, Christian, Gewalt im Spiel, in: Programmiert zum Kriegspielen. Frankfurt am Main 1988, S. 106
[103] Fromme, Johannes, Von Old Shatterhand zu Super Mario Land? Die Spiel- und Unterhaltungswelten der >>Game Boy<<- Generation, in: Kinderkulturen: Neue Freizeit und alte Muster. Weinheim und Basel 1992, S. 76, 77
[104] Fromme, Johannes, Von Old Shatterhand zu Super Mario Land? Die Spiel- und Unterhaltungswelten der >>Game Boy<<- Generation, in: Kinderkulturen: Neue Freizeit und alte Muster. Weinheim und Basel 1992, S. 76, 77
[105] Bettelheim, B., Eines Kindes Garten ist die Fantasie, in: Salzburger Nachrichten 1989, S.5
[106] Strata di, Filippo, in: Die Rückkehr der Gewalt. Wiesbaden 1996, S. 142
[107] Fritz, Jürgen, Modelle und Hypothesen zur Faszinationskraft von Bildschirmspielen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 11
[108] Weber, Karsten, Gewalt und Medien, Gewalt durch Medien, Gewalt ohne Medien?, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 40
[109] Sacher, Werner, Jugendgefährdung durch Video- und Computerspiele?, in: Zeitschrift für Pädagogik Heft 2 1993, S. 313
[110] Weber, Karsten, Gewalt und Medien, Gewalt durch Medien, Gewalt ohne Medien?, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 37
[111] Zitat aus: Rötzer, Florian, Virtuelle Gewalt- reale Gewalt. Hanover 2003, S. 47
[112] http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Die-Bundespruefstelle/geschichte.html
[113] http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/indizierungsverfahren.html
[114] http://www.wwcl.net/article19.htm
[115] Jörns, Gerald, Counterstrike aus Sicht des Jugendschutzes, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 124
[116] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 74
[117] Fritz, Jürgen, Lebenswelt und Wirklichkeit, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 13, 16
[118] ebd.
[119] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?: Wirkungen und Nutzung von Gewalt in Computerspielen. Frankfurt am Main 2002, S. 78
[120] Fritz, Jürgen, Lebenswelt und Wirklichkeit, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 18
[121] Bloch, Ernst, Tagtraum und Nachttraum, in: Traumspiele. Hamburg 1994, S. 169
[122] ebd.
[123] Fritz, Jürgen, Lebenswelt und Wirklichkeit, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 19
[124] Fritz, Jürgen, Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 230
[125] Fritz, Jürgen, Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 230
[126] Fritz, Jürgen, Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 231, 232
[127] Fritz, Jürgen, Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 233, 234
[128] Fritz, Jürgen, Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 233, 234
[129] Fritz, Jürgen, Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 234-245
[130] ebd.
[131] Fritz, Jürgen, Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 234-245
[132] ebd.
[133] Fritz, Jürgen, Zwischen Transfer und Transformation: Überlegungen zu einem Wirkungsmodell der virtuellen Welt, in: Handbuch Medien: Computerspiele. Bonn 1997, S. 234-245
[134] ebd.
[135] Fritz, Jürgen, Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim; München 1995, S. 241- 242
[136] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?. Frankfurt am Main 2002, S. 92
[137] Fritz, Jürgen, Modelle und Hypothesen zur Faszinationskraft von Bildschirmspielen, in: Warum Computerspiele faszinieren. Weinheim und München 1995, S. 15
[138] Fromme, Johannes, Pädagogische Reflexionen über Computerspielekultur der Heranwachsenden. Bonn 1997, S. 305
[139] Alle Zitate aus: Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?. Frankfurt am Main 2002, S. 148
[140] Rötzer, Florian, Virtuelle Gewalt- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 116
* Schwind, H- D./ Roitsch, K./ Ahlborn, W./ Gielen, B.: Gewalt in der Schule am Beispiel Bochum. Mainz: Weißer Ring Verlagsgesellschaft, 1995
[141] Steckel, Rita, Aggression in Videospielen. Münster, Berlin, New York 1998, S. 10
[142] Steckel, Rita, Aggression in Videospielen. Münster, Berlin, New York 1998, S. 10
[143] Steckel, Rita, Aggression in Videospielen. Münster, Berlin, New York 1998, S. 188-191
[144] ebd.
[145] ebd.
[146] Steckel, Rita, Aggression in Videospielen. Münster, Berlin, New York 1998, S. 188-191
[147] Steckel, Rita, Aggression in Videospielen. Münster, Berlin, New York 1998, S. 193
[148] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?. Frankfurt am Main 2002, S. 156
[149] Willmann, Thomas, Death’s a game, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 137
[150] Willmann, Thomas, Death’s a game, in: Virtuelle Welten- reale Gewalt. Hannover 2003, S. 138
[151] Ladas, Manuel, Brutale Spiele(r)?. Frankfurt am Main 2002, S. 156
- Arbeit zitieren
- Lars Okkenga (Autor:in), 2007, Gewalt in Computerspielen - Über den Zusammenhang zwischen virtueller Welt und realer Gewalt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110959
Kostenlos Autor werden




















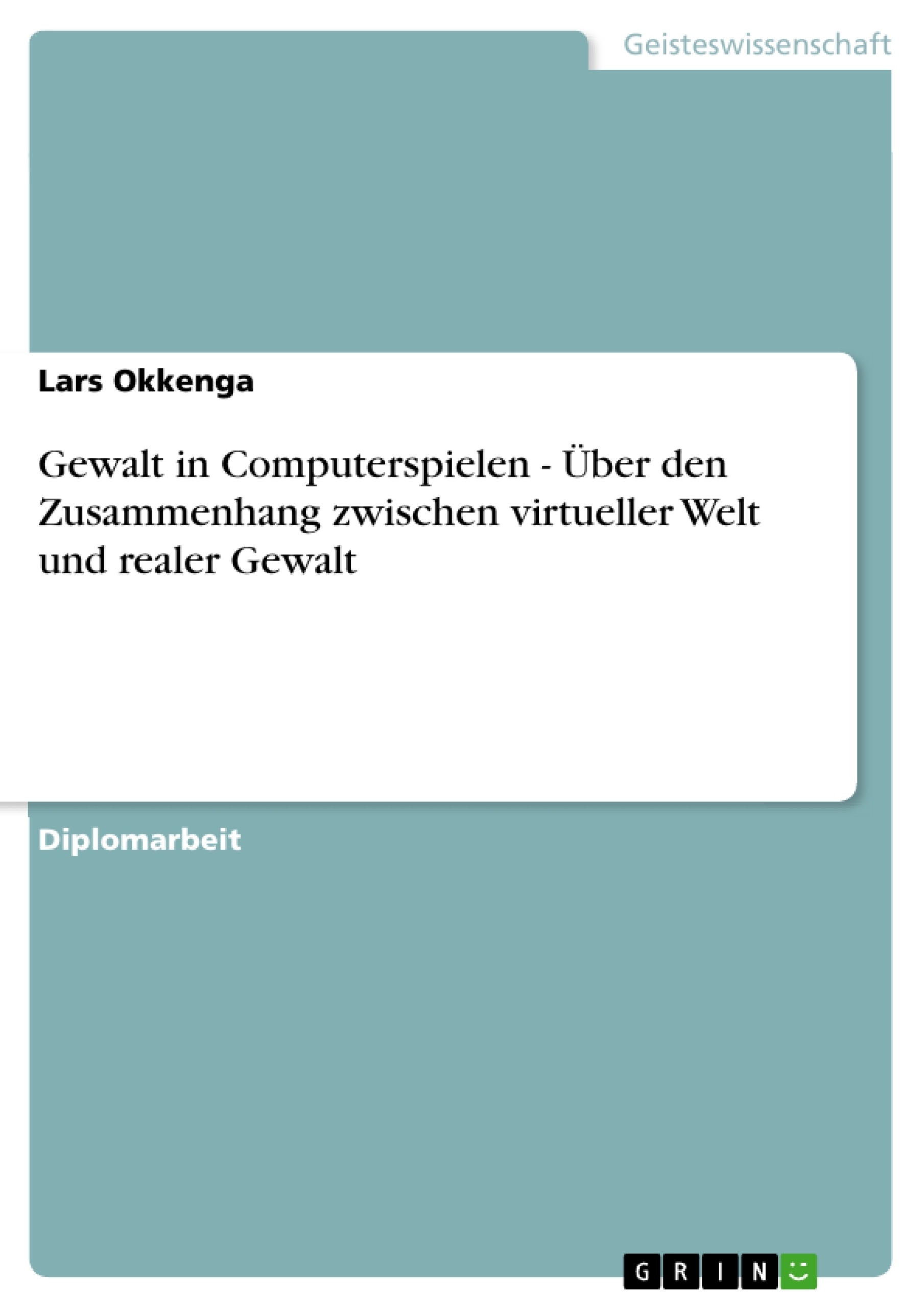

Kommentare