Leseprobe
Gliederung
1. Häufigkeit der Phänomene und Begriffsbestimmung
2. Phänomene
3. Annäherung an die Phänomene aus psychoanalytischer Sicht
3.1. Die Bedeutung des Ich
3.2. Triebpsychologische Aspekte
3.3. Objektbeziehungspsychologische und bindungstheoretische Aspekte
3.4. Selbstpsychologische Aspekte
3.5. Der Aspekt von Delophilie und Theatophilie
4. Therapeutische Gesichtspunkte
5. Literatur
Zusammenfassung.
Lampenfieber als Alltagsphänomen, das zur Steigerung der Leistung bei einem Auftritt beitragen kann, ist begrifflich von Aufführungsangst zu trennen. Diese beeinträchtigt die Qualität des Vortrags und geht mit Blockade der Kontrollfunktionen, Depersonalisation und somatischen Begleiterscheinungen einher. Die Phänomene werden vor dem Hintergrund einer psychoanalytischen Annäherung an die Motive zum Auftritt vor Publikum und an die unbewußt damit verbundenen Gefahren näher betrachtet. Wesentliche psychoanalytische Arbeiten zum Thema werden nach triebtheoretischen, objektbeziehungs- und selbstpsychologischen Schwerpunkten geordnet kurz referiert und anhand eigener Fallvignetten illustriert. Weiterhin wird skizziert, daß L. Wurmsers Konzept von Delophilie und Theatophilie geeignet ist, diese drei theoretischen Zugangsweisen zur Auftrittsangst zu integrieren. Am Ende wird unter klinischem Aspekt dafür plädiert, psychoanalytische Therapieansätze zur Behandlung von Aufführungsangst, da sie, wie gezeigt, auf einer differenzierten Theorie zum Verständnis der Phänomene basieren, nicht erst, wie aktuell wiederholt empfohlen, als ultima ratio in chronifizierten Fällen anzuwenden, sondern die Indikation hierfür bereits frühzeitig zu prüfen.
Summary.
Stage fright, a condition that can even help to increase the quality of a person’s performance, must not be confused with performance anxiety . Performance anxiety is accompanied by a loss of control, by depersonalization and somatic problems and it disturbs the quality of the performance. This paper takes a psychoanalytical approach to determine what makes a person expose him/herself - perform - in front of an auditorium and to look at the dangers that the person subconsciously connects with this situation. Important psychoanalytical papers on the subject are listed and their findings shortly related. The triple focus here is on theories of instincts, object-relations and narcissism. Case histories from the author’s practice illustrate the findings. L. Wurmser’s concept of delophily and theatophily is shown to be a way of integrating the three theoretical approaches to performance anxiety. Since psychoanalytical therapies for the treatment of performance anxiety can thus be based on a complex and precise theory that helps to understand the phenomena, the paper recommends that those therapies be considered at a much earlier stage in the clinical treatment than has currently been recommended.
1. Häufigkeit der Phänomene und Begriffsbestimmung
Lampenfieber und Podiumsangst sind weit verbreitet. S.O. Hoffmann (1999) rechnet sie zu den Alltagsphänomenen. Nach Plaut (1990) erleben ca. 80% aller Menschen ein gewisses Maß Angst, wenn sie die Aufmerksamkeit einer Gruppe auf sich gerichtet spüren. Empirische Arbeiten geben hohe Gesamthäufigkeiten von Lampenfieber oder Aufführungsangst unter Musikausübenden an (zwischen 24 und 96% nach der Übersicht von Möller 1999, 97,5% nach Altenburg und Krawehl 2000), können aber keinen signifikanten Einfluß der Parameter Alter, Geschlecht, Auftrittserfahrung, beruflicher Status als fest angestellter oder freischaffender Künstler und vorhandener oder fehlender Sichtkontakt zum Publikum auf die Ausprägung von Aufführungsangst finden (Übersicht bei Brodsky, Sloboda und Waterman 1994). Eine Reihe von Autoren (Plaut 1990, Gabbard 1983, Bastian 1989) hebt positive Aspekte daran hervor, die in Selbstzeugnissen von Musikern und auch in einer empirischen Studie belegt sind (Eckhardt und Lüdemann 1974). Der Cellist Gerhard Mantel (2001) führt ein engagiertes Plädoyer für die Lebendigkeit der Aufführung und kommt zu dem Schluß: „Der Hörer hat ein Recht auf mein Lampenfieber!“ (S. 16) Offenbar gibt es also bzgl. der Leistung für jeden Ausführenden eine bestmögliche Spannung vor dem Auftritt. Der Musikpädagoge Hartmann (1983) gibt in diesem Zusammenhang den Hinweis auf eine Optimierungskurve für die Leistung in Abhängigkeit vom Niveau der motivationalen Erregtheit, die 1908 von Yerkes und Dodson aufgestellt wurde. Aus diesen Gründen unterscheiden mehrere Autoren (Plaut 1990, Schröder und Liebelt 1999, Möller 1999) begrifflich zwischen Lampenfieber einerseits und Podiums- oder Aufführungsangst andererseits. Dabei wird ersteres als physiologische Bereitstellungsreaktion qualifiziert, unter der ein Optimum an Leistung zu erwarten ist, während letztere durch übermäßige Erregung zu Leistungseinbußen führt, subjektiv als hochgradig belastend erlebt wird und objektiv die Gesundheit beeinträchtigen kann.
2. Phänomene
Im Vorfeld der Aufführung kommt es bei vielen Bühnenkünstlern zu Stimmungsschwankungen, zunehmender Kränkbarkeit, Gereiztheit und Störungen der zwischenmenschlichen Beziehungen. Am Ende kann der „Wahngedanke“ auftauchen, das Publikum komme, um den Künstler verheerend zu erniedrigen (Kaplan 1969). Im Zusammenhang damit herrscht ein Wechsel „zwischen Phantasien über die Großartigkeit, andere zu begeistern, und den Befürchtungen, den eigenen Anforderungen und den Erwartungen anderer nicht entsprechen zu können.“ (Möller 1999)
Die Erscheinungen im Zusammenhang mit Aufführungsangst i.e.S. lassen sich nach Möller (1999) in drei Symptomkomplexe einteilen: Blockade, Depersonalisation und psychosomatische Begleitreaktionen.
„Die Blockade löst ein Gefühl aus, als seien alle sorgfältig geprobten Stellen ausgelöscht und als sei die Kontrolle über die eigenen gestalterischen Fähigkeiten einschließlich der des Gedächtnisses, der Wahrnehmung und der Bewegung nicht mehr voll verfügbar.“ (Möller 1999, S. 34) Unter diese Kategorie ist die Sorge, bei der Aufführung unter den sonst vorhandenen eigenen interpretatorischen Möglichkeiten zu bleiben, ebenso zu subsumieren wie die Angst, sich nicht mehr konzentrieren zu können, steckenzubleiben, den Faden zu verlieren oder sonstige grobe Fehlleistungen zu produzieren und sich dadurch zu blamieren. Auch wird gelegentlich ein Grübelzwang vor Aufführungen berichtet (Gabbard 1983).
Frau C., eine Sängerin, gibt z.B. in der Anamnese an: „Vor dem Einschlafen kam mir das plötzlich in den Kopf, das Ereignis. Es ergab sich eine Gedankenkette, die ließ sich nicht abstellen, bei aller Gegenwehr. Das hat sich von Nacht zu Nacht gesteigert.“
So bezieht sich der befürchtete Kontrollverlust nicht nur auf die bei der Aufführung geforderte Funktion, sondern er wird schon im Vorfeld gegenüber der Symptomatik erlebt, was regelhaft ibs. im Hinblick auf die psychovegetativen Begleitreaktionen gilt. Hierzu Frau C.: „Da wirst du das einfach nicht los, beim besten Willen nicht.“
Depersonalisation „wird meist als Spaltung zwischen einem funktionierenden und einem beobachtenden Selbst mit besonderer räumlicher Desorientierung erlebt. Das beobachtende Selbst nimmt das funktionierende Selbst räumlich distanziert wahr, als agierte es mechanisch vor einem Publikum, das ebenfalls als ganz entfernt wahrgenommen wird. Aspekte des Körperbildes und physiologische Funktionen, die sonst vorbewußt sind, kommen zu Bewußtsein und fühlen sich überwältigend nah an.“ (Kaplan 1969, S. 64, eigene Übers.)
So berichtet Herr H., ein Sänger, von seinem zweiten solistischen Auftritt: „Als ich nach vorne ging, war es mir, als könnte ich mir von schräg oben zusehen. Dann sah ich mich da stehen, hörte mir beim Singen zu und kommentierte das innerlich: >Bei dem kommen ja ganz schöne Töne raus!<“
Zusätzlich zu diesen mentalen Phänomenen treten somatische Begleiterscheinungen auf, die grundsätzlich objektivierbar sind wie Erhöhung der Pulsfrequenz, vermehrtes Schwitzen, Schlafstörungen oder Änderungen der Körpertemperatur. Diese Erscheinungen können allgemein als stereotype vegetative Streßreaktion i.S. einer Fluchtreaktion aufgefaßt werden (Lang 1999). Vorzugsweise treten sie in den Körperteilen auf, welche beim jeweiligen Auftritt als wichtig empfunden werden.: z.B. spürt der Bläser Trockenheit im Munde, während dem Streicher bei einem langen Ton der bogenführende Arm zittert.
Dementsprechend sagt Frau C., die Sängerin: „Das ganze Zwerchfell zieht sich zusammen, die ganze Atmung zieht sich so hoch, daß ich nicht mehr loslassen kann.“
3. Annäherung an die Phänomene aus psychoanalytischer Sicht
3.1. Die Bedeutung des Ich
Das Ich als Stätte der Angst und als Organisator der verschiedenen Formen ihrer Abwehr unter den Ansprüchen der anderen intrapsychischen Instanzen einerseits und der Außenwelt andererseits steht hier notwendig stets im Zentrum des Geschehens. Hinzu kommt die essentielle Bedeutung von Ich-Funktionen wie Affekttoleranz, Impulskontrolle und immer wieder auch Frustrationstoleranz bei Auftritten und im Umfeld davon. Die differenzierteste Wahrnehmung und die nüancierteste Kontrolle der Motorik wird bei allen Bühnenkünstlern vorausgesetzt. Jegliches Spiel kann zudem nur als solches gelingen, wenn die Realitätskontrolle jederzeit verfügbar ist. Vorträge auf wissenschaftlicher oder politischer Szene erfordern neben souveräner Beherrschung des Themas rhetorische Fertigkeiten, die in mancher Hinsicht den Anforderungen an Schauspieler vergleichbar sind. Es ist müßig, diese Selbstverständlichkeiten hier zu verbreitern und durch Beispiele zu belegen. So wäre es problematisch, die ich-psychologischen Aspekte aus den folgenden Kapiteln herauszulösen, diese verlören dadurch gewissermaßen ihr Rückgrat. Auch findet sich in der Literatur keine psychoanalytische Arbeit zum Thema, die darauf eindeutig fokussiert. Daher soll die Bedeutung der ichpsychologischen Aspekte an dieser Stelle zwar hervorgehoben werden, ihre Abhandlung aber gleichwohl implizit im Rahmen der folgenden Kapitel erfolgen. Deren Gliederung erfolgt nach dem Schwerpunkt, den die jeweils zitierte Arbeit setzt.
3.2. Triebpsychologische Aspekte
Fenichel (1946) nähert sich dem Thema mit dem Ansatz: „Das Lampenfieber tritt auf, wenn die unbewußten Motive des Schauspielers bewußt zu werden drohen (wenn das >Spiel< Wirklichkeit zu werden droht).“ (S. 404) Diese sind nach seiner Anschauung zusammengefaßt folgende: Der Partialtrieb, welcher der Schauspielkunst zugrundeliegt, ist der Exhibitionismus. Schauspieler haben nach Fenichel (1946) dreierlei Befriedigung bei ihrer Arbeit: 1.) eine erogene, die aber minimal bleibt, 2.) eine narzißtische durch den Applaus, der benötigt wird, „wie ein Säugling Milch und Liebe braucht“ (S. 394) (was die Abhängigkeit vom Publikum deutlich macht), 3.) eine weitere narzißtische Befriedigung durch magische, machtvolle Einflußnahme auf das Publikum, um sich der eigenen Überlegenheit zu versichern und damit Angst zu bannen, vermutlich die vor Kastration, aber auch zur Verleugnung der Abhängigkeit. (So sind Wunscherfüllung und Abwehr bereits aufs engste miteinander verknüpft.) Dieses Motiv der angestrebten Kontrolle durch magische Bemächtigung gilt auch im Hinblick auf die gespielte Rolle. Denn ein Schauspieler verfolgt dabei unbewußt dieselben Ziele wie ein Kind, das spielend übt, die Außenwelt zu beherrschen, indem es aktiv rein-szeniert, was es sonst passiv erlebt, und indem es Zeitpunkt und Quantität, mit der eine Spannung auftritt, selbst bestimmt und sie dann z.T. im Spiel abreagiert. Im Spiel identifiziert sich der Schauspieler probeweise mit phantasierten Möglichkeiten eigener Entwicklung wie ein Priester in seinem Amt sich mit Gott identifiziert. Insofern das Dargestellte unbewußte Triebwünsche repräsentiert, ermäßigt er seine dadurch bedingten Schuldgefühle, indem er das Publikum zur Teilnahme an der Schuld und im Applaus zur Billigung bewegt. Bei tragischem Ausgang wird wie bei religiösen Riten die Hoffnung auf Erlösung nach vollzogener Strafe mobilisiert, während durch Witz, Groteske und Clownerie latent das Publikum kastriert werden soll, um die Gefahr der eigenen Kastration zu verleugnen, worauf die exhibitionistische Handlung als ganze grundsätzlich immer zielt. Neben dieser ödipalen Ebene gibt es auch ein orale: Der Schauspieler hat die Phantasie, das Publikum zu nähren, latent darunter aber auch den Wunsch, es mit der „Milch“ seines Applauses zu verschlingen. Die mit der Aufführung verbundene Angst bezieht sich vor diesem Hintergrund zum einen darauf, daß das Spiel außer Kontrolle geraten und die magische Beeinflussung des Publikums konkret werden könnte, umgekehrt zum andern, daß es nicht an der Schuld des Künstlers teilnehmen sondern sich mit seinem strafenden Über-Ich identifizieren könnte. Seine Angst hat zudem die Qualität der Scham, enttarnt zu werden erstens im eigenen Kastriertsein, zweitens in den eigenen sexuellen, aggressiven und narzißtischen Motiven, drittens in seiner Abhängigkeit vom Publikum.
Auch Freundlich (1968) hebt darauf ab, daß hinter dem Lampenfieber die Angst des Künstlers steht, daß seine Omnipotenzphantasien und seine narzißtischen Entäußerungen als solche von einem Publikum aufgedeckt werden, das entsprechende Wünsche auch hegt. Eine gelungene Aufführung bedeutet vor dem Hintergrund, daß auf das Publikum Motive der ödipalen Rivalität mit dem konkurrierenden Elternteil oder mit Geschwistern übertragen werden, auf unbewußter Ebene eine Erfüllung destruktiver Wünsche. Der Künstler fürchtet daher, daß sein Erfolg beim Publikum zu Eifersucht und Vergeltungswünschen führt.
Bergler (1949) verwirft die Hypothese, Schauspielerei sei im letzten Grunde durch den exhibitionistischen Partialtrieb motiviert, als naiv. Nach seiner Auffassung liegt ihr vielmehr Skopophilie zugrunde, die bereits eine sekundär auf das Objekt verschobene narzißtische Schaulust am eigenen Körper darstellt. Diese auf die Beobachtung der Eltern zielende Skopophilie wird auf ein erstes Über-Ich-Verbot hin vom Aktiven ins Passive gewandt, d.h. durch die Begierde ersetzt, angeschaut zu werden. In einem nächsten Schritt verbietet das Über-Ich auch den exhibitionistischen Wunsch, der in einem weiteren Abwehrschritt desexualisiert im Wunsch, anderen im Schauspiel eine Freude zu bereiten, sublimiert wird. In der Identifikation mit den Zuschauern befriedigt der Schauspieler den auf diese verschobenen ganz ursprünglichen Wunsch, Voyeur seiner selbst zu sein. Er stellt Charaktere dar, für die nicht er sondern der Autor die Verantwortung trägt. So wird aus dem kleinen Voyeur ein großer Exhibitionist, der sagen kann: „Ich bin nicht schuldig, es ist nur ein Spiel!“ und: „Die anderen spannen, ich nicht!“ Denn Exhibitionismus wird als das ungleich geringere Vergehen erlebt. Bühnenangst ist daher nur vordergründig die Angst vor einer exhibitionistischen Niederlage. Dahinter steht die Angst, als Vergeltung für den Voyeurismus verhungern zu müssen, verschlungen, vergiftet, erstickt, zerstückelt, ausgesaugt oder kastriert zu werden. Als Beleg für diese Ableitungen beruft sich Bergler (1949) auf Material aus seiner klinischen Erfahrung mit zahlreichen Schauspielern, bei denen die Analyse regelhaft aufdeckte, daß sie als Kinder sexueller Handlungen zwischen Erwachsenen gewahr wurden und dies als traumatisierend erlebten.
Gabbard (1979) will seine Ausführungen zum Problem der Angst vor dem Auftritt nicht auf Bühnenkünstler beschränken, da es sich nach seiner Erfahrung um ein allgemein menschliches Phänomen handelt. Es werden nach seiner Auffassung im Zusammenhang damit Kernkonflikte auf verschiedenen Ebenen der psychosexuellen Entwicklung aktualisiert. Er weist darauf hin, daß die von Mayman definierte „Schampersönlichkeit“ Züge trägt, die auch das Erleben und die Dynamik von Menschen mit Auftrittsangst kennzeichnet: Auf bewußter Ebene bestehen hier eine ständige Sensibilisierung für Zuschauer oder Zuhörer, vor denen man sich unsicher fühlt und eine Überbesetzung der für andere wahrnehmbaren Teile des Selbst mit dem Gefühl, entblößt und der Wahrnehmung durch andere ausgeliefert zu sein. Verdrängt dahinter lebt die Erinnerung an die Erheiterung durch die eigene Nacktheit als Kind, dahinter wieder im Kern oft die Scham über die lächerliche Unzulänglichkeit des stolz gezeigten Genitales und die Furcht, als Großtuer entlarvt zu werden. Dazu kommen phallisch-urethrale Ängste, in demütigender Weise die Selbstkontrolle zu verlieren. Hierbei wird sexuelle oder emotionale Entladung mit dem Verlust der Kontrolle über Blase oder Mastdarm gleichgesetzt. Die Furcht, bei der Aufführung blockiert zu sein oder einen groben Patzer zu machen, ist damit verknüpft.
So kommt es nach eigener Erfahrung zumindest unter Musikstudenten immer wieder vor, daß in Proben dem Mund dessen, dem ein hörbarer Fehler unterläuft, zusätzlich noch der Ruf: „ Scheiße!“ entfährt.
In einem weiteren Argumentationsstrang führt Gabbard (1979) aus, daß in allen Kulturen Exhibitionismus und Skopophilie tabuisiert sind, am strengsten jeweils in der Eltern-Kind-Beziehung, weshalb z.B. nach mancher Erfahrung Podiumsangst bei Auftritten vor den Eltern am heftigsten ist. Zudem wird über das Zeigen der Genitalien bei manchen Tierarten, v.a. unter Affen, die Rangordnung von Dominanz und Unterwerfung geregelt. Das Exhibieren ist dort ein aggressiver, Unterwerfung heischender Akt. Dieses biologisch verankerte Motiv könnte auch beim Menschen unter Umständen im Zusammenhang mit dem Sichzeigen wieder wachgerufen werden und zu einem Schuldkomplex führen. Ein weiteres Moment, das zu Schuldgefühl und Angst vor Strafe führen kann, ist der aggressive, omnipotente Wunsch, das Publikum zu manipulieren. Schließlich kann die Phantasie, mit dem Triumph der Aufführung einen ödipalen oder Geschwisterrivalen zu vernichten, ödipales Schuldgefühl hervorrufen (Gabbard 1983). In all diesen Fällen würde dann bei Aufführungsangst das Publikum als strafender Vater wahrgenommen.
Hierzu seien einige Illustrationen aus der Anamnese von Frau C. angeführt: Die ödipale Rivalität mit der Mutter verschiebt sie auf die Kinderfreundin Rita. Als Frau C. auf deren Hochzeit singt, hat sie bereits im Vorfeld Kehlkopf- und Luftröhrenentzündung sowie heftigste Angst bis zur Panik. Den Auftritt erlebt sie dann als einen Kampf auf Leben und Tod: „Ich habe um mein Leben gesungen... Ich habe sie an die Wand geklatscht, ich habe sie an die Wand gespielt mit meinem Spielvermögen. Am nächsten Tag bin ich total tot nach Hause gefahren.“ Neid auf die Konkurrentinnen, der unter dem Diktat des Über-Ich gegen das Selbst gekehrt wird, ist auch eine wesentliche Komponente bei den in ihren Auswirkungen destruktiven körperbezogenen Symptomen beim Vorsingen. Die zuvor und dabei empfundene Angst ist hier als Signalangst aufzufassen, was für mörderische Folgen der Neid hätte, steuerte er ungebremst das Handeln, und welch grausame Vergeltung sie dann dafür vom mächtigen Vater zu erwarten hätte. So beginnt die panische Angst einmal auf dem Weg zum Vorsingen beim Anblick eines Friedhofs. Das Motiv, sich beim Singen der Zuhörer zu bemächtigen, wird deutlich, wenn Frau C. annimmt, die sie beurteilenden Juroren erwarten, „daß du sie zum Zuhören zwingst“.
Greenson (1967) weist auf die hohe Prävalenz von Lampenfieber unter Psychoanalytikern und auf die damit korrespondierende Neigung zum berufstypischen Versagungs-Incognito-Verhalten hin. Er vermutet, daß dadurch verdrängte exhibitionistische Impulse und eine generalisierte Aggressivierung des Schauens und Gesehenwerdens verdeckt werden. Die Tatsache, daß nur eine relativ bescheidene Zahl psychoanalytischer Veröffentlichungen zum hier behandelten doch sehr weit verbreiteten Phänomenkomplex Stellung nimmt, könnte die Argumentation von Greenson (1967) stützen. Denn eine tiefere Diskussion des Themas brächte immer auch die Gefahr mit sich, als Autor in die Nähe einer Selbstoffenbarung zu geraten, die bei der spezifischen Scheu, sich zu präsentieren, gerade besonders gefürchtet würde.
3.3. Objektbeziehungspsychologische Aspekte
Kaplan (1969) stellt die These auf, daß die Kunst allgemein und das Theater im besonderen Entwicklungsstadien des Individuums von der Geburt bis zur Reife zelebriert. Stellvertretend für das Publikum setzt sich der Künstler beim Auftritt mit seinem Lampenfieber als einem Aspekt wiederbelebter ungelöster Themen seiner Entwicklung auseinander, die aber ebenso die von vielen Individuen aus dem Publikum sind. Dieses nimmt daher daran Anteil als an einer erneuten Möglichkeit, diese Themen zu lösen. Angst definiert Kaplan als Signal dafür, daß die Bedingungen verletzt sind, welche die lebenserhaltende Versorgung garantieren. Die Einschätzung, was zum Überleben notwendig ist und damit die entsprechende Angst unterliegt einer Entwicklung. Bei deren Darstellung legt Kaplan (1969) den Schwerpunkt auf die Betrachtung des Wechselspiels zwischen Mutter und Kind. Die primäre Angst ist von daher das Mißfallen über den zeitweiligen Verlust des unmittelbar physischen Zusammenspiels mit der Mutter. Dieses zentriert sich am Anfang des Lebens um die Region von Mund und Nase und die Haltung des Körpers, insbesondere des Kopfes, der ja zunächst von der Mutter sorgfältig gestützt werden muß, wenn sie das Kind auf den Arm nimmt. Sicherheit und Unsicherheit in sozialen Situationen offenbaren sich daher als erstes in der Haltung und dem Mienenspiel um Mund und Nase. Eine erste Quelle von Autonomie und Selbstsicherheit ist die Stimulation der perioralen Region mit der eigenen Hand. Bei Unsicherheit im späteren Leben wird dieses Verhalten wiederbelebt. Auch durch eine straffe oder eine betont lässige Körperhaltung kann ein primär unsicherer Mensch sich seiner Unabhängigkeit versichern: „Ich genüge mir selbst und brauche keine Mutter, die mich hält!“ Wer nun auf eine Bühne tritt, ist von dem Moment an nicht so frei, die Haltung selbst zu wählen. Er hat daher auf dem Podium die genannten Möglichkeiten zur Selbstversicherung nicht zur Verfügung. Desto mehr machen viele vor dem Auftritt hinter der Bühne davon Gebrauch, indem sie z.B. stricken, rauchen, die Hände ringen oder auf und ab gehen.
Nach der Betrachtung der Angst vor dem Objektverlust diskutiert Kaplan (1969) dann die Angst vor dem Liebesverlust, die vom Kind erst empfunden werden kann, wenn sein Vermögen zu denken und zu antizipieren soweit gereift ist, daß es einsieht, daß die Mutter ihre Verfügbarkeit an bestimmte Bedingungen knüpft. Angst wird von da an zum Signal dafür, daß das Kind in Gefahr ist, eine dieser Bedingungen zu verletzen. Umgekehrt entsteht Freude, wenn sie erfüllt werden. So kann ein Mensch seiner Mutter zuliebe, die Ängstlichkeit z.B. beim Vater brandmarkt, in kontraphobischer Weise Situationen aufsuchen, die Angst machen. Wenn das Auftreten vor Publikum auf diese Weise motiviert ist, stellt Lampenfieber eine Angst dar, die zum Handeln, das sie auslöst, einlädt und nicht zu dessen Vermeidung führt. Daher werden sich Bühnenkünstler, sofern sie kontraphobisch motiviert sind, mit ihrem Lampenfieber ihr Leben lang auseinandersetzen.
Ein weiterer Argumentationsstrang von Kaplan (1969) bezieht sich auf das künstlerisch begabte Kind, das sich dadurch auszeichnet, daß es die Außenwelt sensibler wahrnimmt und jedem wahrgenommenen Ding zusätzlich zu den banalen weitere symbolische Bedeutungen zuschreibt. Auf diese Weise gewinnt das begabte Kind Alternativen zu den gewöhnlichen Objektbeziehungen und Rückzugsmöglichkeiten daraus, wenn Schwierigkeiten auftreten. So durchläuft es die Entwicklungsstadien schneller, dafür wird der ödipale Konflikt selten ganz gelöst. Es entwickelt leichter als der Durchschnitt zahlreiche sogenannte „Phantome“, d.h. innere Bilder von Menschen, die es mehr probeweise nachahmt als daß es sich tatsächlich mit ihnen identifiziert. So übernimmt es nicht wirklich deren Fähigkeiten sondern mimt sie nur und ist daher in besonderer Weise gefährdet, als Gaukler entlarvt zu werden. Durch diese Pseudo-Identifizierungen gewinnen die Betroffenen neben der bürgerlichen eine künstlerische Identität, die sich durch den kreativen Begabungsdruck in der Realität Raum verschafft. Die Angst vor dem Auftritt, mit dem ja die künstlerische Identität aktualisiert wird, ist vor diesem Hintergrund als Angstsignal vor der Trennung von der in der bürgerlichen Identität verwurzelten Mutter zu verstehen.
Diese Herleitung läßt sich teilweise mit der Geschichte von Frau C. illustrieren: Sie entstammt einem zwanghaft geprägten Elternhaus, in dem bürgerliche Sekundärtugenden in der Wertskala obenan standen und mit erbarmungsloser Rigidität durchgesetzt wurden. Frau C.s musische Begabung wurde früh sichtbar und auch zu einem gewissen Grad gefördert, jedoch bloß als Zierrat des bürgerlichen Hauses und nie in ihrer existentiellen Tragweite anerkannt. Stets wurde ihr die Kinderfreundin Rita, die brav ihren Weg innerhalb der herkömmlichen bürgerlichen Normen ging, als im Gegensatz zu ihr liebenswertes Beispiel vorgehalten.
Plaut (1990) macht in dem Zusammenhang ergänzend darauf aufmerksam, daß ein überdurchschnittlich begabtes Kind aber auch immer wieder Schwierigkeiten hat, von seinen weniger begabten Eltern verstanden zu werden und diesen Umstand oft so interpretiert, daß sie es nicht lieben. Der Antrieb zur schöpferischen Tätigkeit kann dann seine Kraft aus der Erwartung beziehen, die verlorene Liebe durch das schöpferische Werk zurückzugewinnen.
Kaplan (1969) führt im weiteren aus, daß am Beginn der Latenzzeit eine Enttäuschung steht: Das Kind befolgt die Bedingungen, die ihm zum Erhalt der Liebe von den Eltern gesetzt sind und muß doch feststellen, daß diese auch seine nunmehr gereiften Wünsche nicht alle erfüllen. Das begabte Kind kann darauf einen Familienroman ausphantasieren. Dabei werden die Eltern zu Stiefeltern, die das Kind aufzogen, nachdem es früh von seinen guten, wahren, meist aristokratischen Eltern getrennt worden war. Die Geschichte rankt sich um das Wiederfinden des guten Objekts und um das Wiedererlangen des verlorenen privilegierten Standes. Der Familienroman spielt bei Schüchternen, bei Hochstaplern und bei Bühnenkünstlern gleichermaßen eine wesentliche Rolle. Doch Schüchterne, die ja dem Kontakt mit andern aus dem Wege gehen, behalten den Familienroman für sich und haben kein Publikum; Hochstapler haben keines, das um diese ihm zugewiesene Funktion weiß. Nur der Bühnenkünstler, der wie der Hochstapler seinen Familienroman agiert, hat dabei Lampenfieber. Denn er sieht sich Menschen gegenüber, die wissen könnten, daß er diese Rolle spielt. Da aber der Familienroman hochgradig verpönte Elemente beinhaltet, nämlich die Herabsetzung, ja Beseitigung der aktuellen Eltern und das Reklamieren eines privilegierten Standes, entsteht Angst im Hinblick auf sein mögliches Offenbarwerden.
So ist eines der liebsten Lieder für Frau C. schon zu Lebzeiten ihrer Eltern das, in dem R. Schumann die Worte in Töne gesetzt hat: „Aus der Heimat, hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keiner mehr.“
Schließlich bemerkt Kaplan (1969), daß bei einer gelungenen Wechselwirkung zwischen Mutter und Kind sich dessen Angst löst. Analog verschwindet bei einer Wechselseitigkeit im Zusammenwirken („collaborative reciprocity“, S. 82) zwischen Publikum und Künstler augenblicklich dessen Lampenfieber. Das macht einen wesentlichen Faktor für eine gute Aufführung aus, und beide Seiten genießen diese Spannungsreduktion gleichermaßen. Daher wird sich ein guter Bühnenkünstler immer wieder Aufgaben stellen, in denen er Lampenfieber hat.
So empfiehlt Mantel (2001, S. 15) gegen Lampenfieber: „Es ist deshalb zweckmäßig, sich beim Spielen auf dem Podium eine einzelne Person vorzustellen, die entweder real im Konzert anwesend ist oder zumindest sein könnte, für die ich spiele, eine mir wohlgesonnene Person, von der ich weiß, daß sie auf meine Art des Musizierens positiv reagiert. Das kann jemand ganz Fremdes sein, an dessen Mimik und Körpersprache ich bei gelegentlichem Hinschauen den >Resonanzeffekt< ablesen kann.“
Auch Gabbard (1979) zieht zum Verständnis von Aufführungsangst u.a. objektbeziehungspsychologische Momente heran. Ein bedeutsamer Anteil davon besteht danach im Wiedererleben der Angst des Kindes, die es überkommt, wenn es sich als selbständiges Individuum gegen den regressiven Sog der Symbiose behauptet. Im Augenblick, da der Künstler auf die Bühne tritt, wird die schmerzliche Erfahrung reaktualisiert, die er v.a. in der Subphase der Wiederannäherung hatte machen müssen, nämlich da draußen ganz allein auf sich angewiesen zu sein. Manche nehmen diesen Moment vorweg, indem sie sich einige Minuten vor dem Auftritt vom Kontakt mit anderen fernhalten, um nicht erst im Rampenlicht ganz schlagartig auf sich gestellt zu sein.
Die mit der Wiederannäherungskrise verbundene Angst besteht darin, vom Objekt verlassen zu werden oder seine Liebe zu verlieren, wenn man sich von ihm löst. Wenn der Künstler dann draußen auf der Bühne das Publikum als Mutter wahrnimmt, heißt das also, daß er fürchtet, das Publikum verläßt die Vorstellung oder entzieht ihm seine Gunst. Das Glücksmoment bei Aufführungen, bei denen Publikum und Künstler sich eins fühlen und dessen Bühnenangst völlig schwindet, läßt sich aus dieser Perspektive so verstehen, daß dann die „böse“ zurückweisende Mutter durch die „gute“ symbiotische Mutter ersetzt und die Angst vor dem Objektverlust überwunden ist.
Unter einem auf das kollektive Unbewußte gerichteten Blickwinkel argumentiert Hayes (1975) auch letztlich objektbeziehungspsychologisch. Ihr zufolge ist ein öffentlicher Auftritt gleichzusetzen damit, daß ein Individuum sich von der Gruppe separiert, was beim Hordenwesen Mensch den Archetyp des Ausgestoßenen aktualisiert, der als vogelfrei gilt und physischer Vernichtung preisgegeben ist. Sie weist darauf hin, daß Großgruppen als Zuhörer sich tatsächlich manchmal offen entwertend verhalten (z.B. mit Buhrufen, lautem Hohnlachen, Zischen etc.), auch wenn sie sich aus Individuen zusammensetzen, von denen jedes für sich viel zu kultiviert wäre, sich einzeln derart zu entäußern. So ist immer auch Realangst im Lampenfieber enthalten. Die Bedrohung schwindet und mit ihr die Angst vor dem Auftritt, wenn der Ausführende den Archetyp des anerkannten Führers aktualisiert, der die Horde z.B. zu den besten Weidegründen leitet und sich so nicht im eigenen Interesse sondern in dem der Gemeinschaft hervortut. So kommt er mit einer wertvollen Gabe zur Gruppe, und es entsteht eine wechselseitige Verbindung zwischen dem Gesamt der Horde und dem Einen, der dann nicht länger der Ausgestoßene ist.
In entsprechender Weise hat es sich der oben bereits erwähnte Herr H. zur Angewohnheit gemacht, sich unmittelbar vor dem Auftritt darauf zu besinnen, daß er dem Publikum nicht sich sondern ein kostbares Werk präsentiert und selbst nur das Instrument ist, durch das die Musik hindurchtönt, womit er sein Lampenfieber in der Regel überwindet.
Bei der Diskussion der Depersonalisation, die ja bei Podiumsangst immer wieder auftritt, weist Stolorow (1979) unter dem klassischen Gesichtspunkt auf ihre „unheimliche“ Qualität hin und führt an, daß Freud Gefühle des Unheimlichen der Wiederkehr verdrängter infantiler Konflikte zuschreibt und weiterhin feststellt, daß Depersonalisation und Derealisation der Abwehr dessen dienen, was verbotene infantile Strebungen reaktivieren könnte. Depersonalisation beinhaltet eine Spaltung der Selbstrepräsentanz in einen im Geschehen verbleibenden und einen beobachtenden Teil im Dienste der Abwehr eines schweren innerseelischen Konflikts. Die abzuwehrenden Impulse und die Gefahrensituation werden dem im Geschehen verbleibenden Teil zugeschrieben, welcher als entfremdet wahrgenommen wird. So fühlt der davon Betroffene tatsächlich keine Angst wegen der Depersonalisation, vielmehr fühlt er sich depersonalisiert, weil er eine angsterregende Situation abwehren will. Nimmt man den objektbeziehungspsychologischen Aspekt hinzu, besteht die Funktion der Depersonalisation beim Bühnenauftritt in dem Zusammenhang darin, daß sich das „gute“ Selbst von dem „bösen“, sich autonom gebenden Selbst und dem „bösen“, den Schritt in die Autonomie mißbilligenden Objekt, dem Publikum, auf sichere Distanz begibt. Andererseits identifiziert er sich aber auch gleichzeitig mit diesem Mutterobjekt insofern, als er sein eigener Zuschauer wird, und mindert auch durch dieses Einswerden seine Trennungsangst.
Als Illustration hierzu mag wieder Herr H. dienen. Tatsächlich verspürte er bei dem geschilderten Depersonalisationserleben keine Angst, vielmehr so etwas wie Verwunderung. Der reaktivierte infantile Konflikt bestand bei ihm darin, daß er einerseits in intimer Situation allein mit der Mutter von ihr immer wieder zum Singen ermuntert und am Klavier beifällig begleitet worden war, während sie ihn sonst bei allen Äußerungen seiner natürlichen Expansivität und Expressivität besonders in der Öffentlichkeit rasch ausschimpfte, er solle sich „nicht so aufführen“.
König (1981) weist darauf hin, daß speziell das Publikum, also die Gruppe, Übertragungsauslöser für eine Mutterfigur ist, da viele Bühnenkünstler bei Proben auch vor sachkundigen und kritischen Menschen wie Regisseur oder Kollegen kein Lampenfieber haben. Er führt dann hier bereits weitgehend diskutierte Hintergründe von Lampenfieber an, nämlich die Angst, sich vor der Mutter phallisch-exhibitionistisch darzustellen, die Angst vor dem Offenbarwerden aggressiver Impulse und die Angst, sich aus der Symbiose mit dem Mutterobjekt Gruppe heraus zu profilieren und ihr, dem Sog zur Verschmelzung mit ihr widerstehend, als Individuum entgegenzutreten. Die Auffassung von Lampenfieber als Ausdruck einer mangelnden Kompetenz im Umgang mit den entsprechenden Impulsen fügt er als ich-psychologischen Gesichtspunkt hinzu.
Aus der Arbeit von Plaut (1990) ist hier als zusätzlicher Gesichtspunkt zu referieren, daß Künstler notwendig in einen Konflikt geraten: Als Schöpfer von Neuem übertreten sie bestehende Normen und separieren sich so als Außenseiter von der Gruppe, wodurch sie verletzlich werden. Dies ist aber andererseits etwas, was das Publikum notwendig von ihnen verlangt. So erwartet man selbst von reproduzierenden Künstlern, daß sie mit neuen Aspekten auch bereits vertrauter Werke das Publikum aufhorchen lassen und in irgendeiner Weise Originalität ins Spiel bringen. Dem kommt in der Biographie der Künstler oft entgegen, daß sie hofften, nur mit Hilfe ihrer außergewöhnlichen Begabung die Liebe ihrer Eltern zurückzugewinnen, die sie vermißten. So finden sie sich in einem unausweichlichen Dilemma konträrer Anforderungen, angepaßt zu sein, um nicht z.B sich wegen übermäßigen Stolzes schuldig zu fühlen, und doch zugleich immer von Neuem das außergewöhnliche Talent unter Beweis zu stellen.
In seiner Übersichtsarbeit subsumiert Hoffmann (1999) Lampenfieber unter die sozialen Phobien. Er hebt den bindungstheoretischen Aspekt hervor. Demzufolge muß das Individuum erst die notwendige Sicherheit in der Befriedigung seiner Bindungsbedürfnisse erlangt haben, ehe die Dominanz des Motivationssystems Bindung durch die Dominanz des Motivationssystems Neugier abgelöst werden kann. Irritationen dieser Entwicklung können zu zahlreichen Symptomen führen, und es gibt Hinweise dafür, daß darunter auch die sozialen Phobien sind. Rückübersetzt in die Sprache der Objektbeziehungstheorie könnte dies eine Bestätigung der von Gabbard (1979) reklamierten Bedeutung der Wiederannäherungskrise und ihrer Lösung für das spätere Auftreten von Aufführungsangst sein.
Weiterhin führt Hoffmann (1999) aus, daß nach seiner Erfahrung phobische Ängste oft über per se nicht konflikthafte Erlebnisse wie den Tiefblick aus großer Höhe oder das Eingezwängtsein in einen engen Raum gleichsam als „physiologische Verunsicherung“ ausgelöst werden. Erst sekundär würden damit im einen Fall konflikthafte Phantasien verknüpft, die im Unbewußten bereitliegen und psychodynamisch zu beschreiben sind, oder aber im anderen Fall im Sinne von Freuds Konzept der Aktualneurose bei entsprechender physiologischer Prädisposition unmittelbar bestimmte neurobiologische Funktionsmuster aktiviert, deren psychisches Korrelat Angst ist. Verbinden wir diesen Ansatz mit der These von Hayes (1975), der zufolge der Auftritt gleichzusetzen ist mit dem Heraustreten aus dem Rudel, was für das ursprüngliche Hordenwesen Mensch von Natur aus in seinem kollektiven Gedächtnis mit Bedrohung assoziiert ist, so wird die eben referierte Argumentation auch für die Erklärung von Lampenfieber nachvollziehbar, zumindest in der Variante, in der sie noch die sekundäre Verknüpfung mit unbewußtem konflikthaftem Material einbezieht. Allerdings ist zu fragen, ob es nicht doch wiederum konflikthafte Momente sind, die ein Individuum veranlassen, die Situation aufzusuchen, welche die „physiologische Verunsicherung“ mit sich bringt. Das mag beim Benutzen eines Fahrstuhls weniger wahrscheinlich sein, bei der Besteigung eines Berges auf ausgesetztem Pfad oder eines Konzertpodiums hingegen schon eher.
3.4. Selbstpsychologische Aspekte
Offenkundig ist, daß das Selbstwertgefühl von Menschen, die etwas vortragen, bei der Aufführung auf dem Spiel steht. Mehrere Autoren, die sich bei ihrer Beschäftigung mit Aufführungsangst darauf beschränken, die bewußten Phänomene in empirischen Studien zu untersuchen, erwähnen das. Aus spezifisch psychoanalytischer Sicht spricht bereits Ferenczi (1923) im Hinblick auf Lampenfieber davon, daß Bühnenkünstler von der eigenen Stimme oder andern Funktionen in narzißtischer Weise beim Auftritt berauscht sind und benennt den Umstand, daß für die Betroffenen dann der Gegenstand der Aufführung gegenüber der Beschäftigung mit dem eigenen Verhalten ganz in den Hintergrund tritt. Kohut (1972) verdanken wir den Hinweis, daß schon Kleist in seinem Aufsatz „über das Marionettentheater“ 1810 ein Beispiel dafür angegeben hat, wie die bewußte Beschäftigung mit einer Geste in der Absicht, diese graziös werden zu lassen, deren natürliche Anmut verschwinden läßt, so daß die vormals flüssige Bewegung plump wird und sich im Betroffenen eine tiefe Verunsicherung breit macht. Hier sei der ergänzende Hinweis angebracht, daß die englische Sprache für unser Wortfeld „unsicher, befangen“ den Begriff „self-conscious“ kennt. In dem Zusammenhang läßt sich anfügen, daß Sandgren (1998) in der Diskussion zu ihrem Vortrag über Ergebnisse ihrer Interviews mit einem nennenswerten Teil der schwedischen Opernsängerinnen und -Sänger berichtet hat, daß die erfolgreichsten Künstler am wenigsten narzißtische Merkmale in ihrer Persönlichkeitsstruktur aufweisen. Freilich wäre hier zu prüfen, ob vielleicht nur die narzißtischen Persönlichkeitszüge zurücktreten, sobald der persönliche Erfolg fraglos ist, oder ob dauerhafter Erfolg auf der Bühne tatsächlich besser zu erreichen ist, wenn Künstler sich in den Dienst ihrer Kunst stellen, als wenn sie die Kunst in den Dienst ihres als defizient erlebten Selbst stellen.
Die Schamangst wird von Schorn (1999) ganz in den Mittelpunkt ihrer Auffassung von Lampenfieber und Aufführungsangst gerückt. Dabei erwähnt sie zwar den triebpsychologischen Aspekt, der im Wunsch angesehen zu werden, seinen Niederschlag findet, betont aber eher den narzißtischen Wunsch, ansehnlich zu sein. Mit Wurmser spricht sie von der Zweischichtigkeit der Scham in dem Sinne, daß Schamangst hervorgerufen wird einerseits durch die bloße Tatsache, daß man sich selbst bei dem Auftritt vor Publikum zeigt, anderseits dadurch, was man vorführt. Weiterhin weist sie darauf hin, daß im Zusammenhang mit dem Auftritt widersprüchliche Forderungen des Ich-Ideals aktiviert werden und dadurch Schamkonflikte entstehen können. So mag auf der einen Seite der Anspruch stehen, glänzende Leistungen zu zeigen, auf der anderen Seite kann derselbe Mensch von sich verlangen, bescheiden zu sein. Bemerkenswert ist noch ihr Hinweis, daß der Umstand, daß jemand auftritt, oft Ergebnis einer Reaktionsbildung ist, v.a. dann, wenn dabei vorzugsweise etwas gezeigt wird, das in der jeweiligen Gesellschaft als anstößig gilt: Durch die „Wurschtigkeit“ oder Unverschämtheit wird die latent vorhandene heftige Scham abgewehrt. Die dabei empfundene Angst ist in diesem Fall die vor den real zu befürchtenden beschämenden Reaktionen des Publikums, die freilich dann auf neurotischem Wege im Sinne einer projektiven Identifizierung provoziert wären.
Ausführlich setzt sich vornehmlich Gabbard (1983) mit den selbstpsychologischen Aspekten des Themas auseinander. Er stellt heraus, daß im Zusammenhang mit der Aufführung die narzißtische Entwicklungsthematik wiederbelebt wird. Wie eine Persönlichkeit mit Verlangen nach Spiegelung („mirror-hungry personality“ nach Kohut und Wolf 1978) unablässig auf der Suche nach einem Selbstobjekt ist, das ihr inneres Defizit füllt und sie in die selige Ganzheit des narzißtischen Urzustands versetzt und das sie unabdingbar benötigt, um ein ausgeglichenes Selbstwertgefühl zu erhalten, genauso suchen viele Bühnenkünstler den Applaus als ein für das seelische Überleben unerläßliches Agens, das nicht internalisiert werden kann. So müssen sie trotz ihrer Verzweiflung über ihre Not, sich darzustellen und ungeachtet ihrer manchmal schweren Bühnenangst und Scham immer wieder versuchen, neue Selbstobjekte zu finden, deren Aufmerksamkeit und Anerkennung sie herbeizuführen trachten. Dabei sind manche Künstler überzeugt, daß ihr Vortrag völlig makellos sein muß, um angenommen zu werden. Dahinter steht nach der Erfahrung des Autors in der Genese oft, daß die Mutter den späteren Künstler ihrerseits als Selbstobjekt gebraucht und bei seinen frühen Loslösungsversuchen nur dann bestätigt hat, wenn er diese exakt nach ihren Vorstellungen vollzog.
Unter diesem Aspekt kann man auch den Teil der Aufführungsangst, den Mantel (2001) der Angst vor dem Fehler zuschreibt, wie sie in einer völligen Unterwerfung des Schülers unter die Definitionsgewalt der einzig „richtigen“ Interpretation durch den Lehrer gründet, folgendermaßen verstehen: Der Schüler entwickelt nicht seine eigene künstlerische Identität, indem er eigene Versionen der Interpretation im Dialog mit dem Lehrer erarbeitet und in ihrer Stimmigkeit zunehmend selbst verantwortet, sondern er patzt und zeigt durch seine Fehlleistung im Abweichen von der rigide vorgegebenen Spielweise analen Trotz. Die hierdurch aktualisierten Impulse des Über-Ich werden im Sinne einer Angst vor der antizipierten Strafe erlebbar.
Auch Arcier (1997) spricht von einem übersteigerten Ideal, das oft dadurch entsteht, daß die Eltern ihr Kind anregen, daß es sich selbst übertreffen soll. Das Starsystem, das der Gesellschaft immanent ist und von den Medien getragen wird, greift dieses Motiv auf, löst die Eltern ab und „wird zum künstlichen Über-Ich, zum Identitätsköder ... Der Künstler wird versuchen, dem durch die Medien geschaffenen Image zu entsprechen, das nicht mehr sein Selbstbild ist“ (S. 92) und spaltet sich auf in ein „reales Ich“ und ein „Image-Ich“. (Meines Erachtens müßte es besser reales bzw. Image- Selbst heißen.) Je höher ein Künstler in der Erfolgsskala steigt, umso mehr tritt nach Arcier (1997) das „Image-Ich“ in den Vordergrund, umso abhängiger wird er in seiner psychischen Existenz vom Erhalt seines Erfolgs und umso mehr Angst muß er haben, von den erreichten Höhen abzustürzen wie Ikarus, der mit seinen selbst verfertigten Flügeln der Sonne zu nahe kam.
Das Ergebnis einer empirischen Studie von Kirchner (2003) an Pianisten mit Auftrittsangst zeigt, daß diese das Selbstvertrauen der Probanden unterminiert. Deren Identität ist davon affiziert, wie sie sich selbst sehen und wie sie meinen, daß andere auf sie blicken. In psychoanalytische Terminologie übersetzt, ist auch damit die zentrale Rolle des Ich-Ideals bei der Entstehung von Auftrittsangst erwiesen.
Illustrierend läßt sich hierzu anführen, daß Gabbard (1983) von einem Geiger berichtet, der meinte, wenn seine Aufführung schlecht wäre, sei er als ganzer Mensch schlecht. Schließlich genügte ihm bloßer donnernder Beifall nicht mehr als Versicherung dafür, daß er annehmbar ist. Daher gestaltete er seine Programme so, daß er am Ende oft stehende Ovationen erhielt, für ihn die einzige Bestätigung dafür, daß er liebenswert war.
Wäre dies ein Beispiel für eine Spiegelübertragung auf das Auditorium, gibt es auch den Fall, daß im Sinne einer idealisierenden Übertragung der Bühnenkünstler in der Aufführung die beglückende Verschmelzung mit der idealisierten Elternimago, d.h. dem Publikum sucht, mit anderen Worten also eine idealisierende Übertragung auf die Zuhörer etabliert (Gabbard 1983). Darauf, daß dieses Bedürfnis nach symbiotischer Fusion umgekehrt auch für die Rezipienten zumindest bestimmter Musikgattungen wie Beat oder Wagner-Opern gilt, hat Reister (1990) hingewiesen. So korrespondieren offenbar die Wünsche nach Verschmelzung der Beteiligten einer Aufführung auf beiden Seiten der Rampe zumindest manchmal eng miteinander.
Vor diesem Hintergrund ließe sich dann vielleicht das, was, wie vorhin referiert, unter objektbeziehungstheoretischem Gesichtspunkt von Kaplan (1969) als Wechselseitigkeit im Zusammenwirken („collaborative reciprocity“) zwischen Künstler und Publikum benannt und als angstlösendes Agens gekennzeichnet wurde, in selbstpsychologische Terminologie als Befriedigung der Sehnsucht nach Fusion mit der idealisierten Elternimago übersetzen.
In dialektischem Gegensatz dazu steht die Nähe dieser Thematik der Verschmelzungserlebnisse im Zusammenhang mit Musik zu „la petite mort“ auf dem Höhepunkt der geschlechtlichen Vereinigung mit der damit unbewußt verbundenen Gefahr der Auslöschung des individuellen Selbst. Das Moment, das eben noch als angst lösend bezeichnet wurde, wäre dann angst auslösend. Es wäre an Fallstudien zu prüfen, ob die Bereitschaft zur Bühnenangst auch damit zu tun hat. Einen Hinweis darauf, daß dies zutreffen könnte, gibt eine sehr heftige Angstreaktion von Frau C. beim Anhören der Aufnahme „Officium“ von Jan Garbarek und dem Hilliard-Ensemble, einer meditativen Musik, die bei Menschen, die sich darauf einlassen, einen Zustand sehr tiefer Regression bis hin zu einer symbiotischen Ebene erzeugen kann.
Auftrittsangst erwächst vor dem Hintergrund des Konzepts narzißtischer Übertragung auch aus der Sorge, vom Publikum mit einem Mangel an Empathie, z.B. mit dem Ausdruck von Langeweile, mit Stillschweigen oder mit Buhrufen, zurückgewiesen und am Ende gar verlassen zu werden. Im Zusammenhang damit wäre Depersonalisation als Fragmentation des Selbst zu verstehen, die in dem Moment auftritt, da der Künstler um das Agens bangt, das er zum Erhalt der Integration seines Selbst notwendig braucht.
Ein Teil des hier Beschriebenen läßt sich anhand psychodynamischer Erwägungen zur Anamnese von Frau C. illustrieren. So berichtet sie von einem frühen Mangel an wohlwollender Spiegelung durch die Mutter. Vielmehr erinnert sie von deren Seite ausschließlich Entwertungen. Es gibt Hinweise darauf, daß die Mutter in Frau C. ungelebte Selbstaspekte wie Kreativität und Lebendigkeit bekämpfte, gleichzeitig aber auch im Stillen neidvoll bewunderte und sie so ihrerseits als narzißtisches Selbstobjekt gebrauchte. Stärker scheint dieser Aspekt in Beziehung zum Vater hervorzutreten, einem in seinem beruflichen Streben nach Anerkennung und Geltung selbst schwer gekränkten Mann. Es ist von daher nicht schwer zu verstehen, daß die Podiumsangst sie besonders heftig dann befällt, wenn sie bei Bühnen und Konzertagenturen vorsingt. Denn dort sind die mächtigen Träger der Entscheidung über ihre Existenz, über ihren Wert als Sängerin und, in ihrer Wahrnehmung, damit ebenso über ihren Wert als Person versammelt, die wie die Eltern Höchstleistungen von ihr verlangen und von denen sie von vornherein annimmt, daß sie deren Erwartungen insbesondere im Vergleich mit ihren Mitbewerberinnen ebensowenig gerecht werden kann wie einst denen der Eltern im Vergleich mit Rita.
Versuche, in der für das Selbst äußerst prekären Situation vor der Aufführung die narzißtische Balance zu halten und die Angst zu ermäßigen, sind folgende: Zum einen können Vortragende die Bedeutung des Publikums durch betont lässiges, gleichgültiges Verhalten herunterspielen oder das Publikum im Stillen aktiv entwerten. So sagt Frau C. über die Menschen, die sie beim Vorsingen zu beurteilen hatten: „Ich wehre mich gegen diese Fratzen da unten, diese ausgelutschten Operettenheinis, die meinen, ihre Macht ausleben zu müssen. Die sind nicht zuhörwillig, hocken da und quaken.“ Dem gegenüber stehen Versuche, das bedrohte Selbst aufzuwerten, nämlich durch Erinnerungen an frühere Erfolge oder durch Identifikation mit dem idealisierten Publikum nach dem Schema: „Alle diese hochgradig sachverständigen Menschen sind an diesem denkwürdigen Ort eigens zusammengekommen, um mich zu erleben!“
Eine weitere Möglichkeit, das Selbstwertgefühl in der Aufführungssituation zu stabilisieren (und damit gleichzeitig eine eigene Neidthematik abzuwehren) ist nach Gabbard (1983) die, daß der Künstler dabei selbst den Neid anderer zu erwecken trachtet. Der Preis dafür ist wiederum Angst, dafür von den Neidern gnadenlos verfolgt zu werden. Dies ist der Grund, warum von manchen Künstlern ein Publikum aus Kollegen am meisten gefürchtet wird. Auf diese Weise liegt der bewußten Angst vor Fehlschlägen eine unbewußte Angst vor dem Erfolg zugrunde. Die bislang wenig glanzvolle Karriere von Frau C., der höchst kompetente Musiker mehrfach ihre herausragenden künstlerischen und stimmlichen Qualitäten bescheinigt haben, die aber immer wieder gescheitert ist, wenn es beim Vorsingen um ein Engagement ging, mag diesen Satz vor dem Hintergrund ihrer bereits dargestellten Neidthematik hier belegen.
In der Nähe der Angst vor den Folgen des Neides steht nach Gabbard (1983) die Furcht des Künstlers, in seiner grenzenlosen Gier nach narzißtischer Bestätigung durch den Beifall des Publikums dieses auszusaugen und zu beschädigen. Diese Angst wird vom Künstler mitunter in der Projektion auf das Auditorium bewußt wahrgenommen, so als wollte dieses ihn verschlingen. So erlebte eine Gesangsstudentin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstruktur voller Angst bei einem ihrer ersten Auftritte, daß Augen der Zuhörer auf Stielen auf sie zukamen, um sie zu verschlingen.
3.5. Der Aspekt von Delophilie und Theatophilie
Im folgenden soll noch skizziert werden, wie das Konzept von Wurmser (1981) zu den Bedürfnissen zu schauen und sich zu zeigen auf das vorliegende Thema angewandt werden könnte. Denn es übergreift die Hauptstränge psychoanalytischer Theorieentwicklung und läßt sich als stringente Zusammenfassung eines großen Teils dessen, was bisher über die Interaktion zwischen Vortragenden und ihren Auditorien aus psychoanalytischer Sicht gesagt wurde, zum Abschluß dieser Ausführungen hier anfügen, auch wenn der Autor selbst zum vorliegenden Thema explizit nicht Stellung nimmt.
Wurmser (1981) konzeptualisiert grundlegend Triebkonflikte in der Zone der perzeptiven und expressiven Interaktion des Einzelnen mit seiner Umgebung. Auf das Schauen bezieht sich der theatophile Partialtrieb. Sein Ursprung sind die perzeptuellen Organe; sein Objekt ist letztlich der idealisierte andere; sein Ziel ist die Verschmelzung mit dem Objekt oder die Machtgewinnung von ihm; sein Modus ist neugierige Aufmerksamkeit; der mit der Trieberfüllung einhergehende Affekt ist Bewunderung bis zum Enthusiasmus. So finden sich hier die bereits benannten wesentlichen bewußten und unbewußten Momente, die insbesondere ein Publikum kennzeichnen, offenkundig wieder.
Dialektischer Gegenpart des theatophilen ist der auf das Zeigen gerichtete delophile Partialtrieb. Sein Ursprung sind die expressiven Organe; sein Objekt ist der andere; sein Ziel ist es, dem Objekt machtvoll oder liebevoll mit dem eigenen Größenselbst zu imponieren, es zu faszinieren und / oder es dem Selbst einzuverleiben; sein Modus ist die expressive Kommunikation; die mit der Triebbefriedigung einhergehenden Affekte sind Stolz, Gefühle von Großartigkeit bis hin zu ekstatischem Selbstvertrauen. Es fällt nicht schwer, hier die Motivation zu jeder Art von Auftreten zu finden, sei es nun auf den Bühnen des Theaters oder des Kinos, der Oper oder des Konzerts, des Hörsaals oder des Seminarraums, des Vereinszimmers oder der Kirche, der Politik oder des Sports, der Institution, in der man arbeitet oder der Großfamilie.
Theatophilie und Delophilie entstehen im frühen Dialog des Kindes mit der Mutter gleichzeitig aus einer globalen sensomotorischen Matrix. Damit wäre die alte Diskussion, die in unserem Zusammenhang v.a. von Bergler (1949) geführt wurde, nämlich was von beiden primär ist, müßig. Beide Partialtriebe enthalten gleichermaßen Libido im Sinne des Wunsches nach harmonischer Verschränkung mit dem anderen und Aggression, letztere in ihren Spielarten des Strebens nach Selbstbehauptung, Macht, Angriff und Destruktion. Sie haben jeweils einen aktiven und einen passiven Aspekt: die Delophilie den des aktiven Sichzurschaustellens und den der passiven Bloßstellung, die Theatophilie den der aktiven Neugier und den des passiven Erlebens der Exhibition anderer. Bei allen vier Arten von Sichzeigen und Wahrnehmen bestehen spezifische Gefahren. In unserem Zusammenhang sind dies zum einen Strafen, die das Über-Ich in Vergeltung entsprechender eigener aggressiver Wünsche, den andern zu faszinieren und ihn damit zu überwältigen, verhängt, nämlich in Entfremdung und Blockierung zu erstarren, überwältigt und verschlungen zu werden, andererseits besteht die Gefahr, in Wiederholung früher Frustration im Bedürfnis nach harmonischer Verschränkung mit dem anderen in der Gegenseitigkeit von Mitteilung und Aufmerksamkeit zurückgewiesen zu werden. Wie wir in den vorherigen Abschnitten gesehen haben, sind diese Gefahren wesentliche Quellen der Angst vor dem Auftritt.
4. Therapeutische Gesichtspunkte
Die Mehrzahl der Autoren, die sich vorrangig unter dem Aspekt der Psychotherapie mit Aufführungsangst beschäftigen, stellt Entspannungsverfahren, oft in Verbindung mit (Auto-) Suggestion oder Körperarbeit, sowie kognitiv-behaviorale Ansätze ganz in den Vordergrund.
Bedeutsam ist in dem Zusammenhang das Ergebnis der Arbeit von Liebelt und Schröder (1999). Die Autoren entwickelten, erprobten und evaluierten ein verhaltenstheoretisch fundiertes, Entspannungsverfahren einbeziehendes Gruppeninterventionsprogramm zur Bewältigung von Podiumsangst bei Studierenden der Fachrichtungen Gesang und Instrumentalmusik. Hiervon profitierten die Teilnehmer am meisten, die geringe und mittlere Ausgangswerte von mit Testinstrumenten gemessener Podiumsangst hatten, während die mit stark erhöhten Werten nur wenig Vorteil daraus zogen.
Möglicherweise gestützt auch auf dieses Ergebnis empfiehlt Möller (1999) zur Behandlung von Aufführungsangst ab dem vierten von ihm definierten Schweregrad das psychoanalytische Langzeitverfahren als Therapie der Wahl, während bei allen geringeren Symptomausprägungen die bereits umrissenen nicht konfliktbearbeitenden Maßnahmen ausreichend sein sollen. Als Kriterien für diesen höchsten Schweregrad benennt er eine über Jahre persistierende Symptomatik mit chronifizierten körperlichen Beschwerden und einer nicht mehr erkennbaren auslösenden Situation.
Plaut (1990) hält den verhaltenstherapeutischen Zugang nur in den Fällen für ausreichend, in denen die Aufführungsangst ein weitestgehend isoliertes Symptom darstellt oder wenn das betroffene Individuum nicht introspektionsfähig ist, was nach seiner Erfahrung bei Bühnenkünstlern aber kaum je der Fall ist. Er weist auf die Möglichkeit hin, daß das Symptom eine unerläßliche Abwehrformation gegen eine psychotische Dekompensation ist. Dann sollte zunächst eine ich-stützende Psychotherapie erfolgen, ggf. flankiert von einer Medikation, ehe die Symptomatik angegangen wird. Ferner diskutiert er zwei wichtige Quellen von Widerstand. Die eine ist unbewußter Natur, nämlich die oben bereits beschriebene Angst vor dem Erfolg aufgrund von Über-Ich-Impulsen. Sie richtet sich gegen jede Art von Behandlung, der sich Bühnenkünstler mit psychischen oder körperlichen Störungen unterziehen, welche die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und kann zur negativen therapeutischen Reaktion führen. Die andere besteht in dem weit verbreiteten bewußten Vorurteil, daß die künstlerische Schaffenskraft durch eine Bearbeitung unbewußter Konflikte nachläßt. Tatsächlich hat ja Kreativität mit einem freien Umgang mit Derivaten des Unbewußten zu tun. Plaut (1990) macht aber deutlich, daß dieser gerade durch neurotische Momente oft verstellt wird und im Zuge einer konfliktaufdeckenden Therapie, die gleichzeitig Kompetenzen des Ich stärkt, nicht behindert sondern vielmehr weiter und sicherer wird. Dann fügt er hinzu: „Wieviele große Opern könnten wir haben, wenn Rossinis Unfähigkeit, seine Mutter zu betrauern, angemessen behandelt worden wäre, anstatt daß sie für den Rest seines Lebens zu lähmender Hypochondrie geführt hat?“ (S. 62, eigene Übers.)
Möglicherweise spielen diese Widerstände, welche die Akzeptanz psychoanalytisch begründeter Verfahren nicht nur bei den von Aufführungsangst Betroffenen sondern auch bei den Behandlern beeinträchtigen, eine wichtige Rolle bei dem Umstand, daß die Indikation zur konfliktaufdeckenden Therapie entweder gar nicht oder, wie bei Möller (1999), erst an letzter Stelle in Betracht gezogen wird, wenn die Prognose auch dafür deutlich verschlechtert ist.
Zudem fügen sich verhaltenstherapeutische Ansätze und die Vermittlung von Entspannungstechniken geradezu ideal in das hergebrachte Paradigma der Vermittlung von Musizierpraxis und sind daher an Musikhochschulen zu etablieren, ohne Lehrende und Lernende allzusehr zu befremden. Denn sie beschränken sich im wesentlichen darauf, streng auf Symptomreduktion zielend übend-manipulativ an den Ich-Funktionen der Differenzierung und Steuerung von Affekten und von damit korrespondierenden Kognitionen zu arbeiten. Damit haben sie neben der Stärkung von Selbstwirksamkeit vorzugsweise die unmittelbar symptomrelevanten Ich-Funktionen in Visier, ohne die übrigen Dimensionen des psychischen Raumes zu berücksichtigen, wie sie die psychoanalytischen Teildisziplinen der Lehre jeweils von den Trieben, den Objektbeziehungen und dem Selbst auszuloten versteht. Wenn nun z.B. in dem von Klöppel (2003) vorgestellten Programm trainiert wird, Angstphantasien zu vermeiden und sich die Vorspielsituation zusammen mit positiven Gedanken vorzustellen, paßt dies nahtlos zu Strategien im Gesangs- oder Instrumentalunterricht, die durch Implantation von Imaginationen, welche die Lehrenden vermitteln, ein optimales Ergebnis der technischen Ausführung und des Klanges anstreben. Dementsprechend werden bei diesen Verfahren auch bestgemeinte Ziele normativ vermittelt. Geradezu beispielhaft ist folgende Formulierung der Alexander-Technik-Pädagogin Picht-Axenfeld, zitiert nach Spohr (2003): „Wir sollen die Klänge geben, sie müssen sich von uns ablösen...“ Derartige Anforderungen sind allesamt dazu angetan, die deletären Auswirkungen eines Ich-Ideals, das durch die gewohnte Musikpädagogik und die zunehmend destruktive Konkurrenz im professionellen Betrieb immer höher geschraubt wird, eher noch zu verstärken anstatt sie durch Aufklärung abzuschwächen.
Ein Gegenparadigma hierzu bietet die Psychoanalyse. Sie hat, wie dargestellt, bezogen auf ihre eigene Theoriebildung breit gefächerte, für den Einzelfall damit aber potentiell sehr spezifische Ansätze zur Aufklärung der unbewußten Wurzeln von Aufführungsangst entwickelt, deren therapeutische Wirksamkeit bei der Symptomatik in der praktischen Arbeit belegt ist (Plaut 1990, Kutter und Dettweiler 2003). Sie ermöglichen es, „die hinter den Symptomen verborgenen seelischen Ursachen zu respektieren und zu verstehen und, gleichsam nebenbei, zu beheben.“ (Kutter und Dettweiler, 2003, S. 40) Daher sollte die Indikation zu einer psychoanalytischen oder psychoanalytisch fundierten Behandlung von Anfang an und nicht erst dann geprüft werden, wenn sich die Intervention mit den genannten heutigen nicht konfliktbearbeitenden Standardverfahren als nicht hinreichend wirksam erwiesen hat.
5. Literatur
Arcier A-F (1997) Das Ikarus-Syndrom oder die Krankheiten des Erfolgs. Musikphysiol Musikermed 4:91-94
Bastian HG (1989) Lampenfieber oder „Das Schlimmste sind die fünf Minuten vor dem Auftritt“. Orchester 9:863-868
Bergler E (1949) On acting and stage fright. Psychiat Q Suppl 23:313-319
Brodsky W, Sloboda JA, Waterman, MG (1994) An exploratory investigation into auditory style as a correlate and predictor of music performance anxiety. Med Probl Perform Art 9:101-110
Ferenczi S (1923) Lampenfieber und narzißtische Selbstbeobachtung. Schriften zur Psychoanalyse, Bd. II, S.134-135. Fischer, Frankfurt aM (1972)
Freundlich D (1968) Narcissism and exhibitionism in the performance of classical music. Psychiat Q Suppl 42:1-13
Eckhardt J, Lüdemann L (1974) Kennen Sie Lampenfieber? Orchester 1:10-15
Fenichel O (1946) Über die Schauspielkunst. Aufsätze, Bd. II, S. 390-405. Ullstein, Frankfurt aM Berlin Wien (1985)
Gabbard GO (1979) Stage fright. Int J Psychoanal 60:383-392
Gabbard GO (1983) Further contributions to the understanding of stage fright: Narcissistic issues. J Am Psychoanal Assoc 31:423-441
Greenson RR (1967) Technik und Praxis der Psychoanalyse. Klett-Cotta, Stuttgart (6. Aufl[DMG1] 1992)
Hartmann K (1983) Das Lampenfieber des Musikers - Möglichkeiten der Selbsthilfe und Prophylaxe. Z Musikpäd 21:29-39
Hayes D (1975) The archetypal nature of stage fright. Art Psychother 2:279-281
Hoffmann SO (1999) Die phobischen Störungen (Phobien). Forum Psychoanal 15:237-252
Kaplan D (1969) On stage fright. Drama Rev 14:60-83
Kircher JM (2003) A qualitative inquiry into musical performance anxiety. Med Probl Perform Art 18:78-82
Klöppel R (2003) Techniken zum Umgang mit Lampenfieber unter besonderer Berücksichtigung des Mentalen Trainings. Vortrag gehalten auf dem 9. Europäischen Kongreß für Musikphysiologie und Musikermedizin, Freiburg, April 2003. Kurzfassung in Musikphysiol Musikermed 9:38-39
König K (1981) Angst und Persönlichkeit. Verlag für Medizinische Psychologie, Göttingen (1993, 4. Aufl.)
Kohut H (1972) Thoughts on narcissism and narcissistic rage. Psychoanal Study Child 27:360-400
Kohut H, Wolf, ES (1978) The disorders of the self and their treatment: an outline. Int J Psychoanal 59:413-425
Krawehl I, Altenmüller E (2000) Lampenfieber unter Musikstudenten: Häufigkeit, Ausprägung und „heimliche Theorien“. Musikphysiol Musikermed 7:173-178
Kutter P, Dettweiler G (2003) Angst als Ursache von Lernstörungen. Vortrag gehalten auf dem 9. Europäischen Kongreß für Musikphysiologie und Musikermedizin, Freiburg, April 2003. Kurzfassung in Musikphysiol Musikermed 9:40
Lang A (1999) Das Konzept Schlaffhorst-Andersen zur gezielten Prävention und Behandlung der Aufführungsangst. Musikphysiol Musikermed 6:78-82
Liebelt P, Schröder H (1999) Prävention und Intervention von Podiumsangst - Aufbau und Evaluation eines psychologischen Gruppenprogramms. Musikphysiol Musikermed 6:7-13
Mantel G (2001) Einige Gedanken zum Lampenfieber aus der Sicht des auftretenden Künstlers. Musikphysiol Musikermed 8:12-18
Möller H (1999) Lampenfieber und Aufführungsängste sind nicht dasselbe! Musikphysiol Musikermed 6:33-41
Plaut EA (1990) Psychotherapy of performance anxiety. Med Probl Perf Art 5:58-63
Reister G (1990) Zur Psychoanalyse der Musik. Wissenschaftliche Examensarbeit am Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie Göttingen.
Sandgren M (1998) Stimme und Selbstwert. Vortrag gehalten auf dem 6. Europäischer Kongreß für Musikermedizin und Musikphysiologie, Berlin, 15.-18. Okt. 1998. Persönliche Mitteilung in der Diskussion.
Schorn A (1999) Zur Psychologie des Lampenfiebers. Freie Assoziation 2:323-333
Schröder H, Liebelt P (1999) Psychologische Phänomen- und Bedingungsanalysen zur Podiumsangst von Studierenden an Musikhochschulen. Musikphysiol Musikermed 6:1-6
Spohr A (2003) Alexandertechnik für Musiker. Vortrag gehalten auf dem 9. Europäischen Kongreß für Musikphysiologie und Musikermedizin, Freiburg, April 2003. Kurzfassung in Musikphysiol Musikermed 9:85
Stolorow RD (1979) Defensive and arrested developmental aspects of death anxiety, hypochondriasis and depersonalisation. Int J Psychoanal 60:201-213
Wurmser L (1981) Die Maske der Scham: die Psychoanalyse von Schamaffekten und Schamkonflikten. Springer, Berlin Heidelberg New York (3. Aufl 1997)
Dr. med. Matthias Gubitz
- Arbeit zitieren
- Dr. med. Matthias Gubitz (Autor:in), 2000, Die Angst vor dem Auftritt - Lampenfieber und Aufführungsangst aus psychoanalytischer Sicht , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110787
Kostenlos Autor werden



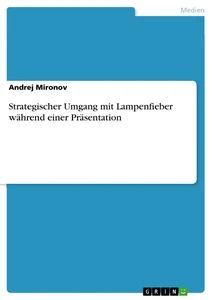


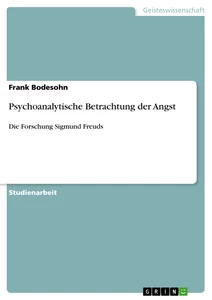
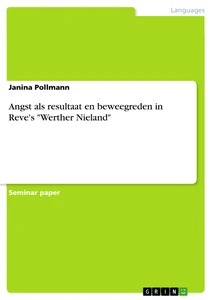




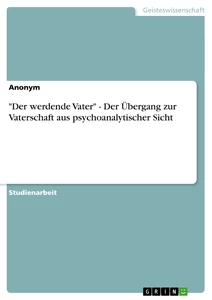



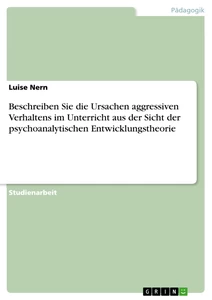





Kommentare