Leseprobe
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Entwicklungen im deutschen Kaiserreich
2.1 Industrialisierung und Innenpolitik
2.2 Bevölkerungsentwicklung und Industrialisierung
2.3 Städtebau Politk
3. Wohnungs(re)formen
3.1 Mietshausviertel
3.2 Werkssiedlungen
3.3 Reformwohnungsbau
3.4 Absonderungen
3.5 Konsequenzen der Wohnungsreformen
4. Alltagsleben ungelernter Arbeiter, Fachkräften und deren Familienmitgliedern
4.1 Zonen der Transition
4.2 Mietshausviertel
4.3 Frauen
4.4 Kinder, Jugendliche und ältere Menschen
5. Fazit
1. Einleitung
Durch das Aufeinandertreffen dreier Faktoren -Bevölkerungswachstum, Binnenwanderung und Hochindustrialisierung- von Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts setzte eine städtebauliche Entwicklung ein, die zum Ziel hatte, finanzierbare und lebenswürdige Wohnungsunterkünfte für Angehörige aller Schichten zu bewerkstelligen.
Zu diesem Zweck wurde die Bauwirtschaft in private Hände übertragen, private Instutitionen realisierten unterschiedliche Wohnreformen und versuchten eine Lösung für die Wohnungsfrage zu finden.
Diese Arbeit soll zeigen, welche Ideen es gab, wie ihre Umsetzung aussah und welche Konsequenzen sie für das alltägliche Leben hatten.
Die heutige Forschung liefert dafür eine Vielzahl von Möglichkeiten, welche sich allerdings meist nur auf eine Stadt oder einen Teil in der Vorstellung ihrer Ergebnisse beziehen. Im Folgenden soll in Einbezug der historischen Gegebenheiten ein allgemeiner Überblick über die städtebaulichen Entwicklungen im deutschen Kaiserreich gegeben werden. Im Vordergrund steht dabei die Frage: Wie sahen Arbeitsunterkünfte zur damaligen Zeit aus und welchen Einfluss hatten sie auf das Alltagsleben der Arbeiterfamilien?
Zu Beginn dieser Arbeit soll ein Einblick in die innenpolitische Lage des Kaiserreiches sowie der Bevölkerungs- und Industrieentwicklung gegeben werden. Dies soll dem Leser die Gründe für jene oder die jeweiligen anderen Entwicklungen verständlicher machen. Im Hauptteil werden die Wohnformen der Arbeiter in der Kaiserzeit vorgestellt. Abschließend soll der vierte Teil das Alltagsleben in den zwei verbreitesten Wohnformen zum Inhalt haben.
2. Entwicklungen im deutschen Kaiserreich
2.1 Industrialisierung und Innenpolitik
Mit der Gründung des deutschen Kaiserreiches am 18. Januar 1871 zeichnete sich auch eine Wende in der deutschen Wirtschaft ab. Es vollzog sich der Übergang zur Hochindustrialisierung und damit auch eine Verschiebung und Veränderung des Wirtschaftssektors. Festzumachen war dies beispielsweise an dem expandierenden Kreditmarkt, der Einführung einer Vielzahl von neuen Produkten und einem neuerlichen Durchbruch der Technik, welcher sich durch technische Veränderungen und Erfindungen auszeichnete.
Darüber hinaus veränderten sich jedoch auch die Rahmenbedingungen der Wirtschaft; es kam zu einer Auflösung der mittelalterlichen Sozial- und Wirtschaftsstruktur und der Einführung arbeitsteiliger Prozesse.[1] Damit einhergehend gab es Ansätze zur Entstehung eines liberalen Wirtschaftsmarktes, welche sich schließlich durchsetzten.
Die politischen Umstände in der konstituellen Monarchie waren indes von Uneinigkeit geprägt. Im Zuge der Industrialisierung und der Verbesserung der Lebensqualität wuchs die Bevölkerung und damit auch die Frage nach Versorgung und Unterbringung der Bürger. Erschwert wurde die Diskussion durch innenpolitische Konflikte, welche sich aus den unterschiedlichen politischen Hauptströmungen im Kaiserreich ergaben. Es kristallisierten sich hierbei im Groben zwei Gruppierungen heraus; zum einen das „nationale Bürgertum“, welches sich hauptsächlich aus Konservativen, Freikonservativen und Nationalliberalen formatierte. Diesem gegenüber stand die Arbeiterschicht, welche durch die Sozialdemokraten repräsentiert wurde. Die Eskalation des Konflikts trat mit der Verabschiedung des sog. „Sozialistengesetzes“ ein, welches jegliche Propaganda für die Sozialdemokratie verbot.[2]
Doch trotz dieser unterschiedlichen politischen Meinungen kam es schließlich zu einer Einigung, welche eine radikale Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung zur Folge hatte; hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Sozialgesetzgebung in den 1880ger Jahren verabschiedeten Gesetze, welche die Einführung der Kranken-, Unfall und Alters- und Invalidenversicherung beinhalteten. Trotz dieses Erfolges für Arbeiter bzw. für die Unterschicht, war der Einfluss der Sozialdemokraten auf die Politik sehr gering. Obwohl sie große Stimmengewinne zwischen 1871 und 1914 erzielten, gelang es nicht, „eine Regierungsbeteiligung oder gar eine [...] Regierungsübernahme zu realisieren“.[3]
2.2 Bevölkerungsentwicklung und Industrialisierung
Mit dem Beginn der Hochindustrialisierung zeichnete sich auch ein starker Bevölkerungsanstieg ab. Dieser wurde von mehreren Faktoren begünstig und war wiederum Grund für eine verstärkte Verstädterung. Im weiteren Verlauf bedingten sich beide Faktoren wechselseitig.
Nach Hafner vollzog sich das Bevölkerungswachstum in zwei Phasen. Dabei war die erste Phase durch eine sinkende Sterblichkeitsrate und eine gleichbleibende Geburtenziffer gekennzeichnet. Die Konsequenz des Bevölkerungsanstiegs zwischen 1872 und 1902 war die steigende Mobilität der Bevölkerung, welche durch Auswanderung nach Übersee und Binnenwanderung gekennzeichnet war. Ab 1902 kam es schließlich zu einer Senkung der Geburtenrate bei gleichzeitiger Senkung der Sterblichkeitsrate. Den ersten Faktor führt Hafner auf die stärkere Konsumorientierung zurück, welche die Phase der Hochindustrialisierung mit sich brachte[4]. Schon Mitte der Fünfziger war es zu einer verstärkten Binnenwanderung gekommen, welche den Prozess der Verstädterung förderte. Der Grund hierfür war die wachsende Popularität des Stadtlebens und sog. „Push- und Pullfaktoren“, welche den Arbeiter vom Landleben weg, hin zum Stadtleben zogen. Die Stadt bot so beispielsweise „ein umfangreiches Angebot an Arbeitsplätzen und damit auch eine bessere Arbeitsplatzsicherung als in ländlichen Gebieten“[5]. Des Weiteren gab es ein großes Kultur- und Freizeitangebot, welches von denjenigen, die es zeitlich und finanziell wahrnehmen konnten, genutzt wurde.[6] Ebenso war die Tatsache, einen höheren Verdienst für die Arbeit in den Fabriken zu erlangen ein Faktor, der dem Stadtleben Attraktivität verlieh. Dabei ist jedoch beachten, dass die hohen Lebensunterhaltskosten den vermeintlichen Gewinn relativierten.
Alle drei Faktoren –Binnenbewegung, Bevölkerungswachstum, Industrialisierung- führten zu einem tiefen Strukturwandel der Stadt.[7] Merkmale dieses Wandels waren die Entstehung neuer Großstädte und die Umformung des Stadtbildes und seiner Funktion: „[…] war sie seit dem Mittelalter vorwiegend Mittelpunkt der Verwaltung und des Handels, wurde sie nun [...] Zentrum der industriellen Produktion [...]“[8]. Die anwachsende Urbanisierung brachte das Problem der Wohnungsfrage mit sich und es wurde nach einer Lösung für die Wohnungsnot gesucht. Brüggemeier und Niethammer grenzen diese Behauptung ein; so habe es keinen Mangel an Wohnraum gegeben, sondern lediglich einen Mangel an kostengünstigem und kleinem Wohnraum. Die proletarischen Familien hätten meist nicht das Einkommen gehabt, um einen entsprechend großen Wohnraum zu mieten oder sie wären durch das Landleben an schlechte Wohnbedingungen gewohnt und akzeptierten die schlechten Wohnverhältnisse um Geld zu sparen.[9]
2.3 Städtebau Politik
Der Städtebau oblag seit Mitte des 19. Jahrhundert dem Staat. Dies änderte sich mit dem Einfluss des liberalen Wirtschaftsgedanken.[10] Mit ihm wurde der Großteil der Wohnungsbedarfsbedeckung auf die private Wirtschaft übertragen. Der Staat unterteilte den Städtebau in verschiedene Fachbereiche, welche wiederum einen Teil eines Verwaltungsapparates darstellten. Die Aufgabe des Staates lag nun darin, Rahmenbedingungen festzusetzen, welche vom Bauherren befolgt werden mussten.
Die wichtigsten Reglementierungen waren in der Bebauungsordnung und dem Bebauungsplan festgehalten; der „Bebauungsplan teilte die städtischen Neubaugebiete in unterschiedliche Nutzungszonen, regelte die Verantwortlichkeit der Gemeinden, bzw. des Staates, die Offenlegung des Planes, die Einspruchmöglichkeiten, das Enteignungsverfahren und die Kostenverteilung“[11]. Die Detailplanung und Ausführung oblag den Kommunen und deren Stadtverordnetenversammlung.[12] Die Bauordnung legte die Mindestanforderung bezüglich Feuersicherheit, Hygiene und Standhaftigkeit fest. Überwacht wurde die Einhaltung durch die Baupolizei, welche dem Staat unterstellt war.[13]
Plan und Ordnung beinhalteten nur vage Richtlinien, was zu einer inkonsequenten Zoneneinteilung führte und Raum für stadtbauliche Fehlentwicklungen ließ. Hafner nennt hierfür das Beispiel Hobrecht und dessen „Mietskasernen“, welche von dem Großteil der Bevölkerung bewohnt, jedoch aufgrund ihrer Konzeption vielfach kritisiert worden sind.[14] Eine Nachbesserung der Bauordnung sollte die Zonenbauordnung schaffen, jedoch stellte sich keine spürbare Verbesserung für den Stadtbau ein. Gefördert durch die neue Ordnung wurde lediglich die „Citybildung“; so wuchs beispielsweise der Dienstleistungssektor an und es entstanden neue Kaufhäuser und Banken. Um die neue City herum bildeten sich „Zonen der Transition“. Dort lebten meist Arbeiter, deren Arbeitsplätze im Inneren der Stadt lagen. Kennzeichnend für diese Viertel war es, dass sie meist unhygienisch waren und den schlechten Teil der Stadt beschrieben.[15]
Trotz der Jugendlichkeit des Städtebaus als Lehrfach waren sich die Stadtplaner bezüglich der Zielsetzung ihrer Reformen international einig. So wolle man „eine menschenwürdigere, zeitgemäßere und vor allem auch schönere Umwelt für die Großstadtbewohner [...] schaffen“[16]. Dabei diente insbesondere das Konzept der „Gartenstadt“ von Howard als Vorbild, jedoch konnte es im deutschen Reich nur unzureichend umgesetzt werden.[17] Um kostengünstig zu bauen und die maximale Ausnutzung der Grundstücke zu erreichen, stieg die Bebauungsdichte. Die dominierende Wohnform war das Mietshaus, welches oft mehrstöckig gebaut war und eine große Belegung aufwies. Diese Bauten unterschieden sich oft nicht maßgeblich von jenen, die die Werkssiedlungen schmückten bzw. durch den Reformbau realisiert worden waren. Die Entstehung von Einfamilienhäusern, wie es in England der Fall war, wurde in Deutschland nicht gefördert.[18]
3. Wohnungs(re)formen
3.1 Mietshausviertel
Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ging man dazu über, die alte Bebauung durch neue Mietshäuser zu ersetzen. Finanziert wurde dies durch Terrain- und Baugesellschaften; entwickelte sich ein „Privater Wohnungsmarkt, in dem der größ(t)e Teil der Arbeiter meist teuer und/oder schlecht wohnte“[19]. Die Grundsubstanz der Mietshäuser war von guter Qualität. Ihre Fassaden und Grundrisse unterschieden sich nur im geringen Maße von den bürgerlichen Wohnblöcken. Auf diese Weise kam es zu einem höheren Wohnwert, da ästhetische Gesichtspunkte auch eine Rolle spielten.[20] Die innere Ausstattung der Mietshäuser wies einen minimalen Wohnkomfort auf und auf Einrichtungen wie Speicher und Kellerraum wurde häufig verzichtet, um eine Gewinnmaximierung zu erzielen.[21]
Das bekannteste Beispiel für solche Mietshäuser sind die sog. „Mietskasernen“. Ihren Namen erhielten sie durch die kasernenartige Anordnung der Mietshäuser und der fehlenden Ästhetik dieser Bauten. Sie wurden vom Stadtplaner Hobrecht, in der Hoffnung eine soziale Vermischung zu erzielen, entworfen. Dazu kam es allerdings nur spärlich, vielmehr trug diese Form der Behausung zur Segregation der Arbeiter bei. Einige Arbeiterviertel wurden zu 65% von Arbeitern bewohnt, in einem Stadtteil von Hamburg belief sich die Prozentzahl dieser Schicht sogar über 70%. Dieser Prozess zeichnete sich besonders im Bauboom der 1880iger Jahre ab; noch 1870 hatte es noch einen relativ hohen Grad an Vermischung gegeben.[22]
Die Arbeiterviertel zeichneten sich nicht nur durch eine hohe Bebauungsdichte aus, sie wiesen auch eine beträchtliche Wohndichte auf: „Im Jahre 1885 rechnete man im allgemeinen 0,41 bis 0,65 heizbare Zimmer pro Person“[23]. Oft bewohnten mehr als zwanzig Familien einen Wohnblock. Zusätzlich wurden aus wirtschaftlichen Gründen „Kost- und Quartiergänger“[24] aufgenommen, denn das „Kostgeld“ war eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit und steuerte zur Finanzierung der Wohnung bei.[25]
3.2 Werkssiedlungen
Seine Ursprünge hatte der Werkswohnungsbau in Belgien und England, wo bereits im 18. Jahrhundert Unternehmer Werkswohnungen für ihre Beschäftigten außerhalb der urbanen Siedlungsräume gebaut hatten.[26] Als nun auch im deutschen Reich der Städtebau in private Hände übertragen worden war, setzte sich dieses Modell als eines der erfolgreichsten durch. Das Ziel der Unternehmer war es, Arbeitskräfte langfristig an sich zu binden und vor allem an ländlichen Standorten qualifizierte Arbeiter für das Unternehmen zu gewinnen. Attraktiv wurden die Werkswohnungen besonders aufgrund der relativ niedrigen Mieten, denn die Unternehmen erzielten praktisch keine Gewinne damit, denn das dafür eingesetzte Kapital wurde nur sehr mäßig verzinst.[27] In Deutschland gab es 1914 ca. 140.000 Werkswohnungen. Innerhalb der Werksiedlungen wurden die sozialen Gruppen häufig voneinander getrennt; so gab es Wohnungen für Bergarbeiter, aufgerückte Arbeiter und Hütten- und Walzwerkarbeiter. Die Gestaltung dieser Siedlungen war sehr unterschiedlich und variierte von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit, jedoch konnte die Zugehörigkeit zur Fabrik oft erkannt werden. Das äußere Bild der Siedlungen hatte jedoch keinen „geordneten Bezug zu ihrer landwirtschaftlichen und städtebaulichen Umgebung“[28]. Wegen der geringen Möglichkeiten einer Durchquerung der Siedlungen wiesen sie oft einen Ghettocharakter auf, welcher die Abgrenzung zur städtebaulichen Weise noch verstärkte.[29]
In der ersten Phase des Werkswohnungsbaus bis 1890 zeichneten sich die Werkshäuser durch eine geringe Bauqualität aus. Erst in den Folgejahren stieg der Wohnungskomfort als Folge des „wachsenden Selbstbewußtseins der Arbeiterklasse, das sich durch die Einkommenssteigerung auf einem wachsenden Lebensstandard gründete“[30].[31]
Oft unterschieden sich die Werkshäuser maßgeblich in Größe und Form. Einige waren so ausgerichtet, dass die Obergeschosse UntermieterInnen beherbergen sollten, andere Familien lebten dahingegen in kleinen Fachwerkhäusern im Landhausstil für sich allein.[32]
Der Werkssiedlungsbau war zu seiner Zeit sehr umstritten, da der Arbeiter in einer doppelten Abhängigkeit zum Unternehmer stand und mit seiner Kündigung auch die Wohnung räumen musste. „Wohlverhalten war also wesentliche Voraussetzung um in den dauerhaften Genuß solcher Wohnungen zu kommen“[33]. Ein Vorteil für beide Seiten war die mit der Entstehung von Werkssiedlungen einhergehende Verbesserung der hygienischen Einrichtung, z.B. den Badeanstalten und den Werkskantinen. Dadurch kam es nicht nur zu besseren Lebensbedingungen für die Arbeiter, sondern auch zur Steigerung der Produktivität des Betriebs.[34]
3.3 Reformwohnungsbau
„Der Reformwohnungsbau war vor allem den wohnungs- und sozialhygienischen Diskursen zu verdanken, die sich nach 1890 verstärkten“[35]. Zum Vorbild diente dem Reformwohnungsbau das Konzept der „Gartenstadt“. Dieses sollte das Land- und Stadtleben miteinander vereinen, bzw. wurde angestrebt, „das Leben weiter Bevölkerungsschichten in ein engeres Verhältnis zur Natur zu setzen“[36]. Zum Gartenstadtkonzept gehörte jedoch nicht nur die Etablierung gesunder Lebensverhältnisse, sondern auch die Förderung zur Entstehung genossenschaftlicher Selbstorganisation.
Howards Stadtplanungsmodell konnte in Deutschland nur unzureichend umgesetzt werden, vielmehr kam es zur Entstehung sog. „Gartenvorstädte“. Diese waren wirtschaftlich, wie auch kommunalpolitisch unselbstständig.[37]
Darüber hinaus war es für Arbeiter meist sehr schwer zu einem Eigenheim in den entsprechenden Gegenden zu gelangen, oftmals bedurfte es „enormen Anstrengungen zweier Familiengenerationen“[38]. Ein anderer negativer Aspekt war die offensichtliche soziale Segregation in den Gartenvorstädten; so waren Unterschiede im sozialen Status an der Architektur der Gebäude sichtbar und dies so stark wie noch nie zuvor in der Baugeschichte.[39]
Bereits „dem Wohnungszuschnitt war eingeschrieben, welche Sozialkontakte der Bewohner pflegen konnte“[40].
Diese Segregation war jedoch Teil des Planungskonzeptes der Gartenstadt. Erklärt sei dies nach Von Saldern damit, dass die „Segregation [...] offenbar als Ausdruck einer als vernünftig angesehenen sozialräumlichen Verteilung der verschiedenen Bevölkerungsklassen (galt)“[41].
Eine andere Form des Reformwohnungsbaus ist durch die Entstehung von Baugenossenschaften etabliert worden. Die Idee des genossenschaftlichen Bauens und Wohnens ist auf Frühsozialisten und Sozialkonservative zurückzuführen, allen voran Victor Aimé, welcher sich besonders seit den 1840iger Jahren dafür einsetzte.
Wohnungen der Baugenossenschaften sollten vor allem günstig und selbständig sein, darüber hinaus sollte die Abgeschlossenheit jeder Wohnung gewährleistet sein. Finanziert werden sollte der Genossenschaftsbau durch Kredite vom Staat, welche innerhalb von 25 Jahren getilgt werden sollten.
Das Innere einer Wohnungseinheit sollte einer Norm entsprechen; sie sollte aus zwei Stuben, zwei Schlafzimmern, Küche, Hofraum und Gartenteil bestehen. Des Weiteren sollten maximal vier Wohneinheiten in einem Haus zusammenleben.[42]
Eine günstige Finanzierung wurde zwar durch die Bismarkschen Sozialversicherungsgesetze und dem Genossenschaftsgesetz von 1889 ermöglicht, jedoch kamen die Baugenossenschaften „ohne finanzielle Hilfe von außen oder durch besser situierte Mitglieder [...] in aller Regel nicht aus“[43].
Die Gründung von Baugenossenschaften ist meist von Sozialreformern und kirchlichen Einrichtungen initiiert worden, allerdings war sie nicht sehr verbreitet.[44]
Teile dieser Genossenschaften konnten nur von besser verdienenden Arbeiterschichten erworben werden, jedoch konzentrierten sich die Genossenschaften auf die Realisierung von Wohnungsunterkünften nieder gestellter Arbeitergruppen.
Von Außen betrachtet war die Architektur der Wohnblocks der modernen Bauart angepasst. Die Größe der „meist mehrstöckige(n), eher urban aussehende(n), aber weiträumig angelegte(n) Wohnblocks“[45] wurde als angemessen betrachtet.[46] Darüber hinaus folgte man den modernen Wohnungsbauprinzipien „Licht, Luft und Sonne“.
Positiv stach auch der Bereich „Wohnungshygiene“: die Wohnungen „erfüllten [...] die wohnungshygienischen Standards der Zeit, wenngleich die Toiletten noch immer meist auf halber Treppe platziert wurden“[47]. Das solche Bauten trotz ihren verhältnismäßig attraktiven Fassade für die Unterschicht zu finanzieren waren, hängt nach Clemens Zimmermann mit der „Senkung der Bauqualität sowie [...] (mit) den billigen, moorigen Baugrund“[48] zusammen.
3.4 Absonderungen
Auch wenn die wohnliche Situation der Arbeiter nicht heutigen Standards entsprach, konnte das Gros der Arbeiter auf ein Eigenheim in „richtigen“ Häusern verweisen. Jedoch gab es auch eine Vielzahl an Menschen welche in Massenunterkünften lebten. Zu dieser Gruppe gehörten oft besonders ausländische Arbeiter. Viele von ihnen emigrierten nach Berlin, nachdem das Deutsche Reich den Krieg gegen Frankreich gewonnen hatte. Die starke Konjunktur lockte sie und schürte bei vielen die Hoffnung auf einen festen Arbeitsplatz.
Da viele der ausländischen Arbeiter nicht sofort Arbeit und Unterkunft fanden, setzte die Entstehung von Barackensiedlungen ein. Diese wurden von der Stadt allerdings nicht toleriert; sie reagierte mit einem Großaufgebot der Polizei und ordnete die Zerstörung des Großteils der Barackensiedlungen bis August 1872 an. Um die Obdachlosen nicht dem Blick der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurden Asyle und Arbeiterhäuser gebaut. Diese standen oft unter Polizeiaufsicht und die Bewohner der Arbeiterhäuser standen häufig unter Arbeitszwang. Der innere Zustand dieser Gebäude war meist schlecht. Dies traf auch auf die sog. „Wanderarbeitsstätten“[49] zu, in welchen sich umherziehende Arbeits- und Obdachlose aufhielten.[50] Die äußeren Fassaden der Massenunterkünfte waren meist solide um die „Armut vor den Augen der Öffentlichkeit weitmöglichst zu verbergen“[51].
3.5 Konsequenzen der Wohnreformen
Hafner bezeichnet als die drei wirksamsten Wohnreformen jener Zeit den Werkswohnungsbau (34,9%), den gemeinnützigen Wohnungsbau bzw. die Baugenossenschaften (27,9 %) und den staatlichen Wohnungsbau (20,7 %). Auch die innere Kolonisation, d.h. die Ansiedlung neuer Bauernhöfe fällt mit 13,3 % ins Gewicht.
Alle anderen Reformmodelle seien zahlenmäßig nur sehr gering ausgeprägt gewesen, beispielsweise war das Konzept der Gartenstadt nur mit 1,5 % vertreten. Jedoch fand es ein großes Echo in der Gesellschaft, weshalb es hier aufgeführt werden sollte.[52] Trotz ihrer Gewichtung stellten die Reformmodelle allerdings keine Konkurrenz zum privaten Wohnungsmarkt dar. Nur 1,8 –2,25 der 64 Millionen Einwohner lebten im Jahre 1910 in Wohnungen sog. Reformbauten. Erst in der Weimarer Republik gewannen sie an Bedeutung.[53]
Betrachtet man die Reformmodelle in qualitativer Hinsicht, so lassen sie sich grob in zwei Bereiche unterteilen. Der eine Bereich beinhaltet jene Modelle, welche nur durch den Eingang in eine (finanzielle) Abhängigkeit realisiert werden konnten. Zu dieser Gruppe gehörten die meisten Modelle, insbesondere der Werkswohnungsbau, bei dem die Interessen des Unternehmers im Vordergrund standen. Die Sozialpolitik war in diesem Bereich durch die Anpassung der Bedürfnisse an die der Initiatoren geknüpft. Zur zweiten Gruppe können teilweise die Gartenstädte gezählt werden, welche sich der Hilfe „<<von oben>>“ weitestgehend entziehen konnten. Sie konnten sich jedoch nicht immer den lebensreformerischen Intentionen des Bürgertums entledigen.[54]
Allgemein betrachtet konnte die bauliche Lebensreformbewegung, welche auf die Umstrukturierung der Haushaltsführung und des Alltagslebens abzielte, im baulichen Bereich weitestgehend nicht durchgesetzt werden. „Ihre bedeutendsten Ergebnisse lagen auf jenen Gebieten, wo die bestehende Gesellschafts- und Sozialordnung nicht angetastet wurde“[55].
4. Alltagsleben ungelernter Arbeiter, Fachkräften und deren Familienmitgliedern
4.1 Zonen der Transition
Die in den innerstädtischen Randgebieten entstandenen Arbeiterviertel wurden meist von aus der Innenstadt Verdrängten und Neuankömmlingen bewohnt.[56] Auch ein Großteil der ärmeren Arbeiterschaft bewohnte sog. „Transitions-Zonen“. Oft waren dies bauliche heruntergekommene, ökonomisch entwertete, häufig am Rand der Innenstadt gelegene Wohngebiete, „in denen die sozialen Kontrollen weniger dicht sind, wo Alteingesessene und Zuwanderer, Künstler und Studenten, legale Aktivitäten und Laster der Großstadt sich sammeln können“[57]. Kennzeichnend für Siedlungen dieser Art war die Tatsache, dass dort oft eine große Kriminalität vorherrschte und die Wohndichte extrem hoch war.
Hinzu kam Platzmangel innerhalb der Wohneinheit. So hatten viele der Arbeiterfamilien keine getrennte Küche und wenig Wohnraum. Darüber hinaus wurden die Flure oft gemeinsam genutzt und sog. „Schlafgänger“ zur Untermiete aufgenommen um die Miete finanzieren zu können.[58] “Separate Wohnungen waren hier nicht zu finden“[59]. Die hohe Belegung und die Aufnahme von Schlafgängern ließen kaum Privatsphäre.[60] Für sich allein zu sein war ein Luxus, welchen sich oft nur bürgerliche Familien leisten konnten. Dazu kam, dass Schlafgänger und Familie „keine von vornherein harmonischen Gemeinschaften“[61] waren und damit auch die Sehnsucht nach der Stille des Raums und der Möglichkeit allein zu sein zusätzlich wuchs.
Viele Aktivitäten mussten aufgrund der hohen Wohndichte und Platzenge auf die Straße und den Hof verlagert werden.[62]
Grüttner beschreibt die Lebensverhältnisse der Zonen-Bewohner als „Produkt verengter Bewegungsräume, überbevölkerter Wohnungen und materieller Lebendbedingungen, die durch ständige Unsicherheit gekennzeichnet waren. Aber sie schufen auch ein ungewöhnlich dichtes Kommunikationsnetz und damit eine elementare Voraussetzung für Solidarität und Zusammenhalt“[63].
Die Wohndichte führte demnach dazu, dass persönliche Bindungen stärker hervortraten und ein wachsendes Gemeinschaftsgefühl vorherrschte. Dies hatte zu Folge, dass viele Arbeiter trotz der negativen Bedingungen ihrer Unterkunft diese oft freiwillig nicht verlassen wollten. Die Umsiedlung in andere Stadtteile aufgrund von Sanierungsbeschlüssen oder Ähnlichem gestaltete sich somit als schwieriges Unterfangen. Dies konnte sogar so weit führen, dass Polizeigewalt eingesetzt werden musste, um die Bewohner zum Verlassen ihres Eigenheims zu bewegen.
Doch nicht nur sozial-psychologische Aspekte weckten den Widerstand gegenüber der Umsiedlung, oft hieß eine Umsiedlung einen längerern Arbeitsweg und höhere Kosten für den Arbeiter und seine Familie.
Da finanzielle Unsicherheit ein häufig anzutreffendes Charakteristikum des Arbeiterlebens war, entwickelten die Arbeiter ihre eigenen Wege, um zu überleben.
So konnten sich beispielsweise einige dadurch mit Lebensmitteln versorgen, dass sie die Kosten beim Ladenbesitzer anschreiben lassen konnten.
Je bekannter die Umgebung, je intensiver die Kontakte, desto größer war die Unterstützung , mit welcher der Arbeiter in schwierigen Lagen rechnen konnte.
Die unsichere Zukunft schlug sich auch in der Lebensweise nieder und ist ein starkes Indiz für die Differenzierung wohlhabenderer und ärmerer Schichten. Oscar Lewis prägte den Begriff der „Kultur der Armut“ und charakterisierte sie als Kultur, dessen Angehörige augenblicksbezogen eingestellt seien und sich nicht an langfristigen Zielen orientierten. Vielmehr stand das Überleben bis zum nächsten Tag im Mittelpunkt. Die damit aufkeimende Frustration begünstigte die Entwicklung einer Feindseligkeit gegenüber Bürgertum und Staatsgewalt wie auch die Einstellung, dass Gewalttätigkeit eine Lösung für Konflikte darstelle. Demzufolge war diese Art der Kommunikation auch unter den Milieubewohnern weit verbreitet. Auch wenn dies für den Außenstehenden suspekt erscheint, so war auch diese Art der Konfliktaustragung ein Teil der Alltagskultur, welche Arbeiter, die dort längere Zeit lebten, anhängten.[64]
4.2 Mietshausviertel
Die Mietshausviertel, besonders nach der Sainierung durch die Baugenossenschaften, wurden meist von Facharbeitern bewohnt, welche ein höheres Einkommen als ungelernte Kräfte zu verzeichnen hatten. Facharbeiterfamilien waren Familien mit meist „relativ wenigen Kindern, einem verhältnismäßig stabilen Berufsleben und einer größeren Seßhaftigkeit“[65]. Oft grenzten sie sich von der einfachen Arbeiterschaft ab und versuchten eine Annäherung an die kleinbürgerlichen Verhältnisse zu erreichen. So gab es beispielsweise Kneipen, in welchen sich nur Facharbeiter aufhielten, hingegen auch andere welche sie mieden, da diese meist von ungelernten Arbeitern besucht wurden. Einen starken Unterschied gab es auch in der Identifizierung mit dem jeweiligen Milieu, die starke Anhänglichkeit der Arbeiter zu diesem unterlag in den Mietshausvierteln schon zur Jahrhundertwende einer Auflockerung. Zwar gab es die sozialkulturelle Verbundenheit unter den verschieden Mietparteien auch in Facharbeitervierteln, jedoch war man dort nicht mehr so stark auf die Hilfe der Nachbarn angewiesen und die Bauweise ermöglichte eine wachsende Privatisierung der Familiensphäre. Zwar ging auch bei Facharbeitern das Einkommen nicht stark über den lebensnotwendigen Lohn hinaus, doch war es genug um sich nicht etwas bei Nachbarn ausleihen und beim Einkauf die Rechnung anschreiben lassen zu müssen.
Des Weiteren verließen viele Erwerbstätige das Quartier um zu ihrer Arbeitsstätte zu gelangen, einige von ihnen konnten es sich sogar leisten Verkehrsmittel zu nutzen.[66] „Dadurch erweiterte sich der räumliche Wahrnehmungshorizont und lockerte sich die existenzielle Verankerung im Quartier“[67]. Auch das Wohnen veränderte sich und gab mehr Möglichkeiten zur Individualisierung und ähnelte dem Wohnverhalten des Kleinbürgertums. So gehörten beispielsweise Sofa, Sessel, Tisch, Kommode und Spiegel meist zur Wohnungsausstattung.[68] Zusätzlich gab es nun in vielen Wohnungen die Möglichkeit die Wohnungen abzuschließen. Dies führte dazu, dass sich die Begegnungen mit Nachbarn immer mehr vom Hof in die Wohnung verlagerten.[69]
Oft konnte auch eine sog. „gute Stube“ vorgefunden werden. Dies war ein Raum, welcher nur zu besonderen Anlässen betreten wurde. Hier fand man Polstermöbel und beste Ausstattung der Wohnung. Von Saldern bezeichnet diese „gute Stube“ als Statussymbol, welches einerseits „den Wunsch vieler Arbeiterfamilien nach sozialem Ansehen, gesellschaftlicher Partizipationsfähigkeit und kultureller Repräsentation, andererseits das klare Verlangen nach klarer Distanz zur „Kultur der Armen“ (versinnbildlichte)“[70]. Paul Bröcker kritisierte die „gute Stube“ 1908: „So ist die Stube keineswegs eine Wohnstube, sondern ein toter Raum, der unnütz den Platz wegnimmt, meist auf Kosten der gesunden Schlafgelegenheit“[71].
Oft bestanden die Wohnungen nur aus einem oder zwei Zimmern, was bedeute, dass eine Funktionsaufteilung der Zimmer oft unmöglich zu realisieren war. Jedoch gab es auch Stimmen, welche dies befürworteten; so schreibt Bröcker 1908, dass durch die Trennung von Küche und Wohnraum die Frau von der Wohngemeinschaft ausgeschlossen würde und plädiert daher für eine Zusammenführung der beiden Räume.[72]
Das Familienleben war geprägt von Häuslichkeit. An den Wochenenden und Feiertagen gab es gemeinsame Unternehmungen der Familie und auch der Vater zog das Heim oft der Kneipe vor. Unternehmungen wurden oft mit Hilfe von Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln veranstaltet, jedoch war auch das Wandern eine willkommene Abwechslung zum Wohnungsaufenthalt. Kurz vor der Jahrhundertwende kam es zu neuen Reformen der Mietshäuser. Geplant waren Genossenschaftsbauten, in welchem der Hof das Zentrum des Zusammenwohnens darstellen sollte. Die wenigen Projekte, welche letztendlich wirklich realisiert worden waren, hatten Höfe mit eigenen Läden, Gaststätten und manchmal Gemeinschaftseinrichtungen.[73]
Wie auch bei den einfachen Arbeitern war das Quartier auch für die Facharbeiter Alltagsmittelpunkt, jedoch zeichneten sich bei Letzteren schon während der Kaiserzeit Tendenzen zur Veränderung ab. Erstens kam es zu einer Aufwertung der Wohnung, zweitens gab es einen größeren sozialräumlichen Aktionsmodus und drittens wurde „vereinzelt eine spezifische Form von Sozialraumerfahrung durch genossenschaftliches Wohnen erprobt“[74], welche jedoch erst in der Weimarer Republik ihre Blüte entfaltete.
4.3 Frauen
Die Frauen einer Familie standen meist im Mittelpunkt des Alltagslebens und somit kam ihnen auch der Großteil der Aufgaben zu, mit welchen die sozialen Kontakte organisiert und aufrechterhalten wurden.
Man kann davon ausgehen, dass viele Frauen ihren Alltag vollständig oder zumindest fast vollständig im Quartier verbrachten, das Leben im Quartier war ihr „Areal“.
Ein großer Teil ihrer im Quartier verbrachten Zeit diente der Nutzung von Kommunikationswegen und Informationsnetzen mit Nachbarinnen. Auch wenn die Gespräche der Frauen meist nur „Tratsch“ beinhalteten, sei die Bedeutung dieser Art der Konversation nicht zu vernachlässigen, so Von Saldern.[75] Denn besonders in den Arbeiterquartieren waren die sozialen Bindungen oft lebensnotwendig. Häufig wurde durch solchen „Tratsch“ die Stellung einer Familie nach oben oder unten verschoben und damit auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme auf Hilfe von Nachbarn verbessert oder verschlechtert. Auf diese Hilfe waren die Familien untereinander nicht nur angewiesen, wenn es um Geldsorgen ging bzw. Anschaffung von Lebensmitteln; der oft ausgefüllte Alltag der Frauen brachte oft eine nicht allein zu bewältigende Menge an Haushaltsaufgaben mit sich, welche die Frauen oft gemeinsam erledigten. Besonders hart traf es dabei diejenigen Frauen, welche sich nicht nur um die Kindererziehung kümmern mussten, sondern auch noch einer Arbeit nachgingen. So gingen einige schlecht bezahlter Heimarbeit nach oder arbeiteten nebenher in Fabriken. In solchen Fällen war es besonders bedeutsam, dass man Nachbarinnen darum bitten konnte auf die eigenen Kinder aufzupassen. Die Pflegung der sozialen Kontakte wurde von anderen Schichten oft als Faulheit kritisiert, was implizierte, dass mehr Wert auf die Hygiene in der Wohnung gelegt werden sollte.[76] Jedoch lässt sich erkennen, dass die „entwickelten Benimmvorschriften für das Wohnen in der Stadt noch nicht schichtenübergreifend internalisiert worden waren“[77], denn es gab große Unterschiede in hygienischen Vorstellungen gegenüber Arbeiterhaushalten und höhergestellten Haushalten. Aber auch wenn man bei Arbeiterfamilien einen bestimmten Grad an Vernachlässigung akzeptierte, richteten sich Hygienekampagnen vorrangig an Arbeiterfrauen.
„Arbeiterfrauen waren [...] die hauptsächlichen Träger der quartiersbezogenen sozialen Netzwerke“[78] und kümmerten sich überdies noch um Erziehung, Haushalt und Ernährung. Damit war ihr Alltag bestimmt von Arbeit im Quartier. Daraus folgte auch eine stärkere Anbindung an das Quartier und damit auch die Notwendigkeit einer guten Position im sozialen Feld.[79]
4.4 Kinder, Jugendliche und ältere Menschen
Der Kinderalltag in den Arbeitersiedlungen fand meist auf Höfen und Straßen statt. Zu der Verengung des Platzes durch höhere Wohndichte kam auch noch das Bevölkerungswachstum hinzu, welches zu einer starken Ballung von Kindern im engen Stadtraum führte.[80] Kinder verbrachten ihre Zeit oft nur in einem Teil ihres Quartiers und nicht im ganzen Viertel. Ihre Wohnlage bestimmte auch mit welchen Kindern sie spielten und durch die Offenheit der Wohnungen war es nicht möglich, „Ein- und Ausgrenzungen der Mitglieder zu gewährleisten“[81]. Wie bei den Eltern gab es auch bei den Kindern geschlechtsspezifische Normen. Mädchen aus der Arbeiterschaft hielten sich zwar eher auf der Straße auf, als solche aus dem Bürgertum, jedoch gab es auch hier Grenzen. Mädchen waren meist stärker isoliert und wurden auch stärker in den Haushalt einbezogen. Schon früh lernten sie die Aufgaben einer Hausfrau und Mutter, wie beispielsweise das Einkaufen und die Beaufsichtigung jüngerer Geschwister. Unter Kindern gab es nicht so eine starke Schichtenzugehörigkeit wie bei den Erwachsenen. So kam es nicht selten vor, dass Kinder aus Bürgertum und Arbeiterschaft spielten und gemeinsam Zeit verbrachten.
Das Verhalten der Arbeiterkinder unter ihresgleichen ist noch zu unreichend erforscht. In einigen Quartieren kam es zu Bandenkämpfen, Gewalttätigkeiten und Alkoholmissbrauch, welche durch die Orientierungslosigkeit Jugendlicher zwischen Beruf und Schule verstärkt wurden. Darüber hinaus war es für die meisten nicht möglich das Quartier zu verlassen und ihren Erfahrungsraum zu vergrößern, da das Geld dazu fehlte. So kann es möglich sein, dass diese Erkenntnis Frustration mit sich brachte und auch ihren Teil zur Gewalttätigkeit und dem Alkoholmissbrauch beitrug.
Ältere Menschen hingegen waren auf das Quartier angewiesen, da ihr Aktionsradius eingeschränkt war. Darüber hinaus zeichneten sie sich oft durch eine starke emotionale Abhängigkeit zum Quartier aus, da viele dort ihre Kindheit und Jugend verbracht hatten.[82]
5. Fazit
Die vorgestellten Ergebnisse unterschiedlichster Autoren haben allen voran eines gemeinsam: die Erfüllung von Hygienestandards, die Höhe des Wohnungskomforts und die Bauqualität hingen maßgeblich von finanziellen Mitteln und den Intentionen der Investoren ab. Charakteristisch für eine Arbeiterbehausung waren eine hohe Wohndichte und der Verlust der Privatsphäre. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass Letzteres kein Kriterium für den Wohnungsbau war, sondern sich erst im 20. Jahrhundert durch die pauschale Abgeschlossenheit der Wohnungen entwickelt hat.
Aus heutiger Sicht sind die Arbeiterbehausungen damaliger Zeit vielfach zu kritisieren, jedoch waren die Ansprüche zur Kaiserzeit andere als die heutigen.
Vielen Arbeitern ging es in erster Linie darum, dass die Unterkunft finanzierbar war. Dem folgte der Wunsch nach einem kurzen Weg zur Arbeit und erst dann stellte sich die Frage nach dem Lebensstandard, den die Behausung mit sich brachte. An dem Beispiel der „guten Stube“ wird deutlich, dass der Platzmangel in seinem Stellenwert hinter dem Ansehen stand.
Darüber hinaus ist die Quartiersanhänglichtkeit ein Indiz für die Anpassung an die gegebenen Lebensumstände der Arbeiter.
Möchte man die verschiedenen Wohnformen aus der geschilderten Sicht betrachten, so fällt das Urteil Milde aus. Bessere Wohnungen waren sicherlich jene, welche in Gartenstädten vorzufinden waren. Hierbei spielte jedoch auch die Umgebung und die Verbundenheit zur Natur eine gewisse Rolle. Siedlungen von Baugenossenschaften und die Entstehung der Mietshausviertel können nicht pauschal Kategorien zugeordnet werden. Zum einen liegt das daran, dass es von Zeit zu Zeit und Ort unterschiedlichen Kriterien für diese Art des Wohnungsbaus gab, zum anderen stellt sich die Frage, ob man von einer „besseren“ Wohnung spricht, wenn sie mehr Platz bietet oder wenn sie besserer Bauqualität ist. Daraus wird deutlich, dass eine Kategorisierung der Wohnungsreformen immer von der Sichtweise des Betrachters abhängt. Aus soziologischer Sicht wurde klar, dass die Lage der Unterschichten zwar einen Verlust an Intimität mit sich brachte, aber auch, dass es offensichtlich stärkere Bindungen der Mietparteien untereinander gab. Offen bleibt, welche Rolle der Zusammenhang zwischen Werten und tatsächlicher Realität dem Alltagsleben der Arbeiter zugesprochen wird. Wie gingen sie mit den gegebenen Umständen um? Welche Vorstellungen hatten sie von einer guten Unterkunft?
Quellen- und Literaturverzeichnis:
Behnken, Imbke/Zinnecker, Jürgen „Vom Straßenkind zum verhäuslichten Kind. Zur modernisierung städtischer Kindheit 1900-1980“ in : SOWI 16. Jg., 1987 , H. 2, S. 88.
Brüggemeier, Franz J./Niethammer, Lutz: Schlafgänger, Schnapskasinos und schwerindustrielle Kolonie. Aspekte der Arbeiterwohnungsfrage im Ruhrgebiet vor dem ersten Weltkrieg, in: Reulecke, Jürgen/Weber, Wolfhard (Hrsg.): Fabrik, Familie, Feierabend. Beiträge zur Sozialgeschichte des Alltags im Industriezeitalter, Wuppertal 1978, S.144.
Grüttner, Michael: Soziale Hygiene und Soziale Kontrolle. Die Sanierung der Hamburger Gängeviertel 1892 bis 1936, in: Herzig, Arno/Langewiesche, Dieter/Sywottek, Arnold (HRSG.),“Arbeiter in Hamburg. Unterschichten, Arbeiter und Arbeiterbewegung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, Hamburg 1983, S.360.
Hafner, Thomas: Kollektive Wohnreformen im deutschen Kaiserreich (1871-1918). Anspruch und Wirklichkeit, Stuttgart 1988.
Heller, Hartmut. Gartenstädte als Teil deutscher Großstädte, in: Kohlmann,Theodor/Bausinger, Hermann (Hrsg.), Großstadt. Aspekte empirischer Kulturforschung, Berlin 1985, S.55.
Kanacher, Ursula: Wohnstrukturen als Anzeiger gesellschaftlicher Strukturen. Eine Untersuchung zum Wandel der Wohnungsgrundrisse als Ausdruck gesellschaftlichen Wandels von 1850 bis 1975 aus der Sicht der Elias‘schen Zivilisationstheorie, Frankfurt am Main 1987.
Kirsch, Peter: Arbeiterwohnsiedlungen im Königreich Württemberg, Diss., Tübingen 1982.
N.N.: Geschichte der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in Berlin, Hg. vom Verband Berliner Wohnungsbaugenossenschaften und –gesellschaften e.V., Berlin 1957.
Novy, Klaus (Hrsg.), Wohnreform in Köln, Geschichte der Baugenossenschaften, Köln 1986.
Osthaus, Karl-Ernst: Gartenstadt und Städtebau, in: F. Bollerey/G. Fehl/K.Hartmann (Hrsg.): Im Grünen wohnen - im Blauen planen. Ein Lesebuch zur Gartenstadt mit Beiträgen und Zeitdokumenten (Stadt, Planung, Geschichte; Band 12), Hamburg 1990, S.119.
Pohle, Ludwig: Die Wohnungsfrage. Die städtische Wohnungs- und Bodenpolitik (Sammlung Göschen, Band 496), Leipzig 1910.
Reulecke, Jürgen: Geschichte der Urbanisierung in Deutschland (edition suhrkamp, N.F., Band 249), Main 1985.
Ritter, Gerhard A./Tenfelde, Klaus: Arbeiter im deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914, Bonn 1992.
Sutcliffe, Anthony: Urban Planning in Europe and North America before 1914: International Aspects of a Prophetic Movement, in: Teuteberg, Hans J. (Hg.): Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert. Historische und geographische Aspekte, Köln 1983, S. 441-474.
Teuteberg, Hans J./Borscheid, Peter (Hrsg.): Wohnalltag in Deutschland 1850-1914. Bilder, Daten, Dokumente (Studien zur Geschichte des Alltags, Band 3), Münster 1985.
Von Saldern, Aldelheid: Häuserleben. Zur Geschichte städtischen Arbeiterwohnens vom Kaiserreich bis heute (Politik- und Gesellschaftsgeschichte, Band 38), Bonn 1995.
Von Saldern, Adelheid: Im Hause, zu Hause. Wohnen im Spannungsfeld von Gegebenheiten und Aneignungen, in: Reulecke, Jürgen (Hrsg.): 1800-1918. Das bürgerliche Zeitalter (Geschichte des Wohnens, Band 3), Stuttgart 1997, S.145-332.
Zimmermann, Clemens: Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik. Die Reformbewegung in Deutschland 1845-1914 (Kritische Studien zur Geschichtwissenschaft, Band 90), Göttingen 1991.
Zimmermann, Clemens: Wohnen als sozialpolitische Herausforderung. Reformerischen Engagement und offentliche Aufgaben, Jürgen Reulecke (Hrsg.): 1800-1918. Das bürgerliche Zeitalter (Geschichte des Wohnens, Band 3), Stuttgart 1997, S.503-636.
Aus dem WWW:
Siebel, Walter: Urbanität als Lebensweise ist ortlos geworden.
Die gute Stadt als Utopie von Freiheit, Toleranz und Unabhängigkeit hat ausgedient/ Walter Siebel über die widersprüchlichen Erwartungen an Metropolen., in: Frankfurter Rundschau 174 (2000), S.7.
http://www.lauber.de/urban.html
eingesehen am 17.04 um 15:37 Uhr.
[...]
[1] Vgl. Hafner, S. 32.
[2] Vgl. Hafner, S. 33.
[3] Hafner, S. 34.
[4] Vgl. Hafner, S. 35.
[5] Hafner, S. 41.
[6] Vgl. Hafner, S.42.
[7] Vgl. Reulecke, „Urbanisierung“, S. 68.
[8] Pohle, S. 17.
[9] Vgl. Brüggemeier/Niethammer, S. 144.
[10] Vgl. Hafner, S.55.
[11] Hafner, S.55.
[12] Geschichte der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, S.16 f.
[13] Vgl. Hafner, S. 56.
[14] Vgl .Ebda..
[15] Vgl. von Saldern „Häuserleben“, S.144.
[16] Vgl. Sutcliffe, S.441 ff.
[17] Vgl. Reulecke „Urbanisierung“, S.87.
[18] Vgl. von Saldern „Häuserleben“, S.144.
[19] Reulecke/Weber, S. 142.
[20] Vgl. von Saldern „Häuserleben“, S. 46.
[21] Vgl. Hafner, S.23.
[22] Vgl. von Saldern „Häuserleben“, S. 49.
[23] von Saldern „Häuserleben“, S. 46.
[24] Kanacher, S. 122.
[25] Vgl. Kanacher, S. 122.
[26] Vgl. .Hafner, S. 243.
[27] Vgl. Zimmermann, „Wohnungsreform“, S.69.
[28] von Saldern, „Häuserleben“, S.53.
[29] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 53 f.
[30] Kirsch, S. 99.
[31] Vgl. Hafner, S. 240.
[32] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 52 f.
[33] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 54.
[34] Vgl. Hafner, S. 42
[35] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 54.
[36] „Im Grünen wohnen“, S. 119.
[37] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 54.
[38] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 55.
[39] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 55.
[40] Heller, S. 53.
[41] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 56.
[42] Vgl. Hafner, S. 132.
[43] Zimmermann, „Geschichte des Wohnens“, S. 605.
[44] Vgl. Zimmermann, „Wohnungsreform“, S. 62.
[45] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 57.
[46] Vgl. Novy, S. 142.
[47] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S.57.
[48] Zimmermann, „Wohnungsfrage“, S. 62.
[49] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 59.
[50] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 57 ff.
[51] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 60.
[52] Vgl. Hafner, S. 413.
[53] Vgl. Hafner, S. 415.
[54] Vgl. Hafner, S. 415 f.
[55] Hafner, S. 417.
[56] Vgl. von Saldern „Häuserleben“, S.45.
[57] Vgl. http://www.lauber.de/urban.html.
[58] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 80.
[59] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 80.
[60] Vgl. Kranacher, S. 123.
[61] Von Saldern, „Geschichte des Wohnens“, S. 198.
[62] Vgl. Ebda..
[63] Grüttner, S. 360.
[64] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 81 ff.
[65] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 84.
[66] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 84 f.
[67] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 85.
[68] Vgl. Ritter, S. 602 f.
[69] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 85.
[70] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 85.
[71] Teuteberg/Wischermann, S. 271.
[72] Vgl. Teuteberg/Wischermann, S. 271.
[73] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 86 f.
[74] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 87.
[75] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 88.
[76] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 88 f.
[77] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 89.
[78] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 90.
[79] Vgl. Von Saldern, „Häuserleben“, S. 90.
[80] Vgl. Behnken/Zinnecker, S. 88.
[81] Von Saldern, „Häuserleben“, S. 91.
[82] Vgl. Von Saldern „Häuserleben“, S. 91 ff.
- Arbeit zitieren
- Nina Bednarz (Autor:in), 2005, Wohnen und Alltagsleben der Arbeiter zur Zeit des deutschen Kaiserreiches, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110479
Kostenlos Autor werden


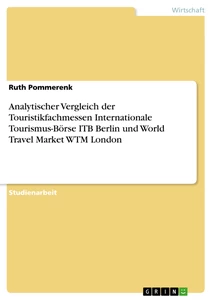

















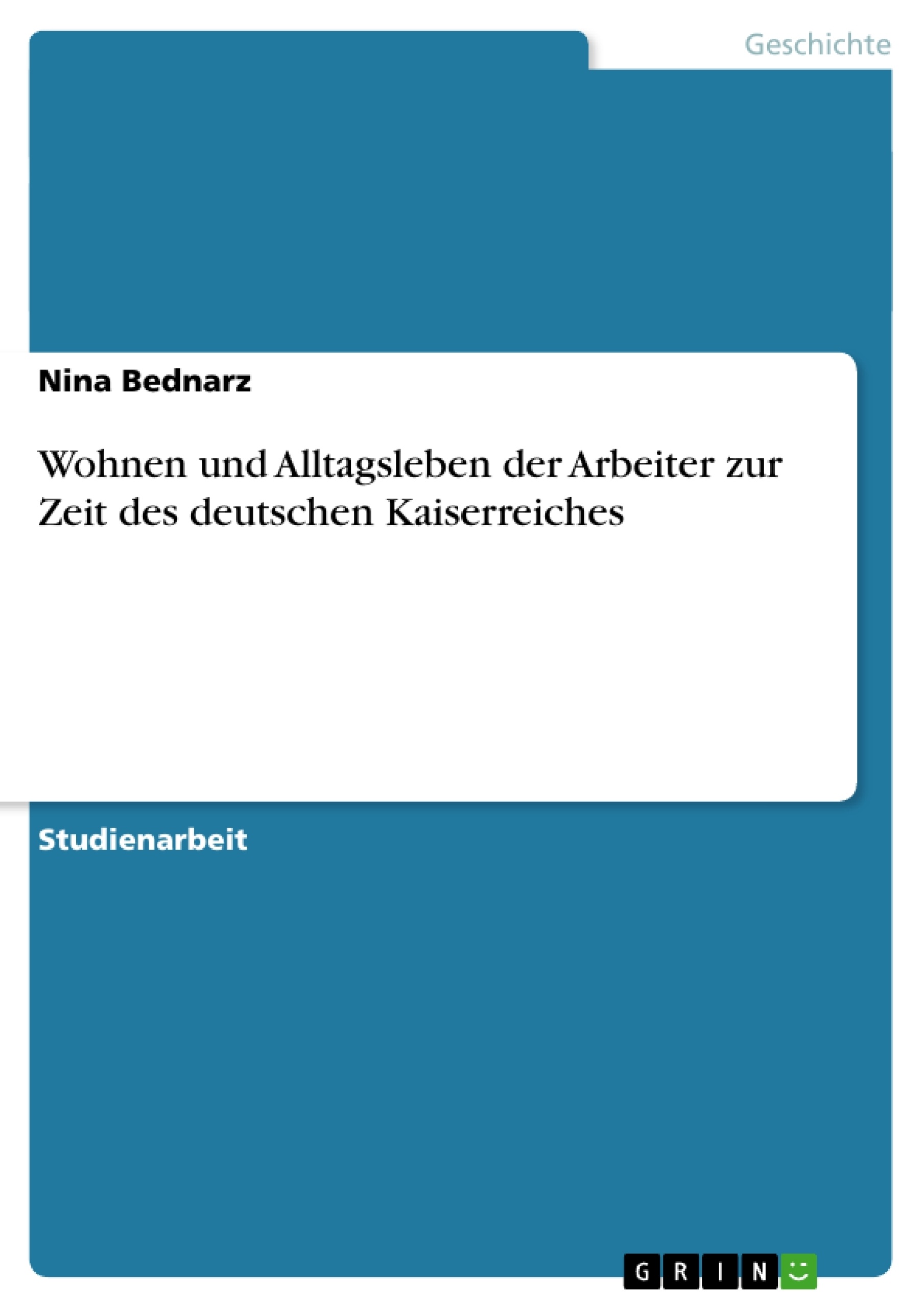

Kommentare