Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist unter einer psychischen Erkrankung zu verstehen?
2.1. Merkmale der Schizophrenie
2.1.1. Symptome und Formen der Schizophrenie
2.1.2. Entstehungs- und Verlaufsbedingungen der Schizophrenie
3. Stigma und Stigmatisierung
3.1. Stigmatisierungen als Generalisierungen
3.2. Diskreditiert und Diskreditierbar
4. Theoretische Hintergrundannahmen
4.1. Entstehung und Durchsetzung von Stigmatisierungen
4.2. Funktionen von Stigmatisierungen
4.3. Stigma als soziales Konstrukt: Vorurteile und Stereotype
4.4 Der Stigmatisierungsprozess
5. Geschichte der Psychiatrie und psychischer Krankheiten
5.1. Jahrhunderte der Ausgrenzung
5.2. Die Psychiatrie-Enquete
6. Das Bild des psychisch Kranken in der Öffentlichkeit
6.1. Das Bedürfnis nach sozialer Distanz
6.2. Mögliche Einflussfaktoren
6.2.1. Der Einfluss der Medien
6.2.2. Schizophrenie als Metapher
6.2.3. Die Darstellung von psychisch Kranken und Psychiatrie in den Medien
6.3. Die Attentate auf Politiker und die Folgen
6.3.1. Die tatsächliche Bedrohung durch psychisch Kranke
7. Stigma und Identität
7.1. Die Stigma-Identitäts-These
7.2. Die Sozialisation zum Stigmatisierten
7.2.1. Der Etikettierungsansatz nach Scheff
7.2.2. Der modifizierte Etikettierungsansatz nach Link
7.3. Subjektives Stigmatisierungserleben psychisch Kranker
7.4. Selbststigmatisierung
7.5. Subjektives Krankheitsbewusstsein
8. Folgen von Stigmatisierungen
8.1. Die Ebene der sozialen Interaktion: Das soziale Netzwerk
8.1.1. Die Angehörigen
8.2. Die Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe
8.2.1. Die berufliche Situation
8.3. Lebensqualität
9. Bewältigungsmöglichkeiten
9.1. Empowerment
9.1.1. Empowerment in der psychosozialen Praxis
9.2. Netzwerkinterventionen
9.2.1. Die Angehörigenhilfe
9.3. Internationale, nationale und regionale Antistigmakampagnen
9.3.1. Praxisbeispiel: Entstigmatisierungskampagnen an Schulen
9.3.2. Praxisbeispiel: Schulungen von Polizisten
10. Resümee
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Psychisch erkrankt zu sein ist in unserer Gesellschaft mit negativen Vorurteilen behaftet. Das Stigma „psychische Krankheit“ wird zum alles bestimmenden Merkmal, hinter dem das Individuum verschwindet. Psychische Krankheit ist ein Tabuthema, über das häufig nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Als Folge der negativen Vorurteile leiden psychisch Kranke so stark wie kaum eine andere Minderheit unter Stigmatisierungen und Diskriminierungen. Sie sind somit einer doppelten Belastung ausgesetzt. Erstens müssen sie lernen, mit ihren Symptomen zu leben und diese in ihr Selbstbild zu integrieren. Zweitens müssen sie lernen, mit den Stigmatisierungen und Diskriminierungen im Alltag und in der Psychiatrie umzugehen. Hinzu kommt, dass viele selber mit den Vorurteilen gegenüber psychisch Kranken aufgewachsen sind. Auf solche Weise sozialisiert, erwarten sie stigmatisierendes Verhalten ihrer Umwelt und wenden die Vorurteile unter Umständen gegen sich selber.
Während meiner Praktikumszeit in einer Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie wurde ich von vielen Freunden und Bekannten gefragt, wie ich das denn aushalten würde; und dass es ja wohl sehr schwer sein müsse, dort zu arbeiten. Auch äußerten viele die Befürchtung, dass ich sie jetzt mit „psychiatrischen Augen“ betrachten würde und eine psychische Erkrankung bei ihnen entdecken könnte. Diese Erfahrungen haben mir gezeigt, wie groß die Angst vor psychisch Kranken, der Psychiatrie und den eigenen „abweichenden Anteilen“ sein kann.
Dass Stigmatisierungen einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben können, fand in den letzten Jahren immer mehr Beachtung in psychiatrischer Fachliteratur. Angermeyer spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem „Boom der Stigmaforschung“.[1]
In Deutschland ist Schizophrenie das Innbild von psychischen Erkrankungen, und gleichzeitig ist Schizophrenie die Krankheit, die mit den negativsten Vorurteilen besetzt ist. Aus diesem Grund beziehen sich die meisten Stigmaforschungen auf das Krankheitsbild der Schizophrenie. In meiner Arbeit werde ich ebenfalls den Schwerpunkt auf die Stigmatisierung schizophren Erkrankter legen.
Die vorliegende Arbeit wird insbesondere der Frage nachgehen, wie psychische Krankheit und Stigmatisierungen subjektiv erlebt werden. Das subjektive Stigmatisierungserleben ist davon geprägt, wie Stigmatisierungen tatsächlich erfahren werden, und was für Stigmatisierungen von den Betroffenen erwartet werden. Eine zentrale Frage dabei lautet, inwiefern die negativen Vorurteile und Stigmatisierungen Auswirkungen auf das Selbstbild des psychisch Kranken haben. Leider gibt es zu den Fragen des subjektiven Stigmatisierungserlebens, der Selbststigmatisierung und der individuellen Möglichkeiten zur Bewältigung bisher nur sehr wenige Veröffentlichungen. Die Stigmaforschung der letzten Jahrzehnte hat sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, ob psychische Erkrankungen überhaupt mit negativen Vorurteilen besetzt sind. Während Goffman sich in seinem Werk „Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität.“ schon 1963 mit der subjektiven Bewältigung von Stigmatisierungen befasste, wurde dieses Thema danach über viele Jahre ignoriert.
Zu Beginn der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Definitionen der Begriffe psychische Krankheit, Schizophrenie, Stigma und Stigmatisierung erläutert.
Dem folgen verschiedene Theorien, die zu erklären versuchen warum es überall auf der Welt negative Vorurteile gibt. Anhand der Geschichte wird gezeigt, dass es Vorurteile gegenüber psychisch Kranken in Mitteleuropa (fast) immer gab. Nur vor diesem Hintergrund ist es möglich, die Situation psychisch Kranker zu verstehen und wirkungsvolle Programme zur Entstigmatisierung zu entwickeln.
Um die Situation psychisch Kranker zu verstehen, wird in dem Folgenden die Einstellung der Allgemeinbevölkerung zu psychisch Kranken und das Ausmaß der sozialen Distanz mithilfe renommierter Studien, dargelegt.
Welche Auswirkungen die Stigmatisierungen auf das stigmatisierte Individuum haben können, zeigen das siebte und achte Kapitel. In dem siebten Kapitel steht das Individuum im Mittelpunkt, welche Strategien es entwickelt um mit Stigmatisierungen umzugehen und wie sich diese auf das Selbstbild auswirken können. Im achten Kapitel geht es um die Folgen von Stigmatisierungen auf den Ebenen der sozialen Interaktionen und der Teilhabe an der Gesellschaft.
Abschließend werden verschiedene Bewältigungsmöglichkeiten vorgestellt.
Die „Nicht-Stigmatisierten“ werde ich im Folgenden als die Normalen bezeichnen. Zur besseren Lesbarkeit werde ich mich auf die männlichen Formen beschränken, und möchte die Leser bitten, in Gedanken die weibliche Form mit einzubeziehen.
2. Was ist unter einer psychischen Erkrankung zu verstehen?
Eine Definition für psychische Erkrankungen zu finden ist nicht einfach. Die Frage, was ein psychisch Kranker ist, ist ähnlich schwer zu beantworten, wie die Frage, was denn ein Mensch wäre.
Sehr treffend ist die Definition von Dörner et al., die psychisch Kranke als Menschen betrachtet, die bei der Lösung ihrer Probleme in einer Sackgasse gelandet sind, aus der sie nicht mehr heraus wissen und dadurch in eine Krise geraten. Für den psychisch Kranken ist das Bedürfnis, Nicht-Erklärbares zu erklären zu groß und zu schmerzhaft geworden, und damit sind sein Schutzbedürfnis und seine Verletzbarkeit gestiegen. Das Ergebnis wird Krankheit, Kränkung, Störung, Leiden oder Abweichung genannt. Das Wort Kränkung kann körperlich und seelisch interpretiert werden, als Kränkung des Körpers, der Beziehungen und des Selbst. Genauso vielseitig ist der Begriff der Störung. Jemand kann eine Störung haben, gestört werden, sich selber stören oder andere stören.[2]
Das Ersetzen von Begriffen wie „verrückt“ oder „irre“ durch den Begriff der Krankheit half anfangs, diese behandeln zu können. Sie wurden damit aus dem Bereich des Mysthischen herausgehoben. Krankheiten sind Störungen im Lebenslauf, die mit einer Herabsetzung der Leistungsfähigkeit einhergehen. Eine Krankheit kann akut und/oder chronisch verlaufen. Es werden bestimmte Symptome diagnostiziert, woraufhin eine Diagnose gestellt wird. Diese ermöglicht eine zielgerichtete Behandlung und damit eine Vorhersagbarkeit des Verlaufes.
Wenn der Aspekt der Beziehung mitbetrachtet wird, kann nicht mehr von einem einzelnen Krankheitsträger gesprochen werden, sondern es muss das Umfeld mit einbezogen werden. „ Die Suche nach den kranken Anteilen in einem Menschen wird zur Suche nach den derzeitigen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, eine Beziehung zu sich, zu anderen oder zur Umwelt aufzunehmen.“[3] Krank ist ein Mensch, doch das bedeutet nicht, dass die Umwelt nicht dazu beiträgt, so und nicht anders zu sein.
Der Begriff der psychischen Erkrankung wird vor allem in der Psychiatrie benutzt, wo die Menschen auch als Patienten bezeichnet werden, und mit diesen Begriffen geht automatisch auch ein heilen wollen einher. Durch den Begriff der Krankheit wird sie zu einem objektiven Begriff, er kann davon abhalten die Person mit der psychischen Erkrankung in ihrem So-Sein zu akzeptieren.
Nüesch plädiert in ihrem Buch für den Gebrauch des Terminus „psychische Behinderung“, vor allem wegen der sozialen Dimension dieses Begriffs. Behinderung wird im Gegensatz zur Krankheit als eine dauerhafte und sichtbare Abweichung gesehen. Wobei der Begriff der Abweichung kritisch zu hinterfragen ist, da er eine Norm voraussetzt. So ist es theoretisch möglich, dass eine Behinderung als Zuschreibungsprozess von außen entsteht, ohne dass ein objektiver Grund vorliegt. Ein Mensch gilt als behindert, wenn eine Abweichung von der Norm vorliegt und dieses von der sozialen Umwelt als negativ gewertet wird. Auch wenn die Behinderung zeitlich begrenzt ist, bleibt doch das Stigma an dieser Person haften, so dass sie auch nach der Genesung als behindert betrachtet wird.[4]
2.1. Merkmale der Schizophrenie
Vor allem schizophren Erkrankte sind von Stigmatisierung und sozialer Distanz betroffen. Es gibt keine andere psychische Krankheit die von der Allgemeinbevölkerung mit so vielen negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht wird. In Deutschland wird psychische Erkrankung automatisch mit Schizophrenie in Verbindung gebracht, dabei aber verkehrt verstanden. Dies hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass nur wenige Menschen in der Allgemeinbevölkerung über Wissen über das Krankheitsbild verfügen. So glauben 80% der Bevölkerung irrigerweise, dass an Schizophrenie erkrankte unter einer gespaltenen Persönlichkeit leiden. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass das Wort schizophren umgangssprachlich meistens benutzt wird um eine Widersprüchlichkeit auszudrücken. Dabei ist aber auch zu beachten, dass das Wort schizophren wörtlich übertragen „Spaltungsirresein“ bedeutet. Deswegen wurde auch schon überlegt, diese Diagnose umzubenennen.[5]
Der Begriff der Schizophrenie als Diagnose wurde 1911 von E. Bleuler geprägt. Er wollte damit die nach seiner Meinung charakteristischen Merkmale der Schizophrenie zum Ausdruck bringen. Die Spaltung bezieht sich dabei auf eine mangelhafte Einheit, eine Zersplitterung und Aufspaltung des Denkens, Fühlens und Wollens und des subjektiven Empfindens. Er löste damit den von Kraeplin geprägten Begriff der „Verblödungspsychosen“ ab.[6]
Nach Dörner gibt es nicht die typische Schizophrenie sondern „jeder entwickelt seine eigene Schizophrenie“ [7]. Trotzdem gibt es die Diagnose der Schizophrenie mit spezifischen Symptomen und Untergruppen. Sie ist vor allem in dem weiteren Krankheitsverlauf sehr individuell. Nach Bleuler liegt das Besondere darin, dass „das Gesunde dem Schizophrenen erhalten bleibt“ [8].
Schizophrenie ist eine ernste, aber gut behandelbare Krankheit. Sie kann akut auftreten oder schleichend verlaufen, und sie kann kurze Zeit andauern, einmalig auftreten oder chronisch verlaufen und zur Invalidität führen.[9] Die Schizophrenie ist bei Frauen und Männern in etwa gleich häufig anzutreffen. Von 100.000 Menschen sind zwischen 250 und 530 Menschen an einer Schizophrenie erkrankt, und 1-2 Prozent der Bevölkerung werden einmal in ihrem Leben an einer Schizophrenie erkranken.[10]
2.1.1. Symptome und Formen der Schizophrenie
Es gibt einige Merkmale (Symptome), die als typisch schizophren bezeichnet werden und sich in allen Kulturen gleichermaßen finden, auch wenn die Inhalte unterschiedlicher Ausprägungen sind. Sie können stark auftreten oder auch so gut wie gar nicht vorhanden sein.
Dazu zählen Störungen des Denkens, Störungen des Gefühls, Störungen des Wollens, Handelns und des Ich-Erlebens. Hinzu kommen die akzessorischen (zusätzlichen) Symptome wie Halluzinationen, Wahnvorstellungen und katatone Symptome (Störungen der Motorik).[11]
Die Grenzen zwischen dem Individuum und der Welt verschwimmen oder werden gänzlich aufgehoben. Die schizophren erkrankte Person kann nicht mehr sagen wer sie ist. Häufig entsteht ein Gefühl, dass die Gedanken und Gefühle abgezogen werden und nur Leere und Kälte übrig bleibt. Oder das Gegenteil tritt ein: Die Gefühle und Gedanken werden von außen eingegeben, von anderen Personen oder Kräften beeinflusst und der Erkrankte fühlt sich ihnen ausgeliefert.[12]
Die Störungen des Denkens sind durch formale und inhaltliche Denkstörungen gekennzeichnet. Das Denken erscheint dem Beobachter als zusammenhangslos und unlogisch. Die Patienten können ihren Gedankenablauf als zu schnell oder zu langsam erleben. Häufig erleben sie Denkzerfahrenheit. Diese ist durch sprunghafte Gedankenabläufe gekennzeichnet, wodurch unverständliche Sätze entstehen können. Es kann sein, dass der Patient an einer gestellten Frage vorbeiredet, verschiedene Gedanken in einem Wort ausgedrückt werden (Kontaminationen) und Wortneuschöpfungen (Neologismen) entstehen. Außerdem haben viele Patienten das Gefühl, jemand würde ihnen die Gedanken aus dem Gehirn absaugen (Gedankenabreißen). Zu den inhaltlichen Denkstörungen gehören Wahnvorstellungen, -ideen, -bildungen. Die Wahninhalte beziehen sich auf unmögliche, unglaubliche oder falsche Überzeugungen, die oft bizarr erscheinen. Diese Überzeugungen sind nur kurzfristig beeinflussbar, die subjektive Überzeugung wird zwanghaft aufrechterhalten. Teile des Wahns entspringen oftmals allgemein anerkannten Vorstellungen, oder Vorstellungen aus der Familientradition, sie unterliegen häufig gesellschaftlichen Einflüssen und verweisen auf Tabus oder Selbstverständlichkeiten. Er beinhaltet oft eigene aggressive oder liebende Wunschvorstellungen und kann damit als Ausdruck eines inneren, unlösbaren Konfliktes oder eines tiefen menschlichen Bedürfnisses gesehen werden. Über die Wahnvorstellungen behält der Patient Kontakt zur Außenwelt und er gerät in panische Angst, wenn diese angezweifelt werden. Häufigste Formen sind Verfolgungswahn, Beeinflussungs- und Beziehungswahn.[13]
Die Gefühlswelt erscheint verarmt, und die Betroffenen erscheinen kühl und gläsern. Die Gefühlsäußerungen durch Mimik und Gestik stimmen nicht mit dem Gesagten überein, es tauchen auch sehr heftige, starke Gefühle auf. Sie scheinen bindungsunfähig, oft zu einer Person zwiespältig und haben häufig wenig Kontakt zur Außenwelt. Die Zwiespältigkeit, die Gleichzeitigkeit von Wollen und Nicht-Wollen, kann zu Handlungsunfähigkeit (Stupor), zu Unterbrechungen, Abbrüchen und mutlosen Neuanfängen führen. In Situationen, in denen sich Patienten bedroht fühlen, überwiegen Erregung, Spannung und Angst. Besonders schwierig sind Situationen, in denen sich die Handlungsunfähigkeit bis auf die Motorik auswirkt (katatoner Stupor), sodass der Mensch sich überhaupt nicht mehr äußern kann.[14]
Die Wahrnehmung ist insofern gestört, dass Dinge als zusammengehörig gesehen werden, die nicht zusammen gehören, bzw. auf die eigene Person bezogen werden. Unwesentliche Dinge bekommen eine starke, subjektive Bedeutung, so dass der Patient denkt, er werde von diesen gemeint, beobachtet, bedroht. Die Verfremdung der Umwelt wird als Derealisation bezeichnet, und die Verfremdung der eigenen Person, des eigenen Körpers, als Depersonalisation. Es gibt Wahrnehmungen, für die es keine äußeren Reize gibt, am häufigsten werden Stimmen gehört (akustische Halluzinationen),es kommen aber auch haptische, optische und Geruchshalluzinationen vor.[15]
Es wird zwischen verschiedenen Subtypen der Schizophrenie unterschieden. Dazu zählen: paranoide Schizophrenie, hebephrene Schizophrenie, katatone Schizophrenie, undifferenzierte Schizophrenie, postschizophrene Depression, schizophrenes Residuum, Schizophrenia simplex, andere Schizophrenie, nicht näher bezeichnete Schizophrenie.[16] Etwa 80% der chronisch schizophrenen Patienten hatten mindestens einmal in ihrem Leben eine paranoide Schizophrenie, die damit die häufigste Formist. Kennzeichnend sind Verfolgungs- und Beziehungswahn, akustische Halluzinationen, aber auch andere Formen des Wahns oder der Halluzinationen. Die Phänomene organisieren sich um ein einheitliches Motiv.[17] Es wird zwischen positiven und negativen Symptomen unterschieden. Die positiven standen lange Zeit in dem Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, da sie als die Symptome ersten Ranges mit Wahn und Halluzinationen leichter als Schizophrenie zu erkennen sind. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Negativsymptomatik (eingeschränkte affektive Ausdrucksweise, Verarmung von Sprach- und Denkinhalten, Interessenverlust, reduzierte soziale Anteilnahme) subjektiv für den Patienten und seine Lebensqualität sehr bedeutsam sind.[18]
2.1.2. Entstehungs- und Verlaufsbedingungen der Schizophrenie
Wie ich oben schon einmal erwähnte, gibt es nicht den typischen Verlauf der Schizophrenie, sondern dieser ist individuell sehr verschieden.
Es kann auch nicht von allgemeingültigen Ursachen gesprochen werden. Es gab viele Forschungen und es gibt viele Hypothesen, aber keine wirkliche Antwort. Es gibt viele verschiedene Risikofaktoren, wie z.B. biologische, genetische und familiäre Einflüsse. Eine Hypothese ist, dass es bei schizophrenen Patienten eine erhöhte Rate von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen gab. Bei vielen schizophrenen Patienten konnten Auffälligkeiten in der kindlichen Entwicklung gefunden werden, wie unauffällige motorische Störungen, eine verzögerte sprachliche Entwicklung, verminderte kognitive Leistungsfähigkeit, erhöhte Ängstlichkeit und verringerte soziale Kontakte. Es gibt eine auffällige Häufung bei Geburten in Großstädten und im Winter. Zahlreiche Familien-, Adoptions- und Zwillingsstudien weisen auf eine genetische Komponente hin. Dass die Neurotransmitter eine Rolle spielen, konnte bisher nicht eindeutig bewiesen werden. Diese Hypothese basiert vor allem darauf, dass einige Symptome der Schizophrenie durch die Gabe von entsprechenden Medikamenten gedämpft werden können. Durch bildgebende Verfahren konnte bei schizophrenen Patienten Ventrikelerweiterungen, erniedrigte Volumen in verschiedenen Hirnregionen, sowie eine reduzierte Aktivität in dem präfrontalen Kortex bewiesen werden. Studien, die sich mit den psychosozialen Faktoren beschäftigen, stehen vor dem Problem, dass nicht gesagt werden kann, ob die stärkeren Belastungen in dem sozialen Umfeld eine Folge der Erkrankung sind, oder vorher schon da waren. Die älteren Ergebnisse aus der Familienforschung sind fragwürdig, da sie alleine der Mutter die Schuld zuweisen (schizophrenogene Mutter). Ein aktuelleres Konzept ist das der „High-expressed-emotions“. Es beschreibt einen familiären Kommunikationsstil, der von häufigen kritischen Kommentaren, allgemeiner Feindseligkeit und einer entmündigenden Überbehütung geprägt ist.[19] Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell versucht, die verschiedenen Hypothesen in einem Modell zu integrieren. Danach wird die Schizophrenie nicht direkt vererbt, sondern nur eine erhöhte Vulnerabilität. Durch belastende Lebensereignisse (z.B. Stress, „high-expressed-Emotions“) können sich dann im Zusammenwirken schizophrene Symptome ausbilden.[20]
Vor allem für die „sekundäre Prävention“ ist es wichtig, dass die schizophren Erkrankten lernen, ihre Frühwarnzeichen zu erkennen und lernen, andere Formen des Umgangs mit Konflikten zu finden.
3. Stigma und Stigmatisierung
Der Begriff des Stigmas wurde von Goffman[21] in die soziologische Diskussion eingeführt. Goffman definiert Stigmatisierung als „die Situation des Individuums, das von vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen ist“ [22].
In älteren Lexika (z.B. Knaur 1992) finden sich nur Hinweise zur Kirchengeschichte und zur Soziologie. In einer neuen Ausgabe des Brockhaus (2004) findet sich unter dem Begriff Stigmatisierung eine soziologische Definition. Der Begriff Stigma kommt aus dem griechischen und bedeutet Zeichen oder Brandmal. In der Kirchengeschichte ist es ein bei stigmatisierten Personen auftretendes Wundmal, das als Leidensmal von Jesus gedeutet wird. Stigmatisierung wird im Brockhaus definiert als „Zuordnung bestimmter, von der Gesellschaft, bzw. einer sozialen Gruppe negativ bewerteter Merkmale (z.B. nicht sesshaft, vorbestraft) zu einem Individuum, das damit sozial diskreditiert wird“[23].
In Griechenland wurde das Stigma als Kennzeichnung für Sklaven, Verbrecher und Verräter in den Körper geritzt oder gebrannt. Die so „gebrandmarkte“ Person war als moralisch minderwertig gezeichnet und sollte gemieden werden.[24]
Aus dem Religiösen kommt dem Begriff eine Doppeldeutigkeit zu. In dem Alten Testament wird ein Stigma auch als Kainszeichen oder Kainsmal bezeichnet, weil Kain seinen Bruder Abel erschlug. Als Strafe kennzeichnete Gott ihn mit einem Merkmal, dass ihn für unrein und ausgestoßen erklärte und somit Einsamkeit und soziale Isolation schuf. Gleichzeitig aber genoss er den besonderen Schutz Gottes, und das Kainsmal war Ausdruck der besonderen Beziehung zu ihm. Ausdruck dieser besonderen Beziehung sind auch die Wundmale Christi, die bei besonders gläubigen Christen auftreten können. Der erste belegte Fall war Franz von Assisi (1224). Seither gab es einige hundert Fälle, die fast ausschließlich Frauen waren.[25]
Diese Doppeldeutigkeit besteht bis heute fort. Stigmatisierten werden oftmals neben negativen auch positive Eigenschaften zugeschrieben, so z.B. dem Blinden eine bessere Intuition oder dem psychisch Kranken Genialität.
Eine anerkannte Definition von Stigma geht auf Jones et al. (1984) zurück, welche vorschlagen, dass “...das Stigma als eine Beziehung zwischen Attribut und Stereotyp gesehen werden kann, in dem Sinne, dass das Stigma ein 'Mal' (Attribut) ist, dass eine Person mit unerwünschten Eigenschaften (Stereotypen) verbindet” [26] .
3.1. Stigmatisierungen als Generalisierungen
Die stigmatisierte Person weicht mit einem Merkmal negativ von den (normorientierten) Erwartungen der Umwelt ab. Dem Stigmatisierten werden weitere negative und positive Eigenschaften zugeschrieben, die mit dem tatsächlich wahrgenommenen Merkmal objektiv nichts zu tun haben. Der Kategorie „psychisch krank“ wird z.B. häufig das Attribut Gewalttätigkeit zugeordnet. „Diese Zuschreibung weiterer Eigenschaften kennzeichnen Stigmatisierungen als Generalisierungen, die sich auf die Gesamtperson in allen ihren sozialen Bezügen erstrecken. Das Stigma wird zu einem »master status«, der wie keine andere Tatsache die Stellung einer Person in der Gesellschaft sowie den Umgang anderer Menschen mit ihr bestimmt.” [27]
Nach Hohmeier sollte beachtet werden, dass nicht das Merkmal an sich negativ ist, sondern dies erst durch die negative Zuschreibung entsteht. Erst in der Beziehung zu seiner Umwelt, durch die Relationen in der es zu ihr steht, die negative Definition und soziale Wertung, die ein Merkmal erfährt, entsteht ein Stigma.[28] Dieselbe Eigenschaft könnte sogar die Normalität eines anderen bestätigen.[29] Um dies zu verdeutlichen, wird häufig das Beispiel eines Soldaten angeführt, für den es unerlässlich ist zu töten.
Goffman führt außerdem das Beispiel der Collegeausbildung in den USA an. Einige Personen verheimlichen, eine Collegeausbildung zu haben, andere sie nicht zu haben, abhängig von dem beruflichen Umfeld. Beide Gruppen vermeiden damit, als Außenseiter oder Versager gesehen zu werden.[30]
Das Stigma, also ein negativ bewertetes Merkmal, tritt für den Normalen in den Vordergrund und wird auf die gesamte Person übertragen, so dass andere Eigenschaften nicht wahrgenommen werden. “Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, daß wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden, wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen wird.” [31]
Die Gesellschaft hält einen ganzen Satz von Kategorisierungen und Attributen bereit, die von der Allgemeinbevölkerung als gewöhnlich und natürlich empfunden werden. Ohne darüber nachzudenken, werden diese normativen Erwartungen in rechtmäßig gestellte Anforderungen umgewandelt.
3.2. Diskreditiert und Diskreditierbar
Goffman unterscheidet zwischen drei „krass verschiedene(n) Typen“ von Stigmata. Neben den „Abscheulichkeiten des Körpers“ und den „phylogenetischen Stigmata von Rasse, Nation und Religion“ benennt er die „individuellen Charakterfehler“. Diese werden unter anderem als Willensschwäche und unnatürliche Leidenschaften gesehen und leiten sich her aus einem bekannten Katalog an Kategorisierungen. Dazu zählt neben Gefängnishaft, Sucht, Arbeitslosigkeit, radikalem politischen Verhalten auch die „Geistesverwirrung“[32].
Finzen unterscheidet in Anlehnung an Goffman ebenfalls zwischen diesen drei Typen von Stigmata. Das Stigma, dass erst im Laufe des Lebens auftritt (wie die psychische Erkrankung) ist besonders schwer zu bewältigen, da die Betroffenen selbst mit den Vorurteilen und Vorbehalten aufgewachsen sind. Entsprechend entwickeln sie nach Finzen „zwangsläufig eine Missbilligung ihrer selbst “[33]. Dies tun sie abhängig von der Stärke der gesellschaftlichen Vorurteile und der tatsächlich erlebten Zurückweisungen im alltäglichen Leben. Finzen spricht in diesem Zusammenhang von einer zweiten Krankheit, welche das Genesungshindernis ersten Ranges werden kann. Die Angehörigen einer Minderheit, wie z.B. Rasse oder Nation, haben bessere Voraussetzungen um Stigmatisierungen zu überwinden, da sie erstens gesund sind und zweitens in eine Gemeinschaft von gleichermaßen stigmatisierten Individuen hineingeboren werden.[34]
Die besondere Situation der psychisch Kranken ist davon gekennzeichnet, dass ihr Stigma nicht sofort für jeden erkennbar sein muss. Bei anderen, wie zum Beispiel körperlich Behinderten, ist das Stigma auf den ersten Blick erkennbar, sie gehören damit in die Gruppe der diskreditierten. Die psychisch Kranken jedoch sind sowohl diskreditiert als auch diskreditierbar. Ein kleiner Kreis weiß von ihrer Erkrankung, aber gegenüber anderen werden sie wahrscheinlich versuchen, diese zu verheimlichen, da sie ja von den negativen Vorurteilen wissen.
Die „Selbstverständlichkeit des sozialen Umgangs ist aufgehoben“ [35] und somit werden dem Stigmatisierten „permanente Wachsamkeit und immer neue Anpassungsleistungen“ [36] abverlangt. Kommt es zu einer Entdeckung des Stigmas so fühlt sich der Nicht-Stigmatisierte, „zumeist auf das Stigma seines Gegenüber fixiert, dem Kontakt nicht gewachsen. Spannungen, Unsicherheit, Verlegenheit und Angst zeichnen deshalb Interaktionen zwischen Stigmatisierten und Nicht-Stigmatisierten in der Regel aus” [37]. Nach Goffman sind jedoch nicht diese Spannungen das eigentlich Unerträgliche, “sondern eher dies, die Information über ihren Fehler zu steuern. Eröffnen oder nicht eröffnen; sagen oder nicht sagen; rauslassen oder nicht rauslassen; lügen oder nicht lügen; und auf jeden Fall, wem, wie, wann und wo. ” [38]
Doch nicht nur die andauernde Sorge entdeckt zu werden, vermindert die Lebensqualität, sondern auch, dass die Nichteingeweihten ihre Vorbehalte in “aller Brutalität” [39] dem Diskreditierbaren gegenüber äußern werden. Sie würden wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise mit den Vorurteilen konfrontiert werden, wenn sie sich offenbaren würden, da die meisten Menschen doch ein gewisses Maß an Taktgefühl besitzen. Nach Finzen ist gerade der Austausch über die Krankheit und die damit verbundenen Probleme für die Kranken wichtig . “Das soziale Leben in einer Welt der Täuschung kann außerordentlich belastend werden und einen Rückfall begünstigen.” [40]
Es reichen in der Regel Verdachtsmerkmale um die Identifikation als Stigmatisierter auszulösen, dazu gehört der Kontakt mit Kontrollinstanzen, wie z.B. eine psychiatrische Klinik.[41] Wenn ein diskreditierendes Merkmal in Erfahrung gebracht wird, „...üben wir eine Vielzahl von Diskriminationen aus, durch die wir ihre Lebenschancen wirksam, wenn auch oft gedankenlos, reduzieren. Wir konstruieren eine Stigma-Theorie, eine Ideologie, die ihre Inferiorität erklären und die Gefährdung durch den Stigmatisierten nachweisen soll; manchmal rationalisieren wir derart eine Animosität, die auf anderen Differenzen - wie zum Beispiel sozialen Klassendifferenzen - beruht“ [42].
Während das Stigma, wie das Vorurteil, auf der Ebene der Einstellungen wirkt, ist die Stigmatisierung “...das Verhalten aufgrund eines zueigen gemachten Stigmas” [43].
Nach Cloerkes sollte überprüft werden, ob das stigmatisierende Verhalten tatsächlich einen Rückschluss auf das entsprechende, zugrundeliegende Stigma zulässt.[44]
4. Theoretische Hintergrundannahmen
Um Stigma und Stigmatisierung bekämpfen zu können, ist es wichtig, die Bedingungen und Ursachen ihrer Entstehung zu kennen, von welchen Faktoren es abhängig ist, dass es sich gesamtgesellschaftlich durchsetzen kann, und welche Funktionen es erfüllt. Schließlich gibt es auf der ganzen Welt, in jeder Kultur oder Gesellschaft Stigmatisierungen und Diskriminierungen. Sie scheinen also eine ganz bestimmte gesellschaftliche Funktion zu erfüllen. Wie in dem 9. Kapitel noch deutlich werden wird, erklären die Merkmale des Stereotyps, warum mit Informationskampagnen oder Protestaktionen keine Veränderung in der Einstellung der Allgemeinbevölkerung erreicht werden kann. Darum scheint es mir unerlässlich, auf die Merkmale des Vorurteils und der Stereotype näher einzugehen.
4.1. Entstehung und Durchsetzung von Stigmatisierungen
Die Frage danach, wie bestimmte Stigmata entstehen, was die Ursachen dafür sind, und wie sie sich durchsetzen, ist bis heute relativ wenig erforscht worden. Es existieren lediglich einige mehr allgemein gehaltene Hypothesen.
Wie kommt es zu der Durchsetzung von Stigmata und Prozessen der Stigmatisierung? Welche sozialen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ermöglichen, dass ein bestimmtes Stigma Geltung erlangt?
Hohmeier[45] stellte 1975 hierzu einige Hypothesen auf, und er wird auch in der aktuellen Literatur viel zitiert.
Eine Ursache sieht er in den Interessen globaler gesellschaftlicher Institutionen und Interessengruppen. Mit dieser Hypothese bezieht er sich auf die Herrschaftsstrukturen einer Gesellschaft, und wie diese Institutionen historisch feststellbar die Gesellschaft geprägt haben. So brachte zum Beispiel die Institution des Privateigentums den Dieb hervor. Die protestantische Arbeitsethik brachte die Stigmatisierung von Landstreichern und Arbeitslosen mit sich.
Eine zweite Ursache sieht er in der Dynamik gesellschaftlicher Differenzierungen. Hierbei schiebt er insbesondere Normen und Leistungsnormen in den Vordergrund. Denn jede Norm bietet die Möglichkeit, den Abweichenden zu stigmatisieren. Damit das Stigma jedoch seine volle Kraft entfalten kann, muss noch eine Machtdifferenz oder das Eingreifen von Kontrollinstanzen hinzu kommen.
Eine dritte Hypothese bezieht er auf die Zweck-Mittel-Orientierung unserer Gesellschaft. Diese ist vor allem bedeutend für Menschen die aus den Arbeitsverhältnissen herausfallen. Die Stigmatisierung wird bedingt oder verstärkt durch bestimmte kulturelle Ideologien, sie setzt bei diesem Unvermögen zur konformen Leistung an.
Eine vierte Hypothese bezieht sich schließlich auf die anthropologische Grundausstattung des Menschen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Menschen ein natürliches Bedürfnis nach Unterscheidung von anderen, nach Triebentladung von Aggressionen, Projektion von belastenden Ansprüchen sowie nach Orientierung durch übernommene Vorurteile haben.
Eine Ursache dafür, dass sich Stigmatisierungen durchsetzen können, findet Hohmeier[46] in den bereits erwähnten Generalisierungen. Einer Person mit einem scheinbar negativen Merkmal werden weitere negative Attribute zugeschrieben. Das Etikett psychisch krank wird praktisch automatisch als Stereotyp auf die gesamte Person übertragen.
Eine zweite Voraussetzung für die Durchsetzung sieht er darin, dass auf einen Normbruch hingewiesen werden kann. Dabei spielt insbesondere die Verbindlichkeit und Verbreitung der gebrochenen Norm, sowie auch das Eingreifen von „Sanktionsinstanzen“ eine wesentliche Rolle.
Eine Norm von höherer Verbindlichkeit und Verbreitung wird meistens auch schärfer sanktioniert. So findet zum Beispiel die Norm „du sollst nicht töten“ eine breite Anerkennung und wird auch schwer bestraft.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Macht, über die Stigmatisierte und Stigmatisierende verfügen. So kann ein Stigma gegenüber machtlosen leichter durchgesetzt werden als gegen jemanden, der über Macht verfügt.
Die Durchsetzung ist außerdem von den Herrschaftsstrukturen abhängig. Es ist davon auszugehen, dass Stigmatisierungen besonders häufig in Gesellschaften auftreten, wo entweder individuelle Leistung und Konkurrenz sehr viel zählen oder starke Spannungen zwischen gesellschaftlichen Gruppen bestehen.
4.2. Funktionen von Stigmatisierungen
Es gibt eine Vielzahl an Theorien, die sich mit den Funktionen von Stigmatisierungen beschäftigt haben. Dazu zählen nicht nur die Soziologie und die Sozialpsychologie, sondern auch die Philosophie, Anthropologie und Psychiatrie.
Als erstes möchte ich einige eher allgemein gehaltene Hypothesen vorstellen, bevor ich näher auf bestimmte Theorien eingehe, die in der Stigmadiskussion zu besonderer Geltung gelangt sind.
Nach Hohmeier[47] erfüllen Stigmatisierungen eine Vielzahl von Funktionen. Für das Individuum sowie für die Gesellschaft.
Für das Individuum hat ein Stigma eine „Orientierungsfunktion“. Durch die bereits erwähnten Generalisierungen eines Merkmals auf die ganze Person wird Handlungssicherheit ereicht und es entsteht die Illusion, die Person zu kennen. Beim Stereotyp vom psychisch Kranken wird dies allerdings umgekehrt. Durch das Attribut „Unberechenbarkeit“ werden die meisten Menschen in ihren Handlungen unsicher und gehen auf Distanz.
Aus tiefenpsychologischer Sicht dienen Stigmatisierungen unter anderem zur Abreaktion von Aggressionen. Des weiteren können sie auch als Projektionen von eigenen verdrängten Trieben verstanden werden. Hierbei sei auch auf die psychoanalytischen Studien im Zusammenhang von Vorurteilen und autoritärer Persönlichkeit hingewiesen.
Sie können aber auch als Strategien zur Identitätssicherung verstanden werden. Mit der Abkehr vom Stigmatisierten soll die eigene „Normalität“ betont werden. Viele Menschen haben Angst, sich mit der eigenen Psyche zu beschäftigen und vor etwaigen „Abweichungsgelüsten“. Außerdem sind viele den Umgang mit Stigmatisierten nicht gewöhnt und haben emotional, kognitiv und instrumental nicht die Möglichkeiten mit der Situation angemessen umzugehen.
Eine weitere Funktion besteht in dem sogenannten „Terror-Management“. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Welt unübersichtlich und chaotisch ist und die Menschen sich von ihrer eigenen Sterblichkeit bedroht fühlen. Diese Umstände schaffen eine lähmende Angst und den Wunsch nach Ordnung, Bedeutung und Übersichtlichkeit. Danach sondern Stigmatisierungen von der Norm abweichende Personen aus und schaffen damit „Übersichtlichkeit“ und „Vorhersehbarkeit“.
Auf der Individualebene wird außerdem die Funktion der Selbstwerterhöhung angeführt. Danach wird durch die Stigmatisierung von Randgruppen oder einzelnen Personen das eigene Selbstwertgefühl erhöht. Durch den Vergleich mit Personen die schlechter gestellt sind, wird eine Eigenaufwertung möglich gemacht.
Dieser Gedanke lässt sich auch auf Gruppen übertragen. Durch das „schlecht machen“ der anderen Gruppe wird der Wert der eigenen Gruppe erhöht. Durch die Bedeutung der eigenen Gruppe, können Diskriminierungen gegenüber anderen Gruppen gerechtfertigt werden.[48]
Ähnlich wie auf der Individualebene, haben Stigmatisierungen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene die Funktion der „Interaktionsregulation“, sie regeln den sozialen Verkehr zwischen den gesellschaftlichen Gruppierungen, wie den Zugang zu knappen Gütern.
Außerdem kommt ihnen eine „Systemstabilisierungsfunktion“ zu. Sie leiten Frustrationen und Aggressionen auf schwache „Sündenböcke“ um. Sie stabilisieren damit das System, indem sie von gesellschaftlichen und sozialen Problemen ablenken. Im Extremfall kann es auch zu einer Rechtfertigung des Systems über Stigmatisierungen kommen. Darüber wird die ungleiche Behandlung von Gruppen gerechtfertig. Damit erfüllen sie auch eine ganz bestimmte Herrschaftsfunktion. Um dies zu veranschaulichen, wird häufig das Beispiel der Judenverfolgung zur NS-Zeit herangezogen. Diesen wurde die Ursache von sozialen Missständen zugeschrieben und schließlich hat sich das System auch darüber gerechtfertigt. Nach Hohmeier ist dies immer dann der Fall, wenn von einer Gruppe behauptet wird, dass sie schlecht für die gesamte Gesellschaft sei.
Schließlich haben Stigmatisierungen in manchen Gesellschaften auch die Funktion, die Normkonformität zu stärken, denn ohne Stigmatisierte wäre es kein Vorteil, normal zu sein.
4.3. Stigma als soziales Konstrukt: Vorurteile und Stereotype
Zwischen Stigma, Vorurteilen und Stereotypen gibt es eine große inhaltliche Nähe. Nach dem Dreikomponenten-Modell der Einstellungsforschung lassen sich diese Begriffe folgendermaßen voneinander Unterscheiden: Vorurteile haben vor allem eine affektive Ausprägung, Stereotype sind kognitive Vorgänge und Stigmatisierungen können verhaltensbezogen gesehen werden.[49]
Nach Hohmeier ist das Stigma der “...Sonderfall eines sozialen Vorurteils gegenüber Personen, durch das diesen negative Eigenschaften zugeschrieben werden.”[50]
Für Stigmata wie für soziale Vorurteile gelten dieselben Definitionskriterien: “Immer negativ, komplexer Inhalt, affektive Geladenheit, historische und interkulturelle Variabilität, Tendenz zur Generalisierung des Merkmals auf die ganze Person”[51]. Allerdings bezieht sich Stigma auf konkrete Personen, während das Vorurteil weiter gefasst ist.
Ein Vorurteil ist ein Pseudo-Urteil über Personen und Personengruppen. Pseudo-Urteil, weil es nicht die Kriterien eines Urteils erfüllt, es wird nicht an der Wirklichkeit überprüft, ist verallgemeinernd und klischeehaft und beinhaltet meist eine extrem negative Bewertung und ist stark änderungsresistent. In ihrer ursprünglichen Fassung können Vorurteile sowohl positive wie auch negative Inhalte haben, meistens werden sie aber rein negativ gesehen. Vorurteile sind also affektive Prozesse der Abwertung, sie beziehen sich vor allem auf die emotionale Komponente.[52]
Der Gebrauch von Vorurteilen läuft vorwiegend unbewusst und automatisch ab, er umfasst die Vielfalt unseres naiven, alltäglichen und selbstverständlichen Urteilverhaltens. Es ist sozusagen eine liebgewonnene Gewohnheit, welche die Umwelt begreifbar macht. Nur durch die Reduktion komplexer Realitäten ist es möglich, Verhaltenssicherheit zu erhalten.[53]
Die Frage nach den Ursachen von Vorurteilen/Stereotypen ist Gegenstand von vielen Forschungsarbeiten gewesen, wobei die Ansichten sehr weit auseinandergehen. Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass das Vorurteil aus einer Kombination von historischen, kulturellen, wirtschaftlichen, situativen und individuell-dispositionellen Faktoren entsteht. Es scheint jedoch festzustehen, dass Vorurteile erlernt werden. Die Forschungsarbeiten haben vor allem ethnische Vorurteile untersucht. Die Präferenz für Gleiche scheint im sehr frühen Lebensalter zu entstehen. Um Eigen- und Fremdgruppengefühle zu erzeugen, scheint es ausreichend zu sein, eine Gruppe willkürlich in zwei Gruppen zu unterteilen. Dies zeigt sich in der Tendenz, die Eigengruppe positiver einzuschätzen und die Fremdgruppe abzuwerten. Es wird angenommen, dass dies ein evolutionäres Überbleibsel ist, welches früher durchaus Sinn gemacht hat.[54]
Die Bindung und Identifikation mit einer bestimmten Gruppe ist auch Identifikation mit deren Vorurteilen. Vorurteile sind immer sozial geteilt, sie bedürfen der fortgesetzten sozialen Bestätigung. Bei einem Wechsel der Bezugsgruppe werden sich diese verändern und damit auch die Orientierungs- und Normsysteme. Da Gruppen häufig, gewollt oder ungewollt, in wechselseitiger Konkurrenz und Rivalität stehen, ist deren Verhältnis oftmals konfliktträchtig. Diese Situation muss als wesentliche Voraussetzung für die Ausbildung von Vorurteilen gesehen werden.[55]
Hierbei spielt Macht wieder eine große Rolle. Der Mächtige kann diesen Mechanismus nutzen, um seine eigene Stellung zu verfestigen oder zu verbessern. Eine Funktion ist der Schutz der Eigengruppe, indem ein Sündenbock zur Verfügung gestellt wird, welcher für die Frustrationen und Missgeschicke verantwortlich gemacht werden kann. Eine andere Funktion ist die Verteilung von Ressourcen. Durch diskriminierende Vorurteile wird die Konkurrenzfähigkeit der Fremdgruppe geschwächt, ihre Ausbildungs- und Berufschancen beeinträchtigt.[56]
In Zeiten von sozialer Stabilität und wirtschaftlicher Prosperität sind die Vorurteile gegenüber der Fremdgruppe meistens nicht negativ gefärbt. In Zeiten der Unsicherheit und rascher sozialer Veränderungen hingegen, scheinen negative Vorurteile gegenüber der Fremdgruppe anzuwachsen. Eine wichtige Funktion des Sündenbocks liegt darin, dass er dem Selbstschutz der Person dient. Die Ursache für den Misserfolg wird nach außen verlegt. Es ist nicht der Fehler meiner Person oder meiner Gruppe, sondern der von anderen und das Stereotyp rechtfertigt diesen Vorwurf. Nach der Theorie der kognitiven Dissonanz werden viele Entscheidungen und Handlungen erst im nachhinein gerechtfertigt. Die kognitive Dissonanz entsteht, wenn die Person nach einer Handlung einer vollständigen Rechtfertigung entbehrt. Dadurch entsteht ein Spannungszustand, den die Person versucht abzubauen indem sie diese Handlung im nachhinein rechtfertigt.[57]
Eine weitere Ursache auf der makrosozialen Ebene ist in den kulturell-normativen Einflüssen zu sehen. Jede Gesellschaft und jede Gruppe entwickelt ein Regelwerk an sozialen Normen, also Verhaltensregeln, deren Übertretung sanktioniert wird.[58]
Aber warum haben einige Menschen mehr Vorurteile als andere? Adorno versuchte 1950 mit seiner Theorie der autoritären Persönlichkeit eine Erklärung hierfür zu liefern. Danach ist die Ausprägung von Vorurteilen stark mit der individuellen Persönlichkeitsstruktur verknüpft. Eine autoritäre Persönlichkeit ist danach jemand der starr an die Werte der Eigengruppe gebunden ist, sich unterwürfig gegenüber autoritären Personen der Eigengruppe verhält, sich Sündenböcke sucht (da die Aggressionen gegen die Autoritäten der Eigengruppe nicht erlaubt sind), Abwehr aller „Innerlichkeit“ aus Furcht vor ursprünglichen Gefühlen, das Abwälzen von Verantwortung nach außen sowie der Glaube, durch die Unterwerfung an der Macht eines anderen teilzuhaben. Zur Entstehung der autoritären Persönlichkeit wird das Hauptaugenmerk auf die Sozialisationsgeschichte gelegt, in welcher sich die Vorurteile eingeschliffen und verhärtet haben. Dabei wird insbesondere das Elternhaus beachtet, ausschlaggebend für die Entwicklung einer autoritären Persönlichkeit ist danach ein autoritärer Erziehungsstil, in welchem Macht, Gewalt, Kontrolle und starke Normausrichtung vorherrschen.[59]
Ein besonderes Merkmal ist eine strenge Disziplin, bei der Ungehorsamkeit durch Liebesentzug bestraft wird. Wenn ein Kind so erzogen wird, fürchtet und hasst es unbewusst seine Eltern, ist aber gleichzeitig abhängig von ihnen. Der Hass, den das Kind gegenüber seinen Eltern nicht äußern darf, wird verschoben und manifestiert sich in Vorurteilen gegenüber anderen.[60]
Diese Theorie wird viel kritisiert, nicht zuletzt, weil es zu viele Menschen mit Vorurteilen gibt, als das sie alle unter solchen Bedingungen aufgewachsen sein könnten. Es sollte vielleicht eher danach gefragt werden, wie manche Menschen es schaffen, vorurteilsvolles Verhalten zu vermeiden. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Zentriertheit auf die Familie, andere Sozialisationsinstanzen werden außer acht gelassen.
Die Theorie der autoritären Persönlichkeit wurde in den folgenden Jahren weiterentwickelt, zuletzt 1996 von Oesterreich. Er spricht von der „autoritären Reaktion“ die unabhängig von der Persönlichkeit bei jedem Menschen zu finden sei. Sie ist eine Basisreaktion menschlichen Verhaltens in Krisen-, Extrem-, Bedrohungs-, Belastungs- oder Konfliktsituation. Wenn dem Individuum keine ausreichenden Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen, kommt es zu Gefühlen der Überforderung und Hilflosigkeit. Diese lösen Angst und Verunsicherung aus, was wiederum eine Orientierung an Sicherheit bietenden Autoritäten auslöst. So kann die Angst erfolgreich abgewehrt werden.[61]
Vorurteile und Stereotype weisen eine große inhaltliche Nähe auf, gemeinsame Merkmale sind, dass es „sozial geteilte, stabile, konsistente, änderungsresistente, starre, rigide, inflexible Urteile über andere Personen, soziale Gruppen oder soziale Sachverhalte“ sind.[62]
Die Unterscheidung gelingt nur, wenn Stereotype als rein kognitive Sachverhalte betrachtet werden. Dies macht allerdings nicht wirklich Sinn, da Stereotype ohne eine bewertende Komponente nicht denkbar sind.
Der Begriff Stereotyp wurde 1922 von Lippmann geprägt, er bezeichnet ein kognitives Schema zur effektiven Informationsverarbeitung. Stereotype basieren auf gesellschaftlich geteilten Theorien, sie sind kulturell vorgefertigt und ein komplexes Gebilde von Wertungen und Interpretationen über Personen in Eigen- und Fremdgruppen. Entscheidend ist, dass Stereotype Generalisierungen sind, welche sich auf die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Kategorien oder Gruppen beziehen.[63]
Die Person wird also „typisiert“ und nicht charakterisiert, sie wird in eine bestimmte Schublade eingeordnet, individuelle Aspekte werden ausgeblendet. Außerdem wird durch Akzentuierungen und Übertreibungen eine Homogenität in einer sozialen Kategorie angenommen, die objektiv so nicht existiert. Die Aufrechterhaltung von Vorurteilen funktioniert durch Wahrnehmungsverzerrungen, selektive Aufmerksamkeit, selektive Auslegung und Vermeidungstendenzen.[64]
Eine Funktion von Stereotypen liegt vor allem in der vereinfachten Informationsverarbeitung. Die komplexe Realität trifft auf die begrenzte Fähigkeit zur Reizverarbeitung, durch die Vereinfachung durch die Stereotypenbildung wird mit einem minimalen kognitiven Aufwand die Menge der zu verarbeitenden Informationen reduziert. Dadurch werden Ressourcen eingespart, die dann für anderweitige Informationsverarbeitung zur Verfügung stehen können.[65] In unserer heutigen Welt gibt es immer mehr Bereiche, so dass niemand alles verstehen kann. Diese Leerräume schaffen Unsicherheit und geraten damit unter Etikettierungszwang.[66]
Eine weitere wichtige Funktion ist die Abgrenzung gegenüber „fremden“ Gruppen, welche Orientierung und Sicherheit im sozialen Umgang bringt. Das Wir-Gefühl der Eigengruppe wird durch sozial geteilte Stereotype gestärkt, was wiederum ein höheres Selbstbewusstsein und eine verstärkte soziale Identität schafft.[67]
Das Prinzip der illusorischen Korrelation (Hamilton, 1976, 1989) erklärt die für Stereotype charakteristischen Verzerrungen bei der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen. Illusorische Korrelation bedeutet wörtlich übersetzt eine eingebildete, scheinbare Beziehung zwischen Merkmalen und Dingen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. In dem Stereotyp wird eine Beziehung zwischen einer Kategorie (Gruppenmitgliedschaft: psychisch krank) und einem bezeichnenden (distinkten) Attribut (Eigenschaft: gefährlich) hergestellt. Derartige Zuschreibungen werden gebildet, wenn zwei auffällige Ereignisse gleichzeitig auftreten. Dabei ist die Häufigkeit nicht entscheidend, sie können auch kommunikativ (z.B. über die Medien) vermittelt werden. Derartige Schemata und Stereotype bilden die Basis jeder weiteren Informationsverarbeitung, die sozialen Kategorien werden praktisch automatisch zur weiteren Informationsverarbeitung abgerufen. Informationen, die das Stereotyp bestätigen, werden dabei bevorzugt behandelt, wohingegen andere Informationen verzerrt werden, so dass die ursprüngliche Meinung nicht revidiert werden muss.[68]
„Ein Stereotyp scheint also ein zweischneidiges Schwert zu sein: Einerseits fördert es die Verarbeitung konsistenter Informationen, andererseits blockiert es die Verarbeitung inkonsistenter Informationen mit der Konsequenz der Selbstbestätigung in beiden Fällen.“[69]
Stereotype und Vorurteile sind jedoch nicht ausreichend für die Entstehung von Stigma. Ein entscheidender Faktor muss noch mit hinzukommen: soziale, wirtschaftliche oder politische Macht. Wenn beispielsweise Menschen mit psychischen Erkrankungen negative Vorurteile und Stereotype gegenüber dem Personal einer psychiatrischen Klinik haben, wird dieses Personal trotzdem nicht zu einer stigmatisierten Gruppe werden. Denn den Patienten fehlt die soziale Macht, um diskriminierende Konsequenzen gegenüber dem Personal durchzusetzen.[70]
4.4 Der Stigmatisierungsprozess
Viel diskutiert wurde der Prozess der Stigmatisierung, welchen Hohmeier[71] 1975 verfasste und veröffentlichte. Diesen möchte ich als erstes kurz umreißen, er ist dem von Scheff insofern ähnlich, dass die Sozialisation zum Stigmatisierten sich unweigerlich vollzieht und am Ende immer eine veränderte Persönlichkeit steht. Die Stigmatisierten übernehmen aufgrund des Konformitätsdrucks Verhaltensweisen, die bei ihnen vermutet werden, und es ergibt sich eine sogenannte selbst erfüllende Prophezeiung, bei welcher sich bestimmte Verhaltensmuster und Reaktionen der Umwelt gegenseitig bedingen.
Danach vollzieht sich der Prozess in drei Phasen:
1. In der primären Sozialisation der Kindheit werden durch die Vermittlung kultureller und sozialer Wirklichkeit bestimmte Rollenmuster gelernt. Dazu gehören auch bestimmte Erwartungen an bestimmte Gruppen und die Definition abweichenden Verhaltens.
2. Sie vollzieht sich in den Interaktionen mit anderen, sogenannten „Normalen“, insbesondere durch bestimmte Erwartungen und Vorstellungen, die diese von der stigmatisierten Gruppe haben, zu der die betroffene Person zählt. Dazu zählt auch die Unsicherheit und Spannung die in solchen Situationen entsteht, wenn die „normale“ Person nicht weiß, wie sie mit der „stigmatisierten“ Person umgehen soll.
3. Sie manifestiert sich durch die Rolle als Klient einer bestimmten Organisation. Dort vor allem durch die Erwartungen des Personals, welche in der kritischen Literatur auch „Zuschreibungsspezialisten“ genannt werden. Aber auch durch die organisatorischen Rahmenbedingungen, wie z.B. bestimmte Regeln und Abläufe.
Link und Phelan[72] entwickelten eine Stigma-Konzept, dass den Prozess ebenfalls in verschiedenen Stufen darstellt. In Anlehnung an Goffman und die Stigma Definition von Jones benutzen sie den Begriff Stigma, wenn die Elemente Etikettierung, Stereotypisierung, Ausgrenzung, Statusverlust und Diskriminierung gemeinsam in einem Machtverhältnis auftreten, welches die Entfaltung erst ermöglicht.
In der ersten Phase wird von der Umwelt ein Unterschied festgestellt und etikettiert. Die meisten menschlichen Unterschiede sind nicht weiter relevant, es gibt aber auch eine ganze Reihe von Unterschieden (z.B. Hautfarbe), denen ein bestimmtes Etikett anhaftet. Psychische Krankheit ist meistens nicht so offensichtlich erkennbar. Es gibt aber doch ein paar Aspekte die genannt werden können. Dazu zählen akute psychotische Symptomatik, die sogenannte Negativsymptomatik und unerwünschte Nebenwirkungen von Psychopharmaka. Außerdem kann das bekannt werden der Diagnose oder eines vergangenen Klinikaufenthaltes die Etikettierung auslösen.
In der zweiten Phase werden dem Menschen, bei dem der Unterschied festgestellt wurde, unerwünschte Attribute zugeschrieben. Das Etikett wird mit einer Reihe unerwünschter Eigenschaften in Verbindung gebracht, die das Stereotyp formen.
In der dritten Phase kommt es aufgrund des Etiketts zu einer Unterscheidung zwischen „wir“ und „sie“. In der amerikanischen (und der deutschen) Geschichte gibt es viele Beispiele dieser Unterscheidung. Diese Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdgruppe habe wurde weiter oben schon behandelt. Das Etikett wird zu einem „master status“, der die ganze Person bestimmt. Dies kann soweit gehen, dass „die anderen“ nicht als wirklich menschlich wahrgenommen werden und damit schrecklichste Behandlungen möglich und rechtfertigbar werden. Diese Übertragung von einem Merkmal auf die ganze Person kann insbesondere bei Schizophrenie bereits im sprachlichen leicht beobachtet werden. Während man Krebs oder ein gebrochenes Bein hat, ist man schizophren. Man ist nicht mehr einer „von uns“, sondern ein Schizophrener, einer „von denen“.
In der vierten Phase erfährt die stigmatisierte Person Statusverlust und Diskriminierung. In den meisten Theorien wird dieser Punkt außer acht gelassen. Er ist jedoch insofern wichtig, dass, wenn Leute etikettiert sind und mit unerwünschten Eigenschaften in Verbindung gebracht werden, eine rationale Grundlage geschaffen ist um sie abzuwerten, zurückzuweisen und auszuschließen.
In dem fünften Punkt betont er die Abhängigkeit des Stigmas von sozialer, ökonomischer oder politischer Macht. Wenn eine Gruppe von Menschen, die nicht über Macht verfügen, eine mächtigere Gruppe mit negativen Etiketten und Stereotypen versieht und sie dementsprechend behandeln, wird es trotzdem keine ernstzunehmenden Folgen für die mächtigere Gruppe geben.
5. Geschichte der Psychiatrie und psychischer Krankheiten
Wie mit psychisch Kranken in den letzten Jahrhunderten in Mitteleuropa umgegangen wurde, ist eine Geschichte der Ausgrenzungen. Über viele Jahrhunderte hinweg wurden sie diskriminiert. Zeitweise ging die Diskriminierung so weit, dass psychisch Kranke verfolgt und getötet wurden. Es gab nur relativ kurze Zeitspannen, in denen sie als Kranke betrachtet wurden. Auch gab es in unserer Kultur nie Augenblicke in denen psychisch Kranken besondere positive Fähigkeiten zugeschrieben wurden, wie es in anderen Kulturkreisen durchaus der Fall ist.
Die Situation psychisch Kranker hat sich entscheidend durch die Psychiatrie-Enquete verändert. Nur auf diesem Hintergrund der Deinstitutionalisierung lässt sich die heutige Situation psychisch Kranker wirklich verstehen.
5.1. Jahrhunderte der Ausgrenzung
In der vorklassischen Periode wurden psychische Krankheiten damit erklärt, dass die Betroffenen von Dämonen und bösen Geistern besessen wären. Folglich bestand die Behandlung aus schamanistischen Ritualen, bei welchen die Geister ausgetrieben oder besänftigt werden sollten. In der vorchristlichen hebräischen Kultur wurden sie als Strafe Gottes empfunden und erhielten damit erstmals eine moralische Komponente.[73]
In der Antike wurden psychische Krankheiten durch Hippokrates zum ersten mal nicht auf Besessenheit durch Geister zurückgeführt, sondern als zum Körper gehörig erklärt. Der Nachfolger von Hippokrates, Gallen, fügte der Erklärung durch körperliche Ursachen noch emotionale Ursachen hinzu. Seine medizinischen Abhandlungen erreichten über den arabischen Raum schließlich auch das mittelalterliche Europa, und gelten als Grundlage für alle folgenden wissenschaftlichen und philosophischen Entwicklungen[74]
Im frühen Mittelalter waren psychisch Kranke relativ gut integriert, viele klösterliche Hospitäler nahmen psychisch Kranke auf und behandelten sie wie Waisen oder Alte. Doch mit den Unruhen, Umbrüchen und der Not die mit der Pest, dem Fall des römischen Reiches und dem Dreißigjährigen Krieg kamen, nahm auch der Aberglaube zu. So war nach der kirchlichen Doktrin Armut und Krankheit eine Strafe Gottes. Die psychisch Kranken wurden als von Dämonen oder dem Teufel besessen betrachtet. Diese machten sich damit der Hexerei schuldig und die „Therapie“ bestand aus der Teufelsaustreibung, wobei auch der Tod des Betroffenen in Kauf genommen wurde. Die nächsten zwei Jahrhunderte wurden von diesen Gedanken bestimmt, wobei ein vom Vatikan in Auftrag gegebenes Buch, die „Hexenkammer“ (erschienen: 1487) den Umgang mit Hexen und Hexenmeistern wesentlich bestimmte. Die letzten Hexenverfolgungen, bei welchen viele psychisch Kranke starben, fanden bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts statt.[75] Doch nicht alle psychisch Kranke wurden wegen Hexerei verurteilt, sondern viele wurden auch in Asylen, Toll- und Zuchthäusern zusammengepfercht. Am häufigsten wurden sie als Narren, Tolle und Toren bezeichnet. In den Asylen waren sie zusammen mit Hilfesuchenden jeglicher Art verwahrt. Noch trostloser war die Situation in den Zucht-, Waisen- und Siechenhäusern.[76] In London wurde das Asyl Bedlam ab 1547 ausschließlich zur Unterbringung psychisch Kranker genutzt. Gegen Eintrittsgeld konnten diese besichtigt werden, was bis zu 100.000 Menschen jährlich taten.[77] In Deutschland entstanden die ersten Irrenanstalten, die speziell zu diesem Zweck errichtet wurden, erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Etwa zur selben Zeit setzte sich der Gebrauch der schonenden Bezeichnung „Irre“ durch, für den sich viele Psychiater stark machten, da er weniger stigmatisierend war.[78]
Im Zuge der französischen Revolution befreite Philippe Pinel 1793 in einem symbolischen Akt die psychisch Kranken von ihren Ketten und leitete damit ein neues, humanistischeres Bild von psychischer Krankheit ein. Ihm folgten Esquirol in Frankreich und Griesinger in Deutschland, damit wurden sie erstmals seit der Antike wieder als Kranke gesehen und dementsprechend behandelt. Griesinger verankerte außerdem die Psychiatrie als akademische Disziplin an den Universitäten.[79] Der Sieg der Naturwissenschaften in der Psychiatrie bedeutete eine ungeheure Befreiung von theologischen, philosophischen und politischen Beengungen für die Theorie wie für die Praxis. Viele jungen Psychiater (u.a. Griesinger) strebten eine revolutionäre Veränderung der Psychiatrie, zugunsten der Wissenschaft und der Abschaffung jeglichen mechanischen Zwanges, an.[80]
In der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts wurde die Vernunft sehr hoch gehalten. Die Irren „unvernünftigen“ passten nicht so recht in die bürgerliche Ordnung und störten die Gewohnheitshierarchien sowie den Lebens- und Denkalltag. Nach Blasius hat die bürgerliche Gesellschaft den „Graben zwischen dem geistig Gesunden und dem geistig Kranken vertieft, letzterem die Rolle eines Fremden in dem Haus zugewiesen, das auch sein Haus war“ [81]. Die Bedrohung geht von etwas Fremden aus, dass das eigene Fremde sein könnte. Die immer reicher werdende Gesellschaft konnte sich gegen Armut und auch immer besser gegen körperliche Krankheiten schützen, aber nicht vor dem Verlust des Verstandes. Er nennt das 19. Jahrhundert auch ein „ Jahrhundert der Vergitterung des Wahnsinns“ [82]. Er wurde hinter Anstaltsmauern verbannt, um eine bürgerliche Leistungskultur störungsfrei aufbauen zu können. Um 1900 wurden die großen Landeskrankenhäuser, weit entfernt von den großen Städten, gegründet. Dazu einigen Zahlen: Während es 1877 auf Reichsebene 93 öffentliche Anstalten mit 33.023 Insassen gab, waren es 1904 schon 180 Anstalten mit 111.951 Insassen. Diese Entwicklung ist auch mit dem steilen Bevölkerungswachstum in dieser Zeit zu begründen.[83] Deutschland erfuhr den vollen Durchbruch der Industrialisierung, es gab eine Bevölkerungsverschiebung in die Stadt, der Alltag veränderte sich in einer neuen gesellschaftlichen Ordnung. Durch den zunehmenden Leistungszwang des Wirtschaftsliberalismus wurden Menschen auffällig, deren psychische Erkrankung bis dahin nicht sichtbar gewesen war.[84] Diese Zeit war jedoch nicht nur von vermehrter Ausgrenzung gekennzeichnet, sondern auch von dem Optimismus der Aufklärung, dass psychische Krankheit heilbar sei. In der bereits 1825 gegründeten Heilanstalt Siegeburg in Preußen wurde durch wissenschaftliche Objektivierung versucht, gesellschaftliche Ängste abzubauen. Es bestand ein großer „Heiloptimismus“, die Kehrseite war jedoch, dass nicht integrierbare als unheilbar in ihre Heimatgemeinde zurück geschickt wurden.[85]
Die Gräueltaten des Nationalsozialismus wurden also nicht im historisch leeren Raum begangen. Natürlich kann Ausgrenzung nicht mit Vernichtung gleichsetzt werden, sie bereitete aber den Boden für das folgende vor.
Viele Tausende vielen der Euthanasie zum Opfer, bis 1942 wurden im Rahmen der sogenannten „Aktion T4“ etwa 70.000 Psychiatriepatienten umgebracht und 300.000 Personen wurden zwangssterilisiert. Dieses wurde von Ärzten vollzogen, welche alles peinlich genau dokumentierten. Die Zeit ab 1941 wird als „wilde Euthanasie“ bezeichnet, da Leistungsschwache getötet oder die Menschen einfach dem Hungertod überlassen wurden.[86]
1952 wurde die Schizophrenie mit der Entdeckung der Wirksamkeit des Chlorprozamin zu einer medizinisch behandelbaren Krankheit.
5.2. Die Psychiatrie-Enquete
In den 50er Jahren entwickelte sich eine neue psychiatriekritische Bewegung. Besonders häufig wurde die Überbelegung der Krankenhäuser und die langen Liegezeiten kritisiert. Während in anderen europäischen Ländern in den 50er Jahren die Psychiatrie neu gestaltet wurde, dauerte es in Deutschland bis in die 70er Jahre. Häfner glaubt, dass die Verbrechen der NS-Zeit der Grund für den Reformstau in Deutschland gewesen ist. Erst mit den gesellschaftlichen Umwandlungen, die ihren Höhepunkt in der Studentenrevolte von 1968 hatten, wurde es möglich, auch das schwierige Feld der Psychiatrie zu bearbeiten.[87] Anfang der 70er Jahre beschäftigte sich schließlich eine Expertenkommission des Deutschen Bundestages mit der psychiatrischen Versorgung. Die 1975 veröffentlichte Psychiatrie-Enquete ist als bedeutender Wendepunkt in der psychiatrischen Versorgung zu bezeichnen. Zentrale Aspekte der Psychiatriereform waren:
- Auf- und Ausbau eines bedarfsgerechten, gemeindenahen Versorgungssystems (in allgemeinen Krankenhäusern) mit ambulanten und komplementären Diensten
- Koordination und Zusammenarbeit innerhalb der Versorgungssysteme
- Förderung der Aus-, Weiter- und Fortbildung des Personals
- Vorrangige Verbesserung der Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher, sowie Alkohol- und Suchtkranker
- Gleichstellung körperlich und seelisch Kranker in rechtlicher, finanzieller und sozialer Hinsicht[88]
Diese sogenannte Deinstitutionalisierung ist inzwischen so gut wie vollzogen, das Hauptziel wurde erreicht. Die Zahl der Betten hat sich halbiert und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist von 210 auf etwa 30 Tage zurück gegangen, während sich die ambulanten und komplementären Einrichtungen vervielfacht haben.[89]
Trotzdem gibt es noch viele Punkte, die unzureichend sind. Von dem Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrener werden vor allem folgende Punkte genannt:
- Die Aktivierung des Selbsthilfepotentials
- Aktive Einbeziehung von Psychiatriebetroffenen in die Psychiatriepolitik
- Förderung von Selbsthilfeansätzen und nicht-stigmatisierenden, nicht-psychiatrischen Ansätzen und
- vor allem Freiheit zur Auswahl aus Behandlungsangeboten zur Stärkung der Menschenrechte.[90]
An anderer Stelle wird vor allem bemängelt, dass Psychiatrie-Erfahrene sich nicht ausreichend ernst genommen fühlen. Außerdem besteht keine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Psychiatrie-Betroffenen und in der Psychiatrie Tätigen. Es gibt noch viel zu tun, damit Betroffene an der Ausgestaltung individueller (Behandlungs- und Rehabilitationsplan) sowie struktureller Hilfesysteme partnerschaftlich beteiligt werden.[91]
Es gibt auch neue Probleme durch die Psychiatrie-Enquete. Der langzeit hospitalisierte Patient wurde von dem chronisch kranken Patienten abgelöst, bei dem das primäre Ziel nicht mehr Heilung und auch nicht Rückkehr in ein „normales Leben“ sein kann. Sie müssen lernen, mit ihren chronischen Leiden zu leben. Die Deinstitutionalisierung ist auch eine Geschichte der Unterlassungen. Weder die Angehörigen, noch die Nachbarn in dem Stadtteil wurden auf die chronisch kranken Menschen in ihrem Umfeld vorbereitet. Sie wurden nicht mit offenen Armen von den Gemeinden empfangen und bis heute begegnen sie Stigma und Vorurteilen in ihrem sozialen Umfeld.[92]
6. Das Bild des psychisch Kranken in der Öffentlichkeit
Auslöser für Stigmatisierung und Diskriminierung von Krankheiten im Allgemeinen sind meistens mit Unkenntnis und Mythen verbunden. Diese Unkenntnis ist der Nährboden für negative Einstellungen gegenüber psychisch Kranken.
Drei typische Fehleinschätzungen von psychisch Kranken sind, dass sie entweder furchteinflößende mörderische Irre, rebellische Freigeister oder Menschen mit einer kindlichen Wahrnehmung der Welt sind.[93]
Ausdruck der Unwissenheit ist auch, dass knapp ein Drittel der Bevölkerung bei dem Begriff Schizophrenie als erstes an eine Form der psychischen Spaltung denkt, meistens in Form einer Bewusstseins- oder Persönlichkeitsspaltung. Und nur 8,8% der befragten Bevölkerung bringen mit Schizophrenie Wahnsymptome in Verbindung, noch seltener werden andere psychiatrische Indikatoren für die Schizophrenie genannt.[94]
In Deutschland sind Schizophreniekranke das Innbild von psychischer Erkrankung. Das zeigt sich auch daran, welche Eigenschaften psychisch Kranken im allgemeinen zugeschrieben werden. Bei Vorlage einer Fall-Vignette mit Symptomen der Schizophrenie, wurde diese von 95% der Bevölkerung als eine psychische Erkrankung erkannt. Depressionen werden hingegen eher als Ausdruck einer kritischen Lebensphase, und Drogenabhängigkeit eher als eine deviante Lebensform gesehen. 78% glauben einen psychisch Erkrankten auf Anhieb erkennen zu können und nannten folgende Aspekte: seltsames Verhalten (73%), sonderbare Sprache (63%), Kleidung (32%), Gesichtsausdruck (25%) und Aggressivität (24%).[95]
Das Stereotyp vom psychisch Kranken ist dem Stereotyp vom psychiatrischen Patienten sehr ähnlich. Angermeyer führte 1993 eine repräsentative Erhebung, mit 2094 mündlichen Interviews, in den neuen Bundesländern Deutschlands durch. Danach gelten sie als:
- auf die Hilfe anderer angewiesen (der psychisch Kranke als Belastung für seine Umwelt, knapp 90 % teilen diese Auffassung)
- unberechenbar und gefährlich (der psychisch Kranke als Bedrohung für andere, knapp die Hälfte halten sie für unberechenbar und 29,5% halten sie für gefährlich)
- unverständlich und fremdartig (der psychisch Kranke als Rätsel, von 42% wurden sie als fremdartig, von 37% als unheimlich und von 34% als unverständlich bezeichnet)
- ungepflegt bis verwahrlost (der psychisch Kranke als Ärgernis für seine Umwelt, ein viertel bis ein fünftel der Befragten halten sie für unattraktiv, ungepflegt und verwahrlost)
- genial (der psychisch Kranke als Faszinosum, 22,4% halten sie für besonders phantasievoll, 14,8% für hochintelligent und nur 6,2% für genial)[96]
Interessanterweise scheinen solche Vorstellungen kulturabhängig zu sein. Jedenfalls für das Attribut der Gefährlichkeit konnte Angermeyer solche Assoziationen weder in Nowosibirsk noch in Ulan Bator nachweisen.[97]
Auch gegenüber psychiatrischen Institutionen sowie den dort Tätigen gibt es negative Vorurteile. Danach glauben 28%, dass in einem psychiatrischen Krankenhaus nicht behandelt sondern nur ruhig gestellt wird und 26% glauben, dass die Patienten in einem Krankenhaus noch kränker würden. Ähnlich ist die Einstellung gegenüber Psychopharmaka, 33% sehen Antidepressiva negativ und 35% Neuroleptika.[98]
Bei der oben erwähnten Befragung von Angermeyer zeigte sich, dass das Bild der Psychiatrie in der Bevölkerung sehr stark von der Anstalt alten Stils geprägt ist. Die Hälfte der Bevölkerung glaubt an die Verwendung von Zwangsjacken und Gummizellen, und folgendes Statement wurde doppelt so häufig bejaht als verneint: „Wenn man einmal in einer psychiatrischen Klinik eingeliefert ist, dann ist es schwierig, wieder herauszukommen, egal ob man etwas hat oder nicht.“[99]
Obwohl mehr Leute dieser Aussage zugestimmt haben, sind trotzdem dreiviertel der Bevölkerung für die Zwangseinweisung psychisch Kranker. Daran zeigt sich, dass die Angst um die eigene Sicherheit größer ist, als die Befürchtung vor ungerechtfertigten Sanktionen. Die Hälfte der Bevölkerung unterstützt auch Sanktionen wie den Fahrausweisentzug, und jeweils ein viertel befürworten den Schwangerschaftsabbruch und den Entzug des Stimmrechts. Die professionellen Helfer unterstützen zwar die Zwangseinweisung mehrheitlich (99%), sind aber kritischer gegenüber den anderen genannten negativen Sanktionen. Dabei ist die Quote der unentschiedenen erstaunlich hoch. Den Schwangerschaftsabbruch zum Beispiel befürworten nur 6%, es sind aber 23% unentschieden.[100]
Viele Autoren (z.B. Angermeyer) gehen davon aus, dass ein vergangener Klinikaufenthalt psychisch Kranke zusätzlich stigmatisiere, dies konnte bei einer Erhebung in der Schweiz, aus dem Jahr 2003 mit 1737 Teilnehmern, jedoch nicht bestätigt werden. Dabei zeigte sich, dass die Ablehnung gegenüber Menschen die in der Klinik waren und welchen, die krank waren in etwa gleich hoch ist. Bei aktueller Krankheit ist die Ablehnung am größten. Dies lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen: 32% glauben, dass jemand mit aktueller psychischer Krankheit von der Mehrheit der Bevölkerung in dem engsten Freundeskreis akzeptiert wird. Bei vergangener psychischer Krankheit glaubt dies 41% der Bevölkerung, und bei einem vergangenen Klinikaufenthalt glaubt dies 39%. Die Abweichung ist also minimal, ob jemand krank oder in einer Klinik war, ist für die meisten gleichbedeutend.[101]
In aktueller Literatur wird auch die strukturelle Diskriminierung angesprochen. Damit sind Ungerechtigkeiten in sozialen Strukturen, politischen Entscheidungen und gesetzlichen Regelungen gemeint. Dazu zählt auch, dass psychisch Kranke Probleme haben können, eine Krankenversicherung zu finden, die sie aufnehmen würde. Bei einer Repräsentativerhebung, bei welcher die Befragten auswählten, für welche Krankheiten die finanziellen Mittel und Forschungsgelder bereitgestellt werden sollten, bildeten Schizophrenie, Depression und Alkoholismus die Schlusslichter.[102]
6.1. Das Bedürfnis nach sozialer Distanz
Um die Einstellung gegenüber psychisch Kranken zu erfassen, wird häufig das Bedürfnis nach sozialer Distanz erfragt. Damit wird die Bereitschaft erfasst, mit einer psychisch kranken Person eine Beziehung einzugehen. Dabei werden bestimmte Beziehungssituationen vorgegeben, die in dem Grad der Intimität variieren. Dabei steigt erwartungsgemäß der Grad der Ablehnung, je enger und persönlicher die vorgestellte Beziehung ist.
Bei Studien zeigte sich, dass das Bedürfnis nach Abgrenzung bei Suchterkrankungen und schizophrenen Erkrankungen besonders hoch ist, wogegen dies bei depressiven Erkrankungen weniger der Fall zu sein scheint. Das Bedürfnis nach Abgrenzung gegenüber depressiv Erkrankten ist ähnlich hoch wie das gegenüber Asylbewerbern. Es liegt Nahe, dass das Bedürfnis nach Abgrenzung mit der Auffassung über negative Eigenschaften des betroffenen Personenkreises zusammenhängt. Das Attribut Gefährlichkeit wird neben Suchtkranken (73,9%) am häufigsten schizophren Erkrankten (71,3%) zugeschrieben. Das Attribut Unberechenbarkeit wird beiden ähnlich häufig (77%) zugeschrieben.[103]
Bei der Frage, welche Personengruppe nicht als Nachbarn erwünscht sind, stoßen Neonazis auf größte Ablehnung. An zweiter und dritter Stelle folgen bereits Drogenabhängige und Alkoholiker. Schizophrene Kranke werden von über einem Drittel der Bevölkerung abgelehnt, ähnlich häufig wie Zigeuner und häufiger als Vorbestrafte. Depressiv erkrankte werden von knapp 20% abgelehnt. Die starke Ablehnung der Suchtkranken dürfte damit zusammenhängen, dass diese nicht als krank betrachtet werden, sonder als selbst verantwortlich für ihre Situation.[104]
Die soziale Distanz gegenüber schizophren Erkrankten wurde in Deutschland 1999 im Rahmen des WPA-Programms von Gaebel et al. untersucht. Es wurden 7246 Personen telefonisch mithilfe eines standardisierten Fragebogens in sechs bundesdeutschen Großstädten befragt. Es ist anzunehmen, dass die Befragung in ländlichen Regionen zu anderen Ergebnissen geführt hätte. Bei der Auswertung zeigte sich, dass 71% der Befragten einen Betroffenen nicht heiraten würden. 41% würde sich durch einen erkrankten Zimmergenossen gestört fühlen, 22% würden die Freundschaft nicht fortführen, 16% würden sich durch erkrankte Arbeitskollegen gestört fühlen, 9% hätten Angst, die Unterhaltung fortzuführen und 7% würden sich schämen, wenn ihre Familie betroffen wäre.[105] Während die letztgenannten Daten doch eher hoffnungsvoll stimmen, so ist die Ablehnung bei der Vorstellung von intimeren Beziehungen doch weitaus höher.
Die oben erwähnte Befragung von Angermeyer kam zu ähnlichen Ergebnissen. Interessant an der Umfrage ist auch, dass das Borderline-Syndrom mit einbezogen wurde. Überraschenderweise zeigte sich, dass die soziale Distanz ähnlich hoch ist wie gegenüber schizophren Erkrankten.[106]
Ein Ziel der Psychiatrie-Enquete war die Einrichtung von gemeindenaher Versorgung, um den Bedarf an stationärer Behandlung zu reduzieren. Doch die Pläne von der Einrichtung eines Wohnheimes oder einer Tagesstätte stoßen immer wieder auf massiven Widerstand in der lokalen Bevölkerung. Bei der oben erwähnten Studie von Gaebel et al. äußerten viele Befürchtungen hinsichtlich des sozialen Friedens und ihrer persönlichen Sicherheit. Zu dem Thema befragt, äußerten sich 31% beunruhigt über die Einrichtung einer Wohngemeinschaft in ihrer Nähe. Davon waren allerdings nur 4,6% so stark dagegen, dass sie bereit wären, an Protestaktionen dagegen teilzunehmen. Die Einrichtung einer Werkstätte oder einer Tagesstätte wurde etwas weniger negativ gesehen. Dabei muss auch gesehen werden, dass es eine allgemeine Tendenz gibt, sich bei Interviews positiv darzustellen, es gibt also wahrscheinlich noch mehr Menschen, die gegen solche Einrichtungen in ihrer Nachbarschaft sind.[107]
Bisher wurde fast ausschließlich die Einstellung der Allgemeinbevölkerung untersucht. Da die Betroffenen aber sehr häufig Vorwürfe gegenüber Professionellen geäußert haben, beginnt sich jetzt auch die Forschung dafür zu interessieren. Das erstaunliche Ergebnis erster Forschungen ist, dass Psychiater sich in der sozialen Distanz zu psychisch Kranken keineswegs von der Allgemeinbevölkerung unterscheiden. Auch sie möchten mehrheitlich keine psychisch Kranken in ihrem privaten Umfeld haben. Sie scheinen sogar eine schlechtere Einstellung zu haben als Kollegen mit einer anderen Berufsausbildung.[108]
6.2. Mögliche Einflussfaktoren
Am stärksten ist die Einstellung gegenüber psychisch Kranken von folgenden Umständen bestimmt: Persönlicher Kontakt zu psychisch Erkrankten bzw. Vertrautheit mit dem psychiatrischen Versorgungssystem, Bildung und kleine Kinder. Bei einer Umfrage stellte sich der persönliche Kontakt zu psychisch Kranken als der stärkste Prädikator heraus, diese haben größtenteils eine benevolente, gemeinde-psychiatrische Orientierung, was zeigt, wie wichtig der persönliche Kontakt ist, wenn Stigma und Vorurteil abgebaut werden sollen. Zu einer Einstellung, die von Autoritarismus und sozialer Kontrolle geprägt ist, neigen am ehesten Personen eines höheren Alters oder Familien mit kleinen Kindern. Bezüglich des Geschlechtes ist nichts eindeutig nachgewiesen, es scheint aber eine leichte Tendenz vorzuliegen, dass Frauen eher zu einer benevolenten Einstellung neigen.[109]
Bei der oben erwähnten Befragung von Angermeyer, zeigte sich kein Unterschied bei der Beurteilung zwischen Geschlecht und Alter. Dagegen scheint der Bildungsgrad die Meinung am stärksten zu beeinflussen. So halten Menschen mit einem höheren Bildungsgrad psychisch Kranke für weniger unberechenbar und gefährlich, schreiben ihnen aber mehr positive Attribute zu wie Genialität.[110]
Interessanterweise scheint die Mehrheit der Bevölkerung die Akzeptanz leichter zu fallen, wenn sie die psychische Störung nicht als eine Krankheit, sondern als eine (vorübergehende) Krise betrachten.[111]
6.2.1. Der Einfluss der Medien
„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ [112]
Es ist ungeklärt, ob die Medien das spiegeln, was die Mehrheit der Bevölkerung über psychische Krankheit und Psychiatrie denkt oder ob sie es prägen. Fest steht jedoch, dass die meisten ihr Wissen nicht aus persönlicher Betroffenheit oder Begegnung mit psychischer Krankheit und Psychiatrie beziehen.
Ein großer Teil der Bevölkerung bezieht ihr Wissen über Psychiatrie und psychische Erkrankungen über verschiedene Medien (Tages- und Wochenzeitungen, Film, Fernsehen und andere). Es scheint ein reziprokes Verhältnis vorzuliegen. Die Medien sind stark meinungsbildend und gleichzeitig sind sie auch ein Spiegel von dem, was in der Gesellschaft gerade „angesagt“ ist, sowie von ihren Individuen. Sie werden von dem bestimmt, was in einer Gesellschaft gedacht wird, welche Normen Geltung haben, was gerade in Mode ist und schließlich auch, was über psychische Krankheit gedacht wird. Gleichzeit prägen sie das Bild und tragen damit zur Stabilisierung von Vorstellungen bei.
„Printmedien sind ein Spiegel der sozialen Repräsentationen, mit denen die Bevölkerung – Journalistinnen und Journalisten eingeschlossen - und auch die „Bildungssprache“ leben. [113]
Bei einer Langzeitstudie bis 1995 wurde festgestellt, dass die Glaubwürdigkeit von Printmedien und Fernsehen gesunken ist, bei letzterem diese jedoch deutlich höher liegt. Beide Medien werden auch als Meinungsbildungs-, Orientierungs- und Anregungsfunktion geschätzt. Beim Fernsehen ist die Unterhaltungs- vor die Informationsfunktion gerückt.[114]
6.2.2. Schizophrenie als Metapher
Asmus Finzen bezeichnet 1996 in seinem Buch „Der Verwaltungsrat ist schizophren“ den Umgang der Medien mit dem Begriff schizophren als metaphorisch. Schizophrenie hat als Metapher auch Zugang in unserer Umgangssprache gefunden. Der metaphorische Gebrauch des Wortes schizophren findet sich unter Jugendlichen, bei Politikern und in vielen Medien wie z.B. Zeitungen. Und dabei scheinen alle davon auszugehen, dass sie verstanden werden. Es besteht ein weitestgehender Konsens darüber, was das Wort Schizophrenie bedeutet. Es steht für die pure Unvernunft, für Unheimliches, Unberechenbares, Verantwortungsloses oder für unverständliches, bizarres, widersprüchliches Verhalten und Denken. Seine metaphorische Verwendung trägt nicht unwesentlich zur Stigmatisierung der Erkrankten bei. Die Metapher leitet sich von dem diffusen, vorurteilsbehafteten Bild der Krankheit ab und verstärkt gleichzeitig das negative Bild der Krankheit, dass in der Bevölkerung vorherrscht.[115]
Die Verwendung dieser Metaphern zieht sich durch alle Medien, und seriöse Zeitungen scheinen dabei keine Ausnahme zu bilden. So kennt ein Autor der Zeit „das Krankheitsbild der politischen Schizophrenie“ und in der FAZ hieß es, dass die Volksbildung in der DDR eine „Erziehung zur Schizophrenie“ gewesen sei.[116]
Bei einer Studie von Ulrike Hoffmann-Richter, die den gesamten Jahrgang 1995 aller seriösen, großen Tages- und Wochenzeitungen untersuchte, zeigte sich, dass das Wort Schizophrenie in der Hälfte der Fälle metaphorisch gebraucht wurde. Ansonsten stand es fast immer im Zusammenhang mit Mord und Vergewaltigung und sagte wenig oder gar nichts über die Krankheit aus.[117]
6.2.3. Die Darstellung von psychisch Kranken und Psychiatrie in den Medien
Bei der eben schon erwähnten Studie von Hoffmann-Richter zeigte sich, dass der Begriff Psychiatrie sehr häufig (innerhalb eines Jahres 415 mal) aber nicht metaphorisch gebraucht wird, hingegen zu 87% als Fachbegriff benutzt wird. Er wird weder rein negativ noch rein positiv benutzt. Am häufigsten findet er eine neutrale (66%) Verwendung oder er steht negativ oder positiv im Kontext.[118]
Im untersuchten Jahrgang der NZZ wurde der Begriff Psychiatrie durchschnittlich 1,1 mal pro Ausgabe verwendet, im Vergleich dazu wurde das Modewort „Millennium“ im Jahr 1999 ebenfalls 1,1 mal verwendet. Dies ist übermäßig häufig im Vergleich zu anderen medizinischen Fachgebieten, jedoch sind sie weniger informativ als Artikel über andere Fachgebiete.[119]
Die audiovisuellen Medien unterliegen einem großen Konkurrenzdruck, da schnell umgeschaltet werden kann. Sie versuchen also durch Spannung und Unterhaltung den Zuschauer an sich zu binden.
Spielfilme sind vor allem Unterhaltungsfilme, wobei psychische Krankheit selten im Mittelpunkt steht und der Zuschauer vor allem emotional beeindruckt werden soll. Je nach Genre steht ein anderer Aspekt im Mittelpunkt. In Thrillern, Krimis, Science-Fiction- und Horrorfilmen kommen psychisch Kranke besonders häufig vor. Es vergeht kein Tag, ohne dass nicht mindestens ein Psychothriller ausgestrahlt wird in dem psychisch Kranke als Massenmörder, Triebtäter oder sadistische, hinterhältige Lustmörder dargestellt werden.[120]
Insgesamt kann aber gesagt werden, dass die Filme sehr unterschiedlicher Ausprägung sind. Jeder zehnte Spielfilm hat mit dem Thema Psychiatrie oder psychische Krankheit zu tun, was verdeutlicht, wie wichtig eine Auseinandersetzung mit diesem Medium ist. Filme in denen das Thema Psychiatrie behandelt wird, haben diese lange sehr negativ dargestellt. In neueren Filmen ist die negative Darstellung durchaus noch vorhanden, aber nicht mehr so verbreitet. Meistens wird mehr Gewicht auf die Innensicht des Kranken gelegt, wobei seine Biographie ausgespart wird und die Gesundung sich durch Beziehungen und nicht durch die medizinische Behandlung vollzieht.[121]
Bei einem Film neueren Datums, dem „weißen Rauschen“, geht es genau um diese Innensicht. Im Mittelpunkt steht eine psychisch kranke Person, und es wird auf dramatische Weise ihr subjektives Erleben der Krankheit, mit Hilfe von akustischen und visuellen Effekten, dem Zuschauer nahe gebracht. Baumann et al. führten bei der Premiere eine Studie durch, bei der er die Zuschauer vorher und nachher nach Stereotypen und sozialer Distanz befragt wurden. Dabei zeigte sich, dass beides in negativer Weise anstieg. Interessant ist auch, dass 58% des Publikums Kontakt zu psychisch Kranken hat, solche Filme sprechen also ein ganz bestimmtes Publikum an.[122]
Meistens werden Menschen mit psychischen Erkrankungen als dramaturgisches Mittel benutzt um Spannung zu erzeugen. Von Anfang an wurden sie als unberechenbar und gefährlich dargestellt, der psychisch Kranke ist damit eine Ausnahmefigur die den „normalen“ Alltag unterbricht. Hierbei wurden in der Bevölkerung weit verbreitete Vorurteile benutzt und damit zementiert. Meistens wird am Ende des Films der „normale“ Alltag wieder hergestellt indem der „Wahnsinnige“ stirbt oder in die Psychiatrie kommt.[123]
Es wird immer wieder die Andersartigkeit des psychisch Kranken betont, sozusagen als Gegenbild zu dem „normalen Bürger“. Stattdessen sollte dargestellt werden, dass psychische Erkrankung eine normale Reaktion ist, die innerhalb des normalen menschlichen liegt und jeden betreffen kann.
Non-fiktionale Filme hingegen bieten neben Unterhaltung auch Aufklärung und Information, wobei die Schwerpunkte und der Tiefgang sehr unterschiedlicher Ausprägung sind.
6.3. Die Attentate auf Politiker und die Folgen
Wie stark der Einfluss der Medien auf die Meinung der Allgemeinbevölkerung ist, hat sich nach den Attentaten auf Oskar Lafontaine und Wolfgang Schäuble im Jahr 1990 gezeigt. Über diese Geschehnisse wurde ausführlich in den Medien berichtet, und es hat sich gezeigt, wie dünn die Schicht der Vernunft ist und wie schnell wieder diskriminierende Muster durchbrechen.
Im April 1990 wurde Oskar Lafontaine von einer Frau mit einem Messer angegriffen, im Fernsehen wurde diese Frau noch am selben Abend als „geistesgestört“ bezeichnet. Später wurde von psychiatrischen Gutachtern die Diagnose der schizophrenen Psychose gestellt. Lafontaine erholte sich rasch von den Verletzungen.
Wenige Monate später, im Oktober, schoss ein Mann aus nächster Nähe dreimal auf Wolfgang Schäuble, der daraufhin in Lebensgefahr schwebte, er sitzt seitdem im Rollstuhl. In der Presse wurde berichtet, dass der Täter bereits vor 10 Jahren psychisch auffällig geworden war. Im Mai des darauffolgenden Jahres stellten psychiatrische Gutachter die Diagnose einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie.
Darauf folgte eine extrem negative, abwertende Berichterstattung über bestimmte psychische Krankheiten die soweit ging, dass sie „als Hatz auf alle psychisch Kranken“[124] verstanden werden konnte. Dies führte soweit, dass ein konservativer Publizist forderte, dass alle potentiellen psychisch erkrankten Mörder und Totschläger registriert und eingesperrt werden sollten. Die negative Berichterstattung hatte für die Betroffenen weitreichende Folgen, viele trauten sich danach nicht mehr, offen über ihre Krankheit zu sprechen.
Die Auswirkungen dieser negativen Berichterstattung lassen sich an einer repräsentativen Erhebung ablesen, die Angermeyer et al.[125] zufälligerweise zeitgleich durchführten. Die erste Erhebung war zu dem Zeitpunkt der Attentate abgeschlossen. Diese gaben Anlass, die Erhebung nochmals durchzuführen. Abgefragt wurde das Bedürfnis nach sozialer Distanz, sowie Stereotype gegenüber Personen mit schizophrener oder depressiver Symptomatik.
Die Ergebnisse zeigen, wie labil die Einstellungen gegenüber psychisch Kranken sind, die Ablehnung stieg deutlich an. In allen Beziehungskonstellationen nahm die Ablehnung im Jahr 1990 gegenüber Psychosekranke um 16 bis 19 Prozentpunkte zu. Am stärksten (um 24%) wuchs die Ablehnung bei der Vorstellung, einen Kranken als Untermieter in der eigenen Wohnung aufzunehmen.
Während im April 1990 nur 19% nicht bereit gewesen wären, einen schizophren erkrankten Mann als Nachbarn zu tolerieren, waren es im Dezember 36%. So konnten sich nach den Attentaten 86% Prozent der Bevölkerung nicht vorstellen, einem psychisch Kranken ihr Kind anzuvertrauen, im Mai waren es immerhin „nur“ 66,7% gewesen (bei Depression: 57,2%). Auch die Zuschreibung der Attribute „unberechenbar“ und „gefährlich“ nahm im Laufe des Jahres zu, im Dezember 1990 hielten nur noch 6% der Bevölkerung psychiatrische Patienten für berechenbar. Nach einem Jahr war die soziale Distanz zwar wieder zurückgegangen (von 66,5% im Dezember 1990 auf 58,2% im Oktober 1991), lagen aber noch deutlich über dem Ausgangsniveau von 38,5%. Bei der Depression hat sich das Distanzniveau innerhalb dieser Zeit nicht ausschlaggebend verändert. Bei den Befragten mit mittelbarem oder unmittelbarem Kontakt zu psychisch Kranken veränderte sich die soziale Distanz in dieser Zeit am wenigsten. Besonders auffällig war, dass bei Befragten, die selber Patienten waren oder welche als Angehörige hatten, die soziale Distanz um 22 Prozentpunkte anstieg. Zum Vergleich: bei Befragten ohne Erfahrung wurde ein Anstieg von 23 Prozentpunkten verzeichnet. Hierzu gibt es nur vage Hypothesen, vermutlich scheinen die Betroffenen mit ihrer Distanzhaltung „zu demonstrieren, dass sie nicht zu der Kategorie von psychisch Kranken gehört oder Kontakt zu ihnen hatte, die mit Gewalt und Mordanschlägen in die Öffentlichkeit treten “.[126]
6.3.1. Die tatsächliche Bedrohung durch psychisch Kranke
Für den deutschen Raum gibt es keine aktuellen Untersuchungen, die letzte wurde 1973 von Böker und Häfner im Zuge der Psychiatriereform durchgeführt. Eine weitere Studie aus dem Jahr 1993 in Schweden kam zu ähnlichen Ergebnissen. Danach ist die Bedrohung durch psychisch Erkrankte nicht höher und nicht niedriger als durch andere Personen.
Neuere Studien (veröffentlicht 1998, aus den USA und Skandinavien) bestätigen diese Ergebnisse zwar, sie räumen aber auch für schizophren Erkrankte ein etwas höheres Gewaltrisiko ein.
Es gibt bis heute keine überzeugenden, allumfassenden Theorien zur Gewalt. Während die einen die sozialen Spätfolgen und das Fehlen reifer Ausdrucksmöglichkeiten für Frustrationen anführen, betonen andere die psychotische Motivation.[127]
Die Ergebnisse von Bökner und Häfner bestätigen die Theorie, dass sekundäre Prozesse zu dem höheren Gewaltrisiko führen. In ihrer Studie fanden sie, dass von 10.000 an Schizophrenie erkrankten etwa 5 später zu Gewalttätern werden. Davon werden etwa 37% im ersten halben Jahr nach ihrer Entlassung gewalttätig, wohingegen nur 3% in den ersten 4 Wochen nach Ausbruch der Krankheit gewalttätig werden.[128]
Neuere Forschungsergebnisse, die auf zwei Symposien 1997 und 1999 zusammengetragen wurden, betonen den Zusammenhang zwischen Gewalttaten und der massiven Ausbreitung von sekundärem Alkohol- und Drogenmissbrauch bei vielen psychisch Kranken. Dieser wird als Ausdruck und Folge von unzureichender Nachsorge und sozialer Unterstützung gesehen. Diese Studien haben ein vierfach höheres Gewaltrisiko, in Form von tätlichen Angriffen und Bedrohungen, bei Männern mit Schizophrenie gefunden. Ein Drittel der Fälle standen in Zusammenhang mit Konfrontationen mit der Polizei (nach Ladendiebstählen), oder auffälligem sozialem Verhalten in der Öffentlichkeit aufgrund von Alkohol. Hiernach ist ebenfalls die Bedeutung der Nachversorgung zu betonen, da die meisten Gewalttaten in den ersten drei bis sechs Monaten nach Entlassung begangen wurden. Nur eine von 644 Gewalttaten, die von Schizophreniekranken innerhalb von 14 Jahren in Schweden verübt wurde, wurde als schwerwiegend klassifiziert.[129]
Einig sind sich die Studien darin, dass die Tatmotive von denen von Gesunden erheblich abweichen. Nur 9% der Opfer sind dem psychisch kranken Täter unbekannt, 86% hingegen gehören zum engsten Familien- oder Freundeskreis, am häufigsten Lebens- oder Ehepartner. Die üblichen Motive von Gewaltverbrechen fehlen fast vollständig. Auch wenn bei Erkrankten mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis das Gewaltrisiko etwas höher liegt, so ist die Öffentlichkeit dadurch nicht mehr bedroht als durch sogenannte Normale.[130]
Wichtig dabei ist zu sehen, dass sich die Gewalttaten nicht im „luft- bzw. gefühlsleeren Raum ereignen. Sie sind Ausdruck heftiger emotionaler Spannungen, die in den Familien sowohl von den Kranken wie von ihren Angehörigen empfunden und benannt werden.“ [131]
Jenseits von den gewaltbegünstigenden Faktoren des Alkohol- und Drogenmissbrauchs, der sozialen Entwurzelung und der fehlenden Nachsorge, gibt es bei Schizophreniekranken auch gewalttätige Handlungen, die in direktem Zusammenhang mit der psychischen Krankheit stehen. Ausgehend von den psychotischen Symptomen des Verfolgungswahns, des Gefühls unter Beobachtung zu stehen, ausspioniert zu werden, vergiftet, getötet oder verletzt zu werden, kann es bei krisenhafter Zuspitzung zu „Notwehrmaßnahmen“ des Betroffenen kommen. Diese Symptomatiken erklären auch, warum Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens häufiger Opfer von Gewalttaten psychisch Kranker werden.[132]
Auch wenn das Gewaltrisiko von psychisch Kranken etwas höher liegt als in der Durchschnittsbevölkerung, so ist es doch nicht höher als bei anderen Risikogruppen. Dazu zählen allgemein Männer im dritten Lebensjahrzehnt und junge Leute, sowie arbeitslose Jugendliche, und Personen die Alkohol oder Drogen missbrauchen.[133]
7. Stigma und Identität
Es wurde bereits mehrfach angesprochen, dass sich Stigmatisierungen auf die Identität, das Selbstbild und das Selbstwertgefühl auswirken können. Die hier vorgestellten Ansätze sind sich uneinig, was den Grad der Beeinflussung des Selbstbildes durch Stigmatisierungen betrifft.
7.1. Die Stigma-Identitäts-These
Grundlegend für die Auseinandersetzung mit der Identitätsproblematik ist das in der Einleitung erwähnte Buch von Goffman aus dem Jahr 1963.
Mit dem Buch „Stigma und Identität“ hat Frey 1983 die Stigma-Identitäts-These ergänzt und erweitert, indem er näher auf den Innenaspekt eingegangen ist.
Goffman unterscheiden zwischen drei Ebenen der Identität: soziale, persönliche und Ich-Identität.
Die „soziale Identität“ beschreibt die Zuordnung von Menschen zu bestimmten Kategorien. Aufgrund des ersten Eindrucks wird das Gegenüber „typisiert“, damit sind bestimmte Erwartungen an das Individuum verbunden. Diese Erwartungen sind eng an das Bild der Gruppe, welcher das Individuum zugehört, gekoppelt. Goffman beschreibt diese routinemäßige Kategorisierung und damit Charakterisierung, auch als „virtuale soziale Identität“. Die Kategorie aufgrund der Eigenschaften, welche das Individuum tatsächlich besitzt, nennt er die „aktuale soziale Identität“. Bei einer stigmatisierten Person kann das stigmatisierende Merkmal dermaßen in den Vordergrund drängen, dass daraus eine große Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität entsteht.[134]
Die „persönliche Identität“ bringt die Einzigartigkeit eines jeden Individuums zum Ausdruck. Goffman beschreibt die Einzigartigkeit als „positive Kennzeichen oder Identitätsaufhänger und die einzigartige Kombination von Daten der Lebensgeschichte“[135]. Gemeint ist damit also nicht die Innensicht, was die deutsche Übersetzung mit „persönlicher Identität“ ja leicht zum Ausdruck bringen könnte.
Die Ich-Identität bezeichnet den Innenaspekt, das subjektive Empfinden der eigenen Situation, Kontinuität und Eigenart.[136] Goffman geht nicht viel weiter auf den Innenaspekt ein, sondern verweist bloß auf Erikson.
„Das stigmatisierte Individuum tendiert zu denselben Auffassungen von Identität wie wir; dies ist ein Schlüsselfaktum. Seine innersten Gefühle über sein eigenes Wesen mögen besagen, daß es eine „normale Person“ ist“.[137] Zur gleichen Zeit wird er von seiner Umgebung aber als „abnormal“ definiert.
Von der Umwelt wird ein Handel angeboten: das stigmatisierte Individuum soll sich normal verhalten und so tun als ob seine Last nicht schwer sei, und damit die Akzeptanz der Umwelt nicht überstrapazieren. Das stigmatisierte Individuum soll seine Andersartigkeit akzeptieren, es hat kein Recht sich auf Normalität zu berufen. Als Gegenleistung für die gelungene Anpassung wird der Stigmatisierte akzeptiert und als normal behandelt. Goffman spricht in diesem Zusammenhang davon, dass auf der Grundlage der Schein-Akzeptanz eine Schein-Normalität gebildet wird.[138]
„Kurzum, es wird ihm gesagt, daß es wie jeder andere ist und daß es dies nicht ist – wenngleich es unter den Sprechern wenig Übereinstimmung darüber gibt, wieviel es von jedem für sich beanspruchen sollte. Dieser Widerspruch und Witz ist sein Schicksal und seine Bestimmung.“[139] Was das stigmatisierte Individuum über sich denken sollte, wird damit von der Umwelt bestimmt.[140]
Goffman betont aber auch, dass niemand den Anforderungen der Normalität entsprechen kann und seine Analyse damit jedermann betrifft.[141]
Frey untersuchte die Veränderung der Identität bei straffällig gewordenen Jugendlichen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf dem Innenaspekt.
Zunächst unterscheidet er zwischen drei verschiedenen „Bedeutungskategorien“ von Identität. Er definiert Identität als:[142]
1. „das Ergebnis externer Typisierungs- und Zuschreibungsprozesse“
2. „das Ergebnis interner Typisierungs- und Zuschreibungsprozesse“
3. „spezifische Integrationsleistung einer Person“
Der externe Aspekt wird von Frey mit dem Begriff „Status“ gleichgesetzt. Er versteht darunter die soziale Verortung eines Individuums durch die Umwelt, die mit bestimmten Erwartungen an das Individuum verknüpft sind. Die soziale Verortung vollzieht sich auf der Grundlage von Prestige- und Stigma-Symbolen. Frey selbst erkannte die große inhaltliche Nähe zu der von Goffman beschriebenen sozialen und persönlichen Identität.[143]
Der interne Aspekt ist nach Frey ein reflexiver Prozess, er bezeichnet diesen auch als das Selbst und unterscheidet zwischen zwei Kategorien: das Soziale und das Private Selbst.[144] Diese Trennung ist notwendig, da diese beiden Seiten selten als deckungsgleich erlebt werden. Das Soziale Selbst „bezeichnet die interne Ebene der Selbst-Erfahrung, auf der die Person sich selbst aus der Perspektive ihrer sozialen Umwelt definiert“[145]. Es dreht sich um die Frage, wie die anderen das eigene Selbst wahrnehmen.
Das Private Selbst „bezeichnet die interne Ebene der Selbst-Erfahrung, in der die Person sich aus ihrer eigenen privaten Perspektive definiert“[146]. Das Soziale und das Private selbst sind Teile der Identität des Individuums und schaffen die subjektive Wirklichkeit.
„Das Soziale und Private Selbst entsteht und verändert sich aufgrund neuer Ereignisse in der objektiven Wirklichkeit.“[147] In diesem Sinne beschreibt Frey die Identität als eine spezifische Integrationsleistung , „bei der divergierende Elemente externer und/oder interner Zuschreibungen aufgelöst oder ausbalanciert werden müssen“[148]. Mit der Integrations- und Balanceleistung möchte das Individuum seine Kontinuität, Konsistenz und positive Selbsterfahrung erhalten. Dies geschieht mithilfe von Identitätsstrategien.[149]
Aufgrund des ständigen Informationsflusses kommt es zu Diskrepanzen zwischen dem sozialen und privaten Selbst, die Identität ist damit einem ständigen Wandel unterworfen, und Kontinuität muss ständig neu hergestellt werden. Identitätsprobleme treten als Folge davon vor allem dann auf, wenn das Individuum sich selber in dem sozialen System nicht mehr verorten kann.[150]
In verschiedenen Situationen reagiert das Individuum unterschiedlich, insofern muss Identität als ein Prozess, eine Balance-Leistung begriffen werden. Darin liegt das Problem der Konsistenz. Die Balance-Leistung, sich einerseits festzulegen und sich gleichzeitig Optionen frei zu halten, setzt eine gezielte Strategie voraus.[151] Damit die Identität trotzdem als kontinuierlich erlebt werden kann, muss das Individuum bestimmte Kriterien entwickeln. „Das kann es aber nur, wenn es eingermaßen verläßlich weiß, was es selber will und wie es sich selber sieht.“[152] Identitäten sind je nach Situation unterschiedlich, um zu verstehen, warum diese trotzdem nicht willkürlich erscheinen, muss mit einbezogen werden, dass das Individuum nur soviel von seiner Identität in Frage stellt wie es für die Situation unvermeidlich erscheint.[153] Das Interesse des Individuum nach Kontinuität und Konsistenz erfasst nur die Dimensionen der Bestätigung, bzw. Nicht-Bestätigung. Es kommt aber noch eine weitere Dimension hinzu, das Interesse an positiver Selbst-Erfahrung. An dieser Stelle führt Frey das hedonistische Prinzip an: Menschen streben danach, positive Selbsterfahrungen zu maximieren und negative zu minimieren. Die Person „wird versuchen, bedrohende Inkongruenzen abzubauen und angenehme Inkongruenzen zu bestätigen“[154].
Um die bedrohenden Inkongruenzen abzuwehren, wendet das Individuum Identitätsstrategien an. Frey unterscheidet zwischen zwei Ebenen, der kognitiven und der Handlungsebene. Auf der kognitiven Ebene kann die Identitätsstabilisierung etwa mit Hilfe von unbewussten Bewältigungsstrategien geschehen. Hierzu gibt es einen großen Katalog, der sich aus den unterschiedlichen psychologischen Theorien zusammensetzt. Die Identitätsstrategien auf der Handlungsebene sind ebenfalls vielfältig. Die Person kann versuchen die Umwelt davon zu überzeugen, dass das Bild das sie von ihr hat nicht stimmt. Eine andere Möglichkeit ist die des Abbruchs sozialer Beziehungen oder die Zuwendung zu anderen gleichermaßen stigmatisierten.[155] Diese Möglichkeit wird im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen viel diskutiert.
Wenn sich das Bild vom sozialen Selbst verändert, so zieht das in der Regel auch eine Veränderung vom privaten Selbst nach sich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das Identitätsgefühl so stabil ist, dass das private Selbst nicht den veränderten Gegebenheiten angepasst wird. Dafür bedarf es gewisser psychischer Anstrengungen und es ist mit Zweifeln und Unsicherheit verbunden. Mit weiteren inkongruenten Informationen wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dieses Selbstbild aufrechtzuerhalten. Das zeigt, dass das private Selbst genauso von der Umwelt beeinflusst wird wie das soziale Selbst.[156]
7.2. Die Sozialisation zum Stigmatisierten
Um den Prozess der Stigmatisierung zu verstehen, wie sich die Phasen hin zu einem „stigmatisierten Individuum“ im einzelnen vollziehen, ist vor allem der labeling approach, der Etikettierungsansatz von Scheff viel diskutiert worden. Er wurde auch sehr häufig kritisiert und schließlich wurde er von Link et al. zum modifizierten Etikettierungsansatz weiterentwickelt. Während sich bei Scheff der Prozess hin zu einem stigmatisierten Individuum unweigerlich vollzieht, gibt es bei Link et al. zwei Faktoren, welche den Prozess beeinflussen können. Die „Selbststigmatisierung“ ist die aktuellste These, sie beschreibt ausführlich einige Punkte, von der die Integration des Stigmas in das Selbstbild abhängig ist.
7.2.1. Der Etikettierungsansatz nach Scheff
Thomas J. Scheff[157] veröffentlichte 1966 eine soziologische Theorie, die dem besseren Verständnis der „chronischen Geisteskrankheit“ dienen sollte. Ursprünglich wurde der Etikettierungsansatz von Tannenbaum entwickelt und von Becker weiterentwickelt, um Devianz im allgemeinen zu erklären. Um eine neue Sichtweise auf das Problem der psychischen Krankheit zu ermöglichen, ersetzt Scheff den Begriff der psychischen Erkrankung mit dem der residualen Verhaltensabweichung. Die gängige medizinische Sicht beschränkt sich auf die Innenwelt des Individuums. Nach der Theorie von Scheff ist jedoch nicht der Mensch an sich krank, sondern er wird als solcher etikettiert. Die Gesellschaft stellt Regeln auf, von denen einige allgemeingültig und von allen Mitgliedern für selbstverständlich gehalten werden. Sie sind so selbstverständlich, dass es darüber keines Austausches bedarf, diese nennt er Residualregeln. Wird nun eine dieser Regeln von einer Person verletzt, so empfindet die Umwelt ihn als absonderlich. Danach sind Verhaltensabweichende „ nicht eine Gruppe von Menschen, welche die gleiche Tat verübt haben, sondern eine Gruppe von Menschen, die als Abweichende etikettiert worden sind.“ [158] Die Gesellschaft findet für jede Regelverletzung ein passendes Vokabular zur Einordnung der Person, wie z.B. Verbrecher, Trinker usw.. Die Regelverletzungen die nicht in eine dieser Kategorien passen, werden zu einer Kategorie zusammengefasst, „etwa Zauberei, Besessenheit oder, in unserer Gesellschaft, psychische Störung“.[159]
Es besteht in der Gesellschaft Einigkeit darüber, was für Menschen „verrückt“ sind, diese Stereotype werden in der frühen Kindheit erlernt und im weiteren Leben bestätigt, z.B. durch die Massenmedien und die Alltagssprache. Eine residuale Regelübertretung muss indes nicht unbedingt zu dem Etikett einer psychischen Erkrankung führen. Im Gegenteil, in den meisten Fällen wird sie geleugnet und nur in einigen wenigen Fällen kommt es zu einer „abweichenden Laufbahn“. [160] In diesen Fällen greifen „Überbetonungs- oder Übertreibungsmuster (...). die nachweisen sollen, dass der Betroffene schon während seiner ganzen Lebenszeit im Grunde ein Abweichender gewesen ist“. [161] In dem Fall, dass die Abweichung eine öffentliche Angelegenheit wird, reagiert die Umwelt mit bestimmten Erwartungen auf dem Hintergrund des Stereotyps, wie sich ein psychisch Kranker zu verhalten hat. „Sein Verhalten wird dem anderer, als geisteskrank bezeichneter Abweichender ähnlich und stabilisiert sich mit der Zeit.“ [162] Die Stabilisierung der Rolle des Geisteskranken vollzieht sich durch ein System von Belohnungen und Bestrafungen. So werden im Krankenhaus Patienten bevorzugt behandelt die Einsicht zeigen und in ihrem Verhalten Symptome von einer Krankheit erkennen. Des Weiteren wird es ihnen so gut wie unmöglich gemacht, ihren alten Status im Berufs-, Familien oder sozialen Leben wiederzuerlangen. Dies geschieht vor allem durch Stigmatisierung und hängt nicht von ihrem tatsächlichen Verhalten ab. Schließlich ist die Person selber mit den Stereotypen von psychischer Krankheit aufgewachsen, und da diese außerordentlich resistent sind, werden „sie auch dann nicht angetastet ..., wenn jemand selbst Gefahr liefe, das Etikett der Geisteskrankheit zu erhalten“. [163] Es kommt zu einem Teufelskreis, in dem der Betroffene von seiner Umwelt etikettiert wird, diese Rolle annimmt und daraufhin noch stärker als ein psychisch Kranker definiert wird, schließlich nimmt er geradezu zwangsläufig die Rolle des psychisch Kranken in seine Identität auf. Dies führt nach Scheff schließlich zu einer Chronifizierung der psychischen Erkrankung.
Dieser Ansatz hat viel und heftige Kritik hervorgerufen. Ein Kritikpunkt ist, dass die meisten Arbeiten wie eine umfangreiche Ideensammlung wirken, dass jedoch die Entwicklung von allgemeinen, empirisch überprüfbaren Theorien fehlt.[164]
Dieser Punkt, dass er vor allem beschreibt aber wenig oder nichts erklärt wird häufig kritisiert.[165]
Weitere Kritikpunkte sind, dass manche Autoren in der Gesellschaft keine Hinweise darauf sehen, dass psychisch Kranken mit Ablehnung begegnet wird. Und wenn doch, so sei dies einzig und allein auf gestörtes Verhalten zurückzuführen. Außerdem würde der überwiegende Teil Stigmatisierung nur vorübergehend erfahren und bei Umfragen unter psychisch Kranken, können nur Wenige konkrete Fälle der Stigmatisierung nennen.[166]
Diese Argumente wurden jedoch in zahlreichen Studien entkräftet.
7.2.2. Der modifizierte Etikettierungsansatz nach Link
In zahlreichen Studien haben Link et al.[167] zur Entkräftigung der oben genannten Kritikpunkte beigetragen und gezeigt, dass es negative Einstellungen gegenüber psychisch Kranken gibt, und dass diese zahlreiche negative Folgen für den Betroffenen haben können. Er fasste diese Ergebnisse 1989 in „the modified labeling approach“[168] zusammen. Ein wichtiger Unterschied zu dem Ansatz von Scheff ist, dass sie davon ausgehen, dass Etikettierung alleine nicht zur Entstehung einer psychischen Krankheit führt, aber dennoch negative Konsequenzen nach sich zieht. Das besondere an diesem Ansatz ist, dass er im Gegensatz zu älteren Theorien die subjektive Sichtweise betont. Der Prozess wird aus der Perspektive der Betroffenen geschildert und es kommen die Situationen, in welchen diese stecken, zum Ausdruck.
Wie Scheff gehen Link et al. davon aus, dass es in der Gesellschaft Vorstellungen davon gibt, was es bedeutet psychisch krank zu sein und diese Stereotype größtenteils negativ besetzt sind.
Link et al. haben zwischen fünf wesentlichen Schritten des Stigmaprozesses unterschieden. Der erste Schritt ist das Erlernen dieser Vorstellungen, die gesellschaftliche Konzeption von der Bedeutung psychischen Krankseins wird verinnerlicht. Die Stereotype werden in der Kindheit erlernt, also auch von denen, die später selbst das Etikett psychisch krank erhalten. Wie sie selbst mit diesem Etikett umgehen werden, und inwiefern die Kenntnisse über das Stereotyp zu Selbststigmatisierung führen wird, hängt vor allem von zwei wichtigen Komponenten ab. Einmal die Vorstellung davon, wie groß das Ausmaß der Entwertung psychisch Kranker ist und zweitens, wie groß das Ausmaß der Diskriminierung ist. In diesem Zusammenhang ist mit Entwertung der Statusverlust und mit Diskriminierung die soziale Distanz gemeint. In Anlehnung an Scheff gehen Link et al. davon aus, dass psychische Krankheit in der Gesellschaft negativ besetzt ist. Link et al. betonen, dass die Erwartung der Zurückweisung psychisch Kranker ein Ergebnis der Sozialisation und des kulturellen Kontextes ist.
In dem zweiten Schritt wird die Wichtigkeit eines offiziellen Etiketts betont, diese Phase ist z.B. erreicht, wenn die betroffene Person eine Diagnose aufgrund einer psychiatrischen Behandlung bekommt. Dieser Schritt ist seiner Meinung nach so wichtig, weil damit die Einstellung der Gesellschaft gegenüber psychisch Kranken persönliche Relevanz erfährt. Eine Reihe „unschuldig“, harmlos wirkender Einstellungen treffen plötzlich auf einen selber zu, sie erhalten dadurch eine neue Bedeutung.
In dem dritten Schritt kommt es zur Reaktion der betroffenen Person, sie entwickelt Bewältigungsmechanismen. In Anlehnung an das Stigma-Management von Goffman unterscheidet er zwischen drei möglichen Reaktionen (coping Strategien). Als erstes nennt er secrecy, also Verheimlichung der Erkrankung vor anderen, um eventuelle Zurückweisungen zu verhindern. Die zweite Möglichkeit ist withdrawal, der soziale Rückzug. Diese Menschen haben dann größtenteils nur noch soziale Kontakte zu ebenfalls stigmatisierten („the own“), oder zu bereits Eingeweihten, die über das Stigma Bescheid wissen und es akzeptieren („the wise“). Zu der zweiten Gruppe gehören insbesondere Menschen die von ihrer Profession her mit psychisch kranken Kontakt haben. Allein aufgrund der Erwartung von Ablehnung vermeiden viele Situationen, in welchen sie Ablehnung erfahren könnten. Mit dieser Strategie wird ebenfalls die Möglichkeit der Zurückweisung auf der Suche nach Freunden oder Arbeit unterbunden. Die dritte Möglichkeit schließlich besteht daraus, andere über die eigene Erkrankung aufzuklären (preventive telling). Im Gegensatz zu secrecy and withdrawal wird die negative Einstellung der anderen also nicht passiv akzeptiert, sondern sie versuchen diese zu verändern. Dazu gehört, andere Menschen persönlich und sachlich zu informieren, sowie das Zusammentreffen und die Aufklärung der Allgemeinheit. Viele psychisch Kranke klären ihnen wichtige Personen auf, gehen aber nicht an die Öffentlichkeit.
Wofür sie sich entscheiden, hängt davon ab, wie sie die Risiken und Vorteile beurteilen. Die Vorteile sind gesteigerter Selbstwert, verringerte Belastung durch die Geheimhaltung, weniger zufällige Diskriminierungen und ein entspannteres und vertrauensvolleres Verhältnis zu den Menschen die jetzt Bescheid wissen. Die Offenlegung beinhaltet aber auch das Risiko der direkten Diskriminierung.[169]
Die Anwendung dieser Strategien wurden von Link et al. in einer Studie mit 164 offiziell etikettierten psychisch Kranken untersucht, die meisten sprachen sich für alle drei Strategien aus. Je nach Situation und Art der Beziehung, wird eine andere Strategie empfohlen. Die meisten (91%) sprachen sich dafür aus, Personen, die einem nahe stehen, über die Krankheit aufzuklären. Bei der Suche nach einer Arbeitsstelle empfahlen 70%, die Krankheit geheim zu halten und 68% waren der Meinung, dass psychisch Kranke Leuten, die schlecht über psychisch Kranke denken, aus dem Weg gehen sollten.[170]
Aus diesen Reaktionen entstehen direkte Konsequenzen für das Leben und die Lebensumstände (Schritt 4) der stigmatisierten Person. Zum einen werden die Auswirkungen der negativen Einstellungen und Handlungsweisen der Bevölkerung wirksam, oder sie sind das Ergebnis des Versuches, diese zu verhindern und sich davor zu schützen. Beides kann zu starken, negativen Konsequenzen führen. Viele psychisch Kranke schämen sich für ihre Erkrankung und fühlen sich schuldig. Diese Gefühle haben negative Auswirkungen auf soziale Beziehungen und das Selbstwertgefühl. Während die oben genannten Verhaltensweisen die negativen Auswirkungen abmildern können, vermindern sie gleichzeitig die Lebenschancen. Withdrawal zum Beispiel kann zum Verlust des sozialen Netzwerkes führen und auch den Verlust von sozialen Ressourcen bedeuten.
Nachdem die Schritte 1-4 wirksam geworden sind, und es zu einer Verminderung des Selbstwertgefühls, der sozialen Kontakte und dem Verlust des Arbeitsplatzes etc. gekommen ist, ist eine erhöhte Vulnerabilität für psychosoziale Störungen zu verzeichnen. Diese Defizite sind eindeutig wichtige soziale und psychologische Risikofaktoren, und können damit zu einer Verschlechterung der Krankenkarriere beitragen.[171]
Genauso wie der Ansatz von Scheff, verdeutlicht der modifizierte Etikettierungsansatz das Prozesshafte der Stigmatisierung. Es besteht eine Entwicklung über mehrere Phasen (Schritte) und durch die chronologische Anordnung können wichtige Hinweise auf effektive Maßnahmen zur Entstigmatisierung gefunden werden.
Der wichtigste Unterschied zu dem Ansatz von Scheff ist wohl, dass die Etikettierung nicht zwangsläufig zu einer Chronifizierung der Krankheit führt. Entscheidend ist, wie das Ausmaß der Abwertung und Diskriminierung von dem Betroffenen eingeschätzt wird. Dies beeinflusst in besonderem Maße das Verhalten der Stigmatisierten. Studien haben gezeigt, dass die erwartete Stigmatisierung in dem Stigmatisierten ein Verhalten hervorrufen kann, welches als solches zur Ablehnung führen kann. Abweichendes, stigmatisierendes Verhalten wird in diesem Fall also erst durch die Etikettierung ausgelöst.[172]
7.3. Subjektives Stigmatisierungserleben psychisch Kranker
Bei Goffman spielten die subjektiven Erfahrungen der Stigmatisierten eine große Rolle. Danach wurden diese jedoch jahrelang vernachlässigt. Im Zuge des Etikettierungsansatzes waren die Einstellungen der Bevölkerung in den Mittelpunkt der Forschung gerückt. Erst durch die Weiterentwicklung zur modifizierten Etikettierungstheorie durch Link und die große Bedeutung, die er der Selbststigmatisierung beimisst, wurden die subjektiven Stigmatisierungsprozesse wieder ins Licht der Aufmerksamkeit gerückt.
Insbesondere zwei Aspekte werden seitdem erforscht. Dazu zählt einmal die konkrete Erfahrung von Stigmatisierungen und Diskriminierungen und zweitens die erwarteten (antizipierten) Stigmatisierungen von den Betroffenen.
Je nach Studie und Land, in der diese durchgeführt wurde, sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Gleich bleibend ist aber die Reihenfolge, wo die stärksten Diskriminierungen erwartet und erlebt wurden.
Am häufigsten wird Diskriminierung im Bereich der interpersonellen Interaktionen erwartet und erfahren. An zweiter Stelle folgen beleidigende und verletzende Darstellungen von psychisch Kranken in den Medien. Es folgen Schwierigkeiten beim Zugang zu sozialen Rollen und am seltensten wurde von strukturellen Diskriminierungen berichtet.[173] Viel häufiger als die direkte Diskriminierung wird von den Betroffenen „zufällige Ablehnung“[174] erlebt. Sie wird als zufällig beschrieben, da die Ablehnung nicht direkt an die Person gerichtet ist. Gemeint sind abfällige, ablehnende Bemerkungen über psychisch Kranke im Beisein eines Betroffenen. Die Person, die das entsprechende Stereotyp geäußert hat, weiß nichts von der Erkrankung ihres Gegenübers und hat ihn nicht persönlich gemeint, insofern trifft ihn diese Ablehnung eher zufällig.
Die bislang größte Studie wurde in den USA von Wahl durchgeführt. An dieser nahmen 1300 Personen teil. Eine vergleichbare Studie wurde auch in Deutschland, in einem Leipziger Krankenhaus durchgeführt, an welcher allerdings nur 105 Personen teilnahmen. Wegen der großen kulturellen Unterschiede und der Unübersichtlichkeit der Studien, die dadurch entsteht, dass unterschiedliche Krankheitsbilder mit einbezogen wurden, und getrennt oder gemeinsam ausgewertet wurden, findet die Studie aus Deutschland hier besondere Beachtung. In diese Studie wurden sowohl schizophren (S) als auch depressiv (D) erkrankte mit einbezogen und getrennt ausgewertet.[175]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
An diesen Ergebnissen fällt auf, dass es eine große Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlich erfahrener Stigmatisierung gibt. Am häufigsten (von 69-81%) wurde erwartet, keine Chance bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz zu haben. Gleichzeitig haben die wenigsten (1,9-19%) tatsächlich eine Ablehnung bei einer Bewerbung aufgrund ihrer psychischen Erkrankung erfahren. Von zwei Drittel der Befragten wurde die Meinung geäußert, dass nur im Zusammenhang mit begangenen Gewalttaten über psychisch Kranke in den Medien berichtet wird. Genauso häufig wird erwartet, dass sich die meisten Leute ablehnend verhalten und den Kontakt meiden. In dem Bereich der antizipierten Stigmatisierung gibt es nur geringfügige Abweichungen zwischen depressiv und schizophren Erkrankten. Letztere erfahren Stigmatisierungen jedoch zumindest in einigen Bereichen weitaus häufiger als depressiv Erkrankte.
In dem Bereich der konkreten Stigmatisierungserfahrungen wird am häufigsten die Ablehnung durch andere erfahren, dies kommt bei Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung weitaus häufiger vor als bei depressiv Erkrankten. In dem Bereich der Kontaktvermeidung wird dies noch deutlicher. Schizophren Kranke erleben auch häufiger die Ablehnung bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder bei einer möglichen Partnerschaft.
Dass die Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlicher Stigmatisierung so groß ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele sich erst gar nicht in Situationen begeben haben, in der Gefahr bestand, diskriminiert zu werden. Dies wird bei der Arbeitssuche besonders deutlich. Ein Drittel der Befragten hatten keine Erfahrungen damit, teilweise, weil sie sich krankheitsbedingt nicht um eine Stelle bewerben und teilweise, (15%) weil sie sich aus Angst vor Ablehnung erst gar nicht in eine entsprechende Situation begeben haben.
Dass konkrete und erwartete Stigmatisierung wenig miteinander zu tun haben, stützt die These von Link et al., dass im Zuge der Sozialisation bestimmte Stereotype in bezug auf psychisch Kranke gelernt werden und dementsprechende Reaktionen ihrer Umwelt erwartet werden.
Die oben erwähnte Studie aus den USA kam zu weitaus höheren Ergebnissen bei konkreten Stigmatisierungserfahrungen, sie liegen sogar über den antizipierten Stigmatisierungen in Deutschland. In diese Studie wurden Menschen mit bipolaren Störungen, Schizophrenie und Major Depression mit einbezogen. Am häufigsten berichteten diese darüber, dass in ihrer Gegenwart abfällig über psychisch Kranke gesprochen wurde (78% manchmal, 50% oft) und 67% gaben an, in den Medien verletzende Sendungen gesehen zu haben und 32%, dass eine Bewerbung von ihnen abgelehnt wurde. Ähnlich ist der Wert bei der Kontaktvermeidung, der bei 60% liegt. Andere Studien aus den USA kamen ebenfalls zu niedrigeren Ergebnissen.[176]
Bei den erwarteten Stigmatisierungen kam Link 1989 in den USA zu ähnlichen Ergebnissen. Der einzige nennenswerte Unterschied ist, dass 81% (im Gegensatz zu 38-43% in Deutschland) mit einer Ablehnung bei der Suche nach einer Partnerin rechnen.[177]
Insgesamt ist zu sagen, dass die erwarteten Reaktionen bei den psychisch Kranken und der Allgemeinbevölkerung übereinstimmen, was wiederum die oben erwähnte These von Link et al. stützt.
7.4. Selbststigmatisierung
Selbststigmatisierung ist erst in den letzten Jahren zu einem Thema geworden dem sich Forschungen widmen. Die Jahre zuvor wird diese zwar in der einschlägigen Literatur erwähnt, die Aussagen sind jedoch mehr allgemeiner Natur.
Selbststigmatisierung entsteht, wenn die Vorurteile und Stereotype gegenüber der stigmatisierten Gruppe, zu welcher die stigmatisierte Person gehört, geteilt und damit gegen sich selbst gewendet werden. Wie ich unter 4.3. dargestellt habe, und von Link et al. auch betont wurde, werden Stereotype schon in der frühen Kindheit erlernt. Viele Betroffene kennen diese also schon lange vor Ausbruch der eigenen Erkrankung und haben diese geteilt, nach Ausbruch der Krankheit wenden sie diese unter Umständen gegen sich selbst.[178] Diese erlernten Stereotype prägen auch die Erwartung von Ablehnung. Wie ich oben dargestellt habe, erwarten die meisten Stigmatisierten mehr Ablehnung als sie tatsächlich erfahren. Diese Stereotype wurden jedoch nicht nur in der frühen Kindheit erlernt, sondern sie werden von den Betroffenen in Form von Diskriminierung auch nach Ausbruch der Erkrankung erlebt. Die Betroffenen werden damit in ihren Erwartungen bestätigt.[179] Dazu zählt insbesondere die zufällige Diskriminierung, diese Bemerkungen können sehr kränkend sein und die Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, der Integrität oder dem Selbstwert nähren.[180]
Finzen spricht davon, dass die Betroffenen aufgrund ihrer Erkrankung eine „zwangsläufige Missbilligung ihrer selbst “[181] entwickeln. Dies wird von ihm auch als zweite Krankheit bezeichnet.
Heute wird nicht mehr von einer zwangsläufigen Missbilligung gesprochen, sondern Forschungen haben gezeigt, dass einige Stigmatisierte durchaus ihr Selbstwertgefühl bewahren können. Das dies ein außerordentlich schwerer Kampf ist, steht außer Frage. Ob und wie die Betroffenen ihre Krankheit annehmen können, hat weitreichende Folgen für den Gesundungsprozess.
Wenn eine Person sich selbst stigmatisiert, so zieht das eine große Anzahl verschiedener negativer Folgen nach sich, insbesondere ein niedrigeres Selbstwertgefühl und geringere Selbstwirksamkeit. Betroffene, welche sich selber stigmatisieren, trauen sich oftmals nicht, sich um Arbeit, eigenständige Wohnmöglichkeit, gesellschaftliche Kontakte oder Partnerschaft zu bemühen.[182] Das Stigma löst bei vielen Schamgefühle aus, was sich wiederum auf die Selbstachtung auswirkt. Sie stellen sich selber in Frage, inwiefern sie fähig sind ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder soziale Rollen zu erfüllen. Viele schwer erkrankte fühlen sich nicht als ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Eine repräsentative Studie ergab, dass die meisten sich nach der Erfahrung der psychischen Erkrankung entmutigt, verletzt und wütend fühlen und ein niedrigeres Selbstbewusstsein als vor der Erkrankung haben.[183]
Eine Studie von Link et al. mit 70 Teilnehmern aus dem Jahr 2001 ergab, dass eine beträchtliche Minderheit der psychisch Kranken ein niedrigeres Selbstwertgefühl als die Allgemeinbevölkerung hat. Es wurde mit einer zehn Punkte Skala gemessen. Die Frage ob sie sich von Zeit zu Zeit unnütz fühlen, bejahten 54% und die Frage, ob sie dazu neigen sich als Versager zu fühlen bejahten 37%. In der US amerikanischen Allgemeinbevölkerung wurde die erste Frage von 29% und die zweite von 10% bejaht. Der Durchschnitt der psychisch Kranken äußerte ein positives Selbstwertgefühl. Doch eine bedeutende Minderheit von 24% lag auf der Skala unter dem Mittelwert und 73% bejahten zwei oder mehr Fragen der zehn Punkte.[184] Es kommt also nicht zu einer zwangsläufigen Missbilligung der eigenen Person und einem verminderten Selbstwertgefühl, sondern viele psychisch Kranke können sich dieses durchaus bewahren.
Durch andere Forschungen hat sich gezeigt, dass nicht alle Menschen gleichermaßen zur Selbststigmatisierung neigen. Während die einen psychische Erkrankung negativ bewerten, sich selber stigmatisieren und dadurch einen negativen Selbstwert haben, lassen andere sich von den Vorurteilen nicht beeinflussen, haben trotzdem einen positiven Selbstwert und leben selbstbestimmt (empowerment). Dieser Umstand wird auch als „Paradox von Selbststigma und psychischer Erkrankung“ bezeichnet.[185]
In welche der beiden Richtungen sich ein Betroffener entwickelt, hängt nach Corrigan ganz entscheidend von zwei Faktoren ab. Erstens ob die Person sich mit der stigmatisierten Gruppe identifiziert. Tut sie es nicht, so enthält das Stigma keine Bedeutung für sie. Wenn sie sich zu der stigmatisierten Gruppe zählt und die Vorurteile auf sich selbst bezieht, so ist es zweitens von entscheidender Bedeutung, ob sie diese als legitim empfindet. Wenn sie diese als berechtigt empfindet, so wird es zu dem oben beschriebenen Prozess der Selbstabwertung, Selbststigmatisierung kommen. Wenn sie jedoch diese Stereotype und Vorurteile nicht teilt und nicht als legitim empfindet, so wird sie sich berechtigterweise darüber empören und sich zum Beispiel in Selbsthilfeinitiativen engagieren.[186]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Drei weitere Aspekte müssen bei psychischer Erkrankung noch beachtet werden. Das verringerte Selbstwertgefühl könnte auch Ausdruck eines depressiven Syndroms sein. Zweitens fehlt während manischer oder psychotischer Episoden die Krankheitseinsicht, so dass das Stigma nicht auf sich selber bezogen wird, da die Betroffenen sich nicht als psychisch krank empfinden. Drittens kann die soziale Wahrnehmung eingeschränkt sein, so dass stigmatisierendes Verhalten der Umwelt nicht wahrgenommen wird.[187]
Es kommt wahrscheinlich häufiger vor, dass verringertes Selbstwertgefühl pathologisiert wird und als depressives Symptom gewertet wird, obwohl es eigentlich Ausdruck der Selbststigmatisierung ist. Meine Erfahrung in der Psychiatrie war, dass so ziemlich jede Äußerung als ein Zeichen der Erkrankung oder der Genesung gesehen wurde, und nur sehr wenig auf andere Ursachen zurückgeführt wurde. “Für den Stigmatisierten ist es außerordentlich schwierig, das einmal festgelegte Stigma aufzulösen, weil alle seine Reaktionen – wie Ärger, Angst, Aufregung, Aggression oder Resignation – als eine Bestätigung der zugeschriebenen Eigenschaften aufgefasst werden. Wie er sich auch verhält, jede Reaktion kann im Sinne des Stigmas interpretiert werden.” [188]
7.5. Subjektives Krankheitsbewusstsein
Fehlendes Krankheitsbewusstsein, Krankheitsuneinsichtigkeit, ist einer der Hauptindikatoren zur Stellung der Diagnose einer psychotischen Krise. Dabei haben viele neuere Studien gezeigt, dass sich viele Psychoseerfahrene darüber im klaren sind, dass die Psychosen nicht der Realität entsprechen.[189]
Inwiefern der betroffene Mensch in der Lage ist die psychiatrische Diagnose zu akzeptieren, hat vielfältige Auswirkungen auf den Verlauf der Erkrankung und wie er mit ihr umgehen wird. Die schwierige Aufgabe, die psychische Krankheit in das eigene Selbstbild zu integrieren, wird in der Therapie oftmals mit einem „akzeptieren müssen“ abgetan. Diese jedoch einfach so zu akzeptieren, ist weder möglich noch nötig, es ist ein Prozess, der Jahre dauern kann. Es ist eine Entwicklung, die inneren und äußeren Veränderungen in das Selbstkonzept zu integrieren. Diese Entwicklung ist verbunden mit „Krisen des Lebenssinns, der Identität, des Selbstwertgefühls, des Kompetenzgefühls, der persönlichen Integrität und des Gefühls, das Leben meistern zu können.“ [190] Dort, wo dies gelungen ist, entwickelt sich ein neues Selbstkonzept und die Betroffenen fühlen sich als wertvolle und aktive Menschen. Die Schwierigkeiten dieses Prozesses wird bei jenen deutlich, wo Kranke und Angehörige von Scham- und Schuldgefühlen gequält werden und mit dem Schicksal hadern.
Das Ziel der psychiatrischen Behandlung ist unter anderem, den Patienten zu einer größeren Krankheitseinsicht zu bewegen, dies bedeutet eine Übernahme der Einschätzungen der Professionell tätigen. In der klinischen Literatur wird davon ausgegangen, dass eine Behandlung und Gesundung nur möglich ist, wenn die Patienten Krankheitseinsicht zeigen. Tun sie dies nicht, so wird ihnen unterstellt, dass sie uneinsichtig sind, die Symptome leugnen und sich der Behandlung wiedersetzen. Es kann aber durchaus sein, dass jemand der sich gegen die Selbstettiketierung sträubt, trotzdem die Symptome als behandlungsbedürftig erkennt.[191]
Für psychisch Kranke bedeutet es einen permanenten Kampf, sich den eigenen Selbstwert zu erhalten. Schizophrenen Patienten wird die Subjektivität genommen, indem die Person der schizophrenen Identität untergeordnet wird.[192]
Die Etikettierung als schizophren durch einen anderen Menschen wird als „Fremddefinition“ bezeichnet. Für die subjektive Einschätzung der Person ist die „Selbstdefinition“ entscheidend. Inwiefern die Fremddefinition auf diese Einfluss nimmt, ist davon abhängig, wie weit die betroffene Person in sozialen Kontexten lebt und auf die Meinungen der Umwelt achtet. Dies ist auch in der Arzt-Patienten-Beziehung zu beachten. Die Übernahme der medizinischen Definition kann zu einem negativeren Selbstbild führen, da diese Definition oftmals mit negativen Prognosen verbunden ist. Insofern kann eine Ablehnung der medizinischen Definition eine identitätsstabilisierende Wirkung haben.[193]
Für viele Patienten liegt die größte Herausforderung darin, sich der Reduktion der Identität als psychisch Kranker zu wiedersetzen. Diese Reduktion wird oftmals von der Psychiatrie unterstützt, indem sie versuchen die Patienten in eine spezifische Krankenrolle zu zwängen. Es sieht häufig so aus, als gäbe es nur zwei Möglichkeiten, entweder zuzugeben, dass es eine psychische, chronische Krankheit gibt oder sie zu verleugnen. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, wie es auch zwei Formen der Akzeptanz von psychischer Krankheit gibt. Während die eine mit Resignation verbunden ist, ist die andere mit einer Hoffnung auf ein besseres Leben verbunden.[194]
Die Krankenrolle zu akzeptieren kann eine Entlastung oder eine Bedrohung der Identität bedeuten. Sie kann teilweise sehr entlastend sein, z.B. bei Depressionen oder wenn in der akuten psychotischen Phase viel Porzellan zerschlagen wurde. Trotz dieser Entlastungen kann die Krankheit eine Bedrohung für die Identität bedeuten, insbesondere wenn sie mit Chronizität in Verbindung gebracht wird. Für den Psychiater ist es notwendig, seine Patienten als krank zu etikettieren. Es ist wichtig, auf die Trennung zwischen der Person und der Krankheit zu achten. So kann bei der Diagnose Borderline davon gesprochen werden, dass es Borderline-Symptome gibt, oder es kann von einer Borderline-Persönlichkeit gesprochen werden. In dem zweiten Fall wird die Identität auf die Krankheit reduziert und andere Eigenheiten und Fähigkeiten werden ignoriert.[195]
Die Krankheitsuneinsichtigkeit kann auch als Strategie gegen Selbststigmatisierung gesehen werden. Studien haben gezeigt, dass Patienten mit einem größeren Krankheitsbewusstsein oftmals ein geringeres Selbstwertgefühl haben, insofern ist die Uneinsichtigkeit eine Form der Krankheitsbewältigung.[196]
Leferink hat in den Jahren 1993-1995 eine Studie zu Krankheitseinsicht und Identität durchgeführt, an der 57 Betroffene sowie Angehörige und Professionelle teilnahmen. Dabei kam er zu dem Schluss, dass Psychosen die Betroffenen in ihrem innersten treffen, ihre Bedeutung als Person in Frage stellen und damit jede Beurteilung der Krankheit zu einer Beurteilung ihres Selbst wird. Der Begriff „doppelte Buchführung“ ist für schizophren Kranke geprägt worden, und bezeichnet eine inkohärente Sichtweise auf sich Selbst und die Symptome. Viele Betroffene haben einen doppelten Zugang, einerseits erleben sie die psychotischen Zustände als einen Teil ihres Selbst und andererseits können sie von außen ihre Symptome selbst beobachten. Einen Kompromiss zwischen diesen beiden Zugängen zu finden, scheint äußerst schwierig zu sein.[197]
An dem Anfang der Psychose werden viele Betroffene von einer Angst gepackt, dass sie wahnsinnig werden könnten. Dazu gehört auch die Angst davor, als solcher erkannt zu werden und in sozialer Hinsicht die Kontrolle zu verlieren . „Die mangelnde Einsicht ist ein Kampf gegen das innerliche Urteil der anderen.“ [198]
Viele Aussagen über die eigene Krankheit haben eine sozial-vermittelnde Qualität. Die Betroffenen versuchen sich gegenüber anderen zu erklären, sie suchen nach Begründungen, Entschuldigungen und Rechtfertigungen. Dazu gehört auch das Normalisieren der psychischen Erkrankung, also entweder, dass die Zuschreibung angezweifelt wird, oder dass die Gewöhnlichkeit psychischer Erkrankungen betont wird. Diese Rechtfertigungen dienen dem Schutz der Identität und der Bewahrung des eigenen Wertes.[199]
Wem es nicht gelingt die Krankheit anzunehmen, der gerät häufig in folgende Reaktionsmuster: Entweder konfrontiert er sich mit der Tatsache der Erkrankung, in diesem Fall ist die Gefahr groß, dass er sich selbst dafür verurteilt (selbststigmatisiert) und als Folge davon depressiv, antriebslos oder resignativ wird und sich von seiner Umwelt zurückzieht. Eine zweite Möglichkeit ist, die Tatsache der Erkrankung nicht zu akzeptieren. Damit verleugnet er einen Teil der Realität und ist wahrscheinlich nicht in der Lage, sich Hilfe zur holen oder die Frühwarnzeichen zu erkennen. Zu dem Annehmen der Erkrankung gehört nicht, möglichst normal sein zu wollen, sondern sich mit seinen Eigenarten zu akzeptieren und sich nicht dafür zu verurteilen.[200]
Das Gegenteil ist jedoch der Fall, viele psychisch Kranke versuchen die Erkrankung zu korrigieren, indem sie sich mit den „Normalen“ identifizieren und versuchen nicht aufzufallen, indem sie sich als besonders normal präsentieren.
8. Folgen von Stigmatisierungen
Die Folgen von Stigmatisierungen reichen in alle Lebensbereiche hinein. Hohmeier unterscheidet zwischen drei Ebenen, zum einen die Ebene der Teilhabe des Individuums an der Gesamtgesellschaft, die Ebene der Interaktionen mit Normalen sowie die Ebene der Veränderung der Identität.[201]
Auf der Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe gibt es vielfältige Folgen. Sie reichen von erschwerten Zugängen zu Ressourcen (z.B. Wohnung) und gesellschaftlichen Positionen (z.B. Arbeit) bis hin zu Verlusten von sozialen Rollen (z.B. Ehepartner). Dieser Bereich steht also in einem engen Zusammenhang mit der Interaktion mit Normalen. Inwiefern sich die Identität, das Selbstkonzept, als Folge der Erkrankung verändert, habe ich bereits im 7. Kapitel erläutert. “Das zentrale Problem des Stigmatisierten auf allen drei Ebenen ist das der Anerkennung als Person und als gesellschaftlicher Partner.”[202]
Als erstes möchte ich die Ebene der sozialen Interaktion besprechen, hierbei möchte ich insbesondere auf die soziale Unterstützung durch Angehörige eingehen. Als zweites folgt die Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe, wobei Arbeit einen besonders hohen Stellenwert hat, und ich diesem Aspekt auch einen extra Punkt widmen möchte. Als ein Konzept, dass versucht, diese verschiedenen Aspekte zusammen zu fassen, möchte ich schließlich auf die Lebensqualität psychisch Erkrankter eingehen.
8.1. Die Ebene der sozialen Interaktion: Das soziale Netzwerk
Unter sozialer Interaktion wird in der Soziologie ein Prozess verstanden, in dem Menschen sich in ihrem Verhalten absichtsvoll aufeinander beziehen und bewusst aufeinander reagieren. Aus sich wiederholenden, beständigen Interaktionen ergeben sich soziale Beziehungen. Aus einer Vielzahl von Beziehungen (Freundschaften, Familienangehörige, Bekannte) ergibt sich ein Netz von Beziehungen, eine Vielzahl an Verbindungen, ein soziales Netzwerk.[203] Im Gegensatz zu traditionellen Gesellschaften, wo das soziale Netzwerk selbstverständlich gegeben war, ist es in unserer modernen Welt etwas, was nach eigenem Belieben gestaltet werden kann und nicht vorgegebenen Formen folgen muss. Aber es ist auch etwas, dass der ständigen Pflege bedarf. Es muss Energie investiert werden, um es zu erhalten und auszubauen.[204]
“Die Folgen der Stigmatisierung auf der Ebene von Interaktionen mit Nicht-Stigmatisierten bestehen dann darin, dass es dem Stigmatisierten unmöglich ist oder zumindest schwer fällt, als vollwertiger Interaktionspartner anerkannt zu werden, dass Interaktionen schwierig und in ihrer Fortsetzung ständig bedroht sind, und dass es permanenter Anstrengungen der Informationssteuerung, eines »stigma managements« (Goffman), auf Seiten des Stigmatisierten bedarf, um sie nicht dem Zustand der Peinlichkeit anheim fallen zu lassen. “ [205]
Mit einem sozialen Netzwerk wird auch die Gesamtheit der sozialen Angebote und Einrichtungen bezeichnet, die bei sozialen Härten und Benachteiligungen einspringen, wenn diese nicht von dem einzelnen Menschen und seinen Angehörigen bewältigt werden können. In der Gesundheitsforschung steht die soziale Unterstützung im Mittelpunkt der Netzwerksforschung. Es ist ein Sammelbegriff für Erfahrungen, welche Gefühle der Geborgenheit und Sicherheit erzeugen.[206]
„Das soziale Netzwerk ist gewissermaßen Bühne oder Schauplatz, wo sich Erfahrungen von Stigma und Diskriminierung vollziehen.“ [207]
Als schizophren diagnostizierte Menschen verfügen über ein weitaus kleineres Netzwerk von tragfähigen, sozialen Beziehungen als Vergleichspersonen aus der Allgemeinbevölkerung, oder Patienten mit anderen psychiatrischen Erkrankungen. Sie bleiben oftmals in ihrer Herkunftsfamilie hängen und pflegen wenige Kontakte nach außen. Bei chronisch Kranken, die lange hospitalisiert waren, gibt es einen Anstieg an Kontakten zu Mitpatienten, und eine gleichzeitige Abnahme an anderen Kontakten.[208]
Das Ausmaß dieser sozialen Isolation ist bei vielen Langzeitpatienten sehr erschreckend, dies wird mit einigen Zahlen verdeutlicht.
Über ein Drittel kennt niemanden, den sie spontan besuchen könnten und 18% haben niemanden, mit dem sie in der Freizeit etwas unternehmen könnten. Noch deutlicher wird diese Situation, wenn die emotionale Unterstützung betrachtet wird. Über 23% kennen niemanden, bei dem sie sich aussprechen könnten. Sie sind also nicht nur einsam, sondern sie haben auch niemanden, der sie bei der Bewältigung belastender Lebensereignisse unterstützen könnte. Die Hälfte der Befragten verfügt über niemanden, der sie trösten würde, mit dem sie ein trauriges Gefühl teilen könnten. Ein Viertel kennt niemanden der sich ihnen nahe fühlt und ein Drittel niemanden, der sie gut kennen würde.[209]
Ich denke, mit diesen Zahlen ist das enorme Ausmaß der emotionellen Isoliertheit vieler Langzeitpatienten deutlich geworden.
Hinzu kommt, dass bei allen Punkten (außer bei dem spontanen Besuch), am häufigsten Familienmitglieder genannt wurden, gefolgt von Betreuern aus dem sozialpsychiatrischen Netzwerk.[210]
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass eine nicht-repräsentative Befragung ergab, dass nur 9,8% schizophren erkrankter sich in einer festen Beziehung befinden und 80,5% ledig sind. In der Allgemeinbevölkerung sind diese Daten fast umgekehrt.[211]
Die sozialen Beziehungen die existieren sind häufig asymmetrisch, die Patienten leben häufig in Abhängigkeit von ihren Eltern und es mangelt an Gegenseitigkeit. Die sozialen Beziehungen sind häufig instabil, kurzlebig und störanfällig. Des weiteren finden schizophrene Kranke weniger soziale Unterstützung in ihren Beziehungen, sie finden selten emotionale und instrumentelle Unterstützung in einer Beziehung.[212]
Es konnte bereits mehrfach nachgewiesen werden, dass ein intaktes Netzwerk den weiteren Krankheitsverlauf positiv begünstigt.[213] Ein tragfähiges, soziales Netzwerk ist eine wichtige Ressource, erlebte Unterstützung in sozialen Beziehungen geht mit besserem Wohlbefinden und psychischer Gesundheit einher. Damit mangelt es bei psychisch Kranken an etwas, was sie besonders dringend benötigen würden: tragfähige, stabile und unterstützende Beziehungen. Dieser Mangel an sozialer Unterstützung führt zu erhöhter Vulnerabilität und erhöht das Risiko für Rückfälle.[214]
Wie ich weiter oben schon erwähnte, sind für die Patienten die Angehörigen oftmals der einzig verbleibende Sozialkontakt außerhalb der „Psychiatrieszene“.[215] Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden etwas näher auf die Situation der Angehörigen eingehen.
8.1.1. Die Angehörigen
Der Ausbruch einer psychischen Erkrankung wird von den Angehörigen als eine Katastrophe erlebt. Das Stigma der psychischen Erkrankung färbt auf sie ab und insbesondere bei Schizophrenie mussten sie lange mit Schuldzuweisungen leben. Sie haben das „Stigma der Problemfamilie tragen müssen (...). [ und wurden ] allein über die Verbindung mit dem Betroffenen diskreditierbar “[216].
Die Lehre von der „schizophrenogenen Mutter“ symbolisiert die Schwere der Auseinandersetzung mit der Schuldfrage und auch wie lange sich die Psychiatrie schwer tat, mit den Angehörigen zusammenzuarbeiten. Sie wurden als Störfaktor, als Belastung für die Arzt-Patienten-Beziehung, als Mitverursacher der Krankheit gesehen. Ihre Bedeutung als therapeutische Bündnispartner und ihre eigene Hilfebedürftigkeit wurde erst sehr viel später wahrgenommen.[217]
Finzen bezeichnet das Leiden der Angehörigen auch als „dritte Krankheit“.[218] Fast zwangsläufig stellen sich die Eltern die Frage danach, was sie verkehrt gemacht haben, es wird ein Sündenbock gesucht, ein Schuldiger soll gefunden werden. Hinzu kommen Schuldzuweisungen Dritter.[219]
Das Erleben von Peinlichkeit und Scham, die Angst vor Ablehnung und Stigmatisierung veranlasst viele Angehörige dazu, die Erkrankung verheimlichen zu wollen. Dieses Schweigegebot, die Anstrengung die „Fassade der Normalität“ aufrechtzuerhalten, stellt eine zusätzliche Belastung dar.[220]
Die Lebensqualität der Angehörigen ist in allen Bereichen niedriger als die der Allgemeinbevölkerung. Am größten sind die Differenzen in den Bereichen der allgemeinen Lebensqualität, Gesundheit und Sozialleben. Die meisten leiden unter schweren gesundheitlichen, finanziellen und psychosozialen Problemen.[221]
Die emotionalen Belastungen der Angehörigen sind vielfältig und werden von der Art der Beziehung zum Patienten beeinflusst. Sie lassen sich folgenden Bereichen zuordnen: Ängste und Sorgen infolge mangelnder Informationen, Unsicherheit und Überforderung mit den Symptomen der Erkrankung, Sorgen bezüglich der Behandlung des Patienten, Hilflosigkeit und Ohnmacht, Einsamkeit und Alleinverantwortung, Nicht-Ernstgenommen-Werden, Zukunftsängste, Gefühle der Einschränkung in der eigenen Autonomie und Abgrenzungsprobleme, Hoffnung und Enttäuschung, Trauer und Verlusterleben, Angst vor Rückfall und Suizid, Schamgefühle und Angst vor Stigmatisierung, Entmutigung, Schuldgefühle, Ärger und Enttäuschung, veränderte Rollen und Rollenkonflikte, Probleme in der gemeinsamen Sexualität sowie Angst vor eigener Erkrankung bzw. Vererbung an die eigenen Kinder.[222] Folge dieser (chronischen) emotionalen Überlastung sind nicht selten psychische Beeinträchtigungen der Angehörigen. Das es einen Zusammenhang zwischen hoher Belastung von Angehörigen, emotionalem Stress und einem erhöhten Rückfallrisiko gibt, ist inzwischen ausreichend belegt.[223] Eine neue Ära der Familienforschung, die versucht ohne Schuld auszukommen, wurde mit der „Expressed-Emotions-Forschung“ eingeleitet. In diesem Rahmen konnte auch die erhöhte Rückfallrate bei der Rückkehr eines schizophren Kranken, in eine Familie mit einem angespannten, kritischen Familienklima, nachgewiesen werden. Der Schlüsselbegriff in der Forschung ist das „emotionale Engagement“, welches hoch oder niedrig sein kann. Damit soll nicht die Schuldfrage neu aufgelegt werden, sondern es geht um Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten im Hier und Jetzt, wobei die Angehörigen Unterstützung auch von psychiatrischer Seite benötigen.[224]
8.2. Die Ebene der gesellschaftlichen Teilhabe
“Stigmatisierungen haben sehr häufig den formellen oder informellen Verlust von bisher ausgeübten Rollen zur Folge oder machen die Ausübung bestimmter Rollen von vorneherein unmöglich. Naturgemäß ist der Ausschluss im beruflichen Bereich besonders verhängnisvoll. Der Zugang zu vielen Berufen oder beruflicher Aufstieg hängt davon ab, ob ein Stigma gegenüber der Umwelt erfolgreich verborgen werden kann. Der Ausschluss ist dabei aufgrund des tatsächlich vorhandenen Merkmales sachlich meist nicht gerechtfertigt.” [225] Auch bei der Wohnungssuche erleben psychisch Kranke immer wieder Zurückweisungen, wenn ihre Krankheit bekannt wird. Bei der oben schon erwähnten Studie von Wahl gaben 19% an, dass es manchmal schwierig gewesen sei, eine Wohnung zu mieten nachdem ihre Krankheit bekannt geworden ist.[226] Eine Studie über wohnungslose Frauen in der Schweiz zeigte, dass 88% mindestens eine psychische Erkrankung in ihrem Leben hatte. Zu dem Zeitpunkt der Studie waren 71% aktuell krank. Dabei ist Substanzmissbrauch am häufigsten (59%), gefolgt von mehreren Erkrankungen (47%) und Angststörungen (41%). Über die Hälfte der Frauen sucht nach privaten Lösungen und ein Drittel wohnt bei anderen Frauen.[227]
8.2.1. Die berufliche Situation
Nach Finzen ist eine Person mit einer schizophrenen Psychose gut beraten, wenn sie ihre Krankheit verheimlicht, wenn sie sich um einen Arbeitsplatz bewirbt. Dies ist zwar Anstellungsbetrug, anders wird sie den Job aber mit größter Wahrscheinlichkeit nicht bekommen. Wer schizophren ist, bekommt keine Anstellung im öffentlichen Dienst, wird erst recht nicht beamtet und bekommt keine Approbation als Arzt. Dies alles nicht aufgrund bestimmter Symptome, sondern allein wegen der Diagnose, dem Etikett Schizophrenie.[228] Dass die Verheimlichung eine große Belastung darstellt, die den Ausbruch einer Krankheit begünstigen kann, habe ich weiter oben schon dargestellt. Hier ein Beispiel einer jungen Frau: „ Ich habe einen Arbeitsplatz in einer Reha-Einrichtung. Die wissen von meiner Erkrankung und ich brauche keine Angst zu haben, falls ich wieder krank werde. Wenn ich mich um eine andere Arbeit bewerben würde, würde ich meine Krankheit verschweigen. Psychisch Kranke haben ja keine Chance, Arbeit zu bekommen. Allein aus Angst, wieder krank zu werden, würde ich wieder krank. Das habe ich nun schon ein paar Mal erlebt.“ [229] Es ist auch schwierig, die Krankheit zu verheimlichen, wenn Restsymptome bestehen. Es ist dann auch nicht unbedingt ratsam, da die Person wahrscheinlich weniger belastbar ist und Rücksichtnahme seitens der Kollegen nur möglich ist, wenn diese über die Erkrankung aufgeklärt sind.[230] Daten zur beruflichen Situation von psychisch Kranken belegen durchgängig eine hohe Erwerbslosenquote.[231] In einem aktuellen Bericht aus Großbritannien zur sozialen Situation von Erwachsenen mit psychischen Störungen wurde folgendes festgestellt: Nur 24% sind erwerbstätig, sie haben ein doppelt so hohes Risiko, ihren Job zu verlieren, ein dreifach erhöhtes Risiko sich erheblich zu verschulden und haben häufig Mietrückstände und laufen damit Gefahr, ihre Wohnung zu verlieren.[232]
Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund einer psychischen Störung, haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen, und bilden die zweitgrößte Gruppe. Von 1997-2001 haben die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischer Erkrankung um 50% zugenommen, von 2001-2004 nochmals um 69%. Gleichzeitig hat die Frühberentung aufgrund einer psychischen Störung ebenfalls erheblich zugenommen. Für Frauen sind psychische Krankheiten die häufigste Ursache für Erwerbsunfähigkeit, für Männer die zweithäufigste. Bei einem Zweitgutachten wurden 75% der Betroffenen für arbeitsfähig eingestuft.[233] Dabei sind die Folgen durchaus nicht positiv, da die „fehlende Funktionsausübung zu einem Mangel an Bewältigungserfahrungen und zu einer sozialen Desintegration führen kann“[234]. Dies wiederum begünstigt die Chronifizierung der Erkrankung. Die unangenehmen Folgen sind also nicht nur die direkten wirtschaftlichen Konsequenzen, sondern sie gehen darüber hinaus mit ihren psychologischen, kommunikativen und statusbezogenen Aspekten.[235]
Chronisch psychisch Kranke gelten als schwer integrierbar in den modernen Arbeitsmarkt. Um sie trotzdem an dem Arbeitsprozess teilhaben zu lassen und ihnen Tagesstruktur zu geben, wurde ein breites Angebot an geschützten Arbeitsplätzen geschaffen, welche den sogenannten zweiten oder besonderen Arbeitsmarkt bilden. Nur wenige (je nach Studie zwischen 2,3% und 10%) schaffen den Sprung aus einer rehabilitativen Maßnahme in den ersten Arbeitsmarkt. Der besondere Arbeitsmarkt fördert also nicht, wie ursprünglich erhofft, die Reintegration, sondern behindert diese mitunter, durch das Stigma des zweiten Arbeitsmarktes.[236] Ob die Integration in den Arbeitsmarkt erfolgreich ist oder nicht, hängt von einigen patientenbezogenen Variablen ab, davon möchte ich nur einige nennen: Die Symptomatik, insbesondere die Negativsymptomatik, Defizite im Sozialverhalten und ein gutes Arbeitsverhalten. Inwiefern die Diagnose Einfluss nimmt, ist ungeklärt.[237] Es scheint von großer Bedeutung für den weiteren Rehabilitationsverlauf zu sein, ob der Patient die Hoffnung aufgegeben hat, sein Schicksal selber beeinflussen zu können oder nicht.[238]
Die meisten rehabilitativen Maßnahmen verfolgen den traditionellen train-and-place-Ansatz. Danach sollen die Betroffenen vorher in einem geschützten Rahmen alle für notwendig erachteten Fertigkeiten lernen, bevor der Versuch der Integration gestartet wird. An diesem Punkt enden diese Programme meist, eine weitere Betreuung findet nicht statt. Dadurch werden die Betroffenen „etwas überspitzt formuliert – doch eher in die psychosoziale Szene als in die Arbeitswelt sozialisiert“. [239] Viel kritisiert wurden diese Programme aber vor allem wegen ihrer stigmatisierenden Konzepte.[240] „Dazu gehören die Verleugnung von Leiden und chronischer Krankheit (man fokussiert Gesundheit), die Pädagogisierung der Rehabilitation (man trainiert Normalität) und die Überbewertung des Willens (man erwartet Motivation).“ [241] Die Rehabilitation basiert mehr auf pädagogischem Wissen und „moralisch-protestantischen Prämissen “[242], denn auf psychologischem Wissen. Das Personal ignoriert psychologische Zusammenhänge und drängt den Betroffenen stattdessen erzieherisch äußere Ordnungs- und Normalitätskriterien (Pünktlichkeit, Konzentrationsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit, Leistung usw.) auf. Sie konzentrieren sich auf die sogenannten Ressourcen und Kompetenzen und verleugnen darüber die Krankheit, das Leiden, die Defizite.[243] Als Folge dessen, fühlen sich viele Kranke in ihrem Leiden nicht ernst genommen, ein zentraler Teil ihres Erlebens wird verdrängt. Es sollte die Integration auch von kranken Anteilen unterstütz werden, die wahren Bedürfnisse erkannt und das Selbstbewusstsein dadurch gestärkt werden.[244] Durch die Orientierung an der Normalität findet die eigentliche Stigmatisierung in diesem Rahmen statt: Normal zu sein ist mehr wert als psychisch krank zu sein.[245]
Ein neuer Ansatz aus den USA, „supported employment“ oder „place-and-train“, scheint neue Perspektiven zu eröffnen. Ausreichende Motivation und psychopathologische Stabilität vorausgesetzt, wird die Rehabilitation ohne lange Vorbereitungsphase direkt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durchgeführt. Das Training und die psychosoziale Betreuung wird von einem „Job Coach“ direkt am Arbeitsplatz durchgeführt. Der Arbeitsplatz und die soziale Umwelt sind völlig normal, durch die intensive und zeitlich nicht begrenzte Betreuung kann den besonderen Bedürfnissen des psychisch kranken Arbeitnehmers Rechnung getragen werden. Eine Reihe von kontrollierten Studien hat die Überlegenheit dieses Ansatzes bezüglich erfolgreicher Wiedereingliederung belegt.[246] In Deutschland wurde dieser neue Ansatz auch schon vereinzelt durchgeführt, sie sind jedoch viel selektiver und der Platzierung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geht ein Trainingsprogramm voraus. Diese lässt die Motivation der Teilnehmer jedoch sinken. Auch sind in Deutschland die finanziellen Anreize für die Unternehmen geringer und sie werden meistens in unqualifizierte, wenig anspruchsvolle Arbeitsplätze vermittelt. Diese sind jedoch am schwinden und wo es eine hohe Arbeitslosenquote gibt, haben es diese Projekte erst recht schwer.[247]
8.3. Lebensqualität
Bis heute sind die Zusammenhänge zwischen äußeren Lebensumständen und dem Zustande kommen von positivem inneren Erleben (Wohlbefinden und Zufriedenheit) relativ unklar. Lebensqualität ist ein relativ neues Konzept, dass in den 80er Jahren in Folge der Deinstitutionalisierung geradezu einen Boom erlebte.[248] Das Neue an dem Konzept ist, dass das subjektive Erleben der Betroffenen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt ist, und nicht nur die äußeren, objektiven Umstände erfasst werden. So paradox wie es erscheint, war doch lange die Zufriedenheit der Patienten in der Psychiatrie kein Thema. Ihre Aussagen wurden nicht ernst genommen, sondern hinterfragt und interpretiert. Lebensqualität ist ein ganzheitliches Konzept, dass die verschiedenen Dimensionen des Erlebens und Verhaltens zusammenfasst und das persönliche Urteil der Patienten berücksichtigt. Lebensqualität muss möglichst breit gesehen werden, der Begriff umfasst Dimensionen wie: materielle Bedingungen, das Funktionieren in sozialen Rollen, Gesundheit, Leiden, Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden, soziale Lebensbedingungen, Bedürfnisse, Lebensziele etc..[249] In den Untersuchungen zur Lebensqualität psychisch Kranker Menschen wird zwischen objektiven und subjektiven Indikatoren unterschieden. Die objektiven Indikatoren umfassen sowohl die soziale Anpassung als auch die materiellen Lebensumstände. Mit den subjektiven Indikatoren wird die Zufriedenheit mit den objektiven Indikatoren erfasst. Als dritter Indikator kommt die persönliche globale Zufriedenheit mit den Lebensumständen hinzu.[250]
Es wird vorausgesetzt, dass der Zugang zu materiellen Ressourcen, sowie das Ausmaß des sozialen Funktionierens die Lebensqualität bestimmt und dass der Grad der Zufriedenheit dieses Verhältnis wiederspiegelt. Dies ist aber bei chronisch psychisch Kranken nicht unbedingt der Fall, die statistischen Zusammenhänge zwischen den objektiven Lebensumständen und der subjektiven Lebenszufriedenheit sind schwach bis gar nicht vorhanden. Viele psychisch Kranke sind ökonomisch benachteiligt, sozial isoliert und fühlen sich etwa doppelt so häufig wie die Allgemeinbevölkerung einsam, gelangweilt und deprimiert. Trotzdem sind die meisten mit ihrer allgemeinen Lebensqualität sehr zufrieden. Um dies zu erklären, wurde noch keine befriedigende Antwort gefunden. Eine Hypothese ist, dass sich bei schwer psychisch Kranken das Anspruchsniveau senkt, dass sich ihre Prioritäten verschieben und sich ihre Vergleichsgruppe ändert. Sie weisen also eine andere Bedürfnisstruktur auf als Gesunde.[251]
Der einzige objektive Indikator, der einen statistischen Zusammenhang mit dem subjektiven Wohlbefinden hat, ist die Variable „verheiratet sein“. Dies zeigt die große Bedeutung von sozialen Beziehungen. Außerdem ist die subjektive Lebensqualität bei arbeitenden Patienten in der Regel höher.[252]
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die individuellen Bedeutungen von Lebenszufriedenheit nur verstanden werden können, wenn das Selbstkonzept, Selbstwertgefühl, Autonomie und Selbst-Wirksamkeit mit einbezogen werden. Häufig zeigte sich in Tiefeninterviews, dass die Lebenszufriedenheit resignativer Art war und sie steigt, wenn die Betroffenen sich selbstständig fühlen können. Sie also das Gefühl haben, ihr Leben selber meistern zu können, eine Perspektive für die Zukunft zu haben und das Gefühl haben respektvoll behandelt zu werden.[253]
Bei einer Umfrage aus dem Jahr 1999 bei welcher 565 schizophrene Patienten danach befragt wurden, was Lebensqualität für sie bedeute, wurde am häufigsten Arbeit genannt (23%). Für ein Viertel sollte diese eine sinnvolle, schöne Arbeit sein. Dies mag damit zusammenhängen, dass Arbeit zu einem „normalen“ Leben dazugehört und es ermöglicht, sich als nützliches und vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu fühlen. Am zweithäufigsten (22%) wurde Gesundheit ganz allgemein genannt. Jeder sechste dachte bei Lebensqualität an Freizeitgestaltung oder soziale Kontakte, Beziehungen ganz allgemein oder verbunden mit positiven Aspekten wie Vertrauen, Harmonie und für andere dazusein. Die Bedeutung von sozialen Kontakten und Arbeit steigt mit der Dauer der Erkrankung.[254]
Die soziale Unterstützung ist wahrscheinlich für psychisch Kranke noch wichtiger als für die Allgemeinbevölkerung. Sie beeinflussen die Lebensqualität, indem sie indirekt das Selbstwertgefühl beeinflussen. Psychisch Kranke sind in besonderem Maße auf wertschätzende, bestätigende und intime Beziehungen angewiesen, auf Menschen, die sie verstehen und ernst nehmen.[255]
In der Befragung wurde außerdem häufig (10%) das Vorhandensein von Familie und die finanzielle Situation genannt. Ebenso häufig wurde mit Lebensqualität Lebensfreude in Verbindung gebracht und von 8% wurden orale Genüsse genannt, genauso häufig wie Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Während Freude, Spaß und Lust am Leben zu haben sowie selbstständig, unabhängig und frei zu sein sehr häufig genannt wurden, dachten wenige an Wohlbefinden, Ruhe, Glück und Frieden und noch seltener wurde Sicherheit, Geborgenheit, keine Sorgen und Probleme haben, genannt. Sehr wenige brachten auch die psychiatrische Behandlung mit Lebensqualität in Verbindung, wenn dann nur in einem negativen Sinne.[256]
9. Bewältigungsmöglichkeiten
Die gesamtgesellschaftliche Einstellungsänderung gegenüber psychisch Kranken ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geschieht, sondern viele Jahrzehnte dauern wird und dessen Ausgang ungewiss ist. Bisherige Kampagnen zur Aufklärung über psychische Krankheiten oder der Protest gegen die verfälschte Darstellung von psychischen Krankheiten in den Medien, wird viel kritisiert. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie nicht auf den Forschungsergebnissen aufbauen, sondern aus plausiblen Alltagsüberlegungen entstanden sind. Die Kampagnen zur Aufklärung der allgemeinen Öffentlichkeit waren bisher von wenig Erfolg getragen. Dies ist leicht mit den Eigenschaften der Stereotype zu erklären, sind diese doch per Definition äußerst änderungsresistent.
Stereotype sind per Definition äußerst änderungsresistent, sie haben auch die Eigenschaft, dass schon existierende Stereotype bestätigt werden und andere Informationen ignoriert werden. Hinzu kommt die Gefahr eines unerwünschten Rückkopplungseffektes: wenn negative Inhalte unterdrückt werden, werden sie insistierender und können damit das Stereotyp aktivieren. Hinzu kommt, dass eine einzelne Person, die ihre Meinung geändert hat, diese wieder an die Gruppennormen anpassen wird. Eine Hoffnung bleibt bestehen, da Vorurteile und Stereotype immer auch einen realitätsbezogenen Kern haben. Auch wenn sie extrem änderungsresistent sind, müssen sie sich doch irgendwann den veränderten Gegebenheiten anpassen.[257]
Es bleibt also die Hoffnung, dass durch möglichst viele und häufige inkongruente Informationen sich das Stereotyp verändern lässt. Sie sollten nicht nur die kognitive Seite durch Informationszufuhr ansprechen, sondern auch den direkten, emotionalen Zugang durch persönlichen Kontakt zu psychisch Kranken suchen.
Die Interventionen scheinen am wirksamsten zu sein, welche die Unmittelbarkeit der Begegnung nutzen, diese verändern Stereotype am nachhaltigsten. Dazu sollte die Begegnung von folgenden Faktoren gekennzeichnet sein: Ein gleicher Status zwischen den Interaktionspartnern, ein kooperativer Kontext in der Begegnung, sie sollte möglichst in der realen Welt stattfinden und ein hoher Grad an Intimität sollte vorhanden sein.[258]
Die Aufklärung ist meistens mit der Vermittlung des medizinischen Krankheitsmodells verbunden. Wie ich weiter oben schon dargestellt habe, wird von einem Großteil der Bevölkerung jedoch eine psychische Störung eher akzeptiert, wenn sie die diese als verständliche Reaktion auf belastende Lebensereignisse betrachtet, und nicht als biologisch verursacht. Auch sind die gut aufgeklärten Psychiater im Durchschnitt nicht wesentlich positiver gegenüber Menschen mit einer psychischen Erkrankung eingestellt. In manchen Bereichen weisen sie sogar eine größere soziale Distanz auf.[259]
Nach Hoffmann-Richter ist die Stigmatisierung psychisch Kranker Teil unserer Kultur. Das Ziel von Antistigmatisierungskampagnen sollte also nicht in kurzfristigen Effekten bestehen, denn bei „ der Organisation von Veranstaltungen, beim Engagement für Fernsehsendungen oder der Publikation von Zeitungsartikeln geht es nicht primär um Information, sondern um Arbeit an der – an unserer - Kultur “[260].
Jedoch können die aktuell Erkrankten nicht warten, bis der langwierige Prozess der Gesellschaftsveränderung vollzogen ist, sondern sie müssen hier und jetzt Techniken an die Hand bekommen, um mit Stigmatisierungen umgehen zu können. Dabei kommt auch der Psychiatrie sowie der Therapie kein unwesentlicher Anteil zu. Es sollte Teil der Therapie sein, über (Selbst-) Stigmatisierung und Bewältigungsmöglichkeiten (coping Strategien, siehe 7.2.) zu sprechen.
Bei vielen psychisch Kranken ist das Selbstwertgefühl reduziert, um es wieder zu heben und damit besser mit (Selbst-)Stigmatisierungen umgehen zu können, sind positive Erfahrungen nötig. Dafür ist es hilfreich, den Mechanismus der Selbststigmatisierung zu durchschauen, dies kann in Form von Selbstreflektion in Selbsthilfegruppen oder strukturierten Programmen geschehen. In der Psychiatrie benötigen Professionelle ein sensibles Gespür dafür, wie schambesetzt die psychische Erkrankung für die Betroffenen ist. Die Betroffenen brauchen Hilfe beim Trauern über aktuelle Einschränkungen und vergangene Möglichkeiten. Die Betroffenen können sich selber leichter akzeptieren, wenn sie auch ihre Fähigkeiten und Stärken wahrnehmen und dies auch die Umwelt tut. Dazu gehört auch, dass die Umwelt sie mit ihrer Erkrankung annimmt und ihnen Gefühle von Wertschätzung und Respekt entgegenbringt.[261]
Daneben sollten die natürlichen sozialen Netzwerke verändert, verbessert und gestärkt werden, um damit positive Beziehungserfahrungen möglich zu machen und das „emotionale Engagement“ in der Familie abzusenken (siehe 7.1.1.). Viele psychisch Erkrankte leiden außerdem unter einem verringerten Selbstwertgefühl, dieses kann im Sinne von Empowerment wieder hergestellt werden.
9.1. Empowerment
Empowerment ist in Deutschland ein relativ neuer Ansatz, deswegen wurde bisher noch kein passender deutscher Begriff gefunden. Häufig wird er übersetzt mit Selbst-Bemächtigung, Selbsthilfe oder Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung. Die Selbststigmatisierung wird häufig auch als Dis-empowerment bezeichnet. In diesem Sinne kann Empowerment auch als das Gegenteil von Stigmatisierung betrachtet werden.
Es gibt viele Möglichkeiten diesen Begriff auszufüllen, es verbergen sich die unterschiedlichsten Theorien und Ansätze hinter dem Begriff des Empowerment. Einigkeit besteht darüber, dass Empowerment ein „Mehr an Lebenswert“ bedeutet und das es beinhaltet, das eigene Leben selbstständig und autonom zu gestalten. Wie dieser Weg zu gestalten ist und wie die professionelle Unterstützung aussehen kann, darüber streiten sich die Geister.[262]
Herriger unterscheidet zwischen vier verschiedenen Zugängen, um sich dem Konzept des Empowerment zu nähern.[263]
1. Die politische Dimension bezeichnet einen Prozess der Umverteilung von (politischer) Macht, sowie die Schaffung von gleich verteilten Zugängen zu Ressourcen. Sie treten für die „Bemächtigung der Ohnmächtigen“ ein, diese Form findet sich vor allem in Bürgerrechtsbewegungen sowie anderen emanzipatorischen Ansätzen.
2. Die lebensweltliche Dimension bezeichnet das „Vermögen von Menschen, die Unüberschaubarkeiten, Komplikationen und Belastungen ihres Alltags in eigener Kraft zu bewältigen, eine eigenbestimmte Lebensregie zu führen und ein nach eigenen Maßstäben gelingendes Lebensmanagement zu realisieren “[264]. Im Mittelpunkt steht die Fähigkeit von Menschen, ihr Leben autonom in Selbstorganisation zu gestalten. Verwendung findet diese Definition in der sozialen Arbeit sowie in der Gemeindepsychologie. Leitfaden ist dabei das Vertrauen in die Stärken und der Glaube an die Fähigkeiten der Klienten.
3. In einem reflexiven Wortsinn bedeutet Empowerment die Selbst-Bemächtigung und Selbst-Aneignung von Lebenskräften. Der Betroffene selbst findet Wege aus der Ohnmacht durch die aktive Aneignung von Macht, Kraft und Gestaltungsvermögen. Es bedeutet den aktiven Ausbruch, durch eigene Kraft, aus der Abhängigkeit und Bevormundung, hin zu einem „mehr“ an Selbstbestimmung, Autonomie und eigener Lebensführung. Diese Definition betont somit den Aspekt der Selbsthilfe und aktiven Selbstorganisation.
4. In einem transitiven Wortsinn bedeutet Empowerment die Unterstützung und Förderung von Selbstbestimmung durch andere. In diesem Sinne ist Empowerment eine professionelle Grundhaltung von beruflichen Helfern in den verschiedenen Gebieten der psychosozialen Arbeit. Sie sollen „ihren Adressaten Hilfestellungen bei der Eroberung von neuen Territorien der Selbstbestimmung geben, sie zur Suche nach eigenen Stärken ermutigen und zur Erprobung von Selbstgestaltungskräften anstoßen “[265]. Die Mitarbeiter sollen demnach die Ressourcen für Empowerment-Prozesse bereitstellen und die (Wieder-) Aneignung von Selbstgestaltungskräften anregen. Dazu gehört die Fokussierung auf die Stärken und Fähigkeiten des Betroffenen und die Abwendung von der Fokussierung auf die Defizite.
9.1.1. Empowerment in der psychosozialen Praxis
In der psychosozialen Praxis verbinden sich die oben beschriebenen lebensweltlichen und transitiven Definitionen von Empowerment.
Das Empowerment kam über die Antipsychiatrie-Bewegung in die psychosoziale Praxis. Als Folge der Institutionalisierung fühlten sich die Patienten abhängig, unmündig, willenlos, machtlos und voller Selbstzweifel. Sie wollten sich aber unabhängig, selbstständig und mündig fühlen können. Insofern hat das Empowerment in der Psychiatrie seinen Ursprung in der Betroffenen-Bewegung.[266]
Der Ausgangspunkt von Empowerment-Prozessen sind stets biographische Nullpunkt-Erfahrungen. Der Betroffene fühlt sich machtlos und fremdbestimmt und durch die Erfahrungen von Unterlegenheit, verliert er das Gefühl sein eigenes Leben selbst beeinflussen und bestimmen zu können. Mit der Theorie der „erlernten Hilflosigkeit“ wurde versucht, sich dieser Prozesse anzunähern.[267]
Die erlernte Hilflosigkeit wird oftmals unwissentlich von professionellen Helfern unterstützt, indem sie den Klienten die Verantwortung für ihr Leben und ihr Handeln abnehmen. Die Professionellen fördern mit dem Glauben, dass die Klienten hilfe- und schutzbedürftig sind, deren Selbststigmatisierung.[268]
Die soziale Arbeit orientiert sich nach wie vor, trotz dem Reden von Ressourcenorientierung, an den Defiziten ihrer Klienten. In der psychosozialen Praxis bedeutet dies entweder eine Orientierung an dem medizinischen Krankheitsmodell oder an einer sozialisationstheoretischen Sicht. Die Probleme der Klienten werden umgedeutet, bis sie in ein altbekanntes Schema passen, für das eine Strategie aus dem Katalog vorhanden ist. Damit wird Nicht-Normalität inszeniert und der Betroffene muss sich der Expertenmacht unterwerfen, wenn er eine Antwort haben möchte. Empowerment bedeutet, eben gerade diese Strategien aufzugeben und grundsätzlich den Blickwinkel zu ändern.[269]
„Partizipation von KlientInnen bedeutet für die Professionellen Macht und vertraute Sicherheit aufzugeben, die mit der Expertenrolle verbunden sind. “[270]
Um einen Empowerment-Prozess anzuregen, sollten von professioneller Seite keine Vorschriften kommen, sondern es sollten gemeinsame Wege ausgehandelt werden. Die Aufgabe des Professionellen besteht vor allem darin, durch die Unterstützung positiver Kapazitäten dem Individuum zu ermöglichen, durch eigene Kraft mehr Autonomie, Selbstverwirklichung und Lebenssouveränität zu erhalten. Das Empowerment in der psychosozialen Praxis baut auf das Modell der Menschenstärken auf. Ein leitender Grundgedanke ist dabei der Glaube an die Fähigkeit zur Selbstaktualisierung, dass jeder Mensch eine innere Kraft besitzt, die als Lebensenergie oder auch als heilende Kraft bezeichnet werden kann. Wenn Menschen in ihren positiven Kapazitäten unterstützt werden, so werden sie auf ihre eigenen Stärken zurück greifen und in einem positiven Sinne weiter wachsen.[271]
Die zentrale Zielsetzung des Empowerments in der psychosozialen Praxis beinhaltet folgendes: Der Professionelle wird als Wegbegleiter im „Irrgarten multipler Identitäten“ gesehen, damit hilft er bei der Suche nach Lebenssinn. Der Professionelle unterstützt den Aufbau und die Renovierung sozialer Netze und er fördert die Eröffnung von Partizipationsräumen.[272]
Was das Konzept „der Menschenstärken“ für professionelle Helfer bedeutet, beschreibt Herriger mithilfe von sechs Schritten:[273]
1. Die leitenden Grundüberzeugungen sind die Orientierung an den Kräften, Stärken und Ressourcen sowie das Vertrauen in die Fähigkeit des Individuums, das Leben selbstbestimmt zu gestalten. Der Professionelle kann unterstützend einwirken durch die Vermittlung von Kontroll- und Kompetenzerfahrungen bezüglich der Gestaltbarkeit der eigenen Lebensumstände. Außerdem können solidarische Netzwerke gefördert oder geschaffen werden, um die Erfahrung von sozialem Eingebundensein zu vermitteln.
2. Die Anerkennung des Eigen-Sinns und der Respekt vor ungewöhnlichen Lebensentwürfen. Viele Menschen haben mit ihrer Wertorientierung sowie mit ihren Deutungs- und Handlungsmustern die normalen Konventionen verlassen. Der Person soll ihr Eigensinn gelassen werden, und sie wird voraussetzungslos akzeptiert. Für den Professionellen bedeutet dies ein Sich-Einlassen auch auf ungewöhnliche Lebensentwürfe und ein Verzicht auf die Expertenrolle und pädagogische Resozialisierungsversuche. Dieser Akzeptanz sind jedoch natürliche Grenzen gesetzt, z.B. wenn es zu sich selber schädigendem Verhalten kommt.
3. Die Empowerment-Prozesse verlaufen selten in linearen Bahnen. Den Klienten muss der Raum gelassen werden, ihre eigenen Wege zu finden und dies in ihrem eigenen Tempo zu tun. Für den Professionellen bedeutet es manchmal eine Herausforderung, den Klienten seine Umwege gehen zu lassen und nicht aus Ungeduld einzugreifen oder an ihm zu verzweifeln.
4. Eine Grundhaltung die nicht beurteilend ist, und der Verzicht auf vorschnelle Expertenurteile. Auch wenn im Mittelpunkt das Sich-Einlassen auf den Alltag des Klienten steht, so soll dieser Dialog über den Lebenssinn trotzdem auch Kritik und das Problematisieren von Selbstverständlichkeiten und Lebensgewohnheiten enthalten. So wird dieser Dialog zu einer schwierigen Gratwanderung zwischen bedingungslosem Akzeptieren und gleichzeitigem Grenzen ziehen.
5. Der Blick richtet sich hauptsächlich auf die Lebenszukunft des Klienten. Es geht darum, aus dem Hier und Jetzt neue Möglichkeitsräume zu erschließen. Der Blick kann auch in die Vergangenheit gehen, dann geht es aber primär um Erfahrungen von Kompetenz, Gelingen und Erfolgreich-Sein. Wenn es um problematische Lebensereignisse geht, so sollte in dem Mittelpunkt der Aufarbeitung das Lernen für die Zukunft stehen.
6. Der ethische Werterahmen bezieht sich auf die Wahrung von Selbstbestimmungsrechten, dem Eintreten für soziale Gerechtigkeit sowie auf das Recht auf demokratische Partizipation.
Für Psychiatrieerfahrene bedeutet dies vor allem das Selbst- und Mitbestimmungsrecht in der Behandlung, insbesondere auch in Bezug auf die Medikation. Dass die Behandlung erfolgreicher ist, wenn der Patient mit über deren Gestalt entscheiden kann und sie nicht als unfreiwillig erlebt, ist inzwischen ausreichend belegt. Die Psychiatrieerfahrenen fordern auch mehr Einbeziehung in die Gestaltung und Leitung von psychiatrischen Institutionen und Entscheidungsprogrammen.[274]
Das bedeutet, dass die Patienten nicht als kranke Individuen sondern als Experten in eigener Sache betrachtet werden. Dieser Bemächtigungsprozess kann dann eine Eigendynamik entwickeln, so dass die Patienten selbstständiger, selbstbewusster und daraus weniger abhängig werden.[275] Damit die Patienten wirklich zwischen Behandlungsansätzen wählen können, müssten mehr Alternativen zur Psychiatrie aufgebaut werden. Es müssen die Freiräume erhalten werden, in denen Anderssein möglich ist. „Je weniger Widerstand in Form von Anders-Sein sichtbar wird, desto rigider und empfindlicher wird die gesellschaftliche Norm. Der gesellschaftliche Kampf für die Anerkennung der „Vielfalt menschlicher Sichtweisen“ ist die Wurzel des Empowermentkonzeptes “.[276] Auch die gesellschaftliche Ordnung muss sich ändern, damit alle Menschen in ihr leben können. Das heißt, dass Empowerment auch bedeutet, sich auf der kommunalpolitischen und sozialpolitischen Ebene zu engagieren und Begegnungsräume zu schaffen. Durch die Förderung der Selbstorganisation sowie der Kooperation von Betroffenengruppen und Professionellen auf einer gleichberechtigten Ebene werden die Betroffenen sichtbar und hörbar. Dadurch verändert sich die Außen- und Eigenwahrnehmung, so dass das Empowermentkonzept auf vielfältige Weise zur Entstigmatisierung, sowohl auf der individuellen wie auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, beitragen kann.
Viel kritisiert wird das Empowermentkonzept wegen der eindeutigen Wertigkeit, die in dem Ideal von dem autonomen, unabhängigen, starken Subjekts liegt und worin Schwach-Sein keinen Platz hat.[277] Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Betonung von Autonomie. Eine Grundvoraussetzung für Autonomie ist jedoch eine wechselseitige Beziehung, die auf Anerkennung gründet. Es „äußert sich das Paradoxon der Anerkennung: Wenn ich autonom sein will, benötige ich ein Gegenüber, das mir diese Autonomie bestätigt. Dadurch bin ich jedoch bereits wieder abhängig “[278].
Doch gerade durch die Vielfalt der Grundüberzeugungen, mit denen das Empowermentkonzept ausgefüllt werden kann, können diese Kritikpunkte leicht wiederlegt werden. Es soll auch nicht Autonomie in Form von totaler Unabhängigkeit von anderen Menschen geschaffen werden, sondern es soll möglich werden, dass die Menschen ihre soziale Beziehungen und ihr Leben, autonom gestalten können. Es soll auch nicht Selbstständigkeit eingefordert werden, sondern der Betroffene soll unterstützt werden, in kleinen Schritten zu diesem Ziel zu kommen.
9.2. Netzwerkinterventionen
Netzwerkinterventionen zielen auf eine Veränderung des natürlichen sozialen Netzwerks. Dabei steht die Aktivierung und Förderung von Hilfepotenzialen im Vordergrund, das soziale Netzwerk soll gestärkt werden. Die Interventionen unterscheiden sich untereinander durch einige Merkmale, wie direkte oder indirekte Strategie, der Ebene der Intervention und der zentralen Zielsetzung. Die direkte Strategie setzt bei einer bestimmten Zielperson an um das Netzwerk zu unterstützen oder zu erweitern. Die indirekte Strategie setzt hingegen bei Rahmenbedingungen an, um ein Veränderung des sozialen Netzwerkes zu ermöglichen. Dies bedeutet zum einen die Aufklärung der Öffentlichkeit. Es bedeutet aber auch die Förderung der sozialen Kompetenzen der psychisch Kranken. Es ist nicht alleine das Etikett „psychisch krank“, welches die negativen Einstellungen der Allgemeinbevölkerung gegenüber schwer psychisch Kranken bedingt. Sondern es sind auch als fremd erlebte Verhaltensweisen. Seitens der psychisch Kranken gibt es Unsicherheiten und beeinträchtigte soziale Fertigkeiten im sozialen Umgang.[279]
9.2.1. Die Angehörigenhilfe
Wie in dem 8. Kapitel dargestellt wurde, sind die Angehörigen häufig die wichtigsten (und einzigen) Beziehungspartner von psychisch Kranken. Die Angehörigen leiden unter vielfältigen Folgen der Krankheit und der Stigmatisierung, gleichzeitig hat das Familienklima einen großen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Erkrankung. Es gehört heute zu dem Standard jeder psychiatrischen Institution, von Professionellen geleitete Angehörigengruppen anzubieten. Selten und meistens nur in einem geringen Umfang gibt es familientherapeutische Gespräche. Des Weiteren gibt es Selbsthilfegruppen für Angehörige.
Das erste mal trafen sich Angehörige 1970 zu einem regelmäßigen Gesprächskreis. Ihnen wurde als Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt. Daher kommt es, dass viele Vereinigungen in ihrem Namen heute noch zuerst psychische Krankheit und erst an zweiter Stelle die Angehörigen erwähnen.[280]
Es ist aber auch Ausdruck davon, dass die Angehörigen damals in ihrem Leiden nicht Ernst genommen wurden.
Die erste expertengeleitete Angehörigengruppe wurde 1973 in einer Tagesklinik eingerichtet. Die Entwicklung in beiden Bereichen stagnierte für die nachfolgenden zehn Jahre, in dem Jahr 1982 gab es schließlich eine Trendwende in der Angehörigenbewegung.[281]
Die Chancen zur Hilfe durch Angehörigengruppen liegen vor allem in folgenden Bereichen: Es werden Informationen über Krankheitsbilder und Hilfsangebote ausgetauscht. Das Zusammensein mit anderen Angehörigen macht Mut, da sie erleben, dass sie nicht alleine sind. Das Zusammensein kann von Scham- und Schuldgefühlen freisprechen und macht damit Offenheit in dem Umgang mit der Krankheit wieder möglich. Außerdem ermöglicht die Solidarität in der Gruppe, gegen Ungerechtigkeiten und Missstände anzugehen, welchen die Familien ansonsten hilflos ausgeliefert wären.[282]
Die Angehörigenselbsthilfe dient in erster Linie der psychischen und sozialen Gesundheit der Angehörigen. Sie hat eine unterstützende Funktion bei der individuellen Verarbeitung der Auswirkungen der psychischen Krankheit und wirkt damit entlastend. Durch den Austausch mit anderen betroffenen Angehörigen können sie auch lernen, besser mit krankheitsbedingten Problemen und Konflikten umzugehen, um damit den Patienten besser unterstützen zu können. Viele Angehörigengruppen haben es sich auch zum Ziel gesetzt, die Politik, Verwaltung und Sozialversicherungen zu beeinflussen. Insbesondere in Form von Lobbyarbeit haben sie vielfältige Möglichkeiten, unter anderem die Entstehung und Konzeption von neuen Einrichtungen mit zu beeinflussen.
In dem Jahr 1985 wurde der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker gegründet. In der folgenden Zeit hat sich der Verband als Lobby für Angehörige und psychisch Kranke einen Namen gemacht, indem er zu allen psychiatrie-politischen Fragen Stellung genommen hat.[283]
Von psychiatrischer Seite initiierte Familieninterventionen haben häufig zum Ziel, die Angehörigen zu unterstützen („support the supporter“). Sie wollen die Angehörigen entlasten, Kompetenzen im Umgang mit dem psychisch kranken Familienmitglied vermitteln und die Angehörigen mit anderen Personen vernetzen. Familieninterventionen, welche die Kommunikation innerhalb der Familie verändern wollen, haben logischerweise andere Schwerpunkte. Wenn die Familienintervention von kurzer Dauer (weniger als 3 Monate) ist, so zeigte sich ein Wissenszuwachs bei den Angehörigen, so dass diese besser mit dem erkrankten Familienmitglied umgehen konnten. Langzeit-Familieninterventionen schaffen es auch, das Rehospitalisierungsrisiko abzusenken. Dies scheint vor allem darüber erreicht zu werden, dass sich familieninterner Stress, bzw. belastende Interaktionen, vermindern.[284]
9.3. Internationale, nationale und regionale Antistigmakampagnen
In den letzten Jahrzehnten wurden einige offizielle Programme gegen die Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch Kranken gestartet. Dazu zählt das weltweite Antistigmatisierungsprogramm des Weltverbandes für Psychiatrie, welches unter dem Namen „Fighting Stigma and Discrimination because of Schizophrenia – Open the doors“, 1996 unter der Leitung von Norbert Sartorius ins Leben gerufen wurde und einen Meilenstein darstellt. Mittlerweile sind mehr als 20 Länder, darunter auch Deutschland, an diesem Programm beteiligt.[285]
Es fokussiert vor allem die Entstigmatisierung von schizophren Erkrankten, wofür mehrere Gründe angeführt werden. Schizophrenie ist die am stärksten von Stigmatisierungen betroffene psychische Erkrankung. Schizophrenie tritt in allen Gesellschaften mit ähnlichen Symptomen auf, ihr weiterer Verlauf ist aber sehr unterschiedlich. Eine wirksame Behandlung der Schizophrenie ist erst seit wenigen Jahrzehnten möglich, und eine Behandlung mit weniger Nebenwirkungen erst seit wenigen Jahren. Des weiteren gibt es große Unterschiede, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen diese bei sich wahrnehmen und wie die Gesellschaft auf sie reagiert. Auch sind die Patienten- und Angehörigenvereinigungen meistens auf die Vereinigung einer Krankheit ausgelegt. Das Programm hat einige Eigenschaften, die es einmalig machen. Dazu zählt, dass die Kenntnisse von den Betroffenen und ihren Angehörigen der wichtigste bestimmende Faktor bei der Programmausrichtung darstellt. In das Programm werden außerdem Regierungsvertreter, kommunale Einrichtungen, die Industrie, pädagogische Einrichtungen, die Medien und die Gesetzgeber mit einbezogen. Das Programm ist langfristig angelegt. Es wird mit einer bestimmten Zielgruppe gearbeitet, Erfahrungen haben gezeigt, dass Kampagnen die sich an die gesamte Bevölkerung gewendet haben, nicht sehr effektiv sind.[286]
Das Programm sieht Kampagnen auf vielen verschiedenen Ebenen vor. Dazu zählen Projektwochen in Schulen, Schulungen von Personal in psychiatrischen Kliniken sowie von Polizisten, Informationsveranstaltungen für Arbeitsämter, Gesundheitspolitiker, Arbeitgeber und Journalisten, sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten wie Kunstausstellungen oder Lesungen.[287]
In Deutschland wurde der Verein „Open the doors e.V.“ in dem Jahr 2000 von sieben verschiedenen Projektzentren ins Leben gerufen. Die Hauptzielgruppen in Deutschland sind: die allgemeine Bevölkerung (alle Zentren), in psychiatrischen Einrichtungen tätiges Personal (Düsseldorf), Medienvertreter (München, Düsseldorf, Leipzig), Polizeibeamte (München) und Schüler (Leipzig, Hamburg, Düsseldorf). Weitere Zentren gibt es in Kiel und Itzehoe.[288]
Es gibt aber auch andere Aktivitäten, wie die Antistigma-Kampagne des Royal College of Psychiatrists, welche im Gegensatz zu dem Programm der WPA ihren Fokus nicht ausschließlich auf die Schizophrenie lenkt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in den Bereichen Aufklärung, Kontakt und Protest.[289]
Das Jahr 2001 wurde von der WHO und den Vereinten Nationen zu dem Jahr der seelischen Gesundheit ausgerufen und damit verbanden sich eine Reihe von globalen, nationalen und regionalen Aktivitäten. Ein Hauptziel dieser Kampagne ist es, Stigmatisierung auch politisch bewusst zu machen, da es sich kein Land, auch das ärmste nicht, leisten kann, nicht die psychische Gesundheit seiner Bevölkerung zu fördern, zu schützen und nachhaltig in sie zu investieren.[290]
Neben diesen „offiziellen Antistigmakampagnen“ gibt es auch die „Antistigmakampagne von unten“. Dazu zählt die Initiative „Irre menschlich Hamburg e. V.“, welche vor über zehn Jahren die Psychoseseminare ins Leben riefen. Diese haben sich seitdem kontinuierlich in Deutschland verbreitet, so dass es mittlerweile über 100 solcher Seminare in Deutschland gibt. Im Mittelpunkt der Psychoseseminare steht der Trialog, also dass sich psychoseerfahrene Menschen (Experten in eigener Sache), deren Angehörige und Psychiatrieprofis auf gleicher Ebene begegnen können und somit voneinander lernen können.[291]
In den offiziellen Kampagnen sind vor allem Hochschullehrer aktiv, welche größtenteils das medizinische Krankheitsbild vermitteln. Eine darauf eingeengte Sicht des psychischen Krankseins trägt das Risiko der Stigmatisierung, da sie die Betroffenen dem allgemeinen Ideal des Menschen wieder annähern möchten. Die Antistigmaarbeit von unten „will deutlich machen, dass das Ideal des allzeit und allseits ebenen und runden Menschen nicht der Wirklichkeit entspricht. Es geht ihr darum, das Bild vom Menschen zu erweitern – in der Psychiatrie und in der Gesellschaft“ [292]. Danach ist die Möglichkeit, psychotisch zu werden, tief im menschlichen Wesen verankert, es ist in diesem Sinne keine biologisch verursachte Krankheit, sondern die Psychosen sind Ausdruck von Lebenskrisen dünnhäutiger, sensibler Menschen. Psychisch Kranke handeln somit nicht menschenuntypisch und alle Menschen können psychotisch werden. Die Psychosen sind nicht immer heilbar, aber es ist möglich, mit ihnen zu leben. Dabei können Medikamente unterstützend wirken, sie benötigen aber einen tragenden Kontext in Form von therapeutischer Begleitung. Diese Inhalte werden vor allem in Form von Informationsveranstaltungen an Schulen vermittelt, worauf sich das nächste Kapitel beziehen wird.[293]
9.3.1. Praxisbeispiel: Entstigmatisierungskampagnen an Schulen
Im Rahmen des von der WPA initiierten Programms wurde in Leipzig die Initiative „Irrsinnig menschlich e. V.“ gegründet. Neben der Medien-Kampagne „Gegen die Bilder im Kopf“ und dem MUT-Preis, welcher Politiker für ihren Einsatz würdigt, gründeten sie auch das Schulprojekt „Verrückt? Na und!“. Wie weiter oben schon erwähnt wurde, betreibt auch die Initiative „Irre menschlich e. V.“ Schulprojekte. Beide Initiativen sind in Hamburg tätig und sind sich vom konzeptionellen Aufbau her ähnlich. Während sich das Schulprojekt „Verrückt? Na und!“ nur an 15-20 jährige Jugendliche richtet, bietet der „Irre menschlich e. V.“ auch Veranstaltungen für die Unter- und Mittelstufe an.
Es sprechen viele Argumente dafür, warum sich so viele Kampagnen an Jugendliche und Kinder richten. Wie in dem 4. Kapitel dargestellt wurde, werden Stereotype und Vorurteile in der frühen Kindheit erlernt und manifestieren sich in der darauffolgenden Zeit. Des weiteren sind Kinder und Jugendliche diejenigen, die die Zukunft gestalten und bestimmen werden.
Die Schule ist nach der Aussage von Jugendlichen der wichtigste Ort, um Wissen über psychische Krankheiten zu erwerben.[294] Dem Schulprojekt „Verrückt? Na und!“[295], sowie für „Irre menschlich e. V.“[296] ist es neben der Aufklärung und Begegnung auch wichtig, dass die Jugendlichen sich mit dem Leben im allgemeinen, ihren persönlichen Lebenszielen und zu erwartenden Hindernissen auseinander setzen.
In dem Verein „Irre menschlich“ wird der Lehrer weitestgehend miteinbezogen. Es wird gemeinsam ein Medienkoffer zusammengestellt, welcher auf das Alter, die Dauer der Veranstaltung und am besten auch auf den teilnehmenden Psychoseerfahrenen („Experten in eigener Sache“) abgestimmt ist. In der Unter-, oder Mittelstufe kann dieser z.B. aus der Lektüre eines Buches bestehen. Für die Oberstufe gibt es viele Möglichkeiten, das Thema aufzubereiten. Nach dem kennen lernen von psychologischen und (kritischen) psychiatrischen Theorien, steht die Begegnung mit einem Psychoseerfahrenen in dem Mittelpunkt.
Das Grundkonzept von „Verrückt? Na und!“ gliedert sich in drei Schritte. Als erstes lernen die Schüler ihre eigenen Vorstellungen und Einstellungen zu psychischer Krankheit kennen. In dem zweiten Schritt beschäftigen sich die Jugendlichen mit ihrem eigenen Selbstbild und ihren Vorstellungen vom Leben. In dem dritten Schritt begegnen sie Psychoseerfahrenen, welche aus ihrem Leben berichten. Außerdem lernen sie etwas über die Hintergründe von psychischen Krankheiten und erfahren, dass es ein umfangreiches Hilfesystem gibt.
Beide Projekte können über einen Tag oder bis zu einem halben Jahr gehen.
Die Auswertung von Schulprojekten hat gezeigt, dass diese die Einstellung der Schüler nachhaltig beeinflussen. Bei einer Studie mit 114 teilnehmenden Schülern, wurden die Einstellungen gegenüber Psychosekranken vor und nach der Durchführung solch eines Schulprojektes miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass es nur bei den Schülern, die einem Psychoseerfahrenen begegnet waren, zu einer signifikanten positiven Einstellungsänderung kam. Bei der Vergleichsgruppe, bei welcher ein Psychiater und ein Sozialarbeiter die Veranstaltung betreuten, zeigten sich keine signifikanten Veränderungen. In einigen Bereichen gab es sogar eine geringfügige negative Veränderung, so wurde von diesen Schülern nach der Veranstaltung häufiger das Attribut Gefährlichkeit mit psychischer Erkrankung in Verbindung gebracht. Die Schüler, die nach dem Unterricht Kontakt aufnahmen, taten dies insbesondere mit den Psychoseerfahrenen. Sie bewunderten ihren Mut zum „Outing“ oder wollten mehr über deren Leben erfahren.[297]
In den Jahren von 2001 bis 2005 haben an dem Projekt von „Verrückt? Na und!“ 3500 Schüler teilgenommen und es soll in Deutschland und international weiter ausgebaut werden.
An dem Programm von „Irre menschlich e.V.“ haben in den Jahren von 2001 bis 2003 etwa 1400 Schüler teilgenommen.
Außerdem zeigte sich bei den Psychoseerfahrenen ein Zugewinn im Sinne von Empowerment.[298]
9.3.2. Praxisbeispiel: Schulungen von Polizisten
Der bayerische Verein „BASTA“[299] der ebenfalls zu dem „open the doors e.V.“ gehört, bietet Schulungen für Polizisten an. Diese finden in Kooperation mit der Bayerischen Beamtenfachhoschule – Fachbereich Polizei statt. Dort werden in Form von einem Studium Führungskräfte und Sachbearbeiter für die Schutz- und Kriminalpolizei ausgebildet.
Die Begegnung zwischen Polizisten, psychisch Kranken und deren Angehörigen können oftmals sehr schwierig und konfliktbeladen sein. Unter Umständen kommt es zu Gewaltanwendung seitens der Polizisten, diese können die Situation oftmals sehr schwer einschätzen. Aus diesem Grund hat sich BASTA dazu entschlossen, den Polizisten über psychische Krankheiten zu informieren und eine Begegnung zwischen psychisch Kranken und Polizisten auf einer gleichberechtigten Ebene zu ermöglichen. Das Ziel ist die Aufklärung und Sensibilisierung. Durch die Begegnung sollen die Polizisten lernen, Vorurteile und Berührungsängste abzubauen und den Menschen hinter der Krankheit zu sehen.
Für das Projekt wird ein Vormittag zur Verfügung gestellt. In dem ersten Schritt kommt es zu einem gegenseitigen kennen lernen. Betroffene und deren Angehörige berichten von ihren Erlebnissen die sie mit der Polizei hatten, die Polizisten können Fragen stellen oder von eigenen Erlebnissen berichten. In dem zweiten Schritt werden schriftliche positive und negative Erlebnisberichte in Kleingruppen diskutiert. Dabei sollen die Polizisten alternative Handlungsstrategien entwickeln. Als letztes wird abhängig von dem Wissensstand und den Interessen der teilnehmenden Polizisten über psychische Krankheiten informiert, Verhaltenstipps für schwierige Situationen vermittelt und Kriseninterventionszentren vorgestellt.
Die Projekt wird von allen Teilnehmern durchweg positiv bewertet. Für die Betroffenen und Angehörigen war die engagierte Mitarbeit der Studenten sehr beeindruckend und für die Betroffenen gab es zusätzlich noch einen Zugewinn im Sinne von Empowerment. Die Leitung der Fachhochschule möchte solche Projekttage auch in den nächsten Jahren durchführen.
10. Resümee
Psychisch Kranke erleben vielfältige Diskriminierungen und sind in ihren Lebenschancen stark beeinträchtigt.
Das Stigmatisierungserleben psychisch Kranker ist durch tatsächlich erfahrene, sowie durch antizipierte Stigmatisierungen gekennzeichnet. Dabei zeigt sich durchgängig, dass mehr Stigmatisierungen erwartet als tatsächlich erfahren werden. Das hängt auch damit zusammen, dass sich viele psychisch Kranke gewisse Dinge nicht trauen, da sie Ablehnung erwarten. Dadurch kommen sie erst gar nicht in Situationen, in denen sie diese erfahren könnten.
Es konnte gezeigt werden, dass die Allgemeinbevölkerung negative Vorurteile gegenüber psychisch Kranken hat, und dass diese in Form von Stereotypen zu Generalisierungen werden, welche die ganze Person betreffen.
Für den Betroffenen selbst ist die Psychose, oder auch eine andere psychische Erkrankung, ein Erlebnis, das ihn in seinem Innersten berührt. Insofern kann die Erkrankung schlecht, wie es nach dem bio-medizinischen Modell üblich ist, von der Person abgespalten werden. Die psychische Erkrankung muss zum einen als Teil der Person begriffen werden, zum anderen darf sie trotzdem nicht das alles bestimmenden Merkmal sein. Dieser Prozess des Integrierens der psychischen Erkrankung stellt für die Betroffenen eine Herausforderung für das gesamte Leben dar. Inwiefern dem Betroffenen es gelingt die psychische Erkrankung positiv in sein Selbstbild zu integrieren, hängt entscheidend davon ab, welche Einstellung er und sein soziales Umfeld zu der psychischen Erkrankung haben.
Von dem sozialen Umfeld ist nicht nur abhängig, wie und ob der psychisch Kranke lernen wird, seine Krankheit anzunehmen, sondern davon wird auch beeinflusst, ob es zu einem chronischen Krankheitsverlauf kommen wird oder nicht. Dass das Vorhandensein und die Art von sozialen Beziehungen ein wichtiger Faktor für den weiteren Krankheitsverlauf ist, konnte insbesondere in der „Expressed-Emotions“ Forschung gezeigt werden. Dabei zeigte sich, dass positive, stabile und tragfähige Beziehungen unterstützend wirken, und negative Beziehungen einen Rückfall begünstigen. Viele Angehörige leiden ebenfalls unter dem Stigma und fühlen sich außerordentlich belastet, worunter die Beziehung zu dem kranken Familienmitglied unter Umständen leidet. Dies zeigt, wie groß die Bedeutung von Unterstützung der Angehörigen und anderen engen Beziehungspartnern ist. Außerdem sollte auch der Ausbau des weiteren sozialen Netzwerks unterstützt werden. Dies passiert allerdings häufig nur innerhalb der Psychiatrieszene.
Da das Erleben der Stigmatisierungen so stark von dem Betroffenen selbst abhängt, ist es eine wichtige Maßnahme zur Entstigmatisierung, den Betroffenen selbst in der Auseinandersetzung mit der Krankheit zu unterstützen. Dies kann innerhalb der Therapie, auch in Form von Sozio- oder Gruppentherapie geschehen. Dazu gehört aber auch, dass die psychiatrisch Tätigen sich selbst und ihre Einstellungen hinterfragen. Eine Psychiatrie, die das Selbstwertgefühl ihrer Patienten stärken möchte, darf nicht selber von stigmatisierenden Gedanken durchdrungen sein.
Die Lebensqualität der psychisch Kranken wird von dem Selbstkonzept beeinflusst. Dabei hat sich gezeigt, dass ein positives Selbstkonzept stark davon abhängt, inwiefern der Betroffene eine positive Zukunft für sich sieht. Diese wird oftmals von der Diagnose einer chronischen psychischen Krankheit zerstört. Die Lebensqualität vieler psychisch Kranker ist als Folge davon eher resignativer Art. Außerdem hängt sie stark von der erlebten Autonomie und Selbstständigkeit ab.
Um sich selber als autonom erleben zu können, muss auch die Behandlung der Krankheit als freiwillig erlebt werden, und dafür muss die Möglichkeit gegeben sein, über sie entscheiden zu können. Es hat sich gezeigt, dass die Behandlung weitaus effektiver ist, wenn sie von dem Betroffenen als freiwillig erlebt wird. Insbesondere ist hier der Punkt der Medikation zu beachten, da viele Betroffene diese als unfreiwillig erleben. Von der Betroffenen-Bewegung wird außerdem gefordert, dass sie in die Leitung von psychosozialen Einrichtungen mit einbezogen werden. Das bedeutet, dass die Betroffenen mit gleicher Bezahlung, als „Experten in eigener Sache“, fest angestellt werden.
Um wirklich frei zwischen Behandlungsmethoden wählen zu können, müssten auch noch weitere Alternativen zur Psychiatrie entstehen.
Die Unterstützung der Integration der psychischen Krankheit in das Selbstbild stellt für die psychosoziale Praxis eine neue Herausforderung dar. Bisher sind die professionellen Helfer weitestgehend auf eine „Normalisierung“ ihrer Klienten oder Patienten ausgerichtet. Diese Ausrichtung an der Norm beinhaltet stigmatisierende Konzepte. Im Sinne von Empowerment sollte der Betroffene in seinem So-Sein belassen werden und dabei unterstützt werden, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Dazu gehört auch, ihn nicht jederzeit vor Fehlern beschützen zu wollen. Auch psychisch Kranke haben ein Recht darauf, Fehler zu begehen und im Nachhinein aus ihnen zu lernen.
Zur Entstigmatisierung ist es wichtig, dass die Betroffenen Techniken an die Hand bekommen, um besser mit Stigmatisierungen umgehen zu können. Dazu zählen die Coping-Strategien, die von Goffman entwickelt und von Link et al. weiterentwickelt wurden. Der gezielte Umgang mit diesen Techniken kann ebenfalls Bestandteil einer Therapie sein.
Außerdem stoßen psychisch Kranke nicht nur aufgrund von Stigmatisierungen auf soziale Distanz, sondern auch aufgrund von tatsächlichem absonderlichen, verstörenden Verhaltens. Selbst wenn der Nicht-Stigmatisierte keine negative Einstellung zu psychisch Kranken hat, kann es somit zu sozialer Distanz kommen. In psychiatrischen Kliniken wird häufig ein „Training sozialer Kompetenzen“ angeboten. Viele psychisch Kranke leiden in ihrem alltäglichen Leben unter der Angst, dass sie sich abweichend, auffallend verhalten könnten. Diese Gefühle könnten unter Umständen von solch einem Training bestärkt werden, weswegen diese sehr sensibel durchgeführt werden müssen.
Für viele psychisch Kranke ist der Austausch in Selbsthilfegruppen sehr wichtig. Dadurch merken sie, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind, und dass es Menschen gibt die diese teilen. Allerdings gibt es auch viele Betroffene, die erzählen, dass sie eben durch solche Selbsthilfegruppen oder den Besuch von Tagesstätten in die Rolle eines psychisch Kranken sozialisiert worden sind. Erst durch die vollständige Ablösung von psychosozialen Einrichtungen gelang ihnen der Weg zurück in ein „normales“ Leben.
Es ist außerdem wichtig, dass es Antistigmakampagnen gibt, die sich an die Öffentlichkeit wenden. Um mit Antistigmakampagnen eine nachhaltige Einstellungsveränderung in der Allgemeinbevölkerung zu bewirken, ist persönlicher Kontakt zwischen Stigmatisierten und Nicht-Stigmatisierten der entscheidende Faktor. Vorurteile entstehen aus Mythen, deren Grundlage wiederum die Unwissenheit ist. Den Vorurteilen ist nicht so einfach durch Protest und Aufklärung beizukommen, sondern es muss auch der affektive Zugang gesucht werden.
Negative Vorurteile gegenüber Minderheiten sind ein universelles Problem, dass nicht nur in unserer Gesellschaft und gegenüber psychisch Kranken existiert. Die Vorurteile dienen unter anderem der Selbstwerterhöhung und der Betonung der eigenen Normalität. Diese Normalität betonen auch viele psychisch Kranke, indem sie die gleiche soziale Distanz gegenüber anderen psychisch Kranken aufbauen.
Dass Vorurteile ein menschliches Grundbedürfnis befriedigen, zeigt, wie schwierig es sein wird, diese aus den Köpfen zu verbannen. Dabei besteht auch die Gefahr, dass sich die negativen Vorurteile nur verlagern und sich dann gegen eine andere Minderheit wenden.
Auch wenn es ein langwieriger Prozess ist, so ist es trotzdem wichtig, dass die Bemühungen zur Entstigmatisierung psychisch Kranker nicht nachlassen, und die Antistigmakampagnen ausgebaut werden. Für den Moment benötigen die Stigmatisierten Unterstützung, um besser mit Diskriminierungen umgehen zu können. Dazu gehört vor allem die Förderung der Selbstständigkeit und Autonomie. Dadurch wird es den Betroffenen möglich gemacht, sich ihren Selbstwert zu erhalten. Dies bedeutet für die professionell Tätigen eine radikale Veränderung des Blickwinkels und eine Umgestaltung von psychosozialen Institutionen und Einrichtungen.
Literaturverzeichnis
ANGERMEYER, M.C.: Soziales Netzwerk und Schizophrenie: Eine Übersicht. In: Angermeyer, M.C.; Klusmann, D. (Hrsg.): Soziales Netzwerk. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1989
ANGERMEYER, M.C.: Das Bild von der Psychiatrie in der Bevölkerung. Psychiatrische Praxis 2000; 27: 327-329
ANGERMEYER, M.C.: Das Stigma psychischer Krankheit aus Sicht der Patienten – Ein Überblick. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 358-366
ANGERMEYER, M.C.: Stigmatisierung psychisch Kranker in der Gesellschaft. Psychiatrische Praxis 2004; 31: S246-S250
ANGERMEYER, M. C.; HOLZINGER, A.; MATSCHINGER, H.: Lebensqualität, das bedeutet für mich... Psychiatrische Praxis 1999; 26: 56-60
ANGERMEYER, M. C.; HOLZINGER, A.: Erlebt die Psychiatrie zurzeit einen Boom der Stigmaforschung? Psychiatrische Praxis 205; 32: 399-407
ANGERMEYER, M.C.; KLUSMANN, D.: Einführung. In: Angermeyer, M.C.; Klusmann, D. (Hrsg.): Soziales Netzwerk. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1989
ANGERMEYER, M.C.; MATSCHINGER, H.: Auswirkungen der Reform der psychiatrischen Versorgung in den neuen Ländern der Bundesrepublik Deutschland auf die Einstellung der Bevölkerung zu Psychiatrie und zu psychisch Kranken. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1995
ANGERMEYER, M.C.; SCHULZE, B.: Psychisch Kranke – eine Gefahr? Psychiatrische Praxis 1998; 25: 211-220
ANGERMEYER, M.C.; SIARA, C.S.: Auswirkungen der Attentate auf Lafontaine und Schäuble auf die Einstellung der Bevölkerung zu psychisch Kranken. Teil 1: Die Entwicklung im Jahr 1990 & Teil 2: Die Entwicklung im Jahr 1991. Nervenarzt 1994; 65: 41-56
BAER, N.; DOMINGO, A.; AMSLER, F.: Diskriminiert. Bonn: Psychiatrie-Verlag 2003
BARHAM, P.; HAYWARD, R.: Ich will einfach. daß meine Krankheit vergessen wird. In: Angermeyer, M.C.; Zaumseil, M. (Hrsg.): Ver-rückte Entwürfe. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1997, S.86-101
BASTA e.V.: Polizeiprojekt. (Internet 22.03.06: http://openthedoors.de/de/ polizeiprojekt.php)
BAUMANN, A.; ZAESKE, H.; GAEBEL, W.: Das Bild psychisch Kranker im Spielfilm: Auswirkungen auf Wissen, Einstellungen und soziale Distanz am Beispiel des Film „Das weiße Rauschen“. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 372-378
BAUMANN, A.; GAEBEL, W.: „Open the doors“ in Deutschland. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 249-259
BECK, M.; ANGERMEYER, M. C.; BRÄHLER, E.: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und sozialer Distanz gegenüber psychisch Kranken? Psychiatrische Praxis 2005; 32: 68-72
BERGLER, R.: Vorurteile und Stereotype. In: Heigl-Evers, A. (Hrsg.): Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. 8, Lewin und die Folgen, Kindler-Verlag, 238-249, 1979
BLASIUS, D.: Wahnsinnig fremd... Psychisch Kranke in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Essener Unikate 1995; 6/7: 98-105
BLEULER, E.: Lehrbuch der Psychiatrie. 12. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1972
BOCK, T.; NABER, D.: Antistigmakampagne von unten – an Schulen. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 402-408
BOTTLENDER, R.; MÖLLER, H.-J.: Psychische Störungen und ihre sozialen Folgen. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W.(Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 7-17
BROCKHAUS: Der Brockhaus in fünf Bänden. Leipzig: F. A. Brockhaus GmbH, 2004
CARIUS, D.; ANGERMEYER, M. C.; STEINBERG, H.: Narrenhaus, Irrenanstalt, Heil- und Pflegeanstalt, Fachkrankenhaus – Zur Entwicklung der Bezeichnungen für psychiatrische Kliniken in Deutschland bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 438-443
CLOERKES, G.: Soziologie der Behinderten. 2. Aufl. Heidelberg: Edition S, 2001
CORRIGAN, P.W.; WATSON, A.C.: The paradox of self-stigma and mental illness. Clinical Psychology: Science and Practice 2002; 9: 35-53
CRISP, A.: Changing Minds: „Every Family in the Land“. Die Antistigma-Kampagne des Royal College of Psychiatrists. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 224-244
DEGER-ERLENMAIER, H.: Angehörige psychisch Kranker auf dem Weg zur Selbsthilfe – Zur Geschichte und Gegenwart der Angehörigenbewegung. In: Deger-Erlenmaier, H. (Hrsg.): Wenn nicht mehr ist, wie es war... Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1992, S. 146-163
DÖRNER, KLAUS: Bürger und Irre. Ergänzte Neuauflage. Hamburg: eva-Taschenbuch 1995
DÖRNER, K.; PLOG, U.; TELLER, C.; WENDT, F.: Irren ist menschlich. 4. Auflage. Bonn: Psychiatrie-Verlag 2002
DOMINGO, A., BAER, N.: Stigmatisierende Konzepte in der beruflichen Rehabilitation. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 355-357
EIKELMANN, B.; ZACHARIAS-EIKELMANN, B.; RICHTER, D.; REKER, T.: Ziel ist Teilnahme am „wirklichen“ Leben. Deutsches Ärzteblatt 2005; 16: 1104-1110
ESTROFF, S.E.; LACHICOTTE, W.S.; ILLINGWORTH, L.C.; JOHNSTON, A.: Jeder ist ein bißchen krank. In: Angermeyer, M.C.; Zaumseil, M. (Hrsg.): Ver-rückte Entwürfe. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1997, S.102-165
FINZEL, M.; SCHMIDMEIER, R.; FRIC, M.; WIDAUER, M.; LAUX, G.: Aggressionen psychiatrischer Patienten – Erste Ergebnisse einer standardisierten Dokumentation des BZK Gabersee. Psychiatrische Praxis 2003; 30: S196-S199
FINZEN, A.: Der Verwaltungsrat ist schizophren. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1996
FINZEN, A.: Psychose und Stigma. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 2000
FISCHER, M.; KEMMLER, G.; MEISE, U.: Schön, dass sich auch einmal jemand für mich interessiert. Psychiatrische Praxis 2004; 31: 60-67
FREY, H.-P.: Stigma und Identität. Weinheim; Basel: Beltz, 1983
FRICKE, R.: (Ent-)Stigmatisierung psychisch kranker Menschen in der Öffentlichkeit. Soziale Psychiatrie 2000; 4: 13-15
GAEBEL, W.; BAUMANN, A.; WITTE, M.: Einstellungen der Bevölkerung gegenüber schizophren Erkrankten in sechs bundesdeutschen Großstädten. Der Nervenarzt 2002; 7: 665-670
GERARD, H.B.: Funktion und Entwicklung von Vorurteilen. In: Heigl-Evers, A. (Hrsg.): Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Bd. 8, Lewin und die Folgen, Kindler-Verlag, 250-263, 1979
GOFFMAN, E.: Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1967
GROß, T. M.: Das Stigma psychischer Erkrankungen. Butzbach-Griedel: Afra Verlag 2000
GÜTTLER, P. O.: Sozialpsychologie. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2003
HÄFNER, H.: Die Psychiatrie-Enquete – historische Aspekte und Perspektiven. In: Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.): "25 Jahre Psychiatrie-Enquete", Band 1. Bonn: Psychiatrieverlag 2001, S. 72-102
HERRIGER, N.: Empowerment in der Sozialen Arbeit. Stuttgart: Kohlhammer 2002
HOFFMANN, H.: Berufliche Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt – Ein realistisches Ziel für chronisch psychisch Kranke? Psychiatrische Praxis 1999; 26: 211-217
HOFFMANN, H.; KUPPER, Z.: Prädikative Faktoren einer erfolgreichen beruflichen Wiedereingliederung von schizophrenen Patienten. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 312-317
HOHMEIER, J.: Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozeß. In: Brusten, M.; Hohmeier, J. (Hrsg.): Stigmatisierung 1, Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen, Darmstadt 1975 (Internetversion, 03.01.06: http://bidok.uibk.ac.at/library/hohmeier-stigmatisierung.html)
HOFFMANN-RICHTER, U.: Psychiatrie in der Zeitung, Urteile und Vorurteile. Bonn, Edition Das Narrenschiff im Psychiatrie-Verlag, 2000
HOFFMANN-RICHTER, U.: Die Stigmatisierung psychisch Erkrankter ist Teil unserer Kultur. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 353-354
HOLZINGER, A.; ANGERMEYER, M. C.; MATSCHINGER, H.: Was fällt Ihnen zum Wort Psychiatrie ein? Psychiatrische Praxis 1998; 25: 9-13
HOLZINGER, A.; BECK, M.; MUNK, I.; WEITHAAS, S.; ANGERMEYER, M.C.: Das Stigma psychischer Krankheit aus Sicht schizophren und depressiv Erkrankter. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 395-401
IRRSINNIG MENSCHLICH E.V.: „Verrückt? Na und!“: Seelische Gesundheit – Gesundheitsförderung, Prävention und Antistigmaarbeit in der Schule seit 2001. (Selbstdarstellung im Internet, 22.03.06: www.irrsinnig-menschlich.de/assets/docs/schule.060206.pdf)
JUNGBAUER J.; STELLING, K; ANGERMEYER, M. C.: Auf eigenen Beinen wird er nie stehen können. Psychiatrische Praxis 2006; 33: 14-22
KNUF, A. (2000a): Steine aus dem Weg räumen! Empowerment und Gesundheitsförderung in der Psychiatrie. In: Knuf, A; Seibert, U. (Hrsg.): Selbstbefähigung fördern – Empowerment und psychiatrische Arbeit. Bonn: Psychiatrie-Verlag 2000, S.32-44
KNUF, A. (2000b): Krankheitsbewusstsein als Schlüssel zu Selbsthilfe und Selbstbestimmung. In: Knuf, A; Seibert, U. (Hrsg.): Selbstbefähigung fördern – Empowerment und psychiatrische Arbeit. Bonn: Psychiatrie-Verlag 2000, S.85-94
KNUF, A: Das Stigma auf der Innenseite der Stirn. 2005 (Internet 26.03.2006: http:// www.beratung-und-fortbildung.de/Stigma_auf_der_Innenseite_der_Stirn.pdf)
LAUBER, C.; RÖSSLER, W.: Empowerment und Stigma. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 212-217
LEFERINK, K.: Die Person und ihre Krankheit. In: Angermeyer, M.C.; Zaumseil, M. (Hrsg.): Ver-rückte Entwürfe. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 1997, S.206-261
LEHMANN, P.: Grußwort des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener. In: Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.): "25 Jahre Psychiatrie-Enquete", Band 1. Bonn: Psychiatrieverlag 2001, S. 44 – 47
LINDEN, M.; WEIDNER, C.: Arbeitsunfähigkeit bei psychischen Störungen. Nervenarzt 2005; 76: 1421-1429
LINK, B.G.; CULLEN, F. T.; STRUENING, E.; SHROUT, P. E.: A modified labeling theory approach to mentals disorders: An empirical assessment. American Sociological Review 1989; 54: 400-423
LINK, B.G.: Die Folgen des sozialen Stigmas für das Schicksal psychisch Kranker. ZNS-Journal 2000; 32: 32-37
LINK, B.G.; PHELAN, J.C. (2001a): On Stigma and its public health implications. Background paper of the conference on Stigma and Global Health 2001 (Internet 01.02.06: stigmaconference.nih.gov/FinalLinkPaper.htm)
LINK, B.G.; STRUENING, E.L.; NEESE-TODD, S.; ASMUSSEN, S.; PHELAN, J.C. (2001b): Stigma as a Barrier to Recovery: The Consequences of Stigma for the Self-Esteem of People with mental Illness. Psychiatric Services 2001, 52: 1621-1626 (Internet 03.04.06: http://ps.psychiatryonline.org)
MAIO, G.: Zum Bild der Psychiatrie im Film un dessen ethische Implikationen. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 99-121
MEISE, U.; SULZENBACHER, H.; KEMMLER, G.; SCHMID, R.; RÖSSLER, W.; GÜNTHER, V.: “...nicht gefährlich, aber doch furchterregend” Ein Programm gegen Stigmatisierung an Schulen. Psychiatrische Praxis 2000; 27: 340-346
MÖLLER-LEIMKÜHLER, A. M.: Stigmatisierung psychisch Kranker aus der Perspektive sozialpsychologischer Stereotypenforschung. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 40-55
NÜESCH, MANUELA: Stigmatisierungserleben und Stigma-Management. Biel: Edition SZH/SPC 2002
OTTE, C.; RÄDLER, T.: Ätiologie und Pathogenese der Schizophrenie. In: Naber, D.; Lambert, M.: Schizophrenie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2004
PRIEBE, S.: Kontra. In: Gaebel, W.; Priebe, S.: Pro und Kontra: Machen Antistigmakampagnen Sinn? Psychiatrische Praxis, 2005; 32: 218-220
PUPATO, K.: Psychiatrie in den Medien. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 83-98
QUINDEL, R.: Zwischen Empowerment und sozialer Kontrolle. Bonn: Psychiatrie-Verlag 2004
RAISCH, W.: So weit die Netze tragen. München, Wien: Profil Verlag 1996
RÖSSLER, W.: Das Stigma psychischer Erkrankungen. Die Psychiatrie 2005; 1: 5-10
RÜESCH, P.: Soziale Netzwerke und Lebensqualität. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 196-211
RÜSCH, N.; ANGERMEYER, M. C.; CORRIGAN, P. W.: Das Stigma psychischer Erkrankungen: Konzepte, Formen und Folgen. Psychiatrische Praxis 2005; 32: 221-232
RÜSCH, N.; BERGER, M.; FINZEN, A.; ANGERMEYER, M. C.: Das Stigma psychischer Erkrankungen – Ursachen, Formen und therapeutische Konsequenzen. In: Berger M. (Hrsg.) Psychische Erkrankungen – Klinik und Therapie, elektronisches Zusatzkapitel Stigma 2004 (Internet 20.02.06: http://www.berger-psychische-erkrankungen-klinik-und-therapie.de/ergaenzung.pdf)
RUTZ, W.: Seelische Gesundheit, Stigma und Ausgrenzung aus europäischer Perspektive und die Destigmatisierungs-Programme der Weltgesundheitsorganisation. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 219-223
SARTORIUS, N.: Fighting Stigma and Discrimination because of Schizophrenia – Open the doors: Das globale Antistigma-Programm des Weltverbandes für Psychiatrie. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S.245-248
SCHMID, R.; SPIEßL, H.; CORDING, C.: Zwischen Verantwortung und Abgrenzung: Emotionale Belastungen von Angehörigen psychisch Kranker. Psychiatrische Praxis 2005; 32: 272-280
SEIBERT, U.: Die Stabilisierung der Identität - eine Empowerment-Strategie. In: Knuf, A; Seibert, U. (Hrsg.): Selbstbefähigung fördern – Empowerment und psychiatrische Arbeit. Bonn: Psychiatrie-Verlag 2000, S.104-121
TORCHALLA, I.; ALBRECHT, F.; BUCHKREMER, G.; LÄNGLE, G.: Wohnungslose Frauen mit psychischer Erkrankung – eine Feldstudie. Psychiatrische Praxis 2004; 31: 228-235
TROSBACH, J.; STENGLER-WENZKE, K.; ANGERMEYER, M.C.: Scham, Peinlichkeit und Ärger... Angehörige von Patienten mit Zwangserkrankungen beschreiben Stigmatisierungserfahrungen im Alltag. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 62-67
VOELZKE, W.: Vom Objekt zum Subjekt – aus Sicht eines Psychiatrie-Erfahrenen. In: Aktion Psychisch Kranke (Hrsg.): "25 Jahre Psychiatrie-Enquete", Band 1. Bonn: Psychiatrieverlag 2001, 212-231
WEYMANN, A.: Interaktion, Sozialstruktur und Gesellschaft. In: Joas H. (Hrsg.): Lehrbuch der Soziologie. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2001
YAGDIRAN, O.; HAASEN, C.: Symptomatik und Subtypen der Schizophrenie. In: Naber, D.; Lambert, M.: Schizophrenie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2004
ZÄSKE, H.; BAUMANN, A.; GAEBEL, W.: Das Bild des psychisch Kranken und psychiatrischer Behandlung in der Bevölkerung. In: Gaebel, W.; Möller, H.-J.; Rössler, W. (Hrsg.): Stigma – Diskriminierung – Bewältigung. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2005, S. 56-82
ZOGG, H.; LAUBER, C.; AJDACIC-GROSS, H.; RÖSSLER, W.: Einstellungen von Experten und Laien gegenüber negativen Sanktionen bei psychisch Kranken. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 379-383
Erklärung
Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit „Stigmatisierungserleben psychisch Erkrankter. Auswirkungen und Bewältigungsmöglichkeiten“ selbstständig und unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel erstellt zu haben.
Alle Stellen die ich wörtlich oder sinngemäß übernommen habe, habe ich als solche kenntlich gemacht.
Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.
Berlin, 24.04.2006 Meike Johannssen
[...]
[1] Angermeyer, Holzinger, S.401
[2] Vgl.: Dörner et al, S.11-34
[3] Dörner et al., S.37
[4] Vgl.: Nüesch, S.24 ff.
[5] Vgl.: Zäske et al., S.79
[6] Vgl.: Bleuler, S.390 f.
[7] Dörner et al., S.153
[8] Bleuler, S.391
[9] Vgl.: Finzen, 1996, S.12
[10] Vgl.: Dörner et al., S.171
[11] Vgl.: Finzen, 1996, S.15
[12] Vgl.: Dörner et al., S.153
[13] Vgl.: Yagdiran, Haasen, S.15 f.; Dörner et al., S.154
[14] Vgl.: Dörner et al., S.155 f.
[15] Vgl.: Dörner et al., S.154
[16] Vgl.: ebd., S.157
[17] Vgl.: Yagdiran, Haasen, S.25
[18] Vgl.: ebd., Haasen, S.19 f.
[19] Vgl.: Otte, Rädler, S.43 ff.
[20] Vgl.: Otte, Rädler, S.52 f.
[21] Goffman wurde 1922 geboren und starb 1982. Ab 1958 hatte er ein Professur für Soziologie an der Universität von California und 1981 wurde er als Präsident für die „American Sociological Association“ gewählt.
[22] Goffman, S.7
[23] Brockhaus, S.4583
[24] Vgl.: Goffman, 1975, S.9
[25] Vgl.: Groß, S.6
[26] Bottlender, Möller, S.22
[27] Vgl.: Hohmeier
[28] Vgl.: Cloerkes, Groß, Goffman
[29] Vgl.: Goffman, S.11
[30] Vgl.: Goffman, S.11 f.
[31] Goffman, S.13
[32] Vgl.: Goffman, S.12 f.
[33] Finzen, 2000, S.34
[34] Vgl.: Finzen, 2000, S.35
[35] Finzen, 2000, S.36
[36] Hohmeier, S.8
[37] Hohmeier, S.8
[38] Goffman, S.56
[39] Finzen, 2000, S.37
[40] Finzen, 2000, S.38
[41] Vgl.: Hohmeier
[42] Goffman, S.13 f.
[43] Cloerkes, S.135
[44] Vgl.: Cloerkes, S.136
[45] Vgl.: Hohmeier, S.12 f.
[46] Vgl.: Hohmeier, S.4 f.
[47] Vgl.: Hohmeier, S.5
[48] vgl.: Bottlender, Möller, S.25
[49] Vgl.: Bottlender, Möller, S.23
[50] Hohmeier, S.7
[51] Cloerkes, S.135
[52] Vgl.: Güttler, S.111 f.
[53] Vgl.: Bergler, S.240 f.
[54] Vgl.: Gerard S.256
[55] Vgl.: Bergler, S.247
[56] Vgl.: Gerard S.256 f.
[57] Vgl.: Gerard, S.258 f.
[58] Vgl.: Bergler S.246
[59] vgl.: Güttler, S.120 ff.
[60] Vgl.: Gerard, S.260
[61] Vgl.: Güttler, S.124 ff.
[62] Vgl.: Güttler, S.114
[63] vgl.: Möller-Leimkühler, S.46
[64] Vgl.: Güttler, S.114 f.
[65] Vgl.: Möller-Leimkühler, S.46 f.
[66] Vgl.: Bergler, S.247
[67] Vgl.: Möller-Leimkühler, S.46 f.
[68] Vgl.: Möller-Leimkühler S.47 ff., Güttler, S.128 ff.
[69] Möller-Leimkühler S.50
[70] Vgl.: Rüsch et al., 2005, S.223
[71] Vgl.: Hohmeier, S.7 f.
[72] Vgl.: Link, Phelan, 2001a, S.5 ff.
[73] Vgl.: Zäske et al., S.58
[74] Vgl.: ebd., S.58
[75] Vgl.: Zäske et al., S.59
[76] Vgl.: Carius et al., S.439
[77] Vgl.: Zäske et al., S.59
[78] Vgl.: Carius et al., S.439
[79] Vgl.: Zäske et al., S.59
[80] Vgl.: Dörner, S.286 f.
[81] Blasius, S.99
[82] Blasius, S.100
[83] Vgl.: Blasius, S.100
[84] Vgl.: Dörner, S.290
[85] Vgl.: Blasius, S.103 f.
[86] Vgl.: Zäske et al., S.60
[87] Vgl.: Häfner, S.85 f.
[88] Vgl.: Häfner, S.96
[89] Vgl.: ebd., S.97 f.
[90] Vgl.: Lehmann, S.44 ff.
[91] Vgl.: Voelzke, S.224 f.
[92] Vgl.: Rüesch, S.196
[93] Vgl.: Rüsch et al., 2005, S.222
[94] Vgl.: Holzinger et al., 1998, S.10
[95] Vgl.: Zäske et al., S.62 ff.
[96] Vgl.: Angermeyer, Matschinger, 1995, S.31 f.
[97] Vgl.: Angermeyer, 2004, S.S247
[98] Vgl.: Zäske et al., S.70
[99] Angermeyer, 2000, S.329
[100] Vgl.: Zogg et al., S.380
[101] Vgl.: Nordt et al., S.386 f.
[102] Vgl.: Angermeyer, 2004, S.S248
[103] Vgl.: Zäske et al., S.79
[104] Vgl.: Beck et al., S.70 f.
[105] Vgl.: Gaebel et al., S.668
[106] Vgl.: Angermeyer, 1995, S.30 f.
[107] Vgl.: Gaebel et al., S.667 f.
[108] Vgl.: Rössler, S.8 f.
[109] Vgl.: Zäske et al., S.66 f.
[110] Vgl.: Angermeyer, Matschinger 1995, S.31 ff.
[111] Vgl.: Rössler, S.9
[112] nach Luhmann in Hoffmann-Richter, 2000, S.9
[113] Hoffmann-Richter, 2000, S.356
[114] Vgl.: Hoffmann-Richter, 2000, S.49
[115] Vgl.: Finzen, 1996, S.27 ff.
[116] Vgl.: Finzen, 1996, S.31
[117] Vgl.: Hoffmann-Richter, 2000, S.195 f.
[118] Vgl.: Hoffmann-Richter, 2000, S.107 f.
[119] Vgl.: Hoffmann-Richter, 2000, S.372 f.
[120] Vgl.: Pupato, S.89 f.
[121] Vgl.: Maio, S.101 ff.
[122] Vgl.: Baumann et al.,2003, S.373 f.
[123] Vgl.: Maio, S.109 f.
[124] Finzen, 1996, S.50
[125] Vgl.: Angermeyer, Siara, S.41-56
[126] Angermeyer, Siara, S.56
[127] Vgl.: Finzel et al., 2003, S.S196 f.
[128] Vgl.: Finzen, 1996, S.54 f.
[129] Vgl.: Finzen, 2000, S.82 f.
[130] Vgl.: Angermeyer, Schulze, 1998, S.218 f.
[131] Finzen, 2000, S.84
[132] Vgl.: Finzen, 2000, S.85 f.
[133] Vgl.: Angermeyer, Schulze, 1998, S.218
[134] Vgl.: Goffman, S.10
[135] ebd., S.74
[136] Vgl.: Goffman, S.132
[137] ebd., S.15 f.
[138] Vgl.: ebd., 150 ff.
[139] ebd., S.154 f.
[140] Vgl.: ebd., S.156
[141] Vgl.: ebd., S.157 f.
[142] Vgl.: Frey, S.15
[143] Vgl.: Frey, S.43 ff.
[144] Vgl.: ebd., S.45
[145] ebd., S.47
[146] ebd., S.48
[147] ebd., S.50
[148] ebd., S.15
[149] Vgl.: ebd., S.58 f.
[150] Vgl.: Frey, S.60 ff.
[151] Vgl.: Frey, S.64 ff.
[152] ebd., S.66
[153] Vgl.: ebd., S.67
[154] ebd., S.74
[155] Vgl.: ebd., S.75 ff.
[156] Vgl.: Frey, S.78 f.
[157] Scheff wurde 1929 in den USA geboren. Er studierte Physik und Soziologie. Von 1963-1972 lehrte er als Professor an verschiedenen amerikanischen Universitäten Soziologie. Er veröffentlichte zahlreiche Aufsätze, welche sich vor allem mit den Zusammenhängen von psychischen Störungen und sozialen Prozessen befassten.
[158] Scheff, S.25
[159] ebd., S.27
[160] Scheff, S.44
[161] ebd., S.68
[162] ebd., S.69
[163] ebd., S.76
[164] Vgl.: Trojan, S.30
[165] Vgl.: Lamnek, S.257 f.
[166] Vgl.: Link, Phelan, 1989, S.400 f.
[167] B. G. Link wurde 1949 geboren. Er studierte Soziologie an verschiedenen amerikanischen Universitäten. Aktuell ist er Professor für „public health“ an der Universität von Columbia und „Research scientist“ an dem „New York State Psychiatric Institute“.
[168] Vgl.: Link, Phelan, 1989, S.400-408
[169] Vgl.: Rüsch et al., 2004, S.7
[170] Vgl.: Link, Phelan, 1989, S.413 ff.
[171] Vgl.: Link, Phelan, 1989, S.403 f.
[172] Vgl.: Link, 2000, S.34
[173] Vgl.: Angermeyer 2003, Holzinger et al.
[174] Link, 2000, S.38
[175] Vgl.: Holzinger et al., 2003, S.397 f.
[176] Vgl.: Angermeyer, 2003, S.359 f.
[177] Vgl.: Link, 1989, S.412
[178] Vgl.: Rüsch et al., 2004, S.5
[179] Vgl.: Angermeyer 2004, S.S247
[180] Vgl.: Rüsch et al., 2004, S.39
[181] Finzen, 2000, S. 34
[182] Vgl.: Rüsch et al., 2004, S.5
[183] Vgl.: Corrigan, Watson, S.36 f.
[184] Vgl.: Link et al., 2001b, S.5 f.
[185] Vgl.: Corrigan, Watson, S.35 f.
[186] Vgl.: Corrigan, Watson, S.36 ff.
[187] Vgl.: Rüsch et al., 2004, S.7
[188] Hohmeier, S.7
[189] Vgl.: Knuf, 2000b, S.86
[190] Baer et al., S.424
[191] Vgl.: Estroff et al., S.118
[192] Vgl.: Barham, Hayward, S.90 f.
[193] Vgl.: Seibert, S.107 f.
[194] Vgl.: Barham, Hayward, S.91 ff.
[195] Vgl.: Seibert, S.109 ff.
[196] Vgl.: Leferink, S.212 f.
[197] Vgl.: Leferink, S.238-254
[198] Leferink, S.255
[199] Vgl.: Leferink, S.248 f., Estroff et al., S.113 f.
[200] Vgl.: Knuf, 2005, S.4 f.
[201] Vgl.: Hohmeier, S.7
[202] Hohmeier, S.7
[203] Vgl.: Weymann, S.95 f.
[204] Vgl.: Angermeyer, Klusmann, 1989, S.6
[205] Hohmeier, S.7
[206] Vgl: Angermeyer, Klusmann, S.7 f.
[207] Rüesch, S.199
[208] Vgl.: Raisch, S.36
[209] Vgl.: Raisch, S.258 f.
[210] Vgl.: Raisch, S.260
[211] Vgl.: Fischer et al., S.63
[212] Vgl.: Angermeyer, 1989, S.188 f.
[213] Vgl.: Angermeyer, 1989, S.192
[214] Vgl.: Rüesch, S.200
[215] Vgl.: Jungbauer et al., S.17
[216] Trosbach et al., S.62 f.
[217] Vgl.: Finzen, 2000, S.43
[218] Vgl.: Finzen, 2000, S.106
[219] Vgl.: Finzen, 2000, S.108 f.
[220] Vgl.: Trosbach et al., S.63 f.
[221] Vgl.: Trosbach et al., S.66
[222] Vgl.: Schmid et al., S.272
[223] Vgl.: ebd., S.273 f.
[224] Vgl.: Finzen, S.141
[225] Hohmeier, S.7
[226] Vgl.: Angermeyer, 2003, S.359
[227] Vgl.: Torchalla, S.229 f.
[228] Vgl.: Finzen, 2000, S.97 f.
[229] Fricke, S.13
[230] Vgl.: Finzen, 2000, S.99
[231] Vgl.: Moos, Wolfersdorf, S.154
[232] Vgl.: Eikelmann et al., S.1104
[233] Vgl.: Linden, Weidner, S.1423 f.
[234] Linden, Weidner, S.1426
[235] Vgl.: Eikelmann et al., S.1108
[236] Vgl.: Hoffmann, S.211
[237] Vgl.: Eikelmann, S.1110, Hoffmann, S.213
[238] Vgl.: Hoffmann, Kupper, S.316
[239] Eikelmann, S.1110
[240] Vgl.: Eikelmann, Hoffmann, Baer, Domingo
[241] Domingo, Baer, S.355
[242] Vgl.: Domingo, Baer, S.355
[243] Vgl.: Baer et al., S.422
[244] Vgl.: ebd., S.422
[245] Vgl.: Domingo, Baer, S.357
[246] Vgl.: Eikelmann et al., S.1110
[247] Vgl.: Hoffmann, S.215
[248] Vgl.: Angermeyer et al., 1999, S.56
[249] Vgl.: Baer et al., S.18 f.
[250] Vgl.: Baer et al., S.26 f.
[251] Vgl.: ebd., S.27 f.
[252] Vgl.: Baer et al., 463
[253] Vgl.: Baer et al., S.32 f.
[254] Vgl.: Angermeyer et al., 1999, S.57 f.
[255] Vgl.: Baer et al., S.33
[256] Vgl.: Angermeyer et al., 1999, S.58
[257] Vgl.: Möller-Leimkühler, S.50 ff.
[258] Vgl.: Rüesch, S.205 f.
[259] Vgl.: Priebe, S.219
[260] Hoffmann-Richter, 2003, S.354
[261] Vgl.: Knuf, 2005, S.7-10
[262] Vgl.: Herriger, S.11
[263] Vgl.: ebd., S.12 ff.
[264] Herriger, S.13
[265] Herriger, S.15
[266] Vgl.: Lauber, Rössler, S.212
[267] Vgl.: Herriger, S.52 ff.
[268] Vgl.: Lauber, Rössler, S.216
[269] Vgl.: Herriger., S.65 ff.
[270] Quindel, S.204
[271] Vgl.: Knuf, 2000a, S.40
[272] Vgl.: Herriger, S.51
[273] Vgl.: Herriger, S.72-80
[274] Vgl.: Lauber, Rössler, S.214
[275] Vgl.: Quindel, S.190
[276] Quindel, S.208
[277] Vgl.: Quindel, Herriger
[278] Quindel, S.210
[279] Vgl.: Rüesch, S.206 f.
[280] Vgl.: Degler-Erlenmaier, S.146 f.
[281] Vgl.: ebd., S.150 f.
[282] Vgl.: ebd., S.156
[283] Vgl.: Deger-Erlenmaier, S.152
[284] Vgl.: Rüesch, S.207 ff.
[285] Vgl.: Rössler, S.10
[286] Vgl.: Sartorius, S.245 ff.
[287] Vgl.: Baumann, Gaebel, S.249
[288] Vgl.: Baumann, Gaebel, S.250 f.
[289] Vgl.: Crisp, S.224 f.
[290] Vgl.: Rutz, S.219 ff.
[291] Vgl.: Bock, Naber, S.402 ff.
[292] Bock, Naber, S.404
[293] Vgl.: Bock, Naber, S.405 f.
[294] Vgl.: Meise et al., S.342
[295] Die Darstellung des Schulprojekts „Verrückt? Na und!“ basiert ausschließlich auf der Selbstdarstellung des Vereins „Irrsinnig menschlich e.V.“ im Internet
[296] Die Darstellung der Initiative „Irre menschlich“ basiert ausschließlich auf dem Erfahrungsbericht von Bock und Naber.
[297] Vgl.: Meise et al., S.343
[298] Vgl.: Bock, Naber, S.402
[299] Vgl.: Die Projektbeschreibung erfolgt ausschließlich aufgrund der Selbstdarstellung des BASTA e.V. im Internet
- Arbeit zitieren
- Meike Johannssen (Autor:in), 2006, Stigmatisierungserleben psychisch erkrankter Menschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110455
Kostenlos Autor werden


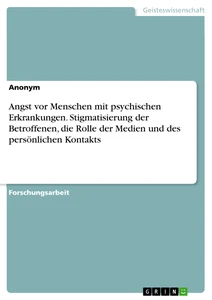









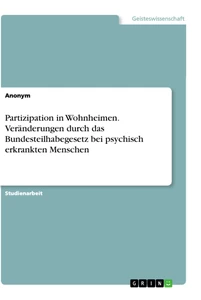




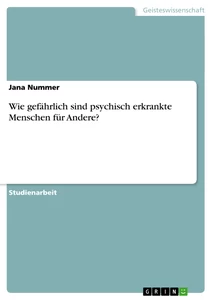

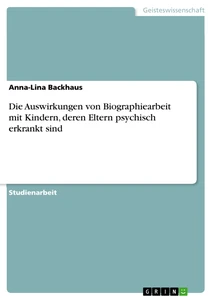
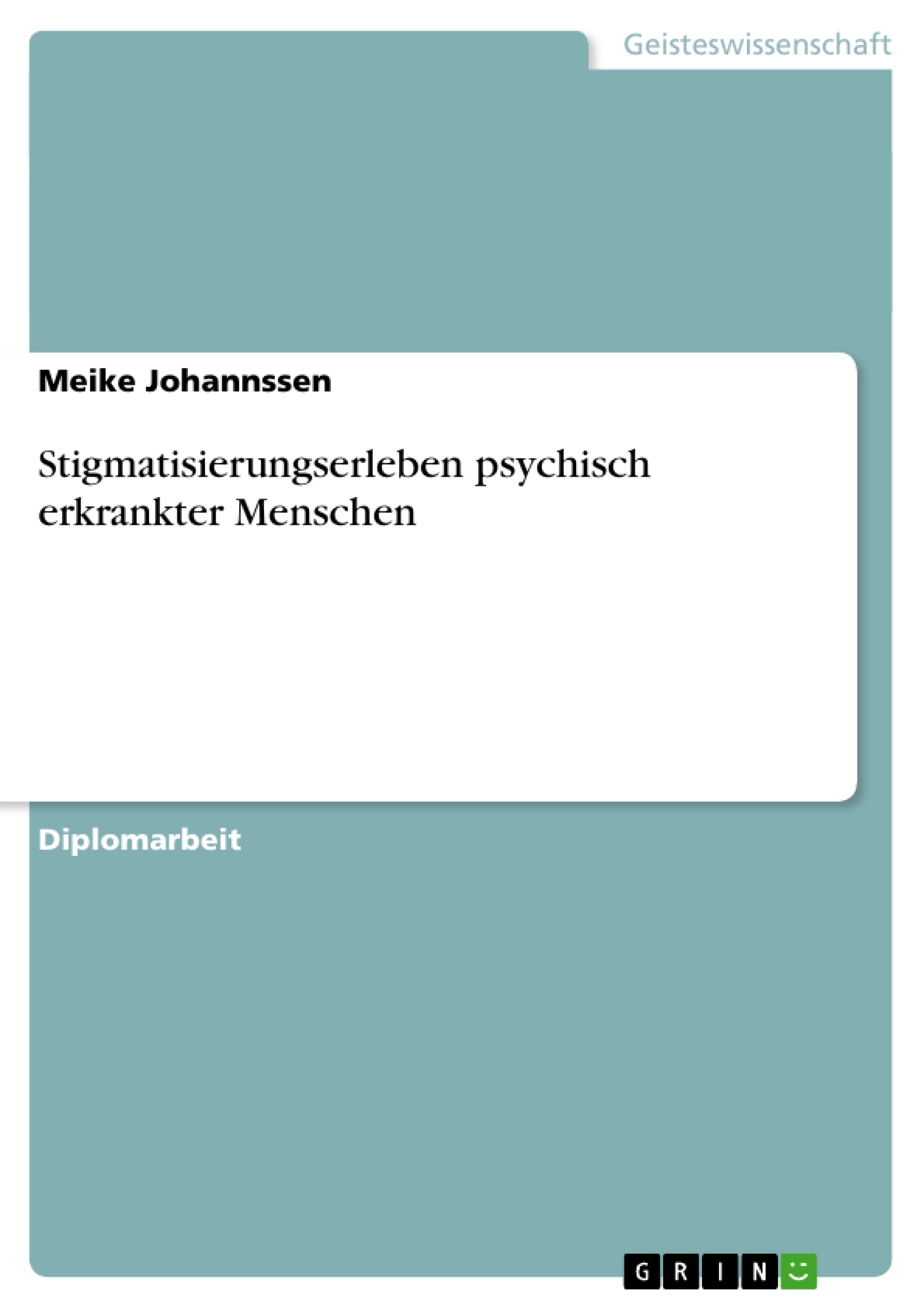

Kommentare