Leseprobe
Inhalt
1 Einleitung
2 Gesundheitswesen im gesellschaftlichen Umbruch
2.1 Demographische und krankheitsstrukturelle Veränderungen
2.2 Effekte sozialer Ungleichheiten
2.3 Globalisierungsfolgen
2.4 Sozialpolitischer Wandel
2.5 Schlussfolgerungen
3 Professionen und Medizin in der klassischen Soziologie: Talcott Parsons
3.1 Gesellschafts- und wissenschaftsgeschichtliche Kontexte
3.2 Grundzüge strukturfunktionalistischer Soziologie
3.3 Parsons’ Soziologie der Professionen
3.4 Strukturfunktionalistische Medizinsoziologie
3.5 Kritik an Parsons
3.6 Schlussfolgerungen
4 Aktuelle Soziologie der Professionen
4.1 Konzeptionelle Ausdifferenzierung
4.2 Machttheoretische Modelle
4.3 Neuere Systemtheorie
4.4 Oevermanns Ansatz
4.5 Inszenierungstheorien
4.7 Schlussfolgerungen
5 Eliot Freidson über Gesellschaft und Professionen
5.1 Freidsons Paradigma
5.2 „Professionalism. The Third Logic“
5.3 Freidson in der Diskussion
5.4 Schlussfolgerungen 6 Fazit und Ausblick Literatur
1 Einleitung
Das Politikfeld „Gesundheit“ ist, salopp formuliert, en vogue. Seit einigen Jah- ren herrscht kein Mangel an Diskussionen über Situation und Perspektiven des deutschen Gesundheitswesens. Seine Institutionen und Funktionsmechanismen sind zu einem wichtigen Gegenstand der öffentlichen Debatte avanciert. Das dürfte mit einer „Umbruchstimmung“ zu tun haben: Offenkundig ist die Auf- fassung weit verbreitet, dass die herkömmlichen Strukturen des Gesundheits- systems einem immensen Wandlungsdruck unterliegen. Besonders die „politi- sche Klasse“ scheint hiervon überzeugt zu sein. Mit dem Hinweis auf „gesund- heitspolitischen Handlungsbedarf“ ergreift sie in jüngster Zeit eine Reihe von Maßnahmen zur Umgestaltung des Gesundheitswesens.
Die Veränderungen des Gesundheitswesens tangieren natürlich auch die Ge- sundheitswissenschaften. Sie werden in Forschung und Lehre sehr unmittelbar mit dem „unruhigen“ Gesundheitssystem konfrontiert. Daraus können interes- sante Analysen und Diskussionen erwachsen. Es besteht aber auch die Gefahr, von der gesundheitspolitischen Hektik angesteckt zu werden und zu wenig Dis- tanz zu den Rezepten der „großen Politik“ und der Massenmedien zu wahren. Umso notwendiger ist es, dass in den Gesundheitswissenschaften Platz bleibt für die eingehende Beschäftigung mit den Verschränkungen zwischen der Ge- sellschaft und ihrem System der Gesundheitsversorgung.
Die vorliegende Arbeit will dazu einen (kleinen) Beitrag leisten. Ihr Augen- merk gilt einer sozialen Gruppe, die mit der Genese der neuzeitlichen Medizin zu einem institutionellen Kernstück der Krankenbehandlung aufstieg: nämlich den Ärztinnen und Ärzten. Was sind typische Handlungsmuster der ärztlichen Profession? Mit welchen Veränderungen in Gesellschaft und Gesundheitssys- tem wird sie konfrontiert? Wie ist es um Gestaltungsmacht und Perspektiven dieses „Berufsstands“ bestellt? Kann überhaupt von einer homogenen Ärzte- schaft gesprochen werden?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, gliedert sich die Magisterarbeit in drei größere Blöcke. Den Auftakt bildet ein Kapitel mit starkem Bezug zur sozialwissenschaftlich geprägten Gesundheitssystemforschung. Es zielt darauf ab, ökonomisch-soziale Rahmenbedingungen der Versorgungs- und Arbeits- strukturen im Gesundheitswesen darzustellen. Eingegangen wird zum Beispiel auf demographische Veränderungen und auf die viel diskutierten Auswirkun- gen der Globalisierung. Dann folgt ein Block, der im Schnittfeld von Medizin- und Professionssoziologie angesiedelt ist. Er setzt sich seinerseits aus zwei Kapiteln zusammen. Zunächst wird ein „soziologischer Klassiker“ beleuchtet: Talcott Parsons. Eine Auseinandersetzung mit seiner strukturfunktionalistisch inspirierten Gesellschaftsanalyse dürfte sich als lohnend erweisen, denn profes- sions- und medizinsoziologische Themen nehmen im Parsons’schen Oeuvre eine überaus wichtige Rolle ein. Parsons’ Sicht professionellen und ärztlichen Handelns beeinflusst bis in die Gegenwart hinein sozialwissenschaftliches Denken. Das tritt deutlich hervor, wenn die Magisterarbeit auf die aktuelle Pro- fessionssoziologie, ihre Positionen und ihre gesundheitswissenschaftlich be- deutsamen Fragestellungen und Forschungsfelder zu sprechen kommt. Der dritte Block hat den Charakter einer Buchkritik. Er widmet sich Eliot Freidsons
„Professionalism. The Third Logic“ – einer Veröffentlichung, in der einer der
„Altmeister“ der internationalen Medizinsoziologie seine Überlegungen zur Bedeutung und Zukunft der professionals entfaltet. Es soll untersucht werden, welche Impulse die 2001 erschienene Publikation für die professionssoziologi- sche Perspektivdebatte zu liefern vermag.
Die Magisterarbeit ist sich im Klaren darüber, dass der Anwendungs- und Pra- xisbezug konstitutiv für das gesundheitswissenschaftliche Selbstverständnis sind. Trotzdem wird die Leserin und der Leser dann und wann auf Abschnitte stoßen, wo ein zunächst vielleicht theorielastig wirkender „Soziologenjargon“ zum Einsatz gelangt. Dies geschieht nicht aus einer prinzipiellen Abneigung gegen handlungsorientierte Lehre und Forschung. Im Gegenteil: Dieser Studie liegt die Annahme zugrunde, dass eine Stärkung des soziologischen Standbeins der Gesundheitswissenschaften ihrem curricularen und diagnostischen Profil zu Gute kommt.
2 Gesundheitswesen im gesellschaftlichen Umbruch
2.1 Demographische und krankheitsstrukturelle Veränderungen
In der Endphase des 19. Jahrhunderts setzte in vielen Ländern West- und Kern- europas ein rascher Wandel der Bevölkerungsstrukturen ein. Er hängt zusam- men mit einer deutlichen Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung. Sie belief sich 1872, als das „Statistische Zentralamt des Deutschen Reiches“ gegründet wurde, in Deutschland auf weniger als 40 Jahre. Männer wurden etwa 36 Jahre alt, Frauen knapp 39 Jahre. Heute haben männliche Neugeborene eine Lebenserwartung von etwa 75 Jahren. Neugeborene Mädchen werden, wie ein Blick in aktuelle Übersichten des Statistischen Bundesamtes zeigt, hier zu Lande im Durchschnitt über 81 Jahre alt (vgl. Statistisches Bundesamt 2004; vgl. auch Kolip 2002: 8 f.).
Das Ansteigen der Lebenserwartung verdankt sich mehreren Umständen. Eine wichtige Rolle spielten die Durchsetzung hygienischer Standards und die Ver- besserung der Lebensmittelqualität. Von großer Relevanz waren außerdem medizinische Fortschritte und die Entstehung einer umfassenden Gesundheits- versorgung, eingebettet in einen sukzessiven Ausbau sozialer Sicherungssys- teme. Diese Trends bewirkten nicht nur ein Zurückdrängen ehemals tödlicher Krankheiten und Seuchen wie Cholera und Typhus. Sie schlugen sich auch in einer gravierenden Verringerung der Säuglings- und Kindersterblichkeit im Laufe des 20. Jahrhunderts nieder: „Zu Beginn des Jahrhunderts starben in Deutschland noch 17 % aller weiblichen und 20 % aller männlichen Neugebo- renen. Gegen Ende des Jahrhunderts haben sich die Sterblichkeitsraten auf 0,5 % verringert. Auch die Kindersterblichkeit (bis 15 Jahre) ist im gleichen Zeit- raum von etwa 8 % auf unter 0,4 % zurückgegangen.“ (Gerber/von Stünzner 1999: 18)
Einen anderen Verlauf als die Lebenserwartung zeigt die Fertilitätsrate. In zahlreichen Ländern der „Ersten Welt“ werden heute erheblich weniger Kinder geboren als vor 100 Jahren. Der Umfang der Gesamtbevölkerung stagniert, während ihre altersmäßige Zusammensetzung sich zu Gunsten der Seniorinnen und Senioren verschiebt. Gerade die Bundesrepublik liefert anschauliches Zah- lenmaterial dafür, wie die Alterspyramide gleichsam auf den Kopf gestellt wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2005). Im Jahr 1985 war ein Fünftel ihrer Bevöl- kerung mindestens 60 Jahre alt. Der Anteil derjenigen, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, belief sich auf etwa 24 Prozent. Als das 20. Jahr- hundert zu Ende ging, ließ sich ein umgekehrtes Bild beobachten: Die mindes- tens 60-Jährigen machten im Jahr 2000 knapp 24 Prozent der Gesamtbevölke- rung aus. Demgegenüber sank der Anteil der Vergleichsgruppe auf circa 21 Prozent. Demographische Prognosen schätzen, dass sich dieser bevölkerungs- strukturelle Alterungsprozess in Deutschland – trotz vermutlich wachsender Zuwanderung junger Personen – in den nächsten drei bis vier Dekaden mit zügigem Tempo fortsetzen wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2003). Der An- teil der unter 20-Jährigen geht nach den Berechnungen des Statistischen Bun- desamtes auf 16 Prozent im Jahr 2050 zurück. Die Gruppe der mindestens 60- Jährigen wird dann mehr als doppelt so groß sein (37 Prozent) und 28 Millio- nen Menschen umfassen. Derzeit gehören dieser Altersgruppe in Deutschland etwa 20 Millionen Personen an.
Die Krankheitshäufigkeit differiert altersspezifisch. Seniorinnen und Senioren sind öfter krank als junge Menschen. Konstatierbar ist überdies, dass chroni- sche Erkrankungen und Multimorbidität bei Älteren deutlich häufiger auftreten als im Bevölkerungsdurchschnitt. Folgerichtig vollzieht sich ein Wandel des Morbiditätsprofils. Vor 100 Jahren dominierten Infektions- und Akutkrankhei- ten das Krankheits- und Todesursachenspektrum. Sie haben mittlerweile an Bedeutung verloren durch die Ausdehnung von Krankheiten wie: Diabetes mellitus, Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, bösartige Neubildungen, Schädigungen des Bewegungsapparats und psychisch manifestierte Leiden.
Durch ein individualmedizinisch geprägtes Versorgungssystem sind solche chronisch-degenerativen Erkrankungen nur unzulänglich in den Griff zu be- kommen: „Sie sind nicht heilbar im klassischen Sinn. Zwar kann die kurative Medizin Linderung der Beschwerden und Symptome erreichen – eine Heilung im Sinne einer vollständigen Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und der gesundheitlichen Lebensqualität ist im allgemeinen jedoch nicht oder nur in eingeschränktem Umfang möglich.“ (Gerber/von Stünzner 1999: 20)
Wenn von „Kostenexplosionen“ im Gesundheitswesen die Rede ist, werden zur argumentativen Untermauerung oft die bevölkerungs- und krankheitsstrukturel- len Transformationen angeführt. Ob diese Faktoren aber tatsächlich eine finan- ziell kaum bewältigbare Zunahme der Zahl und der Schwere der Erkrankungen bewirken, ist in epidemiologischen Kreisen umstritten (vgl. Kolip 2002: 10 f.). Untersuchungen zeigen nämlich, dass wesentliche Teile der Gesundheitsausga- ben in den beiden letzten Lebensjahren vor dem Tod anfallen – unabhängig vom Alter. Die Zunahme der Lebenserwartung bedeutet also offenbar nicht automatisch eine Zunahme der von Krankheit gezeichneten Lebensjahre, zumal sich auch das Auftreten diverser Erkrankungen chronisch-degenerativen Typs anscheinend im Zuge des Älterwerdens „nach hinten“ verlagert. Nach Ansicht zahlreicher gesundheitswissenschaftlicher Studien wäre es obendrein möglich, die finanziellen Herausforderungen des veränderten Krankheitsspektrums durch salutogenetisch geprägte Gesundheitspolitik zu entschärfen: „Theore- tisch ließen sich – bei nicht saldierter und nicht diskontierter Betrachtung – durch konsequent betriebene Prävention langfristig etwa 25 Prozent der heute für die Versorgung von chronischen Krankheiten aufgewendeten Ressourcen einsparen.“ (Rosenbrock/Gerlinger 2004: 41)
Eng verzahnt mit dem „Überalterungsdiskurs“ sind schlagzeilenträchtige Sze- narien zu den finanziellen Auswirkungen des medizintechnischen Wandels. Ihm wird in einer Reihe von Publikationen mit beträchtlicher massenmedialer Resonanz eine kostentreibende Eigendynamik zugeschrieben (vgl. etwa Krä- mer 1993). Diese technizistische Sichtweise ist aber nicht ohne Widerspruch geblieben.
So wird darauf hingewiesen, dass durch kritische Wirkungsforschung und transparentere Planung eine finanziell tragbare Steuerung des „medizinisch- technischen Fortschritts“ möglich wäre. Außerdem ist die Rede von Kosten sparenden Potenzialen neuer Behandlungsmethoden: „Dank der Entwicklung in der mikroinvasiven Chirurgie und der Anästhesie können heute beispiels- weise Eingriffe ambulant oder teilstationär durchgeführt werden, die vor Jahren noch mit einem wochenlangen Krankenhausaufenthalt verbunden waren.“ (Deppe 2000: 222; vgl. auch Braun u.a. 1999: 41 ff.)
Die Dramatisierung des demographischen und technischen Wandels birgt die Gefahr, andere gesundheitswissenschaftlich relevante Faktoren gesellschaftli- cher Entwicklung außer Acht zu lassen. Deshalb empfiehlt es sich, zusätzlich zum Betrachten von Alterspyramiden auch einen Blick auf die neueren Ergeb- nisse aus dem Spektrum der epidemiologischen Forschung zu werfen, wo Zu- sammenhänge zwischen Klassen-/Schichtzugehörigkeit und gesundheitlichem Status unter die Lupe genommen werden.
2.2 Effekte sozialer Ungleichheiten
„Wirtschaftswunder“ und sozialstaatliche Expansion schienen in den kapitalis- tischen Kernländern eine sozialstrukturelle Nivellierung hervorzurufen. Es deu- tete einiges darauf hin, dass sich die Lebensweisen und Einstellungsmuster quer durch alle Bevölkerungsschichten angleichen. In der Soziologie wurden die Stimmen lauter, die einen Abschied von klassischen Konzepten der Un- gleichheitsforschung proklamierten. Die Kritik bezog sich vor allem auf die Marx’sche Klassentheorie, aber auch Max Webers Sicht des okzidentalen Ka- pitalismus galt vielen als obsolet (vgl. Ritsert 1998: 88 ff.). Davon blieb auch die Medizinsoziologie nicht unberührt. In den 1950er und 60er Jahren wurde klassen- und schichtspezifischen Einflüssen auf Gesundheit wenig Beachtung geschenkt. Man unterstellte, ganz im Einklang mit dem damaligen Mainstream makrosoziologischer Theoriebildung, das Verblassen vertikaler Ungleichheiten zu Gunsten einer „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ (vgl. Deppe 1978).
Die Befunde der sozialepidemiologischen Forschung lassen Zweifel an der Validität solcher Annahmen aufkommen. In der Bundesrepublik, wo der Zu- sammenhang von sozialer Ungleichheit und Gesundheitszustand seit Mitte der 1970er Jahre wieder auf ein verstärktes wissenschaftliches Interesse stößt, konnte in verschiedenen Untersuchungen eine schichtenspezifische Variabilität der Krankheitshäufigkeit festgestellt werden (vgl. Helmert 2003). Diese Beo- bachtung deckt sich mit den Resultaten neuerer Untersuchungen in Deutsch- land vergleichbaren Ländern. Die Zugehörigkeit zu sozialen Schichten – zu- meist gemessen an Indikatoren wie Bildung, Einkommen und Stellung im Be- ruf – entscheidet nach wie vor in starkem Maße über die Erkrankungs- und Sterbehäufigkeit. Auch in den ökonomisch stärksten Regionen der Erde gilt demzufolge weiterhin die Regel: Je höher der soziale Status, desto bester der Gesundheitszustand und desto höher die Lebenserwartung.
Dass sich die sozialstrukturelle Position als so bestimmend für Morbiditäts- und Mortalitätsdaten erweist, bringt erheblichen Erklärungsbedarf mit sich. Das Gros der hoch industrialisierten Länder ist durch ein Gesundheitssystem gekennzeichnet, „das zumindest formell gleiche Zugangsbedingungen für alle Menschen eröffnet und allen Menschen ohne Ansehen des sozialen Status durch ein ausgebautes Sozialversicherungssystem eine optimale Versorgung im Krankheitsfall ermöglicht“ (Bauch 2000a: 145). Die institutionelle Logik und Reichweite des medizinischen Versorgungsangebots hat demnach einen eher geringen Einfluss auf das sozialepidemiologische Profil einer Bevölkerung. Ein größeres Gewicht besitzt anscheinend das vom sozialen Status abhängige Ge- sundheitsverhalten. Charakteristisch für Angehörige der Unterschicht und der unteren Mittelschichten ist ein instrumentelles Körperverständnis. Gesund- heitsriskante Lebensstile sind – wie empirisches Material zum Zigaretten- und Alkoholkonsum oder zu Ernährungsgewohnheiten nachweist – hier häufiger anzutreffen als in den „besseren Schichten“. Gleichzeitig zeigen eine Reihe von Analysen, dass Personen mit geringem Ausbildungsniveau Probleme mit den organisationskulturellen Eigenheiten des Gesundheitswesens haben, ver- gleichsweise selten medizinische Dienstleistungen in Anspruch nehmen und Vorsorgeuntersuchungen meiden (vgl. Deppe 2000: 200 ff.).
Freilich darf auch einem ungesunden Lebensstil keine allzu große Bedeutung für Morbiditäts- und Mortalitätsmerkmale beigemessen werden: „So fand die berühmte englische Längsschnitt-Studie ‚Whitehall Study‘ heraus, daß Staats- bedienstete der untersten Rangstufe vier mal häufiger an koronaren Herzer- krankungen erkranken als Beamte an der Hierarchiespitze. Zwar wies die unte- re Schicht in höherem Maße verhaltensabhängige Risikofaktoren auf, aber nachdem diese Faktoren statistisch neutralisiert waren, war die Morbidität der unteren Schicht noch immer dreimal höher als die der oberen Schicht.“ (Kühn 1998: 266) Nicht nur das Gesundheitsverhalten hängt von der sozialökonomi- schen Position ab, sondern auch der Effekt gesundheitlich bedeutsamer Hand- lungsmuster. Salopp ließe sich formulieren, dass reiche Raucherinnen und Raucher länger leben als arme Raucherinnen und Raucher (vgl. Bauch 2000a: 141 f.).
Offenkundig wird der gesundheitliche Status maßgeblich durch die interaktiven Dynamiken in mikrosozialen Settings bestimmt. Sie sind mit einem verhaltens- fixierten Blickwinkel, der den stratifikatorischen und habituellen Differenzie- rungen in Kommunen, Bildungseinrichtungen und Betrieben wenig Beachtung schenkt, nicht hinreichend zu erfassen. Den konkreten Handlungsfeldern der
„kleinen Leute“ scheinen oft Strukturkomponenten eingeschrieben zu sein, die als pathogene „Stressoren“ wirken und – ungeachtet des jeweiligen Gesund- heitsverhaltens – von erheblicher Bedeutung für den individuellen Gesund- heitszustand sind. Ein großes Gewicht wird insbesondere den Arbeitsbedin- gungen attestiert. Wenn Arbeitskräfte mit hohen quantitativen Anforderungen konfrontiert und ihnen zugleich wenig arbeitsorganisatorische Partizipations- möglichkeiten eingeräumt werden, gedeiht der „Job-Strain-Effekt“. Er mani- festiert sich häufig in Stressgefühlen und Hypertonie – vor allem bei einem Mangel an krankheitsprotektiven Netzwerken: Gehen belastende Arbeitsbedin- gungen einher mit Mobbingerfahrungen, mit familiären Problemen oder mit instabilen Freundeskreisen, potenzieren sich Erkrankungs- und Sterberisiken (vgl. Badura/Feuerstein 2001: 370 f.)
Die Hartnäckigkeit sozialer Disparitäten in der Gesundheitlichkeit löste eine Kritik an Vorbeugungsprogrammen aus, für die eine verhaltensorientierte Sichtweise und eine Anlehnung an das biomedizinisch geprägte Risikofakto- renmodell kennzeichnend sind. Ihnen wird angekreidet, schichtspezifische Ge- sundheitsdifferenzen eher noch zu verstärken. Als Beispiel dienen oft die ein- schlägigen Präventionsangebote der Krankenkassen, an denen überproportional viele Personen teilnehmen, die aus Bevölkerungsschichten mit vergleichsweise geringen Gesundheitsbelastungen und Erkrankungsrisiken stammen (vgl. Ro- senbrock/Gerlinger 2004: 64 f.). Diese kontraintentionalen Effekte klassischer Gesundheitserziehung verstärkten in den letzten Jahren den Ruf nach einer Neuorientierung der Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland. Viele gesundheitswissenschaftlich inspirierte Vorschläge stimmen, trotz Mei- nungsverschiedenheiten in begrifflichen und typologischen Fragen, letztlich darin überein, dass Gesundheitspolitik interdisziplinärer und näher an den Le- benswelten agieren sollte. Das salutogenetische Potenzial dieser Interventions- strategie gilt als beträchtlich. Hingewiesen wird dabei gern auf Erfahrungen bei der Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz: „Hier zeigt sich, daß ernsthafte Versuche, die Krankheitsbelastung der unteren Sozialschichten zu reduzieren, eine rein gesundheitspolitische und medizinische Orientierung aufgeben müs- sen. Krankheitsprävention für soziale Unterschichten mündet in Gesellschafts- politik. Die von der Medizinsoziologie dargelegten Konzepte zeigen viele er- folgversprechende Ansatzpunkte insbesondere im Bereich der Organisation der Arbeitswelt. Statusinkonsistenz, Kontrollverlust, Gratifikationskrisen können durch moderne Arbeitsorganisation wenn nicht abgeschafft so doch in ihren pathologischen Auswirkungen minimiert werden.“ (Bauch 2000a: 145)
Das Umsetzen neuer Vorstellungen zur Präventionspolitik in die Praxis erweist sich allerdings als ein komplizierter Vorgang. Er ist nicht bloß – hier sei an die gegenwärtigen Konflikte um das Präventionsgesetz erinnert – tages- und wahl- politischen Taktiken der konkurrierenden Parteien ausgesetzt. Relevant für die Wirksamkeit salutogenetisch orientierter Gesundheitsförderung sind überdies
allgemeine und längerfristige Tendenzen in der Sozial- und Gesundheitspolitik. In neueren Analysen dieser Politikfelder nimmt, wenn ökonomische und politi- sche Makrotrends zur Sprache kommen, das Thema „Globalisierung“ viel Platz ein. Es erscheint somit ratsam, diesem Phänomen auch im Rahmen dieser Stu- die Aufmerksamkeit zu widmen.
2.3 Globalisierungsfolgen
Über Globalisierung wird im Moment viel geredet und geschrieben. Beim Ver- such, sich einen fundierten Überblick über dieses Thema zu verschaffen, sind allerdings Schwierigkeiten vorprogrammiert. Die Globalisierungsdebatte prä- sentiert sich sehr verworren, denn ihr Thema berührt gegensätzliche Interessen. Hinter vermeintlich „objektiven“ Thesen über Globalisierung und ihre Effekte verbergen sich zumeist handfeste strategische Kalküle. „Es nützt der je eigenen Position, wenn man die Effekte der Globalisierung überzeugend groß- oder kleinredet.“ (Ganßmann 2000: 162) Folglich weist die Diskussion über dieses Politikum eine große Bandbreite an Positionen auf. Sie reicht von alarmisti- schen Szenarien, in denen die Globalisierung zu einer unentrinnbaren Natur- gewalt stilisiert wird, bis hin zu Beiträgen, die dieses Phänomen wie einen weitgehend wirkungslosen Papiertiger erscheinen lassen.
Diverse Diskussionsbeiträge, die zwischen diesen Extremen angesiedelt sind, legen Vorsicht bei der Einschätzung des Globalisierungsprozesses an den Tag. Sie warnen davor, alle „Probleme“, mit denen die Tagespolitik konfrontiert wird, ausschließlich der Globalisierung anzulasten. Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass eine Analyse der Tendenzen in Richtung „Weltgesellschaft“ wichtige Erklärungen liefern kann für die sozialökonomischen Veränderungen, die vielerorts beobachtbar sind (vgl. Sablowski 2001). So gilt die Globalisie- rung als eine relevante Triebfeder arbeits- und beschäftigungsstrukturellen Wandels in den reichen Ländern: Die verstärkte Konkurrenz von Niedriglohn- ländern hat zur Folge, dass vor allem Lohnabhängige mit eher geringem Quali- fikationsniveau unter Druck geraten. Ihr Risiko, entlassen zu werden, erhöht sich.
Damit einher geht in vielen Beschäftigungsfeldern eine Verschlechterung der Entlohnungs- und arbeitsrechtlichen Standards. Tarifvertraglich eingebettete und materielle Sicherheiten verbürgende „Normalarbeitsverhältnisse“, die lan- ge Zeit das Gesicht des „Modell Deutschland“ prägten, büßen in einem zuneh- mend flexibilisierten und deregulierten Beschäftigungssystem an Bedeutung ein.
Die sozialstaatlichen Sicherungssysteme drohen vor diesem Hintergrund in ein existenzgefährdendes Dilemma zu geraten. Ihr Einnahmevolumen wird durch anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und die Zunahme von atypischen Beschäfti- gungsformen mit geringem Beitragsaufkommen verschlechtert. Um weiterhin handlungsfähig bleiben zu können, müssen die verbliebenen Beitragszahlerin- nen und -zahler stärker belastet werden – mit der Konsequenz steigender Lohnnebenkosten. Daran nehmen nicht nur diejenigen Anstoß, die medien- wirksam über angeblich zu hohe Arbeitskosten und zu viel „Sozialklimbim“ im Wirtschaftsraum Deutschland lamentieren. Die Finanzierung der Sozialversi- cherungen wird auch für die abhängig Beschäftigten zum Problem, wird doch „die cost-benefit-Bilanz bei pro Kopf wachsenden Beitragslasten und sinken- den oder stagnierenden Leistungen immer schlechter“ (Ganßmann 2000: 150).
Globalisierung scheint aber nicht bloß die staatlich organisierten Sozialversi- cherungen unter Druck zu setzen, sondern Finanzierungsbasis und Gestal- tungsmacht des politischen Systems im Allgemeinen zu unterminieren. So zei- gen vergleichende Analysen staatlicher Finanzpolitiken, dass sich eine interna- tionale Konkurrenz der Steuersysteme etabliert hat. Um global operierendes Kapital zu attrahieren, wird vielerorts die steuerliche Belastung von Unterneh- men und vermögenden Bevölkerungsschichten mitunter erheblich reduziert. Weil der dadurch erhoffte ökonomische Wachstumsschub aber oft auf sich warten lässt, verschärfen sich die fiskalischen Probleme gerade der Wirt- schaftsstandorte mit einer breit gefächerten und finanziell aufwändigen öffent- lichen Infrastruktur. Plastisches Anschauungsmaterial liefern eine Reihe deut- scher Städte und Gemeinden: Aufgrund ihrer schwierigen Haushaltslage sehen sich die lokalen Administrationen gezwungen, im Bereich sozialer und kultu- reller Dienstleistungen den Rotstift anzusetzen.
Die Chancen für ein kommunales Setting, das den Vorstellungen moderner Gesundheitsförderung nahe kommt, dürften sich dadurch merklich verschlech- tern.
Beachtenswert sind auch die Auswirkungen der Globalisierung auf betriebliche Settings. Der Konkurrenzdruck für die Unternehmen nimmt zu. Im Manage- ment greift deshalb – geradezu zwangsläufig – eine gegenüber früheren Zeiten noch rigidere Shareholder Value-Orientierung um sich. Dies wiederum trägt nicht nur zur Verschärfung der schon erwähnten arbeitsmarktlichen Krisen bei. Die aktuellen Managementkonzepte bedingen überdies, dass die Hoffnungen auf salutogene Wirkungen neuer Formen der Arbeitsorganisation und der Un- ternehmenskultur so manches Mal enttäuscht werden. Neben einen nach wie vor hohen Sockel klassischer Arbeitsbelastungen (etwa durch Schichtarbeit oder starke Beanspruchung des Bewegungsapparats) treten eine Fülle von Be- lastungen, die Beeinträchtigungen der mentalen und psychisch-emotionalen Gesundheit mit sich bringen (vgl. Rosenbrock/Gerlinger 2004: 71 ff.).
Sehr direkte Auswirkungen auf Funktionsmechanismen des hiesigen Gesund- heitswesens zeitigt die Globalisierung kommunikationstechnologischer Instru- mente. Es entstehen weltweite Informationsnetze, die Raum- und Zeitdimensi- onen relativieren und ein global village konstituieren, in dem medizinische Forschungsergebnisse und Informationen über Therapieangebote sich sehr schnell über die ganze Welt ausbreiten. Mit Hilfe des Internet ist es möglich, einen Überblick über den transnationalen Markt gesundheitlicher Dienstleis- tungen zu erlangen. Folglich erfährt der „Gesundheitstourismus“ einen be- trächtlichen Auftrieb: Vermögende Bevölkerungsschichten aus Ländern der Peripherie suchen Kliniken mit „exzellentem Ruf“ in den kapitalistischen Kernländern auf. Unterdessen nutzen viele hier beheimatete Normalverdiener das europäische West-Ost-Preisgefälle, um sich zum Beispiel preiswert zahn- medizinisch in Polen oder Ungarn behandeln zu lassen.
Die gestiegene Mobilität der Nutzerinnen und Nutzer medizinischer Dienstleis- tungen korrespondiert mit zunehmend ortsunabhängigen und wanderungsfähi- gen Gesundheitsberufen. Das betrifft sowohl nichtärztliche als auch ärztliche Tätigkeitsfelder, denn eine Globalisierung lässt sich nicht nur mit Blick auf die Produktion von Heil- und Hilfsmitteln beobachten. Medizinische Diagnose und Behandlung wird ebenfalls immer stärker in die Informations- und Konkur- renzmechanismen eines weltweiten Gesundheitsmarktes eingebunden. „Fern- und Tele-Diagnosen werden möglich, Supervisionen und Beratungen vom an- deren Ende der Welt, telekommunikative Assistenz bei kurativen Eingriffen und Operationen sind weltweit abrufbar, ‚Hitlisten‘ der weltweit besten Klini- ken und Ärzte sind erstellbar.“ (Bauch 2000a: 72) Nationale Unterschiede in der Regulierung und Bezahlung ärztlichen Handelns werden vermutlich durch die Globalisierung der Gesundheitsversorgung sukzessive eingeebnet. Das ge- genwärtige Erodieren korporatistisch gestützter Honorarstrukturen und Preis- gestaltungsmechanismen im deutschen Gesundheitssystem fügt sich in dieses Bild. Es ist ein Indiz dafür, dass Globalisierung mitnichten nur die großen Un- ternehmen und Märkte betrifft, sondern auch auf Felder und Verästelungen des gesellschaftlichen Ganzen einwirkt, die – siehe Gesundheitswesen – gemeinhin als wohlfahrtsstaatliches Terrain gelten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, einen Blick auf aktuelle Handlungsmuster staatlicher Sozial- und Gesundheits- politiken zu werfen.
2.4 Sozialpolitischer Wandel
Die Globalisierung der Ökonomie ist eng verquickt mit Verschiebungen des politisch-kulturellen Koordinatensystems. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in zahlreichen Ländern der „Ersten Welt“ zu einer „Sozialdemokratisierung“ des Kapitalismus. Ein keynesianisch orientierter Politikansatz, der auf eine wohlfahrtsstaatliche Einbettung und Zügelung des Marktgeschehens abzielte, erschien quer durch die großen politischen Lager als Garant für ökonomische und soziale Stabilität. Marktliberales Gedankengut geriet in die Defensive, wirkte fast wie ein Fossil aus frühkapitalistischen Zeiten, um dann aber im Laufe der 1970er Jahre eine Renaissance zu erleben.
Das „sozialkapitalistische“ Gesellschaftsmodell geriet nämlich angesichts wachsender konjunktureller und arbeitsmarktlicher Probleme in Finanz- und Legitimationsschwierigkeiten.
Mit dieser Krise setzten sich in der Weltwirtschaft neue Strukturen durch. Das internationale Finanzsystem wurde weitgehend dereguliert und bildete danach die Grundlage für den Globalisierungsprozess der 1980er und 90er Jahre. Es entstand, zusätzlich beschleunigt durch den Niedergang der staatssozialisti- schen Gesellschaftsordnungen, ein kapitalistisches Weltsystem, das geschützte oder politisch moderierte Wirtschaftsräume, wie sie für die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg typisch waren, zum Verschwinden brachte. Damit ent- fiel eine wichtige Voraussetzung keynesianischer Gesellschaftspolitik. Sie büß- te ihre hegemoniale Stellung ein zu Gunsten wirtschaftsliberaler Strategien, die eine auf Wettbewerb und Markt setzende Standortpolitik als adäquate Antwort auf den „Sachzwang“ Weltmarkt betrachten.
In den Utopien der marktliberalen Philosophie findet sich die Vision vom „mi- nimalen Staat“, der sich darauf beschränken soll, durch Justiz und Polizei das Privateigentum zu sichern. Sozialpolitik fällt unter das Verdikt, der eigentlich freiheits- und prosperitätsfördernden invisible hand der Marktökonomie ins Handwerk zu pfuschen. Dennoch ist bisher in keinem kapitalistischen Kernland der Wohlfahrtsstaat als ganzer zur Disposition gestellt worden. „Das geht noch nicht einmal in den USA und am wenigsten bei den große Teile der Wähler- schaft berührenden Programmen der Alters- und Krankenversorgung.“ (Ganß- mann 2000: 160) Was sich aber seit einigen Jahren beobachten lässt, ist eine Tendenz in Richtung eines „residualen Sozialstaats“, der eine Minimalabsiche- rung gegen soziale Risiken bietet, darüber hinausgehende Leistungen aber pri- vatisiert. Dies bedeutet nicht nur eine Kostenentlastung der über Steuern oder Sozialversicherungsabgaben an der Finanzierung des Sozialstaats beteiligten Unternehmen. Da private Krankheits- und Altersvorsorge auf dem Kapital- markt stattfindet, ergeben sich obendrein lukrative Anlagefelder für die Versi- cherungs- und Investmentbranche (vgl. Heinrich 2001).
Es fällt schwer zu prognostizieren, wie weit die Privatisierung des Sozialstaats gehen wird. Dieser Prozess vollzieht sich, trotz aller strukturellen Wucht des globalisierten Kapitalismus, nicht gleichsam naturgesetzlich, sondern unter den Bedingungen eines keineswegs widerspruchsfreien soziopolitischen Felds: Ei- nerseits sind offenbar marktanaloge Handlungsorientierungen in Deutschland und vergleichbaren Ländern auf dem Vormarsch. Folgerichtig mangelt es nicht an Anhaltspunkten, dass „unternehmerisches Denken“ in alle gesellschaftlichen Poren eindringt und sich anschickt, den Status einer alternativlosen „Alltagsre- ligion“ zu erlangen. Auf der anderen Seite zeigen aber demoskopische Unter- suchungen neueren Datums eine weiterhin hohe Akzeptanz der sozialen Siche- rungssysteme in den Einstellungsmustern der Wählerinnen und Wähler. Selbst die immer noch recht „marktfernen“ Versorgungsprinzipien der Gesetzlichen Krankenversicherung erfreuen sich trotz des marktliberalen Zeitgeists nach wie vor beträchtlicher Wertschätzung (vgl. Ullrich 2005: 184 ff.). Der solidarkultu- relle Unterbau des Wohlfahrtsstaats scheint noch nicht so weit zerbröckelt zu sein, wie es in der Medien- und Wissenschaftslandschaft häufig suggeriert wird.
2.5 Schlussfolgerungen
Das Gesundheitswesen ist ein gesellschaftliches Subsystem, das nicht gewis- sermaßen autark agiert. Es ist stark umweltabhängig. Basale Elemente der bis- weilen sehr „unruhig“ anmutenden demographischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse setzen die Mechanismen gesundheitlicher Versor- gung unter Legitimations- und Wandlungsdruck. Das heißt, dass auch professi- onelle Tätigkeiten im Gesundheitswesen eingebunden sind in die Dynamiken sozialer Prozesse und Kräftespiele. Um Zusammenhänge zwischen gesamtge- sellschaftlichen Entwicklungen auf der einen Seite und den in dieser Studie besonders interessierenden Strukturmustern ärztlichen Handelns andererseits besser erfassen zu können, drängt es sich geradezu auf, Theorien und Befunde aus dem Bereich der Soziologie der Professionen zu beleuchten.
3 Professionen und Medizin in der klassischen Soziologie: Talcott Parsons
3.1 Gesellschafts- und wissenschaftsgeschichtliche Kontexte
Professionen zählen zu den klassischen Objekten sozialwissenschaftlicher For- schung. Von einer wirklich etablierten und traditionsreichen Professionssozio- logie kann mit Blick auf den deutschen Sprachraum allerdings nicht gespro- chen werden. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Professionen und Pro- fessionalisierung war lange Zeit eine fast ausschließlich angloamerikanische Domäne (vgl. Macdonald 1995). In der dortigen Berufswelt fungiert der Be- griff professions als Bezeichnung für Berufsgruppen, die sich im Gegensatz zu den gewöhnlichen occupations durch privilegierte Erwerbs-, Qualifikations- und Kontrollchancen auszeichnen und deshalb ein besonderes Sozialprestige genießen. Im Brennpunkt professionssoziologischer Analysen stehen häufig Juristen und Ärzte. Sie gelten als professions par excellence. Zum einen wegen ihrer „langen und theoretisch fundierten Ausbildung“. Zum anderen wegen ihrer „schlagkräftigen Berufsverbände“, die eine verpflichtende Berufsethik etablieren und exklusive Zuständigkeitsbereiche zu Gunsten ihrer Mitglied- schaft beanspruchen. Aber auch Hochschulbedienstete, hoch qualifizierte „Ex- perten“ und „freiberuflich“ Tätige werden schon in den Pionierwerken berufs- soziologischer Forschung als professionell oder zumindest semiprofessionell etikettiert (vgl. Mieg 2003: 11 ff.).
Mit einer bündigen Bestimmung ihres Gegenstands tut sich die Professionsfor- schung freilich schwer. Definitionsprobleme ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte dieser Disziplin. Das rührt sicherlich nicht zuletzt daher, dass die Soziologie der Professionen ihr Augenmerk auf ein Politikum richtet, das weit über sozialwissenschaftliche Zirkel hinaus auf Interesse stößt: Weil in der angloamerikanischen Berufswelt professions privilegierte Positionen ein- nehmen, sind dort bisweilen erbitterte berufspolitische Auseinandersetzungen darüber, wie sich Professionen definitorisch eingrenzen lassen, an der Tages- ordnung (vgl. ebd.: 14 ff.).
Ihren stärksten Bedeutungszuwachs erfuhr die englischsprachige Professions- forschung in den 1960er Jahren. Insbesondere in den USA „stellte sich (anders als z.B. in Deutschland mit seinem hochentwickelten Berufsbildungssystem) mit dem expandierenden Hochkapitalismus die Frage, wie es zu Berufen kommt, die nicht nur auf Gewinn, sondern auch (zumindest dem Anschein nach) auf das Gemeinwohl und fachlich hochwertige Arbeit ausgerichtet sind und deshalb Ansehen und Autonomie genießen“ (Voß 1994:136). Die Konse- quenz waren zahlreiche Publikationen, die sich im Rahmen theoretischer Erör- terungen und empirischer Untersuchungen mit Rolle und Zukunft professionel- ler Tätigkeit beschäftigten. Vielfach stammten sie aus der Feder soziologischer
„Altmeister“. So hat sich Talcott Parsons, der 1979 verstorbene Begründer ei- ner strukturfunktionalistisch inspirierten Gesellschaftsanalyse, in allen Phasen seiner wissenschaftlichen Vita dem professional complex gewidmet und dabei stets einen Schwerpunkt auf die Entschlüsselung ärztlicher Handlungsmuster gelegt. Es dürfte sich als lohnend erweisen, sich einen Überblick über Kern- elemente und Erklärungskraft des Parsons’schen Oeuvre zu verschaffen. Un- übersehbar ist nämlich, dass die Professions- und Medizinsoziologie struktur- funktionalistischer Provenienz bis in die Gegenwart hinein Stoff für gesund- heitswissenschaftlich bedeutsame Studien und Kontroversen liefert.
3.2 Grundzüge strukturfunktionalistischer Soziologie
Talcott Parsons strebte eine grand theory an. Er wollte ein theoretisches Sys- tem von Begriffen schaffen, durch welches alle Aspekte gesellschaftlicher Rea- lität erfasst werden können. Als „archimedischen Punkt“ der Soziologie be- trachtete er dabei das Problem der sozialen Integration: Wie können durch Re- gelmäßigkeit und Stabilität gekennzeichnete Vergesellschaftungsmuster ent- stehen, wo doch menschliches Handeln als frei, d.h. immer auch kreativ und in gewissem Sinne beliebig gedacht werden muss?
Seine Theoriekonstruktion beginnt Parsons mit einem ideengeschichtlichen Rückblick. In seinem ersten größeren Werk, dem 1937 erschienenen Buch „The Structure of Social Action“, finden sich lange Erörterungen zu einer Rei- he philosophischer, soziologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Schulen.
Insbesondere der Auseinandersetzung mit dem utilitaristischen Vertragsdenken der ökonomischen Theorie räumt Parsons viel Platz ein. Er macht den frühbür- gerlichen Vätern dieses Gedankengebäudes eine Unterschätzung des Ord- nungsproblems zum Vorwurf: „Parsons teilte Hobbes’ Grundannahme, daß egoistische Individuen und knappe Mittel der Bedürfnisbefriedigung die natür- lichen Voraussetzungen der Bedürfnisbefriedigung seien und daß eine souve- räne Ordnung diese natürlichen Voraussetzungen überformen müsse, damit es zu einem gesellschaftlichen Zusammenhang anstatt zum bellum omnium contra omnes kommt. Aber er teilte nicht die Grundannahme Hobbes’, daß die Ver- nunft in der Gestalt der Zweckrationalität diese Ordnung konstituieren könne, weil sie, selber so asozial und zersplittert wie die individuellen Handlungszwe- cke, keine stabile Schranke gegen die Gewalt als Mittel egoistischer Bedürf- nisbefriedigung sein kann.“ (Furth 1991: 230 f.)
Eine Lösung des Ordnungsproblems erblickt Parsons in der Rezeption und Weiterentwicklung soziologischer Traditionsstränge. Emile Durkheim spielt in dem Kontext eine wichtige Rolle, weil der französische Soziologe einen sozi- alkulturellen Bezugsrahmen vermeintlich „autonomer“ Handlungszusammen- hänge behauptet: Die Normen, die einen Interaktionsprozess regulieren, ent- springen keinesfalls spontan der jeweiligen Interaktion; mindestens ebenso wichtig für das Zustandekommen von Kommunikation sind allgemeine kultu- relle Muster, die den Interagierenden von vornherein gemeinsam sind. Parsons nimmt diese Überlegungen zum Anlass, die subjektorientierte Handlungstheo- rie gleichsam systemtheoretisch umzudrehen (vgl. Parsons 1951). Soziale Zu- sammenhänge werden nicht mehr als Handlungszusammenhänge verstanden, sondern Handlungszusammenhänge werden als Systeme (stabilized patterns of interaction) gedeutet.1 Interaktionsmuster mit systemtheoretischen Begriffen zu erfassen, bietet nach Parsons den Vorteil, jedes mikrosoziale Ereignis als entweder funktional oder dysfunktional für das System analysieren zu können (vgl. Parsons 1964a: 36 ff.).
Diese struktur-funktionalistische Argumentation bringt eine Relativierung der Handlungskategorie mit sich: Die subjektiv-intentionale Perspektive wird bei Parsons nicht gänzlich irrelevant. Geltung besitzt sie für ihn aber nur noch rela- tiv auf die objektiv-funktionale Perspektive des Systems; also eines übergrei- fenden Ganzen, das sich aus einer eigenen Problemlage heraus konstituiert und keinesfalls als bloßes Summenphänomen einer Reihe individueller Akteure aufgefasst werden kann (vgl. Weiss 1993: 22 ff.).
Nachdem die Handlung als Systemprozess definiert wurde, stellt sich für die strukturfunktionalistische Soziologie die Frage: Wie können systemische Strukturen über einen längeren Zeitraum funktionieren und sich am Leben er- halten? Parsons geht davon aus, dass sich jede Handlung als ein Schnittpunkt mehrerer Systeme denken lässt (vgl. Parsons 1951: 3ff.; Parsons 1964a: 52 ff.). Vor diesem Hintergrund entwirft er ein allgemeines Handlungssystem, das sich seinerseits aus drei Subsystemen zusammensetzt. Bezugsgröße des Persönlich- keitssystems ist die Bedürfnisstruktur des einzelnen Individuums. Eine andere Perspektive dominiert, wenn Parsons auf das soziale System zu sprechen kommt. Hier geht es um Mechanismen, welche die Handlungen zwischen den verschiedenen Personen organisieren. Interaktion und Kommunikation bilden den Stoff des sozialen Systems; es ist aber nicht in der Lage, die interaktions- regulierenden Normen selbst hervorzubringen. Diese Aufgabe wird im analyti- schen Konzept des Strukturfunktionalismus vom kulturellen System erfüllt. Es stellt dem Sozial- und Persönlichkeitssystem gesellschaftlich anerkannte Wert- vorstellungen zur Verfügung, „die als Orientierungsmuster die Konsistenz des individuellen Handelns und die komplementäre Bezogenheit des sozialen Han- delns verbürgen“ (Furth 1991: 232).
Essenziell für ein allgemeines Handlungssystem im „dynamischen Gleichge- wicht“ ist im Parsons’schen Theoriegebäude die Integration des kulturellen Systems in die beiden anderen Systeme (vgl. Parsons 1975: 16 ff.). Geht es um das Verhältnis zwischen Kultur- und Persönlichkeitssystem, übernimmt der Begriff der Internalisierung eine Schlüsselstellung. Mit ihm bezeichnet Par- sons einen Prozess, in dessen Verlauf gesellschaftliche Normen zu einem Be- standteil individueller Motivation werden. Im Zuge der Erörterung des Interna-
lisierungsproblems entfaltet die strukturfunktionalistische Soziologie daher eine Theorie der Sozialisation. Auffällig an ihr ist eine funktionalistische Les- art Freud’scher Schriften (vgl. Parsons 1964c: 78 ff.). So wie Parsons „Hand- lungsmuster und Institutionen nicht aus den Handlungen und Interessen der Beteiligten selbst herleitete, so verstand er – trotz der entwicklungspsychologi- schen Elemente der Psychoanalyse, die er benutzte – den Prozeß der Sozialisie- rung als Anpassung der Mechanismen der Motivation an die Schemata der Ordnung und ging von einer prinzipiellen Identität der Interessen des sozialen Systems und der zu Sozialisierenden aus; blieb also auch mit seiner Sozialisa- tionstheorie auf der Ebene des funktionalistischen Theorieverständnisses“ (Furth 1991: 233 f.).
Parsons ist sich gleichwohl im Klaren darüber, dass nicht alle Individuen in gleicher Weise auf die sozialkulturellen Vorgaben reagieren. Dies bringt ihn dazu, seine Sozialisationstheorie mit einer Theorie abweichenden Verhaltens zu koppeln. Sie will Mechanismen identifizieren, mit deren Hilfe die Gesell- schaft der Verfestigung und Ausbreitung dysfunktionaler Verhaltensmuster entgegenwirken kann. Die strukturfunktionalistische Soziologie unterscheidet zwischen mehreren Formen sozialer Kontrolle. Als charakteristisch für entwi- ckelte Gesellschaften gilt ein Bedeutungsschwund „strafender Isolation“ zu Gunsten einer eher „liberaldemokratischen“ Variante der Verhaltenskanalisie- rung: nämlich der „Isolation zwecks Heilung“. Dass Parsons ärztlich und the- rapeutisch tätigen Berufsgruppen viel Aufmerksamkeit schenkt, hängt also mit seinem Schema der Typen und Wandlungsprozesse sozialer Kontrolle zusam- men (vgl. Parsons 1964d: 277 ff.; Gerhardt 1991: 191 ff.)
[...]
1 Es gibt zahlreiche Definitionsvorschläge für „System“. In einem Standardwerk zur Einführung in die soziologische Systemtheorie findet sich folgende Erläuterung: „Sys- tem [bezeichnet] einen ganzheitlichen Zusammenhang von Teilen, deren Beziehungen untereinander quantitativ intensiver und qualitativ produktiver sind als ihre Beziehun- gen zu anderen Elementen. Diese Unterschiedlichkeit der Beziehungen konstituiert eine Systemgrenze, die Systeme und Umwelt des Systems trennt.“ (Willke 1991: 194)
- Arbeit zitieren
- Geert Naber (Autor:in), 2005, Handlungsbedingungen, Merkmale und Perspektiven der ärztlichen Profession, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110276
Kostenlos Autor werden







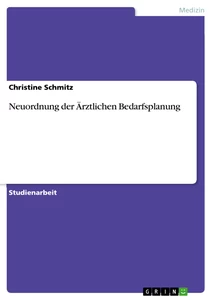




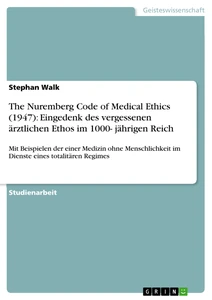

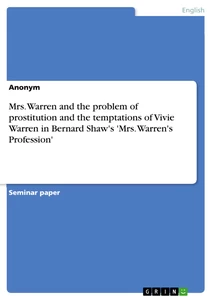

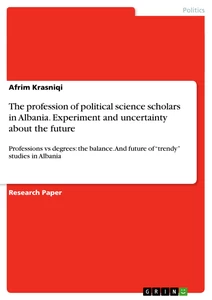
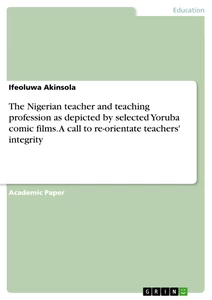


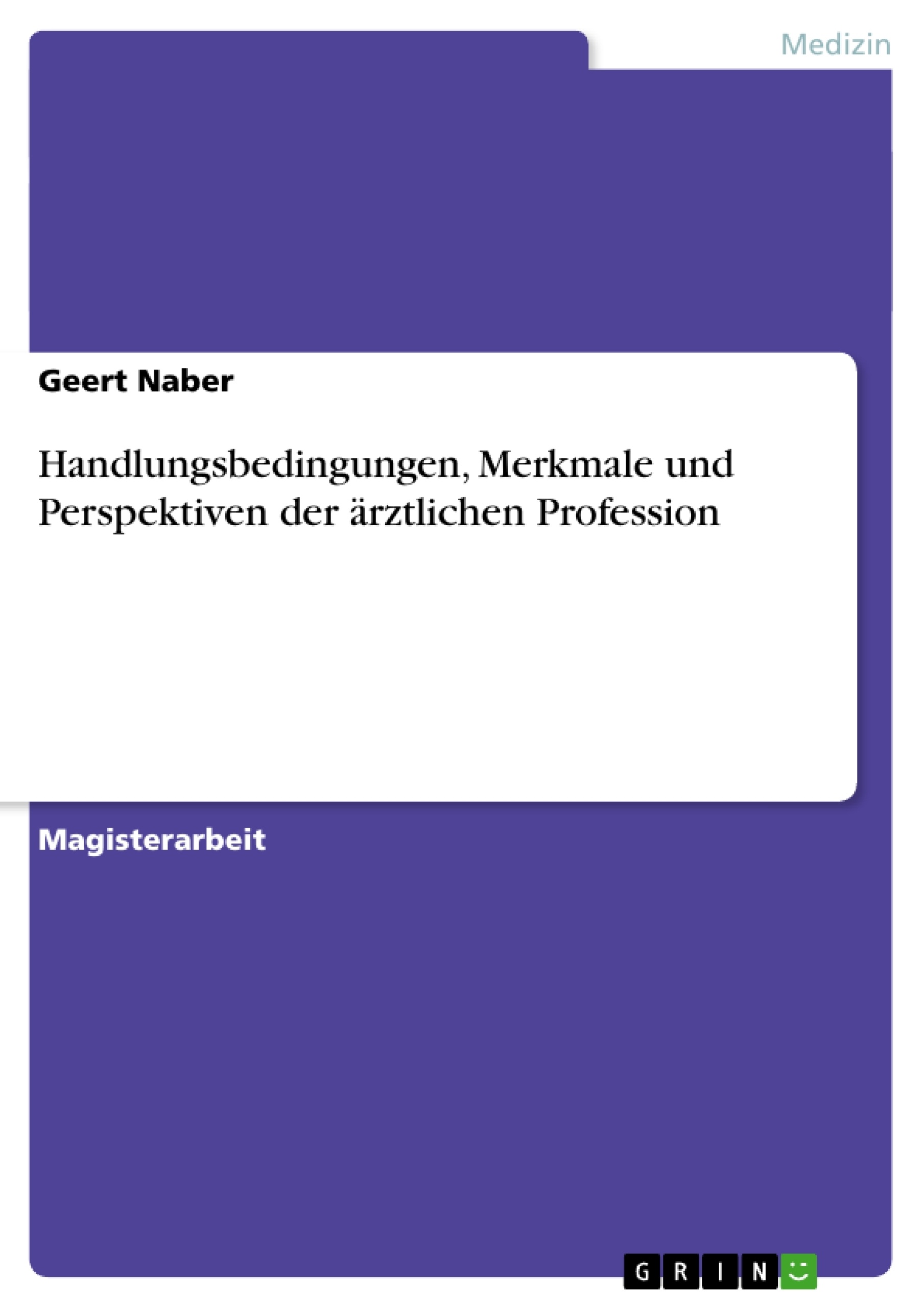

Kommentare