Leseprobe
Inhalt
Einleitung
i. blut und puls in der naturphilosophie
Einleitung
1. Zur Interpretation des Blutkreislaufs
a) Der Grundansatz in der Irritabilität
b) Aristotelische Motive
c) Bemerkungen zur Entdeckung des Blutkreislaufs
2. Über den Anfang des animalischen Lebens: das Phänomen des springend-pulsierenden Blutpunkts
3. Organismus, Raum, Zeit und Blut
ii. blut und puls in der religionsphilosophie
1. Vom Blut als dem Symbol und der Substanz des Lebens zur Inkorporation des heiligen Blutes
2. Die Erhebung zum denkenden Puls
iii. eine these über das verhältnis der beiden hauptwerke hegels: die ›phänomenologie des geistes‹ und die ›wissenschaft der logik‹
iv. die diaphanie des pulses
Einleitung
1. Zum Unterschied der Erscheinungsweise von Tier und Mensch
Exkurs: Die spekulative Deutung der Natur der menschlichen Gestalt
2. Das nichterscheinende und das erscheinende Auge, oder: die Skulptur und die Malerei
3. Das schwingende Erzittern der Musik
v. die rede vom ›punkt‹. versuch einer rekonstruktion des systems
1. Über die auf das Materielle bezogene Bedeutung des Ausdrucks ›Punkt‹ in der zur ›Enzyklopädie‹ gehörigen Naturphilosophie
2. Der ›Punkt‹ in seiner geistigen Bedeutung
3. Der Sprung des Punktes
vi. der knoten des monarchen
Bibliographie
Der vormalige Spruch oder das sogenannte Gesetz: non datur saltus in natura, paßt für die Diremtion des Begriffs durchaus nicht; die Kontinuität des
Begriffs mit sich selbst ist ganz anderer Natur.
g. w. f. hegel
Einleitung
Es ist nicht unbeachtet geblieben, daß Hegel zur Charakterisie- rung der Form der Bewegung des Begrifflichen gelegentlich den
Ausdruck ›Pulsieren‹ gebraucht[1]. Die bekannteste Passage dürfte dabei eine Stelle aus der Phänomenologie des Geistes sein. Gegen Ende des ersten Teils mit dem Titel A. Bewußtsein, im Übergang vom Bewußtsein zum Selbstbewußtsein, heißt es - in einem Satz, übervoll an Bestimmungen:
»Diese einfache Unendlichkeit oder der absolute Begriff ist das einfache Wesen des Lebens, die Seele der Welt, das allgemeine Blut zu nennen, welches allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das vielmehr selbst alle Unter- schiede ist, so wie ihr Aufgehobensein, also in sich pulsiert, ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu sein.« (TWA Bd. 3, S. 132)
Dieser Satz diene hier lediglich als Beleg. An ihm wird bereits ansatzweise deutlich, daß die pulsierende Bewegung eine dem He- gelschen Denken eigentümliche, wenn nicht sogar einheimische Bewegungsform ist: Im Bild der Bewegung des Pulsierens läßt sich die Einheit von Unterschiedenem und die Aufhebung dieses Unter- schiedenseins veranschaulichen. Die Rede vom Pulsieren kehrt im Hegelschen Text kontinuierlich wieder. Schlagen wir die Vorlesun- gen über die Geschichte der Philosophie an der Stelle auf, da Hegel den Begriff und die Bestimmung der Geschichte der Philo- sophie exponiert! Wir lesen, nachdem es vom »Hinausgehen der philosophischen Idee in ihrer Entwicklung« geheißen hat, sie sei keine Veränderung, sondern ein Insichhineingehen und ein Be- stimmterwerden, folgendes:
»Es ist eine Idee im Ganzen und in allen ihren Gliedern [die Rede ist von der vollkommenen, in sich vollständig ausgebildeten Phi- losophie], wie in einem lebendigen Individuum ein Leben, ein Puls durch alle Glieder schlägt.« (TWA Bd. 18, S. 47)[1]
Die eine Idee der gebildeten Philosophie wird hier mit dem einen Puls des lebendigen Individuums verglichen. Der in allen Gliedern gegenwärtige Pulsschlag sammelt und bündelt das scheinbar Zer- streute, ähnlich wie die Idee ihre Bestimmtheiten und Teile in einem intensiven Zusammenhang verwahrt. Am Ende der philosophiege- schichlichen Vorlesungen kommt Hegel auf seine Rede vom Puls zurück. Nachdem er die Geschichte des Denkens von Thales bis Schelling vor den Augen und Ohren seiner Berliner Zuhörer hat vorüberziehen lassen, sagt er:
»Diese Reihe ist das wahrhaftige Geisterreich, das einzige Gei- sterreich, das es gibt, - eine Reihe, die nicht eine Vielheit, noch auch eine Reihe bleibt als Aufeinanderfolge, sondern eben im Sichselbsterkennen sich zu Momenten des einen Geistes, zu dem einen und demselben gegenwärtigen Geiste macht. Und dieser lange Zug von Geistern sind die einzelnen Pulse, die er in seinem Leben verwendet; sie sind der Organismus unserer Substanz.« (TWA Bd. 20, S. 462)[2]
Mein Hinweis bleibt auch an dieser Stelle gegenüber der Hegelschen ÆmjasiV trocken. Angedeutet wird, daß der eine gegenwärtige Geist eine Reihe von anderen Geistern, einen langen Zug von Vorgängern, zu seinem Geisterreich zusammenzieht: Sie, als die einzelnen, ihm angehörenden Pulse, sind der »Organismus unserer Substanz«. Be- merkenswert ist, daß gegenüber dem einen Puls des Individuums zu Beginn der Vorlesungen nun eine Reihe von Geistern genannt, d. h. der eine Geist mehrere Pulse sein eigen nennt. Unklar ist, ob die »einzelnen Pulse« über je eigene Rhythmen verfügen, also nur über ihre Eigenart als Pulse sich zusammenreihen, oder ob mit dem Wort von den »einzelnen Pulsen« einzelne Puls schläge eines einigen und einzigen Pulses gemeint sind. Dem Gesamtsinn entsprechend ist die letztere Variante wahrscheinlicher: Der eine gegenwärtige Geist zählt die Reihe seiner geistigen Vorgänger noch einmal ab, indem er, ihre Geschichte erzählend, sie zu seinen einzelnen Pulsschlägen erhebt.
Die Beispiele mögen genügen. Ihnen ist unsere Frage zu entneh- men. Diese Frage bezieht sich auf den von Hegel angezogenen engen Zusammenhang des Geistes bzw. des Begriffs und der Bewegungs- form des Pulsierens. Ist - so fragen wir - diese Verknüpfung kontin- gent oder nicht? Läßt sich zwischen Geist und Begriff einerseits und der Bewegungsform des Pulsierens andererseits in der Hegelschen Philosophie ein innerer Zusammenhang ausmachen? Ist die in den Zitaten angezogene Analogie eine nur oberflächliche und zufällige - oder liegt in ihr mehr? Weist die Analogie des Geistes und des Begriffs mit dem Puls und der Pulsbewegung auf eine untergründige Verwandtschaft beider Seiten?
Jeder Kenner der Hegelschen Philosophie wird diesen Fragen zunächst kritisch gegenüberstehen. Die Rede vom Pulsieren - wird er sagen -, angewandt auf die Sphäre des Geistigen und den Begriff, ist eine bloß metaphorische Rede und als solche nicht geeignet, näheren Aufschluß über das Hegelsche Denken zu geben. Zwar gebraucht Hegel verschiedentlich (das werden auch die Kritiker der Fragestellung nicht bestreiten können) die aus dem Organischen entnommene Metapher des Pulsierens zur Verdeutlichung und Um- schreibung der Begriffsbewegung, doch liegt der Sinn und der Wert dieses Gebrauchs nur in seiner gleichsam propädeutischen Funk- tion: Der der eigentlichen Begriffsbewegung noch Unkundige soll über das bekannte Bild der Pulsbewegung an diese, d. h. an die begriffseigene Bewegung herangeführt, und, der begrifflichen Aus drucksweise schließlich mächtig werdend und gleichzeitig die Be- schränktheit der metaphorischen Ausdrucksweise einsehend, diese wieder außerhalb der Darstellung des Vernünftigen setzen[1]. Die gelegentliche Rede Hegels vom Pulsieren wäre so als ein zwar sinnvolles, aber bloß transitorisches Moment der eigentlichen, dia- lektischen Begriffsbewegung gefaßt. Der kritische Einwurf, indem er auf den bloß metaphorischen und damit untergeordneten Sinn der Hegelschen Redeweise hinwiese, meldete so schließlich begründeten Zweifel an der Wesentlichkeit der gestellten Frage an. Dem Zweifel, so formuliert, ist einerseits stattzugeben: Unsere Frage ist die Frage nach einer Metapher der eigentlichen Bewegungsform des Begriffs und der Daseinsweise des Geistes und insofern wir nach einer Me- tapher fragen, statt uns auf die begriffseigene Bewegung einzulassen, bleibt der Ansatz beim ›Pulsieren‹ peripher.
Soweit die eine Seite. Diese folgt in ihrer Argumentation den gängigen Erklärungen, denen gemäß die Metaphern in philosophi- schen Darstellungen nur äußerliche und uneigentliche Hüllen sind. Philosophie - so wird gesagt - ist weder Poesie noch Rhetorik. Diese Auffassung ist nicht falsch, aber beschränkt und einseitig. Indem sie das Selbstverständnis der Philosophie einfach übernimmt, d. h. an die Spitze ihres Kanons eine bloße Reformulierung jenes Selbstver- ständnisses setzt, ist sie auf dem einen Auge blind. In ihrer ange- strengten Aufmerksamkeit auf die Bewegung des Begriffs übersieht eine Lektüre dieses Stils die in der Hegelschen Darstellung immer wieder auftauchenden begriffsbegleitenden Metaphern. Was heißt und was bedeutet es, wenn Hegel etwa davon spricht, daß die »festen Gedanken in Flüssigkeit zu bringen« seien (Vorrede zur PhdG, TWA Bd. 3, S. 37)? Oder was heißt es, daß zur Heraufkunft des » Begriff[s], der sich als Begriff weiß« es am Ende der Phänomeno- logie des Geistes notwendig ist, daß der ganze »Bau ihrer Wesen- heiten [das in der Phänomenologie Dargestellte] in sich gesogen werden« muß (ebd., S. 584)? Warum und wozu die immer wieder- kehrende Hegelsche Rede vom ›Keim‹, der schon an sich der Begriff ist? Worauf deutet, ganz generell, die häufige Rede von der ›Ent- wicklung‹ des Begriffs und die Bezugnahme auf die organische Natur zur Verdeutlichung der Verfaßtheit des Begriffs?
All diese und alle weiteren ähnlichen Fragen stellen sich einer streng immanenten Auslegung nicht[1]. Indem sie sich der von Hegel selbst formulierten Forderung - die immanente Bewegung des Be- griffs sei ohne eigenes Einfallen in deren Rhythmus nachzuvollzie- hen[2] - unterwirft, wird die genannte begriffsbegleitende Metaphorik
1 Was hier unter ›immanenter Auslegung‹ verstanden wird, unterscheidet sich von dem, was Th. W. Adorno in seinem Beitrag Skoteinos oder Wie zu lesen sei in kritischer Absicht unter dem Titel einer ›immanenten‹ Lektüre faßt. Da für Adorno der »Anspruch der Hegelschen immanenten Bewegung, daß sie die Wahrheit sei, keine Position« ist, sondern zur »Schwelle [führt] , an der über seinen [Hegels] Wahrheitsanspruch zu entscheiden ist«, kann er sagen, daß der Leser »zu Hegels Kritiker [wird], indem er ihm folgt« (ich zitiere nach: Th W. Adorno, Skoteinos oder Wie zu lesen sei (1962/63); in: Drei Studien zu Hegel, Frankfurt a. M. 1969, S. 105-165; hier: S. 163f.). Geht man in Adornos Essay weiter zurück, so wird deutlich, was unter dieser zur Kritik führenden ›immanenten‹ Lektüre zu verstehen ist. Er hebt hervor, daß dem Hegelschen Diskurs, auch in seinen abstraktesten Phasen, mit »Imagination« (S. 156) und »produktiver Phantasie« (S. 157) zu begeg- nen sei. Erst eine Lektüre, die die zur »Apparatur« verselbständigten Begriffe in die sie »motivierende geistige Erfahrung zurückzuholen« (ebd.) imstande sei, werde dem Hegelschen Text gerecht. »Hegel kann nur assoziativ gelesen werden. Zu ver- suchen ist, an jeder Stelle so viele Möglichkeiten des Gemeinten, so viele Beziehun- gen zu anderen einzulassen, wie irgend sich aufdrängen. Die Leistung der produktiven Phantasie besteht nicht zum letzten darin. [...] Assoziatives Denken hat bei Hegel sein fundamentum in re.« (S. 159) Diesen Sätzen würden wir zustimmen. Doch bleibt die Frage, ob Adorno diesem Stil der assoziativen Lektüre berechtigterweise die Eigenschaft ›immanent‹ zuspricht. Kein Zufall ist, daß er exakt dort seine kritische Analyse gegen den bloß »paraphrasierenden« Nachvollzug geltend macht, wo Hegel zur »spekulativen Deduktion der Monarchie« (S. 147) sich an schickt. Adorno spricht dort die »immanente Treue zur [Hegelschen] Intention« (S. 148) einer Lektüre zu, die diese Deduktion nicht nachvollzieht. Er will die auf- hebende und insofern negative Bewegung der Dialektik angewandt wissen, wo sie nach Hegel gerade ein Positives zu begründen hat. Da der Hegelsche Text eine andere Sprache als diejenige der negativen Dialektik spricht, schlagen wir entspre- chend weder eine sich selbst als immanent behauptende, noch eine bloß paraphra- sierende, sondern eine sich selbst als randgängerisch verstehende Lektüre vor, die einen distanzierten Nachvollzug auch jener Deduktion erlaubt.
schließlich als solche, d. h. als Metaphorik verstanden und bleibt - wie dem Hegelschen Selbstverständnis, so dem Ausleger - bloß äußerlicher Hinweis auf ein Eigentliches[1].
a) die Auslegung verzichtet auf die eigene Bestimmung ihrer leitenden Aufmerk- samkeit, überläßt sich dem immanenten Rhythmus der Begriffe und gewinnt so eine Perspektive, die sich zurecht als im Inneren des Hegelschen Denkens befindlich ausgibt, oder b) die Auslegung beharrt auf der Selbstbestimmung ihrer leitenden Aufmerksamkeit, versucht das Denken Hegels unter ihrer Perspektive zu betrach- ten und nimmt gleichzeitig in Kauf, neben dem von Hegel Gesagten herzureden. Man erkennt, daß beide Wege die Aufgabe einer Auslegung des Hegelschen Den- kens nicht zu lösen vermögen: denn diese verlangt - da sie sowohl Auslegung als auch Auslegung des Hegelschen Denkens zu sein hat - eine Berücksichtigung beider Anforderungen. Wie also ist vorzugehen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, den beiden Anforderungen gleichzeitig zu genügen?
Vor dem Hintergrund des Gesagten läßt sich der hier versuchte Zugang zu Hegel als Randgang [1] charakterisieren: Weder im Inneren sich einrichtend, noch nur im Außen verbleibend, versucht er, der Grenze entlang gehend, einen bestimmten Kreis um die Hegelsche Darstellung der Philosophie zu ziehen. Als Leitfaden der Ausarbei- tung dient die von Hegel dem Geist und dem Begriff beigelegte Metapher des Pulsierens.
Metapher des Pulsierens. Damit ist zugestanden, daß die befragte Bewegung nur auf die der Hegelschen Darstellung eigene begriff liche Bewegung hindeutet. Sie analogisch verdeutlicht.
Die erste Frage, die Frage, die der Klärung der Analogie von Begriff und Pulsieren vorauszugehen hat, ist diejenige nach der Herkunft dieser Metapher. In welchem Bereich, in welcher Sphäre, ist die ›Pulsieren‹ genannte Bewegung gleichsam ›zuhause‹? Woher entnimmt Hegel die Metapher, mit der er gelegentlich die Bewegung des Begriffs oder die Existenzweise des Geistes charakterisiert?
Diese Sphäre - wird jedermann sofort sagen - ist das Organische, und näher: der Bereich von Herz und Blut. Hegel entlehnt seine Metapher aus der Sphäre des inneren Organismus. Im Inneren des Organismus schlägt der Puls. Erinnern wir uns an die zitierten Textpassagen. Darin wird sowohl das Blut als auch der Organismus direkt genannt. Während im ersten Zitat das »allgemeine Blut« als Name des »absoluten Begriffes« vorgestellt wird, assoziieren die beiden anderen den Geist und die Idee mit den Pulsschlägen eines Individuums bzw. dem Organismus unserer Substanz. Der Versuch einer Klärung der Bedeutsamkeit der von Hegel gebrauchten Meta- pher wird also zunächst auf das Gebiet des Organischen, und d. h. in die Sphäre der Naturphilosophie verwiesen. Es ist nachzusehen, welchen Sinn Hegel der Pulsbewegung bereits in der Naturphiloso- phie gibt, um seine Übertragung auf den Begriff und den Geist zu verstehen. (Kap. I)
Eine aufmerksame Lektüre der naturphilosophischen Deutung von Blut und Puls wird feststellen, daß in die Hegelschen Ausfüh- rungen sich gelegentlich Vorstellungen aus einer ganz anders gear- teten Sphäre einmischen, - einer Sphäre, die ebenso Anspruch er- hebt, den Ausgangsbereich für die Metapher des Pulsierens abzuge- ben: Die Religion. Nicht nur, daß Hegel mitten in den Ausführungen des dritten Jenaer Systementwurfs zur organischen Assimilation vom »Mystizismus« und von der übersinnlichen Welt spricht (GW Bd. 8, S. 125), auch die nähere Interpretation des Kreislaufs des Blutes wird dort mit der Bemerkung eröffnet, daß der »jüdische Gesetzgeber« verbot, »das Blut der Tiere zu verzehren«, weil, so gibt Hegel den Grund an, »das Leben der Tiere in dem Blute ist« (ebd., S. 159). Den innerhalb der naturphilosophischen Sphäre fremden Andeutungen auf die Religion ist nachzugehen. Es sind jene Orte in der Religionsphilosophie Hegels aufzusuchen, an denen vom Blut und vom Pulsieren gesprochen wird. (Kap. II)
Unseren Ausgangspunkt bilden die Hegelschen Übertragungen der Pulsbewegung auf den Begriff und den Geist. Nach dem Durch- gang durch die beiden regionalen Sphären der Natur- und Religions- philosophie ist die Frage zu stellen, ob die Möglichkeit der generel- len Übertragung der Bewegungsform des Pulsierens auf einer ver- knüpfenden Zusammenschau der Bedeutungen des Blutes und des Pulses in den beiden Sphären beruht. Ich werde es unternehmen, die Hegelsche Bestimmung des Verhältnisses seiner beiden Hauptwer- ke, der Phänomenologie des Geistes und der Wissenschaft der Logik, vor dem Hintergrund dieser notwendig sich stellenden Frage anzugehen. (Kap. III)
Über den weiteren Fortgang der Arbeit läßt sich hier kein Vorbe- richt geben. Die folgenden Kapitel (IV-VI) entfalten das in der Ausgangsfragestellung Angelegte, indem sie das je Erreichte zum Ausgangspunkt einer weiteren und tiefer dringenden Nachfrage machen.
I. Blut und Puls in der Naturphilosophie
Einleitung
D ie Philosophie der Natur nimmt in Hegels dreiteiligem System der philosophischen Wissenschaften die Mitte ein. In seiner im
Jahre 1817 zum ersten Mal veröffentlichten Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse stellt die Na- turphilosophie den auf die Logik folgenden zweiten Teil des Kreises der Wissenschaften dar. Abgeschlossen und gekrönt wird das reife System der Hegelschen Philosophie von der Philosophie des Geistes.
Im Übergang und als Vermittelndes von Logik und Geist steht die Natur. Sie stellt, wie es im § 192 der Heidelberger und im § 247 der Berliner Enzyklopädie[1] heißt, die »Idee in der Form des An- dersseins «, d. h. die Idee dar, wie sie in der Bestimmung der » Äu-ßerlichkeit « ist. Verglichen mit der Wissenschaft der Idee an und für sich (Logik) und der Idee, wie sie aus ihrem Anderssein in sich zurückgekehrt ist (Geist), bezeichnet die Natur - neben der Kunst - in der Hegelschen Systematik jene Sphäre, in der die Idee allein sichtbar ist. Doch was sieht Hegel, die Natur betrachtend? Antwort: den Begriff. So heißt es in einem Zusatz zum § 248 der Berliner Enzyklopädie: »Das Affirmative in der Natur ist das Durchschei- nen des Begriffs« (TWA Bd. 9, S. 31). Aus der Sphäre des reinen Begriffs herkommend und in das Reich des Geistes mündend, ist auch die Natur in der Hegelschen Philosophie - obwohl als das Äußerliche, Anschauliche gefaßt - ganz aus dem Geist und im Geist gedacht: Sie komplettiert nur, was dem rein Inneren und Innerlichen fehlt. Was aber fehlt dem rein Inneren und Innerlichen? Die Äußer- lichkeit. Es ist wichtig, auf diesen sich aus der Hegelschen System konzeption ergebenden Kreis bereits hier hinzuweisen -, nur von ihm aus läßt sich die Art und Weise verstehen, wie die Phänomene des Natürlichen in dieser Naturphilosophie immer schon und aus- schließlich unter dem Gesichtspunkt ihrer Adäquatheit zum Begriff in Betracht kommen.
Den Ansatz und die Ausrichtung der Naturphilosophie gewinnt Hegel - gemeinsam mit Schelling - im Ausgang einer Kritik an der These über die Unerkennbarkeit der von Kant eingeführten Idee eines intuitiven Verstandes. In seiner Kritik der Urteilskraft führt Kant aus, daß in der theoretischen Betrachtung der Natur im wesentlichen zwei apriorische Weisen der Erkenntnis zu unterschei- den sind: Während die eine Form unserem, d. h. dem menschlichen Verstand zugeordnet und dadurch charakterisiert ist, daß sie vom » Analytisch-Allgemeinen (von Begriffen)« zum Besonderen fort- geht, ist die andere, einem »intellectus archetypus« zugesprochene Weise dagegen eine Form, die vom » Synthetisch-Allgemeinen (der Anschauung eines Ganzen, als eines solchen) zum Besonderen geht«. Weiter werden die beiden Weisen von Kant anhand des Unterschiedes von Ganzem und Teil erläutert. Während der menschliche, diskursive, Begriffe gebrauchende Verstand stets von den Teilen - gedacht als allgemeine Gründe für darunter zu subsu- mierende Formen - ausgeht, faßt der intuitive, urbildliche und an- schauende Verstand die Möglichkeit der Teile schon immer »als vom Ganzen abhängend« auf (B 349). Dem re konstruierenden, diskur- siven, menschlichen Verstand ist damit die Idee eines kon struieren- den, intuitiven, gleichsam göttlichen Verstandes an die Seite gesetzt. In der Anwendung auf die Gegebenheit etwa eines organischen Körpers (B 351) heißt das für Kant, daß in ihm zwar »durchaus die Idee von einem Ganzen« als vorausgesetzt zu denken ist, nicht aber, daß diese Idee wirklich an dem Dinge ist [1]. An genau diesem Punkt setzen Schelling und dann auch Hegel ein: Warum, so läßt sich ihre kritische Frage an Kant reformulieren, soll es der Betrachtung der Natur zwar erlaubt sein, einen intuitiven, das Ganze denkenden Verstand vorauszusetzen, unerlaubt dagegen, ihn in den Dingen, insbesondere im Organismus, zu finden ?
Es ist bezeichnend, daß die Abwendung Schellings und Hegels von Kant von einem neuen und anderen Blick auf den Organismus begleitet - wenn nicht sogar initiiert - wird: An ihm - wird er nicht nur als das Phantasma eines organisierten Körpers genommen - wird evident, daß das Verhältnis von Ganzem und Teil im Sinne des intuitiven Verstandes in der Natur realisiert ist. So heißt es in der nur sieben Jahre nach der Kritik der Urteilskraft veröffentlichten, pro- grammatischen Schrift Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) Schellings:
»Jedes organische Produkt trägt den Grund seines Daseyns in sich selbst, denn es ist von sich selbst Ursache und Wirkung. Kein einzelner Teil konnte entstehen, als in diesem Ganzen, und dieses Ganze selbst besteht nur in der Wechselwirkung der Teile. In jedem anderen Objekt sind die Teile willkürlich, sie sind nur da insofern ich theile. Im organisierten Wesen allein sind sie real, sie sind da ohne mein Zuthun, weil zwischen ihnen und dem Ganzen ein objektives Verhältnis ist. Also liegt jeder Organisation ein Begriff zu Grunde, denn wo nothwendige Beziehung des Ganzen auf Theile und der Theile auf ein Ganzes ist, ist Begriff. Aber dieser Begriff wohnt in ihr selbst, kann von ihr gar nicht getrennt werden, sie organisiert sich selbst, ist nicht etwa nur ein Kunst- werk, dessen Begriff außer ihm im Verstande des Künstlers vor- handen ist. Nicht ihre Form allein, sondern ihr Daseyn ist zweck- mäßig.« (SW, 1. Abt., Bd. II, S. 40f.)
Jedes dieser Worte ist als eine Antwort auf die kritische Philosophie Kants zu verstehen - und mit jedem dieser Sätze wird die Absetzung von Kant ein Stück weiter vorgetrieben. Achten wir nur auf den völlig neuen Gebrauch des Ausdrucks ›Begriff‹: Während bei Kant der Begriff dem menschlichen, diskursiven Verstand ›zum Behufe‹ der Erforschung der Natur zugeordnet ist, ist der Begriff bei Schel- ling - verstanden als die notwendige Wechselwirkung von Ganzem und Teil - im Organismus realisiert. Wollte man diesen Übergang im Verständnis der Leistung des Begriffs prägnant bezeichnen, so könn- te man von einem Übergang von einem lediglich die Möglichkeit eines Gegenstandes anzeigenden Begriff (bei Kant) zum im Orga nismus verwirklichten Begriff (bei Schelling) sprechen[1]. Da dieser Übergang im Verständnis des Begriffs vor dem Hintergrund einer Reinterpretation der Natur sich zuträgt, ist es nur zu erwarten, daß der Philosophie der Natur, und d. h. der begrifflichen Fassung des natürlich Seienden, eine außerordentliche Bedeutung zukommt: Die gelingende Darstellung der Philosophie der Natur ist die Bewäh- rungsprobe für die Überwindung des Kantischen Kritizismus.
Soweit die knappe Skizze zur Ausgangslage der Hegelschen Na- turphilosophie[2]. Es kann nun nicht mehr erstaunen, was wir für die Jenaer Periode der Entwicklung des Hegelschen Denkens beobach- ten: Die fast völlige Verlegung der denkerischen Anstrengung auf die Ausarbeitung einer Philosophie der Natur. Im engen Kontakt zu Schelling versucht Hegel in seinen Jenaer Jahren den gesamten Um- kreis des Natürlichen begrifflich zu durchdringen, mit Schelling voraussetzend, daß dem Natürlichen selbst bereits das Moment des Begrifflichen inhäriert. Vor dem Hintergrund dieser Auffassung, d. h. der Auffassung, daß die begriffliche Erkenntnis der Natur gleichsam ein Herauslösen einer in der Natur selbst liegenden be- grifflichen Struktur bedeutet, werden jene Sätze verständlich, die Hegel in seinem frühesten Jenaer Entwurf auf der Schwelle zum Teil über den Organismus formuliert. Da ihm das Organische als der »absolute Begriff selbst« (GW Bd. 6, S. 189) gilt, mithin das begriffliche Erkennen des Organischen an ihm auf nichts anderes als sein eigenes Prinzip stößt, kann er sagen:
»Das Erkennen erkennt sich nicht durch etwas anderes, sondern durch sich selbst, und wir erkennen das Organische eben, indem wir erkennen, daß es jene Einheit oder das existierende Erkennen ist.« (ebd., S. 190)
Treten wir nun näher an unsere eigentliche Aufgabe heran. Nachzu- sehen ist, wie Hegel in seiner Naturphilosophie das Blut und dessen Bewegung, das Pulsieren, interpretiert[1]. Aufgrund des Gesagten ist zu erwarten, daß, da das Blut und dessen Bewegung im Inneren des Organismus zu verorten ist, eine nochmalige Verschärfung der das Organische und das Begriffliche identifizierenden Bewegung zu verzeichnen sein wird: Wenn bereits eine Betrachtung des Organis- mus im allgemeinen in ihm den »absoluten Begriff« und das »existie- rende Erkennen« ausmachen zu können glaubt -, wie erst wird die Beurteilung und Beschreibung des Inneren desselben Phänomens ausfallen? Ist nicht zu vermuten, daß mit der Erkenntnis des Inneren des »existierenden Erkennens« die Spitze dessen erreicht wird, was eine spekulative Naturerkenntnis in der Natur zu erkennen sich fähig glaubt?
Der Satz aus der späteren Enzyklopädie, daß die Natur über- haupt als ein » System von Stufen « (§ 249; TWA Bd. 9, S. 31) zu betrachten sei, gilt bereits für die Jenaer Systementwürfe. Im letzten und entwickeltesten der drei tritt uns das Natürliche, geord- net in drei Hauptstufen, so gegenüber: Eine erste Abteilung, betitelt Mechanik, behandelt die Begriffe von Raum, Zeit, Bewegung und Masse. Ein zweite Abteilung unter dem Titel Gestaltung und Che- mismus führt die begonnene Entwicklung fort, indem sie das Stati- sche und Schwere des Mechanischen verflüssigt, um schließlich im reinen Prozeß des Feuers den Begriff des Physischen zu erreichen, der die Einheit des Mechanischen und Chemischen darstellt. Die dritte Abteilung bildet das Organische. In ihr werden die vorher- gehenden Stufen resumiert; das Organische ist, wie Hegel bemerkt, die » Substanz des bisherigen« und als solche » trägt [es] dasselbe überhaupt, an ihm ist es da, wie die einzelnen Organe an einem Subjecte« -, die vormals » physische Selbständigkeit «, so Hegel, ist in ihm »aufgelöst« (GW Bd. 8, S. 108).
Es ist für unsere Zwecke nicht notwendig, in eine detaillierte Erörterung der skizzierten Stufenfolge einzutreten; lediglich auf drei allgemeine, unser Thema betreffende Entwicklungsverläufe des Natürlichen sei hingewiesen.
1) Bemerkenswert ist - und darauf machen die Überschriften kaum aufmerksam -, daß die Abfolge Mechanismus-Chemismus-Orga- nismus von einer Bewegung begleitet wird, die man als Bewegung von der makrokosmischen zur mikrokosmischen Welt beschreiben könnte: Während Hegel seine Ausführungen mit dem Äther, dem Sonnensystem und den schweren Massen der Planeten beginnt, beendet er seine Philosophie der Natur mit Erörterungen über die inneren Verhältnisse im Organischen. Genauer hinsehend, erkennt man, daß, stimmig zur Gesamtabfolge, die (mesokosmische) Erde als Mittlerin dieser Bewegung angesetzt wird: Kommt sie dort, bezogen auf das System der Sonne, als Planet in Betracht, so erscheint sie hier, bereits als Grund des Organischen gesehen, als »lebendige, befruchtete Erde« (ebd., S. 110).[1]
2) Damit zusammenhängend, und doch davon zu scheiden, sind die vom Licht durchlaufenen Metamorphosen. Zunächst als die »in sich gegangene himmlische Sphäre« (ebd., S. 35) gefaßt, verwandelt sich das Licht im Bereich des Chemischen zum Feuer, um dann, sich versenkend und wieder heraustretend aus der Finsternis der Erde, zur Farbe zu werden. So heißt es, um nur ein Beispiel anzuführen, daß die Farbe Rot als das Licht die reale Totalität sei, welche »die Finsterniss überwunden, sie vollkommen durchdrungen hat« (ebd., S. 87). Schließlich entwickelt Hegel, in die Sphäre des Organischen tretend, den Zusammenhang von Licht und Leben an der Blüte der Blume weiter -, endend mit dem Hinweis, daß erst im Sehen das Licht zu seiner letzten und reinsten Manifestation komme (ebd., S. 141).
3) Wie bereits erwähnt, sieht Hegel mit dem Organischen die letzte, die vorhergehenden ›tragende‹ Stufe der Natur erreicht. Parallel dazu wird im Rückblick vom Organischen aus die Reihe der drei Stufen (Mechanismus, Chemismus, Organismus) durch die Grund- differenz von Organischem und Unorganischem ersetzt. Die beiden Stufen des Mechanischen und des Chemischen sinken im Vergleich mit der sie resumierenden Stufe des Organischen zu deren Unorga- nischem herab. Von ihrem Ende her gesehen, wird die Natur also von einer Differenz durchzogen. Diese Differenz scheidet das Na- türliche in unselbständig Unorganisches und selbständig Organi- sches. Den Bezug der beiden Seiten sieht Hegel in der Assimilation geleistet. In der Assimilation findet zwischen Organischem und Unorganischem ein Prozeß statt, der ihre Differenz überwindet und sie einander angleicht. Der Anstoß zu dieser Assimilation geht vom Organischen aus, dieses »reißt«, wie Hegel sagt, »das Unorganische unmittelbar in seine organische Materie« (ebd., S. 125). Unschwer ist zu erkennen, daß dieser ›Hereinriß‹ des Unorganischen in die »organische Flüssigkeit«, dieses »unmittelbare Schmelzen des Un- organischen« (ebd., S. 123) einer Aufhebung des Unorganischen gleichkommt. Wohinein aber wird das Unorganische aufgehoben? Gibt es im Organischen eine genauer zu bezeichnende Substanz, die das Unorganische ›umschmelzt‹ und in sich ›reißt‹? Hegel deutet die Blut substanz nur erst an, wenn er, an einer den Organismus einfüh- renden Stelle, vom »Feuerwesen« der »sich selbst gleichbleibende[n] Flüssigkeit« spricht, »worin alles unmittelbar in seinen Begriff zu- rükkehrt« (ebd., S. 126)[1].
Nimmt man die drei angeführten, allgemeinen Entwicklungsverläu- fe - die Tendenz zum Mikrokosmischen, die Tendenz zur darin sich entfaltenden Transparenz und die Aufhebung der beiden Stufen des Mechanischen und Chemischen im Organischen - zusammen, so erhält man bereits eine Vorstellung vom Ort, den die Blutsubstanz in der Naturphilosophie einnimmt: Als Substanz, die im Inneren des Organismus sich bewegt, bildet sie a) einen Zielpunkt der vom Makro- zum Mikrokosmos verlaufenden Entwicklung, - der innere Organismus, der »wirkliche Begriff« sei das »im Selbst wiederge- bohrne Sonnensystem« schreibt Hegel (GW Bd. 8, S. 156) - b) als Unterhalterin und bildende Substanz des gegliederten Organismus,
d. h. als Substanz, der die organische Gestaltung ›durchsichtig‹ ist, bildet sie einen wichtigen Durchgangspunkt zur erst mit der Fähig- keit des Sehens erreichten völligen Transparenz, c) als jene Flüssig- keit schließlich, die am Ende der Assimilationskette steht, bildet das Blut im Bezug auf die Differenz von Unorganischem und Organi- schem so etwas wie die ultima ratio des Natürlichen. Zu all dem kommt hinzu, daß das Blut als die im Inneren des Organismus pulsierende Substanz des Lebens sich in der Form eines Kreislaufs bewegt. Erst diese, am Blut und seinem Kreislauf festzustellende Bewegung des Insichzurückkehrens ist es, die den letzten Ausschlag für die außerordentliche Stellung des Blutes in der Naturphilosophie abgibt. Erst das Phänomen des Blutkreislaufs entlockt dem speku- lativen Denken jene Bestimmungen, die Hegel, in einem späteren - allerdings ungesicherten - ›Zusatz‹ zum § 354 der Enzyklopädie sagen lassen, daß mit dem Blut der »unmittelbare Ausdruck des Begriffs« gegeben sei, - »den man hier sozusagen mit Augen sieht« (TWA Bd. 9, S. 449).
Das Blut wird zunächst als Einheit von Gestalt und verdauender Wärme, als »Einheit des mechanisch organischen und des chemisch organischen« eingeführt (GW Bd. 8, S. 155)[1]. Die Bezeichnungen ›mechanisch organisches‹ für die Gestalt und ›chemisch organisches‹ für die Verdauung, und die Interpretation des Bluts als deren Einheit nehmen die Dreiteilung der gesamten Naturphilosophie in Mecha- nismus, Chemismus und Organismus wieder auf. Die Kombination der Ausdrücke zu ›mechanisch organisches‹ und ›chemisch organi- sches‹ deutet darauf hin, daß innerhalb des Teiles zum Organismus eine Wiederholung jener Prinzipien auf höherer Stufe angesetzt wird. Mit dem Blut beginnt das Innere des Organismus als Setzendes des Äußeren thematisch zu werden. Die Stellung des Bluts innerhalb des Organischen wird von Hegel in Analogie zum tragenden, bzw. setzenden Charakter des Organischen im Gesamten der Naturphi- losophie gedacht. Außerdem läßt er keinen Zweifel daran aufkom- men, daß das Blut als der eigene und eigentliche Saft des Lebens zu gelten hat. Er verweist dazu, den Beleg ex negativo beibringend, auf religiöse Kontexte, genauer: auf das Tötungsverbot von Tieren bei den Indern und das Verbot des Blutgenusses bei den Juden (ebd., S. 156, 159). Das Blut ist der Repräsentant des Lebens im Inneren des Organismus.
Bevor ich zur detaillierten Auslegung der Spekulationen über den Blutkreislauf und die Pulsbewegung komme, sei die entscheidende, assoziationsreiche Passage im Ganzen zitiert. Nachdem Hegel vom Blut als der »allgemeine[n] Substanz« und der »absoluten Bewe- gung« gesprochen und auf die Schwierigkeiten der Physiologen hingewiesen hat, die Blutbewegung zu erklären, schreibt er, die physiologische Frage aufnehmend und auf seine Weise beantwor- tend:
»Das Herz also bewegt das Blut, und die Blutbewegung ist wieder das bewegende des Herzens - es ist ein Krais - ein perpetuum mobile, das sogleich stille steht, weil die Kräffte im Gleichge wichte sind. Ebendarum ist das Blut selbst das Princip der Bewe- gung, es ist der springende Punkt - nichts unbegreifliches, unbe- kanntes - außer wenn Begreiffen in dem Sinne genommen, daß etwas anderes, die Ursache aufgezeigt wird, von der es bewirkt wird - immer etwas anderes; diß ist aber nur die ä ußre d. h. gar keine Notwendigkeit, nicht der Grund; die Ursache ist selbst wieder ein Ding nach dessen Ursache zu fragen ist, und so fort in die schlechte Unendlichkeit - Unfähigkeit, das Allgemeine, den Grund zu denken und vorzustellen. - no}V ist das Wesen der Welt, d. h. das Allgemeine - das Einfache, welches die Einheit entgegengesetzter ist - und daher Unbewegbare, das aber bewegt - diß ist das Blut, ...« (GW Bd. 8, S. 159).
Ich merke gleich hier an, daß die Nennung des no}V an dieser Stelle singulär ist: An keiner anderen Stelle des Manuskripts hält Hegel es für geboten, auf diesen Terminus der griechischen Philosophie zu- rückzugreifen. Angesichts der bekannten Wichtigkeit des no}V für das Verständnis seiner Philosophie hätte die Tatsache dieser einma- ligen Nennung genügen müssen - so nimmt man an -, um die Aufmerksamkeit der Hegelforschung auf die Passage zum Blut zu lenken. Doch diese Annahme ist - soweit ich sehe - falsch: Die Blutspekulationen Hegels waren und sind in der Forschung kein Thema -, die zitierte Passage, überfließend in ihrem Assoziations- reichtum, ist bisher unkommentiert geblieben[1].
Meine Auslegung wird sich in zwei Schritten vollziehen. Zuerst werde ich der Hegelschen Deutung des Blutkreislaufs, sodann dem im Zitat unter der Bezeichnung ›springender Punkt‹ angezogenen Pulsieren nachgehen.
1. Zur Interpretation des Blutkreislaufs
a) Der Grundansatz in der Irritabilität
Die Hegelsche Darstellung des Blutkreislaufs kann als spekulative Deutung dessen verstanden werden, was die Physiologie seiner Zeit die ›Irritabilität‹ nennt. Das machen die Sätze deutlich, die unmittelbar vor der zitierten Passage sich finden:
»Das Blut ... wird nicht bewegt, sondern es ist die Bewegung - daß es bewegt werde, dazu suchen die Physiologen allerhand Kräfte auf; der Herzmuskel stößt es zunächst aus, und dazu helfen die Wandungen der Arterien und Venen, und der Druck der festen Theile, die es treiben; bei den Venen freylich hilft der Herzstoß nicht mehr - da muß es der Druck der Wandungen allein thun - dieser elastische druck derselben, und des Herzens wo kommt dieser her? von dem Reitz des Bluts - Das Herz also bewegt das Blut, und die Blutbewegung ist wieder das bewegende des Her- zens - ... [s. o.].« (ebd.)
Hegel bietet in diesen Sätzen eine Lösung der Frage nach der Blut- bewegung an. Er schlägt vor, die Suche der Physiologen nach den ›allerhand Kräften‹ abzubrechen und den ›Reitz des Bluts‹ als Aus- gangs- und Ursprungspunkt der Blutbewegung anzuerkennen[1]. Nur auf diesen Hegelschen Vorschlag ist im folgenden einzugehen.
Was meint die Rede vom ›Reitz des Bluts‹? Das Wort Reiz, bzw. Reizbarkeit ist die deutsche Übersetzung des in der damaligen Physiologie gebräuchlichen Ausdrucks ›Irritabilität‹. Zunächst ist also zu fragen: Was heißt ›Irritabilität‹?
Der Begriff der Irritabilität ist in der Physiologie durch Albrecht von Haller (1708-1777)[2] bekannt geworden. Haller hat im Jahre 1752 in einem wirkungsmächtigen Vortrag Ü ber die empfindlichen und reizbaren Teile des menschlichen Leibes ausgeführt, daß in der Irri- tabilität, der Reizbarkeit, die ›verborgene Ursache‹ und ›oberste Kraft‹ des Lebendigen gefunden sei. Nachdem er über die empfind- lichen Teile des Leibes und einige der reizbaren gesprochen hat, gelangt er in seinem Vortrag schließlich zum reizbarsten aller Teile des menschlichen Leibes: zum Herzen[1]. Das in diesem Zusammen- hang immer wieder beigezogene Exempel ist das aus dem lebendigen Frosch entnommene Herz, das noch eine Weile weiterschlägt, und
- nachdem es aus sich selbst nicht mehr zu schlagen vermag - nur einen Reiz von außen braucht, um erneut sich zusammenzuziehen[2]. Was die gesamte Herz-Blutbewegung im intakten Organismus be- trifft, so kommen Hegel und Haller in ihrer Deutung sich sehr nahe, denn auch Haller versteht sie als wechselweises Bewegen und Reizen von Muskel und Blutflüssigkeit[3]. Doch während Haller bei der Konstatierung des mit dem Herz-Blutkreislauf gegebenen ›Aufrech- terhalten eines Ganzen‹ stehenbleibt, erblickt Hegel in diesem Ge- schehen eines ›Gleichgewichts der Kräfte‹ die Möglichkeit einer metaphysischen Deutung. Die wichtige Passage sei hier noch einmal zitiert:
»Das Herz also bewegt das Blut, und die Blutbewegung ist wieder das bewegende des Herzens - es ist ein Krais - ein perpetuum
Haller noch in der Todesstunde (12. Dez. 1777) den Pulsschlag des eigenen verlö- schenden Lebens kontrollierte: »il bat, il bat, il bat - plus« seien seine letzten Worte gewesen (so: A. Elschenbroich im ›Nachwort‹ zur Gedichtauswahl Die Alpen [Stuttgart 1965]).
mobile, das sogleich stille steht, weil die Kräffte im Gleichgewich- te sind. Ebendarum ist das Blut selbst das Princip der Bewegung, es ist der springende Punkt - nichts unbegreifliches, unbekann- tes - außer wenn Begreiffen in dem Sinne genommen, daß etwas anderes, die Ursache aufgezeigt wird, von der es bewirkt wird - immer etwas anderes; diß ist aber nur die ä ußre d. h. gar keine Notwendigkeit, nicht der Grund; die Ursache ist selbst wieder ein Ding nach dessen Ursache zu fragen ist, und so fort in die schlech- te Unendlichkeit - Unfähigkeit, das Allgemeine, den Grund zu denken und vorzustellen. - no}V ist das Wesen der Welt, d. h. das Allgemeine - das Einfache, welches die Einheit entgegengesetzter ist - und daher Unbewegbare, das aber bewegt - diß ist das Blut, ...« (GW Bd. 8, S. 159)
Der Gedankengang dieser Aufzeichnung ist folgender: Hegel geht aus von der durch die wechselseitige Reizung von Herz und Blut zustandekommenden Blutbewegung, diese ist ihm ein kreishaftes, stillstehendes System, ein perpetuum mobile, darin er ein Gleichge- wicht der Kräfte ausmacht. Da nun das die Bewegung initialisierende Reizvermögen gleichermaßen im Herz und im Blut lokalisiert wird, der Schlag des Herzens aber letztlich vom Blut ausgelöst wird, liegt mit dem Kreislauf des Blutes ein System vor, das seine Bewegungs- herkunft aus sich selber nimmt: Nicht nur das sich kreisend Bewe- gende -, auch das den Kreislauf in Gang Setzende ist in der Blutsub- stanz gegeben. Konsequenterweise wehrt Hegel sowohl den Versuch ab, die Blutbewegung aus einem Anderen als ihr selbst zu begründen, wie er auch von der naheliegenden Erklärung Abstand nimmt, wonach die Ursache der Blutbewegung unbegreiflich und unbekannt sei. Eindringlich wird an dieser Stelle zwischen einem bloß oberflächlichen, in die ›schlechte Unendlichkeit‹ führenden Erklären, und einem wesentlichen, die innere Notwendigkeit des Geschehens begreifenden Denken unterschieden. Während das oberflächliche Denken die Ursache eines vorliegenden Phänomens, hier der Blutbewegung, immer wieder nur in einem anderen, äußer- lichen Ding zu finden imstande ist, - und damit, wie Hegel sagt, der ›schlechten Unendlichkeit‹ anheimfällt -, dringt das wesentliche Denken zum Allgemeinen, zum Grund des Phänomens vor[1]. Dieser
allgemeine Grund, so deklariert Hegel bezugnehmend auf das Blut, ist der no}V, der, verstanden als das ›Einfache, welches die Einheit Entgegengesetzter‹ ist, von ihm zugleich das ›Unbewegbare, das aber bewegt‹ genannt wird.
b) Aristotelische Motive
Mindestens zwei Elemente der Hegelschen Argumentation deuten auf die Übernahme Aristotelischer Motive hin. Zunächst dürfte mit der Abwehr der Annahme einer fortgesetzten Begründbarkeit der Herz-Blutbewegung ein Rückgriff auf das von Aristoteles in ver- schiedenen Zusammenhängen gebrauchte Postulat des ¿n<gkh stí- nai, des notwendigen Halts in Begründungszusammenhängen vor- liegen. Auch für Aristoteles ist, und das an entscheidenden Stellen seines Werks, ein zunächst sich anbietender Fortgang von Begrün- dungen ins Unendliche (der sog. ›regressus in infinitum‹) schließlich zugunsten eines Halts abzubrechen[1]. Wie bei Hegel - der vom drohenden Fortgang in die schlechte Unendlichkeit spricht - enthält auch bei Aristoteles das Postulat des ¿n<gkh stínai eine diskrimi- nierende Funktion. So wird etwa im Zusammenhang der Begrün- dung des Satzes vom auszuschließenden Widerspruch jenen Uner- zogenheit (¿paideusÍa) vorgeworfen, die nicht wissen, wofür ein Beweis zu suchen ist, und wofür nicht. Und Aristoteles fährt fort: »Denn daß es überhaupt für alles einen Beweis gebe, ist unmöglich, sonst würde ja ein Fortgang ins Unendliche eintreten und auch so kein Beweis stattfinden«[2]. Im siebten Buch der Physik schließlich wird das stínai, das Ruhen und Feststehen, in unmittelbare Nähe zum Wort ÈpÍstasJai gerückt: So sei der Erwerb des Wissens nicht mit einem Entstehen (gÄnesiV ) oder einer Veränderung (¿lloÍwsiV ) zu vergleichen, sondern, gerade umgekehrt, sagen wir doch, »daß durch Findung von Ruhe und Halt der Geist begreife und denke«[3].
Übertritt von dieser zu jener - falls ein solcher angestrebt wird - läßt sich letztlich nur durch einen Sprung gewinnen.
Das zweite in der Hegelschen Argumentation auftretende, an Aristoteles erinnernde Element ist die Wendung vom ›Unbewegba- ren, das aber bewegt‹. Mit dieser Wendung ist der kurz zuvor genannte no}V zusammenzunehmen. Denn: Auch Aristoteles führt im Zuge der Bestimmung des Unbewegt-Bewegenden im sechsten und siebten Kapitel des zwölften Buches seiner Metaphysik den no}V an. In den genannten Kapiteln wird, ausgehend von der Feststellung, daß mit der Kreisbewegung des Fixsternhimmels eine stetige und immerwährende Bewegung in der Natur gegeben sei, auf ein letztes unbewegtes Bewegendes geschlossen[1]. Im Zusammenhang dieses Beweisgangs - und zwar im Zuge des Aufweises, daß die ewige und d. h. ununterbrochene Kreisbewegung des Himmels ein ebenso immer in Tätigkeit befindliches Prinzip (¿rcê ) voraussetze - wird auf den no}V des Anaxagoras verwiesen. An einer Stelle im fünften Kapitel des wohl kurz zuvor entstandenen achten Buches der Physik legt Aristoteles den Anaxagoreischen no}V sogar direkt als Unbe- wegt-Bewegendes aus[2]. Vergleichen wir die beiden Bezugnahmen auf den no}V. Bei Aristoteles heißt es:
»Und so spricht Anaxagoras ganz richtig, wenn er sagt, der no}V sei leidenslos und keiner Mischung zugänglich und er ihn zum Ursprung von Bewegung macht. Nur so allein könnte er ja, selbst unbeweglich, bewegen und unvermischt (mit den Dingen) über sie walten.«[3]
Und bei Hegel:
»- no}V ist das Wesen der Welt, d. h. das Allgemeine - das Einfache, welches die Einheit entgegengesetzter ist - und daher Unbeweg- bare, das aber bewegt - diß ist das Blut, ...« (GW Bd. 8, S. 159)
Wie ersichtlich, erschöpft sich die Gemeinsamkeit der beiden Hin- weise auf den no}V in dem - allerdings ausschlaggebenden - Ansatz desselben als des Unbewegt-Bewegenden. Gravierend sind die Un- terschiede: Während für Aristoteles der no}V des Anaxagoras gerade als mit den seienden Dingen unvermischbarer in Betracht kommt, läßt sich dasselbe für den mit dem Blut identifizierten no}V Hegels wohl nicht behaupten. Ist für Hegel das selbst unbewegte Prinzip der Bewegung in und durch die Kreisbewegung selbst gegeben, liegt für Aristoteles der unbewegte Anstoß zur Bewegung gerade außer- halb des von ihm Bewegten[1]. Das Hegelsche ›Wesen der Welt‹ als das ›Allgemeine‹ und ›Einfache, welches die Einheit Entgegengesetzter‹ ist, widerstreitet ganz offensichtlich der Aristotelischen Auslegung des no}V als des mit der Welt unvermischten und leidenslosen Welt- prinzips. Der Frage, ob Hegel oder Aristoteles dem von Anaxagoras zum ersten Mal formulierten Prinzip des no}V näher kommen, ist an dieser Stelle nicht nachzugehen. Hegel nennt den Namen des Ana- xagoras nicht. Seine Deutung des no}V als Auslegung des Anaxago- reischen no}V zu verstehen, wäre deshalb unstatthaft[2]. Außerdem gibt Hegel selbst den Hinweis, wie er den von ihm angeführten no}V und das von ihm zitierte Unbewegt-Bewegende verstanden haben will: als das ›Einfache, welches die Einheit Entgegengesetzter ist‹.
c) Bemerkungen zur Entdeckung des Blutkreislaufs
Diese Kennzeichnung verweist uns aus der griechischen Philosophie zurück an die Deutung der Kreisbewegung des Blutumlaufs. Die Formel vom ›Einfachen, welches die Einheit Entgegengesetzter ist‹ greift noch einmal auf, was Hegel angesichts des stillstehenden Systems des Herz-Blutkreislaufs bereits gesagt hat: Daß das Herz das Blut bewege, daß umgekehrt die Blutbewegung wieder das Bewegende des Herzens sei, und endlich, daß das Blut als das Prinzip der ganzen Bewegung zu gelten habe. Als solches Prinzip ist das Blut das ›Allgemeine‹, der ›Grund‹ und das ›Einfache, welches die Einheit Entgegengesetzter ist‹. Von hier aus gelangt Hegel schließlich dazu, das Blut das ›Unbewegbare, das aber bewegt‹ zu nennen und es mit dem no}V zu assoziieren. Die von ihm realisierte Möglichkeit, die aus der griechischen Philosophie bekannten Titel dem Blut beizulegen, hängt mit einem Ereignis der Wissenschaftsgeschichte zusammen: der Entdeckung, daß das Blut sich in einem Kreislauf bewegt. Erst diese Entdeckung - zusammen mit der teleologischen Ausrichtung der Naturphilosophie auf den Organismus und das Leben - hat die Assoziationen Hegels ermöglicht.
Sehen wir nun zu, ob Hegel mit seiner erweiterten Deutung des Herz-Blutkreislaufs in die Nähe jener Vorstellungen kommt, die bei der unmittelbaren Entdeckung mit diesem verknüpft wurden.
Das in unserem Zusammenhang entscheidende wissenschaftsge- schichtliche Ereignis ist die Veröffentlichung von Untersuchungen über die Herz- und Blutbewegung durch William Harvey im Jahre 1628. In Harveys De motu cordis et sanguinis wird in der Geschichte der Physiologie erstmals dargestellt und bewiesen, daß das vom Herzen ausgeworfene Blut nicht irgendwo im Gewebe des Körpers sich verliert, sondern zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt und so einen geschlossenen Kreislauf (circuitus) bildet. Diese Entdeckung hatte kaum zu überschätzende Konsequenzen. W. Harvey gilt als der ›Vater der modernen Physiologie‹. K. E. Rothschuh - Autor einer Geschichte der Physiologie - beschreibt die Entdeckung des Herz-Blutkreislaufs durch Harvey als Beginn einer »autokatalyti- schen Problementfaltung« in der Physiologie[1]. Hinzu kommt, daß
1 dazu: K. E. Rothschuh, Die Entwicklung der Kreislauflehre im Anschluß an Wil- liam Harvey. Ein Beispiel der ›autokatalytischen Problementfaltung‹ in den Erfah- rungswissenschaften (1957); in: ders., Physiologie im Werden, Stuttgart 1969, S. 66-86
auch Descartes - noch bevor er das Buch von Harvey zu Gesicht bekommen hatte - die Kreislauflehre übernahm[1]. Descartes erkannte sofort, daß die Entdeckung Harveys seinen eigenen Bemühungen um eine rein mechanische Erklärung des Kreislaufgeschehens entge- genkam. Man muß sagen: scheinbar entgegenkam. Denn wie ein Blick in die Wissenschaftsgeschichtsschreibung zeigt, entbrannte sofort ein Streit um die zutreffende Deutung des neuentdeckten Phänomens: Der neu entdeckte Kreislauf des Blutes kann sowohl vitalistisch als auch mechanistisch interpretiert werden[2]. Während die mechanistische Deutung das im Inneren des Organismus arbei- tende Herz-Blutsystem v. a. unter dem Gesichtspunkt seiner Lei- stung, seiner Motorik und im Sinne eines kleinen Pumpwerks inter- pretiert, stößt der ›Vitalismus‹, nach der Herkunft der beobachtba- ren Bewegung fragend, mit ihm auf eine Quelle des Lebens. Aufge- fordert, die Hegelsche Sicht des Kreislaufs vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung zu beschreiben, hätte man beide Deutungs- muster ins Spiel zu bringen: Während seine Deutung des Kreislaufs als eines in sich ausgeglichenen Systems, als eines ›perpetuum mobi- le‹, eher in die ›mechanistische‹ Richtung weist, könnten seine Hin- weise auf das Blut als des Prinzips der Bewegung und seine daran anschließende metaphysische Deutung eher ›vitalistisch‹ genannt werden. Doch diese Titel bleiben - obwohl auf wichtiges aufmerk- sam machend - Schubladen, die nicht geeignet sind, über das in Frage stehende Phänomen und dessen Deutung Aufschluß zu geben. Neh- men wir etwa den gemeinsamen Rekurs Hegels und Hallers auf die Irritabilität: Gehört dieser Rekurs auf das Grundphänomen der Reizbarkeit einer mechanistischen oder einer vitalistischen Sicht auf den Organismus an? Die Frage ist nicht zu beantworten -, und da ß sie nicht zu beantworten ist, belegt bereits die Geschichte des Ge- brauchs des Begriffs selbst: Während Haller - der den Begriff neu aufbrachte - sich selbst von vitalistischen Tendenzen distanzierte, entwickelten seine Schüler, unter demselben Titel der Irritabilität und angesichts derselben Versuche, die Lehre von den elementaren
Kräften des Lebens[1]. Ähnlich liegt die Sache beim Entdecker des Blutkreislaufs, bei W. Harvey. Auch bei ihm finden sich beide Deutungsmuster nebeneinander: Während er im fünften Kapitel von De motu cordis die Herz-Blutbewegung mit ineinandergreifenden Rädern und mit der Mechanik eines Gewehrschlosses vergleicht, stößt derselbe Autor, in demselben Werk, im Zuge der Frage nach dem ontogenetischen Ursprung der Herz-Blutbewegung, auf das punctum saliens - und damit auf den ersten sichtbaren Ausgangs- punkt des animalischen Lebens.
2. Über den Anfang des animalischen Lebens: Das Phänomen des springend-pulsierenden Blutpunkts
Hegel nennt, kurz nachdem er den Herz-Blutkreislauf als ein in sich ausgeglichenes, bewegt-ruhendes System exponiert hat, das Blut das Prinzip der Bewegung und als solches: den springenden Punkt. Eine erste Lektüre der Passage wird dieser Bezeichnung keine besondere Beachtung schenken. Sie wird vielmehr davon ausgehen, daß Hegel hier das Blut, das er zuvor das Prinzip der Bewegung genannt hat, gleichsam zur Bekräftigung seines Prinzipiencharakters den sprin- genden Punkt nennt. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Aus- druck ›springender Punkt‹ meist zur Bezeichnung der zentralen Sache einer Angelegenheit oder eines Zusammenhangs verwendet. So auch hier. Vermutet eine unbefangene Lektüre. Und: Sie hat darin nicht ganz unrecht, - sie übersieht nur, daß an dieser Stelle des Hegelschen Manuskripts der Ausdruck ›springender Punkt‹ nicht nur zur nachdoppelnden Bekräftigung eingesetzt ist, sondern direkt das dem Zusammenhang zugrundeliegende Phänomen bezeichnet. Der alltägliche Sprachgebrauch weiß gewöhnlich nicht, daß der Ausdruck ›springender Punkt‹ ursprünglich zur Bezeichnung eines in der Physiologie beobachtbaren Phänomens geprägt wurde. Das punctum saliens oder der springende Punkt bezeichnet in der Wis- senschaft der Physiologie den pulsierenden Blutpunkt, der sich im Experiment - z. B. am bebrüteten Hühnerei - etwa am vierten Tage nach der begonnenen Bebrütung bemerkbar macht. Der springende Punkt bezeichnet also phänomenal den Anfang des tierischen Le- bens; das Tier, hier das Huhn, schwebt zu dieser Zeit gleichsam zwischen Gesehenwerden und Nichtgesehenwerden, zwischen Sein und Nichtsein: Herz und Blut sind noch nicht zu unterscheiden, der pulsierende Blutpunkt zeigt nur an, daß hier etwas am Entstehen ist. Dieses Phänomen hat auch Hegel im Auge, wenn er im Zitat das Blut den springenden Punkt nennt. Zwar ist zu vermuten, daß er nie selbst ein entsprechendes Experiment vorgenommen hat, dennoch kann man berechtigterweise annehmen - ich erwähne das naturwissen- schaftlich gebildete Umfeld seiner Jenaer Zeit -, daß Hegel weiß, wovon er spricht und schreibt, wenn er das Blut den springenden Punkt nennt[1].
Zur Veranschaulichung des Phänomens sei der Bericht eines Au- genzeugen des punctum saliens, der Bericht W. Harveys, angeführt. In seinen Exercitationes de Generatione Animalium, darin sich u. a. ein minutiöses Protokoll von Beobachtungen am bebrüteten Hüh- nerei findet, heißt es:
»Wenn am vierten Tage eine Untersuchung am Ei vorgenommen wird, ist die Metamorphose schon größer und die Verwandlung schon bewundernswürdiger -, und mit jeder Stunde im Verlaufe des Tages augenscheinlicher. In diesem Zeitraum findet der Über- gang vom pflanzlichen Leben zum tierischen Leben im Ei statt.
1 O. Breidbach vermutet, daß insbesondere die Schriften F. J. Schelvers - eines Jenaer Botanikers, um dessen Nachfolge Hegel sich zeitweise beworben hat (vgl. den Brief Hegels vom 20. Feb. 1807 an Niethammer) - zu dieser Zeit Einfluß auf ihn ausübten.
Allerdings erschien die von ihm als Beleg angeführte Schrift Schelvers Kritik der Lehre von den Geschlechtern der Pflanze, darin das punctum saliens genannt wird, erst im Jahre 1812. Das Manuskript des dritten Jenaer Systementwurfs dagegen wird in die Jahre 1805/06 datiert (vgl. O. Breidbach, a. a. O., S. 231). [An dieser Stelle sei auf einen Beitrag in der von Schelling herausgegebenen Neuen Zeitschrift für speculative Physik hingewiesen, der die Aufmerksamkeit Hegels hervorrief. N.
J. Möller hat dort im Jahre 1802 einen Aufsatz unter dem Titel Ü ber die Entstehung der Wärme durch Reibung nebst Folgerungen für die Theorie beyder Phänomene
veröffentlicht, darin er in einer ›Anmerkung‹ zum § 45 in spekulativer Weise über den Urtypus der Linie in der Natur sich ausläßt (Band I, Stück 3, S. 42ff.). Diese Urlinie, versichert N. J. Möller, ist die Eilinie. Auf den Versuch Möllers, diese Linie als eine mit der raumerfüllenden Materie sich notwendig ergebende zu konstruie- ren, ist hier nicht einzugehen. Es sei lediglich darauf hingewiesen, daß der azen- trisch-zentrische Punkt C, den Möller in die Graphik der Eilinie einträgt (ebd., S. 44), von ihm sowohl als Ort der Sonne als auch als »schlagendes oder athmendes Herz« aufgefaßt wird (ebd., S. 47). - Wie ein ›Zusatz‹ zum § 310 der Naturphilo- sophie belegt, kannte Hegel diesen Aufsatz Möllers (vgl. TWA Bd. 9, S. 201).]
Jetzt nämlich zeigt sich ein dünner, rötlicher Rand in der Eiflüs- sigkeit und, beinahe in seinem Zentrum, zuckt ein springender, blutfarbener Punkt, so klein, daß er im Moment seiner Diastole wie ein kleiner Feuerfunken hervorleuchtet, und er dann, in seiner Systole, dem Blick wieder ganz entschwindet. Als eine solches kaum sichtbares (Kommen und Verschwinden) zeigt sich der Anfang des tierischen Lebens, der von der plastischen Kraft der Natur initiiert wird!«[1]
Niemand, der diese Zeilen offenen Sinnes liest, wird sich der faszi- nierenden Kraft die vom punctum saliens offenbar ausgeht, ganz entziehen können. Wie Harvey schreibt - und er beendet den Satz auch im Original mit einem in der wissenschaftlichen Prosa unübli- chen Ausrufezeichen - ist im punctum saliens die plastische, formen- de Kraft der Natur selbst am Werk: es ist die plastica vis naturae die im punctum sanguineum saliens sich zeigt. Es ist diese Differenz von erscheinendem Phänomen und unsichtbarer Kraft, die im springen- den, d. h. erscheinenden und wieder verschwindenden Blutpunkt gleichsam ihre Veranschaulichung erhält. Wenn Harvey vom er- scheinenden Feuerfünkchen, dem ignis scintillula spricht, ist damit mehr beschrieben, als zu sehen ist: im blutroten Fünkchen zeigt sich ebensosehr die plastica vis naturae. Wir könnten, diese Beobachtung zum Ausgang nehmend, uns ins Innere der physiologisch-philoso- phischen Weltsicht Harveys vertiefen, verweisen die Worte ›Feuer‹ und ›Fünkchen‹ doch deutlich auf den ›calor innatus‹, die angebore- ne Wärme, und damit auf den Grundbegriff der Harvey’schen Bio- logie[2].
Harvey gilt als Entdecker des Blutkreislaufs. Hier beschreibt er, spürbar beeindruckt, das punctum saliens als den ersten, kaum sichtbaren Anfang des animalischen Lebens. Die Frage ist nun - und diese Frage ist im Hinblick auf die Hegelschen Ausführungen zu stellen -, welcher Zusammenhang zwischen dem Kreislauf des Blu- tes und dem punctum saliens besteht. Wie erwähnt, lassen sich im Anfangsstadium der sogenannten ›Embryogenese‹, zum Zeitpunkt, da das punctum saliens zu pulsieren beginnt, das Herz und das Blut noch nicht unterscheiden. Da von einem Kreislauf des Blutes aber nur gesprochen werden kann - und Hegel stimmt mit Harvey darin völlig überein -, wenn sich Herz und Blut unterscheiden lassen, also ausgebildet haben, und sich gegenseitig zur Bewegung reizen kön- nen, liegt der pulsierende, springende Punkt dem Herz-Blutkreislauf zeitlich vorauf. Bezeichnend ist, daß in der Geschichte der Embryo- logie zwei Thesen vertreten wurden: Während Aristoteles, der be- reits zweitausend Jahre vor Harvey den springenden Punkt beob- achtete[1], in ihm die Bewegung des Herzens ausmachte, vertritt Har- vey die These, daß es das Blut sei, darin die erste Bewegung des Lebens zu beobachten sei[2]. Hegel folgt mit seiner Auffassung - er nennt das Blut das Prinzip der Bewegung und den springenden Punkt - Harvey. Ähnlich wie der Entdecker des Blutkreislaufs sieht auch er im springenden Punkt den Anfang des sich selbst in Bewe- gung setzenden Blutes. Die Deutung der Kreislaufbewegung des Blutes führt beide an ihren Ursprung, den pulsierenden, springenden Punkt zurück[3].
Von hier aus lassen sich nun auch einige der gewagtesten Beschrei- bungen Hegels sinnvoll deuten: Wenn er von der Blutbewegung als von einer »achsendrehende[n], sich um sich selbst jagende[n] Bewe- gung« (GW Bd. 8, S. 156) oder von einem »absoluten in sich Pulsie- ren und Erzittern« spricht; oder wenn er, eine Aufzeichnung Sömmerings kommentierend, mit dem Blut eine Bewegung »gesetzt« sieht, »worin es [das Blut] verschwindet, und wieder hervortritt« und diese Bewegung ein »elastisches Erzittern« (ebd., S. 161) nennt, so sind seine Worte keine ›bloßen Metaphern‹[1]. Die Wendungen sprechen von der faszinierenden Einheit zweier Bewegungen, die mit dem Herz-Blutkreislauf gegeben sind: der in sich zurückgehen- den Kreisbewegung und der springenden Punktbewegung. Nimmt man von den beiden Bewegungen einerseits das in sich zurückkeh- rende Moment der Kreisbewegung und andererseits das Moment des Kommens-und-Verschwindens des springenden Punktes zusam- men, so läßt sich wohl von einem elastischen Erzittern sprechen. Allen Hegelschen Wendungen ist dabei eigentümlich, daß sie eine in sich strittige Einheit von Ruhe und Bewegung zu bezeichnen suchen. Das gilt sowohl von der Bewegung des Achsendrehens, wie auch vom Erzittern (darin eine hin und her gehende und doch am selben Ort bleibende Bewegung angesprochen ist) und der Pulsbewegung. Letztere hat ihren Ort - den sie als Blut verläßt und wiedergewinnt - in der Mitte des lebendigen Organismus.
Die Hegelsche Deutung des Blutkreislaufs und des ihm zugehören- den Pulsierens ist eine spekulative Deutung des Phänomens. Hegel sieht in ihm nicht nur eine rote, im Inneren des Organismus umlau- fende Substanz des Lebens, sondern verknüpft - bzw. identifiziert - das in der Natur Gegebene mit meta physischen Bestimmungen. So spricht er vom Blut als dem no}V oder dem Unbewegt-Bewegenden; vom Kreislauf des Blutes als einem perpetuum mobile, von einer Bewegung, die, nicht durch außer ihr Liegendes angestoßen, den Grund in sich selbst hat. In Übereinstimmung mit dem Sprachge- brauch der Physiologie bezeichnet Hegel das Blut als den springen- den Punkt. Der springende Punkt, sich meldend am vierten Tage einer Eibebrütung, wird auch vom Entdecker des Blutkreislaufs, dem Mediziner und Physiologen W. Harvey, als erster sichtbarer Anfangspunkt animalischen Lebens verstanden. Als Anfangs punkt des Lebens: Mit ihm ist das erste bewegte Phänomen des sich bilden- den Lebens gegeben. Aber nicht nur das. Die Pulsation des Blutes ist auch das letzte noch sichtbare Phänomen des Lebens eines Orga- nismus. Harvey spricht deshalb vom pulsierenden Blut als dem primum vivens ultimum moriens, dem ersten und letzten Lebenszei- chen eines Organismus[1]. Davon ist bei Hegel nicht die Rede. Seine spekulative Deutung tendiert sogar dazu, die Blutbewegung allein unter ihrem überzeitlichen oder unendlichen, d. h. sich selbst erhal- tenden Aspekt zu betrachten. Das Blut, als wahrhafter Grund gefaßt und mit dem no}V und dem Unbewegt-Bewegenden zusammenge- nannt, erscheint geradezu als die Manifestation eines Unendlichen im Inneren des Organismus. Doch auch für Hegel - und gerade für ihn - gehört zum Leben eines Organismus ebenso der Tod. Der Tod gehört dem Natürlichen sogar so eng zu, daß die beiden letzten Paragraphen des zweiten Teils der späteren Enzyklopädie ihn ei- gens zum abschließenden Thema der Darstellung der Naturphiloso- phie machen. »Der Tod des Individuums aus sich selbst« lautet der zweitletzte Paragraph der Naturphilosophie [2]. Auch für Hegel ist das organische Leben endliches Leben. Diese Beobachtung kontrastiert in auffallender Weise mit seiner Deutung des Systems des Herz- Blutkreislaufs. Dort lokalisiert er, wie gesehen, die wahrhafte Un- endlichkeit, den allgemeinen Grund im Inneren des Organismus. Man darf annehmen, daß auch Hegel selbst auf die geschilderte Unvereinbarkeit zwischen der Endlichkeit des Organismus und dessen in ihm angesetzten, in der Bewegung des Herz-Blutkreislaufs realisiert scheinenden Unendlichen aufmerksam geworden ist. Wieein Blick auf die den Organismus betreffenden Paragraphen der späteren Enzyklopädie zeigt (§§ 350ff.), ist er vorsichtiger gewor- den: Die im dritten Jenaer Entwurf mit dem Blut assoziierten metaphysischen Bestimmungen finden sich nicht mehr. Zwar wird vom Pulsieren als der »Aktivität in sich«, der »lebendigen Selbstbe- wegung, deren Materielles nur eine Flüssigkeit, das lebendige Blut ... sein kann«, gesprochen (TWA Bd. 9, S. 439), doch fehlen Bemer- kungen, die den Kreislauf des Blutes mit dem no}V, dem Unbewegt- Bewegenden und dem in und mit ihm gegebenen wahrhaften Grund in Beziehung bringen[1]. Diese Zurücknahme metaphysischer Bestim- mungen läßt sich, so scheint es, mit der Hegelschen Einsicht in die wesenhafte Endlichkeit des organischen Lebens verknüpfen. Denn wie soll, so wird er sich gefragt haben, im Inneren eines per defini- tionem Endlichen ein Unendliches sich manifestieren? Wie soll die zu Zeiten anfangende und zu Zeiten endende Pulsbewegung des Blutes mit einem zu keiner Zeit beginnenden und nie endenden, sich auf sich selbst beziehenden unendlichen Grund zusammengehen? Zwar ist es nach Hegel möglich, den Kreislauf des Blutes, d. h. seine nur aus ihm selbst erklärbare und damit in sich selbst gegründete Bewegung metaphysisch zu deuten, - aber ob im Inneren des leben- digen Organismus der no}V, das Unbewegt-Bewegende und der allgemeine Grund auch wirklich sind, ist damit nicht ausgemacht[2].
Eine Lösung des von uns aufgezeigten Dilemmas findet sich in den frühen naturphilosophischen Entwürfen nicht. Daß das Orga- nische nicht der eigentliche Ort des sich manifestierenden Unendli- chen sein kann, wird spätestens dann klar, wenn es stirbt. Aber ebenso klar ist, daß das Organische jenseits seiner Endlichkeit einen Reflex des Unendlichen in sich trägt: Der springende Punkt des Blutes markiert einen absoluten, nicht weiter ableitbaren Ausgangs- punkt animalischen Lebens.
Vor dem Hintergrund dieses - sich aus dem Text selbst ergeben- den - Dilemmas werden nun zwei Hinweise wichtig, die Hegel gibt. Der eine Hinweis ist die dem Manuskript anmerkungsweise beige- gebene Benennung der Zeit als des springenden Punkts (GW Bd. 8, S. 11), der andere ist die in einem zum dritten Jenaer Entwurf gehörigen Fragment konstruierte enge Verwandtschaft von Zeit und Blut. Beiden Hinweisen gemeinsam ist, daß sie einen Bezug des Organismus bzw. des springenden Punkts zur Zeit andeuten. Wäh- rend dem zweiten Hinweis an dieser Stelle nachzugehen ist - er läßt sich noch ganz naturphilosophieimmanent deuten und wird darin gipfeln, daß Hegel dem Organismus die Zeitform der Dauer zu- spricht - müssen wir die Assoziation von Zeit und springendem Punkt vorerst zurückstellen; sie läßt sich erst später in ihren Konse- quenzen entfalten.
Das Fragment, darin Hegel einen Zusammenhang von Organis- mus, Raum, Zeit und Blut konstruiert, ist von der Hegelforschung bislang kaum beachtet worden - zu absurd scheint das darin Ausge- führte zu sein. Im Zuge unserer Entwicklungen gewinnt das Blatt zur Naturphilosophie dagegen eine herausragende Bedeutung. Denn klar ist: Nur wenn es Hegel gelingt, den Organismus mit der Zeit in einen inneren Zusammenhang zu bringen, ergibt sich die Möglich- keit, das in ihm sich manifestierende Unendliche mit seiner wesen- haften Endlichkeit zu vermitteln.
3. Organismus, Raum, Zeit und Blut
Das Blatt zur Naturphilosophie [1] beginnt mit einer Exposition des Organismus als der »Einheit des inneren und Äußern«. Das Äußere ist als die Gestalt, das Innere als der Prozeß des Gestaltens verstan- den; die Einheit der beiden Seiten ist dadurch gegeben, daß das Äußere, als das Andere des Inneren verstanden, über den »in sich zurückkehrende[n] Kraislauf « an das Innere zurückgebunden, und in ihm als Aufgehobenes ist. Das Selbst des Organismus wird des- halb, als Zusammen von Prozeß und Gestalt, die »Einheit seines Bluts« genannt. Dieser Kreislauf des Bluts, oder, wie Hegel auch sagt, dieses » reine Thun «, repräsentiert eine »höhere Ruhe « als die
Ruhe der Gestalt es ist, die dem bewegten Prozeß entgegengesetzt ist; er ist, als das »allgemeine beyder«, der »Grund« und d. h. »der unruhige Begriff, der sich selbst gleich ist « (GW Bd. 8, S. 291). - Soweit der erste Absatz der Aufzeichnung. Erkennbar ist die Ähn- lichkeit mit den bereits besprochenen Ausführungen zum Blutkreis- lauf. Auch dort hatte Hegel, indem er die Bewegung des Blutes mit dem ›Unbewegbaren, das aber bewegt‹ zusammenbrachte, eine ›hö- here Ruhe‹ eines ›unruhigen Begriffs‹ im Auge. Und: Auch dort wurde das im Inneren des Organismus kreisende Blut als nicht weiter ableitbarer Grund vorgeführt.
Anders der nun folgende Absatz. Zwar bezieht sich Hegel klar auf das bereits Gesagte und uns Bekannte - der Absatz beginnt mit einem ›hiedurch‹ - dies aber nur, um eine desto weitgehendere Öffnung zu vollziehen. Er führt den Raum und die Zeit in die Rede vom Organismus ein:
»Hiedurch ist der Organismus in die reine Idealität erhoben die vollkommen durchsichtige Allgemeinheit; er ist Raum und Zeit
- nicht raümlich oder zeitlich, so daß diese reines Prädikat wären, eines Subjekts, sondern er ist diese Anschauung; er schaut etwas an, das raümlich und zeitlich ist, d. h. das von ihm unterschieden, anderes, und es unmittelbar nicht ist.« (ebd.)
Die Naturphilosophie Hegels, das machen diese Sätze noch einmal deutlich, ist eine spekulative Deutung der Natur. Wie an dieser Stelle vom in sich ruhenden - aber bewegten - Kreislauf des Blutes zu- nächst der Schritt zur »durchsichtigen Allgemeinheit« und schließ- lich zur Aussage vollzogen wird, daß der Organismus Raum und Zeit »ist« (Hegel hebt hervor), scheint zunächst unnachvollziehbar. Nur zögernd wird man darangehen, den Text ernstzunehmen.
Zur Deutung des Absatzes ist noch einmal bereits Gesagtes in Erinnerung zu rufen. Hegel hebt das Organische als das sich auf sich selbst beziehende Lebendige vom Un organischen ab. Im Prozeß dieses sich Abhebens, und d. h. faktisch: im Prozeß des Essens und Trinkens, wird das Unorganische vom Organischen ›umgeschmol- zen‹ (s. o.) oder als selbständig Seiendes aufgehoben. Analog zu dieser in der äußeren Natur beobachtbaren Beziehung des Organi- schen auf das Unorganische wird der Organismus als Einheit von Innerem und Äußerem, von Gestalten und Gestaltetem angesetzt. Dabei ist es wichtig, zu sehen, daß mit der Übertragung des Verhält- nisses sich der negative oder vernichtende Bezug des Organischen
auf das Unorganische in einen positiven oder setzenden Bezug des Inneren auf das Äußere wandelt: Die Glieder des Organismus sind zwar ein Äußeres und gleichsam das Unorganische des lebendigen Organismus - sie werden von seinem Inneren ständig zurückgenom- men und aufgehoben -, aber nur so, daß dies Innere sie ebenso ständig hervorbringt. Hegel formuliert einmal knapp, daß das Blut in »seinem Gegensatze ebenso gibt als verzehrt« (GW Bd. 6, S. 231), also sowohl setzend als auch aufhebend tätig ist. In unserer Auf- zeichnung wird diese Deutung des Organismus - unterstützt durch eine spekulative Betrachtung der Blutbewegung - zur Aussage ge- steigert, daß mit dem Organismus eine »reine Idealität« und eine »vollkommen durchsichtige Allgemeinheit« gegeben sei. Von hier aus kommt es schließlich zu jenen Sätzen, die vom Organismus sagen, daß er Raum und Zeit »ist«. Dazu kommt Hegel, weil er seine eigenen Worte von der ›reinen Idealität‹ und der ›durchsichtigen Allgemeinheit‹ ernst nimmt: Da Raum und Zeit (seit Kant)[1] als reine, allgemeine und a priorische Anschauungen gelten, dem Organismus aber die obengenannten Attribute zugesprochen werden können, »ist« er - der Organismus - schließlich Raum und Zeit. Hegel präzisiert sofort das naheliegende Mißverständnis, als sei damit vom Organismus gesagt, daß er räumlich und zeitlich sei, also einer Anschauung sich als Räumliches und Zeitliches darbiete, - vielmehr, sagt er, »ist« der Organismus »diese Anschauung«.
Ähnlich wird dieser Zusammenhang in einer längeren Randbemerkung innerhalb des dritten Jenaer Systementwurfs ausgesprochen. Auch dort geht er von der »innerlichen Idealität« des Organismus aus, - und er fährt fort:
»er, der Organismus, existirt als ideelles, in seine Einfachheit zurükgekehrtes; einfache selbstische Substanz des Ganzen - de- ren Selbst das Anderssein vollkommen durchsichtig ist, weil sie sich selbst hervorbringt; Kraislauff Blut, dem das Andre das er aufzehrt, so wie erzeugt, dasselbe Selbst ist; - es unterscheidet seine Glieder von sich.« Und weiter:
»Diese Idealität ist unmittelbar der Organismus. Raum und Zeit sind die Formen seiner Anschauung; ungegenständliche Gegenständlichkeit, der Sinn.« (GW Bd. 8, S. 165)
Dieser Text bringt gegenüber dem oben Zitierten nichts eigentlich neues, aber er verdeutlicht das Gesagte. An ihm wird noch klarer erkennbar, daß die Identifikation des Organismus mit Raum und Zeit vor dem Hintergrund einer bestimmten Deutung des Kreislaufs und der Substanz des Blutes vollzogen wird. Der ›selbstischen Sub- stanz‹ ist »das Anderssein vollkommen durchsichtig, weil sie sich selbst hervorbringt«, gleichwie dem »Kraislauff Blut - ... das Andre das er aufzehrt, so wie erzeugt, dasselbe Selbst ist«. Mit diesen Worten wird präzisiert, was unter der im Inneren des Organismus angesetzten Durchsichtigkeit und Idealität zu verstehen ist. Dem ebenso aufzehrenden wie erzeugenden Blut ist das Andere - die Glieder des Organismus werden erwähnt - vollkommen durchsich- tig, d. h. es unterscheidet etwas von sich und identifiziert das Andere mit sich - im selben Moment. Diese, in einem Medium völliger Transparenz angesetzte, gleicherweise unterscheidende und identi- fizierende Tätigkeit der Substanz und des Kreislaufs des Blutes wird in die Beschreibung der Anschauungsformen von Raum und Zeit aufgenommen: Auch die Anschauung »schaut etwas an, das räum- lich und zeitlich ist, d. h. das ... unterschieden, anderes, und es unmittelbar nicht ist« (s. o.). Hegel hebt hier die Worte ›räumlich‹ und ›anderes‹ hervor, es scheint, als unterscheide er damit die Weise, wie im Organismus die Anschauungsformen der Zeit und des Raum integriert sind. Zu vermuten ist, daß, falls Hegel eine solche Unter- scheidung ansetzt, er die Zeit eher dem Inneren, den Raum aber dem Äußeren des Organismus zuordnet[1]. Diese Vermutung wird bestä- tigt. Hegel schreibt, bezugnehmend auf den Organismus: »Das Für- sich ist Zeit - das Ansich[,] die Gestalt[,] ist Raum « (GW Bd. 8, S. 164). Während die Zeit den Ort des Selbstbezugs, d. h. das Für- sichsein des Organismus markiert, wird der Raum mit der Gestalt, dem Ansich des Organismus identifiziert. Wird nun diese Differenz von Fürsich und Ansich des Organismus nicht statisch in einem Nebeneinander belassen, sondern mit der im Inneren des Organis- mus stattfindenden Bewegung des Unterscheidens und Identifizie- rens verknüpft, so wird eine weitere Redeweise verständlich: »Der Organismus«, heißt es im bereits bekannten Blatt zur Naturphiloso- phie, »ist selbst die Zeit, das sich selbst bewegende; er zieht sich in seine einfache Zeit zurück, setzt sich als aufgehobnen Raum «.
Damit ist die Analogisierung - wenn nicht: die Identifizierung - von Organismus und Raum und Zeit vollständig durchgeführt, und damit wird die Verwandtschaft - wenn nicht: die Identität - von Zeit und Blut evident: Da in der Beschreibung des Organismus beide dieselbe Funktion eines sich selbst Bewegenden, das Äußerliche aufhebenden Inneren übernehmen, und der Organismus Raum und Zeit »ist«, werden Zeit und Blut einander derart angenähert, daß es scheint, als seien sie durcheinander ersetzbar[1].
Vor dem Hintergrund dieser Hegelschen Konstruktionen um Orga- nismus, Raum, Zeit und Blut ist schließlich seine Grundthese zum Organismus zu lesen: »Die Dauer«, sagt er, »existirt hier [d. h. im Organismus] als solche« (GW Bd. 8, S. 292). Vergleicht man diese Zuschreibung mit den Expositionen zum Begriff der Dauer inner- halb des ersten Teils der Naturphilosophie, des Teils zum Mechanis- mus, so fällt auf, daß, so wie dort die Dauer als die »Substanz« (ebd., S. 14) des Raumes und der Zeit abgehandelt wird, sie hier mit dem »Selbst« und dem »Subjekt« (ebd., S. 292) in Zusammenhang ge- bracht wird. Übereinstimmend mit dem Gesamtverlauf der Natur- philosophie hat sich auch der Ort der Dauer - die in beiden Fällen als das Resultat und der Ort der Übereinkunft von Raum und Zeit angesetzt wird - aus dem Äußeren in das Innere verschoben. Nimmt man hinzu, daß diese Verschiebung von einer untergründigen Ver- wandtschaft von Zeit und Blut unterstützt wird, und Hegel außerdem den springenden Punkt vom Blut auf die Zeit überträgt, so wird die mit der Naturphilosophie des letzten Jenaer Entwurfs geschaffene offene Situation überdeutlich.
Ü bergang im Blick stand. Wie konnte diese Differenz entstehen? Sie konnte entstehen, weil Hegel gleich zu Beginn des Kapitels über die sinnliche Gewißheit eine Scheidung zwischen der darin thematisier- ten Gestalt des Bewußtseins und einem ›wir‹ der seiner Entwicklung Zusehenden vornimmt[2].
Wie gesehen, läßt Hegel die sinnliche Gewißheit sprechen. Diese Rede ist an ›uns‹ - die wir ihr zuhören - gerichtet. Darin sagt sie, die sinnliche Gewißheit, »von dem, was sie weiß, nur dies aus: es ist «. Indem nun einerseits das auf die Rede des sinnlichen Bewußtseins hörende ›wir‹ nur hört, daß dieses von allem und jedem nur sagt, daß es ist, andererseits aber sieht, daß ein je einzelner Dieser von einem je einzelnen Diesen eben dieses Sein aussagt, ist die Differenz zwi- schen der im Satz ausgedrückten allgemeinen Anwesenheit des Sei- enden und der je von einer sinnlichen Gewißheit gemeinten spezifi- schen Gegenwart desselben gegeben. Daraus erhellt, daß das reine Sein des sinnlichen Wissens von diesem geistlos realisiert wird, d. h. es wird nur realisiert, weil ein zuhörendes ›wir‹ seine Rede von allem Situativen reinigt und so schließlich eine Aussage über das Seiende im Ganzen darin ausfindig machen zu können glaubt. So muß man sagen: Zum reinen Sein der sinnlichen Gewißheit gehören eigentlich zwei Beteiligte, einmal die sich aussprechende Gestalt des Wissens, die, ein allgemeines sagend, nicht weiß, was sie sagt, und das ›wir‹ des Phänomenologen, welches das von ihr Gesagte hörend zu deuten versteht.
Das erste Kapitel der Phänomenologie zur sinnlichen Gewiß- heit ist nichts anderes als die Ausfaltung des mit dieser Grundanlage gegebenen. Die Bestimmung des Horizonts des reinen Seins wird sich entsprechend von ihr her ergeben müssen. Damit ist zugleich gesagt: Der von Hegel angesetzte Horizont zur Bestimmung des reinen Seins liegt weder im anwesend Seienden als solchen noch in der je einzelnen Gegenwart einer sich aussprechenden sinnlichen Gewißheit. Zwar wird, der Anlage entsprechend, der Sinn des reinen Seins von diesen beiden Seiten her gebildet, selber liegt er aber in einem vermittelnden Dritten. Zu vermuten ist, daß auch dieses Dritte als ein temporal Bestimmbares sich ergeben wird. Auf dieses Dritte stoßen wir, wenn wir nun genau darauf achten, wie Hegel die beiden Seiten miteinander ins Gespräch kommen läßt. In der Kon- sequenz seiner Grundanlage liegt nämlich, daß auch Rückfragen des ›wir‹ des Phänomenologen an die sinnliche Gewißheit möglich sind. Also fragen ›wir‹ sie doch zurück, was sie denn meint, wenn sie von einem Diesem spricht:
» Sie ist also selbst zu fragen: Was ist das Diese ? Nehmen wir es in seiner doppelten Gestalt seines Seins, als das Jetzt und als das Hier, so wird die Dialektik, die es an ihm hat, eine so verständliche Form erhalten, als es selbst ist. Auf die Frage: was ist das Jetzt ? antwor- ten wir also zum Beispiel: das Jetzt ist die Nacht. Um die Wahrheit dieser sinnlichen Gewißheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese Wahrheit auf; eine Wahrheit kann durch aufschreiben nicht verlieren; ebensowenig dadurch, daß wir sie aufbewahren. Sehen wir jetzt, diesen Mittag, die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so werden wir sagen müs- sen, daß sie schal geworden ist.« (ebd., S. 84)
Man beachte, daß in diesem Abschnitt das ›wir‹ des Phänomenolo- gen nicht nur die Frage stellt, sondern auch die Antwort gibt. »Auf die Frage: was ist das Jetzt ? antworten wir also zum Beispiel ... «. Zu dieser Rollenübernahme kommt es, weil die Frage: Was ist das Diese? zunächst in die Frage nach dem Hier und dem Jetzt verwan- delt wird[1]. Auf die gestellte Frage gibt das ›wir‹ die Antwort: Das Jetzt ist die Nacht. Und: »Um die Wahrheit dieser sinnlichen Ge- wißheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schrei- ben diese Wahrheit auf; ...«. In der Folge wird begründet, warum das Aufschreiben als die Prüfung der Aussage der sinnlichen Gewißheit gelten kann: Durch das Aufschreiben, wie durch das Aufbewahren, verliert die Wahrheit nichts. Dahinter liegt: Die Wahrheit bleibt in ihrem Aufgeschriebensein erhalten. Hegel gibt also, nachdem er das zusehende und fragende ›wir‹ die Antwort auf die Frage nach dem Jetzt der sinnlichen Gewißheit hat geben lassen, einen Maßstab zur Prüfung der Wahrheit der sinnlichen Gewißheit - und damit des reinen Seins - an, der seine Auszeichnung darin hat, daß er dauert. Dies Dauernde ist die geschriebene Sprache; an ihr »widerlegen wir unmittelbar unsere Meinung« (ebd., S. 85) und in ihr ist das »sich erhaltende Jetzt ... nicht ein unmittelbares, sondern ein vermitteltes« (ebd., S. 84), ein allgemeines Jetzt. Nicht anders beim Hier. Auch das »Hier selbst verschwindet nicht; sondern es ist bleibend im Ver- schwinden des Hauses, Baumes usf. und gleichgültig, Haus, Baum zu sein« (ebd., S. 85). Hegel unterstreicht das ›es ist‹ in diesem Satz. Damit deutet er zurück auf die anfängliche Aussage der sinnlichen Gewißheit. Hätte er alle aufeinanderfolgenden Worte zum Hier, die Worte ›es ist bleibend im Verschwinden‹ unterstrichen, hätte er zusätzlich zum Hinweis auf das reine Sein auch den Horizont seiner Auslegung angegeben: Dieser Horizont ist in der Dauer gegeben.
Die Dauer ist das gesuchte Dritte gegenüber der Anwesenheit des Seienden im Ganzen, dem ›es ist‹, und der je einzelnen Gegenwart einer sinnlichen Gewißheit, dem Diesen. In ihr als ihrem Maßstab - der zugleich Resultat ist - treffen und vermitteln sich die beiden Seiten. Abschließend heißt es:
»Dieser sinnlichen Gewißheit, indem sie an ihr selbst das Allge- meine als die Wahrheit ihres Gegenstandes erweist, bleibt also das reine Sein als ihr Wesen, aber nicht als Unmittelbares, sondern [als] ein solches, dem die Negation und die Vermittlung wesent- lich ist.« (ebd., S. 85)[1]n- gestellt. Nun gibt es aber, neben der darin sich ausdrückenden Hochschätzung des Lebendigen, einen zweiten Grundzug des Hegelschen Denkens, nämlich die Hochschätzung des freien Wil- lens des Menschen. Diese beiden Schätzungen können in ihrem Aufeinandertreffen zu Konflikten führen. Und sie tun es an dieser Stelle. In den eben besprochenen frühen Bemerkungen zum Blut- verbot der Juden ist der Konflikt noch hintangehalten. Schlagen wir aber die späteren Vorlesungen über die Philosophie der Religion an der Stelle zum Kultus der Juden auf, wird es anders. Hegel spricht zwar auch hier von einem ›Zurückgeben‹ der ›Le- bendigkeit‹ an den ›Herrn‹, von einem Kreis des Lebens also, der im und durch den Kultus des Tieropfers anerkannt wird. Der Schlußsatz aber macht dann deutlich, daß diese Verehrung eines ›Unantastbaren, Göttlichen‹ zu überwinden ist: »Der Mensch hat noch nicht das Gefühl seiner konkreten Freiheit, vor welcher das bloße Leben als Leben etwas Untergeordnetes ist« (TWA Bd. 17, S. 92). Was in der einen Sphäre also eine bemerkenswerte Achtung vor dem Leben ist, ist in der anderen ein bloßes Unvermögen zum Entschluß, - auf die Tiere zuzugehen und sie zu verspeisen. Dieser Unterschied in der Bewertung desselben ist nicht von der Sache her bestimmt, sondern von der Perspektive, unter der sie er- scheint.
Die Perspektive Hegels ist diejenige des Christentums. Der obener- wähnte Konflikt erhält seine Lösung in der Verspeisung des Christus im Abendmahl. Darin ist das ehrende Andenken an Gott und das Leben mit der konkreten Freiheit zusammengebracht. Es ist hier nicht das Blut eines Tieropfers, das, von Gott zurückverlangt, den Kreis des Lebens außerhalb des Kultus beläßt, sondern die Selbst- opferung eines Menschen, der sein Blut als Gabe Gottes faßt und als Sakrament einsetzt. Der Bruch mit den Gebräuchen des Judentums könnte nicht größer sein: Was dort im Bezug auf die Tiere einem ausdrücklichen Verbot unterstand, wird hier zum kultischen Mittelpunkt der Gründung einer neuen Religion[1].
Hegels Bezugnahme auf das Hauptsakrament des Christentums ist zunächst zurückhaltend. In der noch in Bern (1793-1796) verfaß- ten Studie zur Positivität der christlichen Religion [2] wird das Abend- mahl lediglich zur Illustration herangezogen. Auch an dieser Hand- lung lasse sich zeigen, daß sie »in dem Munde und unter den Augen des Tugendlehrers Jesu selbst eine ganz andere Gestalt« (TWA Bd. 1, S. 128) gehabt hätte, als sie in der allgemeinen Sekte dann erhielt. Unbelastet durch »dogmatische Begriffe« lese sich die Geschichte des letzten Abends, den Jesus noch im Schoße der vertrauten Freundschaft zubrachte, als »rührend[e] und menschlich[e]« Art, das jüdische Passah in ein »Sinnbild« zu verwandeln, das das Anden- ken an ihn mit Teilen des Mahls in Verbindung setze (ebd.). Hegel wehrt die aus den Einsetzungsberichten entwickelten, positiven Theologumena ausdrücklich ab, wenn er sagt, daß »der so lange durchgeführte Gebrauch der Worte Blut und Fleisch, Speise und Trank« in Joh. 6.47ff. »selbst von Theologen für etwas hart erklärt« (ebd., S. 128f.) worden sei. In der Berner Zeit ist ihm allein die »freundschaftliche Unterhaltung«, das »gesellige Beisammensein« und die »wechselseitige Öffnung und Aufheiterung der Gemüter« während des letzten Mahls erwähnenswert, - eine Auslegung der harten Worte von Blut und Fleisch etc. findet nicht statt. Hegel selbst mußte diesen Mangel empfinden, denn seine Studie hatte sich zur Aufgabe genommen, dasjenige in der Religion Jesu aufzuspüren, was - jenseits bloßer Postulate der Vernunft - »die Veranlassung gab, daß sie positiv wurde« (ebd., S. 111)[3]. Nun ist das Mysterium des Abendmahls aber genau dies: Uneinsehbar für die Vernunft, d. h. nur zu glauben (die Vernunft hatte für Hegel noch nicht die Bedeutung der spekulativen Vernunft), und gleichzeitig Anlaß für das Positivwerden des Christentums (Kirche). Hegel spricht diese Tatsache in seinen Jugendschriften nie aus.
Auch die zweite - nun ausführlichere - Schilderung des letzten Mahls Jesu im Geist des Christentums erkennt in ihm noch nicht den Ausgangspunkt zur Selbstinterpretation der Kirche.
Ein anderes steht im Vordergrund: die Liebe. Hegel interpretiert die Einsetzung der Sakramente durch Jesus im Geist des Christen- tums als die »Feier eines Mahls der Liebe« (ebd., S. 364). In der Liebe glaubt Hegel schließlich die gelingende Vereinigung von Subjekti- vem und Objektivem, von Praktischem und Theoretischem - und d. h. von praktischem Subjekt und theoretischem Objekt - gefunden zu haben. »Die theoretischen Synthesen werden ganz objektiv, dem Subjekt ganz entgegengesetzt. Die praktische Tätigkeit vernichtet das Objekt und ist ganz subjektiv - nur in der Liebe allein ist man eins mit dem Objekt, es beherrscht nicht und wird nicht beherrscht« (ebd., S. 242). In ihr wird, endlich, der wiederzuerlangende Ur-Zu- stand von vor der Entzweiung gefunden: »In der Liebe ist das Getrennte noch, aber nicht mehr als getrenntes, [sondern] als Eini- ges, und das Lebendige fühlt das Lebendige«, heißt es in einem Entwurf (ebd., S. 246). Das Leben, die Liebe, sind keine Begriffe, keine Reflexionsprodukte mehr, sie überwinden vielmehr alle Tren- nungen und führen zurück an jenen Ort, von dem die christliche Religion auszugehen scheint. Sie sind ein letztes in der Überwindung der Philosophie - insbesondere der Kantischen - und ein erstes in der Gründung der Religion: für den Hegel jener Zeit (ab 1797) der ideale Ausgangspunkt einer umfassenderen Auslegung: »Vereini- gung und Sein sind gleichbedeutend« (ebd., S. 251).
Die Auslegung des Abendmahls ist vor diesem Hintergrund zu lesen. Auch in ihm findet eine Vereinigung statt, aber eine solche, die noch nicht eine »durch Einbildungskraft objektivierte« ist. Insofern ist »dieses Mahl also auch keine eigentliche religiöse Handlung«; und doch nähert sich das Mahl einer solchen, denn »bei dem Mahle der Liebe kommt doch auch Objektives vor«, und dadurch wird es »schwer, seinen Geist deutlich zu bezeichnen«. Hegel spricht von einem Schweben des Mahls, da in ihm zwar ein äußerer Anknüp- fungspunkt gegeben sei, dieser aber dennoch das Ganze nicht in » ein Bild« zu vereinigen vermöge. - Die Differenz zwischen dem in der Empfindung vollständig zerrinnenden Äußeren im Mahl und dem positiven Bestehenbleiben eines Bildes organisiert die Darstellung. Unter diesem Gesichtspunkt verbleibt das im Abendmahl verspro- chene Göttliche im Unerfüllten: Im Mahl der Liebe bleibt nichts zurück, kein Stein und Marmor, keine Gestalt, die zur wiederholten Andacht und Vereinigung auffordern würde. Hegel erzählt die Ge- schichte des Abendmahls als einmaliges Ereignis, er erkennt nicht, daß in der Aufforderung Jesu ›Dies tut zu meinem Gedächtnis‹ die Einsetzung eines zu Wiederholenden geschieht. Nur dies erklärt, weshalb er der Szenerie dieses Mahls keinen religiösen Status zubil- ligt. Hegel nähert sich den Einsetzungsberichten gleichsam naiv, als ob diese ohne Wirkung und Folgen geblieben wären. Es ist diese Naivität der vermeintlich erstmaligen Auslegung des Geschehens, die dem Text Unmittelbarkeit verleiht. Diese Unmittelbarkeit läßt sich am schwebenden Vibrieren abnehmen, das den Hegelschen Gedanken in der Beschreibung der Transsubstantiation begleitet.
Im Mahl Jesu kommt also ein Zweifaches zusammen: Einmal das Mahl als eine gemeinschaftliche Veranstaltung unter Freunden, die aller Empfindung betrifft, dann aber »das Weitere, die Erklärung Jesu: dies ist mein Leib, dies ist mein Blut«, dadurch die Empfindung »zum Teil objektiv« wird (TWA Bd. 1, S. 365). Die Objektivität der Vereinigung ist im Brot und im Wein gegeben. Doch Brot und Wein sind nicht nur Brot und Wein, sondern die von Jesu bezeichneten, ihn selbst bezeichnenden Teile seiner selbst: sein Fleisch und sein Blut. Dadurch liegt in der Handlung des Austeilens ein »mehr« als in ihr gesehen wird: sie ist eine »mystische Handlung« (ebd.). Dies ›Mehr‹ kommt nun aber nicht dadurch zustande, daß den Objekten von Außen eine Erklärung angehängt wird, vielmehr sind, durch die unmittelbare Einheit des Austeilens, des Benennens und des Genuß- es, »die Heterogenen ... aufs innigste verknüpft« (ebd., S. 366). Hegel macht in der Einheit des Abendmahls eine Verknüpfung aus, die nicht vom Denken, dem Vermögen des Vergleichens, gestiftet sein kann. Das innige Einbehaltensein von Brot und Wein in das Gesamt- geschehnis macht, daß sie, für das Denken unerreichbar, zu »mysti- sche[n] Objekte[n]« (ebd.) werden. Das obengenannte ›Mehr‹ meint nichts anderes als diese Verwandlung, die in und mit dem Brot und dem Wein zu geschehen hat:
»Hier, im Abendmahl, werden Brot und Wein mystische Objekte, indem Jesu sie seinen Leib und Blut nennt und ein Genuß, eine
Empfindung unmittelbar sie begleitet; er zerbrach das Brot, gab es seinen Freunden: Nehmet, eßet; dies ist mein Leib, für euch hingegeben; so auch der Kelch: Trinket alle daraus; dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, über viele ausgegossen zur Entlassung der Sünden.«
Und der Text fährt fort:
»Nicht nur der Wein ist Blut, auch das Blut ist Geist; der gemein- schaftliche Becher, das gemeinschaftliche Trinken [ist] der Geist eines neuen Bundes, der viele durchdringt ... usw.« (ebd.)
Im zweiten Teil des Zitats wird vom Geist gesprochen. Der Geist ist das über dem Abendmahl Schwebende. Der Wein, der zunächst als Objektives vor Jesus und seinen Jüngern steht, wird in und durch die Benennung als Blut und seinem gleichzeitig geschehenden Ge- nuß zum Geist. Benennung und Genuß heben ihn auf. Die Vermitt- lung leistet das Blut. Es wird im entscheidenden Satz zweimal ge- nannt: zuerst als das Ende einer Verwandlung aus dem Wein, dann als der Anfang einer Verwandlung in den Geist. In ihm als der verknüpfenden Mitte verdichtet sich das Geschehen des sprechen- den Handelns - oder des handelnden Sprechens - zur Gründung des Bundes. »Vereinigung und Sein«, vermerkt Hegel, »sind bleichbe- deutend«; und er fügt zur Erläuterung hinzu: »in jedem Satz drückt das Bindewort ›ist‹ die Vereinigung des Subjekts und Prädikats aus - ein Sein« (ebd., S. 251). Indem Jesus spricht ›Dies ist mein Leib; dies ist mein Blut‹ und das Brot und den Wein austeilt, behält er die Stücke doch auch in sich zurück - die Austeilung und Teilung des Mahls, vorgängig im Sprechen aufgehoben, ist ebensosehr die Ver- einigung im Mahl. Das ›ist‹ des ›Dies ist‹ kehrt über das geforderte Verzehren des damit Angesprochenen zum Austeilenden zurück: So durchdringt und vereinigt das Sprechen des Mittlers die versammelte Schar. Ihre Vereinigung ist ihr Sein - in seinem Blut. Das übersteigt jeden Begriff:
» ... sie sind alle Trinkende, ein gleiches Gefühl ist in allen; vom gleichen Geiste der Liebe sind alle durchdrungen; wäre ein aus einer Hingebung des Leibes und Vergießung des Blutes entstan- dener Vorteil, Wohltat dasjenige, worin sie gleichgesetzt wären, so wären sie in dieser Rücksicht nur im gleichen Begriff vereinigt; indem sie aber das Brot essen und den Wein trinken, sein Leib und
sein Blut in sie übergeht, so ist Jesus in allen, und sein Wesen hat sie göttlich, als Liebe durchdrungen.«
Und weiter:
»Aber die objektiv gemachte Liebe, dies zur Sache gewordene Subjektive kehrt zu seiner Natur wieder zurück, wird im Essen wieder subjektiv. Diese Rückkehr kann etwa in dieser Rücksicht mit dem im geschriebenen Worte zum Dinge gewordenen Gedan- ken verglichen werden, der aus einem Toten, einem Objekte, im Lesen seine Subjektivität wiedererhält. Die Vergleichung wäre treffender, wenn das geschriebene Wort aufgelesen, durch das Verstehen als Ding verschwände; so wie im Genuß des Brots und Weins von diesen mystischen Objekten nicht bloß die Empfin- dung erweckt, der Geist lebendig wird, sondern sie selbst als Objekte verschwinden.« (ebd., S. 367)
Zwei Bemerkungen zu dieser Passage:
1. Die Tatsache des Vergleichs. In einem Feld, das wiederholt außer- halb aller Gleichwie ’ s, das bar aller Möglichkeiten zum Vergleich angesetzt wurde, gibt es nun den Vergleich zwischen Essen und Lesen [1]. Was aber bedeutet es, daß an jener Stelle, an der von Hegel dem Unvergleichlichen etwas an die Seite gestellt wird, es die Schrift ist, auf die er zurückgreift?
2. Die Struktur der Rückkehr. Das Brot und der Wein, die als solche zunächst nur als zu Verzehrende in Betracht kommen, werden von Jesu benannt: ›Dies ist mein Leib, Dies ist mein Blut‹. Dadurch wird dem Äußeren der Bezug auf den Leib Christi wesentlich, ein Bezug, der im gemeinsamen Verzehr seine Realisierung erhält. Hegel spricht von einer objektiv gemachten Liebe, die im Essen wieder subjektiv werde und zu ihrer Natur zurückkehre. Analog beim geschriebenen Wort. Dieses, herkommend aus der Innerlichkeit eines sich Äußern- den, erhält im Lesen, d. h. im Auffassen seines Sinns, ebenfalls seine ›Natur‹ zurück[2]. Präzisierend wird angefügt, daß der Vergleich tref1 J. Derrida, der die Stelle in Glas liest und auslegt, vermutet, daß »der Vergleich mit dem Lesen dasjenige selbst bestimmen soll, das der Struktur des Vergleichs ent- wischt« (»La comparaison avec la lecture doit ici definir cela même qui échappe, à la structure comparative.« (J. Derrida, Glas I, 1981, S. 98a) fender wäre, wenn das »geschriebene Wort aufgelesen, durch das Verstehen als Ding verschwände«[1], d. h. das Tote des Buchstabens vollständig überwunden würde und das geschriebene Wort im le- bendigen Geist sich aufhöbe. Es ist diese Steigerung des Vergleichs, die nochmals deutlich macht, daß Hegels Auslegung des Abend- mahls ganz der Unmittelbarkeit des ersten Mahls verpflichtet ist: Hätte er nämlich die Sprachlichkeit - und d. h. hier: die Wiederhol- barkeit - der Einsetzungsworte ›Dies ist mein Leib, Dies ist mein Blut‹ ernst genommen, und sie nicht als nur transitorische Momente im schließlichen Essen des Mahls zum Verschwinden gebracht, hätte er weder seinen Schriftvergleich zu präzisieren, noch das Abend- mahl außerhalb der religiösen Handlungen zu belassen brauchen. Im Vergessen aber, daß die das Brot und den Wein bezeichnenden Einsetzungsworte nicht mit dem von ihnen Bezeichneten gleichen Wesens sind, sondern bleibend und eine Religion zu konstituieren fähig sind, folgt Hegel, so G. Fessard, »der lutherischen Doktrin, die die Scheidung von Konsekration und Kommunion verneint«[2].
Halten wir fest: Hegel vergleicht das Essen und das Lesen vor dem Hintergrund einer beiden gemeinsamen Bewegung der Rückkehr. Ein weiteres Resultat unserer Lektüre war die Einsicht in die Ver- mittlerrolle des Blutes. Der das Abendmahlsgeschehen kommentie- rende Satz: »Nicht nur der Wein ist Blut, auch das Blut ist Geist« läßt die Substanz des Blutes als die Angel des Geschehens auftreten. Beide Beobachtungen lassen sich in eine Gesamtbewegung zusam- mennehmen, darin im Trinken des Weines das von Jesu Bezeichnete auf der gemeinschaftlichen Stufe ins Subjektive zurückkehrt. Mit der Rückkehrbewegung geht eine Gemeindebildung im Geiste Jesu par- allel. Damit aber hat sich der Zielpunkt der Bewegung gegenüber seinem Ausgangspunkt nur scheinbar verschoben, denn der »Tag der Vollendung« wird jener sein, da Jesu die »Gewächse des Wein- stocks« mit seinen Jüngern neu, in einem neuen Leben im Reiche des Vaters trinken wird (ebd., S. 366)[1].
Vom Reich des Vaters ist bisher nicht die Rede gewesen. Doch gibt die Selbstbezeichnung Jesu’ als Sohn Gottes und die angeführte Matthäus-Stelle Herkunft und Zukunft des göttlichen Geschehens unzweifelhaft als ›Reich des Vaters‹ an. Die Vermittlungs- und Rückkehrbewegung des Blutes hat demgemäß dies ›Reich‹ zum Ausgangs- und Zielpunkt.
Damit ist die Rückkehrbewegung zu vergleichen, die Hegel dem Blut in seiner Interpretation der jüdischen Religion beigelegt hat. Das Hauptaugenmerk lag dort auf der Bedeutung des Blutes als Leben. Das Blutgenußverbot des jüdischen Gesetzgebers wurde als Achtung vor dem Lebendigen, die Rückforderung des Opferblutes als Beleg und Hinweis auf ein göttliches, das Leben bewahrendes Wissen ausgelegt. Die Rückkehrbewegung des Blutes spielte sich außerhalb der als zerrissen und entzweit beschriebenen jüdischen Situation ab. Ganz anders im Christentum: Hier spielt das Blut die Rolle des unmittelbar Vermittelnden, hier greift es direkt, sogar als treibendes Moment, in das Geschehen ein, hier gibt es keine Scho- nung des Blutes und keinen Befehl der Rückgabe an Gott, sondern die Aufforderung, den Wein als Blut des Sohnes Gottes zu nehmen und zu trinken. Der Unterschied der beiden von Hegel dem Blut zugedachten Rollen ist kurz folgender: In der jüdischen Religion ist das Blut das innere, nicht in das Geschehen eingreifende lebendige Göttliche, im Christentum ist das Blut das äußere, in das Geschehen eingreifende geistige Göttliche. So läßt sich schließlich sagen, daß der mit dem Übergang vom Judentum zum Christentum gegebene Be- deutungswandel des Blutes als Schritt vom inneren Leben zum Erscheinen des Geistes gedacht wird.
Aus religionshistorischen Gründen ist zu vermuten, daß der Übergang vom insichbleibenden Blut im Judentum zum in das Geschehen eingreifenden Blut im Christentum mit der Hegelschen Fassung des Vater-Sohn-Verhältnisses in Verbindung zu bringen ist. Diese Vermutung würde konkreter erst dann, wenn eine Stelle beigebracht werden könnte, darin Hegel den Bezug des jüdischen Gottes zum Vater des christlichen Gottsohnes anspricht. Klar ist von vorneherein, daß ein solcher Bezug nur ein negativer, d. h. ein den jüdischen Gott und den christlich verstandenen Vater scheidender sein kann.
Im Text zum Geist des Christentums kommt Hegel, gleich nach- dem er das Verhältnis Jesu zu Gott als dasjenige eines Sohnes zu seinem Vater angedeutet hat, auf die ›Judensprache‹ zu sprechen:
»Die Bezeichnung dieses Verhältnisses ist einer der wenigen Na- turlaute, der in der damaligen Judensprache zufällig übriggeblie- ben war und daher unter ihre glücklichen Ausdrücke gehört. Das Verhältnis eines Sohnes zum Vater ist nicht eine Einheit, ein Begriff, wie etwa Einheit, Übereinstimmung der Gesinnung, Gleichheit der Grundsätze und dergleichen, eine Einheit, die nur Gedachtes [ist] und so vom Lebendigen abstrahiert, sondern lebendige Beziehung Lebendiger, gleiches Leben«. (TWA Bd. 1, S. 375f.)
Neben dem lebensachtenden Verbot des Blutgenußes wird hier ein zweites glückliches Moment im Judentum gefunden: einen Natur- laut der jüdischen Sprache, bedeutend ›Sohn Gottes‹. Es ist kein Begriff, kein aus dem entzweiten Zustand des Judentums stammen- der Verstandesausdruck, sondern das Relikt eines Naturzustandes, auf den Jesus in seiner Selbstbezeichnung zurückgreift. Doch damit ist die Anlage zur folgenreichen göttlichen Tragödie bereits gegeben: Die Juden, entzweit wie sie sind, verstehen die lebendigen Worte ihrer eigenen Sprache nicht mehr, sie erheben vielmehr »den Ver- stand, die absolute Trennung, das Töten, zum Höchsten des Geistes« (ebd., S. 380) - und werden so schuldig am Tod des Gottsohnes. Mit diesem Tod, der so der Negation einer der letzten Naturlaute der jüdischen Sprache gleichkommt, ist die Trennung von jüdischem Gott und christlichem Vater perfekt: Letzterer ist nun ganz nur vom Sohn her zu verstehen und der Bezug zum Gott der Juden ist zum Nicht-Bezug, zum absoluten Bruch oder zum Bruch des Absoluten geworden.
Damit läßt sich unsere fragende Vermutung wie folgt konkreter formulieren: Wenn - ich sage: wenn - es einen Bezug zwischen dem insichbleibenden, lebendigen Blut im Judentum und dem in das Geschehen eingreifenden Blut des Christentums gibt, dann geht dieses Nach-Außen-Treten mit einer Negation, einer Trennung oder einem Töten einher. Man wagt es kaum, dem Hinweis, den dieser Satz gibt, nachzugehen -, zu phantastisch scheint, daß hier das Opferblut Christi gemeint sein könnte. Und doch, es scheint keine andere Sache zu geben, die beide Bedingungen erfüllt: gleichzeitig nachaußentretendes Blut zu sein und eine absolute Negation, ein Töten zu veranschaulichen - als das Blut des Opfers Christi[1]. Klar ist aber auch, daß mit diesem Blut die äußerste Entfernung zum Leben gegeben ist. Hegel hat, und das wird erst hier deutlich, das Blut sowohl im Juden- als im Christentum vorwiegend mit dem Leben in Verbindung gebracht: Das Verbot des Blutgenußes ist als Achtung vor dem Leben gedeutet (Gottes Rückforderung des Op- ferblutes ist als Rückgabe der Lebenssubstanz an den Geber des Lebens verstanden), das Abendmahlsgeschehen ist als lebendiges Zusammen- und Durchdrungensein von Jesu Jüngern genommen[2].
Nun aber ergibt es sich, daß das Blut auch unter dem Aspekt des Opfers gedacht werden muß. Der Übergang vom Juden- zum Chri-
1 »Der Tod«, sagt Hegel später (in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes), »ist das Furchtbarste, und das Tote festzuhalten das, was die grösste Kraft erfor- dert.« Indem wir obigem Hinweis folgen, ist geflossenes Blut, deutlichster und furchtbarster Zeuge des Todes, unser Gegenstand; doch: Schauen wir diesem »Negativen ins Angesicht« und sehen wir zu, ob dieses »Verweilen ... die Zauberkraft« ist, »die es in das Sein umkehrt« (TWA Bd. 3, S. 36).
2 Bemerkenswert ist, daß Hegel im Geist des Christentums die Opfer symbolik von Brot (Leib) und Wein (Blut) ausdrücklich vom Abendmahlsgeschehen fernzuhal- ten versucht: Das Mahl der Liebe als Opfermahl zu verstehen, wäre das Heranbrin- gen eines bloß äußeren Gleichwie oder ein Mißverstehen desselben als Vereinigung »nur im gleichen Begriff« (TWA Bd. 1, S. 367).
stentum ist nicht ein harmloser Übergang zwischen zwei Lebens- kreisen des Blutes, sondern als absoluter Bruch aufzufassen. Der Tod Christi ist als dieser Bruch zu denken. Mit ihm tritt zwischen den einen Kreis des Lebens und den anderen Kreis des Lebens der Tod ein. Der ›Blutverlust‹, der mit Christi Tod zwischen den beiden Kreisen sich ereignet, ist entsprechend zweifach zu denken: Was von der einen Seite als ein Verlust göttlichen Lebens durch den trennen- den und tötenden Verstand sich darstellt, ist auf der anderen Seite der Umschlag eines Mahls der Liebe in ein Opfermahl.
Wie wir angemerkt haben, läßt Hegel es zunächst nicht zu, daß das Blut (also der zu trinkende und den Bund gründende Wein) als Opferblut gedeutet wird. Er beschreibt die Handlung Jesu völlig präsentisch, d. h. ohne Bezug auf dessen späteren Tod. Hegel spricht zwar von der »Vergießung des Blutes« und dem »ausgegossenen Blut« (TWA Bd. 1, S. 367) - aber nur im Vorbeigehen und so, daß er diese Bedeutung vom Trinken des Weines fernhält. Anders die späteren Thematisierungen des Abendmahls. In den Vorlesungen über die Philosophie der Religion etwa ist es eine feste Reihen- folge, daß erst nach dem Tode Christi sich die Gemeinde u. a. durch die Einnahme des Abendmahls realisiert. Bereits im dritten Jenaer Systementwurf (1805/06) heißt es, daß im christlichen Kultus der Leib und das Blut des Gottes, »der sich täglich in seiner Gemeine aufopfert «, genossen werde (GW Bd. 8, S. 283); und das spätere Manuskript zu den religionsphilosophischen Vorlesungen führt aus, daß das » Erschaffen « und die » Erhaltung « der Gemeinde einer »ewige[n] Wiederholung des Lebens, Leidens und [der] Auferste- hung Christi in den Gliedern der Kirche « gleichkäme, die Konstitu- tion der Gemeinde sich im Meßopfer vollzöge, darin »Christus täglich dargebracht« werde[1]. Im Wort von der ewigen Wiederholung des Mahls ist nun auch Abstand genommen von der Betonung der Einmaligkeit des letzten Mahls; Hegel, so könnte man sagen, hat damit den Schritt von der Beschreibung des Lebens Jesu zur Dar- stellung der christlichen Religion vollzogen. Damit kann er nun auch die Differenzen zwischen den christlichen Konfessionen erkennen, und selbst für eine von ihnen Stellung beziehen. Hatte er noch in
seinen Fragmenten über Volksreligion und Christentum (1793/94) Luther gescholten, da dieser sich in »traurige Streitigkeiten mit Zwingli, Ökolampad« einließ und damit gezeigt hätte, wie weit er von der »Idee der Verehrung Gottes in Geist und Wahrheit entfernt war« (TWA Bd. 1, S. 63), so heißt es nun im Manuskript zur Vorlesung, daß »Luther ganz mit Recht nicht nachgegeben« habe, »so sehr man ihn ... bestürmt« hätte (Vorl. Bd. 5, S. 91). Der Streit zwischen Luther, Zwingli und Ökolampad - auf den hier nicht näher einzutreten ist - drehte sich um die Bedeutung und die Stellung des Abendmahls in der christlichen Kirche: »In diesem letzten Mittel- punkt der Religion«, soll Hegel im Jahre 1831 gemäß einer Nach- schrift von D. F. Strauss gesagt haben, »treten Differenzen ein, welche alle übrigen Differenzen in der Religion bestimmen« (ebd., S. 288)[1].
Hegels letzte Position ist aus dem Vorlesungsmanuskript zu ge- winnen. Im Sakrament des Mahls wird »die Einheit des Subjekts und seines absoluten Objekts « zum »unmittelbaren Genuß« gegeben, d. h. »das Göttliche« wird » gegessen und getrunken «, also nicht nur bedeutungs- und vorstellungsmäßig symbolisiert, sondern das Sinn- liche ist selbst » werdend zum Göttlichen «, verwandelt sich selbst zur » göttlichen Substanz « (ebd., S. 89f.). Hegel verknüpft in seiner Auf- fassung des Abendmahls den Assimilationsvorgang sehr eng mit dem übersinnlichen Geschehen der Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi -, so eng sogar, daß die Frage nach dem Unterschied eines gewöhnlichen Verdauungsvorgangs, der die Speisen ebenfalls in Blut verwandelt, und der Spezifität des christli- chen Mahls akut wird.
In seinem ›Wastebook‹[2] spricht Hegel sogar direkt vom » Essen der Gottheit «; und er fügt an: »Gott opfert sich auf, gibt sich der Vernichtung hin - Gott selbst ist tot; die höchste Verzweiflung der völligen Gottverlassenheit« (TWA Bd. 2, S. 563). Mit diesem Aphorismus, der das verzehrende Essen mit dem Tode Gottes parallelisiert, ist der Durchgangspunkt der Deutung des Abendmahls von einem Mahl der Liebe zum Opfermahl markiert[1].
Wie aber, und im Hinblick worauf, gelingt es Hegel zum Leben zurückzukehren? Wie ist der Punkt der ›höchsten Verzweiflung der völligen Gottverlassenheit‹ zu überwinden? Müßte sich die Kehre aus dem Abgrund des Todes nicht an der Gewinnung eines Sinnes des Opfers zeigen?
Hegel gewinnt den rettenden Sinn des Opfers aus der Differenz von Organischem und Unorganischem. Indem er dem Opfer die Seite des Unorganischen, dem Unorganischen aber den wesentlichen Bezug zum Organischen zuspricht, gelingt es ihm, die Seite des Todes schließlich an die Seite des Lebens zurückzubinden. In einem im Kritischen Journal der Philosophie veröffentlichten Text (Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts [1803] ) erklärt er:
»[Die] Kraft des Opfers besteht in dem Anschauen und dem Objektivieren der Verwicklung mit dem Unorganischen, durch welche Anschauung diese Verwicklung gelöst, das Unorganische abgetrennt und, als solches erkannt, hiermit selbst in die Indiffe- renz aufgenommen ist, das Lebendige aber, indem es das, was es als einen Teil seiner selbst weiß, in dasselbe legt und dem Tode opfert, dessen Recht zugleich anerkennt und zugleich sich davon gereinigt hat.« (TWA Bd. 2, S. 494f.)
Obwohl dieser Text im Umfeld einer Darstellung der Sittlichkeit der griechischen Welt sich findet, macht der Fortgang klar, daß das Paradigma des göttlichen Opfers von Hegel aus der christlichen Vorstellungswelt abgenommen wird. Wie sonst könnte er fortfah- ren -, man achte auf die Erhebung in die »Herrlichkeit«:
»Es ist dies nichts anderes als die Aufführung der Tragödie im Sittlichen, welche das Absolute ewig mit sich selbst spielt, - daß es sich ewig in die Objektivität gebiert, in dieser seiner Gestalt hiermit sich dem Leiden und dem Tode übergibt und sich aus seiner Asche in die Herrlichkeit erhebt.« (ebd.)
Lassen wir diese großen und oft zitierten Worte - die vor dem Hintergrund des sich ankündigenden absoluten Wissens zu lesen sind - zunächst auf sich beruhen. Uns interessieren die Konsequen- zen der Verknüpfung von Opfer und Unorganischem, und d. h. die Konsequenzen der Vorstellung einer Rücknahme des Opfers in das Organische des Lebens.
Der Bezug des Organischen zum Unorganischen liegt, wie wir aus dem Kapitel zur Naturphilosophie wissen, in der Assimilation, darin die Aufnahme und Anähnlichung des Unorganischen an das Organische geleistet wird. In der zitierten Passage über das Opfer ist nun aber nicht von der Assimilation, sondern von einer Abtren- nung des Unorganischen vom Organischen, einem ›Hineingebären in das Objektive‹, die Rede. Die Richtung der Bewegung zwischen Organischem und Unorganischem ist hier also ein umgekehrte. Der Gegenbegriff zur Assimilation ist die Entäußerung. Wäre nun der Hegelsche Gebrauch der Ausdrücke ›Organisches‹ und ›Unorgani- sches‹ einheitlich, d. h. aus der Religionsphilosophie in die Natur- philosophie - und zurück - zu übertragen, so wäre anzunehmen, daß es einen Punkt des Austauschs, d. h. einen Punkt gebe, da dasselbe in der Natur- und der Religionsphilosophie - nur unter verschiede- nen Aspekten (der Assimilation/der Entäußerung) - erscheint.
Dieser Punkt ist in den Wein bzw. das Blut gelegt. So heißt es an vergleichbaren Stellen zum Übergang vom vegetabilischen zum ani- malischen Organismus in den naturphilosophischen Entwürfen der Jenaer Zeit, nachdem der Wein als das letzte und höchste Produkt des Vegetabilischen exponiert wurde: »Das Pflanzenindividuum selbst aber kann diesen Wein [d. h. ihr Produkt] nicht selbst trinken« (GW Bd. 6, S. 201f.)[1], die im Wein erreichte Geistigkeit des Vegeta- bilischen wird »nicht ihr Blut, sondern ihr Tod erst wird dazu « (GW Bd. 8, S. 136). Mit der Erwähnung des Todes und der Rede vom Darreichen des Weines - das »Pflanzenindividuum reicht ihn [den 1 »sein Brot nicht selbst essen« hieß es ursprünglich zur Vervollständigung. Diese Worte sind noch von Hegel selbst gestrichen worden.
Wein] nur edleren Naturen als die für sie zubereitete unorganische Natur dar« (GW Bd. 6, S. 202) - wird außerdem deutlich, daß Hegel nicht davor zurückschreckt, auch die Opfersymbolik des Weines bzw. des Blutes in die Naturphilosophie zu übertragen. Damit aber ist die Möglichkeit einer Vermischung der Aspekte der Entäußerung (Religion/Opfer) und der Assimilation (Natur/Stufen) angezeigt, die in der ›Phänomenologie des Geistes‹ schließlich zu ihrer syste- matischen Bedeutung kommt.
Unsere Aufgabe ist, die dem Blut und dem Puls beigelegten Bedeu- tungen in der Religionsphilosophie zu kommentieren. Bis hierher ist allein vom Blut die Rede gewesen. Der Puls, bzw. die Bewegung des Pulsierens kam nicht in den Blick. So wird ein zweiter Teil nötig. Dieser trägt den Titel:
2. Die Erhebung zum denkenden Puls
In den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie kommentiert Hegel einen theosophischen, das Verhältnis von Vater und Sohn betreffenden Satz Jakob Böhmes - des »ersten deutschen Philosophen« (TWA Bd. 20, S. 94) - also:
»›Der Sohn ist das Herz‹, das Pulsierende, ›im Vater‹« (ebd., S. 107, H.v.m.).
Schlägt man die Böhme’sche Morgenröte im Aufgang an der zitierten Stelle auf, so erkennt man, daß Hegel in der Vervollständigung des Bildes vom Herzen seine eigene Auffassung des christlichen Vater- Sohn-Verhältnisses kundtut: Vom Pulsieren ist bei Böhme nicht die Rede[1].
Überprüfen wir das. Sehen wir nach, wie Hegel das christliche Vater-Sohn-Verhältnis zu fassen sucht.
Bevor ich auf die späten Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes zu sprechen komme - darin wird explizit vom Puls und dem Pulsieren gesprochen - ist kurz auf ein frühes, von Hegel selbst nicht veröffentlichtes Fragment aus dem Jahre 1804 einzuge- hen. In dem Fragment, das fünf oder sechs Jahre nach dem Geist des Christentums entstanden ist, spricht Hegel zwar nicht ausdrücklich vom Pulsieren, doch ist auf die Bewegungen zu achten, die in und zwischen den beiden ›Reichen‹ des Vaters und des Sohnes spielen. Das Fragment beginnt:
»Im Sohn erkennt sich Gott als Gott. Er sagt zu sich selbst: Ich bin Gott. Das Insich hört auf, ein Negatives zu sein. Das Unter- scheiden und der Reichtum des Selbstbewußtseins Gottes ist darin mit seiner Einfachheit ausgesöhnt und das Reich des Sohnes Gottes ganz auch das Reich des Vaters. Das Selbstbewußtsein Gottes ist nicht ein Insichhineinkehren und ein Anderssein des Sohnes, sowie nicht ein Anderssein des Insichhineinkehrens als der einfache Gott, sondern die Anschauung im Sohn ist das Anschauen desselben als seiner selbst, aber so, daß der Sohn Sohn bleibt, wie Nichtunterschiedenes und zugleich Unterschiedenes; oder das ausgebreitete Reich des Universums, das kein Fürsich- sein mehr sich gegenüber hat, sondern dessen Fürsichsein ein Hineinkehren in den Gott ist, der Gottes Hineinkehren in sich ist, eine Freude über die Herrlichkeit des Sohnes, den er als sich selbst anschaut.« (TWA Bd. 2, S. 536f.)[1]
Die dichte und in sich selbst verschränkte Passage bietet dem Ver- ständnis einige Schwierigkeiten. Ein mehrmaliges Lesen aber er- kennt schließlich, daß Hegel den Unterschied und das Ineinander- spiel der beiden Reiche des Vaters und des Sohnes als eine wechselweise Bewegung vom Einfachen zum Reichtum und vom Reichtum zum Einfachen begreift. Dabei wird sowohl das Einfache als auch der Reichtum zunächst von der Tendenz des Insichhinein- kehrens beherrscht. Setzte sich diese Tendenz in den beiden Reichen gesondert durch, blieben sie getrennt und ihr Bezug wäre nicht zu klären. Eine Bewegung und ein Austausch setzt erst mit dem Erken- nen ein. Dieses Erkennen wird doppelt gefaßt, einmal als dasjenige Erkennen, das sich im Insichhineinkehren einstellt, das andere Mal als ein Erkennen, das je das andere Reich erkennt. Nun geschieht es
- und das macht die Undurchdringlichkeit der Passage aus -, daß die beiden Erkenntnisrichtungen ineinanderfallen. Das bedeutet, daß im erkennenden Insichhineinkehren das andere als ein ebenso sich in sich Hineinkehrendes erkannt wird, oder, wie Hegel im Bezug auf den Unterschied von Gott und ausgebreitetem Universum formu- liert, daß das »Fürsichsein ein Hineinkehren in den Gott ist, der Gottes Hineinkehren in sich ist.« Die beiden sich insichhineinkeh- renden Reiche werden als je auf das andere hin offen gefaßt: Im Insichhineinkehren des einen Reiches erscheint das je andere Reich, und umgekehrt. Dergestalt vermittelt sich das Einfache und der Reichtum in einer in sich selbst rückläufigen, auf das andere hin offenen Bewegung. Hegel trifft diese Mitte in dem Wort vom Selbst- bewußtsein Gottes ›Ich bin Gott‹ an. In ihm als der ruhigen Mitte der wirbelnden Bewegung ist der Reichtum mit der Einfachheit ausgesöhnt. Doch achten wir genauer auf die Bewegungen, die sich in ihm treffen! Die eine Bewegung ist diejenige vom Einfachen (Vater) zum Reichtum (Sohn), die andere ist diejenige vom Reichtum (Sohn) zum Einfachen (Vater). Im Wort vom Selbstbewußtsein Got- tes trifft also eine Bewegung der Expansion (Einfachheit-Reichtum) mit einer Bewegung der Kontraktion (ReichtumEinfachheit) zu- sammen. Im Wort vom Selbstbewußtsein Gottes ›Ich bin Gott‹ bedeutet das ›Ich‹ den Reichtum, ›Gott‹ die Einfachheit. Das ›bin‹ oder das Sein der Beziehung aber ist der Treffpunkt der Expansions- und Kontraktionsbewegung. Zu suchen ist eine Bezeichnung für dieses Sein. Worauf stoßen wir? In welchem Bild ist das Geschehen in dieser Mitte am treffendsten gesehen? Antwort: im Pulsieren.
Von hier aus vervollständigt Hegel den Satz Böhmes: »Der Sohn ist das Hertze in dem Vater« zu: »›Der Sohn ist das Herz‹, das Pulsierende, ›im Vater‹.«
Man könnte nun aufgrund unserer Auslegung meinen, daß das Wort ›Pulsieren‹ ein oft gebrauchtes Hauptwort der Hegelschen Religionsphilosophie ist. Dem ist nicht so. Das Wort erscheint, gemessen an der aufgewiesenen Bedeutung als Bild des Bezugs von Vater und Sohn, relativ selten. Nachdem in den Vorlesungen über die Philosophie der Religion nur wenige Male vom Pulsieren gesprochen wird - als markantester Fall sei die Stelle erwähnt, da die Bewegungsform des allgemeinen Elementes des Gottes »in seiner ewigen Idee an und für sich« (Titel) mit den Worten: »es ist das reine Pulsieren in sich selbst« angegeben wird (TWA Bd. 17, S. 220) -, sind es vor allem die späten Vorlesungen über die Beweise vom Da- sein Gottes, die eindringlich die Bewegung des Pulsierens ins Spiel bringen.
Hegel eröffnet seine Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes[1] mit der Vorführung des Konflikts zweier Parteien. Die eine Partei, die Partei der Frömmigkeit, setzt die Erkenntnis Gottes in das Gemüt und das Gefühl. Die andere Partei, die Partei des rein Rationalen, lehnt die Möglichkeit einer Erkenntnis des substantiellen Gehaltes Gottes ab[2]. Während die eine Partei den Zugang zu Gott in den bloß fühlenden Glauben legt, bleibt für die andere eine Erkenntnis Gottes unmöglich. Doch bleiben die beiden Extreme für Hegel nicht geschieden. In der zweiten seiner Vorlesun- gen beobachtet er, daß die beiden Weisen des Verhältnisses bzw. Nicht-Verhältnisses zu Gott in der Weise eines Komplotts aufs engste zusammenhängen, denn: dem erkenntnislosen Glauben oder gedankenlosen Fühlen der einen Seite schickt die andere die Versi- cherung hinterher, daß dies tatsächlich die einzige Weise des Erken- nens Gottes sei. Während jene die Seite Gottes für sich behält, liefert die andere ihr dazu den Beweis ihres einseitigen Besitztums. In seinen Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes hat Hegel es sich zur Aufgabe gestellt, beide Einseitigkeiten in ihrer schlechten Ergänzung gegeneinander in Bewegung zu bringen. Mit- te und Ansatz zur Vermittlung der beiden Einseitigkeiten ist die Auslegung der Gottesbeweise als des Gedankenausdrucks einer »Er- hebung des Menschengeistes zu Gott« (TWA Bd. 17, S. 356). Dem Charakter dieses Ansatzes entspricht, daß noch vor der eigentlichen Abhandlung des Gegenstandes - d. h. der einzelnen Durchnahme und Deutung der verschiedenen Gottesbeweise - jene Bewegung des Erhebens des Geistes zu Gott kurz charakterisiert wird. Im Zentrum dieser Bewegung, die auch die Vermittlungsbewegung der beiden oben genannten Parteien ist, steht das Herz und der Puls. Dabei dient der Rekurs auf das Herz und den Puls dazu, einen Weg vom Gefühl zum Denken aufzuzeigen. Hegel unterscheidet zunächst das Herz vom bloßen Gefühl. Während dem Gefühl je Einzelnes, Besonderes, nur einen Moment lang Dauerndes zum Inhalt wird, bezeichnet das Herz »die umfassende Einheit der Gefühle nach ihrer Menge wie nach der Dauer« (ebd., S. 372). Das Momentane und Flüchtige der Gefühlsbestimmtheit erhält erst im Herzen seinen »Grund, der ihre Wesentlichkeit [der Gefühle] außerhalb der Flüchtigkeit des erschei- nenden Hervortretens in sich befaßt und aufbewahrt enthält« (ebd.). Das Herz also ist die Aufhebung des Gefühls so, daß dessen Be- stimmtheiten nun von ihm gehalten und getragen werden. Es verein- heitlicht und zieht die Gefühlsbewegungen in eine Allgemeinheit zusammen, die den Charakter eines Individuums ausmachen[1]. Diese Bewegung der Aufhebung ist eine Bewegung vom momentan und augenblicklich bestimmten Einzelnen, der Bestimmtheit durch das Gefühl, zum dauernden Allgemeinen, dem Herzen; während im Gefühl die einzelnen Bestimmtheiten getrennt bleiben, kommen sie im Herzen zu ihrer ungetrennten Einheit. Diese, am Individuum und seiner psychophysiologischen Konstitution abgenommene Dif- ferenz von Gefühl und Herz läßt Hegel jenen Satz aussprechen, dem wir unsere Hauptaufmerksamkeit zu widmen haben. Nachdem das Herz also als das Gefäß und der aufbewahrende Grund der wech- selnden Gefühle angesprochen wurde, heißt es:
»In dieser ungetrennten Einheit derselben - denn das Herz drückt den einfachen Puls der lebendigen Geistigkeit aus - vermag die Religion den unterschiedenen Gehalt der Gefühle zu durchdrin- gen und zu ihrer sie haltenden, bemeisternden, regierenden Sub- stanz zu werden.« (ebd., S. 372f.; Hervorhebung im Text)
In diesem Satz wird das Herz als der Mittel- und Durchgangs- punkt der religiösen Erhebung bestimmt: sowie sich das Herz von der subjektiven Seite als der Sammlungspunkt der Gefühle darstellt, ist es gleichzeitig - von der anderen Seite her - als der Punkt des Eindringens des substantiellen Gehalts der Religion bestimmt[1]. Die Mitte der beiden Bewegungen ist das Herz als die ungetrennte Einheit. Eine eingefügte Bemerkung deutet diese Einheit des Her- zens als » einfachen Puls der lebendigen Geistigkeit«. Auf diese Weise ist der Mittel- und Durchgangspunkt der beiden Bewegungen - einerseits der Erhebung des Subjekts zu Gott und andererseits des Eindringens des Religiösen in eben dieses Subjekt - selbst als beweg- tes, einfaches Pulsieren bestimmt.
In der vierzehnten Vorlesung kommt Hegel auf die Rede vom Puls bzw. dem Pulsieren zurück. Die Erhebung des Geistes zu Gott geschehe »im Innersten des Geistes auf dem Boden des Denkens ...«
- und weiter:
»... die Religion als die innerste Angelegenheit des Menschen hat darin den Mittelpunkt und [die] Wurzel ihres Pulsierens. Gott ist in seinem Wesen Gedanke, Denken selbst, wie auch weiter seine Vorstellung und Gestaltung sowie die Gestalt und Weise der Religion als Empfinden, Anschauen, Glauben usf. bestimmt wer- de. Das Erkennen tut aber nichts, als jenes Innerste für sich zum Bewußtsein zu bringen, jenen denkenden Puls denkend zu erfas- sen.« (ebd., S. 472f.)
Mit dieser Rede, die von Gott als dem Denken selbst und der Erhebung vom Endlichen zum Unendlichen als einem denkenden Erfassen des denkenden Pulses spricht, wird deutlich, daß Hegel die Religion, den Gott und das Erheben zu ihm von der Philosophie aus faßt. Hat man eben noch geglaubt, die Erhebung des Menschen zu
Gott vor dem Hintergrund des religiösen Dogmas der Inhärenz des Sohnes im Vater verstehen zu dürfen - der Sohn ist (nach Böhme) als das Herz bzw. das Pulsierende im Vater gefaßt -, wird man nun eines besseren belehrt: Die Religion hat »im Innersten des Geistes auf dem Boden des Denkens ... den Mittelpunkt und [die] Wurzel ihres Pulsierens«. Zu diesem Mittelpunkt und zu dieser Wurzel haben wir uns nun zu begeben.
III. Eine These über das Verhältnis der beiden Hauptwerke Hegels: die ›Phänomenologie des Geistes‹ und die ›Wissenschaft der Logik‹
U nsere Arbeit fragt nach dem Hintergrund der Hegelschen Übertragung der Bewegungsform des Pulsierens auf den Begriff, den Geist und die Idee. Wie kommt Hegel dazu, vom ›absolu- ten Begriff‹ zu sagen, daß er ›pulsiere‹; wie kommt er dazu, von den in der Geschichte aufgetretenen Philosophien als einem Geisterreich zu sprechen, deren ›einzelne Pulse‹ der ›Organismus unserer Sub- stanz‹ sein sollen?
Nachdem wir der Rede vom Pulsieren in der Natur- und der Religionsphilosophie nachgegangen sind, ist die Frage nach der generellen Übertragung der Bewegung des Pulsierens auf die ge- nannten Hauptworte der Hegelschen Philosophie (Begriff, Geist, Idee) wiederaufzunehmen. Die Frage ist: An welcher Stelle des Hegelschen Werkes läßt sich der Ort ausmachen, da die generelle Übertragung ihre Fundierung und ihre Legimitation erhält?
Meine These ist, daß die beiden philosophischen Hauptwerke Hegels, die Phänomenologie des Geistes und die Wissenschaft der Logik - insbesondere was ihr Verhältnis zueinander betrifft - vor dem Hintergrund des Versuchs Hegels gelesen werden können, die verschiedenen Bedeutungen und Gebrauchsweisen des Wortes ›Pulsieren‹ in der Natur- und der Religionsphilosophie in Überein- stimmung miteinander zu bringen. Denn sagen läßt sich: Nur falls ihm dieser Ausgleich gelingt, ist seine generelle Übertragung des Pulsierens auf den Geist, den Begriff und die Idee[1] legitimiert, also nicht mehr zufällig, d. h. im je gegebenen Fall auf eines der regionalen Gebiete der Natur oder der Religion zu beziehen. Anzunehmen ist weiter, daß Hegel seiner generellen Übertragung die Legitimation so verschafft, daß er die verschiedenen Bedeutungen und Ge- brauchsweisen des Wortes in der Natur- und der Religionsphiloso- phie in bestimmter Weise miteinander vermittelt - so vermittelt, daß die Bewegungsform des Pulsierens nachher wirklich auf den Geist, den Begriff usw. übertragen werden kann.
Um zu sehen, welche Vermittlungen dem Ausdruck ›Pulsieren‹ zur Ermöglichung seiner generellen Übertragung notwendig wer- den, ist zunächst negativ zu fragen: Worin liegt die wesentliche Uneinheitlichkeit, das wichtigste Nichtübereinstimmen im Hegel- schen Gebrauch des Wortes ›Pulsieren‹ in den beiden Bereichen der Natur- und der Religionsphilosophie? Nur falls der hauptsächlich- ste Divergenzpunkt der Bedeutungen von ›Pulsieren‹ in den beiden genannten Bereichen gefunden werden kann, läßt sich auch die Hauptrichtung der notwendig werdenden Vermittlung angeben.
Der tiefste Riß in der Bedeutung von ›Pulsieren‹, der sich uns im Durchgang durch die Natur- und Religionsphilosophie gezeigt hat, ist derjenige zwischen dem natürlich- endlichen Pulsieren im Inneren des Organismus und dem denkend- unendlichen Puls bzw. Pulsieren des Göttlichen. Allerdings ist es nun nicht so - wie man schnell anzunehmen geneigt ist -, daß Hegel von der Endlichkeit des Pul- sierens generell in der Sphäre der Natur, von der Unendlichkeit desselben dagegen vorwiegend in der Religionsphilosophie spräche
- nein, Tatsache ist, daß sowohl hier wie dort, sowohl in der Natur wie in der Religion, der Puls und das Blut, die Bewegung des Pulsierens insgesamt, beide Bedeutungen annehmen. Wie wir gese- hen haben, assoziiert Hegel dem inneren Blut-Kreislaufsystem des Organismus, trotz der wesentlichen Endlichkeit dieses Lebendigen, den no}V, das Unbewegt-Bewegende und den wahrhaften Grund. Ebenso in der Religion. Auch hier lassen sich beide Bedeutungen - die auf das Endliche und die auf das Unendliche bezogene Bedeu- tung - ausmachen: Während im Umkreis des Blutes - des fließenden Blutes, das den Tod anzeigt - die Hegelsche Rede auf die furchtbar- ste und gleichzeitig notwendigste Katastrophe der Menschenge- schichte zu sprechen kommt, kann er, im selben Feld und im Zusam- menhang der von diesem Ereignis her sich konstituierenden Religion vom Leben, vom Puls und von der Aufhebung des Todes - schließ- lich vom unendlichen Göttlichen sprechen.
Da nun die generelle Übertragung der Bewegungsform des Pul- sierens auf den Geist, den Begriff, die Idee usw. erfolgt, ist zu vermuten, daß die hierzu dem ›Pulsieren‹ notwendig werdende Ver- mittlung zwar aus beiden Bereichen (Natur, Religion), aber in die eine Richtung, die Richtung des Un-Endlichen zu geschehen hat. Zu vermuten ist weiter, daß, während die Erhebung - gleichsam der ›Transport‹ - vom Endlichen zum Unendlichen in Kategorien des Religiösen zu erfolgen hat, das was da erhoben wird, zunächst der Natur (im weitesten Sinne) und hernach der Sphäre des Geistigen (ebenfalls im weitesten Sinne) angehört. Wenn wir nun diese beiden Bewegungen - die beiden Bewegungen, die zur Möglichkeit einer generellen Übertragung der Bewegung des Pulsierens führen - ver- knüpfen, so stehen wir vor dem von Hegel wiederholt beschriebenen Verhältnis seiner beiden Hauptwerke, der Phänomenologie des Geistes und der Wissenschaft der Logik.
Warum?
In dem Stück Womit mußder Anfang der Wissenschaft gemacht werden? das dem ersten Buch der Wissenschaft der Logik - betitelt: Das Sein - vorangestellt ist, lesen wir zum Verhältnis von Phänomenologie und Logik:
»Aus der Phänomenologie des Geistes oder der Wissenschaft des Bewußtseins als des erscheinenden Geistes wird vorausgesetzt, daß sich als dessen letzte, absolute Wahrheit das reine Wissen ergibt. Die Logik ist die reine Wissenschaft, das reine Wissen in seinem Umfang und seiner Ausbreitung. Das reine Wissen ist die zur Wahrheit gewordene Gewißheit oder die Gewißheit, die dem Gegenstand nicht mehr gegenüber ist, sondern ihn innerlich ge- macht hat, ihn als sich selbst weiß, und die auf der anderen Seite ebenso das Wissen von sich als einem, das dem Gegenständlichen gegenüber und nur dessen Vernichtung sei, aufgegeben, sich ent- äußert hat und Einheit mit seiner Entäußerung ist.
Das reine Wissen in diese Einheit zusammengegangen, hat alle Beziehung auf ein Anderes und die Vermittlung aufgehoben und ist einfache Unmittelbarkeit.
Die einfache Unmittelbarkeit ist selbst ein Reflexionsausdruck und bezieht sich auf den Unterschied von dem Vermittelten. Inihrem wahren Ausdruck ist diese einfache Unmittelbarkeit das reine Sein oder das Sein überhaupt; Sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung.
Dieser Rückblick auf den Begriff des reinen Wissens ist der Grund, aus welchem das Sein herkommt, um den Anfang der absoluten Wissenschaft auszumachen.
Oder zweitens umgekehrt, der Anfang der absoluten Wissenschaft muß selbst absoluter Anfang sein, er darf nichts voraußetzen. Er muß also durch nichts vermittelt sein, noch einen Grund haben; er soll vielmehr selbst der Grund der ganzen Wissenschaft sein. Er muß daher schlechthin ein Unmittelbares sein oder vielmehr das Unmittelbare selbst. Wie er nicht gegen anderes eine Bestim- mung haben kann, so kann er auch keine in sich, keinen Inhalt enthalten, denn dergleichen wäre ebenfalls eine Unterscheidung und Beziehung von Verschiedenem aufeinander, somit eine Ver- mittlung. Der Anfang ist also das reine Sein.« (Das Sein [1812], S. 35)[1]
Hegel faßt hier den Übergang seiner beiden Werke als einen Über- gang, der in sich selbst bewegt ist. Diese innere Bewegtheit kommt dem Übergang zu, weil er einerseits das Ende oder das Resultat eines Vorhergehenden - der Phänomenologie des Geistes -, anderer- seits der Anfang eines Nachfolgenden - der Wissenschaft der Logik - ist. Im Übergang spiegeln sich in gewisser Weise beide Seiten. Diese Spiegelung läßt sich an der Art abnehmen, wie Hegel im Zitat das Wort Grund gebraucht. Einmal heißt ihm Grund darin: begründet sein durch eine Herkunft, das andere Mal heißt ihm Grund-Sein: Ausgang-Sein für ein Zukünftiges. Sowie der Grund als »Rückblick auf den Begriff des reinen Wissens« Grund der Herkunft aus der Phänomenologie des Geistes ist, ist er als »Anfang der absoluten Wissenschaft« selbst »der Grund der ganzen Wissen- schaft«. Hegel nennt diesen Grund im Ü bergang von seinem Her- künftigen zu seinem Zukünftigen das eine Mal ›das reine Wissen‹, das andere Mal ›das reine Sein‹. Während der Übergang auf der einen Seite auf eine Bewegung zurückverweist, die von der Gestalt einer bloßen, sich des gegenüberliegenden Gegenstandes bewußten sinn- lichen Gewißheit ausgeht, um schließlich bei ihrer letzten, absoluten 1 Ich zitiere nach der wiederabgedruckten Erstauflage des ersten Bandes der Wis- senschaft der Logik: G. W. F. Hegel, Das Sein (1812), hg. v. H.-J. Gawoll, Ham- burg 1986 Wahrheit - dem reinen Wissen - anzukommen, deutet er als Anfang und Grund des Kommenden auf die Wissenschaft der Logik als der reinen Wissenschaft vor. Als solcher heißt er: das reine Sein, oder ist er: einfache Unmittelbarkeit. Ist der Anfang dort als Resultat eines Vorhergehenden, als erfüllter Inhalt genommen, so ist er hier, als auf ein Folgendes vordeutender, als bloß abstrakte Form verstanden.
Entsprechend unserer These soll nun dieser Übergang vor dem Hintergrund des Versuchs gelesen werden können, die verschiede- nen Bedeutungen und Gebrauchsweisen des Wortes ›Pulsieren‹ in Übereinstimmung miteinander zu bringen. Wie wir angedeutet ha- ben, müßte zur Lösung dieser Aufgabe eine Bewegung der Erhebung
- unter im weitesten Sinne religiösen Kategorien stehend - mit der Ankunft bei einer Form verknüpft werden, die in irgendeiner Weise auf ihre Herkunft aus dem Bereich des Natürlichen zurückdeutet.
Über das reine Wissen als dem Resultat der Phänomenologie des Geistes heißt es:
»Das reine Wissen ist die zur Wahrheit gewordene Gewißheit oder die Gewißheit, die dem Gegenstande nicht mehr gegenüber ist, sondern ihn innerlich gemacht hat, ihn als sich selbst weiß, und die auf der anderen Seite ebenso das Wissen von sich als einem, das dem Gegenständlichen gegenüber und nur dessen Vernich- tung sei, aufgegeben, sich entäußert hat und Einheit mit seiner Entäußerung ist.« (ebd.)
Hegel beschreibt hier dasjenige, was er andernorts die notwendiger- weise darzustellende Einheit des Subjekts und der Substanz nennt[1]. Während einerseits das Subjekt auf dem Wege vom sinnlichen zum absoluten Wissen die Substanz sich völlig »innerlich« zu machen hat, weiß es andererseits gerade die Substanz schließlich als sich selbst, als Subjekt, und ist so »Einheit mit seiner Entäußerung«. Die Kate- gorien, mit denen diese Bewegung beschrieben wird, sind: die Ver- innerlichung und die Entäußerung. Diese Kategorien erinnern an ihre Herkunft aus der Sphäre des Religiösen. Wie wir gesehen haben, läßt sich der Weg, den die Substanz des Blutes zu ihrer Erhebung und übersinnlichen Belebung zurückzulegen hat, als Weg in ihre Entäußerung und von dort zurück in ihre Er-Innerung beschreiben. Und so wie dort der Weg der Erhebung ein Weg durch die absolute Entäußerung oder den Tod - und zwar des Sohnes Gottes - ist, so läßt Hegel auch für die mit der Phänomenologie des Geistes unternommene Erhebung vom sinnlichen zum absoluten Wissen durchblicken, daß sie erst unter der Kategorie des Opfers gedacht, ihre Funktion erfüllt (vgl.:TWA Bd. 3, S. 590). Und so wie dort das eigentlich Belebende, oder besser: das eigentlich Begeistende, in der Er-Innerung des Entäußerten besteht, wird auch in der Phänome- nologie die Er-Innerung als diejenige Bewegung vorgestellt, die die Substanz in ihre höhere, rein geistige Form erhebt (ebd., S. 591). Den entscheidenden Beleg aber für die Analogie sehen wir im folgenden: Wie ebenfalls gesehen, trägt sich die eigentliche Bewegung des Ent- äußerns und Er-Innerns in der Sphäre der Religion rund um das von Jesus eingesetzte Abendmahl zu: Indem er ein letztes, mit seinen Jüngern begangenes Essen dazu benutzt, das ausgeteilte Brot und den ausgeteilten Wein sein Leib und sein Blut zu nennen und seine Jünger gleichzeitig dazu auffordert, dasselbe hinfort zu seinem Ge- dächtnis zu tun -, er schließlich getötet wird und das Abendmahl so zum Opfermahl wird, erhalten die eßbaren Substanzen Brot und Wein die Bedeutung mittelbar Entäußerungen Gottes zu sein, und, gleichzeitig, in ihrem recht vollzogenen Verzehr, die Funktion, die Erinnerung an ihn wach- und aufrechtzuerhalten. Ließe sich nun zeigen, daß die in der Phänomenologie angezogene Einheit von Entäußerung und Erinnerung in Analogie zur Bewegung der soge- nannten Transsubstantiation im Religiösen sich deuten läßt, so wäre unsere These über die Vergleichbarkeit beider Erhebungen vom Endlichen zum Unendlichen kaum mehr zu bestreiten.
Wie erinnerlich, lautet der von Hegel selbst geäußerte Satz, der die Verwandlung der einen Substanz der Eucharistie, des Weines, als solche sagt, so: ›Nicht nur der Wein ist Blut, auch das Blut ist Geist‹.
Dieser Satz läßt sich als Prototyp eines spekulativen Satzes ausle- gen. Wenn wir die Wendung des ›nicht nur, [sondern] auch‹ weglas- sen, so lautet der Satz, der ein Doppelsatz ist: ›Der Wein ist Blut, das Blut ist Geist‹. Auffallend ist zunächst, daß, während Wein und Geist nur einmal genannt werden, das Blut zweimal, einmal als Prädikat zu Wein, das andermal als Subjekt zu Geist auftritt. Als dieses Prädikat-Subjekt spielt das Blut die Vermittlungsinstanz vom ersten Teilsatz, der mit dem Wein beginnt, zum zweiten Teilsatz, der mit dem Geist endet. Mit der Einsicht in diese Vermittlerfunktion des Prädikat-Subjekts ›Blut‹ läßt sich nun, wie ich meine, die Hegel- sche Exposition zum spekulativen Satz in der Vorrede zur Phäno menologie des Geistes verknüpfen. Die allgemeinste Formulie- rung zum spekulativen Satz gibt das folgende. Hegel schreibt, nach- dem er vom Verhältnis des gewöhnlichen zum spekulativen Satz gesprochen hat:
»Formell kann das Gesagte so ausgedrückt werden, daß die Natur des Urteils oder Satzes überhaupt, die den Unterschied des Sub- jekts und Prädikats in sich schließt [dies die Charakterisierung des gewöhnlichen Satzes], durch den spekulativen Satz zerstört wird und der identische Satz, zu dem der erstere wird, den Gegenstoß zu jenem Verhältnisse enthält.« (TWA Bd. 3, S. 59)
Meine These ist nun, daß die hier rein formell beschriebene Verwandlung des gewöhnlichen Satzes in den spekulativen Satz vom Prädikat-Subjekt bzw. Subjekt-Prädikat ›Blut‹ her verstanden werden kann. Dazu muß der Hegelsche Doppelsatz zum Abendmahlsgeschehen so umgeschrieben werden:
→
Wein ist Blut Geist ist Blut
←
Das, was Hegel den identischen Satz nennt, ist auf diese Weise im Prädikat-Subjekt bzw. Subjekt-Prädikat ›Blut‹ lokalisiert (Blut ist Blut). Der Gegenstoß des identischen Prädikat-Subjekts/Subjekt- Prädikats besteht nun darin, daß es die Reihenfolge von Subjekt und Prädikat der von ihm betroffenen Sätze aufhebt: Es ist dann, und das heißt für Hegel offenbar spekulativ denken, nicht mehr zu entschei- den, ob der Wein Blut ist, das Blut Wein ist, das Blut Geist ist oder der Geist Blut ist. Alle diese Bestimmungen verflüssigen sich in der spekulativen Darstellung. Vor diesem Hintergrund ist die Bestim- mung des Wahren zu lesen, die Hegel, ebenfalls in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes gibt:
»Das Wahre ist ... der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist; und weil jedes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar [sich] auflöst, ist es ebenso die durchsichtige und einfache Ruhe.« (ebd., S. 46)
Die hier angezogene Verbindung des Weines mit dem Wahren ergibt sich direkt aus dem als Syllogismos verstandenen Satz zur Transsub- stantiation: Aus dem Obersatz ›Der Wein ist Blut‹ und dem Unter satz ›Das Blut ist Geist‹ ergibt sich der Schlußsatz von der Identität des Weines mit dem Geist oder dem Wahren (medius terminus ist das Blut)[1].
Wie man weiß, bezieht sich die der Phänomenologie vorange- stellte Vorrede auch auf den zweiten Teil des ›Systems der Philoso- phie‹: auf die Wissenschaft der Logik[2]. So ist auch das dort zum spekulativen Satz Gesagte nicht nur für die Phänomenologie, sondern ebensosehr für die Darstellungsform der Wissenschaft des reinen Wissens, der Logik, gültig. Von dem Übergang des einen Werks in das andere sind wir ausgegangen. Wie sich gezeigt hat, läßt sich die in der Phänomenologie geschehende Erhebung vom sinn- lichen zum absoluten Wissen in Kategorien verstehen, die uns bereits aus der Beschreibung der christlichen Religion bekannt sind. Als Prototyp des spekulativen Satzes haben wir einen frühen Satz Hegels zum Abendmahlsgeschehen ausmachen können. Darin spielt die Substanz des Blutes die Instanz der Vermittlung, d. h. jene Substanz, durch deren Bewegung der Entäußerung und Er-Innerung die Er- hebung zum Unendlichen geschieht[3]. An ihrem Ende erreicht die Phänomenologie das reine Wissen. Mit diesem Ende deutet sie vor auf einen Anfang: den Anfang der Logik. Die Logik ihrerseits beginnt mit dem reinen Sein. So wandelt sich die Fülle des im reinen Wissen enthaltenen in die einfache, abstrakte Unmittelbarkeit eines neuen Anfangs. Unsere These spricht von einem Zusammenhang des Verhältnisses von Phänomenologie und Logik mit dem Versuch, die Bedeutungen und Gebrauchsweisen des Ausdrucks ›Pulsieren‹ zusammenzuführen. Träfe sie zu, müßte sich die mit dem Ende der Phänomenologie erreichte Fülle des reinen Wissens in eine Form verwandeln, die, unter der Forderung stehend, spekulative Form zu sein, der Bewegung des Pulsierens Ausdruck verleihte. Die Wissen nicht innerhalb des Christentums verbleibt, sondern von ihm gleichsam geschicht- lich auseinandergezogen auch für die Übergänge zwischen den Religionen angesetzt wird. -
Daß Hegel das »menschliche Denken in Analogie zum christlichen Abendmahl versteht«, ist schon andernorts, ebenfalls mit Bezug auf die Phänomenologie bemerkt worden; so in: B. Liebrucks, Sprache und Bewußtsein Bd. 5, Hegel: PhdG, Frankfurt 1970, S. 303. Auch Liebrucks bezieht die Bewegung der Transsubstan- tiation auf die Bewegung die im spekulativen Satz zwischen Subjekt und Prädikat stattfinden soll, sowie auf den Bezug und die Verwandlung der Substanz in das Subjekt (ebd., S. 18, 71, 362, 388).
schaft der Logik beginnt mit dem reinen Sein. Doch das reine Sein ist noch kein Satz. Der erste Satz aber der Hegelschen Logik lautet:
»Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe.« (Das Sein [1812], S. 48)
Dieser erste Satz der Hegelschen Logik muß als spekulativer Satz verstanden werden. Unsere These ist, daß mit ihm der Schritt von -, oder besser: der Bruch mit dem Ende der Phänomenologie voll- zogen wird. Auf ihm gründet und mit ihm begründet sich die reine Wissenschaft, die Logik. Mit ihm gelangt Hegel - nun in unserer Sprache formuliert - vom spekulativ auf das Wissen angewandten Syllogismos der Transubstantiation zur spekulativ-logischen Satz- form als Ausdruck des springenden Punkts. Zu vermuten ist: Weil die Logik mit dem in einem Satz ausgeprägten springenden Punkt beginnt, kann Hegel sagen, daß ihr Fortgang im Werden der ›Sache selbst‹ liege; und weil diese ›Sache selbst‹, deren Entwicklung die Logik darstellt, den Gang vom Endlichen zum Unendlichen hinter sich hat, bewegt sich die Darstellung der reinen Wissenschaft von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende im Äther des reinen, unendlichen oder göttlichen Begriffs[1]. Doch sind dies nur erst Andeutungen. Bevor wir näher auf den Anfangssatz der Logik eingehen können, ist ein kleiner Umweg nötig.
Es ist bekannt, daß nicht nur die Logik mit dem reinen Sein beginnt, sondern auch die Phänomenologie mit dem reinen Sein (der sinnlichen Gewißheit) einsetzt. Zu prüfen ist, inwiefern sich der Anfang der Logik vom Anfang der Phänomenologie unterschei- det. Erst vor dem Hintergrund dieses Unterschiedes in der Bestim- mung des Seins wird sich unsere These erhärten lassen.
1. Zum Anfang der Phänomenologie. - Die Phänomenologie des Geistes stellt das werdende Wissen dar[2]. Das Werden des Wis- sens nimmt seinen Ausgang in der sinnlichen Gewißheit. Die sinn- liche Gewißheit ist die erste einer Reihe von Gestalten des Bewußtseins, durch die sich der Geist, dessen Erscheinen die Phänomeno- logie darstellt, hindurchzuarbeiten hat. »Das Wissen, wie es zuerst ist, oder der unmittelbare Geist ist das Geistlose, das sinnliche Bewußtsein« (TWA Bd. 3, S. 31). Den Anfang der Darstellung des erscheinenden Wissens macht das Geistlose. Und doch findet Hegel hier, und gerade hier, das reine Sein. Wie das? Hegel kann das reine Sein auf der ersten Stufe des erscheinenden Wissens, d. h. im unmit- telbaren Wissen finden, weil er es - das unmittelbare Wissen oder das Wissen des Unmittelbaren - sprechen läßt. Was aber spricht das unmittelbare Wissen oder die sinnliche Gewißheit? »Sie sagt von dem, was sie weiß, nur dies aus: es ist « (ebd., S. 82). Das geistlose Wissen konstatiert von dem, was es vor sich hat, nur die einfache Tatsache seines Seins (oder: da ß es Seiendes ist). Ihr geistloses Spre- chen sagt vom Seienden nur: es ist. Gerade deshalb macht das reine Sein die Wahrheit des sinnlichen Wissens aus. Indem das unmittel- bare Wissen ein Wissen nur des Unmittelbaren, des Seienden ist, besteht seine wissende aber geistlose Rede nur darin, zu sagen: es ist. Es ist die einfache Wahrheit des auf seine bloße Anwesenheit redu- zierten Seienden, die im kurzen Satz des sinnlichen Wissens zum Ausdruck kommt: das Seiende ist, - und sonst nichts. Das reine Sein macht deshalb das »Wesen dieser Gewißheit« aus. Man hört und liest durchaus richtig, Hegel sagt: das Wesen dieser Gewißheit. Er spricht also, obwohl er das sinnliche Wissen einen ganz allgemeinen Satz hat sprechen lassen, von einer einzelnen sinnlichen Gewißheit[1]. Dieser sinnlichen Gewißheit; einem Fall der Bewußtseinsgestalt ›sinnlicher Gewißheit‹ also. Deshalb kann Hegel weiterfahren und sagen, daß »aus dem reinen Sein« zwei »Diese«, ein » Dieser als Ich und ein Dieses als Gegenstand, herausfallen« (ebd., S. 83). Die beiden Diesen fallen aus dem reinen Sein heraus, weil mit der Rede des sinnlichen Wissens über das Seiende nicht dessen Anwesenheit (nämlich des Seienden), sondern ein einzelner Fall einer gerade auftretenden Ge- genwart im Blick stand. Wie konnte diese Differenz entstehen? Sie konnte entstehen, weil Hegel gleich zu Beginn des Kapitels über die sinnliche Gewißheit eine Scheidung zwischen der darin thematisier- ten Gestalt des Bewußtseins und einem ›wir‹ der seiner Entwicklung Zusehenden vornimmt[2].
Wie gesehen, läßt Hegel die sinnliche Gewißheit sprechen. Diese Rede ist an ›uns‹ - die wir ihr zuhören - gerichtet. Darin sagt sie, die sinnliche Gewißheit, »von dem, was sie weiß, nur dies aus: es ist «. Indem nun einerseits das auf die Rede des sinnlichen Bewußtseins hörende ›wir‹ nur hört, daß dieses von allem und jedem nur sagt, daß es ist, andererseits aber sieht, daß ein je einzelner Dieser von einem je einzelnen Diesen eben dieses Sein aussagt, ist die Differenz zwi- schen der im Satz ausgedrückten allgemeinen Anwesenheit des Sei- enden und der je von einer sinnlichen Gewißheit gemeinten spezifi- schen Gegenwart desselben gegeben. Daraus erhellt, daß das reine Sein des sinnlichen Wissens von diesem geistlos realisiert wird, d. h. es wird nur realisiert, weil ein zuhörendes ›wir‹ seine Rede von allem Situativen reinigt und so schließlich eine Aussage über das Seiende im Ganzen darin ausfindig machen zu können glaubt. So muß man sagen: Zum reinen Sein der sinnlichen Gewißheit gehören eigentlich zwei Beteiligte, einmal die sich aussprechende Gestalt des Wissens, die, ein allgemeines sagend, nicht weiß, was sie sagt, und das ›wir‹ des Phänomenologen, welches das von ihr Gesagte hörend zu deuten versteht.
Das erste Kapitel der Phänomenologie zur sinnlichen Gewiß- heit ist nichts anderes als die Ausfaltung des mit dieser Grundanlage gegebenen. Die Bestimmung des Horizonts des reinen Seins wird sich entsprechend von ihr her ergeben müssen. Damit ist zugleich gesagt: Der von Hegel angesetzte Horizont zur Bestimmung des reinen Seins liegt weder im anwesend Seienden als solchen noch in der je einzelnen Gegenwart einer sich aussprechenden sinnlichen Gewißheit. Zwar wird, der Anlage entsprechend, der Sinn des reinen Seins von diesen beiden Seiten her gebildet, selber liegt er aber in einem vermittelnden Dritten. Zu vermuten ist, daß auch dieses Dritte als ein temporal Bestimmbares sich ergeben wird. Auf dieses Dritte stoßen wir, wenn wir nun genau darauf achten, wie Hegel die beiden Seiten miteinander ins Gespräch kommen läßt. In der Kon- sequenz seiner Grundanlage liegt nämlich, daß auch Rückfragen des ›wir‹ des Phänomenologen an die sinnliche Gewißheit möglich sind. Also fragen ›wir‹ sie doch zurück, was sie denn meint, wenn sie von einem Diesem spricht:
» Sie ist also selbst zu fragen: Was ist das Diese ? Nehmen wir es in seiner doppelten Gestalt seines Seins, als das Jetzt und als das Hier, so wird die Dialektik, die es an ihm hat, eine so verständliche Form erhalten, als es selbst ist. Auf die Frage: was ist das Jetzt ? antwor- ten wir also zum Beispiel: das Jetzt ist die Nacht. Um die Wahrheit dieser sinnlichen Gewißheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese Wahrheit auf; eine Wahrheit kann durch aufschreiben nicht verlieren; ebensowenig dadurch, daß wir sie aufbewahren. Sehen wir jetzt, diesen Mittag, die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so werden wir sagen müs- sen, daß sie schal geworden ist.« (ebd., S. 84)
Man beachte, daß in diesem Abschnitt das ›wir‹ des Phänomenolo- gen nicht nur die Frage stellt, sondern auch die Antwort gibt. »Auf die Frage: was ist das Jetzt ? antworten wir also zum Beispiel ... «. Zu dieser Rollenübernahme kommt es, weil die Frage: Was ist das Diese? zunächst in die Frage nach dem Hier und dem Jetzt verwan- delt wird[1]. Auf die gestellte Frage gibt das ›wir‹ die Antwort: Das Jetzt ist die Nacht. Und: »Um die Wahrheit dieser sinnlichen Ge- wißheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schrei- ben diese Wahrheit auf; ...«. In der Folge wird begründet, warum das Aufschreiben als die Prüfung der Aussage der sinnlichen Gewißheit gelten kann: Durch das Aufschreiben, wie durch das Aufbewahren, verliert die Wahrheit nichts. Dahinter liegt: Die Wahrheit bleibt in ihrem Aufgeschriebensein erhalten. Hegel gibt also, nachdem er das zusehende und fragende ›wir‹ die Antwort auf die Frage nach dem Jetzt der sinnlichen Gewißheit hat geben lassen, einen Maßstab zur Prüfung der Wahrheit der sinnlichen Gewißheit - und damit des reinen Seins - an, der seine Auszeichnung darin hat, daß er dauert. Dies Dauernde ist die geschriebene Sprache; an ihr »widerlegen wir unmittelbar unsere Meinung« (ebd., S. 85) und in ihr ist das »sich erhaltende Jetzt ... nicht ein unmittelbares, sondern ein vermitteltes« (ebd., S. 84), ein allgemeines Jetzt. Nicht anders beim Hier. Auch das »Hier selbst verschwindet nicht; sondern es ist bleibend im Ver- schwinden des Hauses, Baumes usf. und gleichgültig, Haus, Baum zu sein« (ebd., S. 85). Hegel unterstreicht das ›es ist‹ in diesem Satz. Damit deutet er zurück auf die anfängliche Aussage der sinnlichen Gewißheit. Hätte er alle aufeinanderfolgenden Worte zum Hier, die Worte ›es ist bleibend im Verschwinden‹ unterstrichen, hätte er zusätzlich zum Hinweis auf das reine Sein auch den Horizont seiner Auslegung angegeben: Dieser Horizont ist in der Dauer gegeben.
Die Dauer ist das gesuchte Dritte gegenüber der Anwesenheit des Seienden im Ganzen, dem ›es ist‹, und der je einzelnen Gegenwart einer sinnlichen Gewißheit, dem Diesen. In ihr als ihrem Maßstab - der zugleich Resultat ist - treffen und vermitteln sich die beiden Seiten. Abschließend heißt es:
»Dieser sinnlichen Gewißheit, indem sie an ihr selbst das Allge- meine als die Wahrheit ihres Gegenstandes erweist, bleibt also das reine Sein als ihr Wesen, aber nicht als Unmittelbares, sondern [als] ein solches, dem die Negation und die Vermittlung wesent- lich ist.« (ebd., S. 85)[1]
2. Vergleichen wir damit den Anfang der Logik. - Wie gesehen, bringt Hegel die Schrift oder die geschriebene Sprache zu Beginn der Phänomenologie als allgemeines, die einzelnen Hier und Jetzt aufhebendes und aufbewahrendes Medium ins Spiel. Da mit dem ›einfachen Versuch‹ des Aufschreibens der Aussagen der sinnlichen Gewißheit für Hegel deren Wahrheit (der sinnlichen Gewißheit selbst aber: ihre Unwahrheit) sich zeigt, konnten wir den Horizont der Bestimmung des reinen Seins in der Dauer finden. Sehen wir nun zu, welche Funktion der Schrift am Anfang der Logik zukommt, so stoßen wir - entsprechend der gewandelten Bedeutung des reinen Seins - auf folgendes: Für den Satz, der den Anfang der Logik markiert, darf nicht mehr gelten, daß er als sprachlicher Ausdruck einzelne Hier und Jetzt aufhebt, vermittelt und aufbewahrend ent- hält, sondern, beinahe umgekehrt, muß für ihn gelten, daß er im selben Moment, da er gesagt wird, ebenso sich als Gesagtes aufhebt. Nur ein Satz, der aufgrund seiner Form und seines Inhalts sofort - indem er gesetzt wird - sich aufhebt und verschwindet, dauert nicht. Positiv läßt sich das Gesagte als die Forderung formulieren, einen Satz zu finden, der die Eigenart hat, sein Gesetztsein, und d. h. sein Erscheinen als endlich-begrenzter Satz unmittelbar zu durchstoßen und so als Satz seine Funktion nur darin hat, Reflex des Unendlichen zu sein. Dieser Forderung hat Hegel mit dem ersten Satz seiner Wissenschaft der Logik zu genügen versucht[1]. Wie wir jetzt sehen werden, läßt sich die Hegelsche Lösung jener Forderung nach einem unmittelbar sich selbst aufhebenden, unendlichen Satz vor dem Hintergrund des Versuchs interpretieren, den springenden Punkt zu sagen.
Der springende Punkt ist zunächst das Blut. Als solches weist er zurück auf die in der Phänomenologie dargestellte Entwicklung der Erhebung vom Endlichen zum Unendlichen: Der Syllogismos der Transsubstantiation hat seine, ihn vermittelnde Substanz im Blut. Nun ist der springende Punkt aber auch die Zeit. Die Bemer- kung, darin die Zeit als springender Punkt bezeichnet wird, findet sich in dem bereits mehrfach herangezogenen dritten Jenaer Systementwurf. Die Zeit wird dort als die Einheit des »daseyen- de[n] reine[n] Widerspruch[s]« und dessen »beständigen sich Auf- hebens« vorgestellt. Als dieses letztere, als das Dasein des beständi- gen sich Aufhebens ist die Zeit, wie eine Randbemerkung hervorhe- bend bemerkt, der » springende Punkt « (GW Bd. 8, S. 11)[2]. Der Ausdruck nimmt, wie der Zusammenhang deutlich macht, unmit- telbar die kurz zuvor gegebene Bestimmung der Zeit auf. Die Zeit, heißt es dort, als der »daseyende reine Widerspruch« ist:
»das daseyende Seyn, das unmittelbar nicht ist, und das daseyende Nichtseyn, das ebenso unmittelbar ist « (ebd.).
Vergleichen wir diese Formulierung mit der Hegelschen Bestim- mung des Anfangs der Logik. Wie es in der vorbereitenden Abhand- lung Womit mußder Anfang der Wissenschaft gemacht werden? heißt, ist der Anfang die »Einheit von Sein und Nichts« und als solcher:
»Nichtsein, das zugleich Sein, und Sein, das zugleich Nichtsein ist« (Das Sein[1812], S. 39).
Die Ähnlichkeit der beiden Formulierungen zur Zeit und dem An- fang springt sofort in die Augen. In beiden ist von einem in sich widersprüchlichen, unvermittelt vom Sein ins Nichtsein und vom Nichtsein ins Sein Umschlagenden die Rede. Das eine Mal nennt Hegel dieses Umschlagen: Zeit bzw. springender Punkt, das andere Mal: Anfang. Wie also muß der Anfang der Logik lauten, wenn er, gemäß unserer These, den springenden Punkt in einem Satz aussagen soll? Antwort: »Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe«.
Doch bleiben mehrere Schwierigkeiten. Eine davon, wohl die wichtigste, ist: Sowohl gemäß unserer als auch der Hegelschen Dar- stellung soll es sich beim Anfangssatz der Logik um einen Satz handeln, der, gesetzt, sich unmittelbar selbst aufhebt und als unend- lich erweist. Da nun in unserer Interpretation der Anfangssatz den springenden Punkt sagen soll, der springende Punkt von Hegel aber mit der Zeit in Verbindung gebracht wird, stellt sich die Frage: Wie soll ein den springenden Punkt sagender, und d. h. ein mit der Zeit in Verbindung stehender Satz an sich selbst unendlich sein? Achten wir dazu auf die von Hegel in den beiden Zitaten gebrauchten Worte ›unmittelbar‹ und ›zugleich‹. Sowie die Zeit ein daseiendes Sein sein soll, das unmittelbar nicht ist - und umgekehrt -, so ist im Anfang ein Sein auszumachen, das zugleich Nichtsein ist - und umgekehrt. Beide, die Art und Weise des Zusammenseins von Sein und Nicht- sein anzeigenden Worte deuten auf die temporale Dimension der Gegenwart. So hat Hegel, ebenfalls im dritten Jenaer Systement- wurf, die Unmittelbarkeit direkt als Gegenwart verstanden (GW Bd. 8, S. 11). So läßt sich schließlich die angezogene Einheit von Sein und Nichts als die Einheit von Sein und Nichts in einer Gegenwart deuten. Ineins damit ist die Möglichkeit gegeben, den Satz ›Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe‹ als einen an sich selbst unendlichen Satz zu deuten. Warum? Weil Hegel die Gegenwart als die absolute Gegenwart mit der Ewigkeit ineins setzt[1]:
»Was absolut gegenwärtig oder ewig ist, ist die Zeit selbst, als die Einheit der Gegenwart[,] Zukunft und Vergangenheit.« (ebd., S. 13)
Ließe sich nun zeigen, daß der Anfangssatz der Logik gerade als einer dem springenden Punkt ausdruckverleihender seinen Hori- zont in der Einheit der drei Zeitdimensionen oder der absoluten Gegenwart hat, so wäre damit seine innere Unendlichkeit als Mög- lichkeit belegt. Dazu ist der kleine, unscheinbare Schritt vom sprin- genden Punkt zum springenden Jetzt -Punkt nötig. Vom Jetzt oder dem »Itzt« heißt es nämlich kurz vor dem eben Zitierten, daß es die »Einheit dieser Dimensionen« (nämlich der Zukunft, der Vergan- genheit und der Gegenwart) sei und daß, um der »Untheilbarkeit des Itzt willen, ... alle drey [Dimensionen] ein und dasselbe Itzt« sind. Daß der Schritt vom springenden Punkt zum springenden Jetzt- Punkt der Hegelschen Auffassung nahe bleibt, belegen seine Aus- führungen zu den einzelnen, je vom »Itzt« her verstandenen Dimen- sionen deutlich: Während die Gegenwart zunächst als einfache Gegenwart oder Unmittelbarkeit, - als das Itzt, das »schlechthin alles andre aus sich aus[schließt]« (ebd., S. 11) - gefaßt wird, kommt mit der »zweyte[n] Dimension«, der Zukunft, das »Negiren dieses Itzt«, ein Anderes hinzu; wir halten dann »das Nichtseyn ihres Seyns [des Seins der Gegenwart] fest «. So ist die Zukunft »unmittelbar in der Gegenwart, denn sie ist das Moment des Negativen in dersel- ben«, und er erläutert: »das Itzt ist ebenso Seyn, das verschwindet, als das Nichtseyn unmittelbar zu seinem eignen Gegentheil, zum Seyn umgeschlagen ist; um dieser Unmittelbarkeit willen fällt das Seyn ihres Unterschiedes außer ihnen.« Von dieser Verselbständi- gung der Bewegung des Unterscheidens von Gegenwart und Zu 258, Zusatz ], H.v.m.). - Bereits Heidegger hat auf dieses Verhältnis von Ewigkeit und Dauer in Hegels Metaphysik hingewiesen. In einer Vorlesung aus dem Jahre 1930 heißt es dazu, nachdem Heidegger die Hegelsche Bestimmung der Ewigkeit als der absoluten Gegenwart zitiert hat: »Diese Gegenwart ist nicht die des mo- mentanen Jetzt, das alsbald verfließt und verflossen ist, auch nicht bloß die dauernde Gegenwart im gewöhnlichen Sinn des weiter fort Währenden, sondern jene Ge- genwart, die bei sich selbst und durch sich selbst steht, in sich reflektierte Dauer; eine Anwesenheit von der höchsten Beständigkeit, die nur die Ichheit, das Beisich- selbstsein, zu geben vermag« (GA Bd. 31, S. 110). Leider hat Heidegger diese seine Einsicht in das Verhältnis von Ewigkeit und Dauer bei Hegel in der Vorlesung des folgenden Semesters zur Phänomenologie nicht auf diese angewendet. Für ihn beginnt die Phänomenologie » absolut mit dem Absoluten « (GA Bd. 32, S. 54) -, das ist aber gerade die Frage.
kunft her gewinnt Hegel die Vergangenheit; so, daß er schließlich in ihr das »reine Resultat, oder die Wahrheit der Zeit« (ebd., S. 13) ausmachen kann[1].
Neben diese Bestimmungen der drei Dimensionen und ihrer Einheit gehalten, gewinnen die Sätze, die Hegel unmittelbar auf den Anfangssatz seiner Logik folgen läßt, einen nun bestimmbaren Sinn. Sogleich nach der Setzung des Anfangssatzes ›Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe‹ heißt es nämlich:
»Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern daß das Sein in Nichts und das Nichts in Sein - nicht übergeht -, sondern übergegangen ist. Aber ebensosehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern daß sie absolut unterschieden sind, aber ebenso jedes in seinem Gegenteil verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwin- dens des einen in dem anderen: das Werden, eine Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat.« (Das Sein[1812], S. 48)
Das Variieren zwischen der Geltung des Anfangssatzes als eines Vergangenen - das Sein ist mit ihm in Nichts und das Nichts ist mit ihm in Sein über gegangen - und einem noch Gegenwärtigen - Sein und Nichts sind absolut unterschieden und jedes ebenso in seinem Gegenteil verschwindend - deutet darauf hin, daß in ihm die Wahr- heit der Zeit (die Vergangenheit) als Ewigkeit oder Unendlichkeit (als unendliche Gegenwart) zum Ausdruck gebracht werden soll. So läßt sich der Anfangssatz der Logik als jenes textuelle Ereignis
fassen, das zwar den Anfang einer auf es folgenden Schrift markiert – und von ihr her gesehen dann als Vergangenes erscheint -, das aber dennoch durch die ganze folgende Darstellung hindurch stets gegenwärtig -, absolut gegenwärtig bleibt[1].
Ich gehe auf den weiteren Inhalt und Fortgang der Wissenschaft der Logik nicht näher ein. Dazu ist unsere Perspektive zu grobma- schig. Doch lassen sich vor dem Hintergrund unserer These, ähnlich wie zur Phänomenologie, einige allgemeine, weitere Bemerkun- gen machen.
Erste Bemerkung. Hegel hat stets daran festgehalten und es immer wieder ausgesprochen, daß die Wissenschaft der Logik, d. h. die darin enthaltenen logischen Bestimmungen, als »Definitionen des Absoluten« oder als die » metaphysischen Definitionen Gottes « an- gesehen werden können (so: Enz. I, § 85; TWA Bd. 8, S. 181). Außerdem hat er die Logik in drei Teile geteilt: In die Lehre vom Sein, die Lehre vom Wesen und die Lehre vom Begriff [2]. So werden die metaphysischen Definitionen Gottes also in drei Teilen präsen- tiert. Zusammen mit der Bemerkung, daß die jeweils » zweiten Be- stimmungen«, da sie Bestimmungen der jeweiligen Sphäre »in ihrer Differenz « sind, die »Definitionen des Endlichen « (ebd.) seien, läßt sich vermuten, daß die Ordnung der Logik auf das aus dem Chri- stentum bekannten Dogma der trinitarischen Verfaßtheit Gottes verweist. »Die Logik als ganze ist also die Darstellung der spekula- tiven Wahrheit dessen, was die christliche Dogmatik als ›immanente Trinität‹ bezeichnet« - so etwa lautet die prägnante Formulierung eines Interpreten der ›Trinitätslehre‹ Hegels‹[3]. Ohne auf eine Dis- kussion dieser Interpretation einzutreten, läßt sich dennoch sagen: Falls die Ordnung der Hegelschen Logik Affinitäten zur christli- chen Doktrin der Trinität aufweist - und es spricht einiges dafür -, ist dies vor dem Hintergrund unserer Deutung relativ einfach zu erklären. Wie gesehen, läßt Hegel im entscheidenden Übergang von der Phänomenologie zur Logik das Resultat der Ersteren, das reine Wissen, in den Anfang des letzteren Werkes, das reine Sein, umschlagen. In unserer Formulierung hieß dasselbe: Übergang vom spekulativ auf das Wissen angewandten Syllogismos der Transsub- stantiation zur spekulativ-logischen Satzform als Ausdruck des springenden Punktes. Dergestalt läßt sich der die Entwicklungen der Logik initialisierende abstrakte Anfang als Fülle, und zwar als Fülle des im Verlaufe einer Transsubstantiationsbewegung Gewonnenen fassen. Wenn wir nun die Wissenschaft der Logik als die von ihrem Anfang her zu verstehende, im unzeitlichen sich zutragende Ausfaltung des zuvor Gewonnenen verstehen, so kann es nicht verwundern, daß diese Ausfaltung zur Strukturierung ihrer selbst auf in ihrem Anfang liegende Momente zurückgreift. Können wir nun jene Bewegung (der Phänomenologie des Geistes) als die durch eine Transsubstantiationsbewegung vermittelte Erhebung vom Endlichen zum Unendlichen fassen, so können wir diese Be- wegung (der Logik) als die im Ewigen sich zutragende Ausfaltung des in jener Bewegung Durchlaufenen verstehen. Die Ausfaltung des göttlichen Begriffs geschieht dann entsprechend in drei - an das christliche Dogma der immanenten Trinität erinnernden - Teilen[1].
Zweite Bemerkung. Eine ganz anders geartete, frühe und einflußrei- che Kritik hat die Hegelsche Logik durch A. Trendelenburg erfah- ren. In seinen bald nach Hegels Tod (1831) veröffentlichten Logi- schen Untersuchungen - das Vorwort zur ersten Auflage ist auf den 1. August 1840 datiert - geht er im dritten Kapitel näher auf die dialektische Methode und insbesondere auf die von Hegel an den Anfang seiner reinen Wissenschaft gesetzte Dialektik von Sein und Nichts ein. Trendelenburg:
»Das reine Sein, sich selbst gleich, ist Ruhe; das Nichts - das sich selbst Gleiche - ist ebenfalls Ruhe. Wie kommt aus der Einheit zweier ruhenden Vorstellungen das bewegte Werden heraus? Nirgends liegt in den Vorstufen die Bewegung vorgebildet, ohne welche das Werden nur ein Sein wäre.«[1]
Trendelenburg moniert, daß Hegel, gleich zu Beginn seiner Logik, die Bewegung »stillschweigend unter[schiebt]« um Sein und Nicht- sein in den Fluß des Werdens zu bringen (ebd.). Die »räumliche Bewegung«, so heißt es weiter, »ist hiernach zunächst die Vorausset- zung der voraussetzungslosen Logik« (ebd., S. 42). Ohne auf die Qualifizierung der in der Hegelschen Logik auftretenden Bewe- gung als einer räumlichen näher einzugehen - Trendelenburg vertritt die Auffassung, daß die Kategorien der Logik von der Naturphilo- sophie her zu verstehen seien -, wird hier auf wichtiges hingewiesen: Man kann und muß sich tatsächlich fragen, wie die Logik, nachdem sie die beiden Unmittelbaren: Sein und Nichts, lediglich genannt hat, zur inneren Bewegtheit ihrer Sätze kommt. Der erste Satz der He- gelschen Logik lautet: »Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe«. In ihm wird, so unsere These, dem springenden Punkt satzhaft Ausdruck verliehen. Wie wir im ersten Kapitel zur Natur- philosophie gesehen haben, bringt Hegel den springenden Punkt - lokalisiert im Inneren des Organismus und verknüpft mit dem Kreis- lauf des Blutes - mit dem ›Unbewegbaren, das aber bewegt‹ in Verbindung. Da mit ihm der letzte, nicht weiter ableitbare Grund des Kreislaufsystems gegeben ist, der Grund aber das Allgemeine, der no}V[2] ist, - und in diesem Allgemeinen und doch ›Einfachen, welches die Einheit Entgegengesetzter ist‹, die Bewegung spontan anfängt, ergibt sich schließlich die Möglichkeit, der den springenden
Punkt sagenden Anfangssatz der Logik als jenen, von Trendelenburg vermißten Umschlagspunkt der Ruhe in Bewegung zu verstehen[1].
Ü bergang
Wir haben unserer Studie zu Beginn die Aufgabe vorgesetzt, der Hegelschen Übertragung der Bewegungsform des Pulsierens auf einige der Hauptworte seiner Metaphysik (Geist, Idee, Begriff) nachzugehen. Nun sind wir dahin gelangt, im Anfang der Wissen- schaft der Logik den satzhaften Ausdruck für das zu finden, was wir den springenden Punkt nennen. Da nun einerseits das Springen des springenden Punkts auf das Pulsieren zurückverweist, anderer- seits der Anfang der Logik einen Mittel- und Ausgangspunkt der Hegelschen Metaphysik darstellt, scheint die Aufgabe, jenen Ort aufzufinden, der der generellen Übertragung der Pulsbewegung ihre Legitimation verschafft, gelöst: Weil am Anfang der Logik - und d. h. in der Mitte der Hegelschen Philosophie - verborgen ein Punkt pulsiert[2], wird es für Hegel möglich, die pulsierende Bewegung auf den Geist, den Begriff und die Idee im allgemeinen zu übertragen.
Nun wird man gegen diese Deutung - wie bereits gegen die Anlage der Studie insgesamt - einwenden, daß sie das von Hegel begrifflich Ausgedrückte unter im weitesten Sinne ä sthetischen Kategorien auszulegen versucht[1]. So wie die Aufmerksamkeit auf die Metapher des Pulsierens einem Interesse an der rhetorischen Dimen- sion des Hegelschen Diskurses entspringt, liegt nun, mit der Ein- legung eines ›springenden Punkts‹ in den Anfangssatz der Logik, eine Sichtweise vor, die schließlich nicht umhin kommt, von einem ›textuellen Ereignis‹ zu sprechen.
Dieser Hinweis ist aufzunehmen. Doch nicht so, daß nun in eine Diskussion um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer ästheti- schen Wahrnahme des Hegelschen Textes einzutreten wäre, sondern es ist der Versuch zu unternehmen, in den von der Hegelschen Ästhetik selbst eröffneten Raum einzutreten, um von dort, mithilfe Hegels selbst, einen Rückblick auf die Berechtigung oder Unzuläs- sigkeit unserer Auslegung vorzunehmen.
Dabei kann der Frageansatz derselbe bleiben. Auch an die Hegel- sche Ästhetik ist zunächst die Frage zu stellen: Wo und in welchem Zusammenhang wird in ihr das Wort ›Pulsieren‹ gebraucht?
Sehen wir zu, wohin wir gelangen, wenn wir die unter ä sthetischen Kriterien stehende Frage nach dem Gebrauch des Ausdrucks ›Pulsieren‹ auf Hegels eigene Ästhetik anwenden.
IV. Die Diaphanie des Pulses
Einleitung
D ie Kunst ist die erste Sphäre des absoluten Geistes. Das in ihr waltende, formale Prinzip ist die Anschauung. Die ästhetische
Anschauung ihrerseits schaut etwas an, d. h. sie ist wesentlich auf ein ihr von außen gegebenes Materielles angewiesen. Diese Angewiesen- heit auf ein Materielles, darin der ästhetischen Anschauung das Kunstwerk erscheint, macht das objektive Moment der Sphäre der Kunst aus. Dabei ist, so Hegel, zu beachten, daß das äußerliche objektive Dasein des Kunstwerks nur deshalb der Sphäre des abso- luten Geistes angehören kann, weil es den Durchgang durch den Geist hinter sich hat, d. h. vom und durch den Geist erzeugt worden ist. Das Naturschöne, das ebenso äußerlich, objektiv und materiell ist und ebenso angeschaut werden kann wie das Kunstwerk, wird gleich zu Beginn der Ästhetikvorlesungen[1] ausgeschieden: Die Na- turschönheit kommt nur als ›Reflex des Geistes‹ in Betracht[2].
Bemerkenswerterweise erscheint aber das Naturschöne, das aus dem Gegenstandsfeld der Philosophie der schönen Kunst zunächst ausgeschlossen wird, innerhalb des einführenden, systematischen Teils wieder. Wie das? Wie wird das zunächst ausgeschlossene na- türlich Seiende wiederaufgenommen? Das natürlich Seiende oder das Naturschöne wird in der Philosophie der Kunst - entsprechend ihrer Gesamtanlage - unter dem Gesichtspunkt eines noch unvoll- ständigen Durchgangs durch den Geist aufgenommen. Hegel be- mängelt am Naturschönen, daß sein Inneres nur Inneres bleibt, daß das natürlich Seiende es nicht dazu bringt, sein Äußeres vollständig von einem Innerlichen durchzogen erscheinen zu lassen. Auf dem Wege der Bewegung eines zunehmend deutlicheren Hervortretens des Absoluten im Sinnlichen bleibt das Natürliche Vorstufe: Seine Selbsttransparenz bleibt mangelhaft. Wie aber, so ist zu fragen, gewinnt und bestimmt Hegel schließlich den Übergang vom Natur- schönen zum Kunstschönen, - vom äußerlichen, anschaubaren, aber vom Geist undurchdrungenen Natürlichen -, zu den Gestalten der Kunst?
Hegel setzt an genau die Stelle, da es um die Verhältnisbestim- mung des Natur- und Kunstschönen geht, eine Analogie, in der er die Aufgabe der Kunst unter Rückgriff auf Verhältnisse im Natürli- chen bestimmt[1]. Vorbereitet wird die Analogie, indem vom Auge und der Seele gesprochen wird. Auf die Frage, in welchem Organ des menschlichen Leibes am ehesten die Seele gesehen wird und sich ausdrückt, gibt Hegel die Antwort: im Auge. Da ß das Auge sieht und was im Auge gesehen wird: jedesmal ist es ein Ausdruck des Seelischen. Unmittelbar an diese Verknüpfung von Seele und Auge wird die uns interessierende Analogie angeschlossen. Unter Rück- griff auf den zuvor erläuterten Unterschied von tierischem Körper und menschlichem Leib heißt es:
»Wie sich nun an der Oberfläche des menschlichen Körpers im Gegensatze des tierischen überall das pulsierende Herz zeigt, in demselben Sinne ist von der Kunst zu behaupten, daß sie jede Gestalt an allen Punkten der sichtbaren Oberfläche zum Auge verwandle, welches der Sitz der Seele ist und den Geist zur Erscheinung bringt.« ([Hotho] TWA Bd. 13, S. 203)[2]
»Blitzlichthaft«, so ein Kommentator unseres Textes, »ist in die- ser Passage die Hegelsche Kunstphilosophie ausgeleuchtet und ein- gefangen«[1]. Tatsächlich weist der Inhalt und die Stellung dieser Analogie sie als Angel und Brücke aus: In ihr gibt Hegel - in der Form einer Analogie, die aufgrund ihrer die Teile zusammenbinden- den Kraft an Platon erinnert - die Bestimmung der Sache der Kunst. Ich sage Bestimmung der Sache der Kunst, denn erst mit diesem Vergleich gelingt es Hegel, von einem Außerhalb des Kunstschönen her, ihm - dem Kunstschönen - die Sache und Aufgabe vorzusagen. Die Hegelsche Vorgabe aber der Sache der Kunst greift auf eine von ihm im Natürlichen beobachtete Differenz zurück: der Differenz von tierischem und menschlichem Körper, genauer: auf das Erschei- nen bzw. Nichterscheinen des pulsierenden Herzens an der Ober- fläche des tierischen bzw. menschlichen Körpers. Unsere Aufgabe besteht nun darin, nachzusehen, ob, und wenn ja: wie, sich diese analogische Bestimmung der Sache der Kunst in der Hegelschen Systematik niederschlägt. Ist sie tatsächlich jenes ›Blitzlicht‹, von dem J. Simmen spricht?
Zunächst ist der erste Bezug von tierischem Körper und mensch- lichem Leib zu betrachten. Danach ist der Formulierung vom Auge, das an allen Punkten der Kunstgestalt zu erscheinen habe, nachzu- gehen.
1. Zum Unterschied der Erscheinungsweise von Tier und Mensch
Die Analogie setzt mit dem Hinweis auf den Unterschied von tierischem und menschlichem Körper ein. Hegel sieht diesen Unterschied im Nichterscheinen bzw. Erscheinen des pulsierenden Herzens an der Oberfläche des tierischen bzw. menschlichen Körpers. Zu fragen ist: Vor welchem Hintergrund spitzt sich der Vergleich von Mensch und Tier auf diesen Punkt zu?
Dieser Hintergrund wird im ersten Teil der Vorlesungen über die Ästhetik erarbeitet.
Die leitenden Titel zur Bestimmung des Naturschönen sind: die Idee und das Leben [1]. Die Idee wird von Hegel dabei als Einheit von Begriff und Realität, das Leben aber als die erscheinende Idee und
d. h. als die Einheit von Seele und Leib gefaßt. Den lebendigen Zusammenhang von Seele und Leib - und damit die Realität der Idee
- findet Hegel im Organischen. Damit ist nur wiederholt, was uns bereits aus der Naturphilosophie bekannt ist: Die Privilegierung und Höherstufung des Organischen, Lebendigen gegenüber dem bloß Mechanischen oder Chemischen. Hier, in der Ästhetik, findet Hegel jene Grunddifferenz im Unterschied, d. h. in der unterschiedlichen Bedeutung von Teil und Glied expliziert: Während Teile bloß zu- sammenhängen, finden Glieder ihre Existenz in der »ideellen Ein- heit« ([Hotho] TWA Bd. 13, S. 160).
»Wir müssen die Identität von Seele und Leib nicht als bloßen Zusammenhang auffassen, sondern in tieferer Weise. Den Leib und seine Gliederung nämlich haben wir anzusehen als die Existenz der systematischen Gliederung des Begriffes selbst, der in den Gliedern des lebendigen Organismus seinen Bestimmtheiten ein äußeres Naturdasein gibt.« (ebd., S. 161)[1]
Das Gemeinte - es geht hier nur um die Bestimmung des Unterschie- des von zusammenhängenden Teilen und in sich verbundenen Glie- dern - wird am Unterschied von Sonnensystem und Organismus verdeutlicht. Läßt sich die Sonne als Seele und die Planeten und Monde als Glieder ihres Systems auffassen? Nein, sagt Hegel, denn die Sonne bleibt von ihren Gliedern verschieden, es findet keine Einheit statt: »Die Momente des Begriffs sind hier im Sonnensystem ... unterschiedene Existenzen; sie machen nur ein System, kein Indi- viduum aus«[2]. Erst im lebendigen, organischen Individuum ist die Idee realisiert. Als Beleg der im Organismus erreichten Identität von Begriff und Realität, von Seele und Leib, gilt die Empfindung: »Die Empfindung des lebendigen Organismus gehört nicht nur einem besonderen Teile selbständig zu, sondern ist diese ideelle einfache Einheit des gesamten Organismus selbst«[3]. In der Empfindung sind die Teile des Organismus als Glieder erkannt: »Ich bin nicht viele, sondern ein Empfindendes«[4]. Hegel spricht in diesem Zusammen- hang vom »Idealismus der Lebendigkeit«[5]. Doch ist das nur die eine Seite: denn da die Einheit von Seele und Körper sich zwar in einem gegliederten Organismus kundgibt, andererseits aber die empfin- denden Glieder auf eine lebendige Einheit zurückverweisen, liegt im Ganzen des Organismus ein Widerspruch [6]. Dieser Widerspruch ist der vom Organismus selbst interpretierte Unterschied von Seele und Leib: die Glieder, ständig von der belebenden Einheit zurückgenom- men, negiert, erhalten gerade in der Negation ihrer Äußerlichkeit, in ihrer Zusammennahme in die Seele ihre positive Existenz als Glieder des belebten Körpers. Der Unterschied von Seele und Leib wird so zur Differenz von ideeller Einheit und realem Außereinander, das »Setzen und Auflösen des Widerspruchs von ideeller Einheit und realem Außereinander macht den steten Prozeß des Lebens aus«[1]. Im Gegensatz zum System der Sonne, wo die Sonne eine für sich abgesonderte Existenz behält, werden die Glieder des Organismus im gedoppelten Prozeß des Lebens »stets erhalten und stets in die Idealität ihrer Belebung zurückgenommen«[2]. Von hier aus gelangt Hegel zur Erscheinung [3]. Denn was ist die Erscheinung? Hegels Antwort: »Erscheinung ... heißt nichts anderes, als daß eine Realität existiert, [die] jedoch nicht unmittelbar ihr Sein an ihr selbst hat, sondern in ihrem Dasein zugleich negativ gesetzt ist«[4]. So ist das Leben gleichbedeutend mit seinem Erscheinen: Ein Inneres, das Äußere negierend, setzt sich an ihm zugleich als Erscheinendes positiv. Es läßt sich also sagen, daß mit dem Organismus eine Realität gegeben ist, bei der das Äußere sich an ihm selbst als Inneres zeigt[5].
Dieses Zurückzeigen des Äußeren auf ein Inneres ist das Erschei- nen[1].
Soviel zum Hintergrund des ersten Verhältnisses der in Frage stehenden Analogie. Wie erinnerlich, wird dort ein Bezug von tieri- schem und menschlichem Körper angesprochen. Hegel führt als Mangel des tierischen Körpers an, daß an seiner Oberfläche - im Gegensatz zur Haut des Menschen - das pulsierende Herz sich nicht zeige. Dessen Existenz erfüllt also nur unvollständig die Forderung des Erscheinens: Das Innere - d. h. hier das pulsierende Herz - zeigt sich nicht oder zu wenig am Äußeren. Die Erklärung, die Hegel dazu anbringt, folgt streng dem Gedanken einer Stufung der Natur. Dabei wird die Stufenreihe Pflanze-Tier-Mensch mit der Forderung des Erscheinens des Inneren am Äußeren so verknüpft, daß erst beim Menschen ein Höheres, nämlich das Erscheinen des Inneren als Inneres, erreicht wird. Während an der Oberfläche des tierischen Organismus ein Rückfall zum Vegetabilischen zu beobachten ist - Hegel führt das Federkleid, die Schuppen, die Haare, den Pelz, die Stacheln und die Schalen der Tiere an -, kehrt sich beim Menschen das Innere, der Einheitspunkt des Lebens nach außen:
»Die Haut [des Menschen] ist nicht mit pflanzenhaft unlebendi- gen Hüllen verdeckt, das Pulsieren des Blutes scheint an der ganzen Oberfläche, das klopfende Herz der Lebendigkeit ist gleichsam allgegenwärtig«[1].
Mit diesem Satz sind wir unmittelbar beim ersten Teil der Ausgangsanalogie angelangt. Diese lautet:
»Wie sich nun an der Oberfläche des menschlichen Körpers im Gegensatze des tierischen überall das pulsierende Herz zeigt, in demselben Sinne ist von der Kunst zu behaupten, daß sie jede Gestalt an allen Punkten der sichtbaren Oberfläche zum Auge verwandle, welches der Sitz der Seele ist und den Geist zur Erscheinung bringt«. (TWA Bd. 13, S. 203)
Exkurs: Die spekulative Deutung der Natur der menschlichen Gestalt
Bevor ich zur Darstellung des zweiten Teils der Analogie weitergehe, ist auf eine leicht zu übersehende Besonderheit hinzuweisen. Es fällt zunächst nicht auf, daß Hegel in der Mitte der Analogie, als Dreh- punkt des Vergleichs, den menschlichen Leib ansetzt. Denn: Sowohl das pulsierende Herz als auch das Auge sind als spezifische Merk- male des menschlichen Leibes genommen -, damit rückt seine Ge- stalt in die Mitte der Analogie. Die Analogie wird ihm damit gleich- sam auf den Leib geschrieben - man könnte sagen: sein Leib wird ihm zum Zeichen des Übergangs vom Naturschönen zum Kunst- schönen. Diese Beobachtung lenkt den Blick auf eine Bemerkung Hegels in der Enzyklopädie. Die Bemerkung fällt innerhalb der Philosophie des Geistes, genauer: dem vorletzten Paragraphen zur Anthropologie, der sich thematisch mit der wirklichen Seele oder der
Seele in ihrer Wirklichkeit befaßt (§ 411). Hegel bestimmt dort die Leiblichkeit des Menschen als das » Zeichen « und das »Kunstwerk der Seele« (TWA Bd. 10, S. 192). Da die Äußerlichkeit des mensch- lichen Leibes auf der Stufe der verwirklichten Seele nicht sich - also die bloße Äußerlichkeit - vorstellt, sondern die Seele, »ist sie deren Zeichen «. Die Spanne, die der als Zeichen verstandene Leib des Menschen nötig hat, um auf etwas anderes als sich selbst zu verwei- sen, wird auch hier anhand des Wortpaars Inneres-Äußeres ent- wickelt: Das Äußere, indem es auf ein Inneres verweist, ist das Zeichen dieses Inneren. Der hier gebrauchte Ausdruck ›Zeichen‹ meint nichts anderes als das uns bekannte ›Scheinen‹ des Inneren am Äußeren. Dieser Zusammenhang wird dadurch angedeutet, daß von der durch die Seele gestalteten Leiblichkeit des Menschen als von einem »Kunstwerk der Seele« gesprochen wird. Daß dieses Wort vom menschlichen Leib in die Sphäre des Ästhetischen gehört, macht ein Verweis deutlich, den Hegel in einem Paragraphen an- bringt, der davon spricht, daß die Kunst zu den von ihr zu produ- zierenden Anschauungen auch der »gegebenen Naturformen« be- darf (§ 558; ebd., S. 368): als die höchste dieser gegebenen Naturformen wird - unter Rückverweis auf den § 411, darin der menschliche Leib das »Kunstwerk der Seele« genannt wird - die menschliche Gestalt angegeben. Nehmen wir hinzu, daß kurz zuvor (§ 556; ebd., S. 367) das Ideal, d. h. die Gestalt der Schönheit, als das » Zeichen der Idee« angesprochen wird, so erkennen wir, daß in der Hegelschen Philosophie die Deutung des menschlichen Leibes mit der Be-Deutung der Worte ›Natur‹, ›Kunst‹ und ›Zeichen‹ einher- geht: Der in der Philosophie des Geistes als »Kunstwerk der Seele« bezeichnete menschliche Leib ist zugleich »höchste Naturform« und Ausgangsgestalt für die Kunst. - Wie wir sehen werden, findet diese zentrale Stellung der menschlichen Gestalt in der Hegelschen Interpretation des Übergangs von der griechischen Skulptur zu den romantischen Kunstformen ihren Ausdruck.
In Bezug auf den Übergang vom ersten zum zweiten Verhältnis der Ausgangsanalogie läßt sich von einer spekulativen Deutung des menschlichen Leibes durch Hegel sprechen: Indem er anhand einer natürlichen Gegebenheit - dem Durchscheinen des Blutes an der Oberfläche der menschlichen Haut - die Aufgabe der Kunst formu- liert - daß sie die zu formende Gestalt an allen Punkten ihrer Oberfläche zum Auge zu verwandeln habe -, wird ihm die Natur zum Ansatz und zur Ahnung dessen, was die Kunst vollendet.
»Es erledigt sich hierdurch das Prinzip von der Nachahmung der Natur in der Kunst«, lautet die hierher gehörende trockene Bemer- kung in einer Apposition zum § 558 der Enzyklopädie (ebd., S. 368).
2. Das nichterscheinende und das erscheinende Auge, oder: die Skulptur und die Malerei
Der zweite Teil der Analogie spricht die Aufgabe der Kunst an. Die Kunst, so wird gefordert, hat die Gestalt oder das Erscheinende[1] an allen Punkten zum Auge zu verwandeln. Sehen wir nun nach, wel- ches der privilegierte Ort innerhalb der Kunstphilosophie ist, da Hegel die Einlösung seiner Forderung findet, so stoßen wir auf den Übergang von der Skulptur zur Malerei: So wie er dem Fehlen des Augensterns an den klassischen griechischen Statuen Gewicht und Bedeutung beilegt, so hebt er die mit der Malerei erscheinende Subjektivität hervor, die sich im Blick des Auges zeige[2].
Die Skulptur ist die klassische Kunstform. Ihren geschichtlichen Ort hat sie in der Kunst der Griechen. Diese hätten es am vollkom- mensten vermocht, der Äußerlichkeit, und d. h. hier dem Material des Steins, jene Gestalt zu geben, darin der »Geist in seiner leiblichen Form in unmittelbarer Einheit still und selig dastehen« kann (TWA Bd. 13, S. 118). Systematisch zwischen die Objektivität der Archi- tektur und die Subjektivität der romantischen Kunstformen (Male- rei, Musik, Poesie) eingeordnet, sieht Hegel die Skulptur ihre Auf- gabe als Halt auf dem Wege vom bloß Äußerlichen zum rein Inneren vollbringen:
»Daher fehlt denn aber auch [d. h. aufgrund ihrer Stellung zwi- schen Objektivität und Subjektivität] der Skulpturgestalt, da sie den in die Körperlichkeit eingesenkten Geist vor die Anschauung bringt, der sich in der ganzen Gestalt sichtbar zeigen muß, der erscheinende Punkt der Subjektivität, der konzentrierte Aus- druck der Seele als Seele, der Blick des Auges.« (TWA Bd. 14, S. 357)
Diese Aussage findet sich in der Einleitung zur Darstellung der Skulptur; zunächst wird dort der Versuch abgewiesen, »historisch erweisen zu wollen«, daß die Alten an einigen Tempelstatuen ein Auge aufgemalt hätten. Auch der Einsatz von Edelsteinen in Augen- höhlen ist lediglich auf die »Lust« zurückzuführen, »die Götterbil- der so reich und prächtig als möglich auszuschmücken«.
»Wir können es deshalb als ausgemacht ansehen, daß an den wahrhaft klassischen und freien Statuen und Büsten, die aus dem Altertum auf uns gekommen sind, der Augenstern sowie der geistige Ausdruck des Blicks fehlt. Denn obschon häufig in den Augapfel auch der Augenstern eingezeichnet oder durch eine konische Vertiefung und eine Wendung angedeutet ist, welche den Glanzpunkt des Augensterns und dadurch eine Art von Blick ausdrückt, so bleibt dies dennoch wieder nur die ganz äußerliche Gestalt des Auges und ist nicht seine Belebung, nicht der Blick als solcher, der Blick der inneren Seele.« (ebd., S. 389)[1]
So entbehrt die Skulptur das Seelenvollste: das Auge. Den Grund sieht Hegel in der spezifischen Aufgabe der Skulptur: Diese hat die ›auseinandergeschlagene‹ Seele, die Totalität der äußerlichen Gestalt zum Zweck, und deshalb, so spitzt er zu, ist ihr »die Augenblicklich keit des Blicks nicht erlaubt« (ebd., S. 390). Die Griechen werden gerade aufgrund ihres Verzichts auf die Darstellung des konzentriertesten Ausdrucks der Seele gerühmt. Da bei ihnen der betrachtende Geist, der Beschauer, es ist, der die ins Äußerliche ergossene Totalität zusammenfaßt, gehört es zu ihrem großen Sinn, den konzentriertesten Ausdruck der Seele - das Auge -, dem Außen des materiellen Kunstprodukts nicht mitgegeben zu haben[1].
Allerdings ist dieser große, die Beschränkung festhaltende Sinn der Griechen ebenso ihr Mangel: Sie schauen ihre Götter nicht als den fleischgewordenen christlichen Gott an. Kunstsystematisch ist der geschichtliche Bruch zwischen den plastischen griechischen Göttergestalten und dem menschgewordenen Gott der Christen als Übergang von der Skulptur zur Totalität der romantischen Kunst- formen - d. h. der Malerei, der Musik und der Poesie - gefaßt; in ihnen erst kommt es zur vollständigen Äußerung des lebendigen, seelenvollen Inneren in das Gegenüber des Kunstwerks[2]. Dabei ist bedeutsam, daß, anders als der Übergang von der symbolischen zur klassischen Kunstform (Architektur-Skulptur), der Übergang von der klassischen zur romantischen Kunst kein aus der Kunstanschau- ung selber hervorgehender ist, sondern »ihr«, der Kunst, »als ein wirkliches Geschehen, als Geschichte des fleischgewordenen Gottes von außen gegeben« wird (ebd., S. 112). Hegel spricht in dieser entscheidenden Passage, dem Übergang von der klassischen zur romantischen Kunstform, immer wieder vom »Fleisch«, von »Fleisch und Blut«, von »Fleisch und Geist« und von der »Fleisch- werdung« des Gottes (ebd.). In der Einleitung zur ersten der roman- tischen Kunstformen, der Malerei, wird das in und mit ihr Anzuge hende als das »Herausleuchtende«, als das aus dem »Inneren heraus- scheinende« oder »das Hervorscheinen des in sich konzentrierten Inneren« angesprochen (TWA Bd. 15, S. 14f.). In der Kombination jenes außerästhetischen Ereignisses und der innerhalb der Kunstab- folge parallel sich ergebenden materialen Bestimmung dürfte also, Hegel zufolge, das Eigene der Malerei zu suchen sein. Und tatsäch- lich konzentriert sich die Aufgabe oder das von der Malerei zu lösende Problem in der Darstellung des Inkarnats, der menschlichen Fleischfarbe:
»Das Schwerste nun aber ... in der Färbung, das Ideale gleichsam, der Gipfel des Kolorits« - wobei die Farbe, das Kolorit als das »eigentliche Material der Malerei« angenommen ist (ebd., S. 33) - »ist das Inkarnat [1], der Farbton der menschlichen Fleischfarbe, welche alle anderen Farben wunderbar in sich vereinigt, ohne daß sich die eine oder andere selbständig heraushebt Diese [die Fleischfarbe] ... ist ein ideelles Ineinander aller Hauptfarben. Durch das durchsichtige Gelb der Haut scheint das Rot der Arterien, das Blau der Venen, und zu dem sonstigen mannigfal- tigen Scheinen und [den] Reflexen kommen noch graue, bräun- liche, selbst grünliche Töne hinzu, die uns beim ersten Anblick höchst unnatürlich dünken und doch ihre Richtigkeit und wahr- haften Effekt haben können.« (ebd., S. 78)
Im Inkarnat kommen die darstellerischen Möglichkeiten der Malerei und die Anforderung an sie zusammen: das Mittel der malerischen Darstellung, die Farbe, hat das göttliche Fleisch des Sohnes Gottes in ideeller Weise durchscheinen zu lassen.
Zusatz - Hegel zitiert in diesem Zusammenhang einen Ausspruch
D. Diderots (ebd., S. 79). Dieser schreibt in seinem Versuchüber die Malerei:
»Wer das Gefühl des Fleisches erreicht hat, ist schon weit gekommen, das übrige ist nichts dagegen. Tausend Maler sind gestorben, ohne das Fleisch gefühlt zu haben, tausend andere werden sterben, ohne es zu fühlen.«
Diese Übersetzung stammt von J. W. Goethe, der die Abhandlung Diderots (1795) im Jahre 1799 in deutscher Fassung mit Anmer kungen begleitet erscheinen ließ. Sein Kommentar nimmt die Aussagen Hegels vorweg. Auch er spricht von der Fleischfarbe als dem »Gipfel der Farbe«; und weiter:
»Die Elementarfarben, welche wir bei physiologischen, physi- schen und chemischen Phänomenen bemerken und abgesondert erblicken, werden, wie alle andere[n] Stoffe der Natur, veredelt, indem sie organisch angewendet werden. Das höchste organisier- te Wesen ist der Mensch, und man erlaube uns, die wir für Künstler schreiben, anzunehmen, daß es unter den Menschenras- sen innerlich und äußerlich vollkommener organisierte gebe, de- ren Haut, als die Oberfläche der vollkommenen Organisation, die schönste Farbenharmonie zeigt, über die unsere Begriffe nicht hinausgehen. Das Gefühl dieser Farbe des gesunden Fleisches, ein tätiges Anschauen derselben, wodurch der Künstler sich zum Hervorbringen von etwas Ähnlichem geschickt zu machen strebt, erfordert so mannigfaltige und zarte Operationen des Auges sowohl des Geistes und der Hand, ein frisches Naturgefühl und ein gereiftes Geistesvermögen, daß alles andere dagegen nur Scherz und Spielwerk, wenigstens alles andere in dieser höchsten Fähigkeit begriffen zu sein scheint«[1]. Bemerkenswert ist, daß Goethe in seinem Kommentar nie vom Inkarnat, wohl aber von der ›Farbe des gesunden Fleisches‹ spricht. Dazu paßt seine Annahme einer ›vollkommen organisierten Menschenrasse‹ - Goethe bemerkt, daß er zu Künstlern spricht -, über die unsere Begriffe nicht hinausgingen. Dieser Hinweis fehlt bei Hegel. Da er die Malerei als die erste der romantischen Künste vom außer- ästhetischen Ereignis der Fleischwerdung Gottes her versteht, ist ihm die Stufung der Menschen nach Rassen hier nicht erwähnens- wert[2].
Damit ist das zweite Verhältnis der Ausgangsanalogie ansatzwei- se erläutert: Es ist der Übergang von der klassischen Kunstform der griechischen Skulptur zur Erscheinung des Inkarnats, der Fleisch- farbe des Menschen in der Malerei, der die geforderte Verwandlung der Oberfläche der Gestalt zum Auge leistet. Hegel betont, daß die Fleischfarbe nicht als materielle Farbe, sondern als durchsichtige Tiefe - »wie das Blau des Himmels, das fürs Auge keine widerstand- leistende Fläche sein darf, sondern worein wir uns müssen vertiefen können« (TWA Bd. 15, S. 79) - in Betracht zu kommen hat[1].
Da der Hegelschen Konstruktion die Tendenz zu einer immer wei- tergehenden Entmaterialisierung und Subjektivierung der Kunstfor- men zugrundeliegt, der Malerei aber immer noch ein Äußerliches und Bestehenbleibendes wesentlich ist, erreicht die Kunst erst im klingenden Erzittern der Materie, dem Ton, ihr - vorläufiges - Ziel. Diesen Zug seiner Ästhetik deutet Hegel auch an unserer Stelle an, wenn er, noch innerhalb des Abschnittes zur Malerei und bezugneh- mend auf die eben erörterte Fleischfarbe verlangt, daß »dies Inner- liche, Subjektive der Lebendigkeit ... auf einer Fläche nicht als auf- getragen, nicht als materielle Farbe, ... sondern als selbst lebendiges Ganzes erscheinen« soll (ebd.). Diese Forderung nach einer imma- teriellen, lebendigen Fleischfarbe bleibt innerhalb der Malerei unein- lösbar.
Auch ein nochmaliger Blick auf die zum Ausgang genommene Analogie zeigt die Notwendigkeit des Fortgangs zur Musik. Die naheliegende Annahme, daß der Sinn der von der Gestalt und dem Auge sprechenden zweiten Relation in und mit der Darstellung von Skulptur und Malerei ausgeschöpft ist, erweist sich als unzutreffend. Nehmen wir nämlich ihren Bezug zur ersten Relation - und d. h. ihren Bezug zum Erscheinen des pulsierenden Herzens hinzu -, so wird deutlich, daß mit dem bloß statischen Durchscheinen des Blutes im Inkarnat die in der ersten Relation angezogene Bewegung des Pulsierens nicht eingelöst ist. Die Reichweite der ersten Relation übertrifft das in der zweiten Relation explizit Gesagte. Die Be- schränkung aber der zweiten Relation liegt in der Nennung des Auges - denn damit wird das in der ersten Relation genannte Pulsie- ren auf sein Erscheinen eingeschränkt. Indem wir das Pulsieren aber im Erzittern wiedererkennen, überschreiten wir das in der zweiten Relation angesprochene Erscheinen hin zum Erklingen[1].
3. Das schwingende Erzittern der Musik
Wie geschieht nun der Übertritt von der Malerei zur Musik? Ant- wort: Als Reduktion der Dimensionen auf den schwingenden, erzit- ternden Punkt. Hatte schon die Malerei gegenüber der Skulptur begonnen, die drei Raumdimensionen auf die Fläche zu reduzieren, so ist es nun die Musik - oder besser deren Element: der Ton, der die Räumlichkeit völlig verdichtet und in dieser Verdichtung aufhebt. Parallel zu dieser Reduktion des Materials auf den Punkt, sieht Hegel die in der Malerei noch in einem Außen dargestellte Subjektivität sich vollständig in sich zurücknehmen:
»Das Ideellsetzen des Sinnlichen durch die Musik ist ... darin zu suchen, daß sie das gleichgültige Auseinander des Raumes, dessen totalen Schein die Malerei noch bestehen läßt und absichtlich erheuchelt, nun gleichfalls aufhebt und in das individuelle Eins des Punktes idealisiert«[1].
Und:
»Die Musik drückt nur das Klingen und Verklingen der Empfin- dung aus und bildet den Mittelpunkt der subjektiven Kunst,« -
d. h. den Mittelpunkt zwischen Malerei und Poesie - »den Durch- gangspunkt der abstrakten Sinnlichkeit zur abstrakten Geistig- keit«[2].
Hegel sieht die Funktion der zwischen die Malerei und die Poesie gesetzten Musik in deren Vermittlung des bis zum »individuellen Eins des Punkts« idealisierten Materials mit der Sinnlichkeit des aufnehmenden Subjekts. Fragen wir nun, wie diese Vermittlung - die Vermittlung, wie es im zweiten Zitat heißt, der »abstrakten Sinnlich- keit zur abstrakten Geistigkeit« - beschrieben wird, so stoßen wir auf die Zeit. Denn die Zeit ist beides: sowohl die im Äußerlichen stattfindende Abstraktion des Äußeren als auch die im Innerlichen geschehende Abstraktion des Inneren. Ist sie dort als das Tilgen des Außereinander der Räumlichkeit gefaßt, so hier als die sich in sich zusammennehmende negative Einheit. Wird sie dort zum Thema, da die Musik als auf die Malerei folgende Kunstform deren Resträumlichkeit reduziert, so hier, da die Musik zum innerlich- geistigen Ausgangspunkt der Poesie erkoren ist.
Die Stellung der Musik innerhalb der Hegelschen Philosophie der Kunst stellt - topologisch formuliert - einen Knoten zweiter Ordnung dar. Sehen wir nun zu, wie Hegel diesen Knoten knüpft. Er geht aus von der Innerlichkeit:
»Die Innerlichkeit nämlich als subjektive Einheit ist die tätige Negation des gleichgültigen Nebeneinanderbestehens im Raum und damit negative Einheit.« (TWA Bd. 15, S. 156)
Von der negativen Einheit haben wir bereits im Zusammenhang der Darstellung des Organismus gesprochen. Was dort die Rücknahme der äußeren Glieder in die Einheit der Lebendigkeit ist, ist hier die ›tätige Negation des gleichgültigen Nebeneinanderbestehens‹ im Raum. Bezog sich dort die Bewegung der Aufhebung auf die Äu- ßerlichkeit der Glieder, so hier auf die Äußerlichkeit des Raums. - Hegel fährt fort:
»Die gleiche ideelle negative Tätigkeit ist in ihrem Bereiche der Äußerlichkeit die Zeit.« (ebd.)
Damit ist gesagt: Dieselbe Arbeit des tätigen Negierens von Äußer- lichkeit findet im Äußeren selber statt - und dies ist die Zeit. Soweit die Ausgangslage: Das abstrakte Äußerliche, die Zeit, steht neben oder gegenüber dem abstrakten Innerlichen, das ebenfalls wie die Zeit strukturiert ist. Was geschieht nun in dieser Situation? Was gibt Hegel die Möglichkeit, jenes abstrakte Objektive und dieses abstrak- te Subjektive aufeinander zu beziehen? Antwort: Es ist das materiel- le, am Objekt entstehende Erzittern, der Ton, der die subjektive Innerlichkeit ihrem einfachsten Dasein nach in Bewegung setzt und rhythmisiert:
»Da nun die Zeit ... das wesentliche Element abgibt, in welchem der Ton in Rücksicht auf seine musikalische Geltung Existenz gewinnt und die Zeit des Tons zugleich die des Subjekts ist« - zuvor wurde festgestellt, daß das »wirkliche Ich« der Zeit ange- hört - »so dringt der Ton schon dieser Grundlage nach in das Subjekt ein, faßt dasselbe seinem einfachsten Dasein nach und setzt das Ich durch die zeitliche Bewegung und deren Rhythmus in Bewegung«. (ebd., S. 157)
Und Hegel schließt seine Darstellung:
»Dies ist es, was sich als wesentlicher Grund für die elementarische Macht der Musik angeben läßt.« (ebd.)
Geht man dieser Erklärung zur elementarischen Macht der Musik nach, so erkennt man, daß es zuallererst zwei Punkte sind, die im wirkenden Ton zur Deckung kommen. Auf der Seite des Materials ist es der Übergang von der räumlichen Bestimmtheit des Kunst- werks, d. h. der Übergang von der Dreidimensionalität der Skulptur zur Zweidimensionalität der Malerei und zur Idealität der Materia- lität, dem Ton, der über die Negativität des Punktes durchgeführt wird. Unmittelbar an das oben Zitierte, das mit dem ›individuellen Eins des Punktes‹ endet, heißt es weiter:
»Als diese Negativität aber« - d. h. als die Bewegung der Auf- hebung des Außereinanders des Raums - »ist der Punkt in sich konkret und tätiges Aufheben innerhalb der Materialität, als Be- wegung und Erzittern des materiellen Körpers in sich selber in seinem Verhältnis zu sich selbst. Solche beginnende Idealität der Materie, die nicht mehr als räumlich, sondern als zeitliche Idealität erscheint, ist der Ton, das negativ gesetzte Sinnliche.«[1]
Halten wir fest: Der Ton wird von der sich selbst aufhebenden Materialität, vom zeitlich bestimmten Punkt her verstanden. Aberauch die Subjektivität ist ein Punkt. Das wird von Hegel anläßlich einer Darstellung der musikalischen Instrumente ausgesprochen. Gegenüber den ›flächenhaften‹ Instrumenten, wie Pauke und Glocke, werden dort die ›linearen‹ Instrumente favorisiert[1]. Warum? Dazu die Erklärung:
»Das Innerliche nämlich ist als Subjekt dieser geistige Punkt, der im Tönen als seiner Entäußerung sich vernimmt. Das nächste Sichaufheben und Entäußern des Punktes aber ist nicht die Flä- che, sondern die einfache lineare Richtung.« (TWA Bd. 15, S. 174)
Als Grund der größeren Tauglichkeit der Saiten- und Blasinstru- mente gilt ihre näher beim geistigen Punkt der Subjektivität liegende materielle Beschaffenheit: Sie sind mit ihren Luft- bzw. Materiesäu- len (Saiten) dem Punkt näher verwandt als die Flächen der Pauken und Glocken[2]. Der Hintergrund der beiden Erklärungen bildet jedesmal die Stufenreihe von Punkt-Linie-Fläche bzw. Fläche-Li- nie-Punkt: Während im Materiellen die Reihe von der Fläche zum erzitternden Punkt führt, geht im Geistigen der Punkt dazu über, sich in der erzitternden Linie selbst zu vernehmen[3]. Der Ton der Musik ist nun jenes Phänomen, da der Endpunkt jener Reihe mit dem Anfangspunkt dieser Reihe sich deckt, - oder vielleicht besser: der Ort, da der Endpunkt jener Reihe in den Anfangspunkt dieser Reihe ü berspringt.
Was also läßt sich im Inneren der Hegelschen Beschreibung des Übergangscharakters der Musik ausmachen? Worin konzentriert sich die Knüpfung jenes Knotens zweiter Ordnung, als den wir die kunstsystematische Stellung der Musik faßten? Worin, endlich, ter- miniert die Ausgangsanalogie, darin Hegel die Aufgabe der Kunst formuliert? Antwort: In einem springenden Punkt.
Dieser springende Punkt markiert zugleich ein Ende und einen Anfang. Einmal ist er als letzter: Punkt der räumlichen Dimensionen, sodann ist er als erster: Punkt der Geistigkeit.
Ähnlich zu dieser noch innerhalb der Musik sich findenden Ur- Sprungssituation zwischen einer sich im Punkt aufhebenden Mate- rialität und einer vom Punkt des Geistes ausgehenden Äußerung, wird der Übergang von der Musik zur Poesie gefaßt -, zur Poesie, die zu ihrem ›Material‹ nur noch die Idealität des Zeichens hat. Der »Ton, das letzte äußere Material der Poesie«, sagt Hegel, ist »ein für sich bedeutungsloses Zeichen «, er »kann demnach ebensogut auch bloßer Buchstabe sein, denn das Hörbare ist wie das Sichtbare zur bloßen Andeutung des Geistes herabgesunken« (TWA Bd. 13, S. 122f.). Und zum Übergang von der Musik zur Poesie heißt es:
»Der Ton wird dadurch zum Wort als in sich artikuliertem Laute, dessen Sinn es ist, Vorstellungen und Gedanken zu bezeichnen, indem der in sich negative Punkt, zu welchem die Musik sich fortbewegte, jetzt als der vollendet konkrete Punkt, als Punkt des Geistes, als das selbstbewußte Individuum hervortritt, das aus sich selbst heraus den unendlichen Raum der Vorstellung mit der Zeit des Tons verbindet.« (ebd.)
Festzuhalten ist zunächst: Der Hegelschen Darstellung ist in beiden angezogenen Fällen die Rede vom ›geistigen Punkt‹ oder dem ›Punkt des Geistes‹ wesentlich [1]. So wie es nur möglich ist, einen Zusammen- hang zwischen der größeren Adäquatheit bestimmter Instrumente und dem in der Musik geschehenden »abstrakten Sichselbstverneh- men«[2] über den Punkt zu konstruieren, so gestattet auch allein die Nennung des Geistes als eines Punktes den Übergang vom Ton der Musik zum Wort der Poesie.
Vergleichen wir nun die beiden Anwendungen des Ausdrucks auf das Geistige oder den Geist, fällt auf, daß die Bedeutung jedesmal eine andere ist: Während innerhalb der Musik die Nennung des
›geistigen Punkts‹ ihre Berechtigung aus dem Vegleich mit der ›li- nearen Richtung‹ bezieht und der Punkt entsprechend als abstrakter Punkt gedacht ist, meint der ›Punkt des Geistes‹, der ›aus sich selbst heraus den unendlichen Raum der Vorstellung mit der Zeit des Tons verbindet‹, den vollendet konkreten Ausgangspunkt der poetischen Äußerung. Parallel zu dieser Verwandlung des abstrakten, leeren Punkts der Subjektivität in der Musik zum vollendet konkreten Punkt des Individuums in der Poesie schlägt der Ton in das Wort um. Das Wort-Werden des Tons aber kann nur deshalb stattfinden, weil der Ton im Bereich der Poesie kunstsystematisch bereits als bedeutungsloses Zeichen gefaßt ist[1]. Nur weil der Ton von der Musik zur Poesie sich zum bedeutungslosen Zeichen gewandelt hat, kann er jenes Gefäß sein, darin der konkrete Punkt des Geistes sich ausdrückt, d. h. ›aus sich selbst heraus den unendlichen Raum der Vorstellung mit der Zeit des Tons verbindet‹.
»Die Poesie geht in der negativen Behandlung ihres sinnlichen Elementes so weit, daß sie ... den Ton ... zu einem bedeutungslosen Zeichen herabbringt. Dadurch löst sie aber die Verschmelzung der geistigen Innerlichkeit und des äußeren Daseins in einem Grade auf, welcher dem ursprünglichen Begriffe der Kunst nicht mehr zu entsprechen anfängt, so daß nun die Poesie Gefahr läuft, sich überhaupt aus der Region des Sinnlichen ganz in das Geistige hineinzuverlieren.« (TWA Bd. 15, S. 235)
Von einer ›Gefahr‹ für die Poesie ist an dieser Stelle nicht zufällig die Rede. Diese Gefahr ergibt sich aber weniger aus der Verfaßtheit der poetischen Ausdrucksweise selbst, als vielmehr daraus, daß Hegel die Basis und das Element des Poetischen im bedeutungslosen Zei- chen ansetzt. Denn indem er das Wort der Poesie aus dem Ton der Musik herkommen sieht, ist und bleibt das Medium des poetischen Ausdrucks ursprünglich und unverlierbar mit der Herkunft aus einer Abstraktion belastet.
Sehen wir uns diese, sich aus der Hegelschen Konstruktion erge- bende und damit supponierte ›Gefahr‹ für die Poesie genauer an. Wie erwähnt, läßt sich die Bedeutungslosigkeit des Zeichens der Poesie zunächst vor dem Hintergrund der Abstraktheit des Gesche-hens in der Musik, dem Tönen, verstehen. Das auf eine letzte Ab-straktheit reduzierte Tönen läßt Hegel über die sowohl im Materiel-len als auch im Geistigen analog auftretende abstrakte Negativität der Zeit geschehen. Wie wir weiter sahen, liegt die letzte Möglichkeit des ›Eindringens des Tons in das Subjekt‹ im zweiseitigen Auftreten der abstrakten Negativität als Punkt. In diesem Auftritt eines gedop-pelt-einheitlichen Punktes - des erzitternden Punktes des Materiel-len und des geistigen Punktes der Subjektivität als der der Ton im Klingen und Hören zu fassen ist -, liegt nach Hegel die Möglichkeit dafür, daß die Musik ihre Aufgabe als Durchgangspunkt von der Malerei zur Poesie erfüllt.
Von hier aus ist die Frage zu stellen: Worauf also weist das aus dem Ton der Musik herkommende bedeutungslose Zeichen der Poesie zurück? Oder anders: Worin liegt die von Hegel der Poesie zugeschriebene ›Gefahr‹, ›sich überhaupt aus der Region des Sinnli- chen ganz in das Geistige hineinzuverlieren‹? Antwort: Darin, daß sie, die Poesie, hinter die ihr in der Hegelschen Ästhetik zugedachte Herkunft kommt.
Sehen wir zu, worin gleichsam das erste Wort der hinter ihre Her- kunft gekommenen Poesie in der Hegelschen Ästhetik bestehen müßte. Zunächst ist klar, daß dies erste Wort die Affirmation der Zeichenhaftigkeit des Mediums der Poesie beinhalten müßte, und d. h. vor dem Eintritt aller Konkretheit von Vorstellungen, Phanta- sien etc. eines poetischen Individuums nur die völlige Bedeutungs- losigkeit zum Inhalt - also keinen Inhalt - haben dürfte. Das erste Wort dürfte nur sich selbst als bedeutungsloses Zeichen affirmieren. Weiter läßt sich sagen, daß ineins mit dieser Affirmation der völligen Bedeutungslosigkeit das erste Wort auf die Herkunft seiner Bedeu- tungslosigkeit, d. h. auf die im Tönen stattfindende Abstraktion verweisen müßte. Nur durch diesen Rückbezug auf die in der Musik tatsächlich stattfindende Abstraktion sicherte sich das erste Wort seine völlige Bedeutungslosigkeit, d. h. würde es nicht einfach nur nichts bedeuten, sondern würde dem Sein der Abstraktion oder der Bedeutungslosigkeit Ausdruck verleihen. Schließlich müßte das er- ste Wort, einerseits aufgrund seiner Herkunft aus dem Tönen der Musik, andererseits aufgrund seiner Zugehörigkeit zur immateriel- len Zeichenhaftigkeit des Mediums der Poesie, die Eigenschaft ha- ben, ausgesprochen, geäußert, unmittelbar wieder zu verschwinden.
Sammeln wir das Gefundene ein. Das erste Wort setzt sich aus drei Bestandstücken zusammen: Aus einem Rückverweis auf die Abstraktheit des Tönens in der Musik (den dortigen überspringen- den Punkt), einer Affirmation der Bedeutungslosigkeit des Zeichens in der Poesie und einer, aus beiden Sphären herrührenden Charak- teristik des unmittelbaren Verschwindens im Geäußertsein. Wohin aber führt uns die Zusammenfügung dieser drei Anforderungen an ein erstes Wort ? Auf den Anfangssatz der Hegelschen Logik. Dieser lautet: »Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe«. Dieser Satz - der die inkarnierte Gefahr für die Poesie ist - verschwindet, indem er geäußert wird (hebt sich ins Werden auf), affirmiert die Bedeutungslosigkeit des Zeichens (das reine Sein, völlig leer und bestimmungslos, ist gerade darin dem Nichts gleich) - und sagt den springenden Punkt.
V. Die Rede vom ›Punkt‹ Versuch einer Rekonstruktion des Systems
Die Rede vom Punkt, das hat sich im vorhergehenden Kapitel herausgestellt, ist der Hegelschen Konstruktion in dem Moment, da sie das Geschehen innerhalb der Kunstform der Musik und den Übergang vom Ton der Musik zum Wort der Poesie anzuzeigen hat, wesentlich. Die Rede vom Punkt kann als Ausdruck der Hegel- schen Intention verstanden werden, die Kunstformen und deren Übergänge für das »Denken faßbar zu machen«[1]. So weist uns der Gebrauch dieses Ausdrucks zurück in die dem Denken eigene Sphä- re, in die Philosophie.
In welcher Weise und in welchen Zusammenhängen gebraucht Hegel in seiner Philosophie den Ausdruck ›Punkt‹? Zu erwarten ist
- entsprechend den Hinweisen, die die Ästhetik gibt -, daß der Punkt in zwei voneinander unterscheidbaren Hauptbedeutungen auftritt: erstens in einer auf das Materielle, und zweitens in einer auf das Geistige bezogenen Bedeutung.
Ich gebe zunächst einen Bericht über die Bedeutungsbewegung des Ausdrucks ›Punkt‹ in der zur Enzyklopädie gehörigen Natur- philosophie. Danach ist auf den ›geistigen Punkt‹ einzugehen. Wie sich zeigen wird, weist uns die Spur, die wir in der Ästhetik aufge- nommen haben (der Ansatz eines Übergangs vom materiellen Punkt zum geistigen Punkt - und umgekehrt) schließlich in das Schluß- kapitel der Wissenschaft der Logik.
1. Über die auf das Materielle bezogene Bedeutung des Ausdrucks ›Punkt‹ in der zur ›Enzyklopädie‹ gehörigen Naturphilosophie
Vor dem Hintergrund unserer Fragestellung ordnet sich die in der Naturphilosophie [1] dargestellte Entwicklung folgendermaßen:
In die erste Phase, die von den Erörterungen über den Raum und die Zeit bis zum konkreten, gesetzten Punkt - dem Ort - reicht. In die zweite Phase, die die ihren Mittelpunkt suchende schwere Materie zum Gegenstand hat.
In die dritte Phase, in der die Materie sich selbst gegen ihren - sie selbst definierenden - Einheitspunkt entgegensetzt, und so zum Klingen kommt.
Schließlich in die letzte, den tierischen Organismus betreffende Phase, in der das Natürliche zur freien, selbstbestimmten Bewegung kommt und sich stimmlich verlauten läßt.
Besondere Aufmerksamkeit ist den Übergängen von der ersten zur zweiten und von der zweiten zur dritten Phase zu schenken. Sie werden von Hegel als Übergänge einerseits der Idealität zur Realität und andererseits des Sich-Setzens der Idealität in der Realität charakterisiert. Die zuletzt genannte Phase enthält sodann den Schlüssel, der diese Übergänge erst begreiflich macht.
Ich beginne meine Ausführungen mit einer Erläuterung zur er- sten, bis zur Bestimmung des Ortes reichenden Phase; erwähne dann die spezifische Verfaßtheit der in die Realität entlassenen Idealität in der zweiten Phase, und komme dann auf die beobachtbaren Über- gänge und ihren Zusammenhang mit der letzten Phase zu sprechen.
Hegel eröffnet die Erste Abteilung der Naturphilosophie mit Erörterungen über das »ganz abstrakte Außereinander, - Raum und Zeit « (TWA Bd. 9, S. 41). Gleich im ersten Paragraphen, dem § 254 zum Raum, kommt er auf den Punkt zu sprechen. Kritisiert wird die Rede von » Raumpunkten «, der auf den Raum beziehbare Punkt ist nicht ein »positive[s] Element« desselben, sondern die »in ihm ge- setzte Negation« (ebd., S. 42). Da der Raum als das gleichgültige, vermittlungslose Nebeneinander gilt, dies kontinuierliche Außer- und Nebeneinander aber »nur die Möglichkeit, nicht das Gesetzt- sein des Außereinanderseins« markiert, ist die Rede von ›Raum- punkten‹ »unstatthaft« (ebd.). Der Entfaltung der mit dem Raum gegebenen Möglichkeit widmet Hegel die ersten Paragraphen seiner Naturphilosophie. Die Realisierung dieser Möglichkeit liegt im Um- schlag der im Raum vorfindlichen »ganz bestimmungslosen drei Dimensionen « (ebd., S. 44) zur wechselseitigen Bestimmung eben dieser Dimensionen. Den ersten, alles folgende beherrschenden Un- terschied sieht Hegel im Punkt. Der Punkt ist das in die Bestim- mungslosigkeit des Raums eintretende erste Bestimmende des Raums.
»... der Unterschied [den der Raum an ihm hat] ist wesentlich bestimmter, qualitativer Unterschied. Als solcher ist er 1. zu- nächst die Negation des Raums selbst, weil dieser das unmittelba- re unterschiedslose Außersichsein ist, der Punkt. 2. Die Negation ist aber Negation des Raums, d.i. sie ist selbst räumlich; der Punkt als wesentlich diese Beziehung, d.i. als sich aufhebend, ist die Linie, das erste Anders-, d. i. Räumlichsein des Punktes; 3. die Wahrheit des Anderseins ist aber die Negation der Negation. Die Linie geht daher in die Fläche über, ... usw.« (ebd., S. 44f.)
Hegel führt die vom Punkt ihren Ausgang nehmende Selbstbestim- mung des Raums zur Linie und zur Fläche weiter. In der Fläche sieht er schließlich die »Wiederherstellung der räumlichen Totalität« er- reicht, die aber nun das »negative Moment an ihr hat« und so » umschließende Oberfläche « ist und als solche einen » einzelnen ganzen Raum absondert« (ebd., S. 45). Einen einzelnen ganzen Raum: Damit wird angezeigt, daß der Raum über seine vom Punkt ausgehende und zur Linie und Fläche fortgehende Selbstbestim- mung nun vollständig bestimmt ist und d. h. die Bewegung der Bestimmung des Raums von seinem Ende her dieselbe ist. Wird der Raum als positiver genommen, so kann die Fläche als die erste und die Linie als dessen zweite Negation verstanden werden; auch die so gedachte Bestimmung langt schließlich beim Punkt als der »sich auf sich beziehende[n] Negation« an. Die »Notwendigkeit des Über- gangs« vom Punkt zum ganzen Raum und vom ganzen Raum zum Punkt ist »dieselbe« (ebd.). Fragen wir nun danach, welches die eigene Bestimmtheit dessen ist, was die in sich rückläufige Selbstbe- stimmung des Raums provoziert, so erhalten wir die Antwort, daß dies die Zeit sei:
»Die Negativität, die sich als Punkt auf den Raum bezieht und in ihm ihre Bestimmungen als Linie und Fläche entwickelt, ist aber in der Sphäre des Außersichseins ebensowohl für sich... So für sich gesetzt, ist sie die Zeit.« (ebd., S. 46f.)
Die Zeit ist als die fürsichseiende Negativität dessen verstanden, was im Bereich des Raums dem Punkt zugesprochen wird. So ist sie die »negative Einheit des Außersichseins« (ebd., S. 48) als der sich setzende und wieder negierende Punkt. Entsprechend kann Hegel sagen, daß die Zeit das Sein sei, »das, indem es ist, nicht ist, und indem es nicht ist, ist « (ebd.). Für uns genügt es festzuhalten: Die Zeit wird als das in sich widersprüchliche, fürsichseiende Selbstbestimmen des Raums gefaßt.
Der nächste Paragraph nennt die Dimensionen der Zeit. Hegel läßt die Dimensionen der Zeit - die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft -, kaum genannt, sogleich wieder sich auflösen. Das hat seinen Grund darin, daß die zeitlichen Dimensionen, anders als jene des Raums, in der Natur, »wo die Zeit Jetzt ist, nicht zum bestehenden Unterschiede« (ebd., S. 52) kommen[1]. Sie werden des- halb nur im Vorübergehen angeführt und dienen nur zur Gewin- nung des Jetzt als des nun zeitlich bestimmten Punkts[2]. Von diesem zeitlich bestimmten Punkt aus gelangt Hegel schließlich zum Ort.
Da der in sich negative Punkt des Raums sich in der Zeit als fürsich- seiender, d. h. sich setzender und sich wieder aufhebender Punkt erweist und das Jetzt, zu dem er sich entwickelt, die Dimensionen der Zeit in sich zusammenfallen läßt, und - diese Bestimmung fehlte noch - die in der Natur ununterscheidbaren Dimensionen der Zeit aber der Raum sind[1], kommt es schließlich zum »konkrete[n] Punkt«
- und dieser konkrete Punkt ist der » Ort « (ebd., S. 55). Der Ort wird als die » gesetzte Identität des Raumes und der Zeit« (ebd., S. 56) gefaßt. Doch wesentlich ist: Gerade als diese Identität verweist der Ort gleichenteils auf den Raum und die Zeit zurück. Er ist nicht nur die gesetzte Identität von Raum und Zeit, sondern ebensosehr der »gesetzte Widerspruch, welcher der Raum und die Zeit, jedes an ihm selbst, ist« (ebd.). Der Punkt des Raums und der Punkt der Zeit kommen in einem » räumlichen Jetzt « als dem konkreten Punkt ihrer Identität zwar zusammen, doch ist mit ihm, da »die Zeit sich räum- lich als Ort, aber diese gleichgültige Räumlichkeit ebenso unmittel- bar zeitlich gesetzt wird«, schließlich die » Bewegung « gegeben (ebd.). Die Bewegung wird als der am Ort - dem räumlichen Jetzt - sich manifestierende, je für sich genommene Widerspruch des Raums und der Zeit gefaßt. »Dies Werden«, heißt es weiter, »ist aber selbst ebensosehr das in sich Zusammenfallen seines Widerspruchs, die unmittelbar identische daseiende Einheit beider, die Materie « (ebd.). Hegel nennt diesen Übergang von der Abstraktion des Ortes und der Bewegung zum konkreten Dasein der Materie einen »für den Verstand unbegreifliche[n]« »Übergang von der Idealität zur Realität«. (ebd.)
An dieser Stelle geschieht der Übergang von der ersten zur zwei- ten Phase in der Entwicklung der Naturphilosophie. Diese zweite Phase, die durch den Umschlag des räumlichen Jetzt - dem Ort - in die Bewegung eingeleitet wird, ist dadurch charakterisiert, daß der Punkt nun außerhalb des zu Beschreibenden zu liegen kommt. Sehen wir nämlich nach, welche Rolle der Punkt innerhalb der folgenden Abschnitte spielt, so finden wir ihn hier als den Mittelpunkt, und zwar als den außer die schwere Materie fallenden Mittelpunkt: »Das Materielle ist eben dies, seinen Mittelpunkt außer sich zu setzen« (ebd., S. 62). Der Übergang von der Idealität zur Realität gilt also nicht für den Punkt: Indem die Schwere »sozusagen das Bekenntnis der Nichtigkeit des Außersichseins der Materie in ihrem Fürsich- sein« ist, bleibt der Mittelpunkt, nach dem die schwere Materie strebt, das ideelle Zentrum, der »gesuchte Punkt« für sie (ebd., S. 63, ›Zusatz‹).
Doch begibt sich die Materie auf den Weg, den gesuchten Punkt ihrer Einheit zu finden. Charakteristisch der Ort, da sie ihn findet. Es ist der Ort selbst. Die Darstellung führt uns, indem sie die Schwere als ein »Suchen des Einheitspunktes« (ebd., S. 156) und gleichzeitig als die aus der Idealität entlassene Materie faßt, mit dem schließlichen Fund des vorübergehend ›verlorenen‹ Punktes wieder an ihren Ausgang zurück.
Die Idealität, die gegenüber der Realität der schweren Materie den Punkt für sich im Ort zurückbehielt, realisiert sich schließlich in der Elastizität. »Es kommt hier [in der Elastizität] die Idealität zur Existenz, welche die materiellen Teile nur suchen «, d. h. es kommt in der Elastizität »der für sich seiende Einheitspunkt« zur Existenz (ebd., S. 168). Was aber ist die Elastizität? Und warum findet die Materie gerade in ihr den gesuchten Einheitspunkt? Antwort: In der Elastizität findet Hegel ein erstes Anzeichen der sichselbsterhalten- den Materialität. Die elastische Materie zeichnet sich dadurch aus, daß sie im Nachgeben gegen eine andere widerständige Materie zugleich ihre Eigentümlichkeit zu bewahren imstande ist. Die elasti- sche Bewegung kann entsprechend als das Resultat des Stattfindens einer doppelten Negation beschrieben werden: So wie ein Körper auf einen anderen Gewalt ausübt, so schwingt dieser als elastischer zurück und negiert so die fremde Einwirkung wieder[1]. Indem Hegel es nun unternimmt, diesen Punkt des Aneinanderstoßens zweier Körper als die in der Materie existierende Idealität zu denken, stößt er wieder auf den Ort:
»Der Ort des Materiellen ist sein gleichgültiges bestimmtes Beste- hen; die Idealität dieses Bestehens ist somit die als reelle Einheit gesetzte Kontinuität, d.i. daß zwei vorher außereinander beste- hende materielle Teile, die also als in verschiedenen Orten befind- lich vorzustellen sind, jetzt in einem und demselben Orte sich befinden. Es ist dies der Widerspruch, und er existiert hier mate- riell.« (ebd.)
Erinnern wir uns. Bereits das aus dem Ineinanderübergehen von Raum und Zeit sich ergebende räumliche Jetzt - der Ort - war wesentlich durch eine in ihm liegende Widersprüchlichkeit ausge- zeichnet. Indem nun hier, im Paragraphen zur Elastizität, die Mate- rie als der eine Ort des Zusammenstoßens zweier Körper zu denken ist, gilt jene in den Ort gelegte Widersprüchlichkeit schließlich für sie, die Materie selbst. Deshalb wird gesagt, daß mit der Elastizität die ›Idealität zur Existenz‹ kommt. Sehen wir nun nach, worin das Resultat der zur Existenz kommenden Idealität zu sehen - besser: zu hören - ist, so stoßen wir auf den Klang:
»Die Idealität, die hierin [d. h. in der Widersprüchlichkeit der an einem Ort zweifach seienden Materie] gesetzt ist, ist eine Verän- derung, die ein doppeltes Negieren ist ... sie ist eine Idealität als Wechsel der einander aufhebenden Bestimmungen, das innere Erzittern des Körpers in ihm selbst, - der Klang.« (ebd., S. 170f.)[1]
Fassen wir kurz den naturphilosophischen Entwicklungsgang bis zum Erklingen der Materie zusammen. Begonnen wird mit dem Raum. Zugleich mit ihm ist der Punkt als seine in ihm befindliche Negation gegeben. Die Entwicklung der Dimensionen des Raums geht auf den sich negativ auf den Raum beziehenden Punkt zurück. Für sich gesetzt ist dieser in sich negative Punkt die Zeit. Ebenso ist er das Jetzt. Das Jetzt aber ist als auf die untergegangenen Dimen- sionen der Zeit bezogen zu denken. Als seiendes, d. h. als räumliches, ist das Jetzt sodann der Ort. Im Ort ist der Punkt des Raums als Zeit gesetzt und der Punkt der Zeit, das Jetzt, als Raum. Von hier aus, d. h. vom Ort als dem gesetzten Widerspruch her, ergibt sich schließ- lich die Bewegung; die Bewegung aber weist auf die in sich zusam- menfallende Einheit von Raum und Zeit und d. h. auf die Materie vor. Der Übergang von der in der Bewegung sich manifestierenden widersprüchlichen Einheit des Ortes in die Materie ist ein Übergang von der Idealität zur Realität. Entsprechend sucht die schwere Ma- terie ihren Mittelpunkt nun außer sich. Sie findet ihn erst in der Elastizität. Mit der Elastizität kommt es zur im Materiellen existie- renden Idealität. Diese Idealität ist hörbar im Klang des Körpers.
Die beschriebene Bewegung kann als eine Form der Grundbewegung des Hegelschen Denkens überhaupt angesehen werden: Ein Ideelles, sich in sich selbst näher Bestimmendes, geht in die Realität über, bestimmt sich dort weiter und kehrt schließlich, auf einer höheren Stufe, zur Idealität zurück.
Bei dieser Idealität ist nun anzuknüpfen. Die Frage ist: Worin lassen sich die anfängliche und die schließlich erreichte Idealität vergleichen? Oder konkret: Worin kommt die Selbstbestimmung des Raums, die sich in der Zeit ein Fürsichsein gibt und über den Ort in die Realität und von der Realität wieder über den Ort in die Idealität übergeht, mit dem Hervortreten des Klangs aus der Mate- rialität überein? Die Antwort auf diese Fragen finden wir im § 351 der Naturphilosophie. Dort werden dem höchst entwickelten Orga- nismus, dem Tier, unter anderem folgende Wesensmerkmale zuge- sprochen:
»Das Tier hat zufällige Selbstbewegung, ... die ... sich nach inne- rem Zufall aus sich selbst zum Orte bestimmt. Damit verbunden ist, daß das Tier Stimme hat, indem seine Subjektivität als wirkli- che Idealität (Seele) die Herrschaft über die abstrakte Idealität von Zeit und Raum ist und seine Selbstbewegung als ein freies Erzit- tern in sich selbst darstellt« (TWA Bd. 9, S. 351).
Die Gestalt des Tiers kann als das Telos der Naturphilosophie Hegels angesehen werden: In ihr werden die zuvor in einer Abfolge zer- streuten Momente der Natur schließlich versammelt. Auf unsere Frage gibt die Charakterisierung dieses Sammlungspunkts folgende Antwort: Die vom in sich negativen Punkt ausgehende Selbstbestim- mung des Raums, die in der Zeit ein Fürsichsein erhält, über den Ort in die Realität übergeht und durch ihn wieder sich in den Klang - dem »inneren Erzittern des Körpers in ihm selbst« - aufhebt, termi- niert in der Stimme des Tiers. Wesentlich ist dabei das letzte Wort des Zitats: Hegel spricht davon, daß das Tier seine Selbstbewegung als ein freies Erzittern in sich selbst darstellt. Nehmen wir diesen Hinweis mit der weiteren Charakterisierung des Tiers als der »freien Zeit« (ebd.) zusammen, bedenkend, daß die Zeit als das Fürsichsein des in sich negativen, den Raum bestimmenden Punktes gefaßt ist, so können wir sagen, daß mit der Stimme des Tiers zugleich ein sich selbst darstellender, in sich negativer, fürsichseiender, d. h. freier Punkt in der Natur gegeben ist[1].
Ich spreche bewußt von einem Zugleich des Gegebenseins einer Stimme und der Selbstdarstellung eines in sich negativen, freien Punktes in der Natur: Denn gerade in dieser Implikation von Stimme und (negativem) Punkt liegt die Möglichkeit einer freien Explikation des am Ende der Wissenschaft der Logik Erreichten in die Natur.
2. Der ›Punkt‹ in seiner geistigen Bedeutung
In einer seiner letzten Rezensionen, die Hegel in Berlin in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik abdrucken ließ, findet sich eine Passage, die unsere Sache in aller Deutlichkeit ausspricht. Nach- dem er einen Satz aus dem von ihm rezensierten Buch zitiert hat - einen Satz, darin sich das Selbstverständnis ausspricht, daß ein auf einen Punkt reduziertes Ich ein unwürdiges und ohnmächtiges Ich sei[1] -, heißt es:
»Um auch eine Frage zu machen, deren Antwort sich von selbst verstehen soll [Hegel spielt auf das oben angeführte, im rezensier- ten Text sich findende Selbstverständnis an], so fragen wir: Liegt nicht die Bedeutung, Würde und Macht des Geistes gegen die ausgedehnte Welt gerade in der Einfachheit des Denkens, in der es Punkt, aber freilich kein räumlicher noch zeitlicher, ist?« (TWA Bd. 11, S. 81f.)
Halten wir fest: Für Hegel gibt es eine Gebrauchsweise des Aus- drucks ›Punkt‹, die diesen mit dem Geist assoziiert -, und zwar so assoziiert, daß mit dieser Verknüpfung auf die Einfachheit des Den- kens, auf die Würde und die Macht des Geistes gegenüber der ›ausgedehnten Welt‹ hingedeutet wird. Diese mit dem Punkt assozi- ierte geistige Bedeutung taucht in seinem Werk öfters auf. Es ließen sich eine Reihe von Stellen anführen, darin gerade die einfache Punktualität des Geistes die Mächtigkeit eben dieses Geistes anzeigt. Ein besonders sprechendes Beispiel hierzu entnehme ich dem ersten der Jenaer Systementwürfe[2]. Die Anführung gerade dieses Beispiels erfüllt außerdem noch einen weiterreichenden Zweck: An ihm wird zugleich deutlich, daß dem nur als Punkt verstandenen Geist ein wesentlicher Mangel anhaftet.
Im Fragment Nr. 20 des ersten Jenaer Systementwurfs spricht Hegel vom »absolut einfache[n] Punkt des Bewußtseins«, dem »Ab- solutsein des Individuums als eines solchen« und nennt dies: »die Freiheit seines Eigensinns« (GW Bd. 6, S. 296). Er findet in dem sich auf seinen Eigensinn konzentrierenden Subjekt den Punkt zwar als das »Formale der Vernünftigkeit«, doch ist das daraus sich ergeben- de »Absolutsein schlechthin nur negativ« (ebd., S. 295). Der Punkt der Reflexion, indem er sich nur auf sich selbst bezieht, setzt auch immer wieder nur sich selbst und ist damit »die absolute Leerheit des Unendlichen«, oder: »reine Beziehung« (ebd.)[1]. Die zitierte Charakterisierung des geistigen Punktes kennt zwei Seiten: Die mangelhafte, daß das punktualisierte Subjekt nur sich selbst setzt, und die notwendige und wichtige, daß mit der auf den Punkt redu- zierten Reflexion ein potentiell Unendliches gegeben ist. Fragen wir nun, worin jene mangelhafte Seite aufgehoben und diese eigentlich positive - aber als formale Leerheit noch negative - Seite sich erfüllt, so lautet die Antwort: In dem, was Hegel unter der Persönlichkeit oder der Person versteht.
Hegel hat wiederholt auch von der Persönlichkeit oder der Person als einem ideellen und in sich unendlichen Punkt gesprochen. So heißt es etwa in der Rezension über die Werke F. H. Jacobis (1817), daß die Freiheit sich »unmittelbar Persönlichkeit « sei und zwar in der Form eines »unendliche[n] Punkt[s] des An-und-für-sich-Be- stimmens «[1].
Doch ist an dieser Stelle höchste Vorsicht geboten: Obwohl in beiden Fällen, dem Fall des eigensinnigen Subjekts und dem Fall der Persönlichkeit, je von einem sich auf sich selbst beziehenden unend- lichen Punkt gesprochen wird, sind beide streng voneinander zu unterscheiden. Während das eigensinnige Subjekt sich nämlich auf das es umgebende Allgemeine nur negativ zu beziehen fähig ist, gehört es gerade wesentlich zum Hegelschen Verständnis dessen, was eine Person ist, daß in ihr das punktuelle Einzelne vom Allge- meinen durchdrungen sich darstellt[2].
3. Der Sprung des Punktes
Das letzte Kapitel der Wissenschaft der Logik setzt mit einem Rückblick ein. Der Rückblick nimmt dabei noch einmal auf die Themen der einzelnen Kapitel des letzten, Die Idee betitelten Ab- schnitts Bezug. Indem er dies tut, zeigt sich, daß die absolute Idee aus der Dialektik von theoretischer und praktischer Idee - der Idee des Erkennens und der Idee des Guten - und dem Rückgang auf die Idee in ihrer Unmittelbarkeit - dem Leben - sich ergibt. Hegel findet das Ziel und die höchste Konkretion der absoluten Idee schließlich in der Persönlichkeit. Wir lesen:
»Die absolute Idee, wie sie sich ergeben hat, ist die Identität der theoretischen und der praktischen, welche jede für sich noch einseitig, die Idee selbst nur als ein gesuchtes Jenseits und uner- reichtes Ziel in sich hat, - jede daher eine Synthese des Strebens ist, die Idee sowohl in sich hat als auch nicht hat, von einem zum anderen übergeht, aber beide Gedanken nicht zusammenbringt, sondern in deren Widerspruche stehenbleibt. Die absolute Idee als der vernünftige Begriff, der in seiner Realität nur mit sich selbst zusammengeht, ist um dieser Unmittelbarkeit seiner Objektivität willen einerseits die Rückkehr zum Leben; aber sie hat diese Form ihrer Unmittelbarkeit ebensosehr aufgehoben und den höchsten Gegensatz in sich. Der Begriff ist nicht nur Seele, sondern freier subjektiver Begriff, der für sich ist und daher die Persönlichkeit hat, - der praktische, an und für sich bestimmte, objektive Begriff, der als Person undurchdringliche, atome Subjektivität ist, der aber ebensosehr nicht ausschließende Einzelheit, sondern für sich All- gemeinheit und Erkennen ist und in seinem Anderen seine eigene Objektivität zum Gegenstande hat. Alles Übrige ist Irrtum, Trüb- heit, Meinung, Streben, Willkür und Vergänglichkeit; die absolute Idee allein ist Sein, unvergängliches Leben, sich wissende Wahr- heit, und ist alle Wahrheit.
Sie ist der einzige Gegenstand und Inhalt der Philosophie. Indem sie alle Bestimmtheit in sich enthält und ihr Wesen dies ist, durch ihre Selbstbestimmung oder Besonderung zu sich zurückzukeh- ren, so hat sie verschiedene Gestaltungen, und das Geschäft der Philosophie ist, sie in diesen zu erkennen. Die Natur und der Geist sind überhaupt verschiedene Weisen, ihr Dasein darzustellen, Kunst und Religion ihre verschiedenen Weisen, sich zu erfassen und ein sich angemessenes Dasein zu geben; die Philosophie hat mit Kunst und Religion denselben Inhalt und denselben Zweck; aber sie ist die höchste Weise, die absolute Idee zu erfassen, weil ihre Weise, die höchste, der Begriff ist. Sie faßt daher jene Gestal- tungen der reellen und ideellen Endlichkeit sowie der Unendlich- keit und Heiligkeit in sich und begreift sie und sich selbst. Die Ableitung und Erkenntnis dieser besonderen Weisen ist nun das fernere Geschäft der besonderen philosophischen Wissenschaf- ten. Das Logische der absoluten Idee kann auch eine Weise dersel- ben genannt werden; aber indem die Weise eine besondere Art, eine Bestimmtheit der Form bezeichnet, so ist das Logische dage- gen die allgemeine Weise, in der alle besonderen aufgehoben und eingehüllt sind. Die logische Idee ist sie selbst in ihrem reinen Wesen, wie sie in einfacher Identität in ihren Begriff eingeschlos- sen und in das Scheinen in einer Formbestimmtheit noch nicht eingetreten ist. Die Logik stellt daher die Selbstbewegung der absoluten Idee nur als das ursprüngliche Wort dar, das eine Äuße- rung ist, aber eine solche, die als Äußeres unmittelbar wieder verschwunden ist, indem sie ist; die Idee ist also nur in dieser Selbstbestimmung, sich zu vernehmen, sie ist in dem reinen Ge- danken, worin der Unterschied noch kein Anderssein, sondern sich vollkommen durchsichtig ist und bleibt.« (TWA Bd. 6, S. 548ff.)
Mit der zitierten Passage kommt die gesamte Wissenschaft der Logik auf einen Höhepunkt. In ihr wird das für das Hegelsche System grundlegende Verhältnis der Philosophie bzw. der Logik zu den anderen Systemteilen an- und ausgesprochen. Für uns ist im Moment nur von Interesse, daß der Text, der zunächst von der Nennung der Persönlichkeit ausgeht, schließlich in einer Selbstcha- rakterisierung des Logischen sein Ziel hat. Darin erscheint das Lo- gische als die »Selbstbestimmung« der absoluten Idee -, als eine Selbstbestimmung, die als das Sichselbstvernehmen eines »ur- sprünglichen Wortes« gefaßt wird und von dem er sagt, daß es zwar eine Äußerung, - aber als »Äußeres unmittelbar wieder verschwun- den« sei. Bemerkenswert ist weiter, daß der Ort dieses Geschehens im Inneren des Begriffs angesetzt wird. Gegenüber der Kunst und der Religion, die mit der Philosophie ebenfalls zum Reich des abso- luten Geistes zu zählen seien und mit ihr »denselben Inhalt und denselben Zweck« hätten, bleibe die Idee in der Form des rein Logischen im Inneren des Begriffs »eingeschlossen«.
Bezieht man nun die im Inneren des Begriffs sich zutragende Selbst-Bestimmung der absoluten Idee auf die zuvor genannte Per- sönlichkeit, und denkt man sich die Selbst-Bestimmung als eine Bereicherung, die ebensosehr, als Bereicherung einer Persönlichkeit, eine Vertiefung derselben darstellt, so läßt sich über die Bewegung des Erreichens der so verstandenen absoluten Idee sagen:
»Jede neue Stufe des Außersichgehens, d. h. der weiteren Bestim- mung, ist auch ein Insichgehen, und die größere Ausdehnung [ist] ebensosehr höhere Intensität. Das Reichste ist daher das Konkre- teste und Subjektivste, und das sich in die einfachste Tiefe Zurück- nehmende das Mächtigste und Übergreifendste. Die höchste, zugeschärfteste Spitze ist die reine Persönlichkeit, die allein durch die absolute Dialektik, die ihre Natur ist, ebensosehr alles in sich befaßt und hält, weil sie sich zum Freiesten macht, - zur Einfach- heit, welche die erste Unmittelbarkeit und Allgemeinheit ist.« (ebd., S. 570)
Im zweiten Teil des Zitats bringt Hegel - ungesagt - den Punkt ins Spiel. Die angezogene »reine Persönlichkeit«, die die »höchste, zu- geschärfteste Spitze« darstellen soll und sich zum »Freiesten« - d. h. zur »Einfachheit« zu machen hat, wird ein paar Seiten vorher als der » einfache Punkt der negativen Beziehung auf sich« vorgestellt (ebd., S. 563). Auch hier ist von der Person als dem Freien schlechthin die Rede. Zugleich wird bedeutet, daß mit der Ankunft bei diesem » innersten, objektivsten Moment des Lebens und Geistes« der » Wendungspunkt der Bewegung des Begriffs« erreicht sei. Im Er- kennen, daß die Bedeutung des Ganges der Logik in nichts anderem besteht als der zur Persönlichkeit sich entwickelnden Selbst-Bestim- mung der absoluten Idee in der Form des Begriffs, tritt, in und durch ebendieses Erkennen, ein Wendungspunkt in der Bewegung des Begriffs ein. Den bestimmten Inhalt hinter sich lassend, ist mit diesem Wendungspunkt der Ort erreicht, da die Form, die die abso- lute Idee im Medium des rein Logischen hat, sich auf sich selbst bezieht. Diese Selbstaffektion des Formellen führt die beiden Seiten mit sich, einerseits ›einfacher Punkt der negativen Beziehung auf sich‹ zu sein und andererseits auf die reichste Totalität - den ganzen Gang der Logik - zurückzublicken. So kann Hegel schließlich - von der Wissenschaft der Logik als einem »in sich geschlungen[en] Kreis« (ebd., S. 571) sprechend - sagen, daß diese Wissenschaft ihr »Vor hat « ihr »Nach« aber » zeigt « (ebd.). Ihr ›Vor hat‹ meint, daß sie die Selbst-Bestimmung der absoluten Idee in der Form des reinen Begriffs zur Persönlichkeit, d. h. zum Wendungspunkt bringt; ihr ›Nach zeigt‹ meint, daß sie, gerade indem sie auf ihre Selbst-Bestim- mung zurückblickt und damit den ›einfachen Punkt der negativen Beziehung auf sich‹ erreicht, zum Einfachen wird. Dieses Einfache aber soll eine ›erste Unmittelbarkeit‹ sein und als solche sich wieder auf den Anfang beziehen[1]. In seinem Bezug auf den Anfang ›zeigt‹ dies Einfache sein ›Nach‹. Wie das?
Die Logik endet in ihrem letzten Kapitel zur absoluten Idee mit einem Rückblick auf den von ihr durchlaufenen Gang. Dieser Gang, der die Bestimmung der absoluten Idee in der reinen, insichbleiben- den Form des Gedankens, d. h. des Begriffs, auseinanderlegt, er- scheint von seinem Ende her als die Selbst-Bestimmung der reinen und einfachen, alle Bestimmungen in sich befassenden und sich auf sich selbst beziehenden Persönlichkeit. Als solche sich auf den Gang der Logik als ihrer Selbst-Bestimmung beziehende Persönlichkeit wird sie als das ›Freieste‹ oder die ›Einfachheit‹ gefaßt, ›welche die erste Unmittelbarkeit ist‹. So muß der selbst abstrakte Anfang der Logik von ihrem Ende her als Anfang gefaßt werden, der die Totalität aller folgenden Bestimmungen bereits in sich enthält -, denn diese Bestimmungen entpuppen sich schließlich als die Bestim- mungen der sich selbst bestimmenden reinen Persönlichkeit. Den Anfang der Logik machen die beiden Bestimmungslosen und Un- mittelbaren: das reine Sein und das reine Nichts. Der erste Satz der Logik lautet: ›Das reine Sein und das reine Nichts ist dasselbe.‹ Dieser Anfang ist nun als Anfang der sich selbst bestimmenden reinen Persönlichkeit zu lesen. Hegel charakterisiert das »innerste, objektivste Moment des Lebens und Geistes, wodurch ein Subjekt, Person, Freies ist«, die »dialektische Seele«, im Schlußkapitel der Logik als den »einfachen Punkt der negativen Beziehung auf sich«. Die freie Persönlichkeit, sich auf den Anfang der Logik als auf ihren Anfang beziehend, wird also versuchen, jene Unmittelbaren: Sein und Nichts, mit sich als dem »einfachen Punkt der negativen Bezie- hung auf sich« zu verknüpfen. Im Rückblick von ihrem Ende her bezeichnet das erste Ausgesagte der Logik nichts anderes als die freie, sich auf sich selbst beziehende reine Persönlichkeit in ihrer Einfachheit selbst. Weiter: Die Logik, hat Hegel formuliert, stellt die absolute Idee nur als das »ursprüngliche Wort dar, das eine Äußerung ist, aber eine solche, die als Äußeres unmittelbar wieder verschwunden ist, indem sie ist« (s. o., Zitat). Indem die absolute Idee sich als reine Persönlichkeit bestimmt, realisiert sich die Logik als die Darstellung des ursprünglichen Wortes. Der Anfang, indem er nichts anderes mehr darstellt als die unmittelbar wieder ver- schwindende Äußerung des ursprünglichen Wortes ist mit der Stim- me der sichselbstbestimmenden Persönlichkeit zusammengegangen. Der das ursprüngliche Wort darstellende Satz des Anfangs ist nun das ursprünglich ausgesprochene und wieder verschwindende Wort selbst. Der Anfangssatz der Wissenschaft der Logik ist damit geworden, was er schon immer war: Ein Gesetztes, das in seinem Gesetztsein sich selbst aufhebt. Doch, noch mehr: Indem der An- fangssatz seine Realisierung im verlautenden Wort erhält, das ur- sprünglich verlautende Wort aber - über die Persönlichkeit - auf den einfachen Punkt der negativen Beziehung auf sich verweist, setzt er zugleich dasjenige wieder frei, wovon er der satzhafte Ausdruck ist: den springenden Punkt.
Hegel hat das Erklingen des Tons in der Musik als das Übersprin- gen eines Punktes aus dem Materiellen in das Geistige beschrieben. Indem es nun am Ende der Logik zur absoluten Idee als der sich- selbstbestimmenden, sichselbsterfassenden und sich auf den Anfang der Logik als ihren eigenen Anfang sich beziehenden reinen Persön- lichkeit kommt, dieser Anfang von uns aber als der satzhafte Aus- druck eines springenden Punktes ausgelegt wird, ist zu erwarten, daß es am Ende des Werkes zu einem Übersprung des Punktes aus dem Geistigen in das Materielle kommt. Dieser Übersprung, der sich in unserer Deutung durch die Vokalisation des den springenden Punkt sagenden Anfangssatzes der Logik ergibt, wird von Hegel als das bekannte, am Ende der Logik sich ereignende Entlassen der Natur aus dem Reiche des reinen Begriffes gefaßt. Weiter: Wie gesehen, läßt sich die Bewegung der Bedeutung des Ausdrucks ›Punkt‹ in der Naturphilosophie der Enzyklopädie als eine Bewegung fassen, die vom in sich negativen, raumbestimmenden Punkt zum ebenso in sich negativen, sich in der Stimme frei darstellenden und seinen frei eingenommenen Ort markierenden Punkt beschreiben. Die Natur ist die Idee in ihrem Außersichsein oder in ihrer Äußerlichkeit. Da der aus der Wissenschaft des reinen Begriffs übergesprungene Punkt in ihr schließlich zur freien Selbstdarstellung und Selbstmarkierung kommt, muß Hegel jenes Entlassen der Natur aus der Sphäre des reinen Begriffs als eine Befreiung fassen[1]. Es ist in der Vokalisation des Anfangs, daß diese Befreiung geschieht; da weiter diese Befrei- ung im Ausgang von einem bereits Freien geschieht - nämlich der Persönlichkeit - so scheinen sich schließlich, ursprünglich ausgelöst durch die Bewegung der Selbstbestimmung des reinen Begriffs und dessen Zusammennahme in die reine Persönlichkeit, zwei Freie gegenüberzustehen. Doch trügt der Schein. Das aus dem reinen Begriff Entlassene, die Natur, bringt es nicht dazu, der reinen Per- sönlichkeit auf der gleichen Stufe gegenüberzustehen: Die sich in der Natur manifestierende Stimme ist die - obzwar ihren Ort frei mar- kierende - Stimme eines Tiers und nicht einer Person. Das Tier, das lediglich über eine natürliche, bereits durch seine Herkunft aus einer Gattung gegebene Allgemeinheit verfügt, muß deshalb sterben. Da aber jedes Tier »im Tode eine Stimme hat«[2] - dies eine Grundüber- zeugung Hegels - scheint der Konstruktion das unmöglich Scheinende zu gelingen, nämlich: Auch an das Ende der Naturphilosophie ein Moment zu setzen, das den Übergang von der Natur zum Geist (die Philosophie des Geistes ist der auf die Naturphilosophie folgende dritte Kreis des Enzyklopädie-Systems) an die bereits innerhalb der Logik gegebene systemkonstitutive Assoziation von Anfang bzw. Ende und Vokalisation[1] zurückbindet.
Die gegebene Deutung der Übergänge des reifen enzyklopädischen Systems erscheint zunächst als allzu gewagt. Dazu ist zu sagen: Die gegebene Deutung erscheint nicht nur als gewagt, sie ist gewagt. Nun läßt sich aber zeigen, daß die so gedeutete späteste Systemkonstitu- tion nur den auf der Basis der rein logischen Sphäre stattfindenden Schlu ß aus früheren Versuchen Hegels darstellt, die Sphäre der Natur mit der Sphäre des Geistes zu verknüpfen. Es lassen sich auf diesem Weg insgesamt vier notwendig zu durchlaufende Stadien unterscheiden[1].
Erstes Stadium. Der früheste Hinweis auf das sich entwickelnde System findet sich in der ersten größeren Veröffentlichung Hegels, der Schrift über die Differenz des Fichte’schen und Schel- ling’schen Systems der Philosophie (1801)[1]. Im Zuge einer Dar- stellung der Philosophie Schellings kommt es dort zu Formulierun- gen, die weit in die eigene spätere Philosophie Hegels vorausver- weisen. Der Hintergrund der uns interessierenden Textpassage bil- det die - von Schelling durch seinen Neuansatz in der Naturphilo- sophie aufgeworfene - Frage nach dem Verhältnis der beiden Wis- senschaften der Intelligenz und der Natur. Beide Wissenschaften sind »Wissenschaften des Absoluten« - und, da das Absolute kein »Nebeneinander« duldet (TWA Bd. 2, S. 102), konzentriert sich seine Darstellung schließlich in dem Versuch, das Verhältnis der beiden Wissenschaften der Intelligenz und der Natur vor dem Hin- tergrund der Selbstidentität und der Selbstentzweiung des Absolu- ten zu beschreiben:
»Keine der beiden Wissenschaften kann sich also als die einzige konstituieren, keine die andere aufheben. Das Absolute würde hierdurch nur in einer Form seiner Existenz gesetzt, und so wie es in der Form der Existenz sich setzt, muß es sich in einer Zweiheit der Form setzen; denn Erscheinen und Sich-Entzweien sind eins.« (ebd., S. 106)
Soweit die Ausgangslage. Uns interessiert an dieser Stelle nicht, wie Hegel dazu kommt, die beiden Wissenschaften vom Absoluten aus fassen zu wollen, woher er diese Auffassung gewonnen hat usw., unsere einzige Aufmerksamkeit gilt seiner Beschreibung des Er- scheinens des Absoluten, das zugleich ein Sich-Entzweien ist. Nach- dem er weiter festgestellt hat, daß das Absolute in der einen Wissen- schaft (derjenigen der Intelligenz) ein »Subjektives in der Form des Erkennens« und in der anderen (derjenigen der Natur) ein »Objek- tives in der Form des Seins« ist (ebd., S. 110), beide Wissenschaften aber als nur relative Totalitäten nach dem »Indifferenzpunkt«, d. h. nach dem unentzweiten, über ihnen schwebenden[1] Absoluten streben, heißt es:
»Der Indifferenzpunkt, nach welchem die beiden Wissenschaften, insofern sie, von seiten ihrer ideellen Faktoren betrachtet, entge- gengesetzt sind, streben, ist das Ganze, als eine Selbstkonstruk- tion des Absoluten vorgestellt, das Letzte und Höchste derselben. Das Mittlere, der Punkt des Übergangs von der sich als Natur konstruierenden Identität zu ihrer Konstruktion als Intelligenz, ist das Innerlichwerden des Lichts der Natur, - der, wie Schelling sagt, einschlagende Blitz des Ideellen in das Reelle und sein Sich-selbst-Konstituieren als Punkt[2]. Dieser Punkt, als Vernunft der Wendepunkt beider Wissenschaften ist die höchste Spitze der Pyramide der Natur, ihr letztes Produkt, bei dem sie, sich vollendend, ankommt; aber als Punkt muß er sich gleichfalls in eine Natur expandieren.« (ebd., S. 111)
Unterscheiden wir zunächst die beiden Grundbedeutungen des Ausdrucks ›Punkt‹ in diesem Zitat. Der Punkt kommt einmal als Vernunft oder als Wendepunkt in Betracht; als solcher nähert er sich dem gesuchten, über beiden Wissenschaften schwebenden Indiffe- renzpunkt. Zum zweiten aber kommt der Punkt auch als Punkt zum Zuge, d. h. Hegel nimmt in und mit ihm auch die Möglichkeit wahr, ihn im räumlichen Sinne zu verstehen: Als solcher gibt er den Ausgangspunkt für eine Expansion in eine Natur ab. Sieht man nun genauer hin, womit Hegel es unternimmt, den Punkt in seiner geistigen Bedeutung als Wendepunkt der beiden Wissenschaften mit dem auf den Raum bezogenen Punkt der Natur in Beziehung zu bringen, so stößt man auf die Wendungen vom ›Innerlichwerden des Lichts der Natur‹, der Schelling’schen Wendung vom ›einschlagen- den Blitz des Ideellen in das Reelle‹ und der Rede von der ›Pyramide der Natur‹. Alle diese Wendungen erheben im Text den Anspruch, die geistige und die auf das Natürliche bezogene Bedeutung des Ausdrucks ›Punkt‹ ineinander zu vermitteln. Oder anders formu- liert: Der aus ihnen sich ergebende Sinn soll den Umschlag - gleich- sam den ›Transport‹ - zwischen dem Punkt in seiner geistigen und dem Punkt in seiner sinnlichen Bedeutung leisten[1].
Doch: Erfüllen die genannten Wendungen ihre Aufgabe? Kann es Hegel genügen, in reichlich undurchsichtiger Weise den Übersprung und damit die innere Mitte der beiden Wissenschaften der Natur und der Intelligenz durch im weitesten Sinne ›poetische‹ Wendungen bloß zu evozieren ?
Man bedenke: Gerade im gelingenden Aufweis dieses Übergangs läge erst die Legitimation dessen, was auf ihn folgt; unmittelbar auf die zitierte Passage aber läßt Hegel die »Wissenschaft« in ihn - d. h. den Punkt des Übergangs - sich als ihren »Mittelpunkt« stellen, um sogleich von ihm aus die beiden Seiten der Natur und der Intelligenz zu rekonstruieren. Doch genügt es augenscheinlich nicht, lediglich durch eine kunstvolle Handhabung des Ausdrucks ›Punkt‹ eine Mitte zu konstruieren, von der aus dann den beiden Seiten ihre Plätze ›angewiesen‹ (so Hegel selbst; ebd., S. 112) werden können. An diesem Gelingen hängt aber die ganze folgende Ausführung. Und: Das folgende findet seinen Abschluß schließlich darin, daß, analog zur späteren Reihung in der Wissenschaft der Logik, die Sphären der Kunst, der Religion und der Spekulation um das Abso- lute - hier noch nicht als ›absolute Idee‹, sondern als »absolute[s] Leben« gefaßt - gruppiert werden (ebd., S. 113).
Zweites Stadium. Eine anders geartete, aber ebenso wichtige Deu- tung das Absoluten finden wir in den auf die Differenzschrift folgenden sogenannten Jenaer Systementwürfen. Hier ist das Absolute oder der »lebendige Gott« als »Äther« gefaßt (GW Bd. 7, S. 188). Das, was in der Differenzschrift mit der »ewigen Mensch- werdung« Gottes assoziert wird, nämlich das »Zeugen des Worts vom Anfang«, wird hier mit dem Äther verknüpft. Hegel spricht hier - ich zitiere aus dem als zweiten gezählten Entwurf - von einem »Sprechen des Äthers mit sich selbst« (ebd., S. 190) und von einer aus dem Inneren des Äthers »absolut hervorbrechenden Stimme« (ebd.). Der angesetzte Selbstbezug des Absoluten wird nicht als Bezug auf dessen Menschwerdung und damit christlich verstanden, sondern in das Sichselbstvernehmen des Äthers gesetzt. Im Zuge der Beschreibung dieses Sichselbstvernehmens macht Hegel in eminen- ter Weise vom Wort ›Stimme‹ Gebrauch. Neben der bereits zitierten »aus dem Inneren absolut hervorbrechenden Stimme« wird von einer »zuruffende[n] Stimme« (ebd., S. 189), von einem »Empfangen der Stimme« (ebd., S. 190), gar von einer »Articulation der Töne der Unendlichkeit« (ebd., S. 191) gesprochen. Wesentlich dabei ist, daß das Geschehen dieser Selbstmitteilung des Äthers als ein insichblei- bendes Geschehen gefaßt wird. So heißt es von der im Äther ver- orteten ›zuruffenden Stimme‹ ausdrücklich, daß diese nicht als eine »hinausgehende Bewegung«, sondern ihr Aussprechen als »stumm[es] und verschlossen[es]« (ebd., S. 189) zu verstehen sei. Und doch gehört dem sichselbstgleichen Äther ebenso ein Anders- sein zu. Dieses Anderssein wird von Hegel mit der im »Sprechen des Äthers mit sich selbst« sich realisierenden Stimme verknüpft. So heißt es:
»Das sichselbstgleiche ist nicht bloß sichselbstgleich, es ist ebenso absolut unendlich, es spricht sich aus; dieses Aussprechen ist sein Andersseyn, oder seine Unendlichkeit; was es ausspricht, ist es selbst, was spricht, ist es selbst, und wohin es spricht, ist wieder es selbst; denn indem es sich ausspricht, oder nach seiner Unend- lichkeit ist es als einfaches sich auf sich selbstbeziehendes das Andre, und diese Einfachheit, der Äther ist die Lufft, die das Sprechen aufnimmt und vernimmt, die weiche Materie, welche die entgegengesetzte Gährung der Unendlichkeit in sich emp- fängt, und ihr Wesen gibt, oder ihr Bestehen ist, ein einfaches Bestehen, das ebenso das einfache Nichts ist. - Dieses Sprechen des Äthers mit sich selbst ist seine Realität, nemlich daß er sich ebenso unendlich, als er sich selbstgleich ist.« (ebd., S. 190)
Für uns ist an diesen - von Hegel selbst nie veröffentlichten - Aufzeichnungen zweierlei wesentlich: erstens, die Verknüpfung des Absoluten mit der Vorstellung einer bei- und insichbleibenden Stimme[1] ; zweitens, der Realitätsbezug - jenes Anderssein des Äthers -, der mit dieser Vorstellung verknüpft ist.
Drittes Stadium. Im letzten der drei Jenaer Entwürfe, der noch mit der Nennung des Äthers als dem »reinen« und »bestimmungs- losen seeligen Geist« einsetzt (GW Bd. 8, S. 3), stößt Hegel auf das Phänomen des springenden Punkts. Am Ende seiner Naturphiloso- phie, auf der resumierenden Spitze derselben, findet er im Blut - der im Inneren des Organismus kreisenden Substanz des Lebens - die Möglichkeit einer Lösung des Punktproblems. Indem er entdeckt, daß der Punkt als springender Punkt in der Natur real sich zeigt, und ineins damit der Kreislauf des Bluts sich als sichselbstbewegendes System, das Blut selbst aber als no}V sich auslegen läßt, muß er es in Angriff nehmen, jenen frühen Versuch aus der Differenzschrift zu reformulieren. Die Substanz, darin sich jener Übersprung als wirklich stattfindender aufweisen läßt, ist das Blut. Nun ist das Blut aber nicht nur in der Naturphilosophie eine Substanz, die Hegels Interesse auf sich zieht, - vielmehr weist es, gerade als Substanz des Lebens verstanden, in die Sphäre des Religiösen hinein (vgl. dazu die Kapitel I und II dieser Arbeit). Das Unternehmen der Phänomeno- logie des Geistes kann - freilich nur unzureichend und ohne daß der konkrete Inhalt sich darin erschöpfte - als die Bewegung ver- standen werden, auf der Seite des im geistigen Sinne genommenen Blutes zum springenden Punkt, und damit zu jenem bereits in der Differenzschrift anvisierten Mittelpunkt zu gelangen, von dem aus sich die Platzanweisung der Teile des Gesamtsystems vornehmen läßt.
Es ist bekannt, daß die Phänomenologie des Geistes, die ur- sprünglich den ersten Band des Systems der Wissenschaft ausmach- te, im Zuge der weiteren Ausarbeitung des Systems wegfiel bzw. in der enzyklopädischen Philosophie des Geistes schließlich eine unter geordnete Stellung einnehmen sollte. Dieses Wegfallen der Phäno- menologie läßt sich als Konsequenz eines weiteren Fundes Hegels deuten, - eines Fundes, der es ihm schließlich ermöglicht, die Logik, die Wissenschaft des reinen Begriffs, an den Ausgang und den Anfang der Kreise des endgültigen Systems zu stellen.
Viertes Stadium. Diese Möglichkeit kündigt sich bereits gegen das Ende der Phänomenologie des Geistes an. Es ist darauf zu achten, wie hier - insbesondere im letzten Abschnitt des Kapitels zur Kunst- religion, dem Abschnitt zum geistigen Kunstwerk (TWA Bd. 3, S. 529-544) - das Wort ›Person‹ zum Einsatz kommt. Ebenso ist hinzuweisen auf jene Schilderung innerhalb des Kapitels zur offen- baren Religion, die die Geburt des »als Selbstbewußtsein werdenden Geistes« plausibel zu machen hat (ebd., S. 549). Jene eindringliche Schilderung, die einzeln die um die »Geburtsstätte« des sich dann offenbarenden Geistes »umherstehenden« Gestalten aufzählt, macht deutlich, daß es vor allem anderen der sich verdichtende Sinn des Wortes ›Person‹ ist, der zur schließlichen Geburt der neuen und letzten Gestalt der Religion führt. Während Hegel innerhalb der Kunstreligion unter dem Wort ›Person‹ die Maske des Schauspielers versteht (dies die lat. Bedeutung des Wortes ›persona‹)[1] und er am Ende jenes Kapitels die Schauspieler schließlich ihre Masken able- gen, d. h. das »eigentliche Selbst des Schauspielers«»mit seiner Per- son zusammen[fallen]« sieht (ebd., S. 544), nimmt die Schilderung der um die Geburtsstätte umherstehenden Gestalten - neben dem Rückbezug auf die eben genannte, sich am Ende der Kunstreligion ergebende Gestalt der bloßen »Gewißheit seiner selbst« (ebd.) - auch auf die Person der Welt des Rechts und die » gedachte Person des Stoizismus« Bezug.
Hegel spricht es in der Phänomenologie des Geistes nirgend- wo aus, daß mit dem menschgewordenen und offenbaren Gott des Christentums es schließlich zum absoluten und doch reellen, in einem Einzelnen sich ereignenden personare des Absoluten kommt[1]. Doch muß das Ungesagte nicht auch ungedacht sein. Dazu ein Hinweis. Die Entwicklung der Kunst, wie sie von Hegel in seinen Vorlesungen über die Ästhetik dargestellt wird, endet mit der modernen Komödie (erwähnt wird etwa Molières Tartuffe; TWA Bd. 15, S. 570). Charakteristisch ist nun Hegels Begründung: Da der Zweck der Kunst in der Hervorbringung des Absoluten zu realer Erscheinung und Gestalt für unsere äußere Anschauung be- steht, die Komödie aber nurmehr die Darstellung des Zufälligen und Subjektiven zum Zweck hat, »tritt die Gegenwart und Wirksamkeit des Absoluten nicht mehr in positiver Einigung mit den Charakteren und Zwecken des realen Daseins hervor, sondern macht sich nur noch in der Form geltend, daß alles ihm nicht Entsprechende« aufgehoben wird, »und nur die Subjektivität als solche sich ... in dieser Auflösung als ihrer selbst gewiß und in sich gesichert zeigt« (ebd., S. 573). Das Ende der Kunst liegt in der völligen Reduktion des Äußeren, d. h. in der gänzlichen Rückführbarkeit des zum Ausdruck kommenden auf den bloßen Punkt eines künstlerischen Subjekts. So ist es im Humor der Komik die einfache »Person des Künstlers« (TWA Bd. 14, S. 229), die sich darstellt. Diese Person ist aber nicht im wahrhaften Sinn eine Persönlichkeit, ein Ort des Durchtönens des Absoluten, sondern ein partikuläres Subjekt, das seine aus sich selbst gezogenen Launen und Einfälle zum besten gibt. Die Person des Komödienschreibers steht damit im extremsten Gegensatz zur Person, wie sie von Hegel in den Vorlesungen über die Philosophie der Religion in Christus, d. h. dem Sohn Gottes gefaßt wird. Dort heißt es, gerade nachdem ein Wort von Christus »gleichsam als subjektiv ausgesprochen« charakterisiert worden ist, daß damit nun die » Person « Christus in Betracht komme (TWA Bd. 17, S. 284); und weiter: »Er ist es, der ... unmittelbar aus Gott dieses spricht und aus welchem Gott dieses spricht.« In Christus geschieht, so ist zu folgern, das personare des Absoluten. Und noch mehr: Da das Erscheinen des Gottes in der Gestalt eines Menschen diesem, dem Gott, notwendig ist, ist mit der Erscheinung der Person Chri- stus zugleich ein Hinweis darauf gegeben, daß Gott selbst als Per- sönlichkeit verstanden werden will. Das »Aussprechen und Wollen der an und für sich seienden Wahrheit und die Betätigung dieses Aussprechens wird« - in der Person Christi - »als Tun Gottes ausgesprochen« (ebd.).
Nehmen wir nun das Gesagte zusammen. Die vier Stadien sollen Stadien auf dem Weg zum enzyklopädischen System markieren. Das erste und die beiden anderen Kreise des Systems vorgängig verbin- dende Glied dieses Systems ist die Wissenschaft der Logik. Die Wissenschaft der Logik ihrerseits endet mit der Exposition der absoluten Idee und dem Hinweis, daß die an ihrem Ende erreichte Spitze der reinen Persönlichkeit sich auf die durchlaufenen Bestim- mungen des Logischen als auf Bestimmungen ihrer selbst bezieht. Indem wir den Anfang der Logik als satzhaften Ausdruck des sprin- genden Punkts, das Logische selbst - mit Hegel - als das Insichblei- ben des reinen Begriffs, die auf den Anfang der Logik sich beziehen- de reine Persönlichkeit auf das mit ihr sich ereignende Durchtönen des Absoluten hin verstehen, so erkennen wir schließlich, daß Hegel, wenn er am Ende seiner Logik diese als das Sichselbstvernehmen des ursprünglichen Wortes faßt, nichts anderes damit anzeigt, als die gelungene Transposition des sich selbst in seiner Unendlichkeit und seinem Anderssein vernehmenden Äthers in das Innere der absolut verstandenen Persönlichkeit. Ineins mit dieser gelungenen Transpo- sition des unendlichen Sprechens des Absoluten mit sich selbst in das Innere des reinen, göttlichen Begriffs und dessen Auseinander- legung in den drei Büchern der Wissenschaft der Logik ergibt sich weiter die Möglichkeit, das mit der Stimm begabung[1] gegebene Moment des Herausgehens als ein Herausgehen und Äußerlichwerden des rein Logischen, als Natur zu fassen. Allerdings ist dabei nicht mehr zu entscheiden, ob das Moment der mit der Stimme gegebenen Realität oder der Bezug ebendieser Stimme auf den Anfang der Logik als den Anfang ihrer Selbstbestimmung - der Bezug auf den springenden Punkt - es ist, der die Veranlassung für das Entlassen der Natur aus der Sphäre des reinen Begriffs darstellt. Hegel würde an dieser Stelle wohl geltend machen, daß ein Pochen auf Entscheid- barkeit in dieser Frage darauf hindeute, daß dem Fragenden die Sache selbst aus dem Blick geraten sei.
Folgt man der dargestellten Deutung über den mit dem Ende der Logik gegebenen inneren Zusammenhang des Hegelschen Systems, so ist zu erwarten, daß das Thema der Person oder der Persönlichkeit auch in anderen Sphären der Philosophie Hegels eine Hauptrolle spielen wird. Auf die Deutung der Religion und deren Entwicklung hin zum Christentum wurde bereits kurz hingewiesen. Diese Ent- wicklung führt schließlich zum dreieinigen, geistigen Gott des Chri- stentums, der in seiner Formbestimmung als »unendliche Persön- lichkeit« verstanden wird, darin »jedes Moment als Subject« aufzu- fassen sei[1]. Das Medium, darin die drei Momente aufgehoben und in die eine unendliche Persönlichkeit eingefaßt sind, sieht Hegel in der Liebe, denn: »In der Freundschaft, Liebe gebe ich meine abstrakte Persönlichkeit auf und gewinne sie dadurch als konkrete. Das Wahre der Persönlichkeit ist also eben dies, sie durch dies Versenken, Versenktsein in das Andere zu gewinnen« (TWA Bd. 17, S. 233)[2].
Unser Interesse am Hegelschen Gebrauch des Wortes ›Person‹ und ›Persönlichkeit‹ ist ein spezifisches; die Frage, die sich aufgrund unserer Deutung stellt, lautet:
Gibt es eine Stelle in seinem Werk, da, unter Rückbezug auf die Sphäre des Logischen, von der Person oder der Persönlichkeit so gesprochen wird, daß deren einziges, von ihm ihr in den Mund gelegtes Zitat in der einfachen Formalität eines Punktes besteht?
Da »das wahrhafte Wesen der Liebe« darin besteht, »das Bewußtsein seiner selbst aufzugeben, sich in einem anderen Selbst zu vergessen« kann sie als eine Bewegung aufgefaßt werden, darin der Geist in seinem Anderen bei sich selber bleibt, sich selbst dort wiederfindet und so das Andere des Geistes ebenso sich als »geistige Persönlichkeit« erweist.
VI. Der Knoten des Monarchen
S ehen wir uns die §§ 272 ff. des letzten großen, von Hegel selbst veröffentlichten Werkes, der Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) vor dem Hintergrund des Erarbeiteten genauer an.
Das Thema des § 272 der Rechtsphilosophie ist die innere Verfas- sung, d. h. die Teilung der Gewalten im Inneren des vernünftigen Staates. Hegel macht darin klar, daß nicht irgendwelche Zwecke und Nützlichkeiten die Einteilung nach verschiedenen Gewalten im Staat begründen, sondern daß einzig und allein »die Selbstbestim- mung des Begriffs in sich« es ist, welche »den absoluten Ursprung der unterschiedenen Gewalten enthält und um derentwillen allein die Staatsorganisation ... das in sich Vernünftige und das Abbild der ewigen Vernunft ist« (TWA Bd. 7, S. 433). So müssen also die drei im Inneren des politischen Staates unterscheidbaren Gewalten - als da sind: a) die gesetzgebende Gewalt, b) die Regierungsgewalt und c) die fürstliche Gewalt - vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Wissenschaft der Logik gesehen werden. Unmittelbar auf das eben Zitierte sagt Hegel: »Wie der Begriff und dann in konkreter Weise die Idee sich an ihnen selbst bestimmen und damit ihre Moment abstrakt der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit setzen [diese Reihenfolge entspricht den drei obengenannten Gewal- ten], ist aus der Logik - freilich nicht der sonst gang und gäben - zu erkennen.« So erhält die innere Diremtion des politischen Staates, d. h. dessen Auffächerung in drei voneinander unterschiedene Ge- walten ihre Legitimation aus der » Natur des Begriffs « (ebd., S. 432). Dabei ist zu beachten, daß » jede dieser Gewalten selbst in sich die Totalität dadurch ist, daß sie die anderen Momente in sich wirksam hat und enthält« - zusammen aber, da sie »den Unterschied des Begriffs ausdrücken, schlechthin in seiner Idealität bleiben und nur ein individuelles Ganzes ausmachen« (ebd.). Dieses sich gemäß der Natur des Begriffs in unterschiedene Gewalten auseinanderlegende Ganze ist der Staat. Da nun in jeder der drei Gewalten die jeweils anderen enthalten sind, aber erst die fürstliche Gewalt - das Moment der Einzelheit - die unterschiedlichen Gewalten zur individuellen Einheit zusammenzufassen fähig ist, ist mit ihr die »Spitze und der Anfang des Ganzen« gegeben (ebd., S. 435). Entsprechend beginnt Hegel seine Darstellung der inneren Verfassung des Staates mit ihr. Er beginnt mit ihr, indem er dasjenige, was er zuvor über die in der logischen Sphäre sich zutragende Selbstbestimmung des Begriffs gesagt hat, als das »Moment der letzten Entscheidung « auslegt (ebd., S. 441)[1]. Die fürstliche Gewalt ist die Spitze und der Anfang des Ganzen, da in ihr die Selbstbestimmung sich konkretisiert, d. h. es in ihr zur letzten Entscheidung kommt, »in welche alles Übrige zu- rückgeht und wovon es [das Ganze] den Anfang der Wirklichkeit nimmt« (ebd.).
An dieser Stelle ist äußerste Aufmerksamkeit erfordert, denn: In exakter Analogie zu diesem bereits im ersten Paragraphen zur fürst- lichen Gewalt angezogenen Übergang von der Selbstbestimmung des Begriffs zum Moment des letzten Entscheidens setzt Hegel im folgenden einen Übergang von der »Persönlichkeit des Staates« zur Realität dieser Persönlichkeit, zur »Person des Monarchen« an (§ 279; ebd., S. 445). Im Monarchen als der Staatsperson schlechthin »tritt das Moment der letzten sich selbst bestimmenden Willensent- scheidung ... als immanentes organisches Moment des Staates für sich in eigentümliche Wirklichkeit heraus« (ebd.). Wenn wir oben vom Moment des letzten Entscheidens als einer ›Auslegung‹ der Selbst- bestimmung des Begriffs gesprochen haben, so wird nun deutlich, daß Hegel im Monarchen gleichsam den real existierenden Ausleger jenes Übergangs findet. Parallel dazu kommt es zu der in unserem Zusammenhang höchst wichtigen Reformulierung der beiden Seiten der Auslegung als Persönlichkeit und Person. Tatsächlich sagt Hegel
- nachdem er von der nur in der Person des Monarchen wirklichen Persönlichkeit des Staates gesprochen hat - :
»Persönlichkeit drückt den Begriff als solchen aus, die Person enthält zugleich die Wirklichkeit desselben, und der Begriff ist nur mit dieser Bestimmung Idee, Wahrheit.« (ebd.)
Wie eine Kommentatorin (A. Redlich) bemerkt, läßt sich diese Unterscheidung von Persönlichkeit und Person - die von Hegel im übrigen Werk nicht konsequent durchgehalten wird - so deuten, daß der so gefaßte Begriff der Persönlichkeit als jener Grund sich verste- hen läßt »der durch die Person wie durch eine Maske hindurchtönt und sie erst eigentlich zur Person macht«[1]. Obwohl der Ausdruck ›Maske‹ an dieser Stelle eine fremde, aus dem Bereich des Theaters herkommende Vorstellung auf Verhältnisse im Inneren des politi- schen Staates überträgt[2], läßt sich, wie mir scheint, der Bezug des Begriffs der Persönlichkeit zur Wirklichkeit der Person des Monar- chen in der Weise des ›Durchtönens‹ fassen. Denn: Hegel setzt in genau dem Moment, da er die Form dieses Bezugs genauer anzuge- ben hat, ein Zitat, d. h. eine direkte, durch Anführungs- und Schluß- striche gekennzeichnete Rede in seine Darstellung. Das Zitat, in und mit dem die Person des Monarchen den Begriff der Persönlichkeit des Staates realisiert[3], d. h. die Gewißheit desselben ausdrückt und »das Abwägen der Gründe und Gegengründe ... abbricht und ... alle Handlung und Wirklichkeit anfängt«, lautet:
»›Ich will‹« (ebd.)
Damit hat Hegel angegeben, worin die Realisierung des Überganges von der Selbstbestimmung des Begriffs zum Moment des letzten Entscheidens liegt: In einem von ihm dem Monarchen in den Mund gelegten Ausspruch, der lautet ›Ich will‹. Der Begriff des Monarchen ist der »schwerste Begriff für das Räsonnement« (ebd., S. 446), weil er den Rückgang von der Selbstbestimmung des Begriffs auf die wirklich stattfindende Selbstbestimmung bei sich führt. Gleich ob vom Begriff des Monarchen oder von der Person des Monarchen die Rede ist: Jedesmal ist er als das » schlechthin aus sich Anfangende « zu fassen (ebd.)[1].
In einem berühmten Zusatz zum § 280 der Rechtsphilosophie legt Hegel das im ›Ich will‹ Liegende weiter aus. Nachdem er nocheinmal gegen Vorstellungen sich gewendet hat, die vom Volk etwa gegenüber der Vernünftigkeit des Monarchen vorgebracht werden - dieser könne übel gebildet sein oder in seiner Besonderheit negativ auf die Staatsgeschäfte sich auswirken -, heißt es:
»Es ist bei einer vollendeten Organisation nur um die Spitze des formellen Entscheidens zu tun, und man braucht zu einem Mo- narchen nur einen Menschen, der ›Ja‹ sagt und den Punkt auf das j setzt« (ebd., S. 451).[1]
Statt des ›Ich will‹ läßt Hegel an dieser Stelle den Monarchen ›Ja‹ sagen und den Punkt auf das j setzen. Damit wickelt er präzis jenes aus dem ›Ich will‹ des Monarchen aus, das gemäß unserer Deutung in ihm liegt: Während mit dem durch den Monarchen notwendig zu sagenden ›Ja‹ die bloße Forderung nach dessen Stimmbegabung gemeint ist[1], deutet die Rede vom Punkt - den der Monarch auf das j zu setzen hat - auf den parallel zur Vokalisation des Anfangs freiwerdenden, dem Seienden den Anfang gebenden springenden Punkt.
Ich spreche mit Bedacht vom Anfang des Seienden. Auch Hegel parallelisiert das aus sich Anfangende und insofern grundlose ›Ich will‹ des Monarchen mit seiner »ebenso grundlose[n] Existenz« (ebd., S. 451), seiner unmittelbaren » Natürlichkeit « und d. h. der »natürlichen Geburt « (ebd., S. 450) desselben[2]. Er gibt an, daß »dieser Übergang vom Begriff der reinen Selbstbestimmung in die Unmittelbarkeit des Seins und damit in die Natürlichkeit«»rein spekulativer Natur« sei, und seine Erkenntnis daher der »logischen Philosophie« angehöre (ebd.). Dieser Bezug der Darstellung der Person des Monarchen auf die ›logische Philosophie‹ liegt unserer Deutung bereits zugrunde: Indem wir das vom Monarchen Gesagte und Gesetzte mit dem in die Persönlichkeit Gelegten am Ende der Wissenschaft der Logik zusammensehen, ist nur zu erwarten, daß auch der dortige Übergang aus der Sphäre des Logischen in die Sphäre des Natürlichen hier sich reproduziert.
Doch Hegel geht noch weiter. Er kombiniert die beiden unableit- baren Seiten des Monarchen - die Seite des aus sich anfangenden ›Ich will‹ und die Seite seiner Geburt - zur »ungetrennten Einheit« und findet in dieser Einheit schließlich die » Majestät « des Monarchen begründet (ebd., S. 451f.). In der ruhigen Einheit der Majestät aber liegt das Moment des von »der Willkür Unbewegten « (ebd.)[1].
Nehmen wir diese Bemerkung auf. Wie ist also die Gesamtgestalt des Monarchen zu beschreiben? Einerseits liegt sowohl in ihrem ›Ich will‹ als auch in ihrer Natürlichkeit, d. h. ihrer Geburt, ein grundlo- ses aus sich selbst Anfangen. Andererseits soll gerade die Vereinigung dieser beiden Seiten in einer Person die unbewegte Majestät dersel- ben ausmachen. Läßt sich damit nicht von der Gesamtgestalt des Monarchen als von einer unbewegt-bewegenden Einheit sprechen? Oder kurz: Faßt Hegel in der Gestalt des Monarchen nicht die Geburt und den Willen zu einer Einheit des Unbewegt-Bewegenden zusammen?
Die Figur des Monarchen in der Rechtsphilosophie ist ein Knoten. Die Linien, die zu ihm führen, haben ihre Herkunft aus zwei ver- schiedenen Richtungen. Zurecht hat man darauf hingewiesen, daß Hegel die Geburt des Monarchen »nach dem Modell der Inkarnation konstruiert«[2]. Doch ist dies nur die eine Seite, jene Seite, die auf die
Analogie der Realisierung der Persönlichkeit Gottes in seinem Sohn und der Realisierung der Persönlichkeit des Staates im Monarchen verweist. Ebenso wichtig ist die andere, ebenfalls auf denselben Knoten zulaufende Linie: Diese findet ihren Ausdruck in der Stili- sierung des Monarchen als der unbewegten - aber bewegenden - Majestät. Indem Hegel an die Spitze der Pyramide[1] des Staates und d. h. in das Zentrum der Sphäre des absoluten Rechts die ungetrennte Einheit eines schlechthin aus sich anfangenden Unbewegten setzt, gibt er zu erkennen, daß er im Monarchen auch das aus der Tradition griechischer Metaphysik stammende höchste Moment eines Unbewegt-Bewegenden realisiert findet.
Hegel läßt keinen Zweifel daran aufkommen, daß mit der Dar- stellung des Monarchen eine - wenn nicht: die - Mitte der spekula- tiven Philosophie erreicht ist. Seine wiederholten Verweise auf die Logik, sein Vergleich des mit dem Monarchen gegeben » unmittel- bare [n] Umschlagen [s] der reinen Selbstbestimmung des Willens (des einfachen Begriffes selbst) in ein Dieses [1] und natürliches Da- sein« mit dem im ontologischen Beweis vom Dasein Gottes stattfin- denden »Umschlagen des absoluten Begriffes in das Sein« (ebd., S. 450), seine Bemerkung schließlich, daß » nur die Philosophie« die »Majestät denkend betrachten« darf, weil »jede andere Weise der Untersuchung als die spekulative der unendlichen, in sich selbst begründeten Idee« die »Natur der Majestät auf[hebe]« (ebd., S. 452)
-, alle diese Hinweise lassen erkennen, daß in und mit der spekula- tiven Betrachtung der absoluten Staatsperson die Hegelsche Philo- sophie Einblicke in ihr eigenes Inneres freigibt -, oder anders formuliert: daß die Fassung der Figur des Monarchen in der Rechts- philosophie in das pulsierende Herz der Spekulation zurückdeutet.
Verifizieren wir das.
Sehen wir uns den Knoten genauer an. Es gibt an ihm eine innere und eine äußere Seite zu unterscheiden. Die innere Seite ist der Rückbezug des Monarchen auf den Begriff, die äußere ergibt sich dadurch, daß Hegel am Moment der Geburt des Monarchen festhält. Man könnte nun diese beiden Seiten so zu kombinieren versuchen, daß man sagt: Die innere Seite, der Begriff, ist der Herkunftsort, d. h. der Geburtsort des Monarchen. Der Monarch wäre dann als eine Art ›Begriffsgeburt‹ gefaßt. Dagegen wendete man natürlich ein - man hat diesen Einwand seit Schelling ständig wiederholt[1], - daß Begriffe nicht gebären können. Nun ist die Hegelsche Wissenschaft der Logik als die Darstellung des Reichs des reinen Begriffs aber keine Logik wie sie gang und gäbe ist[2]. Zu überprüfen wäre also, ob die Hegelsche Fassung und Darstellung des Begriffs nicht ihr Hauptmo- tiv gerade darin hat, jene gängige Vorstellung von der Unmöglichkeit einer ›Geburt aus dem Begriff‹ zu widerlegen. Dazu wäre allerdings erforderlich, daß dasjenige, was Hegel den ›Begriff‹ nennt, von Beginn an eine ursprüngliche und wesentliche Beziehung zu einer Substanz unterhält, die eine schließliche ›Geburt aus dem Begriff‹ ermöglicht bzw. einen Umschlag aus der Sphäre des Begriffs in die Sphäre des Natürlichen zu denken erlaubt. In unserer Deutung der Wissenschaft der Logik ist aber genau dies der Fall. Indem wir in ihrem Anfang beim Sein und beim Nichts den satzhaften Ausdruck des springenden Punkts erkennen und der Anfang im weiteren Verlauf der Logik sich erhält, der springende Punkt aber auf die in sich pulsierende Substanz des Blutes zurückverweist, wird es mög- lich, die problematische ›Geburt aus dem Begriff‹ als ein Geschehen zu fassen, das lediglich die Explikation eines implizit im Begriff liegenden darstellt.
Doch gehen wir noch weiter. Der an den Anfang der Logik gesetzte springende Punkt weist seinerseits in zwei Richtungen zurück. Einerseits in die vor ihm liegende Bewegung einer Erhebung vom endlichen zum absoluten Wissen - den Gang der Phänomeno- logie des Geistes -, andererseits auf die Hegelsche Deutung des Kreislaufs des Blutes aus dem dritten Jenaer Systementwurf. Wäh- rend wir jene Erhebung als eine Bewegung fassen, darin die Inkor- poration des Absoluten bzw. die definitive Transsubstantiation des heiligen christlichen Blutes statthat, weist uns die Deutung des Kreislaufs des Blutes schließlich auf das in ihm angesetzte, auf die Metaphysik des Aristoteles deutende Unbewegt-Bewegende zu- rück.
Damit sind die beiden, zum Knoten des Monarchen führenden Linien freigelegt: Während das, was wir seine ›Geburt aus dem Begriff‹ nennen, auf die Bewegungen der Inkorporation des Abso- luten und der im Äther des reinen Begriffs stattfindenden Selbstdar- stellung des Absoluten sich zurückbeziehen läßt, nimmt die Charak- terisierung des Monarchen als eines majestätischen, unbewegten aus sich Anfangens die Bestimmungen wieder auf, die Hegel zuerst an der insichkreisenden und aus sich sich bewegenden Blutsubstanz gefunden hat.
So hat Hegel in der Figur des majestätischen Monarchen - der vernünftigen Spitze des Staates als des »absolute[n] unbewegte[n] Selbstzweck[s]« (ebd., S. 399) - schließlich eingelöst, was er bereits in Jena mit dem no}V assoziiert hat. Nachdem er von der nicht weiter zurückführbaren Kreislaufbewegung des Blutes und dem springen- den Punkt als dem Prinzip dieser aus sich anfangenden Bewegung gesprochen hat, heißt es - ich zitiere einige entscheidende Worte mehr als im ersten Kapitel - : »no}V ist das Wesen der Welt, d. h. das Allgemeine - das Einfache, welches die Einheit entgegengesetzter ist - und daher Unbeweg- bare, das aber bewegt - diß ist das Blut, es ist das Subject, so gut als der W i l l e n eine Bewegung anfängt« (GW Bd. 8, S. 159).
Bibliographie
G. W. F. Hegel
TWA Werke in zwanzig Bänden (Theorie-Werkausgabe). Auf der Grund- lage der Werke von 1832-1845 neu edierte Ausgabe, Redaktion E. Moldenhauer und K. M. Michel, Frankfurt a. M. 1971 [zit. mit Band- und Seitenziffer]
GW Gesammelte Werke. In Verbindung mit der deutschen Forschungs- gemeinschaft herausgegeben von der Rheinisch-Westfälischen Aka- demie der Wissenschaften, Bände 6-8, Hamburg 1971-76. Diese drei Bände enthalten die Wiedergabe der Jenaer Systement- würfe I-III [I: Bd. 6, hg. v. H. Kimmerle; II: Bd. 7, hg. v. R. P. Horstmann und J. H. Trede; III: Bd. 8, hg. v. R. P. Horstmann; zit. mit Band- und Seitenziffer]
Andere Textausgaben:
- »Der Geist des Christentums«, Schriften 1796-1800. Mit bislang unver- öffentlichten Texten, hg. u. eingeleitet v. W. Hamacher, Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1978
- Dissertatio Philosophica de Orbitis Planetarum. Philosophische Erörte- rung über die Planetenbahnen (1801), übersetzt, eingeleitet und kommen- tiert v. W. Neuser, Weinheim 1986
- System der Sittlichkeit, aus: G. W. F. Hegel, Frühe politische Systeme, hg. u. kommentiert v. G. Göhler, Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1974, S. 13-102
- Wissenschaft der Logik, Erster Band: Die objektive Logik, Erstes Buch: Das Sein (1812), neu hg. v. H.-J. Gawoll, Hamburg 1986
- Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse und andere Schriften aus der Heidelberger Zeit (Heidelberger Enzyklopädie [1817] ), aus: G. W. F. Hegel, Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe in
zwanzig Bänden, Bd. 6, mit einem Vorwort v. H. Glockner, Stuttgart 1956
- Die vollendete Religion (Manuskript 1821), in: G. W. F. Hegel, Vorle- sungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte. Bd. 5, hg. v. W. Jaeschke, Hamburg 1984
164 BIBLIOGRAPHIE
Briefe:
– Briefe von und an Hegel. Bd. 1-4, hg. v. J. Hoffmeister, Hamburg 1952ff.
Ü bersetzung:
- Fenomenologia dello Spirito, tr. di Enrico de Negri, Scandicci/Firenze 1992 [10. Aufl.]
Vorlesungsnachschriften:
- Vorlesung über Logik und Metaphysik (1801/02), aus: Schellings und Hegels erste absolute Metaphysik (1801/2), zusammenfassende Vorle- sungsnachschriften v. I. P. V. Troxler, hg. v. K. Düsing, Köln 1988, S.
63-77
- Naturphilosophie Bd. I, Die Vorlesung von 1819/20, Nachschrift v. G. Bernardy, hg. v. M. Gies, Napoli 1982
- Vorlesungen zur Philosophie des subjektiven Geistes, Nachschriften v. Kehler u. Griesheim, aus: M. J. Petry, Hegels Philosophy of the Subjective Spirit, 2. Anthropology, Dordrecht, Boston 1978
- Vorlesungen über die Philosophie der Kunst (1823 u. 1826). Nachschrif- ten, aus: Die Idee und das Ideal, Sämmtliche Werke Bd. Xa, hg. v. G. Lasson, Hamburg 1931
- Die Ästhetik oder Philosophie der Kunst (1823 u. 1826). Vorlesungsnach- schrift Kromayer, Deutsches Literaturarchiv Marbach
- Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft, Heidelberg 1817/18 mit Nachträgen aus der Vorlesung 1818/19, Nachgeschrieben v.
P. Wannemann, hg. v. C. Becker u. a., Hamburg 1983
- Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, Edition und Kommen- tar in sechs Bänden v. K.-H. Ilting, Stuttgart Bad Cannstatt 1973ff. (unabgeschlossen)
Andere Philosophen und beigezogene Literatur
Adorno, Th. W., Skoteinos oder Wie zu lesen sei (1962/63); in: ders., Drei Studien zu Hegel, Frankfurt a. M. 1969 (3. Aufl.), S. 105-165 Aristoteles: Die Stellenangaben beziehen sich auf die Zählung nach der Bekker Ausgabe (Aristotelis opera. Edidit Academia Regia Borussia ex recognitione I. Bekkeri. Vol. I/II, Berlin 1831), die Textangaben auf:
- Physica, hg. v. W. D. Ross, Oxford Classical Text series, 1982
- Historia animalium, Books I-III, ed. A. L. Peck, Loeb 1965
Aubenque, P., Hegelsche und Aristotelische Dialektik; in: Hegel und die antike Dialektik, hg. v. M. Riedel, Frankfurt a. M. 1990, S. 208-224
BIBLIOGRAPHIE 165
Baader, F. X. v., Über eine Äußerung Hegels über die Eucharistie; in: ders., Werke Bd. VII, hg. v. Fr. Hoffmann, Leipzig 1854 (Nachdruck: Aalen 1963), S. 247-58
Bloch, E., Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel (Erweiterte Ausgabe 1962); in: ders., Gesamtausgabe in 16 Bänden. Bd. 8, Frankfurt a. M. 1977 Böhme, J., Aurora oder Morgenröte im Aufgang (1612); in: ders., Sämtliche
Schriften. Faksimile-Neudruck der Ausgabe von 1730 in 11 Bänden. Bd. 1, neu hg. v. W.-E. Peuckert, Stuttgart 1955-61
Breidbach, O., Das Organische in Hegels Denken. Studie zur Naturphilo- sophie und Biologie um 1800, Würzburg 1982
Brunn, W. L. v., Kreislauffunktion in William Harvey’s Schriften, Berlin Heidelberg New York 1967
Collenberg, B., Hegels Konzeption des Kolorits in den Berliner Vorlesun- gen über die Philosophie der Kunst; in: Phänomen versus System. Zum Verhältnis von philosophischer Systematik und Kunsturteil in Hegels
Berliner Vorlesungen über Ästhetik oder Philosophie der Kunst, hg. v.
A. Gethmann-Siefert, Bonn 1992 (Hegel-Studien. Beiheft 34), S. 91-164 Derrida, J., Le Puits et la Pyramide. Introduction à la Sémiologie de Hegel; in: Marges de la Philosophie, Paris 1972, S. 79-127
- La Mythologie blanche. La Metaphore dans le Texte philosophique; in: ders., Marges ... [s.o.], S. 247-324
- Glas I/II. Que reste-t-il du Savoir absolu?, Paris 1981 (Erstausgabe: Paris 1974)
Fessard, G., Hegel. Le Christianisme et l’Histoire, Paris 1990
Fichte, J. G. und Schelling, F. J., Briefwechsel, Einleitung v. W. Schulz, Frankfurt a. M. 1968
Fuchs, Th., Die Mechanisierung des Herzens. Harvey und Descartes - Der vitale und der mechanische Aspekt des Kreislaufs, Frankfurt a. M. 1992 Fulda, H.-F. und Horstmann, R.-P. (Hg.), Hegel und die »Kritik der
Urteilskraft«. Veröffentlichungen der Internationalen Hegel- Vereinigung Bd. 18, Stuttgart 1990
Gadamer, H.-G., Vorgestalten der Reflexion; in: Subjektivität und Meta- physik. Festschrift für W. Cramer, hg. v. D. Henrich und H. Wagner, Frankfurt a. M. 1966, S. 128-143
Gans, E., Vorwort zur 2. Ausgabe der Rechtsphilosophie (1833); in: Mate- rialien zu Hegels Rechtsphilosophie. Bd.1, hg. v. M. Riedel, Frankfurt a.
M. 1975, S. 242-248
- Erwiderung auf Schubarth (1839); in: ebd., S. 267-275
Garewicz, J., Hegel über Böhme; in: Philosophie und Poesie. O. Pöggeler zum 60. Geburtstag, Bd. 1, hg. v. A. Gethmann-Siefert, Stuttgart Bad Cannstatt 1988, S. 321-329
Gilson, E., Descartes, Harvey et la Scolastique; in: Études sur le Rôle de la Pensée médiévale dans la Formation du Système Cartésien, Paris 1951, S. 51-101
166 BIBLIOGRAPHIE
Goethe, J. W., Diderots Versuch über die Malerei. Übersetzt und mit Anmerkungen begleitet; in: ders., Berliner Ausgabe. Bd.21. Übersetzun- gen I, Berlin Weimar 1977, S. 731-783
Haller, A. v., Abhandlung von den empfindlichen und reizbaren Theilen des menschlichen Leibes. Vortrag, Göttingen d. 22. April 1752, verdeutscht
v. C. Chr. Krausen, Leipzig 1756
- Die Alpen und andere Gedichte, Auswahl und Nachwort v. A. Elschen- broich, Stuttgart 1965
Harvei, G. (Harvey, W.), Opera, sive Exercitationes de motu cordis et sanguinis in animalibus atque Exercitationes duae anatomicae de circula- tione sanguinis tumque Exercitationes de Generatione Animalium; Qui-
bus Praefationem addidit Bernardus Siegfried Albinus, Leyden 1737 Heidegger, M., Sein und Zeit, Tübingen 1977 (14. Auflage)
- Kants These über das Sein (1961); in: ders., Wegmarken, Frankfurt 1978,
S. 439-473.)
- Logik. Die Frage nach der Wahrheit (Vorlesung WS 1925/26), Gesamt- ausgabe (GA) Bd.21, Frankfurt a. M. 1976
- Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie (Vorlesung SS 1930), GA Bd.31, Frankfurt a. M. 1982
- Hegels Phänomenologie des Geistes (Vorlesung WS 1930/31), GA Bd.32, Frankfurt a. M. 1980
Hobbes, Th., Of Persons, Authors, and Things personated; in: ders., English Works, Vol. III: Leviathan, London 1839 (Nachdruck: Aalen 1962), S. 147-152 (Chapter XVI)
Hörisch, J., Das Essen des Gottes: Hegels und Hölderlins Abendmahl; in: ders., Brot und Wein. Die Poesie des Abendmahls, Frankfurt a. M. 1992,
S. 187-206 (Kap. 11)
Jaeschke, W., Urmenschheit und Monarchie. Eine politische Christologie der Hegelschen Rechten (Manuskript von C. F. Goeschel); in: Hegel-Stu- dien, Bd. 14, Bonn 1979, S. 73-107
Kant, I., Werke in zehn Bänden, hg. v. W. Weischedel, Darmstadt 1960 (Nachdruck 1983)
LaMettrie, J. O. de, L’homme machine / Die Maschine Mensch, übers. u. hg. v. C. Becker, Hamburg 1990
Larenz, K., Hegels Dialektik des Willens und das Problem der juristischen Persönlichkeit; in: Logos. Internationale Zeitschrift für Kultur und Phi- losophie, Bd. 20, Tübingen 1931, S. 196-242 (Wiederabdruck in: G. W. F.
Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, hg. v. H. Reichelt, Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1972, S. 733-778.)
Levere, Tr. H., Hegel and the Earth Sciences; in: Hegels Philosophie der Natur, hg. v. R.-P. Horstmann u. M. J. Petry, Stuttgart 1986, S. 103-120 Liebrucks, B., Hegel: Phänomenologie des Geistes, Sprache und Bewußtsein
Bd.5, Frankfurt a. M. 1970
BIBLIOGRAPHIE 167
Luther, M., Auswahl aus seinen Schriften, hg. v. K. G. Steck, Berlin Darm- stadt Wien 1961
Mackensen, L., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Re- clam), Stuttgart 1966
Majetschak, St., Logik des Absoluten. Spekulation und Zeitlichkeit in der Philosophie Hegels, Berlin 1992
Manuwald, B., Studien zum Unbewegten Beweger in der Naturphilosophie des Aristoteles, Stuttgart 1989
Marion, J.-L., Le Présent et le Don (1977); in: Dieu sans l’Être, Paris 1982,
S. 225-258
Meyer, R. W., Dialektik der sinnlichen Gewissheit und der Anfang der Seinslogik; in: Hegel und die antike Dialektik, hg. v. M. Riedel, Frankfurt
a. M. 1990, S. 244-267
Möller, N. J., Über die Entstehung der Wärme durch Reibung nebst Folge- rungen für die Theorie beyder Phänomene; in: Neue Zeitschrift für spekulative Physik, Ersten Bandes drittes Stück, hg. v. F. J. W. Schelling,
Tübingen 1802 (Nachdruck: Hildesheim 1969)
Nancy, J.-L., La Juridiction du Monarche hégélien; in: Rejouer le Politique. Travaux du Centre de Recherche philosophiques sur le Politique, publiés sous la responsabilité de Ph. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, Paris 1981,
S. 51-90
- L’Amour en Éclats (1986); in: Une Pensée finie, Paris 1990, S. 225-268 Nowak, A., Hegels Musikästhetik, Regensburg 1971
Oehler, K., Der Beweis für den Unbewegten Beweger; in: ders., Der Unbe- wegte Beweger des Aristoteles, Frankfurt a. M. 1984, S. 40-63 Plessner, H., Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie (1928/1966); in: ders., Ges. Schriften Bd. IV, Frankfurt a. M. 1981
Redlich, A., Die Hegelsche Logik als Selbsterfassung der Persönlichkeit (1947), Meisenheim am Glan 1971
Rheinfelder, H., Das Wort ›Persona‹. Geschichte seiner Bedeutungen mit besonderer Berücksichtigung des französischen und italienischen Mittel- alters, Halle (Saale) 1928
Riedel, M., Dialektik des Logos? ; in: Hegel und die antike Dialektik, hg. v.
M. Riedel, Frankfurt a. M. 1990
Rosenkranz, K., Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben, Berlin 1844 (Nachdruck: Darmstadt 1977)
Rothschuh, K. E., Die Entwicklung der Kreislauflehre im Anschluss an William Harvey. Ein Beispiel der »autokatalytischen Problementfaltung« in den Erfahrungswissenschaften (1957); in: ders., Physiologie im Wer-
den, Stuttgart 1969, S. 66-86
Schelling, F. J. W., Sämmtliche Werke (SW), hg. v. K. F. A. Schelling, Stuttgart 1856-1861
Schobinger, J. P., Die textimmanente Präsenz des Autors; in: ΣΟΦΙΗΣ
168 BIBLIOGRAPHIE
ΜΑΙΗΤΟΡΕΣ (Chercheurs de sagesse). Hommage à Jean Pépin, Institut d’Études Augustiniennes, Paris 1992
Schweppenhäuser, H., Spekulative und negative Dialektik; in: Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, hg. v. O. Negt, Frankfurt a. M. 1970,
S. 85-97
Simmen, J., Kunst-Ideal oder Augenschein. Systematik - Sprache - Malerei. Ein Versuch zu Hegels Ästhetik, Berlin 1980
Simon, J., Das Problem der Sprache bei Hegel, Stuttgart 1966
Spinoza, B. de, Theologisch-Politischer Traktat (1670), übersetzt v. C. Gebhardt, neu bearbeitet, eingeleitet und hg. v. G. Gawlick, Hamburg 1984
- Briefwechsel, übersetzt v. C. Gebhardt, Hamburg 1986
Splett, J., Die Trinitätslehre G. W. F. Hegels, Freiburg München 1965
Steininger, W., Systematische Betrachtungen über den Begriff der Persön- lichkeit Gottes in der Philosophie Hegels und seiner Schule; in: Phil. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, Jg. 65, 1956, S. 182-231 Theunissen, M., Hegels Lehre vom absoluten Geist als theologisch-politi- scher Traktat, Berlin 1970
- Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik, Frankfurt
a. M. 1980
Trendelenburg, A., Logische Untersuchungen. Erster Band, Leipzig 1870 (3. Aufl.).
Wagner, F., Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes bei Fichte und Hegel, Gütersloh 1971
Wehr, G., Jakob Böhme, Reinbek bei Hamburg 1971
Winckelmann, J. J., Geschichte der Kunst des Altertums (1764), Wien 1934 (Nachdruck: Darmstadt 1982)
Wohlfart, G., Der spekulative Satz. Bemerkungen zum Begriff der Speku- lation bei Hegel, Berlin New York 1981
- Der Punkt. Ästhetische Meditationen, Freiburg i. Br., München 1986
[...]
1 So hat etwa Ernst Bloch in seinen Erläuterungen zu Hegel (Subjekt-Objekt, GA Bd. 8, Frankfurt a. M. 1977) einem Kapitel den Titel gegeben: Pulsschläge und Syllogismen. Darin heißt es: »Hegel will beides [nämlich: die Pulsschläge und die Syllogismen] als das gleiche begriffen wissen, zusammenfallend in der dialektischen Lebendigkeit des Geistes, als welche in Thesis, Antithesis (Widerspruch), Synthesis syllogistischen Pulsschlag hat.« Bloch gebraucht zur Charakterisierung der Werk- gestalt der Hegelschen Philosophie gar das Wort »Kardiogramm« (ebd., S. 151f.). Ein zweiter Hinweis betrifft einen Aufsatz von Hermann Schweppenhäuser, darin es - nachdem die immanente Dialektik das »fortbrennende Feuer« genannt wurde - heißt: »Die Spekulation sucht [ihre Erkenntnis] in diaphaner Anatomie: bei dem eigenen Glühen des Corpus, den sie im Lichte der Einheit von Pulsation und Durch- pulstem studiert.« (Spekulative und negative Dialektik; in: Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, hg. v. O. Negt, Frankfurt a. M. 1970, S. 85-97; hier: S. 85f.) Schließlich sei Manfred Riedel genannt, der in einem neueren, zunächst als Vortrag gehaltenem Text zur dialektischen Methode bündig bemerkt: »Und das Innerste ist der Pulsschlag der dialektischen Methode, jener gleichmäßige Rhythmus des Ganzen, in dem nach Hegel das Herz der Wahrheit schlägt.« (Dialektik des Logos?, in: Hegel und die antike Dialektik, hg. v. M. Riedel, Frankfurt a. M. 1990, S. 16) - Weitere Autoren und Stellen könnten genannt werden. Allen ist jedoch eigentüm- lich, daß sie die Metapher des Pulsierens lediglich gebrauchen, ohne sie zu reflek- tieren, d. h. sie zu befragen.
1 Der Text ist der handschriftlich vorliegenden Berliner Einleitung (1820) in die Ge- schichte der Philosophie entnommen. (Diese Einleitung ist abgedruckt in: TWA Bd. 20, S. 465-519; hier: S. 476).
2 Die Passage gehört zum ungesicherten Korpus der von K. L. Michelet herausge- geben Ausgabe der Vorlesungen (1833-36).
1 Zum didaktischen Einsatz der Metapher vgl. bereits Aristoteles: Rhet. III 10, 1410b6-36
2 So die bekannte Formulierung in der Vorrede zur PhdG (TWA Bd. 3, S. 56). - Hegel, der an dieser Stelle seine Auffassung vom Studium der Wissenschaft kundtut, fordert von demjenigen, der an sie, und d. h. in diesem Fall an den ersten Teil des Systems der Wissenschaft, herantritt, daß er sich »des eigenen Einfallens in den immanenten Rhythmus der Begriffe entschlage« - »diese Enthaltsamkeit«, fährt er fort, sei »selbst ein wesentliches Moment der Aufmerksamkeit auf den Begriff.« - Was ist damit gesagt? Ist damit nicht zunächst und allem zuvor dies gesagt: da ß es einen, den Begriffen oder dem Begriff eigenen Rhythmus gebe? Und weiter: Daß das Gelingen oder Nichtgelingen der geforderten ›Aufmerksamkeit auf den Begriff‹ davon abhängt, ob der an die Wissenschaft Herantretende auf den begriffseigenen Rhythmus achte? oder besser: nicht auf ihn achte, sondern sich ihm ü bergebe -, doch Halt! Was genau fordert Hegel von dem an die Wissenschaft Herantretenden, wenn er die gelingende ›Aufmerksamkeit auf den Begriff‹ von einer Übergabe an - und einer Übernahme des - begriffseigenen Rhythmus abhängig macht? Er fordert nichts anderes als den Verzicht auf eine Aufmerksamkeit zur Erlangung der Auf- merksamkeit, er setzt eine Unachtsamkeit (auf das Eigene) als zu durchschreitendes Tor vor das von ihm versprochene Gelingen der ›Aufmerksamkeit auf den Begriff‹. Mit dieser Forderung des Verzichts auf die eigene Bestimmung dessen, was Auf- merksamkeit heißt, tritt die Hegelsche Philosophie in Konflikt mit dem Unver- zichtbaren jeder Auslegung: daß diese die sie leitende Aufmerksamkeit selbst zu bestimmen habe. In dieser Situation scheinen nurmehr zwei Wege offen; entweder
1 Diese philosophische Rede von der Unterscheidung des Eigentlichen und Uneigentlichen oder von der Differenz des Begrifflichen und des Metaphorischen ist selbst zu problematisieren. Den Hinweis auf die in dieser Unterscheidung liegende Problematik verdanken wir J. Derrida. Im Essay La Mythologie blanche - La M é - taphore dans le Texte philosophique (in: Marges de la Philosophie, Paris 1972, S. 247- 324) entdeckt Derrida, daß das von der philosophischen Tradition als ›Metapher‹ Bezeichnete ein ihr eigenes, spezifisch auf sie zugeschnittenes Konzept zur Aus- grenzung des ihr Fremden darstellt: Erst mit der Position und Konzeptualisierung eines ›Uneigentlichen‹ gelangt - im Gegenzug - das Eigene und Eigentliche der philosophischen Rede zur wiederholten Selbstbestätigung. Im steten Versuch, die reine, unsinnliche und abstrakte Rede als ihr eigenes Reich des Ausdrucks zu kon- stituieren, ist die Philosophie bemüht, das ihrem Ausdruck fremde - die aus der Sphäre des Sinnlichen entnommene ›Metapher‹ - als das Un-Eigentliche zu expo- nieren. Wie Derrida aufweisen kann, erreicht diese Tendenz zur Ausgrenzung des Metaphorischen in und mit der Hegelschen Philosophie gleichsam das Bewußtsein ihrer selbst: Bei Hegel wird die Ausgrenzung des Metaphorischen schließlich ge- schichtlich und systematisch mit dem Zu-sich-selbst-Kommen des Begrifflichen parallel gesetzt. Derrida macht dabei die auch für unseren Zusammenhang wichtige Entdeckung, daß eine Analogie zur Gesamtbewegung dieses Zu-sich-selbst-Kom- mens des Begrifflichen in den einführenden Passagen von Hegels Philosophie der Geschichte zu finden ist: Dort wird der im Orient beginnende und im Ok- zident an ihr Ziel gelangende Gang der Weltgeschichte mit dem Übergang von der äußerlichen, aufgehenden Sonne des Morgens zur niedergehenden, und zwar im Inneren des abendländischen Menschen niedergehenden - und dort wieder aufge- henden - »Sonne des Selbstbewußteins« (TWA Bd. 12, S. 133f.) verglichen. Nimmt man die beiden von Derrida beobachteten Bewegungen - des metaphorischen zum begrifflichen Ausdruck (ähnlich wie Rousseau ordnet auch Hegel dem Orient die metaphorische Ausdrucksweise zu), der äußeren Sonne zur innerlichen ›Sonne des Selbstbewußtseins‹ - zusammen, so drängt sich eine Fragestellung der Art der un- seren geradezu auf. Denn: Hat das Hegelsche Denken sowohl die Aufgabe, in einer allen Metaphorizität ledigen Sprache die Wahrheit (dessen was ist) zu sagen, und findet dies Aussagen am Ort des Aufgehens der ›inneren Sonne des Selbstbewußt- seins‹ statt, so ist zu vermuten, daß die begriffliche Rede des Philosophen, falls sie zu Metaphern greift, zu Metaphern des Innerlichen greift. Und genau dies ist in und mit der begriffsbegleitenden Metapher des › Pulsierens ‹ der Fall.
1 Das Wort ›Randgang‹ erscheint in philosophischem Zusammenhang wohl erstmals im Titel eines Buches von J. Derrida. Unter dem dt. Titel Randgänge der Philosophie gelangten im Jahre 1976 vier von insgesamt elf Essays Derridas zur Veröffentli chung, die vier Jahre zuvor unter dem frz. Titel Marges de la Philosophie erschienen sind. Wie die ›Editorische Notiz‹ der dt. Ausgabe vermerkt, wurde »der Titel Rand- gänge der Philosophie letztendlich auf Vorschlag von Jacques Derrida gewählt« (ebd., S. 5). Gemäß einer mündlichen Mitteilung an den Verfasser geht der Vor- schlag, das Wort ›Marges‹ durch das dt. Wort ›Randgänge‹ zu übersetzen, »letzt- endlich« auf einen Hinweis J.-P. Schobingers zurück, den dieser auf eine entspre- chende Anfrage Derridas hin äußerte.
1 Hegel hat seine Enzyklopädie insgesamt dreimal herausgegeben; zuerst in Heidelberg (1817), dann zweimal in Berlin (1827, 1830). Die kürzere Heidelberger Fassung ist heute beinahe unbekannt.
1 vgl. dazu auch den § 3 der von G. B. Jäsche herausgegebenen Logik Kants. Dort wird von der Idee als dem »Urbild des Gebrauchs des Verstandes« gesprochen und darauf hingewiesen, daß die so verstandene Idee aber lediglich als » regulatives «, nicht aber als » konstitutives « Prinzip des empirischen Verstandesgebrauchs zu gel- ten habe (A 141). - Zum Verhältnis Hegel-Kant im Umkreis des hier Verhandelten vgl. die gedruckt vorliegenden Beiträge einer Arbeitstagung zu: ›Hegel und die Kritik der Urteilskraft (1989), hg. v. H.-F. Fulda und R.-P. Horstmann, Stuttgart 1990; darin besonders die Abhandlungen unter dem Titel Teleologie (ebd., S. 127- 188)
1 In einer ›Anmerkung‹ (§ 76) im zweiten Teil der KdU kommt Kant auf die für den menschlichen Verstand »unumgänglich[e]« Notwendigkeit zu sprechen »Möglich- keit und Wirklichkeit der Dinge zu unterscheiden« (B 340). Den Grund für diese Unterscheidung findet er in der »Natur« der menschlichen »Erkenntnisvermögen« selbst liegend. Da im Menschen »zwei ganz heterogene Stücke«, nämlich: »Verstand für die Begriffe und sinnliche Anschauung für die Objekte«, auszumachen seien, gehe die Unterscheidung von Möglichem und Wirklichem direkt auf die ihm eigene Konstitution zurück. »Nun beruht aber alle unsere Unterscheidung des bloß Mög- lichen vom Wirklichen darauf, daß das erstere nur die Position der Vorstellung eines Dings respektiv auf unseren Begriff und überhaupt das Vermögen zu denken, das letztere aber die Setzung des Dinges an sich selbst (außer diesem Begriffe) be- deutet.« (ebd.) Im Gegensatz zu Kant, der nicht nur das Mögliche, sondern auch das Wirkliche als eine »Setzung« (bzw. »Position«) durch eines der beiden Erkennt- nisvermögen faßt, besteht für Schelling »jedes organische Produkt«» für sich selbst « (SW, 1. Abt., Bd. II, S. 40), ist die Organisation » selbst Objekt, und zwar ein durch sich selbst bestehendes« (ebd., S. 41). (Zur Bedeutung des Aktes der ›Position‹ bei Kant vgl. M. Heidegger, Kants These über das Sein (1961); in: ders., Wegmarken, Frankfurt a. M. 1978, S. 439-473.)
2 Einen Überblick über den Hintergrund der entstehenden Philosophie der Natur während der Jenaer Jahre gibt O. Breidbach in seiner Studie zur Naturphilosophie und Biologie um 1800: Das Organische in Hegels Denken (Würzburg 1982). Breidbach beschließt seine Studie mit einem ›Epilog‹. Der Titel dieses Epilogs lautet: Der lebende Begriff (ebd., S. 362).
1 Bemerkungen zur Quellenlage: Unser Wissen darüber, wie Hegel das Blut, dessen Kreislauf und das Pulsieren im Zusammenhang seiner Naturphilosophie gedeutet hat, stützt sich auf Texte aus vier verschiedenen Ausarbeitungsstufen zum Grundthema des Organismus. Diese Quellen seien kurz charakterisiert: 1. Aus dem Zusammenhang der Vorbereitung auf die Vorlesung Das System der spekulativen Philosophie die Hegel im Wintersemester 1803/04 in Jena gehalten hat, sind eine Anzahl von Manuskriptfragmenten überliefert. Von den insgesamt 22 Fragmenten, die unter dem Titel Jenaer Systementwürfe I veröffentlicht sind (GW Bd. 6, hg. v. H. Kimmerle [1975] ), nehmen 5 auf das Herz, das Blut und/oder den Kreislauf Bezug. Eindringende Analysen sind der Assimilation und dem Fieber gewidmet. Vom Pulsieren ist noch nicht die Rede. 2. Einen etwas anderen Eindruck macht der Textkomplex, der unter dem Titel Jenaer Systementwürfe III veröffentlicht ist: Hier handelt es sich um eine beinahe vollständig erhaltenes, systematisch gestaltetes, handschriftlich ausgearbeitetes Vorlesungsmanuskript aus der Zeit um 1805/6 (GW Bd. 8, hg. v. R.-P. Horstmann [Hamburg 1976]). Der Ausgabe sind zwei Beilagen angefügt. - Diese Handschrift bildet den Grundtext unserer Auslegung. 3. Ferner liegt ein im Jahre 1982 von M. Gies veröffentlichter erster Band zur Naturphilosophie Hegels vor . Dabei handelt es sich um eine Nachschrift der ersten Berliner Vorlesung zur Naturphilosophie (1819/20) von Gottfried Bernardy (G. W. F. Hegel, Naturphilosophie Bd. I. Die Vorlesung von 1819/20, hg. v. M. Gies, Napoli 1982). Der Text ist als erläuternder Zusatz zu den Primärquellen brauchbar; einzelne Formulierungen und Bezugnahmen treten nur in ihm auf. 4. Der zweite, mittlere Teil der Enzyklopädie, betitelt Die Naturphilosophie (zi- tiert wird nach: TWA Bd. 9) enthält Hegels späteste Ausführungen zu Blut und Puls. Im § 354 der Berliner Enzyklopädie wird das Pulsieren als die »irritable sich mit sich selbst zusammenschließende Totalität« (ebd., S. 440) vorgestellt, was das heißt, gilt es zu verstehen. Ein besonderes Problem der Enzyklopädie bieten die seit ihrer Herausgabe innerhalb der Werke (1832-45) beigegebenen ›Zusätze‹. Durch die Veröffentlichung der Jenaer Manuskripte ist nämlich deutlich geworden, daß der Herausgeber etwa der Naturphilosophie (K. L. Michelet) am Textbestand Streichungen vorgenommen hat, bevor er ihn für die ›Zusätze‹ verwendete. So ist etwa im Zusatz zum § 354 der Enzyklopädie (TWA Bd. 9, S. 450f.) im Vergleich mit dem Original (GW Bd. 8, S. 159) gerade die entscheidende Nennung des no}V weggelassen worden.
1 vgl. dazu: Trevor H. Levere, Hegel and the Earth Sciences; in: Hegels Philosophie der Natur, hg. v. R.-P. Horstmann u. M. J. Petry, Stuttgart 1986, S. 103-120
1 Der Text fährt fort: »Essen und Trincken macht die unorganischen Dinge zu was sie an sich, in Wahrheit sind, es ist das bewußtlose Begreiffen derselben, werden darum so aufgehobne, weil sie [es] an sich sind.«
1 Ich lege meiner Interpretation hier und im folgenden stets den Text des dritten Jenaer Systementwurfs zugrunde. Dieser letzte und reifste der drei Jenaer Ent- würfe kennt noch keine Einteilung in Paragraphen wie der Text der späteren Enzyklopädie. Die teilweise ungewohnte Schreibweise und Zeichensetzung in den Zitaten ist diejenige Hegels.
1 So weist O. Breidbach lediglich auf die Hegelschen Formulierungen zur »Autono- mie des Herzschlags« hin, bemerkend, daß, »was die Seite der phänomenologischen Exposition anbelangt«, sie »völlig korrekt« sind (a. a. O., S. 215f.); vgl. dazu auch den eher beiläufigen Verweis Hamachers auf die Passage (in: pleroma - zu Genesis und Struktur einer dialektischen Hermeneutik bei Hegel; in: G. W. F. Hegel, Der Geist des Christentums, Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1978, S. 273ff.).
1 Der Herausgeber des Manuskripts des dritten Jenaer Systementwurfs (R.-P. Horstmann) schreibt die abgewehrte Position - die Position, die zur Erklärung des Blutkreislaufs ›allerhand Kräfte‹ auffinden zu müssen glaubt - insbesondere dem Physiologen J. H. F. Autenrieht zu; er verweist auf die § 359-393 des Auten- rieht’schen Handbuchs der empirischen menschlichen Physiologie (1801/02); vgl. GW Bd. 8, S. 340.
2 Der Schweizer Albrecht von Haller ist vor allem als Dichter bekannt. Sein Unvoll- kommenes Gedichtüber die Ewigkeit hat neben Kant auch Hegel wiederholt be- schäftigt (vgl. etwa das Haller-Zitat zur ›schlechten Unendlichkeit‹ und deren Auf- hebung in der Logik Hegels [TWA Bd. 5, S. 266]). Eine Anekdote besagt, daß
1 vgl. A. v. Haller, Abhandlung von den empfindlichen und reizbaren Theilen des menschlichen Leibes (Vortrag, Göttingen, 22. April 1752), verdeutscht von C. Chr. Krausen, Leipzig 1756, S. 38f.
2 Auch für J. O. de La Mettrie, einem Zeitgenossen Hallers, ist das Weiterschlagen des herausgetrennten Froschherzens eine unzweideutige ›expérience‹. In seiner be- rühmtgewordenen, im Jahre 1747 erschienen Schrift L ’ homme machine - die mit einer ironischen Vorrede an die Adresse Hallers beginnt (La Mettrie hat wahr- scheinlich aus den Boerhaave-Kommentaren Hallers [1739] Kenntnis von dessen Irritabilitätslehre gehabt) - gilt ihm das nachhaltige Schlagen des herausgetrennten Herzens als Beleg seiner These, daß das aus sich selbst sich bewegende Organische die Annahme der Mitwirkung einer ›Seele‹ überflüssig mache. (J. O. de La Mettrie, L’homme machine / Die Maschine Mensch, übers. u. hg. v. C. Becker, Hamburg 1990, hier: S. 96f.)
3 vgl. dazu die dem oben erwähnten Vortrag beigegebene Abhandlung Von der Ur- sache der Bewegung des Herzens. Haller versieht diesen Nachtrag mit einer Be- merkung, darin er von der Bewegung des Blutes und der Irritabilität des Herzens als »zwey Theile[n] eines Ganzen« spricht, »die einander aufrecht erhalten« (a. a. O., S. 44f.).
1 Die Unterscheidung einer ›schlechten Unendlichkeit‹ und einer wahrhaften Un- endlichkeit oder Ewigkeit ist ein bekannter Hegelscher Topos (vgl. dazu: WdL I, Zweites Kapitel: Das Dasein, C. Die Unendlichkeit; TWA Bd. 5, S. 149ff.) Der
1 So z. B. Phys. VIII 5, 256a29: »¿n<gkh stínai kaÎ më eÑV ›peiron ÑÄnai«, im Zu- sammenhang der Bewegungslehre; oder auch Met. XII 3, 1070a3: »¿n<gkh dë stínai«, in Bezug auf die Unableitbarkeit von úlh und eÕdoV.
2 »ÜlwV mÅn g=r Àp<ntwn ¿dônaton ¿pÖdeixin eÕnai” eÑV ›peiron g=r ›n badÍzoi, åste mhd‘ oútwV eÕnai ¿pÖdeixin.« (Met. IV 4, 1006a7f.)
3 »té g=r îremísai kaÎ stínai tën di<noian ÈpÍstasqai kaÎ jrone^n legÖmeqa« (Phys. VII 3, 247b11f.)
1 vgl. dazu: K. Oehler, Der Beweis für den Unbewegten Beweger; in: ders., Der Unbewegte Beweger des Aristoteles, Frankfurt a. M. 1984, S. 40-63
2 Phys. VIII 5, 256b24-27. Diese Passage wird von der neueren Aristotelesforschung, obwohl als ›Aristotelisch‹ anerkannt, einhellig als (späterer) Einschub bezeichnet. Vgl. B. Manuwald, Studien zum Unbewegten Beweger des Aristoteles, Stuttgart 1989, S. 30 (Anm. 82)
3 »di¶ kaÎ ’AnaxagÖraV ÚrJâV lÄgei, t¶n no}n ¿paqí j<skwn kaÎ ¿migí eÕnai, Èpeidê ge kinêsewV ¿rcën aøt¶n eÕnai poie^“ oútw g=r mÖnwV Ân kinoÍh ¿kÍnhtoV æn kaÎ kratoÍh ¿migëV á n.« (256b24-27)
1 vgl. dazu: P. Aubenque, Hegelsche und Aristotelische Dialektik; in: Hegel und die antike Dialektik, hg. v. M. Riedel, Frankfurt a. M. 1990, S. 219ff. Wie Aubenque an der Auslegung einer Stelle aus Met. XII 7, 1072a21-26 zeigen kann, versucht Hegel auch in seinen späteren philosophiehistorischen Vorlesungen das Unbewegt- Bewegende (bzw. den no}V) in eine »Mitte« zu verlegen; für Aristoteles sei aber die Kreisbewegung gerade eine von einem Anderen als sich selbst verursachte Bewe- gung.
2 Obwohl es wahrscheinlich ist. - So nennt denn auch die einzige weitere mir bekannte Stelle, an der Hegel das Blut noch einmal in die Nähe des no}V bringt, den Namen des Anaxagoras. Die Stelle, die an entlegenem Ort (in den Hegelschen Vorlesungen über die Philosophie der Religion) sich findet, - und zudem ungesichert ist -, lautet: »Der Mensch ist Geist, und sein Geist bestimmt sich als Seele, als diese Einheit des Lebendigen. Diese seine Lebendigkeit, die in der Expli- kation seiner Organisation nur eine ist, alles durchdringend, erhaltend, - diese Wirksamkeit ist im Menschen vorhanden, solange er lebt, ohne daß er davon weiß oder dies will, und doch ist seine lebendige Seele die Ursache, die ursprüngliche Sache, die Substanz, welche das wirkt. Der Mensch, eben diese lebendige Seele, weiß davon nichts, will diesen Blutumlauf nicht, schreibt’s ihm nicht vor; doch tut er’s, es ist sein Tun; der Mensch ist tuende, wirkende Macht von diesem, was in seiner Organisation vorgeht. Diese bewußtlos wirkende Vernünftigkeit oder be- wußtlos vernünftige Wirksamkeit ist, daß der no}V die Welt regiert, bei den Alten der no}V des Anaxagoras. Dieser ist nicht bewußte Vernunft« (TWA Bd. 16, S. 379; H.v.m.)
1 vgl. dazu: E. Gilson, Études sur le Rôle de la Pensée médiévale dans la Formation du Système Cartésien, 1951, S. 51-101 (Descartes, Harvey et la scolastique).
2 So etwa gruppiert das kürzlich erschienene Buch von Th. Fuchs Die Mechanisie- rung des Herzens (Frankfurt a. M. 1992) die gesamte nach-Harvey’sche Theorie- bildung in der Physiologie unter das genannte duale Schema. Der Untertitel des Buches - die beiden Deutungsmuster je einem Namen zuordnend - lautet: »Harvey und Descartes - Der vitale und der mechanische Aspekt des Kreislaufs«.
1 Th. Fuchs, a. a. O., S. 187ff.
1 »Quarto itaque die si inspexeris, occurret jam major metamorphosis, & permutatio admirabilor; quae singulis fere illius diei horis manifestior fit; quo tempore in ovo, de vita plantae, ad animalis vitam fit transitus. Jam enim colliquamenti limbus linea exili sanguinea purpurascens rutilat: ejusque in centro fere, punctum sanguineum saliens emicat: exiguum adeo, ut in sua diastole, ceu minima ignis scintillula, efful- geat; & mox, in systole, visum prorsus effugiat, & disparear. Tantillum nempe est vitae animalis exordium, quod tam inconspicuis initiis molitur plastica vis Na- turae!« In: Gulielmi Harvei,Opera II, Exercitationes de Generatione Animalium, Leyden 1737, S. 66.
2 Wobei zu betonen wäre, daß das genannte ›Feuer‹ nur auf die angeborene Wärme verweist, ohne daß diese wirkliches, d. h. brennendes Feuer ist - eine wesentliche Differenz, auf die schon Aristoteles hingewiesen hat (vgl. dazu: Th. Fuchs, a. a. O., S. 66; und auch: W. L. v. Brunn, Kreislauffunktion in William Harvey’s Schriften, Berlin Heidelberg New York 1967; bes. 2., 4. und 5. Kapitel).
1 Aristoteles hat in seiner Tierkunde (Hist. An. VI 3, 561a12f.) zum ersten Mal vom Springen (A. gebraucht das Verb phd<w, ich hüpfe, springe) eines Blutpunkts (stig- më aÒmatÍnh) gesprochen. - Zum Verhältnis Aristoteles-Harvey, - Harvey kannte nicht nur die Aristotelischen Schriften zur Biologie genauestens, sondern orientierte selbst seine Forschungsmethode am griechischen Vorbild -, vgl. die ausgezeichneten Studien von W. L. v. Brunn und auch Th. Fuchs.
2 dazu: Th. Fuchs, a. a. O., S. 95ff.
3 Den Unterschied von ›vitalistischer‹ und ›mechanistischer‹ Sichtweise hier anwen- dend, heißt es bei Th. Fuchs, der die Darstellungen Harveys resumiert: »Wir er- kennen ... , daß das Prinzip der Herzbewegung embryologisch in der elementaren Eigenbewegung und Pulsation des Blutes vorweggenommen ist, die sich dann auf die verfestigten Strukturen überträgt; ... der vitale Aspekt, am reinsten in der Embryogenese sichtbar « - d. h. eben am punctum saliens - » bringt selbst den mechanischen hervor und wird schließlich von ihmüberlagert « (a. a. O., S. 73f.).
1 H.-G. Gadamer hat in einem im Jahre 1966 veröffentlichten Text genau dies von den Hegelschen Wendungen des ›Achsendrehens‹ und ›Erzitterns‹ behauptet. Hät- te er die ›bloße Metaphorik‹ Hegels aber bis zum Pulsieren weiterverfolgt, wären ihm wohl bald Zweifel an seiner Aussage gekommen. (In: Subjektivität und Metaphysik, Festschrift für W. Cramer, hg. v. D. Henrich u. H. Wagner, Frankfurt a. M. 1966, S. 128-143; bes.: 143)
1 in: Gulielmi Harvei, Opera I, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (1628), Leyden 1737, S. 34; vgl. dazu: Th. Fuchs, a. a. O., S. 61, 101, 105, 112
2 Auch der frühere Text der Handschrift (des dritten Jenaer Systementwurfs) endet mit der Beschreibung der grössten Krise, die dem Lebendigen geschehen kann: mit der Beschreibung seines Todes. Und hier läßt sich sogar ein Bezug des Todes zu unserem Thema ausmachen: Da der Tod des Organismus mit der ihn ereilenden Krankheit in Verbindung gebracht wird, als das »reine Leben des kranken Orga- nismus« Hegel aber weiter das Fieber, d. h. den »hitzige[n] Blutorganismus« nam- haft macht, ergibt sich ein bemerkenswerter Rückbezug auf seine Beschreibung des inneren Organismus. Mit der Krankheit wird »das organische Eins ... sich selbst Gegenstand«, der Organismus verwandelt sich entsprechend »in Hitze, Negativi- tät« - und Hegel diagnostiziert: »Blut ist itzt das herrschende« (GW Bd. 8, S. 181). [Das Ende des Organismus im ›hitzigen Blutorganismus‹ nimmt die Vorstellung des Feuers als des ›reinen Prozeßes‹ aus dem Chemismus-Teil wieder auf].
1 Die ›Zusätze‹ zu den Paragraphen können nicht als Gegenbeweis angeführt werden, da sie z.T. Material aus der Jenaer Zeit wiedergeben. (Eine Neuausgabe, wie sie von E. Moldenhauer und K.M. Michel unternommen wurde, hätte die ›Zusätze‹ unbedingt überprüfen und sie mit dem ungefähren Jahr der Niederschrift versehen müssen.)
2 Die Rede von einem »absoluten Tier« bleibt vereinzelt und findet sich nur im ersten der drei Jenaer Entwürfe (GW Bd. 6, S. 212).
1 Es findet sich als Beilage im Anhang des achten Bandes der Gesammelten Werke (S. 291-293).
1 In der Kritik der reinen Vernunft Kants werden der Raum und die Zeit bekanntlich in der Transzendentalen Ästhetik abgehandelt. Für Kant sind Raum und Zeit »reine Formen sinnlicher Anschauung« (B 36), die »im Gemüte a priori bereit liegen« (B 34). Die beiden Formen oder Prinzipien der Erkenntnis werden von Kant je einem äußeren (Raum) und einem inneren Sinn (Zeit) zugeordnet. Durch sie, so heißt es, würden wir einerseits Gegenstände als außer uns vorstellen (äußerer Sinn; Raum) und andererseits unseren inneren Zustand anschauen (innerer Sinn; Zeit) (B 37). - Die Hegelsche Rede vom Raum- und Zeitsein des Organismus bestätigt seine Fassung des Organismus als des ›existierenden Erkennens‹. (Für Kant sind Raum und Zeit reine Formen sinnlicher Erkenntnis.)
1 Ähnlich wie Kant den Raum dem äußeren, die Zeit dagegen dem inneren Sinn zuordnet.
1 Hegel spricht die Identität von Zeit und Blut in den Jeaner Manuskripten nie direkt aus; die sich im ›Zusatz‹ zum § 354 der späteren Enzyklopädie findende Bemer- kung: das Blut sei die »animalische Zeit« (TWA Bd. 9, S. 447) ist eine ungesicherte aber wohlmotivierte, wahrscheinlich vom Herausgeber der Naturphilosophie stammende Hinzufügung.
1 Die Fragmente werden nach der Ausgabe von W. Hamacher zitiert (G. W. F. Hegel, ›Der Geist des Christentums‹ Schriften 1796-1800, hg. v. W. Hamacher, Frankfurt a. M. Berlin Wien 1978; hier: S. 373-75). Die Theorie-Werkausgabe von E. Mol- denhauer und K. M. Michel (TWA) ist an entscheidender Stelle unvollständig.
1 Hegel bezieht sich auf: 1. Mose 9 und 3. Mose 17.
1 Daß das Blut des AT eine Figur ist, die im NT ihre Konkretion erhält, ist eine gängige Auffassung. Luther spricht in der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche (De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium [1520] ) über den Wortsinn von Testament. Dabei vergleicht er den Bundesschluß des AT mit demjenigen des NT so: »Daher mußte auch ein unvernünftiges Tier zum Vorbilde Christi geschlachtet werden, durch dessen Blut dasselbige Testament ward bestätiget, daß, welcher Art das Blut wäre, also auch das Testament wäre, welcher Art das Opfer, also auch die Verheißung« (in: Martin Luther, Auswahl aus seinen Schriften, hg. v. K. G. Steck, Berlin Darmstadt Wien 1961, S. 64).
2 Der Titel stammt von H. Nohl.
3 Dieser Ansatz, die Differenz von Vernunft oder Verstand zum positiven Glauben zu klären, machte ein Hauptinteresse Hegels zu jener Zeit aus. Es entstand, da er als Student der Theologie und Leser Kants zwischen die unbegreiflichen Dogmen des ersteren und die Vernunftpostulate des letzteren zu stehen kam.
2 Da der Vergleich davon ausgeht, daß die Schrift in ihrem Auffassen als Bedeutende vollständig sich aufheben lasse, wird von J. Derrida im Zusammenhangs seines Kommentars die Stimme namhaft gemacht (a. a. O., S. 97a). Voraussetzung der Hegelschen Auffassung sei nämlich die Vorstellung, daß die Stimme die Wahrheit der Schrift sei, bzw. als das Sich-Sprechen-Hören der Sprache im Lesen das Auffassen der Signifikanten begleite und diese vollständig aufzuheben imstande sei.
1 Für G. Fessard liegt mit dem Wort ›aufgelesen‹ ein »jeu de mots« mit dem Wort ›aufessen‹ vor (übersetzt: ›manger entièrement, engloutir, dévorer‹). Er folgt damit Hinweisen, die ihm H.-G. Gadamer mitgeteilt hat (G. Fessard, Dialogue théolo gique avec Hegel [1970] ; in: ders., Hegel. Le Christianisme et l’Histoire, Paris 1990, S. 77, Anm.).
2 G. Fessard, a. a. O., S. 77 - Inwieweit der Anfang der späteren Phänomenologie des Geistes unter dem Titel Die sinnliche Gewißheit oder das Diese und das Meinen das hier Übergangene nachholt, d. h. das schriftliche ›Diese‹ dort mit dem ›Dies‹ der Einsetzungsworte hier zu vergleichen ist, ist schwer zu klären. G. Fessard allerdings möchte das dortige geschrieben-bleibende ›Diese‹ auf das Sprechen Jesu angewandt wissen (ebd., S. 78). Vgl. außerdem: J.-L. Marion, Le Présent et le Don (1977); in: ders., Dieu sans l’Être, Paris 1982, S. 225-258. Marion führt die Hegelsche Kritik der katholischen Hostie auf deren metaphysischen Ausgangspunkt zurück: Da die Metaphysik durch einen Primat der Präsenz charakterisiert sei, und sie die Zeit im Ausgang vom menschlichen Bewußtsein der Zeit fasse, bleibe von ihr aus ein angemessenes Verständnis der Transsubstantiation unmöglich: »Les normes que la métaphysique impose à tout étant, à partir de sa conception du temps, s’exer- cent ainsi jusque sur la présence eucharastique, sans exception ni accommodement« (ebd., S. 240f.). Marion schlägt dagegen vor, die Eucharistie als ein »don du présent« zu fassen: »Le présent du don eucharistique ne se temporalise point à partir de l ’ ici et maintenant, mais comme mémorial (temporalisation à partir du passé), puis com- me annonce eschatologique (tenporalisation à partir du futur), enfin, et enfin seu- lement, comme quotidienneté et viatique (temporalisation à partir du présent). Au contraire du concept métaphysique du temps, le présent ne commande pas ici l’ana- lyse de la temporalité dans son ensemble, mais en résulte.« Und er schließt: »Ce renversement, qu’il nous reste à retracer, implique qu’on entendra la présence eucharistique moins à la façon d’une permanence disponible que comme une nouvelle manière d’advenue.« (ebd., S. 242)
1 Hegel bezieht sich auf Matth. 26.29
1 Die Manuskripte zu den Vorlesungen über die Religionsphilosophie sind abge- druckt: G. W. F. Hegel, Vorlesungen (Ausgewählte Nachschriften und Manuskrip- te), Bd. 3-5; hier: Bd. 5, Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil 3. Die vollendete Religion, hg. v. W. Jaeschke, Hamburg 1984, S. 88 (Das Manuskript wurde bereits für das erste Kolleg über Religionsphilosophie [1821] benutzt.)
1 Die Wichtigkeit, die das Abendmahl für Hegel schließlich erlangte, ist u.a. mit dem Hinweis auf jene prägnante Note zu belegen, darin er gegen die katholische Kritik an seiner lutheranischen Auffassung der Rolle des Abendmahls Stellung nimmt (Über eine Anklage wegen öffentlicher Verunglimpfung der kath. Religion; Schrei- ben vom 3. April 1826; in: TWA Bd. 11, S. 68-71); vgl. auch die Zurückweisung der scharfen Kritik Hegels an der Dinglichkeit der katholischen Hostie durch F.X. v. Baader (Über eine Äußerung Hegels über die Eucharistie; in: F. X. v. Baader, Werke Bd. VII, Leipzig 1854 (Nachdruck: Aalen 1963), S. 247-58). - Ebenfalls ist hinzu- weisen auf die Buchzusammenstellung von J. Hörisch: Brot und Wein (Frankfurt a. M. 1992); dort: Das Essen des Gottes: Hegels und Hölderlins Abendmahl (ebd., S. 187ff.).
2 Die Aphorismen des ›Wastebook‹ werden in die Jahre 1803-1806 datiert.
1 Man vergleiche den oben zitierten Aphorismus mit der Schlußpassage von Glauben und Wissen (1802). Dort wird die kritische Darstellung der Kantischen, Jacobischen und Fichteschen Philosophie mit einem Selbstappell an die wahre Philosophie beendet. Darin wird gefordert, daß der »reine Begriff« oder »die Unendlichkeit als der Abgrund des Nichts« sich dem Gefühl des Todes Gottes »als Moment der höchsten Idee« anzunehmen habe. Nur im Durchgang durch die »Härte der Gottlosigkeit«, das »absolute Leiden« und den »unendlichen Schmerz« sei die »höchste Totalität in ihrem ganzen Ernst und aus ihrem tiefsten Grunde« wiederherzustellen. Hier fällt auch das Wort vom »spekulativen Karfreitag« (TWA Bd. 2, S. 431-433).
1 Böhme schreibt bündig: »Der Sohn ist das Hertze in dem Vater« (Morgenröthe, Cap. 3, § 15) und spricht vom Sohn als dem »Kern in allen Kräften in dem gantzen Vater« (ebd.); vom ›Pulsieren‹ dieses Herzens ist nirgends die Rede. - Laut einer brieflichen Mitteilung Gerhard Wehrs, der in seiner Böhme-Biographie in unter- schiedlichen Zusammenhängen wiederholt vom Pulsieren spricht (G. Wehr, J. Böh- me, Reinbek b. Hamburg 1971, S. 54, 92, 97), drückt sich Böhme auch sonst nicht mit dieser Formulierung aus. »Jedoch«, so G.Wehr, »der Sache nach geht es um eben dies, d. h. er« - Böhme - »spricht von: ›Geburt‹, immer wieder von ›Qual‹, worunter er das ›Quallen‹ und Quellen versteht, eine unablässige Dynamik, die aus den Urgründen der Gottheit ebenso quillt wie im Mensch und Kosmos. Insofern kann man von einem unablässigen Pulsieren sprechen... usw.« (Brief v. 1. 2. 1992 an den Vf.).
1 Herausgegeben hat das Fragment erstmals K. Rosenkranz; in der Neuausgabe der Werke Hegels (Suhrkamp) findet es sich in Bd. 2, S. 536-39; vgl. auch die dortigen Bemerkungen zur Überlieferung.
1 Diese Vorlesung über die Gottesbeweise hielt Hegel im Jahre 1829 als Ergänzung zu seinem Logik-Kolleg. Das Manuskript, das sich dazu in Hegels Nachlass fand, war fast vollständig ausgearbeitet; vgl. dazu den Bericht in: TWA Bd. 17, S. 538f.
2 Suchte man Namen, die für die eine und die andere Partei stehen könnten, stiesse man wohl auf die Namen Schleiermacher und Kant. Während Schleiermacher, der Antipode Hegels in Berlin, die Religion wesentlich als Angelegenheit der subjek tiven Innerlichkeit ansetzt, ist Kant derjenige, der die Prüfung der Instrumente des Erkennens vor dem eigentlichen Erkennen fordert.
1 In der Vorrede zur zweiten Ausgabe der Enzyklopädie (1827) nennt Hegel das- selbe die »kontrakte, auf das Herz sich punktualisierende Religiosität« und er spricht davon, daß erst die »Zerknirschung und Zermürbung« dieser auf die subjektive Frömmigkeit reduzierten Religiösität den Zugang zur »objektiven Wahrheit« der Religion eröffne (TWA Bd. 8, S. 25).
1 Nocheinmal läßt sich an dieser Stelle auf einen Satz J. Böhmes hinweisen. Hegel selbst führt ihn sowohl in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Phi- losophie‹ (TWA Bd. 20, S. 114f.) als auch in den Vorlesungen über die Philosophie der Religion (TWA Bd. 17, S. 240) an. Thema des Satzes ist die Geburt der ›heiligen Dreifaltigkeit‹ aus dem Herzen; im Original lautet er: »Also nahe ist dir Gott, daß die Geburt der H. Dreyfaltigkeit auch in deinem Hertzen geschicht; es werden alle 3 Personen in deinem Hertzen geboren, Gott Vater, Sohn, H. Geist.« (Morgenröthe, Kap. 10, §58) Die Aufgabe, die sich Hegel gestellt hat - den Men- schen vom Endlichen zum Unendlichen, zu Gott zu erheben -, wird von Böhme ähnlich aufgefaßt: auch im Satz Böhmes wird von der Erhebung bzw. der Geburt des Geistes aus dem je einzelnen - und doch allgemeinen - Herzen gesprochen (Gott ist dir nahe, die drei Personen werden aus deinem Herzen geboren).
1 Es blieb noch unerwähnt, daß Hegel in einer Anmerkung in der Rechtsphiloso- phie (1821) auch das »eigentlich[] Dialektische[]« in einem Nachsatz im »bewe- genden Puls[] der spekulativen Betrachtung« findet (Anm. zu § 140; TWA Bd. 7, S. 277)
1 vgl. dazu die Vorrede der Phänomenologie des Geistes (TWA Bd. 3, S. 22f.)
1 Wenn Hegel fortfährt und sagt, daß in dem »Gerichte jener Bewegung« die einzel- nen Gestalten des Geistes nicht bestünden, so heißt das nicht, daß unter jenem Wahren nicht doch der Geist zu verstehen ist -, ein Geist allerdings, der die ein zelnen Gestalten nicht mehr zu unterscheiden braucht, da er sie erinnernd aufbe wahrt und so souverän über deren Differenzen hinwegsehen kann.
2 Die Vorrede wurde von Hegel nach Abschluß der Phänomenologie geschrieben und blickt in einzelnen Abschnitten (so etwa: TWA Bd. 3, S. 47) bereits auf die Wissenschaft der Logik vor.
3 Die letzten Worte der Phänomenologie - jene allseits bekannten Worte, die Hegel einem Schillerschen Gedicht (Die Freundschaft, V. 59f.) entnommen und leicht verändert hat - lauten: » - aus dem Kelche dieses Geisterreiches / schäumt ihm seine Unendlichkeit.« Diese Worte ziehen ebenfalls den Schluß aus dem von uns oben so genannten Syllogismos der Transsubstantiation. In diesem Zusammenhang ist auch auf den Abschnitt zur Religion in der Phäno- menologie hinzuweisen. Die dortige Darstellung der Religionen kann vor dem Hintergrund einer systematischen Verknüpfung der beiden Bewegungen der Ent- äußerung (Opfer) und der Assimilation gelesen werden. Die Aufstufung der Reli- gionen geschieht dabei so, daß eine jeweils vorhergehende Religion das in ihr unter der Form der Entäußerung oder des Opfers Erscheinende der ihr nachfolgenden zur Assimilation darbietet. Besonders deutlich wird diese Entwicklungssystematik im Übergang von der Religion des Lichtwesens zur griechischen, und der griechi- schen zur christlichen Religion. So heißt es im Abschnitt zur Religion des leben- digen Kunstwerks - in einem bezeichnenden Satz, der in gewisser Weise versucht, alle drei genannten Stufen zu verknüpfen - »Noch hat sich ihm also« - dem Bewußt- sein auf dieser Stufe - »der Geist als selbstbewußter Geist nicht geopfert, und das Mysterium des Brotes und Weins [d. h. hier: der Ceres und des Bacchus] ist noch nicht Mysterium des Fleisches und Blutes [d. h. des Sohnes Gottes]« (TWA Bd. 3, S. 527). Man erkennt schließlich, daß für Hegel die Transsubstantiationsbewegung Schließlich sei auf die italienische Übersetzung der Phänomenologie durch E. de Negri aufmerksam gemacht. Dort findet sich die Stelle gegen Ende der PhdG, darin Hegel von der Bewegung des Erkennens spricht, und sie in der »Verwandlung« des »Ansichs in das Fürsichs, der Substanz in das Subjekt« ausmacht (TWA Bd. 3, S. 585), so übersetzt: »...il conoscere, - la transustanziazione di quell’ in-sé nel per-sé della sostanza nel soggetto,...« (G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, tr. di Enrico de Negri, Scandicci/Firenze 1992 [10. Aufl.], S. 298). [Zusatz. Hegel hat später in einem Brief an Goethe, allerdings ohne direkt auf die PhdG Bezug zu nehmen, von seinem »Glauben[] an die Transsubstantiation des Inneren und Äußern, des Gedankens in das Phänomen und des Phänomens in den Gedanken« gesprochen. Der Brief vom 2. August 1821 ist ein Dankesschreiben an Goethe, der ihm zuvor ein Trinkglas mit dem eigenhändig geschriebenen Spruch: »Dem Absoluten empfiehlt sich schönstens zu freundlicher Aufnahme das Urphä- nomen« zukommen ließ. In Hegels Antwortschreiben - das, nach Rosenkranz, im Ton einer »humoristische Feierlichkeit« gehalten ist (K. Rosenkranz, G. W. F. Hegels Leben, Berlin 1844 [Nachdruck: Darmstadt 1977], S. 339) - wird außerdem auf den Wein als einer »mächtigen Stütze der Naturphilosophie« - denn dieser dokumentiere, »daß Geist in der Natur« sei - und auf das den Becher erfüllende Blut - »aus dem sich die bunten [elysischen] Schatten ... zur Kraft und Gesundheit herauftrinken« - verwiesen. Obwohl die Assoziationen Hegels und der Ton des Schreibens auf einen gewissen Unernst hindeuten, dürfte die darin angezogene Abfolge von Wein, Blut und Transsubstantiation, bzw. die Deutung der Transsub- stantiation als einer Wandlung des Inneren in das Äußere - und umgekehrt -, »des Gedankens in das Phänomen und des Phänomens in den Gedanken« auf die in der Phänomenologie des Geistes stattfindende Bewegung zu beziehen sein. Darauf jedenfalls weist auch die an die Wendung vom »bacchantischen Taumel« aus der Vorrede der PhdG erinnernde Nennung des Bacchus im selben Brief.]
1 Hier ist jener bekannte Satz aus der Einleitung zur Logik anzuführen, darin Hegel von der Logik als dem »System der reinen Vernunft« und dem »Reich des reinen Gedankens« spricht, und anfügt, man könne sich deswegen ausdrücken, daß deren Inhalt »die Darstellung Gottes« sei, »wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist« (a. a. O., S. 17).
2 So Hegels Selbstanzeige. Sie ist abgedruckt in: TWA Bd. , S. 593 (Erscheinungsort und -datum sind: Intelligenzblatt der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung, 28. Oktober 1807).
1 Das erste ›Diese‹ im Ablauf des Textes ist bezeichnenderweise ein ›Dieses‹, das die sinnliche Gewißheit designiert: »Diese Gewißheit aber...« lautet der Anfang eines Satzes im zweiten Abschnitt des Kapitels (TWA Bd. 3, S. 82, Z. 17).
2 vgl. dazu den ersten Abschnitt des Kapitels
1 Darin liegt die Bestätigung unseres obigen Hinweises auf die eine einzelne sinnliche Gegenwärtigkeit repräsentierende sinnliche Gewißheit.
1 Von der Dauer als dem Horizont der Auslegung des reinen Seins der sinnlichen Gewißheit wird in der Phänomenologie nicht explizit gesprochen. Doch ist auf Ausführungen im dritten Jenaer Systementwurf - der zeitgleich oder kurz vor der PhdG entstanden ist - hinzuweisen. Hegel legt dort (GW Bd. 8, S. 14ff.) exakt dieselben Attribute, die er in der Phänomenologie der aufgeschriebenen Wahr- heit beilegt, der »Substanz der Dauer« bei. Ebenso wie im Aufgeschriebensein ist in der Dauer das einzelne Hier und Jetzt negiert. Und ebenso wie dort das Schrift- liche die Eigenschaft hat, das Allgemeine als die Wahrheit des Einzelnen zu erwei- sen, ist in der »einfache[n] sichselbstgleiche[n] dauernde[n] Substanz« der Punkt des Raums »wie er in Wahrheit« ist: »nemlich als ein Allgemeines, als ein Hier ... überhaupt« gesetzt -, und als solches ist das Hier »zugleich Itzt, denn es ist der Punkt der Dauer « (ebd., S. 15).
1 vgl. dazu aus der ersten Anmerkung Hegels zum Anfang: »Insofern der Satz: Sein und Nichts ist dasselbe, die Identität dieser Bestimmungen ausspricht, aber in der Tat sie ebenso unterschieden enthält, widerspricht er sich in sich selbst und löst sich auf. Es ist also hier ein Satz gesetzt, der näher betrachtet die Bewegung hat, durch sich selbst zu verschwinden.« (Das Sein [1812], S. 54)
2 Die Randbemerkung zur Zeit lautet vollständig: » springende Punkt - Reicher als Feuer, Seele Bewegung mit seiner dem Raume angehörenden Macht der Natur; Selbst das Zweyte; im Geiste das Erste.«
1 Zwischen der hier genannten Gegenwart und der oben, im Zusammenhang mit der sinnlichen Gewißheit angesetzten Gegenwart liegt der Gang der Phänomenolo- gie. In ihr wird der in ihrem Anfang angesetzte Horizont des reinen Seins, die Dauer, in sich reflektiert. »Die Dauer ist also von der Ewigkeit darin unterschieden, daß sie nur relatives Aufheben der Zeit ist; die Ewigkeit ist aber unendliche, d. h. nicht relative, sondern in sich reflektierte Dauer.« (TWA Bd. 9, S. 50 [Enz. II, §
1 Die entscheidende Passage lautet: »Die Zukunft ist gegen das Itzt [,] das seyende Aufheben des Seyns [,] bestimmt als das nichtseyende Aufheben; diss Nichtseyn sich unmittelbar aufhebend ist zwar selbst seyend, und Itzt, aber sein Begriff ist ein anderer, als der [des] eigentlichen unmittelbaren Itzt; es ist Itzt, welches das negi- rende Itzt des unmittelbaren aufgehoben hat. Als entgegengesetzt diesen andern Dimensionen ist diese die Vergangenheit, - ... wir halten sie außer den andern Di- mensionen. Um der Unmittelbarkeit willen aber, sowohl negativ gegen das negie- rende Itzt zu seyn, oder die Zukunft zur Vergangenheit zu machen, oder in Bezie- hung auf sich selbst, als negirend sich aufzuheben, ist [sie] selbst Itzt; um der Unt- heilbarkeit des Itzt willen, sind alle drey ein und dasselbe Itzt. - Die Vergangenheit ist die vollendete Zeit, ...« (ebd., S. 12). Erkennbar ist, daß die Vergangenheit hier aus der vorher bestimmten Differenz von Gegenwart und Zukunft gewonnen wird. Wie Hegel allerdings zum Ansatz eines zweiten - neben dem »eigentlichen, unmit- telbaren Itzt« - gleichsam über die Dialektik von Gegenwart und Zukunft in die Vergangenheit transportierten Itzt gelangt, kann erst durch den von Hegel selbst angedeuteten (hier nicht zitierten) Bezug auf die Verhältnisse im Räumlichen, ge- nauer auf die dort vorkommende »Negation der Negation« geklärt werden.
1 Von dem auf den absoluten Anfang folgenden heißt es: »Der Fortgang von dem, was den Anfang macht, ist ferner nur eine weitere Bestimmung desselben, so daß dies allem Folgenden zugrunde liegen bleibt und nicht daraus verschwindet. Das Fortgehen besteht nicht darin, daß ein Anderes abgeleitet oder daß in ein wahrhaft Anderes übergegangen würde; - und insofern dieses Übergehen vorkommt, so hebt es sich ebensosehr wieder auf. So ist der Anfang der Philosophie, die in allen folgenden Entwicklungen gegenwärtige und sich erhaltende Grundlage, der seinen weiteren Bestimmungen durchaus immanente Begriff«. (Das Sein [1812], S. 37)
2 In der Enzyklopädie heißen die ursprünglich in zwei Bänden erschienen drei Teile der Logik: Abteilungen.
3 J. Splett, Die Trinitätslehre G. W. F. Hegels, Freiburg i.Br./München 1965, S. 78.
1 Auch die Deutung der Begriffslogik - der Lehre vom Begriff - als »offenbarungs- theologisch begründeter Kommunikationstheorie« ist vor diesem Hintergrund nur allzu verständlich (M. Theunissen, Sein und Schein, Frankfurt a. M. 1980, S. 50). Theunissen kommt dabei recht nahe an unsere Darstellung heran, da er schließlich in der Theorie des spekulativen Satzes - dort geht das »Subjekt in das Prädikat und das Prädikat in das Subjekt über« - das »einseitige Herrschaftsverhältnis« in die »Gemeinschaft wechselseitiger Teilnahme« aufgelöst sieht (ebd., S. 60). Es ist daran zu erinnern, daß die am Sakrament des Abendmahls Teilnehmenden Kommuni- kanten heißen.
1 A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen, Erster Band, Leipzig 1870 (3. Aufl.), S. 38
2 In einer bekannten Passage der Einleitung zur Logik heißt es: » Anaxagoras wird als derjenige gepriesen, der zuerst den Gedanken ausgesprochen habe, daß der Nus, der Gedanke, das Prinzip der Welt, daß das Wesen der Welt als der Gedanke zu bestimmen ist. Er hat damit den Grund zu einer Intellektualansicht der Welt gelegt, deren reine Gestalt die Logik sein muß« (Das Sein [1812], S. 17). Es ist nicht anzu- nehmen, daß die Hegelsche Gebrauchsweise des Ausdrucks ›no}V‹ oder ›Nus‹ derart vom Zufall diktiert wird, daß das hier Gesagte und die angesetzte Nähe des Blutes und des no}V in der Naturphilosophie gar nichts miteinander zu tun hätten. Unserer Deutung jedenfalls gelingt es, einen Zusammenhang aufzuweisen.
1 Obwohl Trendelenburg gegen Ende des ersten Teils seiner Untersuchungen selbst auf das mit der dialektischen Bewegung gegebene Phänomen des Sprunges (a. a. O., S. 263) und schließlich auch auf den mit dem Punkt assoziierbaren Übergang von der Ruhe zur Bewegung stößt (ebd., S. 276), verknüpft er das Gefundene nicht mit einer Deutung des Anfangs der Hegelschen Logik.
2 Nachtrag: Wir sind übrigens nicht die ersten, die die Bewegung des Umschlags von Sein in Nichts - und umgekehrt - als Pulsation deuten. Bereits J.-L. Nancy hat, allerdings nur im Vorbeigehen und ohne seiner Bemerkung mehr als assoziativen Charakter zuzugestehen, die Bewegung »être-néant-devenir« als eine »pulsation infinie« bezeichnet (in: J.-L. Nancy, L’Amour en Éclats; in: Une pensée finie, Paris 1990, S. 234; [Wiederabdruck aus: Alea, Nr. 7, 1986]). - Auch der Gebrauch des Ausdrucks ›springender Punkt‹ im Zusammenhang einer Deutung der Logik Hegels ist nicht originär. Bereits K. Werder hat in seiner Einführung in die Hegel- sche Lehre vom Sein dasselbe getan. In seinem im Jahre 1841 veröffentlichten Buch: Commentar und Ergänzung zu Hegels Wissenschaft der Logik (Berlin [Nachdruck: Hildesheim 1977]) heißt es S. 40f.: »Im Nichts bricht das Seyn das Schweigen in sich von sich selber. Nichts ist die Besinnung des Seins, das Aufgehn seines Sinnes in ihm; sein Blick in sich; der springende Punkt seiner Ursprünglichkeit. - Im Nichts enthüllt sich der heilige Doppelsinn der Leerheit des Seyns ... usw.« - Von beiden Autoren unterscheidet sich unsere Studie darin, daß sie den springenden Punkt bzw. das Pulsieren nicht assoziativ auf den Anfang der Logik überträgt, sondern einen in der Hegelschen Philosophie selbst liegenden Grund auszumachen ver- sucht, weshalb diese Ü bertragungen - d. h. die Übertragungen der beiden genann- ten Autoren - möglich und berechtigt sind.
1 Die einzige, mir bekannte Studie zum springenden Punkt stammt von G. Wohlfart (Der Punkt, Freiburg München 1986). Der Untertitel des Buches lautet: Ästhetische Meditationen. Der anregende Text Wohlfarts erwähnt aber mit keinem Wort die Herkunft des Ausdrucks aus der Physiologie. Auch wird der Hegelsche Gebrauch des Ausdrucks mit keinem Wort erwähnt (obwohl Wohlfart ein Kenner der Phi- losophie Hegels ist und er im Vorwort davon spricht, daß ihn das ›Hervorleuch- tendste‹ - eben der springende Punkt - schon zur Zeit der Abfassung seiner Habi- litationsschrift über Hegels Begriff der Spekulation beschäftigte [Der spekulative Satz, Berlin New York 1981]). Vgl. aber doch die Anmerkung S. 60, dort heißt es: »Der ästhetisch springende Punkt ist im Augenblick der Kopulation, in dem das ›Subjekt‹ das ›Objekt‹ ist. Der ästhetisch springende Punkt ist gleichsam ein ›spe- kulativer Satz‹ in der stillen Sprache eines Blicks.« Für Wohlfart liegt ein den sprin- genden Punkt Auszeichnendes in seinem Augenblicks charakter, - ebenso für uns.
1 Bemerkungen zu den Quellen: Keines der Hegelschen Manuskripte, die noch dem ersten Herausgeber (H. G. Hotho) der Vorlesungen über die Ästhetik vorlagen, ist uns heute bekannt. - Einer Auslegung der Hegelschen Ästhetik stehen aber zur Verfügung: 1. Innerhalb der ›Werke‹ erschienen die Vorlesungen über die Ästhetik erstmals im Jahre 1835 in drei Bänden (X, 1-3), herausgegeben von H. G. Hotho. Eine zweite, veränderte Auflage davon ließ Hotho 1842 erscheinen. Ihm lagen noch verschie- dene handschriftliche Materialien vor. Hotho erwähnt ein Heft aus Heidelberg (datiert: 1818); weiter ein im Oktober 1820 begonnenes Manuskript, darin verschie- dene Blätter und Bogen eingeschoben wurden. »Der Zustand dieser Manuskripte«, so Hotho, »ist von der mannigfaltigsten Art; die Einleitungen beginnen mit einer fast durchgängigen stilistischen Ausführung, und auch in dem weiteren Verlauf zeigt sich in einzelnen Abschnitten eine ähnliche Vollständigkeit; der übrige Teil dagegen ist entweder in ganz kurzen unzusammenhängenden Sätzen, oder meist nur durch einzelne zerstreute Wörter angedeutet, die nur durch Vergleichung der am sorgsamsten nachgeschriebenen Hefte können verständlich werden« (Werke X, 1, S. VIIf.). In den beiden Hotho-Ausgaben sind Hegelsche Originale und Nach- schriften von Hörern unkenntlich durcheinandergemischt. Das ist sehr mißlich. Die Kenntlichmachung des Originaltextes hätte zur editorischen Pflicht gehört. - Zitiert wird die Hotho-Ausgabe nach der innerhalb der Theorie-Werkausgabe v. E. Moldenhauer und K. M. Michel wiederabgedruckten zweiten Auflage (TWA Bd. 13-15). 2. Es war G. Lasson, der auf diesen Mißstand zu reagieren versucht hat. Von ihm liegt mit dem Band Die Idee und das Ideal (erschienen als Bd. Xa in den Sämtlichen Werken, Hamburg 1931) der Versuch vor, unter Rückgriff auf noch erhaltene Nachschriften der Hegelschen Vorlesung den Hotho’schen Text zu revidieren. Da Hotho von Eingriffen in die Nachschriften spricht, Lasson es aber für notwendig hält »die Sprache Hegels in ihrer ursprünglichen Form und nicht nach Hothos Geschmack verschönt« (ebd., S. XI) lesen zu können, ist diese Neuausgabe nötig geworden. Darin sind, wie Lasson betont, die beiden Vorlesungen der Jahre 1823 und 1826 »zweifelsfrei rekonstruiert« (ebd., S. X). Lassons Unternehmen hat nur einen ersten Band gezeitigt; seine Rekonstruktion bricht vor dem Übergang zu den besonderen Formen des Kunstschönen ab. 3. Schließlich ist eine reinschriftliche, gebundene Handschrift zu erwähnen, die ich selbst im Deutschen Literaturarchiv zu Marbach eingesehen habe. Sie trägt den Titel: G. W. F. Hegel, Die Ästhetik oder Philosophie der Kunst, Vorlesungsnach- schrift (Kromayer, 1823 u. 1826). Da die aus diesem Band exzerpierten Passagen von den beiden erwähnten, gedruckten Ausgaben abweichen, ist auch diese Nach- schrift zur Rekonstruktion der Rede Hegels heranzuziehen.
2 Lasson, Die Idee, S. 2 (vgl. auch: [Hotho] TWA Bd. 13, S. 15) - In diesem Zusam- menhang fällt auch jener bekannte Satz Hegels, der seiner Auffassung von der un- bedingten Vorherrschaft des Geistigen vor dem Natürlichen Ausdruck gibt. Dieser Satz ist unter den heute gegebenen Umständen nicht nur zu bezweifeln, sondern aktiv zu negieren. Er lautet: »Der schlechteste Einfall, der durch den Kopf eines Menschen geht ist etwas Besseres, ist höher als die größte Produktion der Natur, denn er ist ein Geistiges, und das Geistige ist höher als das Natürliche« (Die Idee, S. 2). Eine ähnliche Arroganz gegenüber dem natürlich Seienden drücken die - ebenfalls bekannten - Sätze der Naturphilosophie aus, darin von der »Ohnmacht der Natur« gegenüber dem Begriff die Rede ist (so: Enz. II, § 250; TWA Bd. 9, S. 34f.). Die Aussagen Hegels mögen eine Reaktion auf einseitige Abwertungen des Menschlich-Künstlerischen gegenüber dem Natürlichen sein (in diese Richtung weisen Sätze des § 248 der Enz.), in ihrer platten Pauschalität sind sie dennoch unakzeptabel. Als Sätze, die Systemkonsequenzen formulieren, deuten sie auf den ›absoluten Anthropomorphismus‹ des Hegelschen Denkens. Während in der Nachfolge Hegels L. Feuerbach diesen Ansatz noch weitertreibt, ist es u.a. das wesentliche Verdienst M. Heideggers, den anthropozentrischen Zug des neuzeit- lichen Denkens (die Metaphysiken des Willens) destruiert und verlassen zu haben.
1 Wie wir sehen werden, widerlegt dieser Rückgriff auf das Natürliche das in der vorhergehenden Anm. Gesagte nicht. - Der Grund, weshalb Hegel die Bestimmung der Aufgabe der Kunst im Ausgang von Verhältnissen im Natürlichen vornimmt, liegt in seiner philosophischen Gesamtsystematik begründet: Da diese in ihrem mittleren Teil die Idee in ihrer Äußerlichkeit (das Natürliche) darzustellen hat, die Kunst als angehörend dem absoluten Geist aber von der ihr übergeordneten Phi- losophie ihre Aufgabe zugesprochen erhält, muß Hegel versuchen, von jenem Systemteil her ihre Aufgabe zu bestimmen, der, wie sie, auf das Anschaubare, Äußerliche bezogen ist.
2 Das ist die Hotho’sche Version. Sie verdichtet die Analogie in einen Satz. In der Ausgabe von Lasson lautet die Stelle: »Wir sagten schon früher, daß im Gegensatze gegen den tierischen Körper im menschlichen überall das pulsierende Herz sich zeige. Auf dieselbe Weise kann von der Kunst gesagt werden, daß sie das Erschei- nende an allen Punkten der Oberfläche zum Auge zu erheben habe, das der Sitz
der Seele ist, den Geist erscheinen läßt« (Die Idee, S. 220). - Ähnlich knüpft auch der Text der Handschrift Kromayer an bereits Gesagtes an: »Wir haben bemerkt, daß der menschliche Körper in jedem Punkt empfindlich ist; eben so kann von der Kunst gesagt werden, daß sie die Gestalt, das Erscheinende an jedem Punkt gleich- sam zum Auge zu machen habe, das die Seele anzeigt, den erscheinenden Geist« (Kromayer, S. 112). - Obwohl in diesen Zitaten verschieden Varianten der Hegel- schen Rede vorliegen, ist die darin formulierte Analogie erkennbar dieselbe. Die beiden hier zitierten Passagen lassen sogar noch deutlicher erkennen, daß Hegel fordert, die Kunst hätte in ihrem Feld zu realisieren, was bereits im Natürlichen in Anfängen zu beobachten ist. [Es ließe sich zunächst noch kritisch vermuten, die Nennung des ›pulsierenden Herzens‹ gehe auf Hotho zurück, denn auch Lasson verwendete die Nachschrift Hothos zur Rekonstruktion seines Textes. Geht man in der Kromayer-Handschrift aber weiter zurück, zerstreuen sich die Zweifel. Denn was ist in den ›empfindlichen Punkten‹ mitgedacht? Antwort: das pulsierende Herz. Auf der Seite 107 der Handschrift heißt es nämlich: »Der menschliche Körper hat höhere Vollkommenheit [als der tierische] und in ihm ist das Fühlende überall gegenwärtig, die Erscheinung des Lebens tritt allenthalben hervor und in der Zir- kulation des Blutes bis in die äußersten durchscheinenden Punkte zeigt sich die Allgegenwart des Herzens.« Und noch deutlicher: »Beim Tier ist alles verdeckt was zur Organisation gehört; beim Menschen erscheint das pulsierende Herz und das Nervensystem überall an der Oberfläche«.]
1 so: J. Simmen, Kunst-Ideal oder Augenschein, Berlin 1980, S. 24. - Simmen zitiert den ganzen Abschnitt, in dessen Mitte sich die Analogie befindet; da die Analogie eine nochmalige Verdichtung ihres Umfeldes vornimmt, läßt sich seine Rede vom ›Blitzlichthaften‹ erst recht auf sie beziehen.
1 Die Idee und das Leben sind ebenso Titel der Logik. In ihrem letzten Teil, der Lehre vom Begriff bilden sie zusammen den Ausgangspunkt des dritten und letz- ten, in der ›absoluten Idee‹ endigenden Abschnitts. Die Idee und das Leben, begrifflich vorgedacht, werden hier - in der Ästhetik - in ihrer erscheinenden Äußerlichkeit thematisch.
1 Die entsprechende Stelle lautet bei Lasson: »Es ist absolut wesentlich, die Unter- schiede der Seele vom Leibe zu erkennen, aber dies ist nur eine Seite. Die andere Seite ist ihre Identität, und zwar nicht als zweier Zusammengebrachter, nicht nur ihr Zusammenhang, daß die Seele im Leibe ist, sondern so, daß die Gliederung des Leiblichen nichts ist als die Äußerungen der Seele oder die Explikation der Mo- mente des Begriffes selbst; der Begriff macht, bestimmt sich seine Glieder und setzt selbst seine Bestimmungen ins äußerliche Dasein.« (Die Idee, S. 179)
2 in: [Lasson] Die Idee, S. 170; vgl. auch: [Hotho] TWA Bd. 13, S. 158f.
3 in: [Hotho] TWA Bd. 13, S. 161; dazu: [Lasson] Die Idee, S. 171
4 [Lasson], ebd.
5 so: [Hotho], S. 163; bei Lasson heißt es dazu: »Das Lebendige, die Subjektivität ist eben idealistisch, und die idealistische Philosophie ist nichts anderes, als was das Leben als Faktum ist.« (Die Idee, S. 172)
6 vgl. [Hotho], S. 162; und: [Lasson], S. 172. - Damit ist der Abschnitt über den Widerspruch im zweiten Buch der objektiven Logik zu vergleichen (TWA Bd. 6, S. 64ff.). Das folgende kann als Kommentar, insbesondere zur dritten Anm. (S. 74ff.) des dort Ausgeführten gelten.
1 in: [Hotho], S. 162; vgl. [Lasson], S. 172
2 in: [Hotho], S. 163; vgl. [Lasson], S. 172f.
3 Analoge Ausführungen finden sich zu Beginn der Naturphilosophie, d. h. des zwei- ten Teils der Enzyklopädie. In einem Zusatz zu § 248 heißt es: »Das Affirmative in der Natur ist das Durchscheinen des Begriffs« (TWA Bd. 9, S. 31) - dies, nachdem Hegel festgestellt hat, daß die Äußerlichkeit der Natur als das Negative der Idee zu gelten hat (§ 247).
4 so: [Hotho], S. 164; vgl. [Lasson], S. 174
5 so: [Hotho], S. 164; oder: [Lasson], S. 174. [Zusatz. Ich weise darauf hin, daß ein späterer, von Hegel unabhängiger Ansatz, zu einem vergleichbaren Begriff des Er- scheinens gelangt ist. In seinem im Jahre 1928 zum erstenmal erschienen Buch Die Stufen des Organischen und der Mensch bringt H. Plessner, ausgehend von der Cartesianischen Unterscheidung »allen Seins in res extensa und res cogitans« (S. 79; zitiert wird nach: H. Plessner, Ges. Schriften Bd. IV, Frankfurt a. M. 1981), einen wichtigen Abschnitt unter den Titel: Die Zurückführung der Erscheinung auf die Innerlichkeit. Darin - und in dem darauf folgenden Abschnitt - kommt es zu For- mulierungen, die an Hegel erinnern. Auch für Plessner liegt das Erscheinen eines Dings (bzw. eines Organismus) im Zurückzeigen seiner (ausgedehnten) Oberfläche auf ein (unausgedehntes) Innerliches. »Im Aussehen stellt sich der Körper qualitativ dar. Seine substantielle Kernigkeit strahlt in den durch und durch qualitativen Ei- genschaften an die Oberfläche, die an ihm selbst bleibend mit der res cogitans in Gegenstellung (auf unbegreifliche Weise) zusammenhängt.« (S. 85) Der von Pless- ner im Erscheinen angesetzte Rückbezug bleibt allerdings verstanden als der Rück- bezug »auf mich als Subjekt« (»Erscheinen aber heißt Anwesendsein des Dings kraft seiner Bezogenheit auf mich als Subjekt.« [S. 87]). Wie die weiteren Ausfüh- rungen aber zeigen, gesteht Plessner dem organischen Körper schließlich doch »›in- nere‹ Seinscharaktere« zu. Analog zu Hegel »rücken« auch für ihn beim Organi- schen »Raumform und Zeitform«»aus der Stellung bedingender äußerer Formen in die Stellung bedingter ›innerer‹ Seinscharaktere.« (S. 244) »Organischer Körper ist nicht bloß wie jeder physische Körper ein vierdimensionales Gebilde, sondern in seiner Wesenseigenschaft, Raum und Zeit positional zu behaupten, in ihm selber absolute Union von Raum und Zeit.« (S. 245) - Daß unser Vergleich zurecht besteht, belegt Plessner selbst am Ende seines für die zweite Auflage (1966) geschriebenen Vorworts. Dort sagt er, daß er sich auf Hegel hätte berufen können, wenn ihm die entsprechenden Stellen bekannt gewesen wären. Und er fügt an: »Konvergenzen beruhen nicht immer auf Einfluss. Es wird in der Welt mehr gedacht, als man denkt.« (S. 35)]
1 Die Edition von Lasson führt zum Erscheinen weiter aus: »Das Innere also scheint am Äußeren; so gehört zur Idee die Realität ebenso wie der Begriff. Stellt man sich den Geist vor als nicht erscheinend, so ist er unwahr. Dem Inneren ist die Erscheinung notwendig; was nicht erscheint, ist ein bloßes Abstraktum. Sich Gott vorzu- stellen als nichterscheinend, das ist nur abstrakt, das ist kein wahrhafter Gott. Das Wesen muß erscheinen ... usf.« (S. 174). Ist die Idee als Einheit von Begriff und Realität einmal angenommen, so ist damit zugleich ihr Erscheinen verlangt. Der als Einheit von Innerem und Äußerem erscheinende Organismus gibt das Verlangte aber nur erst auf einer niederen Stufe, erst mit dem Erscheinen Gottes ist das totale oder absolute Erscheinen erreicht.
1 in: [Hotho] S. 194. - Bei Lasson ist die ganze Passage in der Unmittelbarkeit des hörenden Niederschreibens festgehalten: »Vergleichen wir damit« - mit der ani- malischen Organisation - »die menschliche Lebendigkeit, so steht sie darin höher, daß der Mensch dies fühlende Eins zu sein, überall vergegenwärtigt. Denn die Pul- sation des Blutes ist an der ganzen Oberfläche; das Herz, das Hirn ist gleichsam allgegenwärtig. Der menschliche Körper zeigt sich schon in seiner Erscheinung als die Lebendigkeit; das Blut scheint überall durch, die Haut ist überall empfindend, während beim Tier die Oberfläche vegetabilischer Natur ist. Das Gerüst der leben- digen Organisation ist beim Tiere verdeckt durch eine niedrigere Stufe des Orga- nismus. Beim Menschen ist das pulsierende Herz überall erscheinend so wie auch das Nervensystem« (Die Idee, S. 209f.). Vgl. auch die bereits weiter oben zitierte Kromayer-Handschrift.
1 Während bei Hotho nur von der Gestalt, bei Lasson nur vom Erscheinenden die Rede ist, nennt die Kromayer-Handschrift, hintereinander gestellt, beide: die Kunst hat »die Gestalt, das Erscheinende an jedem Punkt gleichsam zum Auge zu machen« (S. 112) - lautet ihre Version des von Hegel Gesagten.
2 Das folgende kann sich, da das Editionsunternehmen Lassons abgebrochen wurde und mir die weiteren Bände der Kromayer-Handschrift nicht zugänglich waren, nur noch auf den Text Hothos stützen (hier: TWA Bd. 14, S. 355).
1 Hegel bezieht sich in seinen Ausführungen zur griechischen Skulptur vornehmlich auf J. J. Winckelmanns Geschichte der Kunst des Altertums (1764) - dieser allein hätte das Wesentliche zum griechischen Skulpturideal »mit ebensoviel Begeisterung seiner reproduktiven Anschauung als mit Verstand und Besonnenheit« gesagt (ebd., S. 378). Die Ausführungen zur Augenbildung an der Skulptur finden sich im vierten Kapitel des ersten Teils des Werks: Von der Kunst unter den Griechen. Bemerkens- wert ist, daß für Winckelmann es keineswegs »ausgemacht« ist, daß der Augenstern an den antiken Statuen zu fehlen habe. Vielmehr spricht er geradezu vom »offenen und erhabenen Blick« der griechischen Statuen. Der letzte Satz zum Abschnitt über die Augen lautet: »Viele Köpfe in Erz haben ausgehölte und von anderer Materie eingesetzte Augen: die Pallas des Phidias, deren Kopf von Elfenbein war, hatte den Stern im Auge von Stein.« (J. J. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums, Wien 1934 [Nachdruck: Darmstadt 1982], S. 175f.)
1 »Das Skulpturwerk hat nicht eine Innerlichkeit als solche, welche sich nun auch für sich als dieses Ideelle des Blicks, den anderen Körperteilen gegenüber, kundge- ben und in den Gegensatz von Auge und Leib treten dürfte; sondern was das In dividuum als inneres, geistiges ist, bleibt ganz in der Totalität der Gestalt ergossen, welche nur der betrachtende Geist, der Beschauer, zusammenfaßt.« (ebd., S. 390)
2 In der Übersicht zu seiner Ästhetik findet Hegel den folgenden, konzentrierten Ausdruck zur Abfolge der gesamten Philosophie der Kunst: »Hat nun die Archi- tektur den Tempel aufgeführt [symbolische Kunstform] und die Hand der Skulptur die Bildsäule des Gottes hineingestellt [klassische Kunstform] so steht diesem sinn- lich gegenwärtigen Gott in den weiten Hallen seines Hauses drittens die Gemeinde gegenüber [romantische Kunstformen]« ([Hotho] TWA Bd. 13, S. 119). In der unbereinigten Lasson’schen Fassung lautet die Stufung: »Die Architektur hat der Kunst den Tempel erbaut, der Hand der Skulptur ist der Gott entstiegen, und gegen ihn über steht jetzt in den weiten Räumen seines Hauses die Gemeinde« (Die Idee, S. 129).
1 Bereits in den Ausführungen zum Naturschönen hat Hegel die »Fleisch- und Ner- venfarbe des Teints« das »Kreuz für die Künstler« genannt ([Hotho] TWA Bd. 13, S. 194; [Lasson] Die Idee, S. 210). - Eine ausführliche geistes- bzw. kunstgeschicht- liche Situierung der Hegelschen Auffassung der Farbe in der Malerei gibt: B. Col- lenberg, Hegels Konzeption des Kolorits in den Berliner Vorlesungen über die Philosophie der Kunst; in: Phänomen versus System. Zum Verhältnis von philo- sophischer Systematik und Kunsturteil in Hegels Berliner Vorlesungen über Äs- thetik oder Philosophie der Kunst, hg. v. A. Gethmann-Siefert, Bonn 1992 (Hegel- Studien. Beiheft 34), S. 91-164
1 J. W. Goethe, Berliner Ausgabe Bd. 21. Übersetzungen I, Berlin Weimar 1977, S. 764f.
2 Und doch drängt sich auch für ihn anlässlich einer Darstellung der Unterschiede der Menschenrassen eine solche Stufung auf. In nur in Nachschriften überlieferten Ausführungen zur Anthropologie (Enz. § 388 - § 411; hier: § 393) geht Hegel zunächst von der Vernunft aus. Im Blick auf sie erscheinen alle weiteren Verschie- denheiten, also auch die Hautfarben, als untergeordnet. Endlich bricht aber doch die Teleologie des Erscheinens des Inneren am Äußeren durch; Hegel kommt nicht umhin zu sagen: »Die schönste Farbe ist die, wo das Innere am sichtbarsten ist«. Zur Begründung wird wieder auf den bereits bekannten Unterschied von Pflanze und Tier, sowie den Rückfall der Tiere zum Vegetabilischen (Haarwuchs) zurück gegriffen. Die »innere Energie« des Animalisch-Organischen hat zu erscheinen. Analog zu den Ausführungen in der Ästhetik heißt es hier: »... durch dieses Durch- scheinende kündigt sich bei der Fleischfarbe die Lebendigkeit das inneren Orga nismus an; das rothe Blut der Arterien macht sich sichtbar auf der Haut, oder teilt der Oberhaut seine eigentümliche Erscheinung mit; dadurch kann das Geistige, Affection, Gemüt, sich um so leichter erkennbar machen.« Und Hegel beendet seine Ausführungen zu den Hautfarben mit dem Satz: »Dieser Umstand, daß das Innere, das Animalische und geistige Innere, sich mehr sichtbar macht, ist der ob- jektive Vorzug der weißen Hautfarbe« (Die hier zitierten Nachschriften von Kehler und Griesheim liegen gedruckt vor in: M. J. Petry, Hegels Philosophy of the Subjective Spirit, 2. Anthropology, Dordrecht, Boston 1978, S. 46).
1 vgl. damit das unmittelbar auf die Analogie folgende Zitat des Platonischen Disti- chons an den Aster; auch dort ist es das Bild des Himmels, das die geforderte Ver- tiefung der Gebilde der Kunst andeuten soll. (TWA Bd. 13, S. 203) - Zum erwähnten Distichon vgl. auch das Platon-Kapitel in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie (TWA Bd. 19, S. 14; Hegels Quelle ist Diogenes Laertios [III, 29]).
1 Es sind insgesamt drei Gründe, die für die Berechtigung dieses Übertritts sprechen. Den einen haben wir schon genannt: Das in der Analogie zwar angesprochene, aber mit der Malerei nicht eingelöste Moment der Bewegung drängt zu einem Fortgang zur Musik. Den zweiten Grund sehen wir in der Verwandtschaft der Bewegung des Pulsierens mit der Bewegung des Erzitterns: Hegel hat diese Vewandtschaft durch die gemeinsame Nennung der beiden Bewegungsformen verschiedentlich angedeutet (Ich erinnere an das Zitat aus der Phänomenologie in der Einleitung [TWA Bd. 3, S. 132] und jenes zum Blut aus dem dritten Jenaer Systementwurf [GW Bd. 8, S. 156] im zweiten Abschnitt des ersten Kapitels unserer Arbeit). Drit- tens drängt sich ein solcher Übergang auch aus systematischen Gründen auf: Erst mit ihm wird auch die zweite der eigentlich der Kunstauffassung zugehörenden sinnlichen Auffassungsformen abgedeckt. Neben dem Gesichtssinn - dem in der Hegelschen Ästhetik, wie wohl in jeder philosophischen Ästhetik, die Hauptauf- merksamkeit gilt - ist es der Sinn des Gehörs, der zu den eigentlich ästhetischen Sinnen zu zählen ist. Die Weisen, wie das Sinnliche in der Kunst auftritt, sagt Hegel einmal, ist das »Aussehen und Klingen der Dinge« ([Lasson] Die Idee, S. 66; [Hot- ho] TWA Bd. 13, S. 61). - Die - heute sogenannten - Nahsinne wie Geruch, Ge- schmack und Tastsinn werden von Hegel im Vorfeld seiner Betrachtungen zur Kunst ausgeschieden: Da sie es nicht zuließen, daß das Kunstobjekt für sich beste- hen bleibt, könnten sie nicht diejenigen Sinne sein, durch die der Kunstgenuß ge- schieht. [In diesen Zusammenhang gehört auch die bemerkenswerte Aufmerksam- keit Hegels auf ein Phänomen, das das pulsierende Blut, das Auge und das Erzittern in einem vorführt. Im dritten Jenaer Entwurf zitiert Hegel zunächst eine Auf- zeichnung des Anatomen und Physiologen S. Th. v. Sömmering zu einer Beobach- tung am Auge. Sie lautet in der leicht veränderten Hegelschen Version: »Im Auge scheint der Fall zu seyn, daß die Arterien in feinern, kein rothes Blut mehr enthaltende Zweigchen fortgesetzt werden, die anfangs in eine gleiche Vene, endlich aber in rothes Blut führende Venchen übergehen«. Und er kommentiert: »Hier« - also im Auge - »geht das Ding, das eigentlich Blut heißt, nicht über, sondern [es ist] eine Bewegung gesetzt, worin es verschwindet, und wieder hervortritt, oder ein elastisches Erzittern, ...« (GW Bd. 8, S. 161)]
1 [Hotho] TWA Bd. 13, S. 121; vgl. [Lasson] Die Idee, S. 131f.
2 [Lasson] Die Idee, S. 132; vgl. [Hotho] TWA Bd. 13, S. 122
1 [Hotho] TWA Bd. 13, S. 121; vgl. [Lasson] Die Idee, S. 132. - Hegel faßt hier einige, in der Naturphilosophie getrennt erläuterte Bestimmungen zusammen. Ich erwähne die § 254-257 der Enzyklopädie, darin der Übergang vom räumlich zum zeitlich bestimmten Punkt vorgenommen wird; dann den § 260, darin der »konkrete Punkt« im »Ort« erkannt wird. Schließlich den § 298, der das früher Gesagte gleichsam von der anderen Seite her wiederaufnimmt, d. h. nun die Bewegung nicht von den abstrakten, idealen Formen von Raum und Zeit und über den sie vermittelnden Punkt zur Realität der Materie übergehen läßt, sondern die Materie ins Schwingen bringt und damit den Übertritt aus dem Materiellen zum Ideellen vollzieht. Hegel bringt dabei, konsequenterweise, den Ort wieder ins Spiel. Der Ort, der bereits im § 260 die » gesetzte Idealität von Raum und Zeit« und ebenso der »gesetzte Wider- spruch « war, realisiert nun, im § 298, diesen Widerspruch im Materiellen. Resultat dieser Realisation ist das »innere Erzittern des Körpers in ihm selbst, - der Klang.« (§ 299; TWA Bd. 9) - Dazu unten: Kap. V/1, Über die auf das Materielle bezogene Bedeutung des Ausdrucks ›Punkt‹ in der zur Enzyklopädie gehörigen Natur- philosophie.
1 vgl. damit auch die Hinweise auf die von der materiellen Beschaffenheit des Klin- genden her sich differenzierenden Klangqualitäten in der Enzyklopädie; dort: § 300 und § 301 (TWA Bd. 9, S. 171ff.).
2 vgl. dazu: A. Nowak, Hegels Musikästhetik, Regensburg 1971, S. 56f.
3 Hegel spricht hier von der sich in seiner Entäußerung vernehmenden Subjektivität. Die Spitze des Sich-Selbst-Vernehmens aber wird in der Stimme erreicht. Die Stim- me, die das Prinzip des Blasinstruments und das Prinzip des Saiteninstruments in sich vereinigt - einerseits bringt sie eine Luftsäule, andererseits eine straff gezogene Saite (die Muskeln) zum erzittern - wird mit der Stellung der menschlichen Hautfarbe in der Malerei verglichen: So wie dort die Hautfarbe als ideelle Einheit alle übrigen Farben enthalte, »so enthält auch die menschliche Stimme die ideelle Totalität des Klingens, das sich in den übrigen Instrumenten nur in seine besonderen Unterschiede auseinanderlegt« (TWA Bd. 15, S. 175).
1 Obwohl uns nur die Nachschriften der Vorlesungen zur Ästhetik vorliegen, dürfen wir davon ausgehen, daß Hegel in beiden Fällen das Wort ›Punkt‹ wirklich ge- braucht hat: Es ist das weiterreichende Argument, das den Gebrauch des Ausdrucks erfordert.
2 TWA Bd. 15, S. 152, 190, 197
1 Der eigentliche Umschlag hat also bereits vor dem Auftreten des ›selbstbewußten Individuums‹ stattgefunden: Indem in der Poesie der Ton der Musik zum Zeichen wird, kann in ihm schließlich der »unendliche Raum der Vorstellung« seinen Ausdruck finden. Wie aber wird der Ton zum Zeichen? In und mit der Stimme. Die Stimme ist es, die den Ton als Zeichen setzt. Deshalb konnte, ja mußte Hegel - noch im Kapitel zur Musik - dem stimmlichen Tönen den Umfang aller Instru- mente, die reichhaltigste Konkretheit zusprechen: Weil in und mit der Stimme die Möglichkeit des Tons als Zeichen liegt. Die Stimme ist die variantenreichste Mög- lichkeit der musikalischen Kunstform - aber erst in der Poesie tritt ein ›in sich vollkommen konkretes‹, ein ›selbstbewußtes Individuum‹ in sie ein. Die Stimme erhält, so könnte man sagen, erst mit der Poesie die Wirklichkeit, die ihr gebührt.
1 So die Absichtserklärung, die Hegel ganz am Schluß seiner Vorlesungen über die Ästhetik gibt (TWA Bd. 15, S. 573).
1 Ich beziehe mich im folgenden auf die letztgültige Fassung der Naturphilosophie innerhalb der Enzyklopädie: G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830). Zweiter Teil: Die Naturphilosophie; TWA Bd. 9. - Von den Zusätzen wird nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht.
1 Insbesondere an dieser Stelle, unter Beizug der Hegelschen Bemerkung, daß die Dimensionen der Zeit nur in der »subjektiven Vorstellung«, nämlich als »Erinne- rung«, »Furcht und Hoffnung« notwendig seien (ebd.), setzt Heideggers Kritik an dem von ihm sogenannten ›vulgären Zeitverständnis‹ Hegels an (vgl.: M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1977 [14. Aufl.], S. 428ff.; und: ders., Logik. Die Frage nach der Wahrheit [Vorlesung WS 1925/6], GA Bd. 21, S. 251ff.). - Für Heidegger zeugt Hegels Verständnis der Zeit von einem Ausgang beim bereits ›nivellierten Jetzt‹ und damit von der unreflektiert übernommenen philosophischen Tradition, die das Thema der Zeit stets innerhalb der Naturphilosophie abgehandelt hat. Doch bleibt diese Bemerkung noch an der Oberfläche des von Heidegger eigentlich Kri- tisierten. Denn seine Kritik richtet sich v.a. auf die von Hegel vorgenommene Par- allelisierung von Zeit und »abstrakter Subjektivität«. Die Vorlesung aus dem WS 1925/26 ist an dieser Stelle deutlicher. Dort spricht Heidegger von einer »Erschlei- chung«, die es Hegel erlaube zu sagen: »Die Zeit ist auch, als der Punkt, der sich für sich selbst setzt, abstrakte Subjektivität.« (GA Bd. 21, S. 259; Heidegger bezieht sich auf den § 258 der Naturphilosophie). Das von Heidegger ›Erschleichung‹ Ge- nannte ist das, was unsere Studie unter der zweifachen Bedeutung des Ausdrucks ›Punkt‹ thematisiert.
2 »Das unmittelbare Verschwinden dieser Unterschiede [der Dimensionen] in die Einzelheit ist die Gegenwart als Jetzt « - heißt es im § 259 (ebd.).
1 »Die Vergangenheit aber und Zukunft der Zeit als in der Natur seiend ist der Raum, denn er ist die negierte Zeit« - und Hegel schließt: »so ist der aufgehobene Raum zunächst der Punkt und für sich entwickelt die Zeit« (ebd.).
1 Hegel spricht vom Aufheben einer »erlittene[n] Negation« (ebd., S. 167).
1 Die Komplexität der Darstellung ist an dieser Stelle irreduzibel. Das hat damit zu tun, daß Hegel versucht, das einfache Geschehen des Anschlagens eines materiellen (wohl metallischen) Körpers und sein nachfolgendes Erklingen begrifflich darzu- stellen. Nicht zufällig verweist er in diesem Zusammenhang auf die Darstellung der Paradoxie der Bewegung durch Zenon. Im Paragraphen zur Elastizität heißt es dazu: »Es ist derselbe Widerspruch, welcher der Zenonischen Dialektik der Bewe- gung zum Grunde liegt, nur daß er bei der Bewegung abstrakte Orte betrifft, hier aber [d. h. bei der Elastizität] materielle Orte, materielle Teile.« (ebd., S. 168) Hierher gehört auch Hegels Beschreibung der Entstehung des Funkens (§ 305). Da die »Reibung von zwei Hölzern« oder das »gewöhnliche Feuerschlagen« das »ma- terielle Außereinander des einen Körpers durch die schnell drückende Bewegung des anderen in einen Punkt momentan zusammen[bringt]« und dies einer »Nega- tion des räumlichen Bestehens der materiellen Teile« gleichkommt, ist auch das Phänomen des Funkens bzw. der Flamme als das Resultat einer im Materiellen sich zutragenden Negation der Negation zu fassen. Bezeichnenderweise endet der § 305 mit einer generellen Bemerkung zur Vorgehensweise der Naturphilosophie: »Es handelt sich hier, wie überall in der Naturphilosophie, nur darum, an die Stelle der Verstandeskategorien die Gedankenverhältnisse des spekulativen Begriffes zu set- zen und nach diesen die Erscheinung zu fassen und zu bestimmen.« (TWA Bd. 9, S. 192) - Weitere Hinweise über den Zusammenhang des spekulativen Begriffs mit dem Phänomen des Funkens sind dem noch rohen und weniger geordneten Ma- nuskript zur Naturphilosophie des dritten Jenaer Systementwurfs zu entneh- men. Dort heißt es innerhalb eines Abschnitts zum Chemismus des physischen ein- zelnen Körpers, oder des irdischen Feuers zum Vorgang der Aufhebung des im Raum Getrennten durch das »Eins der Zeit«: »so springt der Funken hervor« (GW Bd. 8, S. 100). Da Hegel außerdem das »Daseyn dieser Selbstentzündung«, eben den Funken, mit dem dabei entstehenden »Knall« und dem beteiligten »Gehör« in Ver- bindung bringt, das Gehör aber als ein das Entstandene unmittelbar wieder Zu- rücknehmendes verstanden wird, kann er dem Funkensprung schließlich ein Selbst- vernehmen assozieren: Das Selbst » vernimmt sich « im Funken, es sei mit ihm eine »Einheit des ansich seyenden und daseyenden Wirklichen « gesetzt, wird am Rande vermerkt. Fragt man weiter, vor welchem Hintergrund diese Einheit des Selbsts im Funken zustandekommt, so gibt Hegel die Antwort, daß in ihm in einem » dasey- enden Punkt zusammen[gefaßt]« sei, »was schon an sich dieser Punkt ist.« - Frage: Ist mit dieser Antwort zu vergleichen, was Hegel ganz am Schluß des Manuskripts von der bei ihrem »Anfange«, d. h. dem unmittelbaren, aber entzweiten Bewußtsein ankommenden Philosophie sagt? Nachdem es dort von der Philosophie gegenüber der Religion und der Kunst geheißen hat, daß in ihr in unmittelbarer Weise »Ich das Absolute«» erkennt «, die Philosophie sich aber ihrer selbst zu entäußern und auf ihren Anfang zurückzukommen habe, heißt es: »Sie [die Philosophie] ist so Mensch überhaupt - und wie der Punkt des Menschen ist - ist die Welt - und wie sie ist, ist er - Ein Schlag erschafft sie beyde« (ebd., S. 287). Ist in diesem einen Schlag nicht der Sprung des einen Funkens mitgedacht, der die Welt erhellt und den Menschen diese und sich selbst erkennen läßt?
1 vgl. dazu: J. Simon, Das Problem der Sprache bei Hegel, Stuttgart 1966, S. 55-74. - Auch Simon stößt auf die genannte Implikation. Die Stimme, so heißt es bei ihm, »ist die Verkündung, daß das Lebewesen mit seinem gegenständlichen Sein den Punkt bezeichnet, von dem aus Raum und Zeit ihm als einem selbstbewegten Sei- enden nur als relative Grössen gelten und den es selbst festsetzt. Denn mit der Stimme erfüllt es Raum und Zeit von einem Punkte aus, ohne sich faktisch zu bewegen, und relativiert Raum und Zeit auf diesen wohl immer in Raum und Zeit seienden, aber selbst nicht in Raum und Zeit festgelegten Punkt« (ebd., S. 59). Vgl. mit unserer Darstellung des Entwicklungsgangs der Naturphilosophie auch: St. Majetschak, Logik des Absoluten, Berlin 1992, S. 276-290
1 Diese Auffassung wird dem § 67 des Buches von A. L. J. Ohlert Der Idealrealismus. Erster Teil (Neustadt a. d. Orla 1830) entnommen.
2 Dieser Entwurf ist rund 25 Jahre vor der oben erwähnten Rezension entstanden. Daß sich die Redeweise Hegels an diesem frühen Manuskript verdeutlichen läßt, deutet zugleich auf die Kontinuität der Assoziation von Punkt und Geist in Hegels Werk.
1 An dieser Stelle ist auf Kant hinzuweisen. Das, was Hegel oben als das ›Formale der Vernünftigkeit‹ oder als ›reine Beziehung‹ vorstellt, wird von Kant unter dem Titel der ›ursprünglich-synthetischen Einheit der Apperzeption‹ gedacht (KdrV, § 16, B 129ff.). Im Rückgang auf die Frage »wie sich Begriffe a priori auf Gegen- stände beziehen können« versucht Kant eine »transzendentale Erklärung« (B 117) dieser - etwa an der Mathematik demonstrierbaren - Möglichkeit zu geben. Dabei stößt er darauf, daß »unter allen Vorstellungen die Verbindung die einzige ist, die nicht durch Objekte gegeben, sondern vom Subjekte selbst verrichtet wird« (B 130). Der genannte Titel der ›ursprünglich-synthetischen Einheit der Apperzeption‹ ist nichts anderes als die Verknüpfung dieses Fundes mit der Annahme, daß die Vor- stellung der Verbindung ihrerseits von einer noch höheren Einheit ermöglicht wird. Diese höhere Einheit findet Kant in dem: »Ich denke«. - Ich weise darauf hin, daß auch bei Kant in diesem Zusammenhang der Ausdruck ›Punkt‹ verwendet wird. In einer bekannten Anmerkung zum § 16 der Kritik der reinen Vernunft heißt es, - nachdem im vorstellungsbegleitenden »Ich denke« die »transzendentale Einheit«, d. h. die Ermöglichung der Auffassung des Mannigfaltigen für ein Bewußtsein aus- gemacht worden ist -, folgendes: »Und so ist die synthetische Einheit der Apper- zeption der höchste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die Transzendental-Philosophie heften muß, ja dieses Ver- mögen ist der Verstand selbst.« Warum, so läßt sich fragen, findet Kant gerade im Ausdruck ›Punkt‹ das Bild um die gefundene Einheit des Selbstbewußtseins zu bezeichnen? Antwort: Der ›Punkt‹ soll die rein formale Struktur des Verstandes und seine innere Unausgedehntheit bezeichnen. »Denn durch das Ich«, so heißt es weiter, »ist nichts Mannigfaltiges gegeben«, nur ein »Verstand, in welchem durch das Selbstbewußtsein zugleich alles Mannigfaltige gegeben würde, würde anschau- en; der unsere kann nur denken und muß in den Sinnen die Anschauung suchen.« (B 135) So ist der genannte Punkt ein Punkt, der nur in sich verbleibt und der damit der unsinnliche und formale Ausgangspunkt für rein rationale Bewegungen ist. - Die Rede Kants vom ›höchsten Punkt‹ hat die nachfolgende Philosophie des sog. ›Deutschen Idealismus‹ stark beeinflußt. So läßt sich - um nur darauf hinzuweisen - der Briefwechsel, den J. G. Fichte und F. W. J. Schelling zwischen 1800 und 1802 geführt haben, geradezu als ein - schließlich abgleitender - Gedankenaustausch um den von Kant in das Denken eingebrachten ›höchsten Punkt‹ verstehen. (Ich zitiere aus: Fichte-Schelling, Briefwechsel, Einleitung v. W. Schulz, Frankfurt a. M. 1968). Nachdem Fichte in einem Brief vom Nov. 1800 von den drei Dimensionen des Raumes behauptet hat, sie seien »durch abstrahierendes Denken im Raume« ent- standen und damit nichts anderes als die »allgemeinen Formen des Denkens selbst«, reißt die Rede vom ›Punkt‹ zwischen den beiden nicht mehr ab. Fichte setzt damit ein, daß er die Analogie der Raumdimensionen und der Formen des Denkens um den Punkt, die »Form des Setzens überhaupt«, konzentriert (S. 106). Dahinter setzt er eine ›Philosophie der Mathematik‹ an, die, über den Punkt als Anfang, jene Deduktion der drei Raumdimensionen leisten soll. Doch Schelling entgegnet, - nachdem er die von Fichte angezogene ›Philosophie der Mathematik‹ eine »Ab- straktion der Naturphilosophie« genannt hat - : »Linie, Fläche und Körper entste- hen ... ursprünglich... erst in der Naturphilosophie, und kommen erst durch Ab- straktion in die Philosophie der Mathematik. Naturphilosophie kann sie also nicht aus dieser voraussetzen.« (S. 112) Auf die zentrale Sache des Punktes, der ›Form des Setzens überhaupt‹, wie Fichte sagt, geht Schelling nicht ein, - scheinbar nicht ein. Denn: Liest man den Brief Schellings genauer, erkennt man, daß zwar vom Punkt gesprochen wird, aber nicht vom Punkt innerhalb einer ›Philosophie der Mathematik‹; Schelling gebraucht den Ausdruck ›Punkt‹ ausschließlich im über- tragenen Sinn. Er spricht von von seinem »Einverständnis über Punkte« mit Fichte (S. 107), vom »Hauptpunkt« (ebd.) des Gegensatzes zwischen Transcendentalphi- losophie und Naturphilosophie, vom »Punct« (S. 108) auf den er schließlich nach einem Jahre dauernden Gang des Denkens zu stehen kam, vom »Mittelpunkt« und von den »Punkten« (S. 111) des Fichteschen Systems mit denen er einig bzw. uneinig ist; schließlich von dem »einen Punkt«, da er sich mit Fichte »vereinigen könnte« (S. 112). Im weiteren Verlauf des Briefwechsels übernimmt Fichte schließlich die Schelling’sche Redeweise: Zwar spricht er zunächst noch vom »Mittelpunkt« (S. 115) des transzendentalen Idealismus, vom »Grundpunkt« eines evidenten Ak- tes, darin das Bewußtsein sich selbst erfasse und durchdringe (S. 127), dann aber auch von seinem »Standpunkt« und dem »Differenzpunkt« mit Schelling (S. 142). Am 3. Oktober 1801 schreibt Schelling: »Unsere Differenzpunkte, verehrtester Freund, in meinem Brief samt und sonders auseinander zu setzen, und bis auf die erste Differenz, von der sie herstammen, Punkt für Punkt zurück zu verfolgen, möchte fast unmöglich sein.« (S. 132) Fast unmöglich, schreibt Schelling. Im selben Brief, gegen das Ende zu, nachdem er selbst sich seines Gewissseins über die eigene Sache versichert, und er davon gesprochen hat, daß er es gerne einem jeden selbst überlasse, die Punkte seines Unterschiedes zu Fichte herauszufinden, lesen wir: »So ist dieser Tage ein Buch von einem vorzüglichen Kopf erschienen, das zum Titel hat: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, an dem ich keinen Antheil habe, das ich aber auch auf keine Weise verhindern konnte.« (S. 141) Der ›vorzügliche Kopf‹, von dem Schelling hier spricht, heißt G. W. F. Hegel. Das Buch, dessen Herausgabe Schelling auf keine Weise hat verhindern können, ist die erste große Druckschrift seines damals einunddreißig Jahre alten Tübinger Freundes.
1 TWA Bd. 4, S. 433. - Erwähnt sei auch eine Stelle aus den Vorlesungen über die Ästhetik. Im Kapitel über die Ehre, wo Hegel ausführt, daß es bei der Verletzung der Ehre nicht auf den Inhalt, sondern auf die Persönlichkeit ankomme, heißt es, daß die Persönlichkeit in der Ehrverletzung »sich, als diesen ideellen unendlichen Punkt« angegriffen erachte (TWA Bd. 14, S. 180). - Ein weiteres Beispiel findet sich in den Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Auch dort spricht Hegel vom »innersten, abstrakten Punkt der Persönlichkeit« (TWA Bd. 16, S. 204).
2 Man könnte an dieser Stelle auf jene oft thematisierte konkrete Bewegung näher eingehen, die den auf sich selbst vereinzelten - aber gleichwohl unendlichen - Punkt des eigensinnigen Subjekts mit dem Punkt der Person vermittelt, - der Person, die ihre Realität schließlich im wechselseitigen Anerkennen von Person en findet. »Recht ist die Beziehung der Person in ihrem Verhalten zur anderen - das allgemeine Element ihres freyen Seyns - oder die Bestimmung, Beschränkung ihrer leeren Freyheit«. (GW Bd. 8, S. 215)
1 Der diesbezügliche Abschnitt lautet: »Vermöge der ... Natur der Methode stellt sich die Wissenschaft als ein in sich geschlungener Kreis dar, in dessen Anfang, den einfachen Grund, die Vermittlung das Ende zurückschlingt; dabei ist dieser Kreis ein Kreis von Kreisen; denn jedes einzelne Glied, als Beseeltes der Methode, ist die Reflexion-in-sich, die, indem sie in den Anfang zurückkehrt, zugleich der Anfang eines neuen Gliedes ist. Bruchstücke dieser Kette sind die einzelnen Wissenschaf- ten, deren jede ein Vor und ein Nach hat oder, genauer gesprochen, nur das Vor hat und in ihrem Schluße selbst ihr Nach zeigt. - So ist denn auch die Logik in der absoluten Idee zu dieser einfachen Einheit zurückgegangen, welche ihr Anfang ist; die reine Unmittelbarkeit des Seins, in dem zuerst alle Bestimmung als ausgelöscht oder durch die Abstraktion weggelassen erscheint, ist durch die Vermittlung, näm- lich die Aufhebung der Vermittlung zu ihrer entsprechenden Gleichheit mit sich gekommen. Die Methode ist der reine Begriff, der sich nur zu sich verhält; sie ist daher die einfache Beziehung auf sich, welche Sein ist. Aber es ist nun auch erfülltes Sein, der sich begreifende Begriff, das Sein als die konkrete, ebenso schlechthin intensive Totalität.« (ebd., S. 571f.)
1 vgl. dazu den letzten Abschnitt des letzten Kapitels der Wissenschaft der Logik.- Unsere Deutung der Rede vom ›Entlassen‹ und der ›Befreiung‹ setzt allerdings die konkrete Ausarbeitung der Naturphilosophie bereits voraus. Die scheinbare Nicht übereinstimmung mit dem Text der Logik ist darin begründet, daß Hegel die von uns referierte Naturphilosophie der Enzyklopädie erst nach der großen Logik geschrieben hat. Während für Hegel das Ende der Logik sein Nach nur erst zeigt, hat für uns die Naturphilosophie ihr Vor in der Logik. Die von uns in die Hegelsche Rede eingelegte Notwendigkeit (das ›Müssen‹) liegt also darin, daß die Naturphi- losophie, wie jeder andere Kreis des Wissens, seinen Anfang im Fortschreiten zu begründen hat.(Das Vorwort des letzten Bandes der Logik ist auf den 21. Juli 1816 datiert, jenes der ersten Ausgabe der Enzyklopädie [Heidelberg] auf den Mai 1817; während sich in dieser frühen Ausgabe der Enzyklopädie der Hinweis auf die mit der freien Selbstbewegung gegebene Stimmbegabung des Tiers bereits findet, fehlt in ihr die von uns beobachtete, durchgängige Aufmerksamkeit auf die Bewegung des Punktes.)
2 Bereits im dritten Jenaer Systementwurf heißt es: »Jedes Thier hat im gewaltsa- men Tode eine Stimme; spricht sich als aufgehobnes Selbst aus«, wobei die Stimme als das » thätige[] Gehör « und so als das »reine[] Selbst, das sich als allgemeines setzt « verstanden ist (GW Bd. 8, S. 170). Im zweitletzten Paragraphen der späteren Na- turphilosophie lesen wir, daß es die »Unangemessenheit zur Allgemeinheit« sei, die den »angeborene[n] Keim des Todes« beim Tier ausmache; und weiter: »Das Auf- heben dieser Unangemessenheit ist selbst das Vollstrecken dieses Schicksals« (TWA Bd. 9, S. 535). Obwohl von Hegel nicht ausdrücklich gesagt, ist die im Tod ertö- nende Stimme des Tiers als letztes Zeichen der Endlichkeit und als ein Hinüber- zeigen in die geistige Sphäre zu verstehen.
1 Der Ausdruck ›Vokalisation‹ bezeichnet einerseits die Bildung und die Aussprache der Vokale beim Singen und andererseits die »Feststellung der Aussprache des (vokallosen) hebräischen Textes des alten Testamentes durch Striche oder Punkte« wie der Fremdwörterduden (1982) vermerkt. Sollte Hegel von dieser Markierungs- technik gewußt haben? Bemerkenswert ist, daß im Theologisch-PolitischenTraktat des Spinoza - und diesen Traktat kannte Hegel, denn er selbst hat mit einem kleinen philologischen Beitrag zu den Annotationes zum Tractatus an der Paulus-Ausgabe der Werke Spinozas mitgearbeitet (vgl. Paulus’ Bericht über die Mitarbeit Hegels im zweiten Band der 1803 erschienenen Edition [S. XXXV]) - im siebten Kapitel Von der Auslegung der Schrift von den sogenannten »Punktisten« gehandelt wird. Im Zusammenhang einer Ausführung über die Schwierigkeiten der Schriftausle- gung geht Spinoza zuletzt auf die zwei haupsächlichsten Gründe dieser Schwierig- keiten ein. Von ihnen schreibt er: »Die erste [Schwierigkeit] besteht darin, daß es im Hebräischen keine Buchstaben für Vokale gibt; die zweite darin, daß die Sätze [des alten Testaments] nicht durch Interpunktionszeichen geschieden und hervor- gehoben oder angedeutet zu werden pflegten. Zwar werden gewöhnlich beide, Vo- kale und Interpunktionszeichen, durch Punkte und Akzente ersetzt, aber darauf kann man sich nicht verlassen, weil diese erst in viel späterer Zeit von Leuten er- funden und eingeführt worden sind, denen wir keinerlei Autorität zugestehen kön- nen. Die Alten haben ohne Punkte (d. h. ohne Vokale und Akzente) geschrieben (wie wir aus zahlreichen Zeugnissen wissen); die Späteren haben beides hinzuge- fügt, so wie sie die Bibel auszulegen für gut fanden. Darum sind die Akzente und Punkte, die wir haben, bloß moderne Auslegungen und verdienen nicht mehr Glau- ben und Autorität, als die anderen Erklärungen solcher Autoren.« (Baruch de Spinoza, Theologisch-Politischer Traktat (1670), übers. v. C. Gebhardt, Hamburg 1984, S. 125f.). Als Beleg seiner Aussage bringt Spinoza sodann ein Beispiel vor, daran die Unzuverlässigkeit der modernen »Punkte und Akzente« sichbar wird. - [In diesem Zusammenhang ist auch auf das in der obengenannten Ausgabe der Werke Spinozas abgedruckte Fragment Compendium Grammatices Lingu æ He- br ææ hinzuweisen. Auch von diesem Text dürfte Hegel Kenntnis gehabt haben. Die entscheidenden Kapitel finden sich ganz zu Beginn der nicht abgeschlossenen Abhandlung. (Cap. I: De Literis et Vocalibus in genere; ... Cap. IV: De Accentibus)] Nachtrag: Hegel kannte die von uns oben sogenannte ›Markierungstechnik‹. In einem Zusatz zum § 246 der Naturphilosophie wird ein Satz Hamanns zustimmend zitiert. Es heißt dort: »›Die Natur‹, sagt Hamann mit Recht, ›ist ein hebräisch Wort, das mit bloßen Mitlautern geschrieben ist, zu dem der Verstand die Punkte setzen muß‹« (TWA Bd. 9, S. 19; der Satz Hamanns findet sich in einem Brief, den dieser Ende Dez. 1759 an Kant geschrieben hat). Es ist an dieser Stelle nicht auf den von Hamann angedeuteten Bezug von hebräischem Wort und Natur einzugehen; für uns ist lediglich von Interesse, daß Hegel von der Technik der Vokalisation im Hebräischen Kenntnis hatte. (In diesem Zusammenhang ist auch auf Hegels theo- logische Studienzeit im Tübinger Stift hinzuweisen [1788-93]. Das Studium der Theologie pflegt das Erlernen der Hebräischen Sprache zu beinhalten.) - Frage: Wie verhält sich das Angesprochene zu den Ausführungen Hegels in der Philoso phie des Geistes, wo er den Begriff eines »hieroglyphischen Lesens« einführt? Unter dem hieroglyphischen Lesen wird dort (TWA Bd. 10, S. 276) jenes an der Buch- stabenschrift stattfindende »taube[] Lesen und stumme[] Schreiben« verstanden, welches den geübten, nicht mehr auf den Umweg des »tönenden Worts« angewie- senen Leser auszeichnet; so wird die »Buchstabenschrift in Hieroglyphen verwan- delt«. Entsprechend birgt nun die Buchstabenschrift den Ton und den Laut in sich. Die Benennung der so verstandenen Buchstabenschrift als einer ›Hieroglyphen- schrift‹ aber weist zurück auf die Hegelsche Fassung des Zeichens im allgemeinen als einer Pyramide. Denn: In der Pyramide - oder dem Zeichen - ist »eine fremde Seele versetzt oder aufbewahrt« (ebd., S. 270). J. Derrida, der - soweit ich sehe - als einziger bisher näher auf diese ›Semiologie‹ Hegels eingegangen ist, spricht in diesem Zusammenhang von einer »Art Inkarnation« (»une sorte d’incarnation«; vgl.: ders., Le Puits et la Pyramide. Introduction à la Sémiologie de Hegel; in: Marges de la Philosophie, Paris 1972, S. 94) als welche Hegel das Zeichen fasse. Als Gegen- bzw. Vor-Bild dieser entwickelten Zeichencharakteristik kann - darauf macht Derrida an anderer Stelle aufmerksam (in: Glas I/II, Paris 1981, S. 352ff) - die Hegelsche Beschreibung der in Theben stehenden Memnonen verstanden werden: Da die Memnonen zwar »beim Sonnenaufgang einen Klang von sich gäben«, dieses Tönen aber noch »von außen des Lichts« bedürfe, werden sie von Hegel schließlich mit der »aus der eigenen Empfindung und dem eigenen Geiste« tönenden Stimme kon- trastiert (TWA Bd. 13, S. 462). Wir begegnen hier noch einmal jener Teleologie, die wir bereits im Durchgang durch die Ästhetik ausmachten: Parallel zur Forderung, daß das Innere im Zuge der Entwicklung zunehmend durch das Äußere hindurch- zuscheinen habe, könnte von einer Richtung hin zu einer immer intensiver werdenden Personanz des Inneren durch ein Äußeres gesprochen werden. Als Telos dieser Entwicklung ließe sich schließlich der Text der Hegelschen Logik verstehen. Faßte man diese als eine Pyramide auf, an deren Ende bzw. auf deren Spitze sich die reine Persönlichkeit erhebt, welche rückblickend den pyramidalen Bau als sich selbst erkennt und mit ihrer Stimme wiederbelebt, so wäre sowohl dem ›hierogly- phischen Lesen‹ als auch dem Telos des aus sich selbst Ertönens Genüge getan.
1 Auch hier gilt, daß unserer Auslegung es lediglich gelingt, grobe Wegmarken des sich entwickelnden Systems anzugeben.
1 Der vollständige Titel dieser ersten großen Veröffentlichung lautet: Differenz des Fichte ’ schen und Schelling ’ schen Systems der Philosophie in Beziehung auf Rein- hold ’ s Beyträge zur leichteren Ü bersicht des Zustandes der Philosophie zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Ich zitiere im folgenden nach dem Abdruck des Textes in: TWA Bd. 2, S. 9-138. - Diese wichtige Frühschrift Hegels kommt hier nur vor dem Hintergrund unserer spezifischen Deutung des späteren Systems in Betracht.
1 vgl. dazu: Schellings und Hegels erste absolute Metaphysik (1801-1802), Zusammenfassende Vorlesungsnachschriften von I. P. V. Troxler, hg. v. K. Düsing, Köln 1988; insbes. S. 72-74. - Das »Schwebende, Zusammenhaltende« des reellen und des ideellen Prinzips - des Absoluten - wird hier in der Symbolik des Punktes und der Linie veranschaulicht. Näher gibt Hegel an, daß das Ideelle als Punkt das »Be- gründen«, das Reelle als Linie vorgestellt aber das »Begründbare« sei. - Vgl. dazu auch den Text der Hegelschen Dissertationüber die Planetenbahnen. Dort wird gesagt, daß eine Erkenntnis des physikalischen oder des realen Begriffs (notio) der Materie auch voraußetze, daß er unter der Form der Subjektivität gesetzt werde; die Form des sich auf die Materie beziehenden Geistes (Hegel gebraucht den lat. Ausdruck ›mens‹) aber ist der Punkt: »Damit wir die reale Materie erkennen, muß dem abstrakten Begriff des Raumes der Gegensatz beigegeben werden, den wir in der lateinischen Sprache eher ›mens‹ nennen, und wenn wir dies auf den Raum beziehen: ›Punkt‹. (Ut realem materiam intelligamus, spatii abstractae notioni con- traria sive subjectivitatis forma addenda est, quam voce magis latina mentem, et si ad spatium referatur, punctum, appellemus.)« Auch der Zusammenhang von ›mens‹ (Geist) und Zeit wird bereits in dieser frühen Schrift angesprochen. So findet Hegel in der Linie das Produkt des sich auf den Raum beziehenden, als Zeit sich ständig selbst erzeugenden Geistes (in: G. W. F. Hegel, Dissertatio Philosophica de Orbitis Planetarum. Philosophische Erörterung über die Planetenbahnen (1801), Wein- heim 1986, hier S. 127ff.).
2 Hegel bezieht sich auf: F.W.J. Schelling, Darstellung meines Systems der Philosophie; in: Zeitschrift für spekulative Physik, Bd. 2, Heft 2, S. 116 (in: SW, 1. Abt., Bd. VI, S. 205). - Von dem ›Sich-selbst-Konstituieren‹ eines Punkts spricht Schel- ling - soweit ich sehe - nirgends. Allerdings könnte die Schlußanmerkung der Schelling’schen Darstellung (ebd., S. 212), darin von der »Construction der abso- luten Indifferenz« als der Stufe der »höchsten Tätigkeitsäußerung« der Natur ge- sprochen, diese als »Punkt« bezeichnet, und von ihr aus die »Construktion der ideellen Reihe« eingeleitet wird, Hegel zu seiner Formulierung bewogen haben. Ich weise weiter darauf hin, daß Schelling im § 46 derselben Schrift von der Mög- lichkeit spricht, die »Form des Seyns der absoluten Identität ... allgemein unter dem Bild einer Linie« sich zu denken (ebd., S. 137). In einem Zusatz dazu heißt es, daß diese Linie die »Grundformel« zur Construktion des ganzen Systems, - und für die Philosophie dasselbe sei, »was die Linie für den Geometer« (ebd., S. 138). Da die Linie insgesamt »drei Punkte« veranschaulicht, nämlich, a) den Pol der »über- wiegenden Subjektivität« (+A = B), b) den Pol der »überwiegenden Objektivität« (A = B+), und c) den mittleren »Indifferenzpunkt« (A = A), in jedem Teil aber die »ganze absolute Identität« da ist, ließe sich schließlich die Hegelsche Rede von der ›Pyramide der Natur‹ auf jene drei Punkte beziehen, die in der Schelling’schen Linie ganz rechts, im Teil der »überwiegenden Objektivität«, angesetzt sind.
1 An dieser Stelle zwei Bemerkungen. Erste Bemerkung: Wir sprechen vom ›Umschlag‹ und ›Transport‹ - Hegel spricht vom ›Einschlag des Blitzes‹ und dem ›Innerlichwerden des Lichtes‹. In beiden Fäl- len zeigen die Wendungen denselben, an dieser Stelle mit dem Punkt geschehenden metaphorischen Proze ß an. Während allerdings unsere Rede davon ausgeht, daß der Wandel zwischen den beiden Punkten seinen Ort in der Sprache hat, deuten die Worte Hegels auf Prozeße oder Bewegungen hin, die in der Natur ihren Ort haben. Das, was wir den ›metaphorischen Prozeß‹ nennen, müßte sich, folgte man Hegel, entsprechend in der Natur selbst zutragen. Und tatsächlich sagen alle seine Wendungen genau dies, nämlich, daß der Wandel vom bloß natürlichen Punkt zum geistigen Punkt in und von der Natur selbst vollbracht werde. So verstehen wir seine Rede vom ›Sich-selbst-Konstituieren‹ des Reellen ›als Punkt‹: Damit ist ge- sagt, daß die Vernunft schließlich nichts anderes zu tun braucht, als den bereits vom Natürlichen in die geistige Bedeutung erhobenen Punkt entgegenzunehmen. - Was aber geschieht schließlich dem von der Natur bereits zur geistigen Bedeutung raffinierten Punkt in der Sphäre der Vernunft? Die Vernunft wendet ihn noch einmal um. Die Vernunft erkennt: Es ist ein Punkt - und als Punkt muß er sich ›in eine Natur expandieren‹. Zweite Bemerkung: Hegel gebraucht zur Charakterisierung der beiden Bewegun- gen des zur Vernunft kommenden und des sich in eine Natur ausbreitenden Punkts die beiden Titel ›Kontraktion‹ und ›Expansion‹ (vgl. TWA Bd. 2, S. 112). Da weiter das Spiel dieser beiden Bewegungen den Ort des Absoluten selbst bezeichnen soll, werden wir an Ausführungen erinnert, die wir innerhalb des Kapitels zur Reli- gionsphilosophie besprochen haben: Auch dort konnten wir, allerdings bezogen auf das christliche Vater-Sohn Verhältnis, aus der Darstellung Hegels exakt diesel- ben Bewegungen der Kontraktion und der Expansion, die Bewegung einer Kon- traktion in die Einfachheit und die Bewegung einer Expansion in den Reichtum entnehmen. Hat man die Ähnlichkeit dieser Bewegungen einmal erkannt, so kann es nicht verwundern, daß in der Differenzschrift, und zwar am entscheidenden Ende der sich ständig verdichtenden Betrachtungen zum absoluten Indifferenz- punkt der beiden Wissenschaften der Intelligenz und der Natur Hegel plötzlich - kaum angekündigt in der Forderung, daß die »ursprüngliche Identität« die objek- tive Totalität des ausgebreiteten Natürlichen und die subjektive Totalität des sich erkennenden Punktes schließlich in die »Anschauung des sich selbst in vollendeter Totalität objektiv werdenden Absoluten« zu vereinigen habe - seine Ausdrucks- weise wechselt und die zuvor hochkomplex scheinende Forderung in der »An- schauung der ewigen Menschwerdung Gottes, des Zeugens des Worts vom Anfang« realisiert sieht (ebd., S. 112).
1 In der Differenzschrift ist von der Stimme nur an einer Stelle die Rede. Dort wird sie im Zusammenhang eines kurzen Hinweises auf die Stellung des Tiers in der Naturphilosophie genannt (TWA Bd. 2, S. 109f.).
1 Anläßlich der Ausführungen zu den Schauspielen der Kunstreligion heißt es, daß dort der »Held, der vor dem Zuschauer auftritt, ... in seine Maske und in den Schau- spieler, in die Person und das wirkliche Selbst« zerfällt (TWA Bd. 3, S. 541). Einige Seiten vorher ist bereits von den wirklichen Menschen - den Schauspielern - die Rede, »welche die Personen der Helden anlegen und diese in wirklichem, nicht erzählendem, sondern eigenem Sprechen darstellen« (ebd., S. 535).
1 An dieser Stelle sei auf den einzigen mir bekannten Text hingewiesen, der in ver- gleichbarer Weise und ebenfalls bezugnehmend auf Hegel auf das Wort ›Person‹ zu sprechen kommt. In dem Aufsatz Systematische Betrachtungenüber den Begriff der Persönlichkeit Gottes in der Philosophie Hegels und seiner Schule von W. Stei- ninger ist es ein Satz, der unser Interesse erheischt. Bezugnehmend auf das Ende der Phänomenologie des Geistes und vorausverweisend auf die Wissenschaft der Logik heißt es da: »Auf der adäquaten Stufe des absoluten Wissens ist das Selbstbewußtsein nicht nur das personare seiner Momente, sondern weiß sich als dieses personare.« Steininger folgt den Konsequenzen seiner eigenen Sprechweise nicht weiter -, für ihn versteht es sich offenbar von selbst, daß Hegel im Wort ›Person‹ das ›personare‹ mithört (in: Phil. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, Jg. 65, 1956, S. 182-231; hier S. 220). - Spätestens hier wird der Hinweis darauf notwendig, daß die neuere Sprachwissenschaft es ablehnt, das Wort ›Person‹ etymologisch von personare abzuleiten. Als Grund wird die verschiedene Länge des o in lat. persona (lang) und personare (kurz) angegeben. Da lat. ›persona‹ Maske heißt und durch die Maske hindurch der Schauspieler spricht, war es, seit überhaupt Aufzeichnun- gen zur Etymologie des Wortes vorliegen (A. Gellius, Noctes Atticae [V,7]; 1. Jahrhundert vor Christus), immer klar, daß persona und personare zusammenzu- denken sind. Noch in der Mitte des letzten Jahrhunderts war dieser Zusammenhang für einen Sprach- und Wortforscher wie J. Grimm völlig evident (vgl. Deutsches Wörterbuch v. Jakob und Wilhelm Grimm, Bd. 13, Sp. 1561). Heute werden ver- schiedene Etymologien erwogen; doch erreicht wohl keine mehr die Plausibilität der vorherigen, über Jahrhunderte gültigen (Pseudo-)Etymologie. H. Rheinfelder bemerkt rückblickend auf die frühen etymologischen Versuche um das Wort ›per- sona‹: »Wir werden über diese etymologischen Bemühungen lächeln, dürfen uns aber nicht darüber hinwegsetzen, da sie in der Geschichte des Wortes von größerer Bedeutung sein können als die wirkliche Etymologie. Denn auf alle Fälle zeigen sie uns, daß das Wort persona ganz mit dem Wort personare zusammengedacht wurde, und aus diesem, wenn auch irrigen Bewußtsein müssen eine Reihe weiterer Bedeutungen erklärt werden.« (H. Rheinfelder, Das Wort ›persona‹, Halle (Saale) 1928; vgl. bes.: Zur Etymologie des Wortes persona, S. 18-26; hier: S. 19)
1 An dieser Stelle ist auf ein noch nicht beigezogenes Dokument hinzuweisen, darin der Bezug von Stimme, Bestimmen und Person - wenn auch nicht ausgesprochen, so doch als Hintergrund der Darstellung Hegels anzusetzen ist. Es handelt sich um eine kurze Passage zur »tönenden Rede« im sog. System der Sittlichkeit (ca. 1802). Dort heißt es, nachdem die »tönende Rede« als das Medium vorgestellt wurde, darin »das Individuum, die Intelligenz, der absolute Begriff ... in seiner Bestimmt- heit heraus[trete]«, daß demgegenüber das Tier »seine Stimme nicht aus der Tota- lität« herausgebäre; die Stimme des Tiers komme zwar »aus seiner Punktualität, oder aus seinem Begriffsein«, aber erst beim Menschen, d. h. dem »absoluten Punkt des Individuums«, stelle sich die Totalität in der tönenden Rede dar: »Die Körper- lichkeit der Rede aber stellt die Totalität resumiert in die Individualität dar; das absolute Einbrechen in den absoluten Punkt des Individuums, dessen Idealität in ein System inwendig auseinandergetrieben ist.« Wie der Fortgang des von Hegel nicht veröffentlichten Manuskripts zeigt, versteht er unter dem ›absoluten Punkt des Individuums‹ oder dem ›absoluten Begriff‹ aber die »Person« (G. W. F. Hegel, Frühe politische Systeme, Frankfurt a. M. 1974; darin: System der Sittlichkeit, S. 15- 102; hier: S. 30f., 40). Noch eine Bemerkung. Man könnte gegen unsere Annäherung des Sinnes von ›Be- stimmen‹ und ›Stimme‹ geltend machen, daß Hegel selbst wiederholt die Negati- vität, die im Bestimmen liegt, betont habe (z. B. TWA Bd. 5, S. 121; nach dem Satz des Spinoza ›Omnis determinatio est negatio‹, vgl. dazu den Brief Spinozas an J. Jelles vom 2. Juni 1674). Tatsächlich versteht man die spezifische Charakterisierung der Persönlichkeit am Ende der Logik nicht, wenn man nicht auch diesen Sinn von ›Bestimmen‹ miteinbezieht. Die Logik ist als die Bewegung der Selbstbestimmung des reinen Begriffs zu fassen. Wenn man ›Bestimmen‹ nun im negativen, d. h. ein- schränkenden Sinn faßt, so stellt sich diese Bewegung gesamthaft als eine Konkre- tisierung, d. h. als ein fortschreitendes Bestimmterwerden des Inhalts des Reichs des reinen Begriffs dar. Dabei ist wesentlich, daß die Länge dieser Bewegung des Einschränkens parallel geht mit einer Ausdehnung und Vervielfältigung der auf- genommenen Bestimmungen. Die Bestimmung, die zunächst als Determination und d. h. als Negation zu fassen ist, entfaltet über ihre Vervielfältigung und Aus- breitung in einer Kette von Bestimmungen schließlich eine in sich mannigfaltige Struktur: »Jede neue Stufe des Außersichgehens, d. h. der weiteren Bestimmung, ist auch ein Insichgehen, und die größere Ausdehnung [ist] ebensosehr höhere Intensität« (TWA Bd. 6, S. 570). Hegel denkt auch die Bewegung im Bereich des Logischen nicht als einsinnige Bewegung: Auch in der Sphäre des reinen Begriffs ist die Bewegung der Kontraktion zugleich eine Expansion und die Bewegung der Expansion zugleich eine Kontraktion. Das Einschränkende und Fortbestimmende der Bewegung ist zugleich als ein Reicherwerden gefaßt. So wird erst im Rückblick, d. h. nach dem Durchgang durch die feinen Verästelungen des sich immerfort Kon- kretisierenden das Ganze in seiner Einheit als ein Sichselbstbestimmendes offenbar. Dieses Selbst aber, das in allen Bestimmungen das Treibende war, findet schließlich in all den durchlaufenen Momenten sich selbst. »Die höchste, zugeschärfteste Spitze ist die reine Persönlichkeit, die allein durch die absolute Dialektik, die ihre Natur ist, ebenso alles in sich befaßt und hält, weil sie sich zum Freiesten macht, - zur Einfachheit, welche die erste Unmittelbarkeit und Allgemeinheit ist« (ebd.). Erst wenn man die die reine Persönlichkeit ausmachende Vielzahl der Bestimmungen als Äußerungen ihrer selbst zu fassen imstande ist, wird einsichtig, warum die größte Ausdehnung mit einer höchsten Intensität einhergeht. Dazu ist der Schritt vom Verständnis des fortgehenden Bestimmens als Beschränken zur Auffassung not- wendig, daß in allen Bestimmungen das ursprüngliche - als geäußertes sogleich wieder verschwindende - Wort es ist, das diese zum Einfachen und Unmittelbaren zurückholt. So - als dieses Insichselbstzusammenstimmende - ist das ›personare‹ zu denken.
1 in: G. W. F. Hegel, Religionsphilosophie I, hg. v. K.-H. Ilting, Napoli 1978; hier: S. 537, 527 (Vorlesungsmanuskript Hegels [1821] ). Dazu: F. Wagner, Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes bei Fichte und Hegel, Gütersloh 1971; zu Hegel: S. 137- 288
2 vgl. dazu auch: TWA Bd. 14, S. 154ff. In diesem Kapitel der Ästhetik zur religiösen Liebe legt Hegel den Begriff des Absoluten vor dem Hintergrund der Liebe dar.
1 Der erste Paragraph zur fürstlichen Gewalt lautet: »Die fürstliche Gewalt enthält selbst die drei Momente der Totalität in sich (§ 272), die Allgemeinheit der Verfas- sung und der Gesetze, die Beratung als Beziehung des Besonderen auf das Allge meine, und das Moment der letzten Entscheidung als der Selbstbestimmung, in welche alles Übrige zurückgeht und wovon es den Anfang der Wirklichkeit nimmt. Dieses absolute Selbstbestimmen macht das unterscheidende Prinzip der fürstlichen Gewalt als solcher aus, welches zuerst zu entwickeln ist.«
1 in: A. Redlich, Die Hegelsche Logik als Selbsterfassung der Persönlichkeit, Mei- senheim am Glan 1971, S. XII
2 Ich weise jedoch darauf hin, daß auch Th. Hobbes in seinem Leviathan den für seine politische Philosophie wichtigen Begriff der Person aus der Sphäre des Thea- ters herkommen sieht; vgl.: Th. Hobbes, English Works, Vol. III: Leviathan, London 1839 (Reprint: Aalen 1962); Chapter XVI: Of Persons, Authors, and Things personated, S. 147-152
3 An dieser Stelle könnte etwa gefragt werden: Wie kommt Hegel überhaupt dazu, von einer ›Persönlichkeit des Staates‹ zu sprechen? Erst diese Rede erzeugt die Evidenz der den Staat vetretenden Staatsperson, des Monarchen. - Hegel unterläßt es in diesem Zusammenhang, auf die Logik und d. h. deren Schlußkapitel zur absoluten Idee hinzuweisen. Er erläutert die Herkunft des Begriffs vielmehr so, daß er die im »unmittelbaren Rechte« auftretende »abstrakte Persönlichkeit« (vgl.: §§ 35ff.) hier, »im absoluten Rechte, dem Staate«, zur »Gewißheit seiner selbst«, zur »Persönlichkeit des Staates« werden läßt (TWA Bd. 7, S. 445). Zur Begründung dieser Entwicklung wird angeführt, daß es zur Wissenschaftlichkeit einer Wissen- schaft gehöre »die Ableitung ihres ganzen Inhalts aus dem einfachen Begriffe « zu leisten (ebd.). In der Wissenschaft des Rechts ist dieser Begriff: der Wille. Die erste abstrakte Existenz dieses Willens ist aber das Subjekt als Person (§ 35). Da nun im Fortgang der Wissenschaft des Rechts der Anfang sich erhält und zugleich sich in sich verdichtet und auf diese Weise einen konkreten Inhalt gewinnt, ist das Letzte schließlich in der »vollkommen konkreten Objektivität des Willens«, der Persön- lichkeit des Staats gefunden (ebd.). - Die so charakterisierte Methode der Philo- sophie des Rechts hat ihr Vorbild in der Wissenschaft der Logik. (Zur ›Per- sönlichkeit des Staates‹ vgl. außerdem: K. Larenz, Hegels Dialektik des Willens und das Problem der juristischen Persönlichkeit (1931). Für Larenz erreicht die Rechtsphilosophie in dem »Begriff der konkreten Gesamtpersönlichkeit des Staa- tes« und d. h. der »konkreten Willensallgemeinheit« »ihre Vollendung und ihr Resultat« [Der erstmals im Bd. 20 von Logos. Internationale Zeitschrift für Philo- sophie der Kultur erschienene Text ist wiederabgedruckt in: G. W. F. Hegel, Grund- linien der Philosophie des Rechts, hg. v. H. Reichelt, Frankfurt Berlin Wien 1972, S. 733-778; hier S. 749 u. 751)
1 Hegel fügt an, daß eine Hilfe zum Verständnis dieses unmittelbaren Umschlags vom Begriff in die Realität in der Vorstellung des auf göttliche Autorität gegrün- deten Rechts des Monarchen liege (S. 446). Aufgrund dieser Bemerkung kommt es dann zu einem kurzen historischen Exkurs über die allmähliche Verschiebung des Herkunftsortes der letzten Entscheidung in der Geschichte des Politischen (ebd., S. 448f.). Vorausgesetzt wird dabei, daß alle Handlung und Wirklichkeit im Bereich des Politischen ihren »Anfang und ihre Ausführung in der entschiedenen Einheit eines Anführers« nimmt (S. 448). Vor dem Hintergrund dieser Voraussetzung läßt sich dann fragen: Woher beziehen, vormals und jetzt, die Entscheidungen dieser Anführer ihre Legitimation? Nach Hegel lassen sich diesbezüglich geschichtlich drei Stufen unterscheiden: 1. Die letzten Entscheidungen über die großen Angelegenheiten des Staates werden von Orakeln, aus Eingeweiden der Tiere oder dem Fressen und Fluge der Vögel hergeholt. [Hegel führt andernorts Belege für diese erste Stufe an: So fänden sich in Xenophons Anabasis öfters Stellen, da der Feldherr seine Entscheidung aus den Eingeweiden von Opfertieren nehme (vgl. TWA Bd. 18, S. 493)] 2. Mit dem » Dämon des Sokrates « tritt ein Wendepunkt ein, denn: Der »sich vorher nur jenseits seiner selbst versetzende Wille« verlegt sich nun innerhalb seiner und erkennt sich; mit dem Dämon des Sokrates sei deshalb der »Anfang der sich wis- senden und damit wahrhaften Freiheit« gemacht. [In diesem Zusammenhang ist auf die Darstellung der »welthistorischen Person« des Sokrates in den Vorlesun- gen über die Geschichte der Philosophie hinzuweisen (TWA Bd. 18, S. 441- 516; hier: S. 441). Mit dem Dämon des Sokrates, heißt es da, der »in der Mitte zwischen dem Äußerlichen der Orakel und dem rein Innerlichen des Geistes« (ebd., S. 495) stehe, sei »der Mittelpunkt der ganzen weltgeschichtlichen Konversion« gegeben; mit ihm - Sokrates - an der Spitze wäre es in Griechenland geschehen, daß die »Sittlichkeit in Moralität um[ge]schlagen« sei (ebd., S. 468), d. h. das Ent- scheiden - das auch eine Last ist - vom Subjekt übernommen worden sei.] 3. Die letzte Stufe findet Hegel schließlich im ›Ich will‹ des Monarchen; mit ihm ist die Entscheidung gänzlich vom Äußeren abgelöst und völlig ins Innere des Men- schen verlegt. »Dieses ›Ich will‹«, so formuliert ein Zusatz zum § 279 der Rechts- philosophie, »macht den großen Unterschied der alten und modernen Welt aus, und so muß es in dem großen Gebäude des Staates seine eigentümliche Existenz haben.« (TWA Bd. 7, S. 449) [Zusatz. In diesem Zusammenhang ist auf eine noch kaum beachtete, der Hegel- schen Entwicklungssystematik zugrundeliegende Differenz hinzuweisen. Ich mei- ne die an verschiedenen Stellen des Werks angezogene Differenz des Sinnes von Personifikation und Persönlichkeit. Während die Personifikation nach Hegel eine frühe und zu überwindende Weise des äußerlichen Vorstellens der Götter oder des Göttlichen darstellt, wird im Christentum - und nur in ihm - der Gott schließlich als die an und für sich seiende absolute Persönlichkeit gewußt. Auch dieser ent- wicklungssystematische Fortgang arbeitet mit der Differenz von Äußerem und Innerem, genauer: mit dem Nach-innen-gehen eines zunächst dem Äußerlichen angedichteten, wobei parallel zu diesem Nach-innen-gehen dem auffassenden Sub- jekt die Erkenntnis erwächst, daß der Gott ihm als »gegenständliche Selbständig- keit« gegenübersteht (vgl. TWA Bd. 11, S. 186; oder auch zu Personifikation und Persönlichkeit allgemein: TWA Bd. 8, S. 291f.; TWA Bd. 13, S. 421; TWA Bd. 14, S. 47f.). Diese Beobachtung ließe sich, wie mir scheint, für die Deutung der in der Berliner Niederschrift der Einleitung in die Geschichte der Philosophie (1820) ex- ponierten Dialektik von Verhüllen und Enthüllen fruchtbar machen (TWA Bd. 20, S. 465-519; bes. S. 493ff.). Indem das dort sog. verhüllende Anthropomorphistische als dasjenige verstanden würde, was Hegel andernorts das Personifizieren nennt, ließe sich das Enthüllen dieses Verhüllten als jene Bewegung der Vernunft fassen, die schließlich im Anderen - d. h. der zur völligen Konkretion sich entwickelnden absoluten Persönlichkeit - sich selbst erkennt.]
1 Obwohl dieser Zusatz in der zweiten Auflage der Rechtsphilosophie leicht verän- dert erscheint, darf angenommen werden, daß die Rede vom Ja-sagenden und Punk- te-setzenden Monarchen von Hegel stammt. Wie sonst käme der Herausgeber der Rechtsphilosophie (E. Gans) auf den Gedanken, in einem Artikel genau diese Wen- dung vor einem Kritiker in Schutz zu nehmen? So gilt für diese Bestimmung, was Gans im Vorwort zur zweiten Auflage gesagt hat: »Das in den Zusätzen Enthaltene ist von Hegel gegeben, und ich kann im Notfall dies aus meinen Quellen beweisen: es findet sich weder eine Ausführung von mir, noch eine Entstellung des Ausge- führten.« (in: Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie I, hg. v. M. Riedel, Frank furt a. M. 1975; hier: S. 248; für den genannten Artikel von Gans vgl. insbes. S. 271) - Gans’ Quellen liegen mittlerweile gedruckt vor. Die Vorlage für die zitierte Pas- sage findet sich in einer Nachschrift von Hotho, die dieser während eines Kurses im WS 1822/23 angefertigt hat; vgl. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über Rechts philosophie 1818-1831. Edition und Kommentar in sechs Bänden v. K.-H. Ilting, Stuttgart-Bad Cannstatt 1973ff. (unabgeschlossen); hier: Bd. 3, S. 764
1 Bezeichnenderweise vermerkt das Etymologische Wörterbuch von L. Mackensen zum Stichwort ›Ja‹: »Herkunft unbekannt«. Gemäß unserer Deutung haben wir es beim ›Ja‹ um den inhaltslosen Ausdruck einer Selbstaffirmation der Stimme zu tun. - Schlechthin entscheidend ist, daß die sich in einem ›Ja‹ äußernde Stimme die Stimme eines Monarchen ist. Man vergleiche dazu Hegels Entrüstung über den entgegengesetzten Fall in seiner in der Allgemeinen preussischen Staatszeitung kurz vor seinem Tod erschienenen Schrift Ü ber die englische Reformbill (1831). Nach- dem das ›Pamphlet‹ - so bezeichnen die Herausgeber der Theorie-Werkausgabe den Text zur Reformbill - bereits mit dem ausdrücklichen Hinweis einsetzt, daß die Bill in ihrer zweiten Lesung »nur durch den Zufall einer Stimme durchgegangen ist« und Hegel offen gegen die im Hintergrund angesetzte schwankende, d. h. ein- mal dies und einmal jenes gutheißende »öffentliche Stimme Grossbritanniens« an- gegangen ist, kommt er auch am Ende noch einmal auf die ungerechtfertigte, bloß quantitativ durch eine Stimme entstandene Majorität zu sprechen, die das Mini- sterium des Herzogs von Wellington zur Abdankung zwang (TWA Bd. 11, S. 83- 128; hier: S. 83f., S. 124).
2 vgl. zur Geburt als Sprung: TWA Bd. 5, S. 440; TWA Bd. 11, S. 536f.
1 Der Wortlaut des § 281 ist: »Beide Momente in ihrer ungetrennten Einheit, das letzte grundlose Selbst des Willens und die damit ebenso grundlose Existenz, als der Natur anheimgestellte Bestimmung, - diese Idee des von der Willkür Unbe- wegten macht die Majestät des Monarchen aus. In dieser Einheit liegt die wirkliche Einheit des Staats, welche nur durch diese ihre innere und ä ußere Unmittelbarkeit der Möglichkeit, in die Sphäre der Besonderheit, deren Willkür, Zwecke und An- sichten herabgezogen zu werden, dem Kampf der Faktionen gegen Faktionen um den Thron und der Schwächung und Zertrümmerung der Staatsgewalt entnommen ist.«
2 So: M. Theunissen, Hegels Lehre vom absoluten Geist als theologisch-politischer Traktat, Berlin 1970, S. 445. Theunissen spricht im Schlußkapitel seiner grossange- legten Arbeit außerdem von der »Maske des Staates« durch die das »Antlitz Christi« hindurchscheine; schließlich vom Staat als dem »väterlichen Gott« und dem Mo- narchen als dessen »Sohn« (ebd., S. 444). - Zur Sache vgl. auch den Beitrag Ur- menschheit und Monarchie. Eine politische Christologie der Hegelschen Rechten von W. Jaeschke (in: Hegel-Studien, Bd. 14, 1979, S. 73-107). Jaeschke macht darin ein Manuskript C. F. Göschels bekannt, darin ein Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit Gottes in Christus und der Persönlichkeit des Monarchen herge stellt wird. Sein Kommentar des Textes situiert die ›politische Christologie‹ Göschels im zeitgenössischen Umfeld - nicht ohne darauf hinzuweisen, daß sich diese durchaus auf »Ausführungen der Rechtsphilosophie Hegels ... berufen« kön- ne. - Eine nähere Untersuchung dieses Hintergrundes hätte die Rolle, die Hegel der Familie in der Rechtsphilosophie zuteilt, miteinzubeziehen. Ob dabei eine so- genannte ›Heilige Familie‹ das Medium darstellt, das es Hegel erlaubt, das christ- liche Vater-Sohn-Verhältnis auf den Staat und die Geburt des Monarchen zu über- tragen, bliebe allerdings zweifelhaft. Dazu folgendes: Bereits im dritten Jenaer Systementwurf setzt Hegel den Monarchen an die Spitze und in die Mitte des Staates. Dort findet sich auch die Rede vom »Knoten« des Monarchen . Der »erb- liche Monarch« wird als der »feste unmittelbare Knoten des Ganzen« vorgestellt (GW Bd. 8, S. 263). Doch ist er zugleich, da das Ganze die Mitte als der »freye Geist« ist, der » leere Knoten «. Bereits in diesem frühen Manuskript wird der Mo- narch als ein notwendiges und zugleich formelles Moment im Staat gefaßt: Auf die »Beschaffenheit des Regenten« kommt es nicht an. Bemerkenswert an dieser frühen Darstellung ist, daß Hegel in ihr von der »Familie des Fürsten« als der »einzig[] positive[n]«, d. h. als der einzigen spricht, die nicht zu »verlassen« sei (ebd., S. 264). Geht man im Manuskript weiter zurück, entdeckt man schließlich folgende Be- merkung zur Familienzugehörigkeit: »Verwandte sind dasselbe Blut, dasselbe aner- kanntseyn« (ebd., S. 239). Wie mir scheint, ist die spätere Konstruktion der Familie in der Rechtsphilosophie das Ergebnis zweier systematischer Erfordernisse: Die Familie, die dort eine wichtige Hauptstation auf dem Wege von der abstrakten zur konkreten Persönlichkeit ausmacht, wird von Hegel dazu eingesetzt, die » e i n e Person « zu bilden (TWA Bd. 7, S. 310). Während die Rede von der ›einen Person‹ auf die Einheit der Persönlichkeit des Staates im Monarchen vorausverweist, wird mit dieser Idee der Familie zugleich auf die nicht mehr zu verlassende Familie des Fürsten hingedeutet. Allerdings ist wichtig zu sehen, daß die Aufmerksamkeit He- gels auf die Familie erst vor dem Hintergrund der Entwicklungen der spekulativen Philosophie Bedeutung erlangt. Die letztwichtige Verwandtschaft liegt entspre- chend nicht so sehr in der ›Familie des Fürsten‹, sondern in der geistigen Verwandt- schaft des Monarchen und der spekulativen Philosophie - deshalb ist es auch nur dieser erlaubt, den Monarchen denkend zu betrachten. In eben dieser Verwandt- schaft drückt sich die Idee im Hegelschen Sinne aus, - die Idee wird von ihm als die Einheit von Begriff und Realität gefaßt.
1 Hegel selbst gebraucht in seiner Beschreibung des Staates gelegentlich das Symbol der Pyramide (bes. in: G. W. F. Hegel, Vorlesungen über Naturrecht und Staats- wissenschaft, Heidelberg 1817/18 mit Nachträgen aus der Vorlesung 1818/19, nachgeschrieben v. P. Wannemann, hg. v. C. Becker et al., Hamburg 1983, S. 182, 187, 201). Zur ›Pyramide‹ als dem Hegelschen Namen für das Zeichen schlechthin vgl.: J. Derrida, Le Puits et la Pyramide. Introduction à la Sémiologie de Hegel; in: ders., Marges de la Philosophie, S. 79-127). Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die oben zitierte Passage aus der Differenzschrift. Im Vergleich mit dem dort angesetzten Umschlagspunkt auf der Spitze der ›Pyramide der Natur‹ setzt Hegel hier eine sprechende, den Punkt setzende Person an die Spitze der Pyramide.
1 Frage: Wie ist dieses ›Dieses‹ zu denken? In den Vorlesungen über die Philo- sophie der Geschichte wird wiederholt Christus als die Erscheinung eines ›Die- sen‹ begriffen. Indem dieser Mensch, Christus, Gott ist, ist ein Wendepunkt in der Weltgeschichte markiert: »Bis hierher und von daher geht die Geschichte« (TWA Bd. 12, S. 386), sagt Hegel. Schließlich werden die Kreuzzüge als Suche nach dem für die katholische Kirche verlorengegangenen ›Diesen‹ vorgestellt (ebd., S. 467ff.; das ›Diese‹ ist die Hostie und deshalb suchen die Katholiken es außerhalb ihrer selbst; ebd., S. 469). Erst die Reformation, und d. h. ein »einfacher Mönch« (Luther) findet sodann das vormals »in einem irdischen, steinernen Grabe« Gesuchte (ebd., S. 494). Wo? Im Herzen. »Luthers einfache Lehre ist, daß das Dieses, die unendliche Subjektivität, d.i. die wahrhafte Geistigkeit, Christus, auf keine Art in äußerlicher Weise gegenwärtig und wirklich ist, sondern als Geistiges überhaupt nur in der Versöhnung mit Gott erlangt wird - im Glauben und im Genuße « (ebd.). - Die entscheidende Frage lautet: Wie verhält sich das ›Diese‹ des Christentums zu dem ›Diesen‹ im politischen Staat? Antwort: Nicht so, daß dieser Monarch nun der menschgewordene Gott wäre, aber so, daß nur im nachreformatorischen Zeitalter die innere Einsicht für die Notwendigkeit eines ›Diesen‹ im allgemeinen erwartet werden kann. Deshalb bindet Hegel seine Idee der konstitutionellen Monarchie stets an die mit der Reformation erreichte Stufe der Weltgeschichte; nur hier stößt - nach ihm! - der Monarch auf ein vom Herzen ausgehendes Begreifen.
1 vgl. etwa das Hegel-Kapitel in Schellings Münchener Vorlesungen (1827) Zur Ge- schichte der neueren Philosophie (in: SW, 1. Abt., Bd. X) oder auch die Ausführun- gen in der Paulus-Nachschrift der Philosophie der Offenbarung von 1841/42 (hg. v. M. Frank, Frankfurt a. M. 1977, S. 121-139)
2 So ist in der Logik Hegels etwa auch das Leben thematisch. Die ersten beiden Sätze des entsprechenden Kapitels lauten: »Die Idee des Lebens betrifft einen so konkre- ten und, wenn man will, reellen Gegenstand, daß mit derselben nach der gewöhn lichen Vorstellung der Logik ihr Gebiet überschritten zu werden scheinen kann. Sollte die Logik freilich nichts als leere, tote Gedankenformen enthalten, so könnte in ihr überhaupt von keinem solchen Inhalte, wie die Idee oder das Leben ist, die Rede sein.« (TWA Bd. 6, S. 469) In der Folge unterscheidet Hegel das »logische Leben« als das »einfache Insichsein« (ebd., S. 471) vom natürlichen und vom gei- stigen Leben. Damit zu vergleichen ist eine Passage aus der späteren Vorrede zur zweiten Auflage der Logik. Nachdem Hegel die Auffassung, es ließe sich eine Darstellung des Logischen geben, die mit dem Unterschied von Form und Inhalt operiert, abgewiesen hat, heißt es: »Die tiefere Grundlage ist die Seele für sich, der reine Begriff, der das Innerste der Gegenstände, ihr einfacher Lebenspuls, wie selbst des subjektiven Denkens derselben ist. Diese logische Natur, die den Geist beseelt, in ihm treibt und wirkt, zum Bewußtsein zu bringen, dies ist die Aufgabe.« (TWA Bd. 5, S. 27)
- Arbeit zitieren
- Markus Semm (Autor:in), 1994, Die Sache selbst in Hegels System, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109845
Kostenlos Autor werden
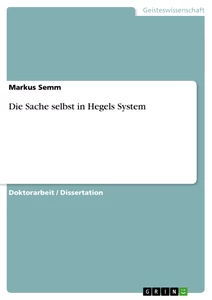

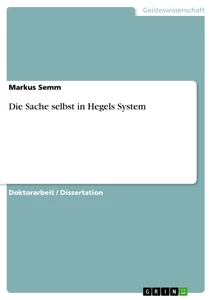





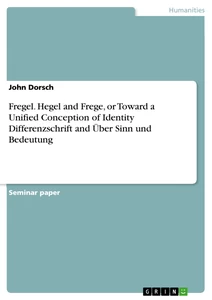
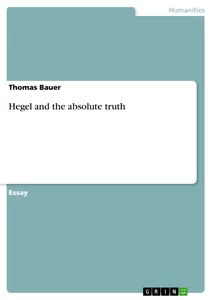
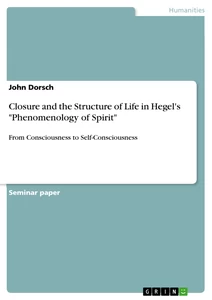
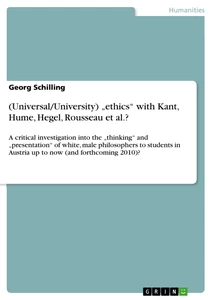
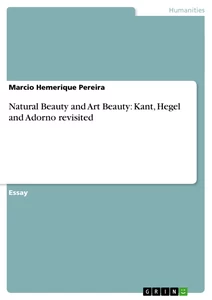
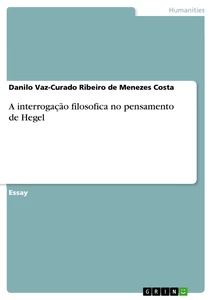
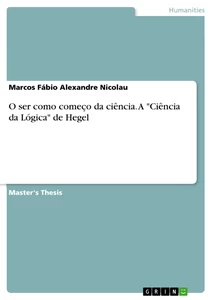





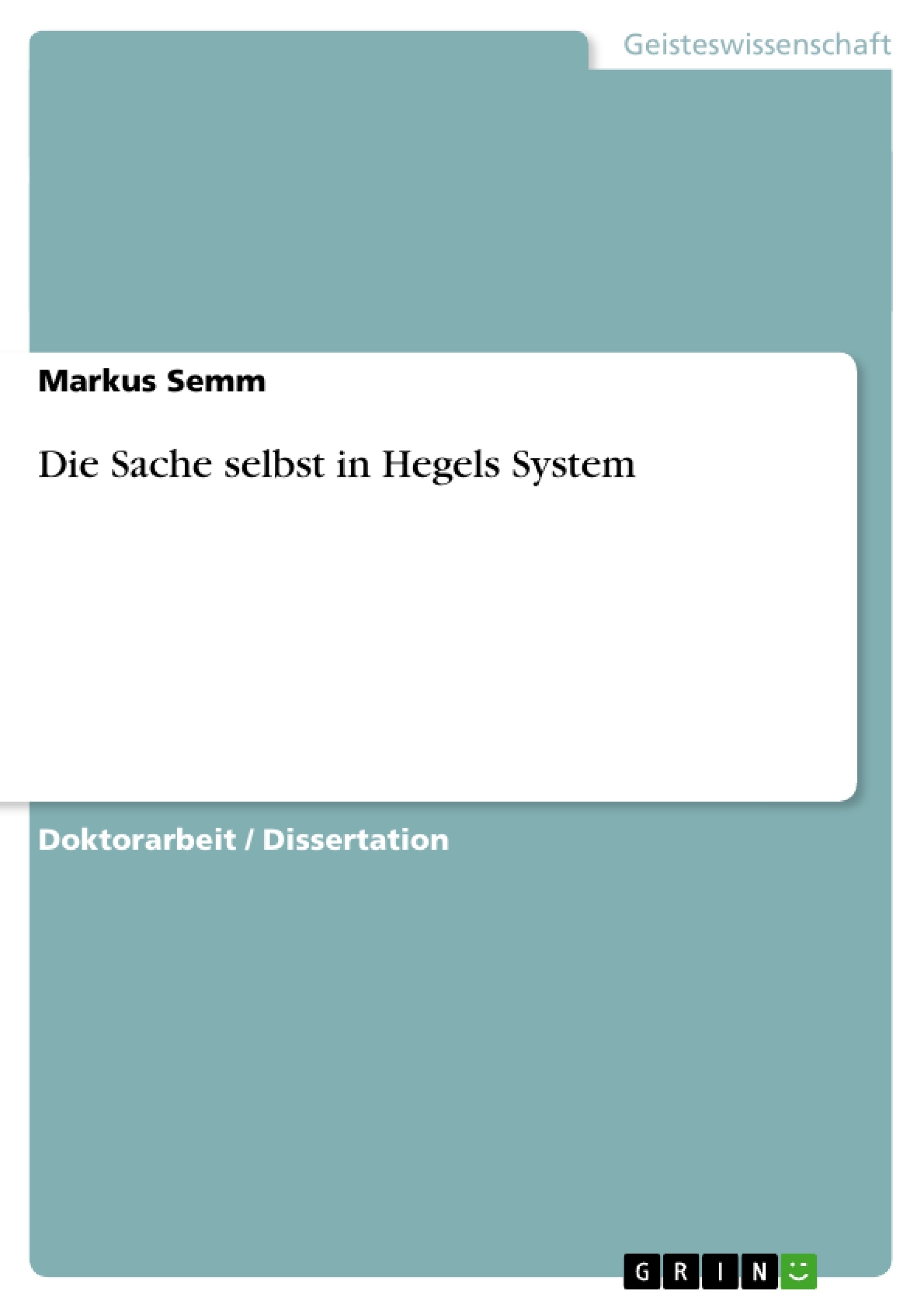

Kommentare