Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Der Durchbruch: Die Möwe
1.1. Das Neue in Tschechows Theater
1.2. Stanislawskis „Partitura“
1.3. Proben am Künstlertheater
1.4. Reaktionen auf Die Möwe
2. Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt
2.1. Onkel Wanja
2.2. Der Berg kommt zum Propheten
2.3. Drei Schwestern
3. Stanislawski „ruiniert“ den Kirschgarten
3.1. Missverständnisse bei der Probenarbeit
3.2. Komödie oder Tragödie?
4. Stanislawski als Tschechow-Schauspieler
5. Resümee
Literaturverzeichnis
0. Einleitung
»Wenn ein betrunkener Arzt auf dem Sofa liegt und es draußen regnet, so wird das, nach Meinung Ĉechovs, ein Theaterstück und, nach Meinung Stanislavskijs – Stimmung; meiner Meinung nach wird das nur furchtbar langweilig, und auf dem Sofa liegen kann man, solange man will – eine dramatische Handlung wird daraus nie...« (Lew Tolstoi, Frühjahr 1903, zit. nach Urban: 345)
Tschechow und Stanislawski[1], zwei große Namen der russischen Literatur und des Theaters, sind eng miteinander verbunden. Das Moskauer Künstlertheater (MChT) unter der Leitung von Wladimir Iwanowitsch Nemirowitsch-Dantschenko und Konstantin Sergejewitsch Aleksejew (mit Künstlernamen Stanislawski) bringt an der Schwelle zum 20. Jahrhundert mit großem Erfolg die Theaterstücke Tschechows auf die Bühne und begründet damit eine neue russische Theatertradition. Alles beginnt mit der umjubelten Premiere von Die Möwe am 17. Dezember 1898. Die anderen Stücke Onkel Wanja (1899), Drei Schwestern (1901), Der Kirschgarten (1904) und Iwanow (1904) brauchen jeweils eine gewisse Anlaufzeit, werden aber alle über viele Jahre gespielt und zählen zu den erfolgreichsten Produktionen des Theaters.
Mich interessiert in dieser Arbeit, was Tschechows Theater ausmacht, wie Stanislawski damit umgeht und warum das Künstlertheater damit so erfolgreich sein kann. Es soll dabei weniger um Stanislawskis Schauspieltheorie gehen, für die die „Tschechow-Epoche“ am MChT allerdings eine wesentliche Grundlage gewesen sein dürfte. Vielmehr soll der konkrete Arbeitsprozess an der Möwe im Vordergrund stehen, der anhand von Stanislawskis genauem Inszenierungskonzept – nicht der tatsächlichen Aufführung – analysiert wird. Ferner möchte ich zeigen, wie sich das spezielle Verhältnis zwischen Autor und Theater durch die mehrjährige Zusammenarbeit entwickelt hat. Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Aufgabe des Regisseurs noch eine recht junge Erfindung[2]. Allein schon deshalb ist die Beziehung zwischen Autor und Regisseur eine sehr interessante. Sie stellt sich bei Tschechow und Stanislawski als besonders mehrdeutig heraus.
1. Der Durchbruch: Die Möwe
Bei der Uraufführung der Möwe ist Tschechow 36 Jahre alt und die Symptome seiner Lungentuberkulose treten immer deutlicher zu Tage. Der aus dem südrussischen Taganrog stammende Arzt hat sich bereits als Autor von humoristischen Kurzgeschichten und Erzählungen einen Namen gemacht[3]. Seit seiner Jugend ist Tschechow fasziniert vom Theater und so versucht er sich bald selbst als Dramatiker. 1889 schreibt er an Pleschtschejev: „Die erzählende Form ist wie eine legitime Frau, die dramatische dagegen wie eine blendend schöne, lärmende, freche und ermüdende Geliebte!“ (zit. nach Laffitte: 80). Sein Iwanow wird in jenem Jahr erfolgreich in St. Petersburg uraufgeführt, die Einakter spielt man in den Provinztheatern.
Ganz im Gegensatz zu seinen dramatischen Helden, ist Tschechow ein sehr aktiver Mensch. Er praktiziert als Arzt, schreibt Novellen, gründet zwei Schulen, ein Krankenhaus und ein Feuerwehrdepot. (vgl. Hensel: 580) Am 21. Oktober 1895 berichtet er seinem Verleger Suvorin über den Fortschritt der Arbeit an einem neuen Stück: „Ich schreibe es nicht ohne Vergnügen, obwohl ich mich schrecklich an den Konventionen der Bühne vergehe. Eine Komödie, drei Frauenrollen, sechs Männerrollen, vier Akte, eine Landschaft (Blick auf einen See); viele Gespräche über Literatur, wenig Handlung, fünf Pud[4] Liebe.“ (zit. nach Die Möwe: 69) Tschechow, selbst unsicher, ob der neue Ton in seinem Stück überhaupt spielbar ist, übersendet das fertige Manuskriptes an Suvorin mit folgender Anmerkung: „Allen Regeln der dramatischen Kunst zum Trotz habe ich das Stück forte begonnen und pianissimo beendet ... Ich bin eher unzufrieden, und wenn ich das neu geschaffene Stück lese, werde ich in der Überzeugung bestärkt, daß ich überhaupt kein Dramatiker bin. ... Geben Sie es niemandem zu lesen.“ (Brief vom 21.11.1895 zit. nach Troyat: 207)
1.1. Das Neue in Tschechows Theater
Die Möwe spielt auf einem russischen Landsitz. Dort treffen Künstler auf Provinzgesellschaft: Die Schauspielerin Arkadina ist mit ihrem Sohn, dem jungen Schriftsteller Konstantin Treplev, und dem erfolgreichen Schriftsteller Trigorin bei ihrem Bruder Sorin zu Besuch. Nachdem eine Aufführung Treplevs Theaterstückes im ersten Akt misslingt, wird ein Geflecht auswegloser Beziehungen entfaltet. Die junge Schauspielerin Nina möchte berühmt werden, darum verschmäht sie die Liebe des erfolglosen Treplev und sucht die Nähe Trigorins, mit dem sie später ein Verhältnis hat. „Jeder möchte das sein und besitzen, was ihm unerreichbar ist. [...] alle müssen Rollen spielen, die sie sich nicht gewünscht haben, und träumen von Rollen, die sie nie erhalten werden [...]“ (Hensel: 583) Das melancholische Träumen und Treiben endet nach einem Streit zwischen Arkadina und den Landleuten mit der Abreise der egoistischen Schauspielerin. Nach zwei Jahren begegnen sich alle wieder und es zeigt sich, dass jeder von ihnen mit seinen Träumen gescheitert ist. Treplev liebt immer noch Nina, sie weist ihn abermals zurück. Die Möwe endet mit dem Selbstmord Treplevs. „Das Stück legt Zeugnis ab für die Absurdität des menschlichen Schicksals. Nach Meinung des Autors gibt es kein edles Anliegen, keinen großen Entwurf, der nicht früher oder später scheitert.“ (Troyat: 214)
Mit den beiden Schriftstellern verhandelt Tschechow in der Möwe zwei Konzepte der Kunst und des Theaters. Autobiografische Momente treten sowohl in der Figur des erfolgreichen Schriftstellers Trigorin, als auch im jungen, revolutionären Dramatiker Treplev zutage. (vgl. Laffitte: 80ff., Troyat: 214f.) Wie Trigorin führt Tschechow Notizbücher, in denen er alltägliche Notizen, Beobachtungen, Gesprächsfetzen und Ideen für Stoffe fest hält. Aus Trigorins Leiden unter der Routine seines Schreibens, spricht Tschechows eigene schöpferische Angst (vgl. Troyat: 214):
„Tag und Nacht beherrscht mich der eine aufdringliche Gedanke: ich muß schreiben, ich muß schreiben, ich muß ... Kaum bin ich mit einer Novelle fertig, muß ich aus irgendeinem Grunde schon die nächste schreiben, dann die dritte, nach der dritten die vierte ... Ich schreibe ununterbrochen, am laufenden Band, ich kann nicht anders. [...] Ich beobachte mich selbst und Sie bei jedem Satz, bei jedem Wort und schließe all diese Sätze und Wörter schnellstens in meine literarische Vorratskammer ein: irgendwo paßt es vielleicht mal. [...] Wenn ich schreibe, ist es angenehm. Auch Korrekturlesen ist angenehm, aber ... kaum ist es erschienen, und schon ertrage ich es nicht mehr, schon sehe ich, daß etwas nicht stimmt, ein Fehler, daß ich es überhaupt nicht hätte schreiben sollen, und ärgere mich, und mir wird ganz übel ... Lacht. Und das Publikum liest es: 'Ja ganz hübsch, talentiert ... Ganz hübsch, aber ein Tolstoj ist er nicht', [...] schließlich und endlich fühle ich, daß ich eben doch nur Landschaften schildern kann, in allem übrigen bin ich falsch und falsch bis ins Mark.“ (Die Möwe, 2. Akt, S. 33ff.)
Treplev wirft seinem erfolgreichen Kollegen vor, der Routine eines abbildenden Realismus zum Opfer gefallen zu sein. Er träumt von einer Umwälzung in der Kunst, von „neuen Formen“:
„Sie [Arkadina, seine Mutter, R.B.] liebt das Theater, sie glaubt sie diene der Menschheit, der heiligen Kunst, aber für mich ist das moderne Theater Routine, Konvention. Wenn der Vorhang aufgeht und bei abendlicher Beleuchtung in einem Zimmer mit drei Wänden diese großen Talente, die Priester der heiligen Kunst vorführen, wie die Leute essen, trinken, lieben, herumgehen, ihre Westen tragen; wenn sie sich bemühen, aus abgeschmackten Bildern und Sätzen eine Moral herauszuangeln – eine Moral, die klein ist, bequem verständlich, nützlich für den Hausgebrauch; wenn sie mir in tausend Variationen immer dasselbe vorsetzen, immer dasselbe, immer dasselbe, - dann fliehe ich und fliehe, wie Maupassant[5] vor dem Eiffelturm geflohen ist, der ihm in seiner Geschmacklosigkeit das Gehirn erdrückte. [...] Wir brauchen neue Formen. Wir brauchen neue Formen, und wenn es sie nicht gibt, dann brauchen wir besser gar nichts.“ (Die Möwe, 1. Akt, S. 12f.)
Was sind diese „neuen Formen“, die Tschechow hier ganz offensichtlich selbst fordert und die sein Theater auszeichnen? Sein Stil wirkt auf die meisten Zeitgenossen im russischen Theater äußerst untheatral: Darstellung des einfachen Lebens, Handlungsarmut, zu viele Pausen. Bei Tschechow fehlen die dramatischen Einzelhelden, die in großen Monologen ihre innersten Gefühle artikulieren[6]. Die „Priester der heiligen Kunst“ sind es gewöhnt – gleichsam wird es von ihnen erwartet – an exponierter Stelle an die Rampe zu treten, um das Publikum mit ihrem Können zu „beglücken“. Kurzum, herkömmliche Dramaturgie fehlt in Tschechows Theater. Ihn interessiert vielmehr die Psychologie der russischen Gesellschaft. „[...] Handlung erschien plötzlich als komplizierte innere Tätigkeit, die sich unter der Oberfläche der Worte und des szenischen Diskurses verbarg [...]“ (Hoffmeier: 30).
Tschechows Figuren sind statisch, passiv, es gibt kaum Entwicklungen; sie können sich nicht aus ihren Situationen befreien. Allein der Möwe, Nina, gelingt es ihren Traum als Schauspielerin zu verwirklichen, alle anderen Figuren (im Prinzip auch Treplev) stehen nach zwei Jahren, im vierten Akt, an gleicher Stelle wie zuvor. Schüchternheit (Mascha), Halsstarrigkeit (Treplev), Egoismus (Arkadina) sind Schuld an ihrer Entfremdung. Sie reden aneinander vorbei, Gefühle stauen sich an, ohne sich immer theatral wirksam zu entladen. Tschechow zeigt die einfachen Leute, wie sie „essen, trinken, lieben, herumgehen“, ohne sie „moralisch [zu] bewerten, sondern diagnostiziert wie ein Arzt, den die Moral nichts angeht.“ (Hensel: 580). Das wahre Drama spielt sich zwischen den Zeilen ab, das Publikum muss weiterdenken. Tschechow schreibt: „Wozu dem Publikum jedesmal erklären, was es vor sich habe? Man muß es erschrecken, und das genügt. Es ist dann interessiert und beginnt noch einmal nachzudenken.“ (Brief an Suvorin 1891, zit. nach Laffitte: 84)
Auch Schauspieler und Regisseure müssen nach- und weiterdenken. So zahlreich wie Tschechow setzte noch keiner Pausen als dramaturgisches Mittel ein. Seine Stücke sind hoch musikalisch: Abwechslung von Geräusch und Schweigen, Sätze, die plötzlich abbrechen, größere dramaturgische Entwicklungsbögen[7] werden musikalisch gestaltet, plötzliche Stilwechsel von realistischer Erzählung zu lyrischen Stellen (vgl. Laffitte: 89). Dazu die genauen Angaben über Jahreszeit und Wetter. In Tschechows neuer Ästhetik ist all das Teil der Psychologie des Stückes.
Trotz der Monotonie, der Passivität und des melancholischen Tones, bezeichnet Tschechow seine Dramen als Komödien. Tatsächlich sind sie reich bestückt mit grotesken Figuren, witzigen Szenen und komischen Widersprüchen zwischen Schein und Sein. Die geradezu mathematische Reihung von verfehlten Lieben, Träumen, Tränen und Schwachheiten in der Möwe ist für Hensel (S. 583) deutliches Merkmal einer „[...] Komödie: der menschlichen Ohnmacht und des notwendigen Scheiterns.“[8]
Tschechow ist ein unpolitischer Mensch, aber er kämpft, wie sein soziales Engagement zeigt, mit seinen Mitteln für eine bessere Zeit. Gesellschaftskritik lässt sich leicht aus seinen Stücken lesen, denn er schildert die vorrevolutionäre russische Gesellschaft so wie sie ist. „Der Dramatiker hatte die Vision, daß die ersehnte Befreiung seines Landes und Volkes aus fest gefahrenen üblen Lebensgewohnheiten, von dem feudalen Herrschaftsdruck zunächst allein bei der inneren Befreiung jedes einzelnen Menschen von seinen Zwängen und Obsessionen beginnen könne.“ (Hoffmeier: 31)
Zu den zahlreichen Anekdoten über Tschechow zählt, dass Die Möwe bei der Uraufführung am 17. Oktober 1896 im Petersburger Alexandrinksij-Theater ein kolossaler Misserfolg gewesen sein soll. Tschechow schreibt am nächsten Tag seinem Verleger: „Ich werde nie wieder Stücke schreiben oder aufführen lassen.“ (zit. nach Troyat: 218) Tatsächlich ist der Premierenabend ein Desaster, das sich in Tschechows Erinnerung einbrennt. Die acht weiteren Aufführungen laufen allerdings besser und bringen sogar einen gewissen Erfolg. Die Ursachen für die misslungene Erstaufführung sind vielfältig: Unmotivierte Schauspieler, unfähige Regie, falsches Publikum. (vgl. Senelick: 36f.) Die Premiere ist als Benefizvorstellung für die beliebte Komödiantin Lewkejewa gedacht, die in der Inszenierung dann nicht einmal auftritt. Das Publikum erwartet einen heiteren Abend, denn auch Tschechow ist damals hauptsächlich durch seine lustigen Zeitungsbeiträge bekannt. Die Schauspieler, so schreibt Senelick (vgl. 30ff.), waren schlecht ausgewählt, interessieren sich höchstens dafür, wie viel Text sie haben und erscheinen nicht einmal zu allen acht Proben. Sie deklamieren auf althergebrachte Weise ihren Text, einzig darum besorgt, ob sie gut zu sehen sind. Tschechow ist bei den Proben anwesend und ihm wird klar, dass die Aufführung scheitern muss. Die ersten bösen Lacher aus dem Premierenpublikum kommen bei Ninas Monolog (während der Aufführung Treplevs Theaterstücks). Der zweite Akt gerät unter höhnendem Gelächter und Zwischenrufen völlig aus dem Ruder. Die Aufführung endet mit Pfeifen, Zischen und Lachen.
Selbst bei Nachproben kommt niemand auf die Idee, dass Tschechows Theater eine neue Schauspielkunst verlangt (vgl. Senelick: 37).
1.2. Stanislawskis „Partitura“
1898 gründen Nemirowitsch und Stanislawski das „Moskauer Künstlertheater für alle“ (MChT). Der erste kümmert sich als Schriftsteller und Dramaturg um den Theaterbetrieb, der zweite als Schauspieler und Regisseur um die künstlerische Arbeit im Hause. Mit einem völlig neuen Theatersystem sagen sie dem konventionellen russischen Theater, Routine und Klischees den Kampf an:
„[...] wir protestierten gegen veraltete Spielweisen, gegen Theatralik und falsches Pathos, gegen das Deklamieren und Übertreiben im Spiel, gegen leere Stilisierung in Inszenierung und Bühnenbild, gegen das Starsystem, das jedes Ensemble zersetzte, gegen die ganze Struktur der Aufführungen und das armselige Repertoire der damaligen Theater.“ (Stanislawski 1987: 233)
Nemirowitsch ist mit Tschechow gut befreundet und begeistert von seinen Arbeiten, er will unbedingt Die Möwe auf den Spielplan der Eröffnungssaison setzen. Für ihn schlägt in diesem Stück „[...] der Puls des russischen Alltagslebens.“ (zit nach Troyat: 243) Tschechow weigert sich zunächst die Genehmigung zu erteilen, erst nach drei Briefen, in denen Nemirowitsch heftig Überzeugungsarbeit leistet, willigt er ein. Stanislawski ist von dem Stück und seinem neuen Stil irritiert und hält es anfänglich für unspielbar: „Ich begreife vorläufig nur, daß das Stück talentvoll und interessant ist, aber von welcher Seite ihm beizukommen ist, das weiß ich nicht.“ (Stanislawski an Nemirowitsch, 29.1.1899, zit. nach Poljakowa: 124) Nemirowitsch muss ihn von der neuen lyrischen Qualität überzeugen und rät ihm das „verborgene Drama“ bei Tschechow zu suchen. Stanislawski zieht sich im Sommer 1898 für eineinhalb Monate auf das Anwesen seines Bruders in Charkow (Ukraine) zurück und arbeitet sein Regiekonzept aus.
In der Anfangszeit des MChT entwirft Stanislawski für alle Stücke den Inszenierungsplan, der von Nemirowitsch oder Stanislawski oder beiden meist ohne große Änderungen auf der Bühne umgesetzt wird. Zwischen die Seiten des Stückes klebt Stanislawski weiße Bögen Papier, auf die er seine Arrangements zeichnet und notiert. Der Regisseur nennt seine Aufzeichnungen: „partitura“[9]. Er skizziert teilweise aufs Genaueste Orte, Stimmungen, Geräusche, sowie die innere („Psychologie“) und äußere Handlung der Figuren, aber all das muss sich der „Stimmung“ der Szene unterordnen. Dieser Plan ist wie eine Orchesterpartitur zu lesen, „[...] in which every element contributes not to exact meaning, but to atmosphere and affect.“ (Senelick: 39). Stanislawski bezeichnet seine Tschechow-Inszenierungen später als „Arbeit mit Intuition und Gefühl“. Seinen Erfolg führt er darauf zurück, begriffen zu haben,
„[...] daß die Form vom Inhalt nicht zu trennen war; daß man die literarische, psychologische oder soziale Seite eines Kunstwerkes nicht gesondert von den Figuren, Szenen und der Ausstattung betrachten konnte, die erst in ihrer Gesamtheit das Künstlerische der Inszenierung ausmachen.“ (Stanislawski 1987: 274)
In den Tschechow-„Partituren“ findet sich vor jedem Akt ein mit „Stimmung“ überschriebener Absatz, in dem Stanislawski die Grundsituation der folgenden Szenen erfasst und das Publikum einstimmt. Ausgehend von Tschechows Regieanweisungen zum ersten Akt der Möwe entwickelt er folgende Situation:
„Das Stück beginnt im Dunkeln, an einem Abend im August. Das trübe Licht einer Laterne, das entfernte Singen eines herumbummelnden Trunkenboldes, das ferne Geheul eines Hundes, das Quaken der Frösche, der Schrei eines Wachtelkönigs und die vereinzelten Schläge einer Turmuhr – helfen dem Zuschauer, das traurige, monotone Leben der handelnden Person zu erfühlen. Wetterleuchten, aus der Ferne klingt schwach Gewitterdonner. Bevor der Vorhang aufgeht, eine Pause von zehn Sekunden.“ (zit. nach Poljakowa: 123f.)[10]
Jeweils am Anfang und Ende eines Aktes ist eine solche Pause von zehn bis fünfzehn Sekunden geplant. Stanislawski gibt den Zuschauern Zeit sich einzulassen auf Ort, Zeit und Stimmung. Dabei haben die optischen und akustischen Effekte stets eine Verbindung zu den „inneren“ Konflikten der Figuren. Ein nahendes Gewitter spiegelt sich in Treplevs Nervosität vor der Aufführung (und entlädt sich mit seiner Flucht) und die wahren Gefühle bleiben ebenso im Trüben, wie die Bühne zu Beginn der Aufführung. Die Stimmung bezieht sich immer auf das Hauptthema[11], das Stanislawski über jeden Akt setzt. Im ersten Akt dominiert Treplevs Nervosität (vgl. Senelick: 43), im vierten wird eine Atmosphäre der „Hoffnungslosigkeit und Akzeptanz des Unvermeidlichen“ (vgl. Allen: 19, Übersetzung: R.B.) kreiert. Stanislawski betont in seinem Inszenierungskonzept „das traurige, monotone Leben“ der Figuren und ihr emotionales Scheitern. Um dies zu vermitteln, legt er einen genauen Rhythmus (Tempo, Geräusche, Pausen) fest, setzt bestimmte Requisiten[12] und Effekte ein und verleiht den Figuren durch Subtexte eine Lebendigkeit, die über den Text hinaus reicht.
Stanislawski charakterisiert die Figuren genau: Ihre bestimmte Art des Sich-Bewegens, ihre eigenen Verhaltensweisen und Ticks (während der ersten Szene knackt Mascha ununterbrochen Nüsse) sind Grundlage für einen „[...] continuous stream of activity.“ (Allen: 50) Die Figuren bewegen sich und „spielen“ auch dann, wenn sie keinen Text haben. Die permanente Beschäftigung der Bühnenfiguren soll das Geschehen realistischer erscheinen lassen. Im zweiten Auftritt des ersten Aktes setzen sich Sorin und Treplev auf die mittig an der Rampe stehende längliche Bank[13]. Während Sorin sein Dasein beklagt und Treplev über seine Mutter und sein Theater spricht, gibt Stanislawski ihnen eine Reihe von Aktionen vor: Sorin kämmt sich während der gesamten Szene Bart und Haare, richtet seine Krawatte. Treplev, in Aufregung, liegt auf der Bank, setzt sich auf sie, bald springt er hoch und legt sich wieder. Dabei raucht er eine Zigarette, zerpflückt Gras und Blumen und zündet eine neue Zigarette an. (vgl. Jones: 24) Keine dieser Anweisungen bezieht sich direkt auf den gesprochenen Text, Stanislawski gibt den Figuren etwas zu tun während sie reden.
Die Besonderheit der Tschechow-Stücke liegt in dem, was unausgesprochen bleibt, also kann es nicht ausreichen nur den Rollentext zu spielen. Stanislawski erfindet den „Subtext“ (vgl. Jones: 75), der Gefühle, Motivationen, das eigentlich Gesagte oder das Nicht-Gesagte enthalten kann. Stanislawski formuliert: „It is the subtext that makes us say the words we do in a play.“ (zit. nach Jones: 76) Allen zeigt, wie der Subtext in der „partitura“ in physische Handlung übersetzt wird. Ninas besondere Gefühle für Trigorin, beispielsweise, werden bereits im ersten Akt eingeführt, indem das Mädchen dem Dichter zweimal die Hand zum Abschied reicht, bevor es geniert abtritt. „Trigorin follows her with his eyes.“ (zit. nach Allen: 55)
Oft fügt der Regisseur stummes Spiel ein oder erweitert die Anlagen, die der Autor dazu gibt, um den Subtext zu kommunizieren. Im vierten Akt machen die unglücklich in Treplev verliebte Mascha und ihre Mutter die Betten. Eben erklärt Mascha sie werde sich die Liebe „[...] aus dem Herzen reißen, mit Stumpf und Stiel“ (Die Möwe, 4. Akt, S. 52), da ertönt aus dem Nachbarzimmer ein melancholischer Walzer (Treplev spielt). Stanislawskis Regieanweisungen:
„Wieder erstarren die beiden Frauenfiguren in ihrer Pose bei der Arbeit und hören hin. Masa schnupft verzweifelt Tabak, dann tanzt sie lautlos zu der fernen Musik ein paar Walzerschritte bis zum nachtdunklen Fenster, starrt hinaus, während das Klavierspiel noch immer fortdauert. Doch in den wenigen Tanzschritten durch den fast dunkeln Arbeitsraum Treplevs liegt die ganze Stimmung eines tragischen Abschieds von einer möglichen großen Liebe, einer zerbrochenen Lebenschance.“ (zit. nach Hoffmeier: 38)
Stanislawski arbeitet bewusst mit Rhythmik und dynamischen Entwicklungen. Ruhige Szenen, wechseln sich mit kraftvollen ab, heitere Gesellschaften mit wehmütigen Monologen. Szenen können von einem Satz zum anderen kippen. Der Regisseur orientiert sich zwar an den musikalischen Strukturen in Tschechows Text, setzt aber oft auch eigene Schwerpunkte. Der erste Akt lebt von Bewegung. Nicht im Sitzen, wie bei Tschechow, sondern während eines Spazierganges, unterbrochen von mehrmaligem Ab- und Wiederauftreten, wird der erste Dialog zwischen Mascha und Medvedenko gespielt. Besonders bei Treplev betont Stanislawski jede Art von physischer Aktivität, er schreibt in seinem Konzept: „The more jumpy and agitated he is now, the stronger will his mood of despair be after the failure of his play.“ (zit. nach Jones: 25) In der Tat ist das Ende bzw. der Abbruch Treplevs Aufführung der Höhepunkt des ersten Aktes. Nach einer 15-sekündigen Pause schliesst sich Dorns Monolog an. (vgl. Jones: 27f.) Er bringt den Energielevel der Szene wieder herunter.
Sein gutes Gespür für Rhythmus beweist Stanislawski auch im dritten Akt, dem Abschied von Arkadina, für den er noch weitere Figuren, Bedienstete des Hauses, hinzu erfindet. Gute Massenszenen hatte er sich bei den Meiningern[14] abgeschaut. Ein wahres Chaos soll entstehen, wenn sich alle auf einmal von der Herrin verabschieden wollen. (Jones: 52) Alle Figuren drücken und schreien durch den Raum, wollen Arkadina die Hand küssen. Dann kommen weitere Dienstmädchen herein, eines trägt ein schreiendes Baby auf dem Arm. Als Arkadina endlich das Haus verlässt, ist die Bühne plötzlich leer und still für die zarte Abschiedsszene zwischen Nina und Trigorin. In den ersten beiden Akten, so führt Jones (S. 63) aus, beginnt Stanislawski mit kräftigen, dynamischen Bildern und endet mit leiseren, einfachen. Diese Entwicklung könne auch auf das Gesamtkonzept der Inszenierung übertragen werden.
Wie geht Stanislawski mit den zahlreichen Pausen um, die Tschechow vorschreibt? Er fügt weitere hinzu. Der Regisseur benutzt sie nicht nur als Trennung zwischen zwei Phrasen, als spannungserregendes Moment oder um Dialoge authentischer wirken zu lassen, sondern er füllt sie darüberhinaus mit Gesten, Bewegung und Geräuschen (vgl. Allen: 18). Im ersten Akt, der im Freien spielt, hört man in den (Sprech)Pausen alles erdenkliche Getier und Waldgeräusche. Der Akt endet in einem „Konzert“ aus Kirchenglocke, Frosch- und Grillengesang und dem Klopfen des Nachtwächters. „Stanislavski build the scene to a crescendo, with a polyphony of sound“, fasst Allen (S. 15) zusammen, „[...] Lightning and sound effects, then, were used to reflect and amplify the characters' inner feelings – to communicate the 'inner drama', the 'subtext'.“ Die Geräuscheffekte sind also nicht nur naturalistische Täuschung des Publikums, sondern beziehen sich ganz stark auf das „Innenleben“ der Figuren.
Die Lotto-Szene im vierten Akt hat Stanislawski mit sechs Sprechpausen (statt einer im Text) gestreckt. In den „Pausen“ hört man Treplevs trauriges Klavierspiel, Sorins Schnarchen und den Gesang von Arkadina und Dorn. Maschas monotone Nummernansage und die Pausen verlangsamen die Handlung, verdeutlichen Langeweile und Trostlosigkeit des Lebens. Jones (S. 66) deutet: „Classical tragedy thrills an audience with apocalypse, but here the audience must endure the entropy.“ Die Zuschauer sollen aber auch erahnen können, dass hinter den banalen Gesprächen etwas Unaussprechliches schwebt. Damit tragen Pausen und Geräusche ganz wesentlich dazu bei Stanislawskis Stimmungen zu erzeugen.
Kritiker haben Stanislawski vorgeworfen, es mit seinen Geräuschen und Klangeffekten übertrieben, Tschechow gar völlig missverstanden und damit zerstört zu haben.
„Das Schweigen, dass Ĉechov vorschreibt, ist das genaue Gegenteil von stummem Spiel. Es ist nichts als Schweigen. Reglosigkeit, Konzentration. [...] Stanislavskijs Ĉechov-Theater war undenkbar ohne Geräuschkulisse. [...] Wo Ĉechov Geräusche vorschreibt, sind sie niemals illusionistisch, sondern stets dramaturgisch.“ (Melchinger, Siegfried: Stanislavskij und die Folgen. In: Urban: 307-313, hier 311)
Die Kritik ist zum Teil sicher berechtigt, allerdings gibt es bei Stanislawski sehr wohl auch Pausen, in denen das Geschehen gänzlich einfriert[15], außerdem haben die Geräusche, wie gezeigt wurde, immer eine dramaturgische Begründung und sind nie nur „nettes“ Beiwerk. Stanislawski rechtfertigt in einem Brief an Nemirowitsch sein Froschquaken: „Theatrical silence is expressed not by soundlessness but by sound. If the silence is not peopled by sound, you cannot achieve the illusion.“ (am 10.9.1898, zit. nach Senelick: 44)
Obwohl Stanislawski sehr kritisch gegenüber sentimentalen Effekten gewesen sein soll (vgl. Jones: 73), mag er an einigen Stellen nicht auf sie verzichten. Beispielsweise vergrößert er Sorins Schwächeanfall im dritten Akt um das Publikum „wach zu halten“. Sorin stützt sich nicht auf den Tisch (Tschechow), sondern fällt Arkadina direkt in die Arme. Stanislawski will, so schreibt Hoffmeier (S. 32), dem Publikum „[...] die versteckten dramatischen Vorgänge [...]“ bei Tschechow offenlegen: „Bemerkung zu Sorins Ohnmacht: Sorin macht ein Gesicht, daß man denken könnte, er sei tot. (Die Szene muß recht realistisch gespielt werden. Es muß denken, Sorin stirbt. Dadurch wird es erregt und interessiert sich stärker für die Vorgänge auf der Bühne.)“ (Stanislawski zit. nach Hoffmeier: 32) Anstatt Sorin das Wasser trinken zu lassen, nimmt (bei Stanislawski) Treplev das Wasser in den Mund und besprüht damit seinen Onkel, der wieder zu sich kommt. (vgl. Jones: 49)
An einer zweiten Stelle bemerkt Stanislawski ebenfalls, wie „billig“ der „Trick“ sei, den er einsetzen möchte und macht es trotzdem: Ab dem Moment im vierten Akt, wo Nina Treplev (endgültig) verlässt, steht er bewegungslos da und hält ein Glas Wasser in der Hand. Ein Fenster fällt zu, so stark, dass das Fensterglas zu Bruch geht. Ein weiteres Fenster geht mit lautem Geräusch zu. Nach 15 Sekunden lässt Treplev das Glas fallen. (vgl. Jones: 70) Wieder wird ein innerer Gefühlszustand durch äußere Aktion dargestellt. Der junge Dichter ist unfähig zu reagieren, seine Gefühle zu zeigen und dennoch wird dem Zuschauer das Toben seines Inneren enthüllt und der Selbstmord vorbereitet.
Fest gehalten kann werden: Stanislawski hat mit Hilfe vieler neuartiger Ansätze im Regiekonzept, in der Darstellungskunst und dem Einsatz von technischen Hilfsmitteln Tschechow interpretiert und, das zeigt der Erfolg, den Menschen geholfen, das Stück aufzunehmen. Oder, wie Jones (S. 73) es ausdrückt, Tschechow erfolgreich in Bilder verwandelt. Er versucht das verborgene Drama nach außen zu transportieren und bedient sich dabei der Mittel der Vergrößerung und Kontrastierung (vgl. Hoffmeier: 32). Widersprüche zwischen Text und Handlung können den Subtext einer Figur durchscheinen lassen. Die Art, wie Stanislawski Details und Handlungen dazu erfindet um das Stück verständlich zu machen, nennt Allen (S. 50) „a novelisation of the plays“.[16] Es ist klar, dass Stanislawski damit den Dramentext verändert. Aus heutiger Sicht ist das unproblematisch, allerdings wurde den MChT-Leuten, die überzeugt sind, Tschechow voll und ganz verstanden zu haben, vorgeworfen, sie hätten Tschechow nur „benutzt“, um ihr Stimmungstheater zu machen. Dagegen setzt Meyerhold[17], dass es allein Tschechow war, der ermöglichte, dass am MChT ein „Theater der szenischen Stimmung“ entstehen konnte:
„Nicht Arrangements, nicht Heimchen, und auch nicht Pferdegetrappel schufen Atmosphäre, sondern nur die einzigartige Musikalität der Darsteller, die den Rhythmus der Tschechowschen Poesie erfaßt hatten und es vermochten, ihre Schöpfungen mit einem Mondschleier zu überziehen.“ (Meyerhold: 115)
Nach Fertigstellung des Regiekonzeptes im September 1898 ist Stanislawski erschöpft und unsicher, ob es gelungen ist: „Ich bin auf gut Glück an das Stück herangegangen, machen Sie mit der Planung was sie wollen.“ (Brief an Nemirowitsch, zit. nach Poljakowa: 124) Sein Kompagnon ist begeistert und lässt den Regisseur wissen: „Ihre mise en scène ist wunderschön geworden. Tschechow ist von ihnen begeistert ... Er hat schnell begriffen, wie sie den Eindruck verstärkt.“ (zit. nach Poljakowa: 125) Als die letzten kleinen Änderungen eingearbeitet sind, haben die Proben schon begonnen.
1.3. Proben am Künstlertheater
Über ein Jahr dauern die Planungen und Vorbereitungen Nemirowitsch-Dantschenkos und Stanislawskis für ihr Künstlertheater. Zur Finanzierung des Vorhabens wird eine „Gesellschaft auf Treu und Glauben“ gegründet, an der Stanislawski mit seinem Privatvermögen nicht unwesentlich beteiligt ist. Die Schauspieler stammen aus Stanislawskis Amateur-Truppe der „Gesellschaft für Kunst und Literatur“, die seit zehn Jahren mit Liebhaberaufführungen die Moskauer „Intelligenzija“ erfreut. Weiterhin kann Nemirowitsch, der als Leiter der dramatischen Klasse an der Moskauer Philharmonischen Schule arbeitet, einige seiner Lieblingsschüler und Absolventen für das neue Theater gewinnen. Die Schauspieler erhalten, auch das ist neuartig, kleine, aber feste Gehälter, die zunächst unabhängig von den Einnahmen bzw. Ausgaben des Theaters sind. Für die Aufführungen kann man ab Herbst 1898 die alte „Eremitage“ in Moskau mieten. Da in der Stadt kein Raum für Proben frei ist, stellt der Jurist Archipow sein Gut im Vorort Puschkino zur Verfügung. Am 14. Juni 1898, um 14:00 Uhr beginnen die Proben. Stanislawski kommt jeden Tag von seinem Gut in Ljubimowka herüber und die Schauspieler wohnen in den umliegenden Sommerhäusern. Es entsteht eine Gemeinschaft junger, energischer und disziplinierter Theatermacher. (vgl. Poljakowa: 109ff.) Nemirowitsch erklärt Tschechow, warum es für ihn so wichtig ist mit jungen Schauspielern zu arbeiten und nicht mit langjährig erfahrenen Profis:
„[...] An experienced actor in his sense [er bezieht sich auf Sumbatow, Leiter des Maly Theaters, R.B.] is bound to be an actor of a certain hamminess (shablon), however lucid – it may be harder for him to present the audience a new image than it is for an actor who is still a neophyte at theatrical banality. [...] Sumbatov obviously understands directing to mean only blocking with prompter, whereas we enter into the very depths of tone for each character in detail and – even more important – the ensemble, the general mood, which is the most important thing of all in The Seagull.“ (Brief während der Proben, zit. nach Senelick: 40)
Geprobt werden mehrere Stücke der Eröffnungsspielzeit parallel, meist von Vormittag bis vier Uhr und am Abend. Für die Möwe stehen 26 Proben auf dem Plan. 16 geleitet von Nemirowitsch und 10 mit Regisseur Stanislawski (vgl. Senelick: 41), der gleichzeitig die Rolle des Trigorin spielt. Die beiden Regisseure verfolgen die gleiche Linie. Wenn auch ihre Zugänge zu Tschechows Stoff verschieden sind, so sollen sie doch „in völliger Übereinstimmung“ (Poljakowa: 144) inszenieren. Stanislawski nennt die gute Zusammenarbeit als wichtige Bedingung für den Erfolg der Aufführungen:
„Unzweifelhaft war, daß eine Kollektivarbeit an Tschechow, sollte sie erfolgreich sein, eine bestimmte Verbindung von kreativen Kräften erforderte: erstens einen Theaterschriftsteller, Dramatiker und Spielpädagogen wie Wladimir Iwanowitsch; zweitens einen von Routine freien Regisseur, der in der Lage ist, durch Arrangements, die Führung der Schauspieler und Anwendung der neuen Möglichkeiten von Licht und Ton die Intentionen des Dichters und das geistige Leben des Menschen auf der Bühne wiederzugeben; drittens einen Tschechow geistig nahestehenden Bühnenbildner wie W. A. Simow.“ (Stanislawski 1987: 274)
Die Bühnenbilder sind oft sehr realistisch, reich detailliert und bieten viele Möglichkeiten der Bespielung. Der Garten des ersten Aktes in der Möwe mit seinen Bäumen und Büschen aus Pappe und dem gemalten Hintergrundbild gleicht einem impressionistischen Gemälde. Mit Lichteffekten wird die Abendstimmung verstärkt und eine Umgebung geschaffen, in der die Schauspieler sich bewegen, leben und spielen können. (vgl. Allen: 49) Die Ausstattung der Innenräume ist ebenso detailgetreu. Dabei geht es Stanislawski und Simow nicht um die Illusion echten Lebens. Das Bühnenbild ist immer auch Träger der Stimmung, ist symbolisch und produziert somit Bedeutung. In der zweiten Hälfte wandelt sich der Charakter des Stückes von einer Satire des Landlebens in ein Drama des Scheiterns, dies spiegelt sich auch in der Bühnengestaltung wider. Stanislawskis Konzept beruht auf der Kohärenz aller theatralen Zeichen, er fordert „die Form vom Inhalt nicht zu trennen“. Simow wird beauftragt „[...] to point up the contrast between the happy comfort of the genial and agreeable life in the first half of the play and the depressing emptiness, hollowness, and discord in the lives of the people in the play in the last two acts.“ (Jones: 54) Die laue, freundliche Abendstimmung der ersten beiden Akte ist dahin. Olga Knipper beschreibt die Bühne im dritten Akt der Möwe als „[...] so lived-in that it extracted a gasp from the spectators“ und im vierten Akt „[...] so cold and dusty that you wanted to wrap yourself in a shawl“ (zit. nach Allen: 49).
Meyerhold berichtet aus Puschkino seiner Frau von den Proben und dem Regietalent Stanislawskis: „Die Proben[18] gehen gut voran, und das ausschließlich dank Alexejew [...]; wie er es doch versteht mit seinen Erklärungen das Interesse zu wecken, Stimmungen zu schaffen, indem er wundervoll vorspielt und dabei selbst in Feuer gerät! Was für ein künstlerisches Gespür, welche Phantasie!“ (Meyerhold: 64)
Stanislawski sieht die Tschechow-Inszenierungen als Grundlage seiner später (ab 1906) entwickelten Schauspieltheorie, genannt seine Methode. Vom Beginn seiner Arbeit geht es dem Regisseur um „innere Wahrheit“ der Darstellung. Wie dies zu erreichen sei, ist der große Unterschied zwischen seinen frühen und späteren Arbeiten. Bei der Möwe versucht er durch verschiedene „bewährte“ Elemente, wie Dekoration, Kostüm[19], Beleuchtung, Geräusche und Musik eine „äußere Stimmung“ herzustellen.
„Oftmals wirkte sie auch auf die Schauspieler. Sie sahen die äußere Echtheit, und die Erinnerungen aus dem eigenen Leben entlockten ihnen Gefühle, wie sie Tschechow meinte. Der Schauspieler spielte dann nicht mehr, sondern wurde selbst zur Person des Stückes, die naturgemäß der Seele des Schauspielers entsprang. Fremde Worte und Handlungen wurden vom Schauspieler als eigene angenommen. Ein Wunder war geschehen [...]“ (Stanislawski 1987: 274f.).
Die kunstvoll geschaffenen „Stimmungen“, so deutet Allen (S. 47f.), sind also nicht in erster Linie für die Zuschauer gedacht, sondern sollen den Schauspielern helfen, die Welt des Stückes zu „absorbieren“. Stanislawski gibt in seiner „partitura“ allen Figuren genaue Anweisungen zu Handlungen, Gangart, ja sogar Intonation. Er fixiert die äußere Form der Rolle und hilft den Schauspielern die innere Form, die „innere Wahrheit“ zu finden. (vgl. Allen: 50) Später kritisiert er seine „diktatorische“ Herangehensweise:
„Damals waren die Schauspieler noch unerfahren, so daß despotisches Vorgehen fast unvermeidlich war. Ich zog mich in mein Arbeitszimmer zurück und entwarf detaillierte Arrangements, so wie ich sie in meiner Empfindung spürte, wie ich sie in meiner Vorstellungskraft sah und vernahm. Der Regisseur nahm in solchen Augenblicken keine Rücksicht auf die Gefühle der Schauspieler. Damals war ich aufrichtig der Überzeugung, man könne Menschen befehlen, was sie zu fühlen und wie sie zu leben hätten.“ (Stanislawski 1987: 246)
Ab dem 9. September 1898, das Theater ist inzwischen nach Moskau gezogen, ist Tschechow bei einigen Proben anwesend. Die Schauspieler, die den Dichter verehren, sind verunsichert, ebenso nervös ist Tschechow. Doch die Situation entspannt sich nach dem ersten Akt. „Zum ersten Mal hatte er [Tschechow, R.B.] den Eindruck, von seinen Darstellern verstanden worden zu sein.“ (Troyat: 245) Als sie ihn nach Hinweisen für ihre Rolleninterpretation fragen, hält sich der Autor zurück. Er bietet ihnen keine psychologischen Motivationen oder Erklärungen an, sondern spricht höchstens über Details. So verrät er Kachalow, dem ursprünglichen Darsteller des Trigorin, lediglich, dass dieser sich seine Angelruten selbst schnitzt. „The main thing is the fishing rods...“ Als Kachalow nicht locker lässt, wird Tschechow ein wenig zornig und sagt: „There's nothing more, it is all written down.“ (zit. nach Allen: 53f.) Tschechow bittet darum, Trigorin mit Stanislawski zu besetzen. (vgl. Troyat: 245)
Die Premiere findet am 17. Dezember 1898 in der Moskauer Eremitage in Abwesenheit des Autors statt, der den Winter aufgrund seiner Krankheit auf seinem Gut in Jalta verbringt. Die Aufführung steht unter keinem guten Vorzeichen: Zum einen ist Tschechow ernstlich erkrankt und seine Schwester fürchtet, ein erneuter Misserfolg könnte ihn umbringen (vgl. Troyat: 250). Zum anderen braucht das Theater dingend ein zweites finanziell erfolgreiches Stück[20]. Anekdotenhaft wird berichtet, dass die Schauspieler unter dieser Last vor der Vorstellung Baldriantropfen, die Dorn scherzhaft im Stück empfiehlt, eingenommen haben. Stanislawski, als Trigorin mit dem Rücken zum Publikum sitzend, kann im ersten Akt das Zittern seiner Beine nicht unterdrücken. (vgl. Troyat: 250)
„Ich weiß nicht mehr, wie wir gespielt haben. Nach dem Ende des ersten Aktes herrschte Totenstille im Zuschauerraum. Eine Schauspielerin wurde ohnmächtig, und ich konnte mich vor Verzweiflung kaum noch auf den Beinen halten. Doch plötzlich, nach einer langen Pause, krachte und brüllte und klatschte es im Zuschauerraum donnergleich. Der Vorhang ging auf, zu und wieder auf, und wir standen wie betäubt da.“ (Stanislawski 1987: 275f.)
Der Erfolg ist durchschlagend. Tschechow wird sofort telegrafiert, er antwortet: „Euer Telegramm hat mich gesund und glücklich gemacht.“ (zit. nach Troyat: 251) Seither ist die Silhouette einer Möwe das Erkennungszeichen des MChT, sie ist auf allen Plakaten und dem Vorhang des neu gebauten Theaters abgebildet. Mit dieser Aufführung beginnt die Tschechowsche Dramenrezeption, die sie gleichzeitig entscheidend prägt. Sie weist dem jungen Künstlertheater die Richtung[21] und stellt den Beginn eines neuen russischen Theaters dar. (Poljakowa: 138)
1.4. Reaktionen auf Die Möwe
Die Zeitungen sind voll Lob für Regie und Ensemble (vgl. Allen: 21). In vier Spielzeiten wird das Stück insgesamt 63 mal in Moskau gespielt. Es ist der Erfolg, den das erst zwei Monate zuvor eröffnete Theater braucht, um sich in der Moskauer Theaterlandschaft etablieren zu können. Es ist auch der Erfolg, der den Autor rehabilitiert, über Russland hinaus bekannt macht und – nebenbei – auch finanziell absichert. Das Gelingen beruht auf der Geschlossenheit der Aufführung: Text und Bilder, Bühne und Figuren, alles war nach Stanislawskis Plan zu einem atmosphärischen Ganzen zusammengefügt worden. Den jungen Schauspielern, kaum bekannt in der Theaterszene, ist es als Ensemble gelungen, die Figuren zum Leben zu erwecken und hinter ihnen zurück zu treten. „In other words, characters rather than star turns had filled the stage.“ (Senelick: 49)
Tschechow hört von vielen Seiten vom Erfolg seines Stückes und es verlangt ihn Die Möwe zu sehen. Doch erst im April 1899, als die Spielzeit bereits zu Ende ist, die Requisiten, Bühnenbilder usw. verstaut sind, kehrt er nach Moskau zurück. Um dem „geliebten“ Autor den Wunsch zu erfüllen, unternimmt das Ensemble einige Anstrengungen. Stanislawski mietet das Nikitski-Theater an, trommelt Schauspieler und Techniker zusammen und probiert, obwohl ihm die Schwierigkeiten dieses hastigen Unterfangens klar sind:
„Zudem würden die unerfahrenen Schauspieler am neuen Ort unkonzentriert sein, und das wäre in einem Tschechow-Stück das gefährlichste. Hinzu kam, daß der Zuschauerraum einer Scheune glich und, da im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten alle Möbel fortgeschafft waren, vollkommen leer war. In einer leeren Halle bekommt alles einen hohlen Klang, es würde den Autor enttäuschen“ (Stanislawski 1987: 277).
Die Privatvorstellung findet in halbem Bühnenbild und ohne Geräuschkulisse[22] vor etwa zehn Zuschauern statt. Am 9. Mai schreibt Tschechow an Groki:
„Die 'Möwe' habe ich ohne Bühnenbilder gesehen, ich kann über das Stück nicht in ruhigem Ton sprechen, denn die Möwe selbst hat abscheulich gespielt, sie hat die ganze Zeit geheult und geschluchzt, und Trigorin (der Belletrist) [...] sprach wie ein Paralytiker; er hat 'keinen eigenen Willen', und der Darsteller [Stanislawski[23], R.B.] hat das so aufgefaßt, daß mir beim Zuschauen übel wurde. Aber im ganzen war er recht gut, es hat ergriffen. Stellenweise habe ich gar nicht glauben können, daß ich das geschrieben haben soll.“ (Tschechow 2004: 253)
Abgesehen von der Kritik an den Darstellern, was hält Tschechow von der Arbeit Stanislawskis und des MChT? Die überlieferten Äußerungen Tschechows sind oft als Ablehnung der Inszenierung gedeutet worden. Jones (vgl. S. 56ff.) versucht zu zeigen, wie mehrdeutig das Verhältnis zwischen Autor und Regisseur/Theater tatsächlich ist.
Tschechow zeigt sich kritisch gegenüber Stanislawskis Geräuscheffekten und Stimmungen, aber eine konkrete Ablehnung dieser lässt sich nicht belegen. Meyerhold hat ein Gespräch während einer Probe zu Die Möwe dokumentiert, in dem sich Tschechow dazu äußert. Er erfährt von einem Schauspieler, dass man hinter der Bühne Frösche quaken lassen will, damit es „real wird“.
„Real, wiederholte grinsend Tschechow, und sagte nach einer kleinen Pause: Bühne – ist Kunst. Kramskoi hat ein Genrebild gemalt, auf dem großartige Gesichter dargestellt sind. Was wäre, wenn ich aus einem der Gesichter die gemalte Nase ausschneide und eine echte einsetze? Die Nase wäre 'real', aber das Bild verdorben.“ (Meyerhold: 112)
Der Schauspieler erzählt auch, dass im dritten Akt eine Frau mit weinendem Kind auftritt. Tschechow reagiert: „[...] die Bühne [...] fordert eine gewisse Stilisierung. Sie haben nicht die vierte Wand. Außerdem ist die Bühne Kunst, sie bildet die Quintessenz des Lebens ab, auf die Bühne gehört nichts Überflüssiges.“ (zit. nach Meyerhold: 113) Losgelöst aus dem Kontext der Inszenierung müssen diese Effekte unpassend wirken. Aber eingebettet in die von Stanislawski geschaffene Stimmung, als ein Element unter vielen, sollen sie zur Farbigkeit der Aufführung beitragen. Jones (vgl. S. 57) betont, dass diese Bemerkungen auf einer frühen Probe fallen und nicht an Stanislawski selbst gerichtet sind. Tatsächlich aber, da ist Tschechow zuzustimmen, baut der Regisseur eine sehr starke „vierte Wand“ auf und begründet dies damit, dass sich die Schauspieler dann besser konzentrieren, um die Rolle wahrhaftig darstellen zu können.
Von den Proben zum Kirschgarten ist folgender Ausspruch Tschechows überliefert: „Hören Sie, ich werde ein neues Stück schreiben, und es wird folgendermaßen anfangen: 'Es ist so herrlich, so still! Man hört weder Vögel noch Hunde noch den Kuckuck noch den Uhu noch die Nachtigall noch die Uhr noch die Glöckchen und nicht ein einziges Heimchen.'“ (zit. nach Stanislawski 1987: 328f.) Der Regisseur versteht das als Scherz mit ernsthaftem Hintergrund. Und auch Jones deutet dies keineswegs als Ablehnung aller naturalistischen Elemente. Tschechow selbst benutzt Geräusche in seinem Text – freilich nicht so intensiv wie Stanislawski – und er achtet sehr auf Details zum Beispiel bei der Kleidung der Figuren. Er will den Menschen zeigen, „[...] wie schlecht und langweilig ihr lebt!“ (zit. nach Urban: 5) Stanislawski verfolgt genau diese Gedanken, aber nicht durch stilisierte Darstellung, sondern durch berührende Echtheit und Wahrhaftigkeit.
Überschrieben hat Tschechow Die Möwe mit „Komödie“ und protestiert später: „Sie sagen, Sie hätten in meinem Theaterstück geweint ... Und nicht nur Sie ... Aber ich habe sie doch nicht dazu geschrieben, damit Alekseev etwas Weinerliches daraus macht. Ich habe etwas anderes gewollt.“ (1902 im Interview mit A. Serebrow-Tichonow, zit. nach Urban: 5) Unzweifelhaft hat Stanislawski die melancholische Anlage des Stückes stark betont, aber, wie Jones (vgl. S. 60f.) nachweist, lediglich zwei Stellen[24], an denen Tränen fließen, hinzugefügt. Die zwölf anderen stammen von Tschechow selbst. Dass Stanislawski durchaus mit den komischen Elementen in den Stücken umzugehen versteht, soll in Kapitel 3.2. gezeigt werden.
Von Olga Knipper ist überliefert, Tschechow hätte dem Theater verbieten wollen, den vierten Akt zu spielen: „I suggest that my play should end with the Third act.“ (zit. nach Jones: 61) Der vierte Akt sei der atmosphärischste, so analysiert Jones. Dass bei der Aufführung im Nikitski-Theater die faszinierend lähmende Stimmung kaum hergestellt werden konnte, mag der Grund für das Scheitern in den Augen des Autors gewesen sein.
Trotz einiger Kritikpunkte, hat Tschechow die Inszenierung gefallen (vgl. Troyat: 267). Er lobt, mit den erwähnten Ausnahmen, die Darsteller und schreibt nach der Privatvorführung an P.F. Iordanow: „In Moskau hat man im Künstlertheater meine ' Möwe' für mich gespielt. Eine wunderbare Inszenierung. Wenn Sie wollen, werde ich darauf bestehen, daß das Theater im Frühling in Taganrog[25] Station macht [...]“ (Tschechow 2004: 255)
2. Die Zusammenarbeit wird fortgesetzt
2.1. Onkel Wanja
Als nächstes Tschechow-Stück hat Onkel Wanja am 26. Oktober 1899 am MChT Premiere. Die Neubearbeitung seiner Komödie Der Waldschrat[26] wird bereits seit 1897 auf verschiedenen Provinzbühnen mit Erfolg gespielt. Die Rechte für die Moskauer Erstaufführung erhält zunächst das berühmte Maly-Theater. Als man Tschechow allerdings auffordert den dritten Akt, in dem Wanja auf den Professor schiesst, umzuarbeiten, soll er vor Wut rot angelaufen sein (vgl. Stanislawski 1987: 279). Den Zuschlag erhält schließlich doch das „[...] Künstlertheater, dessen Ensemble seine ganze Sympathie besaß.“ (Troyat: 275) Tschechow ist bei einigen Proben anwesend. Während Troyat berichtet, Tschechow hätte munter jeden kleinsten Interpretationsfehler kritisiert, erinnert sich Stanislawski (1987, S. 279): „[...] er konnte nicht über seine Stücke reden, er wurde verlegen, unbeholfen und nahm, um aus der peinlichen Lage herauszukommen und uns loszuwerden, zu seiner üblichen Redensart Zuflucht: 'Hören Sie, ich habe das doch geschrieben, da steht alles drin.'“ Wenn Tschechow Anweisungen gibt, beziehen sie sich auf Details, die sich aber als äußerst wichtig herausstellen. Wanja soll, so Tschechow, eine seidene Krawatte tragen. Stanislawski wird durch diese „Kleinigkeit“ bewusst, dass Wanja ein feiner, gebildeter Mann ist und nicht der plumpe Gutsherr, für den er ihn gehalten hatte.
Die Premiere ist Wochen vorher ausverkauft. Tschechow kann aufgrund seiner Krankheit wieder nicht anwesend sein. Die Schauspieler sind sich ihres Erfolges sicher, doch Applauswogen, wie bei der Möwen -Premiere bleiben diesmal aus. Auch die Kritik berichtet mit „gemischten Gefühlen“. Erst nach einigen Vorstellungen fängt sich die Inszenierung und wird zum Erfolg (vgl. Stanislawski 1987: 281).
Stanislawski berichtet auch, dass Tschechow alle Rollen mit seinen Lieblingsschauspielern besetzen lassen will – was nicht möglich ist –, andernfalls das Stück zurückziehe. Bei den Proben erhält Tschechow den zweifelhaften Titel „Inspektor der Darstellerinnen“ (Troyat: 276), weil er die Frauen des Ensembles weniger kritisiert als die Männer. Zu seinen Lieblingen gehört neben Meyerhold, mit dem ihn eine lange Brieffreundschaft verbinden wird, vor allem Olga Knipper, in die sich Tschechow verliebt hat. Sein gutes Verhältnis zum MChT dürfte ganz wesentlich auf dieser besonderen Beziehung beruht haben. Tschechows Sympathie zeigt sich auch im ironisch, spitzen Ton eines Briefes an Olga nach der Premiere:
„Ja, Schauspielerin, Ihnen allen, den Künstlerschauspielern, ist schon ein gewöhnlicher, mittlerer Erfolg zu wenig. Ihr wollt nur noch Knall, Salutschüsse, Dynamit. Ihr seid total verwöhnt, betäubt vom ständigen Gerede über Erfolg, volle und leere Häuser, seid von dieser Droge bereits vergiftet, und in 2-3 Jahren werdet ihr überhaupt nichts mehr wert sein! Da habt ihrs!“ (Tschechow 2004: 238)
2.2. Der Berg kommt zum Propheten
Im April 1900 begibt sich das MChT auf Gastspielreise nach Sewastopol und Jalta. „Anton Pawlowitsch kann nicht zu uns kommen, weil er krank ist. Also fahren wir zu ihm, denn wir sind gesund. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muß der Berg zum Propheten kommen.“ (Stanislawski 1987: 282)
Die Aufführungen in Sewastopol werden begeistert aufgenommen. Auch Tschechow ist mit Onkel Wanja zufrieden. Der Autor, zuvor wieder durch Hustenanfälle ans Bett gefesselt, fühlt sich wohl unter den Theaterleuten. Als man einmal nach einem Arzt für den erkrankten Schauspieler Artem schickt, sagt er: „Aber hören Sie, ich bin doch der Arzt des Theaters.“ (zit. nach Stanislawski 1987: 283) Die Aufführung der Möwe kann Tschechow gesundheitsbedingt wieder nicht sehen.
Das Ensemble setzt am 14. April nach Jalta über. Tschechow lädt sie und die sich zur Zeit in Jalta aufhaltende Künstlerprominenz – darunter: Bunin, Groki, Kupin, Rachmaninow – zu einem Empfang in seine Villa ein. Es ergibt sich, dass die Schauspieler jeden Tag vor der Vorstellung zu „ihrem Autor pilgern“ (Troyat: 284), um sich dort zum Essen einzuladen. Sie fühlen sich wohl in Tschechows Haus und der ist glücklich, so viele Leute um sich zu haben. Man unterhält sich über ernste Themen, über das Theater und scherzt. Der Schauspieler Moskwin liest immer nach dem Essen aus den Kurzgeschichten des Meisters. Zum Abschied schenkt das Theater „seinem“ Dichter Sitzbank und Schaukel aus der Dekoration von Onkel Wanja. Im Gegenzug versprechen Tschechow und Gorki dem Theater je ein Stück zu schreiben. „Das war, unter uns gesagt, einer der Hauptgründe, weshalb der Berg zum Propheten gegangen war.“ (Stanislawski 1987: 285)
2.3. Drei Schwestern
Die Angst zu Scheitern, missverstanden zu werden hat Tschechow nach der Uraufführung der Möwe in St. Petersburg nie ganz überwinden können. Diese Ängste sind Urheber für seine harte Kritik an der Produktion Drei Schwestern (Premiere am 31. Januar 1901). Es ist das erste Stück, das der mittlerweile schwer erkrankte Autor eigens für das MChT schreibt. Am Probenfortschritt ist er sehr interessiert, hält es für wichtig, anwesend zu sein und hin und wieder Details zu präzisieren. Schon vor Beginn der Proben schreibt er an Olga Knipper, die er nach der Premiere ehelichen wird:
„[...] und zweitens muß ich unbedingt auf den Proben sein, unbedingt! Vier tragende Frauenrollen, vier junge intellektuelle Frauen kann ich Alekseev doch nicht allein überlassen, bei all meiner Achtung vor seiner Begabung und seinem Verständnis. Ich muß wenigstens mit einem Auge die Proben gesehen haben.“ (Tschechow 2004: 256)
Durch die bisherigen Inszenierungen des MChT ist Tschechow, wie er selbst denkt, als Pessimist abgestempelt worden, wogegen er versucht sich zu wehren. (vgl. Allen: 22) Doch schon bei der ersten Leseprobe stellen einige Ensemblemitglieder eine pessimistische Tendenz des Stückes fest, manche weinen sogar. „Tschechow [muss] annehmen, daß das Stück unverständlich und damit unbrauchbar sei.“ (Stanislawski 1987: 287) Das Durcheinander der Proben hält er nicht lange aus, am 11. Dezember 1900 verlässt er Moskau unter dem Vorwand, seine Gesundheit habe sich verschlechtert. Stanislawski (vgl. 1987: 288) vermutet, Tschechow hat Angst um sein Stück, das in den Proben beschwerlich langsam vorankommt.
Aus Wien und Italien erreichen Tschechows Hinweise und Anweisungen per Post die Schauspieler und Regisseure. Er schreibt über Kostüme, Figurenmotivation und die Inszenierung des dritten Aktes. Die Knipper[27] weist er an:
„Beschreib mir wenigstens eine Probe der 'Drei Schwestern'. Muß nicht noch etwas eingefügt oder etwas weggenommen werden? Spielst du gut, mein Herz? Oh je, paß ja auf! Mach in keinem Akt ein trauriges Gesicht. Ein zorniges ja, aber kein trauriges. Menschen, die seit langem einen Kummer mit sich herumtragen und an ihn gewöhnt sind, pfeifen nur vor sich hin und werden oft nachdenklich. So wirst auch du auf der Bühne ziemlich oft nachdenklich während der Gespräche. Verstehst du?“ (Tschechow 2004: 257f.)
Der Premiere ist auch diesmal ein eher mittelmäßiger Erfolg. „Wir glaubten, daß die Inszenierung keinen Erfolg hatte, daß das Stück und die Interpretation keinen Anklang fanden. Es brauchte viel Zeit, um die Kunst Tschechows auch in diesem Stück dem Zuschauer begreiflich zu machen.“ (Stanislawski 1987: 289) Tschechow erfährt erst später vom mäßigen Erfolg. Stanislawskis (vgl. 1987: 289) Report zufolge zeigt er sich, nachdem er die Inszenierung gesehen hat, zufrieden mit dem Ensemble. Er besteht aber darauf die Geräusche während der Brandszene zu ändern. Tschechow selbst darf diese mit den Technikern des Theaters neu einstudieren. Nach einer Vorstellung berichtet er Stanislawski erbost, dass die Zuschauer in der Loge neben seiner sich über die Brandgeräusche amüsiert hätten. „Nachdem Tschechow das erzählt hatte, brach er in gutmütiges Lachen aus, aus dem ein derartiger Husten wurde, daß mir angst und bange um ihn war.“ (Stanislawski 1987: 289)
Das Verhältnis zwischen Stanislawski, mit seinem Künstlertheater, und Tschechow ist ein ambiges. Auf der einen Seite flüchtet der Autor vor den Proben, weil er fürchtet missverstanden zu werden. Seine Stücke werden „eingelullt“ in Stimmungen, er wird als Pessimist und seine Figuren als „cry-babies“ (vgl. Jones: 59) abgestellt. Er traut dem Regisseur nicht zu, seine Stücke so zu inszenieren, wie er sie geschrieben hat. Andererseits hat er grösste Hochachtung vor den Darstellern. Tschechow weiß, wem er den Ruhm verdankt. Wenn er nach Moskau kommt, besucht er leidenschaftlich gern Proben und Vorstellungen am MChT. Er schreibt ihnen die Rollen auf den Leib, lädt sie ein und bewirtet sie. Sein ruhiges und gütiges Wesen, die selbstironische Art machen ihn zum Liebling des Ensembles.
Stanislawski ist überzeugt, dass sein „Theater der szenischen Stimmung“ die einzig schlüssige Interpretation Tschechows ist: „Einzig dem Künstlertheater war es gelungen, Nennenswertes von Tschechow auf die Bühne zu übertragen, und das zu einer Zeit, als das Ensemble im Werden begriffen war.“ (Stanislawski 1987: 269) Die Schauspieler und das Theater identifizieren sich voll und ganz mit dem Autor, denn nicht zuletzt sorgen die Tschechow-Aufführungen für die finanzielle Absicherung des MChT: „Denken Sie nichts Böses von uns. [...] Wie man es auch immer betrachten mag, unser Theater ist Tschechows Theater, und ohne ihn wird es auch uns übel ergehen.“ (Stanislawski an Olga Knipper, zit. nach Troyat: 353)
3. Stanislawski „ruiniert“ den Kirschgarten
Die Premiere des langersehnten vierten Tschechow-Stückes am MChT wird auf den 44. Geburtstag des Autoren, den 17. Januar 1904, gelegt. Zwischen dem dritten und vierten Akt findet eine kleine Feierstunde für Tschechow statt, in der Nemirowitsch-Dantschenko erklärt: „Unser Theater ist Deinem Talent, Deiner Herzensgüte, der Lauterkeit Deiner Seele so sehr verpflichtet, daß du mit vollem Recht behaupten kannst: Dies ist mein Theater.“ (zit. nach Troyat: 265f.) Offenbar sieht Tschechow das anders, bei der Produktion kommt es zu Spannungen zwischen Theater und Autor. Was hat Tschechow veranlasst, trotz des Erfolges[28], an seine Frau zu schreiben: „Stanislavskij hat mein Stück ruiniert. Nun ja, Gott mit ihm.“ (Brief vom 29. 3. 1904 in Tschechow 2004: 284)?
3.1. Missverständnisse bei der Probenarbeit
Tschechows schwere Krankheit zögert die Fertigstellung des Kirschgarten hinaus. Im Sommer 1902 lebt er einige Zeit auf Stanislawskis Gut in Ljubimowka und bringt das Stück gut voran. Immer freundlich angetrieben von Nemirowitsch und seiner Frau, beendet er es aber erst im Herbst 1903. Die Proben beginnen Anfang November. Tschechow, so berichtet Troyat (S. 357), ist besorgt, dass Stanislawski sein Stück „kaputtmachen“ könnte, wenn er nicht bei den Proben dabei sein kann. Der Autor „überschüttet“ das Theater mit Briefen in denen er seine Vorstellungen von Figuren, Besetzungen, Bühnenbild etc. äußert. Angesichts dessen sind die folgenden Zeilen des Dichters an den Regisseur eigenartig:
„Überhaupt machen Sie sich wegen des Bühnenbildes keine Umstände, ich werde mich Ihnen fügen und staunen, ich sitze sowieso immer mit offenem Mund bei Ihnen im Theater. Da gibt es gar nichts zu reden; was immer Sie auch machen werden, alles wird sehr schön sein, tausendmal besser als alles, was ich mir einfallen lassen könnte.“ (am 10.11.1903, in Tschechow 2004: 281)
Sind diese Wort der Tschechowschen Ironie zuzuschreiben? Fügen sie sich nicht ein in jenes ambige Verhältnis zwischen Verehrung und Enttäuschung? Tschechow hält die Einsamkeit am Schwarzen Meer nicht mehr aus, gegen den Willen seiner Ärzte reist er am 2. Dezember nach Moskau. An den Proben teilzunehmen, scheint für ihn das Wichtigste zu sein. Dann aber ist die Zurückhaltung mit der der Autor auf den Proben auftritt unverständlich. Stanislawski berichtet, dass man Tschechow wieder alle Hinweise „aus der Nase ziehen“ muss. „Hätte jemand Tschechow, der bescheiden in den hinteren Reihen saß, bei den Proben beobachtet, er hätte nie geglaubt, daß es der Autor sei. Unsere Versuche, ihn ans Regiepult zu bekommen, scheiterten meist. Hatte man ihn doch am Regiepult, fing er zu lachen an.“ (Stanislawski 1987: 327)
Eine ganz andere Situation dokumentiert A. Simow, der Bühnenbildner des MChT: Bei einer schwierigen Szene geht der Regisseur auf die Bühne und zeigt dem Schauspieler, wie er die Phrase gespielt haben will. Tschechow, der diesem Vorschlag nicht zustimmt, bringt einen Einwand vor, aber Stanislawski, in die Arbeit vertieft, reagiert nicht darauf. „Then Chekhov got up and left. This produced an extraordinarily painful impression on everyone; there was a pause, the rehearsal was brocken off, and we began to discuss how to repair the situation, all the more so since we sincerely loved Anton Pavlovich.“ (zit. nach Allen: 42) Tschechow, der das Theater so liebt und noch 1887 die Bedeutung des Autors während der Probenarbeit hervorhebt[29], verlässt die Probe wie ein beleidigter Schuljunge. Er ist der Meinung, das MChT versteht sein Theater nicht[30], während die Theatermacher denken, dass Tschechow ihre Arbeit nicht nachvollziehen kann: „Es hatten sich eben erste Blüten gezeigt, da kam der Autor und brachte uns alle aus dem Konzept.“ (Stanislawski, Brief vom 26.12.1903, zit. nach Troyat: 363) Nemirowitsch soll sogar einmal zu Tschechow gesagt haben: „Go home, because you are only disturbing everyone.“ (zit. nach Allen: 42)
3.2. Komödie oder Tragödie?
Die Auseinandersetzungen drehen sich immer um einen zentralen Punkt. Während Tschechow mehrfach betont, er habe „[...] eine Komödie, stellenweise sogar eine Farce [...]“ (Brief an Stanislawskis Frau, die auch Schauspielerin ist, in Tschechow 2004: 271) geschrieben, liest Stanislawski den Kirschgarten zunächst als Tragödie (vgl. Senelick: 67). Kritiker werfen Stanislawski noch lange Zeit später vor, die Komödie im Kirschgarten unterminiert zu haben. Doch während der Arbeit am Inszenierungskonzept versteht er immer mehr von Tschechows Komik und Ironie, nennt ihn später sogar den „[...] nicht kleinzukriegenden Humoristen und Witzbold [...]“ (Stanislawski 1987: 332).
Allen (S. 29ff.) versucht zu zeigen, dass sich in Stanislawskis „Partitur“ durchaus einige komische Elemente finden lassen. Das fängt mit der Figurenführung an: Jepichodow ist offensichtlich ein Komödiant. Bei seinem ersten Auftritt lässt er nicht nur während der Begrüßung den Blumenstrauß fallen, sondern wischt auch noch – das erfindet Stanislawski – mit seinem Taschentuch zuerst das Fenster und dann sein Gesicht ab. (vgl. Stanislawski 1989: 11) Dann soll Jepichodows Stuhl umfallen, woraufhin er sein Unglück preisen wird. Doch geschieht dies nicht, indem er den Stuhl umstößt, wie es der Text vorsieht, sondern der Stuhl fällt „von selbst“ aufs Stichwort um, was die Komik noch verschärft. Die Regieanweisung lautet: „Zu diesem Zeitpunkt den Mantel so zwischen die Stäbe der Stuhllehne klemmen, daß der Stuhl, wenn Jepichodow losgeht, durch den verhakten Mantel unvermeidlich umstürzen muß.“ (Stanislawski 1989: 13) Im zweiten Akt beginnt der Kontorist mit einer „Nummer“: Neben die erste große Replik schreibt Stanislawski:
„Jepichodow steht auf, um seinen Worten mehr Gewicht zu verleihen. Während er spricht, merkt er nicht, daß er auf seinem Hut (oder seiner Mütze) steht und diesen ganz zerdrückt. Sein Fuß ist in den Hutboden geraten, und wenn er losgeht, schleift er den Hut mit dem Fuß mit.“ (Stanislawski 1989: 59)
Von einer Wiederaufnahme des Kirschgarten in den 20er Jahren berichtet der Schauspieler Wassili Toporkow[31], wie der Regisseur einer neuen Schauspielerin die Anlage dieser Szene am Beginn des zweiten Aktes erklärt:
„Hier ist echter Humor, hier haben wir das Genie Tschechows. Wie muß man da herangehen, wie die Szene spielen? [...] Es fehlt jede Karikatur, und doch ist es fast eine Art Schaubudenvorstellung. Bei der Durchführung seiner Handlungslinie muß jeder Darsteller dieser Szene äußerst ernst und von seiner Bedeutung überzeugt sein. Je ernsthafter der Kampf zwischen den beiden Rivalen[32] geführt wird, die sowohl sehr feine diplomatische Schachzüge als auch direkte Drohungen mit dem Revolver (stellen Sie sich vor, was für eine spanische Leidenschaft!) machen, um so näher kommen Sie Tschechow.“ (Stanislawski zit. nach Toporkow: 63)
Aus der Betrachtung des gesamten Inszenierungskonzeptes schliesst Allen, dass Stanislawski die Tragödie der Enteignung des heruntergekommenen Landadels mit ironischem Blick zeigt. Die Herrschaft[33] will sich ihre Probleme nicht eingestehen. Als Lopachin vom bevorstehenden Verkauf des Kirschgartens berichtet, wird munter zu Abend gegessen und Wein getrunken. „Die anderen sind empört und hören ihm mit Mißbilligung zu. Sie empören sich über Lopachins barbarische Idee, versuchen aber nicht einen Augenblick, den Kern der Sache zu erforschen [...]“ (Stanislawski 1989: 31) Das Abendessen findet am Kindertisch im Kinderzimmer (vgl. Stanislawski 1989: 29) statt, an dem die Erwachsenen völlig lächerlich wirken.
Der aristokratische Ton, den Stanislawski für Gajew, er spielt die Rolle selbst, findet, kann in dieser Situation der Auflösung nur ironisch sein: „Meiner Meinung nach muß Gajew leichtfertig sein, wie auch seine Schwester. Er merkt überhaupt nicht, wie er spricht. Er begreift es erst, wenn schon etwas gesagt ist.“ (zit. nach Poljakowa: 224) Im vierten Akt wandelt sich Gajew zur tragikomischen Figur, wenn er, nachdem die Andrejewna schon abgetreten ist, sein Taschentuch wie ein Schuljunge in den Mund stopft, während ihm Tränen in den Augen stehen. (vgl. Allen: 30) Diese Szene ist, wie Allen analysiert, ebenso tragischer wie komischer Höhepunkt des Stückes.
Im zweiten Akt zeigt sich Stanislawskis Gespür für komische Szenen. Das Werben der Rivalen um Dunjascha wird in einem Vorspiel auf unterhaltsame Weise antizipiert: Jascha und Dunjascha singen ein Duett, in das Jepichodow versucht einzusteigen. Es gelingt ihm nicht und klingt furchtbar schief. (vgl. Stanislawski 1989: 57) Später, wenn die Mutter ihre Kinder drückt und küsst, beginnt bei Stanislawski
„Eine Szene voller Küsse. Sie küssen sich nicht sondern schmatzen sich ab. Sie geben unartikulierte Laute von sich, stöhnen, weil sie keine Luft mehr bekommen, und lachen, wenn ein Kuss auf eine kitzelige Stelle, zum Beispiel am Ohr, landet. [...] Das ganze endet natürlich mit Gekitzel und einer Balgerei.“ (Stanislawski 1989: 77)
Der Ball im dritten Akt wird zum grotesken Hintergrund für die Nervosität der Ranewskaja. Der Tanz ist albern, keiner kennt wirklich die Schritte und die Zusammensetzung der Tanzpaare (Trofimow mit der Ranewskaja, Pischtschik mit Charlotta, der Lehrer mit Dunjascha) muss einen komischen Eindruck machen. (vgl. Stanislawski 1989: 97f.) Wenn ein Tanz zu Ende ist, wird es still, alle erstarren. „Keiner kümmert sich um den anderen. Jeder ist sich selbst überlassen.“ Die Bedrohlichkeit der Vorahnung in dieser Szene setzt sich zusammen aus dem komischen (Charlottas Zauberkunststücke sind von Stanislawski sehr detailliert ausgearbeitet) und leichtfertigen Gemenge des Balles und den Pausen, wenn alles einfriert und Verlegenheit aufkommt. Diese großartigen Umschwünge machen den Ball tatsächlich zur Farce.
Auch wenn komische Elemente die Partitur durchziehen, so fehlen doch nicht Stanislawskis ausführliche Stimmungsbeschreibungen und melancholische Pausen. Dieser etwas sentimentale Blick auf das russische Leben vor der Revolution ist, was das Publikum von Stanislawski und seinen Mitstreitern erwartet. Der Kirschgarten als Tragikomödie hat etwas von beidem. Sicher ist, dass sich der Stil von Stanislawskis Inszenierungen seit der Möwe verändert. Stanislawski zeigt Tschechow-Figuren nicht mehr als Scheiternde und Frustrierte, sondern als lebenslustige und kämpfende Menschen. „Chekhov, Stanislawski argued, 'was active, he wasn't a pessimist. Life in the 'eighties created Chekhov's heroes. Chekhov himself loved life, and longed for the best life, like all his heroes'“ (Allen: 27f.) Das Regiekonzept vom Kirschgarten ist, im Vergleich zu Drei Schwestern, „[...] hinsichtlich der inszenatorischen Details, insbesondere der Arrangements, weniger elaboriert und entfaltet [...] dafür heftiger, spontaner, sein Urheber ist häufig Gefühlspartei; [...]“ (Stanislawski 1989: 3) Zum ersten Mal sind darin auch Erklärungen zur Motivation und psychologischen Entwicklung der Figuren enthalten. (vgl. Allen: 58)
Tschechows Äußerung, dass Stanislawski den Kirschgarten ruiniert hätte, kann nicht hundertprozentig ernst genommen werden. Meiner Meinung nach, steckt hier viel von Tschechowscher Ironie. Allein der Zusatz: „Nun ja, Gott mit ihm“ schwächt die hinein interpretierbare Frustration. Tschechow kennt den Stil Stanislawskis und schreibt dennoch für das MChT. Außerdem hat er, soweit bekannt ist, Stanislawski nie im direkten Gespräch oder Korrespondenz kritisiert. Die Krankheit hat ihn empfindlich gemacht. Gorki berichtet von heftigen Stimmungsschwankungen, die sich Jean Benedetti (vgl. Allen: 22) auch durch die schwere Lungentuberkulose des Autor erklärt. Tschechow ist Arzt, auch wenn er sich immer wieder Gesundheit einredet, weiß er doch, dass er, wie sein Bruder Nikolai, am Husten sterben wird. Leider hat Tschechow den Erfolg seines Werkes nicht mehr erlebt, fest steht aber, dass es dem Künstlertheater zu verdanken ist, dass Tschechow heute zu den weltweit erfolgreich gespielten Autoren gehört.
4. Stanislawski als Tschechow-Schauspieler
Stanislawski stammt aus einer theaterbegeisterten, wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Schon als Schüler tritt er in Liebhaberaufführungen der Familie auf. Von berühmten Schauspielern erhält er ab und an Unterricht. Zehn Jahre vor dem Künstlertheater ist er Mitbegründer der „Moskauer Gesellschaft für Kunst und Literatur“, wo er bereits Rollen der Weltliteratur spielt und erste Erfahrungen als Regisseur sammelt. In den achtzehnhundert achtziger Jahren ist er „[...] ohne Zweifel der beste Laienspieler [in] Moskau [...]“ (Poljakowa: 53)
Bei den Tschechow-Inszenierungen am MChT ist er Regisseur und spielt gleichzeitig immer eine der größeren Rollen. In der Möwe tritt er als Trigorin auf, in Onkel Wanja als Astrow, spielt den Werschinin in Drei Schwestern und hat großen Erfolg als Gajew-Darsteller in Der Kirschgarten. Nach Tschechows Tod spielt er in der Gedenkinszenierung Iwanow [34] die Rolle des Schabelski, eine Satire auf einen verwöhnten, zu nichts nützen älteren Herren. (vgl. Poljakowa: 229)
Mit seiner ersten Tschechow-Rolle hat Stanislawski keinen Erfolg. Er nähert sich der Rolle mit seiner „üblichen Methode“: „Er wählte einige Züge als Äußerlichkeiten aus und akzentuiert sie scharf, so auch den Charakter der handelnden Person.“ (Poljakowa: 138f.) Stanislawski, der ursprünglich plante Dorn zu spielen, betont die Phrase „Ich habe keinen eigenen Willen“ (Die Möwe, 3. Akt, S. 47) und legt den Dichter Trigorin als bescheidene, ruhige, passive und kraftlose Figur an (vgl. Jones: 47). Tschechow ist enttäuscht von Stanislawskis Leistung, obwohl er ihn selbst besetzt hat: „Ich las im „Kurjer“, Stanislavskij spiele den Trigorin irgendwie schwächlich. Was für eine Idiotie? Trigorin gefällt doch, er ist attraktiv, interessant mit einem Wort, und ihn schwächlich und schlaff zu spielen kann nur ein unbegabter Schauspieler, der keine Ahnung hat.“ (Brief an seine Schwester vom 4.11.1899 in Tschechow 2004: 253) Gegenüber Stanislawski äußert er sich anders: „Ist doch wunderbar, na hören Sie, ich sage, wunderbar! Nur, Sie brauchen schiefgetretene Schuhe und karierte Hosen!“ (zit. nach Stanislawski 1987: 278) Stanislawskis Trigorin aber trägt einen eleganten Anzug. Erst später begreift Stanislawski diese Äußerung Tschechows:
„Aber gewiss doch, zerrissene Schuhe, karierte Hose und überhaupt kein Schönling! Das ist ja das Drama, daß es den jungen Dingern darum geht, daß einer Schriftsteller ist und rührende Geschichten druckt, dann werfen sich ihm sämtliche Nina Saretschnajas an den Hals, ohne zu merken, daß er als Mensch unbedeutend und [...] geradezu häßlich ist.“ (Stanislawski 1987: 278)
Zu Beginn seiner Beschäftigung mit Tschechow hängt der Schauspieler Stanislawski gegenüber dem Regisseur noch zurück: „[...] er hatte das neue Theater schon geschaffen und lebte in ihm, aber Stanislawski als Schauspieler agierte noch überzeugt in der Sphäre des alten Theaters.“ (Poljakowa: 139)
Mehr Erfolg hat Stanislawski mit seiner Darstellung des visionären Arztes Astrow in Onkel Wanja. „Wir stellen Astrow als einen Materialisten im guten Sinn dar, der nicht fähig ist, zu lieben und sich Frauen gegenüber mit einem eleganten Zynismus benimmt [...]“ (Nemirowitsch an Tschechow zit. nach Poljakowa: 165). In Drei Schwestern spielt er den Oberstleutnant Weschinin ohne Maske und Perücke, als Mensch der Zeit, in der Kriege und Revolutionen die Welt verändern. (vgl. Poljakowa: 171ff.) Besonders als Gajew (s. Kapitel 3.2.) gewinnt Stanislawski die Sympathien des Moskauer Publikums und ist längst, neben Olga Knipper, zum Star des Ensembles geworden.
Stanislawski muss erst lernen die neuen Figuren Tschechows zu spielen, doch findet er immer besser den Ton dieser Gesellschaften, die zum Scheitern verurteilt sind und doch leben wollen. Er spielt die älteren Herren, die sich ihrer Situation ergeben (Trigorin) oder zu einfältig sind, sie überhaupt zu erfassen (Gajew). Aber er spielt auch die Männer, die sich nicht dem „flügellahmen Leben“ (Poljakowa: 176) unterwerfen, sondern ihre Visionen behalten und an ein anderes Leben glauben bis zuletzt.
Tschechows Äußerungen über Stanislawskis Schauspielkunst sind abermals widersprüchlich. Einerseits traut er Stanislawski schauspielerisch nichts zu:
„Meine Erinnerungen an Alekseevs Spiel sind dermaßen düster, daß ich sie einfach nicht loswerden kann und einfach nicht glauben kann, daß A. in 'Onkel Vanja' gut sein soll, obwohl alle einstimmig schreiben, er sei tatsächlich gut, sehr sogar.“ (Tschechow an Nemirowitsch am 3. 12. 1899 zit. nach Tschechow 2004: 158)
Andererseits wagt er nie, den Schauspieler persönlich zu kritisieren. Er schreibt für ihn die wahrscheinlich komplizierteste Rolle im Kirschgarten, den Lopachin. Vielleicht will er den Schauspieler herausfordern, immerhin ist Stanislawski tatsächlich Kaufmannssohn? Vielleicht rechnet er mit Sympathiegewinn für die Rolle, wenn sie der Star des Hauses spielt? Das persönliche Verhältnis zwischen Autor und Regisseur bleibt dahingehend weiter rätselhaft.
5. Resümee
Abschliessend möchte ich diese zwei Fragen zusammenfassen: 1) Was zeichnet die Tschechow-Inszenierungen am MChT aus? und 2) Wie kann das Verhältnis zwischen Autor und Regisseur bzw. Theater bestimmt werden?
Zunächst muss festgestellt werden, dass es nicht allein Stanislawskis Tschechow-Inszenierungen sind, sondern, dass am MChT kollektiv gearbeitet wurde. Ohne die dramaturgischen Einführungen Nemirowitsch-Dantschenkos hätte Stanislawski seine Konzepte sicher nie so ausarbeiten können. Auch auf den Proben war Arbeitsteilung angesagt. Schauspieler und Regisseure haben eine neue Darstellungskunst entwickelt, die die „innere Wahrheit“ in den Figuren sucht und sich dafür bis zu Tschechows „Goldader durchgräbt“ (Stanislawski 1987: 273). Mit den jungen Schauspielern konnte man ein Ensemble zusammenstellen, wo sich jeder Einzelne zurücknahm und das sich gegenseitig befruchtete. Die Schauspieler fanden durch ihre Arbeit an den Rollen den „Tschechowschen Rhythmus“ (Meyerhold: 115) und lernten die Musikalität der Dialoge umzusetzen.
Die Geschlossenheit aller Elemente von Bühnenbild über Beleuchtung, Ton, Maske bis zur Figurendarstellung machte den Erfolg der Inszenierungen aus. Dies setzte einen starken Regisseur voraus, der einen genauen Plan hat, um alle theatralen Zeichen auf ein Thema, auf eine Stimmung konzentrieren zu können. Oft ist Stanislawski vorgeworfen worden, dem Publikum lediglich seine naturalistische Illusionsmaschine präsentieren zu wollen. Dabei hatte er versucht sich Tschechow auf eine Weise zu nähern, die eine „Echtheit“ der Umgebung voraussetzt, um eine „Echtheit“ der Gefühle zu ermöglichen. Die einzelnen Elemente dieser Umgebung mögen naturalistisch gewesen sein, aber die Kombination, so Allen (S. 13), war nicht naturalistisch, sondern „[...] a highly poetic rendering of the play.“
Vielleicht war dies alles nur möglich aufgrund der großen Zuneigung und Verehrung der Schauspieler für „ihren“ Autor, den sie förmlich liebten. Nemirowitsch-Dantschenko erinnerte sich später: „When we first played Chekhov, we were all 'Chekhovians'; we carried Chekhov within us, breathed with him the same enthusiasms, cares, thoughts.“ (zit nach Senelick: 50) Auch Tschechow pflegte die Freundschaften zum Theater, zu den Schauspielern. Man beschenkt sich, der Dramatiker schreibt den Schauspielern ihre Figuren auf den Leib. Eine besondere Rolle spielte sicher Tschechows große Verehrung für Olga Knipper. Ohne diese Beziehung wäre der Kirschgarten wohl nie fertig geworden, hätte sich aus dem Erfolg der Möwe nie eine so intime und (relativ gesehen) langjährige Bindung zwischen Autor und Theater entwickelt.
Doch der (nie ausgesprochene) Alleinvertretungsanspruch, den das MChT unterschwellig auf die Tschechow-Stücke – die „Zugpferde“ des Theaters – hegte, sorgte auch für Spannungen in der Zusammenarbeit, die sich gerade kurz vor dem Tod des Autors bei der Inszenierung des Kirschgartens zeigten. Tschechow fühlte sich missverstanden, die Theatermacher fühlten sich in ihrer Autonomie beeinträchtigt. Doch beide Seiten wussten, dass sie ihr Überleben nur dem gemeinsamen Erfolg verdankten.
Die Zusammenarbeit zwischen Stanislawski und Tschechow und ihr persönliches Verhältnis wird in der Forschung sehr unterschiedlich dargestellt und interpretiert. Für mich scheint es so, als ob die Biografen Tschechows (Troyat) die angeblichen Missverständnisse mehr betonen als die Stanislawski-Seite (Poljakowa). Tschechows eigene Äußerungen sind zwiespältig, ironisch, aber Stanislawski schrieb immer mit grösster Hochachtung vom so früh verstorbenen Meister.
„Chekhov and Stanislavsky could be estranged and reconciled by art, estranged and reconciled by life.“ (Jones: 60)
Literaturverzeichnis
Allen, David: Performing Chekhov. London (Routledge) 2000.
Hensel, Georg: Spielplan. Der Schauspielführer von der Antike bis zur Gegenwart München (Econ) 2003.
Hoffmeier, Dieter: Stanislawskij: Auf der Suche nach dem Kreativen im Schauspieler. Stuttgart (Urachhaus) 1993.
Jones, David R.: Great directors at work. Stanislavsky, Brecht, Kazan, Brook. Berkeley, Los Angeles (University of California Press) 1986.
Laffitte, Sophie: Anton Tschechov. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg (Rowohlt) 1960.
Meyerhold, Wsewolod E.: Schriften: Aufsätze, Briefe, Reden, Gespräche. Erster Band 1891-1917. Berlin (Henschel) 1979. Darin besonders: „Briefe an Tschechow“ (S. 73-82) und „Naturalistisches Theater und Theater der szenischen Stimmung“ (S. 105-115), 1906.
Poljakowa, Elena I.: Stanislawski: Leben und Werk des großen Theaterregisseurs. Bonn (Keil) 1981.
Senelick, Laurence: The Chekhov Theatre: A century of the plays in performance. Cambridge (University press) 1997.
Stanislawski, Konstantin S.: Mein Leben in der Kunst. Berlin (Henschel) 1987.
Stanislawski, Konstantin S.: Der Kirschgarten von Anton P. Tschechow. Regiebuch. Berlin (Schaubühne am Lehniner Platz) 1989.
Toporkow, Wassili O.: K.S. Stanislawski bei der Probe. Erinnerungen. Berlin (Henschel) 1952.
Troyat, Henri: Tschechow: Leben und Werk. Aus dem Französischen übertragen von Christian D. Schmidt. Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1987.
Tschechow, Anton: Die Möwe. Komödie in vier Akten. Übersetzt und herausgegeben von Peter Urban. Zürich (Diogenes) 1973.
Tschechow, Anton: Der Kirschgarten. Eine Komödie in vier Akten. Übersetzt von Hans Walter Poll. Stuttgart (Reclam) 1984.
Tschechow, Anton: Über Theater. Herausgegeben von Jutta Hercher und Peter Urban in der Übersetzung von Peter Urban. Frankfurt a. M. (Verlag der Autoren) 2004.
Urban, Peter (Hrsg.): Über Cechov. Zürich (Diogenes) 1988.
[...]
[1] Aus Gründen besserer Lesbarkeit habe ich die deutsche Schreibweise verwendet.
[2] Der erste Regisseur, als künstlerisch Gesamtverantwortlicher, war Georg II. von Meiningen. (vgl. Brauneck, Schneilin (Hrsg.): Theaterlexikon 1. Begriffe und Epochen, Bühnen und Ensembles. Reinbek (Rowohlt) 42001. S. 829) Seine Arbeit gilt als Vorbild für Stanislawski.
[3] 1888 verleiht ihm die Akademie der Wissenschaften den Puschkin-Preis.
[4] Das entspräche im Ernstfall etwa 2 kg.
[5] Guy de Maupassant, frz. Schriftsteller, Mitte des 19. Jahrhunderts, bekannt für meisterhafte Novellen.
[6] Treplev erschießt sich am Ende des Stückes recht unerwartet im Off, man hört lediglich den Knall.
[7] Tschechow selbst beschreibt sie mit musikalischen Termini, siehe Brief an Suvorin Seite 2.
[8] Siehe dazu auch Kapitel 3.2.
[9] Wird auch mit „scrore“ oder „mise en scène“ übersetzt.
[10] Leider liegt mir das Regiebuch der Inszenierung (von S.D. Baluchati 1938 herausgegeben) nicht vor. Daher muss ich mich auf (hauptsächlich englischsprachige) Sekundärquellen beziehen.
[11] Den Begriff der „Überaufgabe“, als „[...] vom Schauspieler und Regisseur definierte[s] Ziel des zu spielenden Werkes [...]“ (Balme, Christopher: Einführung in die Theaterwissenschaft. Berlin (Schmidt) 2003. S. 188) formuliert Stanislawski erst später in seinem Buch „Die Arbeit des Schauspielers an sich selbst“.
[12] Beispielsweise werden erstmals echte Zigaretten und Streichhölzer auf der Bühne verwendet, was der Aufführung eine neue sinnliche Komponente verleiht und eine neue Verbindung zwischen Bühne und Zuschauerraum etabliert.
[13] Die Anweisung, dass Sorin – später auch die anderen Figuren – sich mit dem Rücken zum Publikum setzt, soll zeigen, dass die Figuren ein Leben „unabhängig“ von den Zuschauern führen.
[14] Theatertruppe um Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, die für historische Genauigkeit und gutes Ensemblespiel bekannt war. Stanislawski sieht Gastspiele in Moskau 1885 und 1890.
[15] Siehe Der Kirschgarten, 3.Akt, mehr in Kapitel 3.2.
[16] Interessant ist dies vor dem Hintergrund, dass Tschechows Dramen, u.a. aufgrund der Handlungsarmut als „kleine Romane“ bezeichnet werden. Stanislawski muss also einen „Roman“ mit epischen Elementen auffüllen, um ihn als Drama verständlich zu machen.
[17] Er kommt 1898 24jährig ins Ensembles und spielt die Rolle des Treplev.
[18] Er meint die Proben zu Der Kaufmann von Venedig, der parallel probiert wird.
[19] Es war üblich von den ersten Proben an in vollem Kostüm zu spielen.
[20] Nach der berühmte Eröffnungspremiere von Tolstojs „Zar Fjodor Iwanowitsch“ (mit 666 Vorstellung) folgen fünf weniger erfolgreiche Inszenierungen, darunter: Hauptmanns Versunkene Glocke und Shakespeares Kaufmann von Venedig (vgl. Tschechow 2004: 297).
[21] Stanislawski: „Chekhov's play [...] brought us good luck and, like the Star of Bethlehem, lighted the new road we were to travel in pursuit of our art.“ (zit. nach Jones: 72).
[22] Tschechow dürfte Die Möwe in der Originalinszenierung erst im November 1900, gut zwei Jahre nach der Premiere in Moskau während der Probenzeit zu Drei Schwestern gesehen haben. (vgl. Troyat: 290).
[23] Stanislawski als Schauspieler siehe auch Kapitel 4.
[24] Am Ende des ersten Aktes, während des Dialoges: Mascha-Dorn.
[25] Tschechows Geburtsstadt.
[26] Premiere ist am 27. Dezember 1889 am privaten Abramowa-Theater in Moskau. Das Stück wird als „undramatisch“ kritisiert und nach fünf Vorstellungen abgesetzt. Tschechow arbeitet den ersten und vierten Akt wahrscheinlich 1896 um, der zweite und dritte Akt bleiben nahezu unverändert (vgl. Tschechow 2004: 304).
[27] Sie spielt mit 33 Jahren Mascha; die jüngste der Töchter.
[28] Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft das Stück allein in Moskau am MChT über 750 Mal. Nur wenige Monate nach der Uraufführung wird Der Kirschgarten an vielen Provinzbühnen (in Cherson inszeniert Meyerhold drei Wochen später), dann auch in Petersburg gezeigt (vgl. Tschechow 2004: 308).
[29] „[...] 1) der Autor ist Herr des Stückes, nicht die Schauspieler; 2) überall gehört die Besetzung zur Verpflichtung des Autors, wenn eine solche nicht fehlt; 3) bis jetzt haben alle meine Hinweise zum Nutzen gereicht und sind befolgt worden; 4) die Schauspieler bitten von sich aus um Hinweise [...]“ (Tschechow 2004: 140)
[30] „Entweder ist das Stück nicht gut, oder die Darsteller begreifen es nicht. So wie es momentan inszeniert wird, ist es unspielbar.“ (zit. nach Troyat: 363)
[31] Er spielt in dieser Besetzung den Jepichodow.
[32] Jepichodow und Jascha buhlen um die Gunst Dunjaschas.
[33] Senelick vergleicht den Kirschgarten mit Komödien der Commedia dell' arte in denen auch das Verhältnis zwischen Dienerschaft und Herren unterhaltsam zum Gegenstand wird (vgl. S. 70).
[34] Regie: W. Nemirowitsch-Dantschenko. Premiere 19. 10. 1904, insg. 110 Vorstellung (vgl. Tschechow 2004: 298).
- Arbeit zitieren
- Roland Bedrich (Autor:in), 2005, Die Zusammenarbeit von Stanislawski und Tschechow im Moskauer Künstlertheater, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109807
Kostenlos Autor werden
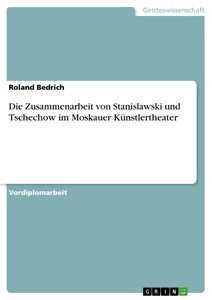

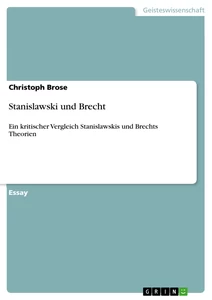







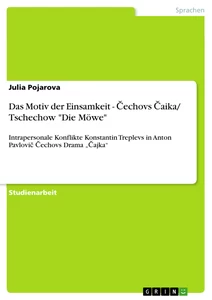







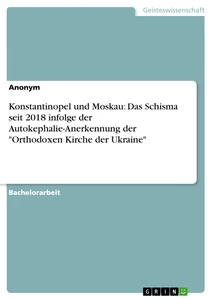



Kommentare