Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Stefan Georges Werk
2 Der erste Ring: Zeitgedichte
2.1 Begründung der Auswahl
2.2 Das Zeitgedicht (1)
2.3 Bocklin
2.4 Die Gräber von Speier
2.5 Das Zeitgedicht (14)
3. Zusammenfassung
1 Stefan Georges Werk
In „Der siebente Ring“, der 1907 erschien, vollzog sich ein Wandel in Georges Denkweise. In diesem Werk vertritt er nicht mehr vordergründig eine rein ästhetische Kunst, sondern fühlte sich dazu berufen, pädagogisch zu wirken und somit Einfluss auf seine Leser zu gewinnen. Er wurde als der siebte Gedichtband Georges 1907 veröffentlicht. Der Band besteht aus sieben Büchern, wobei jedes Buch eine durch sieben teilbare Anzahl von Gedichten aufweist. Der vierte Ring „Maximin“ stellt das Zentrum des „Siebenten Rings“ dar. Georges letzter großer Gedichtband „Das neue Reich“ erschien im Jahr 1928. Obwohl er dies als eine geistige Erneuerung sah, verstanden einige seiner Zeitgenossen den Titel falsch, namlich politisch.[1]
2 Der erste Ring: Zeitgedichte
Der erste Ring „Zeitgedichte“ enthült 14 Gedichte, welche alle dieselbe Form aufweisen. Jedes besteht aus genau 32 Verszeilen, welche jeweils gleichmaßig in vier Strophen aufgeteilt sind.[2] [4] Die Verse reimen sich nicht und bis auf die Versanfaünge verzichtet George fast ganz auf Interpunktion und Großschreibung. Diese Zeitgedichte sind das Resultat von Georges Beschüftigung mit der gegenwürtigen und der vergangenen Zeit. Sie sind charakterisiert durch Zerfall und Neubeginn, denn George kritisiert das Zeitgeschehen und will doch Hoffnung und Ausblick geben. Er konzentriert sich hier ganz darauf, das Verhalten seiner Mitmenschen auf unbarmherzige Art und Weise zu kritisieren und zu richten.[3] George wendet sich hier erstmals an die breite Öffentlichkeit, nümlich das gebildete Burgertum, um Einfluss zu nehmen und zu erziehen. Somit wirkt George ab dem „Siebenten Ring“ als Erzieher und Ethiker.[4] In diesem ersten Buch verzichtet George völlig auf das sonst viel verwendete Kussmotiv, denn die „Zeitgedichte“ sind ein Buch des Unmuts, in dem das Unheil der Zeit beschrieben wird.[5] In den historischen Menschen seiner Zeit (wie Goethe, Nietzsche, Böcklin,...) sieht er sein heroisches Ideal und versucht, diese eigentlich historischen Figuren auf eine mythische Ebene zu heben, um menschliche Urtypen aus ihnen zu machen. Er verbindet sie so mit antiken Vorbildern.[6]
Von manchen seiner Gedichte will George ausdrucklich, dass sie nicht gedeutet werden, aber da die Gedichte des ersten Rings direkt an Außenstehende gerichtet sind, ist der Leser hier dazu aufgefordert, sich eigene Gedanken daruber zu machen.[7]
2.1 Begründung der Auswahl
Da das erste und das letzte Zeitgedicht einen Rahmen um alle anderen bilden und sich von ihnen wesentlich unterscheiden, erschien es mir sinnvoll, diese beiden auf jeden Fall zu behandeln. Die anderen Gedichte sind alle recht öhnlich aufgebaut. In den meisten hat sich George auf eine Vorbildfigur konzentriert, mit deren Hilfe er seine Absicht, die Vergangenheit zu kritisieren und seine Leser zu einem Neuanfang zu ermutigen, verfolgt. Im zweiten Zeitgedicht benutzt er zum Beispiel Dante als Projektionsfigur und baut das Gedicht ahnlich wie einen Lebenslauf auf, wobei sich verschiedene Verse auf vergangene Handlungen Dantes beziehen, welche wirklich geschahen. Da der historische Bezug in allen Gedichten mit Ausnahme des ersten und letzten vorhanden ist, lassen sie sich nicht ohne geschichtliches Hintergrundwissen interpretieren. Es wird außerdem immer deutlicher, dass George ganz bestimmte Personen in seinen Gedichten anspricht. Aus Interesse habe ich „Böcklin“ ausgewahlt und als Gegensatz dazu „Die Gräber von Speier“, denn in diesem Gedicht widmet sich George ausnahmsweise an sehr viele Personen.
2.2 Das Zeitgedicht (1)
Die direkte Anrede „Ihr“ am Anfang der ersten Strophe lasst vermuten, dass das ganze Gedicht einer Ansprache gleicht. Wer damit gemeint ist, namlich die Zeitgenossen Georges (V. 1: „Ihr meiner zeit genossen“)[8] wird auch sofort bekanntgegeben. George spricht hier durch das lyrische Ich hauptsächlich die Leute an, die sich fur gebildet halten, und mochte ihnen klarmachen, wie unwissend und intolerant sie eigentlich sind. Dadurch, dass er sich mit seinem Anliegen direkt an diese Zielgruppe wendet und sie uber ihren Irrglauben aufklaren will, wirkt George mit diesem Gedicht didaktisch.
Die erste Strophe ist wie die letzte in der ich-Form geschrieben, in der dritten Strophe faällt aber auf, dass das lyrische Ich von sich selbst in der dritten Person redet.
Die ersten vier Verse der ersten Strophe nehmen direkt Bezug auf die Zeitgenossen, was durch V. 1: „Ihr“ und V. 3: „ihr“ deutlich wird. Hier werden aber hächstwahrscheinlich nicht sämtliche Zeitgenossen Georges, sondern nur das gebildete Burgertum angesprochen. Der Ausdruck kanntet schon“ im ersten Vers vermittelt dem Leser sofort den Eindruck, dass die Angesprochenen glauben, vieles zu wissen, ohne die Informationen selbst auf Richtigkeit uberpruft zu haben. Damit kritisiert das lyrische Ich, dass das angesammelte Wissen der anscheinend gebildeten Oberschicht nicht fundiert und somit wertlos ist. Wirkliche
Erkenntnis sollte nämlich aus eigenen Erfahrungen und Überlegungen resultieren und nicht das Ergebnis von unbewiesenen Behauptungen sein, wie es hier wohl der Fall ist. Das lyrische Ich will also als erstes seinen Zeitgenossen die Illusion, wissend zu sein, nehmen. Denn bevor es die Menschen uber die Wahrheit aufklaren kann, muss das falsche Wissen, welches sich schon in den Köpfen festgesetzt hat, gelöscht werden, um Kapazitaten fur neues Wissen zu schaffen.
Im folgenden Vers erinnert das lyrische ich sie an die ungerechten Handlungen, die sie in der Vergangenheit gegen es ausöbten. Als Beispiele nennt es hier die Anmaßung, Urteile zu föllen (V. 2: „Bemaasset“) oder sich zu Beschimpfungen hinreißen zu lassen, wodurch es die fehlende Selbstkontrolle derer, die sich selbst für stilvoll halten, anspricht. Dann folgt sofort die Aufklürung dieses Fehlverhaltens mit „ihr fehltet“ (V. 2) (, was man auch gedanklich noch vervollstandigen könnte mit „ihr fehltet mir gerade noch“, so interpretiert empfönde das lyrische ich diese Leute als eine Last). Wodurch diese fehlerhafte Einschatzung hervorgerufen wurde und worin sie bestand wird in den folgenden sechs Versen beschrieben. Ihr unanstandiges, unkontrolliertes und auf Trieben basiertes (V. 3: „gier“) Benehmen wirkte sich wohl auch auf deren Verstand aus, was Blindheit zur Folge hatte. Der Ausdruck „larm“ (V. 23) vermittlet dem Leser das Geföhl einer unangenehmen, ohrenbetauben- den Geröuschkulisse wie zum Beispiel einer Meute bellender Hunde, wobei „gier“ durch das Adjektiv „wöst“ (was auch als „verwustend“ gelesen werden könnte) noch verstörkt wird und dadurch den scheinbar anstöndigen und achtenswerten Lebensstil der Börger heftig kritisiert. Hier wird ein Bild geschaffen, welches genau dem Gegenteil dessen entspricht, wie feine und gebildete Menschen gesehen werden wollen. Durch ihre Ünbeholfenheit (V. 4: „plumpem tritt“) und ihre nicht sehr stilvolle (V. 4: „rohem finger“) Art eilen (V. 4: „ranntet“) sie hastig und ohne Ziel von einem Ort zum nöchsten, ohne dabei auch nur die geringsten Überlegungen uber den Sinn ihres Agierens anzustellen. Dann bringt sich das lyrische Ich selbst ins Spiel, George beschreibt aber vorerst nicht sein wahres Wesen, sondern nur ein Trugbild, welches die Zeitgenossen von ihm erschufen. Dass es für einen verwöhnten (V. 5: „salbentrunknen“) Burschen gehalten wurde, sind jedoch falsche Unterstellungen (V. 5: „galt“) und die offensichtlichen Äußerlichkeiten seines Lebensstils waren nur Schein. Seine Jugend verlief nach außen hin zwar wohlbehütet (V. 6: „sanft geschaukelt“) und entspannt, dass er aber in Wirklichkeit kein solch angenehmes Leben fuhrte, bemerkte niemand (s. Strophe 2). In den nachsten beiden Versen werden positive Eigenschaften wie „anmut“ und „wurde“ (V. 7) des lyrischen Ich aufgezeigt. Die Adjektive „schlank“ und „kühl“ lassen auf eine gewisse Bescheidenheit und Gefuhlsdistanz schließen, was im Vers acht durch „blasser erdenferner festlichkeit“ noch verstürkt wird. George baut hier eine Distanz des lyrischen Ich zum Treiben der Realitüt auf, um sich von irdischen Machenschaften und den Menschen fernzuhalten.
Durch die Art und Weise, wie George das „Zeitgedicht“ formal geschrieben hat, laüsst sich nochmals erkennen, dass er hier Äbstand von Gefühlen nimmt. Obwohl er inhaltlich starke Kritik an seinen Mitmenschen übt, sich von ihnen falsch verstanden und ungerecht behandelt fuhlt, bedient er sich keineswegs einer aggressiven Wortwahl, um seinem Unmut Ausdruck zu verleihen. Er bleibt viel eher neutral und zuruckhaltend, um sich nicht auf das Niveau derjenigen herabzulassen, die er verachtet.
Die naüchste Strophe handelt von den tatsaüchlichen Erfahrungen des lyrischen Ich, welche mit dem vorher geschilderten Schein nichts gemein haben. Im neunten Vers spricht es an, dass seine gesamte (V. 9: „ganzen“) Jugend mit Schmerz und Angst durchzogen war, doch die Angesprochenen erahnten (V. 10: „rietet“) nicht einmal einen Teil (V. 10: „nichts“) dieser Pein. Obwohl es sich weit weg (V. 11: „hochstem first“) vom menschlichen Ungluück befand, wurde es dennoch von verschiedenen Qualen heimgesucht, welche ihn duch Albträume und Ängstzustande belasteten. Auch diese Tatsache blieb seinen Zeitgenossen durch ihre Blindheit verschlossen. Verse 12 bis 14 handeln von einem Verrat durch jemanden, der sich dem lyrischen Ich als Freund preisgab, sich jedoch später mit zerstörerischer Absicht (V. 14: „Mit dolch und fackel“) gegen es erhub und sich somit wahrlich als Feind entpuppte. Von Kampfeslust ergriffen (V. 12: „lechzend“) verschaffte sich jener unerlaubten Zutritt (V. 13: „eingedrungen“) zum Wohnsitz des Verratenen, um ihn zu töten (V. 14: „dolch“) und sein Haus abzubrennen (V. 14: „fackel“). Darauf folgend werden im Gedicht wieder die Zeitgenossen direkt angesprochen, diesmal ironisch durch „Ihr kundige“ (V. 15), denn sie selbst verstehen sich als weise. Im gleichen Vers klagt George sie durch das lyrische Ich an, dass sie dennoch nicht in der Lage sind, menschliche Gefähle zeigen (V. 15: „kein schauern“, „kein lacheln“). Es konnte aber auch sein, dass er sie bittet, jetzt von Heuchelei abzusehen, denn sie verkannten sein Talent, da sie es durch ihre Oberflächlichkeit nicht vermochten, hinter die angesprochenen Äußerlichkeiten zu blicken. Obwohl dieses Talent nicht vollständig klar ersichtlich war, hatte es dennoch erkannt werden können, denn ein „dunner schleier“ (V. 16) kann nicht viel verbergen. Hinter dieser Kritik steckt eine Anschuldigung, für die es durch die konkreten Beispiele keine Entschuldigung zu geben scheint.
„Der pfeifer“ in Vers 14 erinnert an die Geschichte des Rattenfangers von Hameln.[9] Dieser bediente sich einer Flöte, um Ungeziefer aus der Stadt zu locken. Somit assoziiert der Leser mit den Zeitgenossen die Ratten aus dieser allgemein bekannten Geschichte. Nachdem das lyrische Ich erkannt hatte, dass einige seiner Mitmenschen die Stimme gegen es erhoben hatten, fasste es den Entschluss, diese Leute mit den wahren Begebenheiten zu konfrontieren. Also lockte es seine ihn verkennenden Zeitgenossen in seine eigene Umgebung, welche im Gedicht als „wunderberge“ (V. 19) beschrieben wird, was gut zu Vers 11: „höchstem first“ passt. Dadurch ist die Annahme, dass das Anwesen des lyrischen Ich hier lokal erhöht liegt, gerechtfertigt. Man könnte diesen Ort auch symbolisch mit seiner Geistesgröoße in Verbindung bringen. Um die Angesprochenen zu locken, bedarf es lediglich an hubscher Musik (V. 18: „Mit schmeichelnden verliebten tönen“). Dass diese sich schon durch so einfache Mittel betören lassen, zeigt zum wiederholten Mal, wie wenig sie es gewohnt sind, ihren Verstand zum Einsatz zu bringen. Dann zeigte (V. 18: „wies“) das lyrische Ich ihnen den Reichtum, mit dem es sich für gewöhnlich umgab. Dieser erschien den Angesprochenen wertvoller als alles, was ihnen bis dahin bekannt war (V. 19: „fremde schatze“). Als ihnen die Existenz von diesem bisher unbekannten, wunderbaren Reichtum bewusst wurde, verschmühten sie sogleich den Wert dessen, was sie vorher als wertvoll empfunden hatten. Plötzlich erkannten sie die Diskrepanz zwischen ihrem und des Sprechers Besitz, denn was ihnen vorher als prunkvoll und schon bekannt war, ist fur das lyrische Ich uninteressant. Deshalb wollen sie jetzt nichts mehr von ihrer Welt wissen, sondern fangen an, von diesem fremden Reichtum zu schwarmen. In Vers 22 druckt die Wortwahl „schmachtig prunken“ aus, wie die Angesprochenen auf erbüarmliche Art und Weise anfangen, mit Reichtum anzugeben, den nicht sie, sondern ein anderer zustande gebracht hat. Daraufhin werden sie vom Hausherr mit lautem Getose (V. 22: „fanfare“) fortgetrieben. Obwohl die Angesprochenen ihn in der Vergangenheit verletzten, schreibt er in Vers 23, dass zum jetzigen Zeitpunkt er derjenige ist, welcher die Macht besitzt, ihnen zu schaden ( verletzt“). Seine Zeitgonossen werden hier mit ,,morsche[m] fleisch“ (V. 23) verglichen, was beim Leser ein Gefühl der Widerwürtigkeit und ein Bild von verwesenden Körpern hervorruft. Dieser Ausdruck lösst darauf schließen, dass auch das lyrische Ich Ekel vor dem abstoßenden Benehmen dieser Leute empfindet. Um sie so schnell wie möglich wegzutreiben, werden die „sporen“ (V. 23) als Metapher eingesetzt, denn eigentlich sind sie ein Hilfsmittel fur Reiter, um ihre Pferde anzutreiben. Je starker die Sporen zum Einsatz gebracht werden, desto mehr wird das Pferd verletzt und rennt somit schneller, um dem Schmerz zu entkommen. Da die Angesprochenen för ihn jedoch nichts weiter als ,,morsche[s] fleisch“ sind, ist viel mehr Muhe und Gewalt als bei empfindsamen Geschöpfen nötig, um sie zum Verschwinden zu veranlassen. Deshalb verwendet George im nöchsten Vers das Wort „schmetternd“ (V. 24), was die zerstörerische Gewaltanstrengung veranschaulichen soll. Dadurch schickt er sie dorthin zurück, von wo er sie anfänglich zu ihm gelockt hatte.
Die letzte Strophe beginnt mit der wiederholten Andeutung auf das Unvermögen der Angesprochenen, ihren Verstand einzusetzen. Denn sie vertrauen blind auf das, was scheinbar Erfahrene (V. 25: „greise“) erzöhlen und ubernehmen deren Meinung, ohne daruber nachzudenken, auf welcher Grundlage diese Ansicht basiert. Die Alten sind aber nicht weise, sondern eher senil, denn fur verschiedene Dinge fehlt ihnen die richtige Sichtweise (V. 25: „schielend“). Das wiederum zeigt, dass niemand auch nur im Ansatz verstanden hat, wozu das lyrische Ich diese Aktion durchgefuhrt hat. Die Angesprochenen glauben nun irrtuömlicherweise, dass eine Veraönderung im Gange ist, aber das lyrische Ich hat sich nur so verhalten, wie es seinesgleichen schon in der Vergangenheit getan haben und weiß, wie wenig Veränderung bei seinen Zeitgenossen aus den genannten Grunden zu bewirken ist.
Die letzten vier Verse sind recht allgemein gehalten, sind aber auf das lyrische Ich bezogen, welches sich als denjenigen sieht, der versucht, andere zu beeinflussen (V. 29: „eifernde posaune blast“) und auch die Macht hat, zur unangenehmen Bedrohung (V. 30: „Aussig feuer“) zu werden. Trotz diesen lauten, auffölligen Aktionen, die das lyrische Ich und damit auch George durchfuhrt, um wenigstens einen kleinen Teil seiner Mitmenschen zu erreichen, bleibt ihm dennoch bewusst, dass sich Gluck und Erkenntnis (V. 31: „Schönheit kraft und grösse“) zukunftig (V. 30: „morgen“) auch im Stillen finden lasst.
Wie auch in den anderen Zeitgedichten sind in diesem Gedicht kaum noch Merkmale von Georges fruher propagiertem Ästhetizismus zu erkennen. Er bemöngelt hier die naive Blindheit des Volkes durch konkrete historische Beispiele, was in den folgenden Gedichten noch deutlicher zu Ausdruck kommt.
2.3 Bocklin
Das fünfte Zeitgedicht „Böcklin“ entstand kurz nach dessen Tod im Jahre 1901 oder 1902.[10] Wie auch in anderen Gedichten ubt George hier Kritik an der Zeit „geheimes Deutschland“. Arnold Bocklin wird als das Ideal eines Kunstlers dargestellt, welcher trotz Hindernissen sein Werk als deutsches Kulturgut erhalten konnte und ausschließlich fur das Erreichen seines kunstlerischen Zieles lebte. Er stammte ursprunglich aus der Schweiz und lebte von 1827 bis 1901.[11]
Die erste Strophe beschreibt anfangs, wie das deutschsprachige Volk seine nur mittelmaßigen Kunstler und deren Handwerk (V. 2: „popanz“, „kramer“)[12] verehrt und umschwarmt. Ruhm und Anerkennung galt scheinbar nicht den qualitütvollen Kunstlern, sondern nur denen, die zur Erheiterung des Volkes betrugen. Das beeinflusste aber nicht die Entscheidung Bocklins, sich von diesen Kreisen fern zu halten. Um namlich solchen Ruhm zu erlangen, hütte er sich dem Geschmack des Volkes anpassen mussen, was aber nicht in Einklang mit seinen Ansichten und Idealen zu bringen war. Um von der Gnade der Machtigen und dem störenden Larm (V. 1: „Trompetenstoss“) verschont zu bleiben, reist der Angesprochene in Richtung Suden nach Italien (V. 5: „Den sonnen zu.“) und entfernt sich somit von dem oberflüchlichen Treiben des engstirnigen deutschen Volkes. Aus Vers vier „Aus stiller schar“ kann entnommen werden, dass Boücklin einer der wenigen Kuünstler war, der auf die verlockende Anerkennung der breiten Masse verzichten und damit seinen Idealen treu bleiben konnte. Er und seine Gleichgesinnten werden im gleichen Vers als „Fromme“ bezeichnet, denn sie waren bescheiden und ließen sich von ihren Ansichten nicht abbringen. In Florenz[13] (V. 5 und 6: „die Schone/Der stüdte“) fand er dann die Ruhe (V. 5: „ruh“), die er benötigte, um seine Arbeit gewissenhaft fortzusetzen. In den Versen sechs bis acht werden die Grundelemente in Böcklins Gemälden genannt,[14], wie Fichten (V. 6: „treue fichten“) von der Sonne bescheinte Felsen (V. 8: „ergluhtem fels“) und das Ligurische Meer, welche alle Kennzeichen des Landes Italien sind. Wahrscheinlich hatte das Land Italien durch seine Toleranz die Empfindungen Böcklins und somit auch seine Malerei gepragt.
Die zweite Strophe besagt, dass er aus Protest vor der ignoranten Hetze und oberflächlichen Eitelkeit seiner Zeitgenossen floh. Kunstler, die nicht den allgemeinen Vorstellungen entsprachen wurden eingeengt (V. 10: „verschnurt“). Anstatt den eigenen Ideen nachzugehen, sollte der Zweck eines Kuänstlers sein, Interesse beim Volk zu erwecken und sich an dessen Launen und somit an der Mode zu orientieren. Es waren hauptsächlich die Machthungrigen (V. 11: „den himmel stürmte“), welche diese Hetze betrieben und dadurch qualitätvolle kunstlerische Arbeit unterbanden, anstatt dessen aber die Produktion von Schund unterstutzten (V. 11: „unrat schärfte“). Die Verse 13 bis 16 sind ein Ausruf Bäcklins an die Deutschen und Schweizer vor seiner Abreise nach Italien. Darin klagt er sie an, fur wahre Kunst blind zu sein oder blind sein zu wollen. Er sagt, dass er diese Kunst mit sich nehmen wird (V. 15: „rett ich zur fremde“), um sie solange aufzubewahren und zu schutzen, bis das deutschsprachige Volk wieder fahig ist, sie zu erkennen und zu wurdigen (V. 16).
In der folgenden Strophe wird Bocklins Kunst charakterisiert.[15] Sein Zuhause wird als „knechteswelt“ (V. 17) bezeichnet, welche vom Eifern nach Macht, Reichtum und Anerkennung dominiert wird und dadurch schlechter und unehrlicher ist als diejenige irreale Welt, die er durch seine Malerei erschuf. In Italien konnte er ungehindert und mit Freude (V. 19: „mit klaren freuden“) wieder seiner Arbeit nachgehen und seine Ideen verwirklichen, was zur gleichen Zeit in seiner Heimat nicht moäg- lich war. Dies lässt darauf schließen, dass das italienische Volk den Fremden akzeptierten und offen gegenüber seiner Kunst war. Somit war es zu der Zeit reifer als das deutsche Volk, denn es verkannte diese wahre Kunst nicht, sondern forderte sie sogar. In den Bildern spiegelt sich die positive Stimmung Bocklins wieder, denn er malt die pure Lebenslust (V. 18 und 19: „der freien warmen leiber/Mit gierden suss und heiss“). Die folgenden Verse klingen sehr mäarchenhaft und bewirken durch die vielen Adjektive und die Synästhesien in den Versen 20 „silberluft“ und 21 „zaubergruner“ beim Leser eine eindeutige und klare Vorstellung von Bäcklins Bildern. In seiner Kunstwelt versucht er, durch Komposition verschiedener Naturelemente (V. 20: „wipfeln“, V. 21: „flut“, V. 22: „schlucht“) beim Betrachter Urängste hervorzurufen (V. 22: „urgebor- ne schauer“), also Gefühle, die auf anderen Wegen schwer zu erreichen sind. Seine Absicht ist wohl, durch die Darstellung der Schönheit der Natur auch auf ihre Gefahren aufmerksam zu machen und den Menschen in diese Natur miteinzubeziehen. Dieses Urgrauen war auch von Georges Interesse. Bei ihm bestand diese gefährliche Welt auch aus Naturelementen, die er in seiner Dichtung zu bannen versuchte, um Harmonie zu gestalten.[16] Er reduziert den Menschen auf das Wesentliche, nämlich seine Triebe (V. 19: „gierden“), welche hier positiv und lebenserhaltend dargestellt sind (V. 19: „suss“, „freuden“). Durch die Lorbeeren und Olivenbaume (V. 23) bezieht Bäcklin das Land, in dem er lebt, in seine Bilder mitein. Dadurch, dass seine Kunstlandschaft letztendlich weihevoll „Gelobtes land“ (V. 24) genannt wird, assoziiert der Leser damit sofort Italien, die Heimat der christlichen Religion und verbindet es mit dem Paradies, wie es in der Bibel geschildert wird.
Die vierte Strophe nimmt wieder Bezug auf Bäcklins Person, denn er hat die Hoffnung uäber eine schlimme Zeit hinweggetragen, genauso, wie George es mit dem „Siebenten Ring“ vorhatte. Der Schmerz, den er durch seine eigene Verbannung erlitt, ließ sich ertragen, denn er hatte durchschaut, dass sich die Gegebenheiten nach einer gewissen Zeit äan- dern und somit auch die Unvernunft und Hetze seiner Zeitgenossen versiegen musste (V. 25 und 26: „die brandung musste/Vertonen“). Die ersten vier Verse dieser Strophe spielen wahrscheinlich auf Bocklins Bild „Die Pest“ an, welches von George sehr geschätzt wurde.[17]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Bild zeigt den personnifizierten Tod, der auf einem Drachen ruck- lings sitzend uber die Menschen einer Stadt herfallt und eine Spur der Verwustung hinter sich lässt. Die Person des Todes kännte man gleichsetzen mit dem „schrei“ (V. 26), der die Idylle notwendigerweise stären musste. Trotz des dargestellten Elends ist der Himmel im Hintergrund hoffnungvoll blau gemalt,[18] wie im Vers 27 beschrieben wird, was wohl heißen soll, dass Bocklin es geschafft hat, Hoffnung uber eine schlimme
Zeit hinweg zu tragen. Mit diesem Bild hatte Böcklin offensichtlich nicht die Absicht, Figuren und Gegenstönde realitatsgetreu abzubilden. Seine Absicht, beim Betrachter unmittelbar Geföhle hervorzurufen konnte er um so besser verfolgen, indem er marchenhafte Wesen wie Monster, Nixen oder Geister malte. Das angsteinflößende Monster ist hier die Person des Todes, welche auf einem weiteren Monster, namlich einem Drachen sitzt.
In den letzten vier Versen des Gedichtes wird Böcklin mit ausdruckli- chem Dank (V. 31: „dank dir Wöchter!“) geehrt, weil er dazu beigetragen hat, deutsches Kulturgut (V. 32: „heiliges feuer“) zu erhalten. Somit war sein Handeln nicht sinnlos (V. 30: „Nicht arm“).
2.4 Die Gräber von Speier
Dieses Gedicht zeigt Erinnerungen auf, welche durch das unangenehme Erlebnis der Zurschaustellung von Toten, die im Leben Großes vollbrachten hervorgerufen werden. Im Dom von Speyer wurden von seiner Entstehung an verschiedene Herrscher beigesetzt. Im Jahr 1900 ließ Kaiser Wilhelm II. diese Graber offnen,[19] was beim lyrischen Ich Wut und Entrustung uber eine solche Respektlosigkeit verursacht. Wie wenn sie den fur die „leichenschandung“ (V. 2)[20] Verantwortlichen schlagen wollte „zuckt“ nömlich „die hand“ (V. 1). Durch das Offenlegen der nun hösslichen und erbarmlichen Gebeine wird den einst großen Herrschern ihre ganze Pracht genommen. Vielleicht war es die Absicht Kaiser Wilhelms II., der Öffentlichkeit klar zu machen, wie unwichtig vergangene Herrschaften im Vergleich zu seiner sind. Das Volk sollte sich nicht an die bewundernswerten Taten dieser Köonige und Kaiser erinnnern, sondern nur noch an das ekelhafte und bemitleidenswerte Bild derer Leichen. Aber George halt die wichtigsten Lebenselemente dieser Herrscher fest und verewigt sie so in seinem Gedicht. Dass die Gebeine zur Schau gestellt wurden, konnte man daran festmachen, dass die „hand“ (V. 1) des Besuchers die Möglichkeit hatte, die kürzlich zerstörten Gräber (V. 2: „frische trümmer“) zu berühren (V. 2: „streifend“). Diese „hand“ ist nicht nur dem lyrischen Ich zuzuordnen, sondern mehreren Personen, was schon am Anfang des ersten Verses durch das Personalpronomen „Uns“ impliziert wird. Um auf die Tragweite der Grabäffnung aufmerksam zu machen, verdeutlicht George also, dass das lyrische Ich mit seiner Mißachtung gegenuber dieser Handlung nicht alleine war. Wenn mehrere Leute den Sinn dieser respektlosen Tat in Frage stellten, wird das Vertrauen in den gegenwaärtigen Herrscher umso mehr vermindert. Ihre Enträstung wird glaubhaft durch die Wortwahl „aufgescharrten“ (V. 1), was wie „aufgescheucht“ klingt, was wiederum bedeutet, dass man jemandem oder etwas unberechtigt die wohlverdiente Ruhe stielt. Dieses Verbrechen muss nach Ansicht des lyrischen Ich gesuhnt werden, indem die Lebenden der Gegenwart sich die Erinnerung an die Verstorbenen bewusst machen. Das Aufzeigen der ehrfurchtsvollen Erinnerung an vergangene Herrscher bestimmt nun die restlichen drei Strophen, welche die vergangenen 900 Jahre umfassen. Es fängt mit demjenigen an, der den Dom von Speyer erbauen ließ, namlich Kaiser Konrad II.[21] Zunächst werden vier Generationen von Kaisern zwischen 1024 bis 1106 und deren prägnantesten geschichtlichen Merkmale angesprochen. Hier werden vor allem deren Charakterzuge wie Standhaftigkeit (V. 10: „fest“), Großzugigkeit (V. 11: „in busse gross“) und Durchsetzungsvermogen (V. 11: „starksten“) gepriesen. Dann beschreibt George die fur den Untergang der Habsburger verantwortlichen Gegebenheiten, indem er den Grunder Rudolf I.[22] als Geist uber die Zeit hinwegschweben lässt. Somit lasst George Rudolf I. den Untergang des eigenen Volkes mitansehen, wobei die Zeitspanne hier ca. 400 Jahre umfasst. Es wird angesprochen, dass sich das Gluck wendete, als Kaiser Maximilian I. auf den Thron kam. Durch die Spaltung der Kirche (V. 21: „mönchezank“) und den 30jährigen Krieg wurden die Habsburger dann fast vollstöndig zerschlagen und diejenigen, die gegenwörtig noch Ubriggeblieben waren litten immer noch unter ihrer Abstammung (V. 23: „Und nun die grausigen blitze um die reste“). Die Zeitspanne umfasst hier die Jahre 1493 bis 1889. Als letztes behandelt George die Staufer (V. 25), von denen auch ein Mitglied, nömlich Beatrix von Burgund im Speyer Dom begraben war. Damit wird an deren Mann, Sohn und Enkelsohn erinnert, die alle anwesend scheinen, auch wenn sie nicht alle hier begraben wurden. Durch die wenigen Herrscher, deren Überreste im Dom von Speyer freigelegt wurden, konnte ein Ruckblick entstehen, der viele Generationen von Königen und Kaisern umfasst. Da sich George in diesem Gedicht insgesamt neun Personen zuwendet und zusötzlich noch einige historische Hintergrunde anspricht, ist der Informationsgehalt in diesem Gedicht wegen seiner Kurze teils schwierig zu erkennen.
2.5 Das Zeitgedicht (14)
Das vierzehnte Zeitgedicht bildet mit dem ersten einen Rahmen, der sömtliche Zeitgedichte umschließt und somit als Abschluss des ersten Ringes dient. Die sich gleichenden Titel „Das Zeitgedicht“ lassen gleich vermuten, dass diese beiden Gedichte eine Einheit bilden.
Durch die Wiederholung der Personalpronomen „ich euch“[23] im ersten Vers wird sofort klar, das sich der Sprecher wie im ersten Zeitgedicht mit einigen seiner Zeitgenossen auseinandersetzen wird. Diese Auseinandersetzung erfolgt wiederum durch eine direkte Anrede, welche in der ersten Strophe als Aufruf zu verstehen ist. Das lyrische Ich will hier nicht nur Kritik an seinen Mitmenschen uben, sondern auch gegen deren Pessimismus wirken, indem es ihnen den Ratschlag gibt, sich von jemandem helfen zu lassen, wobei es hier mit dem Helfenden auch sich selbst meinen könnte. Anfangs möchte es sich bei den Leuten Gehör verschaffen (V. 1: „stimme dringe“), es möchte also mit seiner Stimme zu ihnen durchdringen. Das ist aber nicht so einfach, weil die Angesprochenen damit beschaftigt sind, ihre Übellaunigkeit (V. 2: „unmut“) kund zu tun, was durch die wörtliche Rede in den Versen drei bis funf verdeutlicht wird. Sie beklagen sich zum Beispiel uber ihre ge- genwörtigen Fuhrer und sind bekummert daruber, dass sich die Zeiten zum Schlechten verändert haben. Die Dinge, die ihnen am wichtigsten waren (V. 4: „glaube“, „liebe“) sind mit dem Tod der fruheren Könige verlorengegangen. Die pessimistische Haltung macht die Menschen aber unföhig, positiv zu denken. Die Wortwahl „verwirft und flucht“ (V. 2) weist darauf hin, dass sie jeden guten Rat ablehnen und lieber im Ungluck verweilen, um sich mit ihrem Schimpfen weiterhin bemitleiden zu konnen. Sie sehen im Moment nur noch die negativen Aspekte des Lebens und haben keine Hoffnung auf einen Ausweg aus ihrer Misere (V. 5: „Wie fluchten wir aus dem verwesten ball?“). Die Erde wird hier mit einem „verwesten ball“ verglichen, was wohl bedeuten soll, dass sich die schlechte Lage schon uberall ausgebreitet hat. Da aber die Erde der einzige Lebensraum fur die Menschen darstellt, ist eine Flucht an einen anderen Ort unmöglich, also hoffnungslos. In den Versen sechs bis neun fordert das lyrische Ich durch den Imperativ „Lasst“ (V. 6) dazu auf, sich von jemanden helfen zu lassen, weil die Angesprochenen es aus eigener Kraft nicht schaffen, aus der Depression zu gelangen. Vielleicht möchte das lyrische Ich auch selbst derjenige sein, der den Entmutigten Licht ins Dunkle bringt (V. 6: „fackel“). Trotzdem macht es ihnen klar, dass sie an ihrem Ungluck selbst schuld sind, denn das „ verderben /Der zeit“ (V. 7f) wird von niemand anderem erschaffen und besteht weiterhin nur durch ihren Pessimismus. Deshalb appelliert das lyrische Ich an die Vernunft der Angesprochenen und schlaögt vor, aktiv zu werden und mit der Hilfe eines Fuhrers den Blick in die Zukunft zu richten, anstatt sich passiv mit unproduktivem Selbstmitleid zu umgeben.
In der zweiten Strophe kritisiert George durch das lyrische Ich das vergangene Verhalten der Angesprochenen, denn sie wollten die Existenz der Bewundernswerten (V. 9f: „Schonen“, „Großen“) nicht wahrhaben und verwarfen deren Ansichten und Ideen (V. 11: „stürztet ihre [...] bilder“). Wahrscheinlich handelten die Angesprochenen aus Neid, weil sie selbst nicht die Voraussetzungen besaßen, zur Elite zu gehören. Sie waren stur und hatten nicht die Absicht, sich eines besseren belehren zu lassen, was ihr Ungluck nur fördern konnte. Da sie nicht in der Lage waren, geistige Höhen zu erreichen, bauten sie hohe Geböude, also Orte, welche sich möglichst weit entfernt vom Schmutz des Bodens befanden. Solche Orte zu erschaffen war den Menschen anscheinend wichtiger, als sich auf den Erhalt ihres Korpers als Hulle fur den Geist zu konzentrieren (V. 12: „öber Korper weg“). Sie schienen absolut keinen Wert auf ihre geistige Entwicklung gelegt zu haben, da dieses Thema hier mit keinem Wort angesprochen wird. Die Bauten, die so entstanden, waren zwar eindrucksvoll, gigantisch (V. 14: „riesenformen“) und vielseitig (V. 14: „mauern bogen turme“), hatten aber keinen andauernden Bestand (V. 16: „verfiel“) und waren somit auf langere Sicht unnutz. In Vers 15 deutet das lyrische Ich an, dass Dinge existieren, die weitaus machtiger sind als alles, was der Mensch herstellen kann (V. 15: „gewolk“), zum Beispiel das Wissen uber die Vergönglichkeit allen Materials. Diese Ahnung wird durch die Wolken personifiziert. Die Anklage der zweiten Strophe besteht darin, dass der Mensch es ablehnt, seinen Geist zu erweitern und seinen Verstand zu trainieren, und als Ersatz hierfür versucht, durch materielle Errungenschaften seinen Lebensstandart zu erhöhen. Die Gegenwart, welche in der ersten Strophe beschrieben wird zeigt jedoch, dass dies nicht funktioniert hat.
Als Folge darauf beschreibt die dritte Strophe, dass die Angesprochenen zu engstirnig waren, um zu verstehen, warum sie ins Ungluck gerieten. Als sie nömlich merkten, dass ihre Muhen umsonst waren, resignierten sie (V. 17: „krochen“) und umgaben sich mit Dunkelheit (V. 17: „hohlen“). Ihre Stimmung war nun depressiv, denn sie empfanden nur noch Finsternis (V. 18: „Es ist kein tag.“) und hatten keine Hoffnung mehr, im Leben noch Glöck zu finden. Da sie den Sinn ihres Daseins nicht erfassen konnten, glaubten sie, das einzig Dauerhafte sei der Tod (V. 18f) und alles andere sei zum Scheitern verurteilt. Fröher verbrach- ten sie ihre Zeit damit, Nutzloses zu erschaffen, aber sie lernten daraus nicht, sondern brachten durch ihr erneut falsches Handeln noch mehr Verderben uber sich. Anstatt dass sie die zweite Chance, das Wesentliche zu erkennen nutzten, wanden sie sich von der Helligkeit (V. 22: „sonnenwege“) ab und begaben sich lieber tiefer ins Dunkle und damit in ihre eigene Mutlosigkeit (V. 17: „höhlen“), um nach ihrem Gluck zu suchen. Dort fanden sie zwar materiellen Reichtum (V. 20: „sucher des golds“, ,,erz“), der aber auch Krankheit (V. 20: „blass und fiebernd“) mit sich brachte und somit ihre Lebensqualitöt nicht wie gewunscht steigerte. Obwohl ihr Wohlergehen gar nicht weit entfernt war, waren die Angesprochenen unfahig, es zu erkennen. Denn hötten sie sich auch nur einmal aus der Dunkelheit gewagt, so hötten sie bemerkt, wie viele Möglichkeiten, zum Gluck zu gelangen, sich ihnen anboten (V. 22: „viele sonnenwege“). Doch ihre Werteinschatzung war falsch und sie verschwendeten zum zweiten Mal ihre Kröfte. Sie nahmen ihrem Geist (V. 23: „seele“) die Möglichkeit, sich zu entfalten, indem sie ihm zu wenig Bedeutung zumaßen und ihn schlecht behandelten. Letzendlich war seine Existenz nur durch Schmutz (V. 23: „gift und kot“) bestimmt, da die Menschen durch ihre Unvorsichtigkeit die letzte Hoffnung im Keim erstickten (V. 24).
In der letzten Strophe wird wie schon in der ersten wieder der Bezug zur Vergangenheit und zu den Ahnen hergestellt, es werden namlich fruhere Herrscher genannt, die „starben“ (V. 3) und deren Abbild „aus stein“ (V. 26) der gegenwörtigen Bevolkerung als Erinnerung dienen soll. Das lyrische Ich sieht in den versteinerten Gesichtern Trauer (V. 25-27: ,, augen [...] schwer“) aus Mitleid fur die Unglucklichen der Gegenwart, wozu sich das lyrische Ich zahlt (V. 26: „unsren tröumen“, „unsren tranen“). Hier schafft das lyrische Ich eine Verbindung zwischen sich und den Angesprochenen um sich anzunaöhern und Vertrauen zu schaffen. Die Erkenntnis uber Vergönglichkeit und Wechsel ist heute wie damals die gleiche (V. 27: „sie wie wir wussten“) und dieses Wissen bekummert das lyrische Ich und die seinen (V. 27: „unsren trönen“). Der Wechsel beinhaltet naturlich auch, dass der Tod fur jeden unausweichlich ist und dass anstelle des anenehmen, glücklichen Lebens Dunkelheit (V. 29: „Nacht kommt fur helle“) und das jungste Gericht tritt (V. 29: „busse für das gluck“). Das Leben an sich geht aber trotzdem weiter, nümlich mit der frischen, jungen Generation (V. 32: „jugend lacht“), die noch nichts von der Trauer und dem Ungluck des Todes ahnt. Obwohl George den Untergang der alten Welt beschreibt, steht für ihn vor allem die Geburt einer neuen Kultur im Mittelpunkt.[24] Die Hoffnung und der Ausblick bestehen darin, dass das Gedankengut der alten Welt in der Jugend weiterlebt.
3 Zusammenfassung
In Georges Fruhwerk war das wichtigste Lebenselement die Schönheit sowie asthetisches, edles Verhalten.[25] Durch seine von hohem Stil durchdrungene Lyrik wird ein feudaler Zustand hervorgerufen, welcher die aristokratische Haltung Georges zeigte.[26] Er verwendete oft antike Motive, um den metaphysischen Gehalt zu veranschaulichen.[27] Im „Siebenten Ring“ fehlen diese Motive, es gibt aber noch eine leichte antike Haltung.[28] Seit dem „Siebenten Ring“ tritt George fur eine fundamentale kulturelle Erneuerung Deutschlands ein.[29] Er sieht sich als das Urbild des deutschen Menschen[30] und den Kunstler als Visionar und Schöpfer einer neuen modernen Gesellschaft.[31] Er fühlt sich zu einer didaktischen
Mission im eigenen Land berufen, welche sich dann eigenmächtig ausbreiten solle.[32] Im Mittelpunkt steht hier die Schöpfung einer neuen Kultur nach dem Untergang der alten Welt.[33]
Quellenverzeichnis
Primärliteratur
George, Stefan: Der Siebente Ring: Zeitgedichte. In: Sämtliche Werke in 18 Banden, Band 6/7. Stuttgart 1986.
Sekundärliteratur
Adorno, Theodor W.: Rede Uber Lyrik und Gesellschaft. In: Akzente. Zeitschrift für Dichtung, Bd. 2: 1957-1959, Hällerer und Hans Bender, Mänchen 1974.
Blasberg, Cornelia:,,Auslegung muss sein“. Zeichen-Vollzug und Zeichen-Deutung in Stefan Georges Spätwerken. In: Stefan George. Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'. Fär die Stefan George-Gesellschaft hg. von Wolfgang Braungart, Tubingen 2001.
Braungart, Wolfgang: Auslegung muss sein“. Zeichen-Vollzug und ZeichenDeutung in Stefan Georges Spätwerken. In: Stefan George. Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'. Für die Stefan George-Gesellschaft hg. von Wolfgang Braungart, Tuäbingen 2001.
Donat, Walter: Stefan George als Wegbereiter. In: Stefan George und die Nachwelt, Dokumente zur Wirkungsgeschichte, hg. von Ralph-Rainer Wuthenow, Stuttgart 1981.
Elgart, Jutta: Das mythische Bild in den Werken von Stefan George und William Butler Yeats: Wesen, Stellung, Funktion. In: Stefan George. Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'. Fur die Steran George-Gesellschaft hg. von Wolfgang Braungart, Tuäbingen 2001.
Kolk, Rainer: Nietzsche, George, Deutschland. Dokumente zu Ernst Bertrams frähen Publikationen. In: Stefan Geroge, Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'. Fär die Stefan George-Gesellschaft hg. von Wolfgang Braungart, Tuäbingen 2001.
Morwitz, Ernst: Kommentar zu dem Werk Stefan Georges. Mänchen/Dussel- dorf 1960.
Osterkamp, Ernst: Die Kusse des Dichters. Versuch uber ein Motiv im 'Siebenten Ring'. In: Stefan George. Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'.
Für die Stefan George-Gesellschaft, hg. von Wolfgang Braungart, Tübingen 2001.
Sternberger, Dolf: Stefan Georges Ruhm. Dokumente zur Zeitgeschichte. In: Stefan George und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte, hg. von Ralph-Rainer Wuthenow, Stuttgart 1981.
Varthalitis, Georgios: Die Antike und die Jahrhundertwende. Stefan Georges Rezeption der Antike, phil. Diss. Heidelberg 2000.
[...]
[1] Ernst Morwitz: Kommentar zu dem Werk Stefan Georges. München/Düsseldorf 1960, S. 215f.
[2] Ebd., S. 215f.
[3] Walter Donat: Stefan George als Wegbereiter. In: Stefan George und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte, hg. von Ralph-Rainer Wuthenow, Stuttgart 1981, S. 61.
[4] Ernst Morwitz: Kommentar zu dem Werk Stefan Georges, S. 235.
[5] Ernst Osterkamp: Die Küsse des Dichters. Versuch über ein Motiv im 'Siebenten Ring'. In: Stefan George. Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'. Für die Stefan GeorgeGesellschaft, hg. von Wolfgang Braungart, Tübingen 2001, S. 75.
[6] Georgios Varthalitis: Die Antike und die Jahrhundertwende. Stefan Georges Rezeption der Antike, phil. Diss. Heidelberg 2000, S. 101f, 112.
[7] Cornelia Blasberg: „Auslegung muss sein“. Zeichen-Vollzug und Zeichen-Deutung in Stefan Georges Spätwerken. In: Stefan George. Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'. Für die Stefan George-Gesellschaft hg. von Wolfgang Braungart, Tübingen 2001, S. 25.
[8] Versangaben zitiert nach: Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte. In: Sämtliche Werke in 18 Bänden, Band 6/7. Stuttgart 1986, S. 6f.
[9] Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte, S. 201.
[10] Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte. In: Sämtliche Werke in 18 Bänden, Band 6/7. Stuttgart 1986, S. 202.
[11] Dolf Sternberger: Stefan Georges Ruhm. Dokumente zur Zeitgeschichte. In: Stefan George und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte, hg. von Ralph-Rainer Wuthenow, Stuttgart 1981, S. 97.
[12] Versangaben zitiert nach: Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte, S. 14f.
[13] Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte, S. 224.
[14] Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte, S. 224.
[15] Ernst Morwitz: Kommentar zu dem Werk Stefan Georges, S. 224.
[16] Walter Donat: Stefan George als Wegbereiter, S. 49.
[17] Ernst Morwitz: Kommentar zu dem Werk Stefan Georges, S. 224.
[18] Ebd., S. 224.
[19] Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte, S. 208.
[20] Versangaben zitiert nach: Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte, S. 22f.
[21] Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte, S. 208.
[22] Ebd., S. 208.
[23] Versangaben zitiert nach: Stefan George: Der Siebente Ring: Zeitgedichte, S. 32f.
[24] Jutta Elgart: Das mythische Bild in den Werken von Stefan George und William Butler Yeats: Wesen, Stellung, Funktion. In: Stefan George. Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'. Für die Steran George-Gesellschaft hg. von Wolfgang Braungart, Tübingen 2001, S. 429.
[25] Walter Donat: Stefan George als Wegbereiter, S. 58.
[26] Theodor W. Adorno: Rede über Lyrik und Gesellschaft. In: Akzente. Zeitschrift für Dichtung, Bd. 2: 1957-1959, Hollerer und Hans Bender, München 1974, S. 23.
[27] Walter Donat: Stefan George als Wegbereiter, S. 48.
[28] Georgios Varthalitis: Die Antike und die Jahrhundertwende. Stefan Georges Rezeption der Antike, S. 102.
[29] Rainer Kolk: Nietzsche, George, Deutschland. Dokumente zu Ernst Bertrams frühen Publikationen. In: Stefan Geroge, Werk und Wirkung seit dem 'Siebenten Ring'. Für die Stefan George-Gesellschaft hg. von Wolfgang Braungart, Tübingen 2001, S. 321.
[30] Walter Donat: Stefan George als Wegbereiter, S. 61.
[31] Jutta Elgart: Das mythische Bild in den Werken von Stefan George und William Butler Yeats: Wesen, Stellung, Funktion, S. 412.
[32] Jutta Elgart: Das mythische Bild in den Werken von Stefan George und William Butler Yeats: Wesen, Stellung, Funktion, S. 412.
[33] Ebd., S. 429.
- Arbeit zitieren
- Isolde Wallbaum (Autor:in), 2003, Der Siebente Ring, Zeitgedichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109769
Kostenlos Autor werden





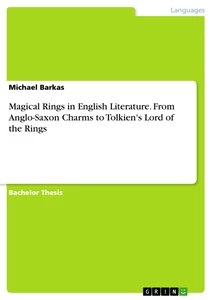
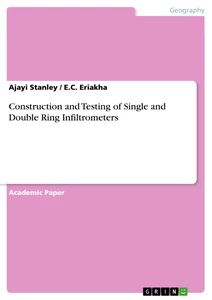

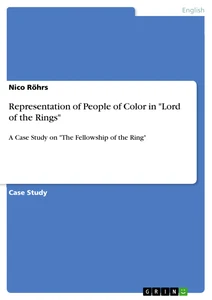
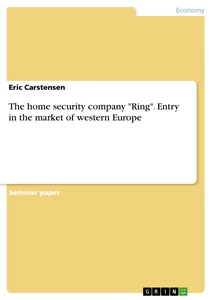



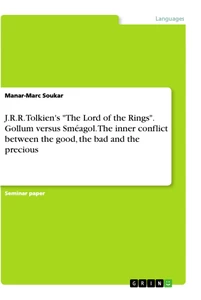

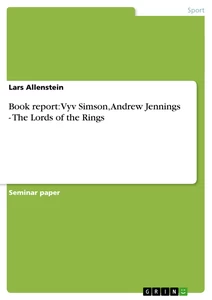


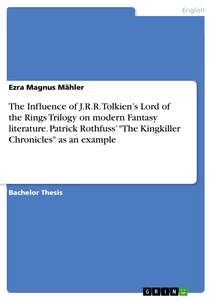

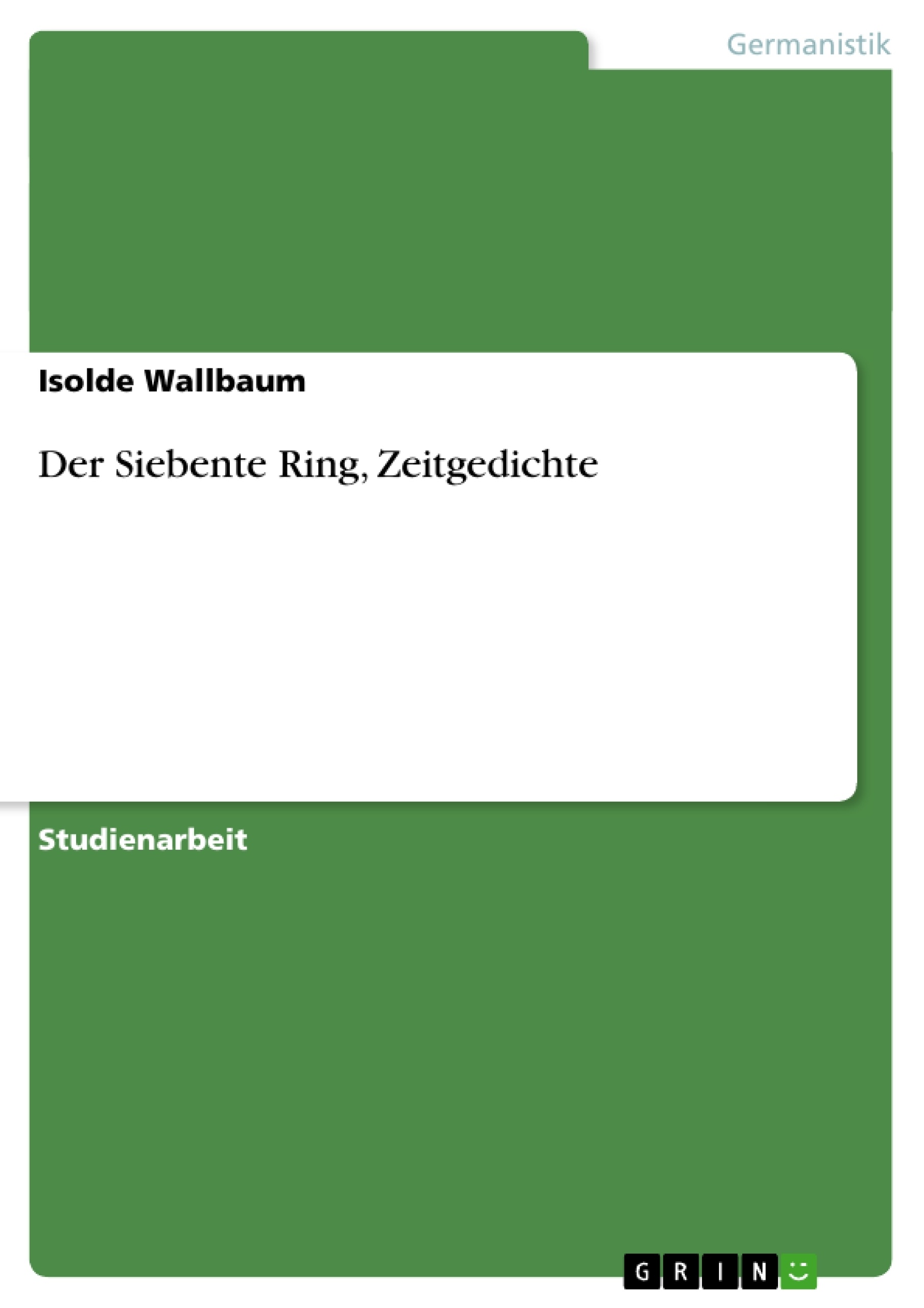

Kommentare