Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Sozialwissenschaftliche Erforschung der Fremdenwahrnehmung
Stereotypenforschung
Transnationale Perzeptionsforschung
Diskursanalytischer Ansatz
3. Literaturwissenschaft und das Fremde
Hermeneutik
Rezeptionsästhetik
Literarische Imagologie
Grundbegriffe
Image
Imagem und Imagothème
Alterität und Alienität
4. Das Polenbild in der deutschen Öffentlichkeit und Literatur
‚Polnische Wirtschaft’
‚Polnische Freiheitsliebe’
Deutsches Polenbild nach 1945
Das Polenbild in der deutsch-jüdischen Literatur
5. Deutsch-jüdische Gegenwartsliteratur
6. Untersuchungsmethode
7. Textauswahl
8. Einzelanalysen
Die erste Generation
Jeannette Lander
Edgar Hilsenrath
André Kaminski
Ruth Klüger
Zwischenresümee
Die Generation der Nachgeborenen
Robert Schindel
Rafael Seligmann
Barbara Honigmann
Irene Dische
Maxim Biller
Doron Rabinovici
Vladimir Vertlib
Zwischenresümee
9. Zusammenfassung
10. Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Sekundärliteratur
1. Einleitung
Die Rolle der Literatur in der Gesellschaft wird von Schriftstellern, Kritikern und Literaturwissenschaftlern unterschiedlich gesehen. Unabhängig aber von den ästhetischen Positionen einzelner Autoren und deren Freiheitsansprüchen wird die Wirkung der Texte untersucht. Erwünscht oder unerwünscht, bewusst oder unbewusst werden von den Schreibenden Wahrnehmungsmuster tradiert und produziert. Von diesen lernen die Leser, wie die ‚richtige Liebe’ oder wie ein ‚spannendes Leben’ auszusehen hat, wie die Welt und die Menschen zu sehen und zu verstehen sind. Oft werden beiläufige Bemerkungen – vor allem wenn sie den gängigen Bildern entsprechen – unreflektiert mitgelesen und können der Verstärkung der vorhandenen Stereotype dienen. Literatur tradiert auch Länder- und Nationenbilder. Spätestens seit dem Aufkommen der Reiseliteratur gegen Ende des 18. Jahrhunderts prägt sie die gegenseitige Wahrnehmung der Nationen.[1] Bis heute ist das Lesen historischer Romane, sowie das Betrachten historischer Filme, die populärste Art sich die Geschichte eigener und fremder Nationen anzueignen, was dazu führt, dass ganze Generationen von den literarischen Bildern beeinflusst werden.[2]
Im Bereich des Alltagswissens ist die Vorstellung, dass bestimmte Charaktereigenschaften notwendig auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation schließen lassen, dass es also Nationalcharaktere gibt, immer noch präsent, obwohl Sozial- und Politikwissenschaftler inzwischen gegenteilige Position einnehmen. Das bedeutet nicht, dass die Forscher keine Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen mehr erkennen. Diese werden aber als historisch bedingte Mentalitätsunterschiede, kulturelle Eigenarten, durch Erfahrungen geprägte Handlungs- und Denkweisen verstanden. Sie sind nicht vorgegeben oder unveränderlich, deshalb müssen sie im jeweiligen kulturellen und politischen Kontext gesehen, und immer wieder im Hinblick auf ihrer Aktualität befragt werden.
In wieweit in der Gegenwartsliteratur die traditionellen Wahrnehmungsmuster tradiert, verstärkt oder durchbrochen werden, soll in dieser Arbeit am Beispiel des Polenbildes in der deutsch-jüdischen Prosa, die von vielen Literaturwissenschaftlern „für eines der auffälligsten und erstaunlichsten Phänomene in der deutschen Literatur der neunziger Jahre“[3] gehalten wird, untersucht werden.
Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahmen die oft aus den Ostprovinzen stammenden jüdischen Autoren in ihren in der deutschen Sprache verfassten Schriften eine sich selbst zugeschriebene Vermittlerrolle zwischen Deutschen und Polen an.[4] In der sogenannten Ghettoliteratur zeichneten sie ihr oft polnisches Umfeld und brachten vermehrt polnische Protagonisten in die deutschsprachige Literatur.[5] Auf Grund dessen ist es für die Literaturwissenschaft interessant zu untersuchen, ob die deutsch-jüdischen Gegenwartsautoren – trotz Unterbrechung und geänderter Voraussetzungen – diese Tradition weiterführen.
Seit den neunziger Jahren sprechen sich viele deutsch-jüdische Autoren für eine engagierte, sozial und politisch wirksame Literatur aus. Sie sehen sich nicht „in der Rolle der marginalisierten Minderheit oder in der der Kinder und Enkel von Opfern“[6], sondern als Repräsentanten eines traditionsbewussten, welt- und gesellschaftsoffenen Judentums, als „Vorbilder für Toleranz und damit als Sprecher für die Opfer von heute“[7]. Dadurch – und der ihnen zugeschriebenen besonderen Mahn-Aufgabe in der deutschen Öffentlichkeit wegen – stellen sie einen Anspruch auf Realitätsnähe, so dass die von ihnen dargestellten Fremdenbilder von den Lesern oft nicht als ästhetische Darstellungen, sondern als Tatsachenberichte rezipiert werden: So wird eine fiktionale Welt mit der Wirklichkeit gleichgesetzt und in den Bereich des Alltagswissens der Leser übertragen.[8]
In dieser Arbeit werden die in den letzten dreißig Jahren erschienenen Prosawerke von Autoren zweier Generationen berücksichtigt: der ersten Generation nach der Shoah, also derjenigen, die zwar vor dem Krieg geboren wurden, aber erst nach dem Kriege debütierten, und der zweiten Generation, also der Nachgeborenen. Zu den Autoren der ersten Gruppe gehören Jeannette Lander, Edgar Hilsenrath, Ruth Klüger, und André Kaminski; zu der zweiten Robert Schindel, Rafael Seligmann, Barbara Honigmann, Irene Dische, Maxim Biller, Doron Rabinovici und Vladimir Vertlib. Als Kriterium der Autorenauswahl wurde deren eigenes Zugehörigkeitsbekenntnis zu der deutsch-jüdischen Literatur genommen.[9] Die ausgewählten Autoren beschäftigen sich mit jüdischen Themen, als Medium benutzen sie aber die deutsche Sprache. Eine Ausnahme bildet die in New York geborene, seit über zwanzig Jahren in Berlin lebende, aber auf Englisch schreibende Irene Dische. Ihre Werke können trotzdem als der deutsch-jüdischen Literatur zugehörig gesehen werden, weil sie sich mit den Problemen des gegenwärtigen deutsch-jüdischen Lebens auseinandersetzen und in das Kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aufgenommen wurden.[10] Die Texte anderer wichtiger deutsch-jüdischer Gegenwartsautoren wie Jurek Becker, Robert Menasse, Vladimir Kaminer, Katja Behrens oder Esther Dischereit wurden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, weil in ihren fiktionalen Texten jeglicher Bezug auf Polen fehlt.[11]
Vor der Analyse der einzelnen Werke werden Möglichkeiten einer theoretischen Annährung an das Problem der Wahrnehmung des Fremden – besonders des Nationalfremden – erörtert. Sozial- und literaturwissenschaftliche Ansätze wie Stereotypenforschung, transnationale Perzeptionsforschung, Diskursanalyse, komparatistische Imagologie, Rezeptionsästhetik und Hermeneutik sollen kurz vorgestellt werden, um die Vielfalt der Theorien und Betrachtungsperspektiven, aber auch die Parallelität mehrere Forschungsergebnisse zu zeigen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den von den einzelnen Theorien aufgeworfenen und nicht eindeutig beantworteten Fragen wird nicht vorgenommen, weil sie die Rahmen einer Magisterarbeit übersteigt.
2. Sozialwissenschaftliche Erforschung der Fremdwahrnehmung
Stereotypenforschung
Sozialwissenschaften werden für die Literaturwissenschaft vor allem dann relevant, wenn sie das soziale Wissen des alltäglichen Denkens untersuchen, ein Wissen also, das auch bei der Rezeption literarischer Texte aktualisiert wird, um die beschriebenen Ereignisse verstehen zu können.
Seit dem 16. Jahrhundert entwickelt sich die Vorstellung, dass Völker als Kollektivindividuen betrachtet werden können: Ihnen werden bestimmte Charaktereigenschaften zugeschrieben, die sich zu konstanten und oft unreflektierten Wahrnehmungsmustern des Fremden und - in Abgrenzung dazu - des Eigenen verselbständigen, so dass sie schließlich als gültiges Wissen anerkannt und betrachtet werden. Die meisten Sozialwissenschaftler behaupten, dass so entstandene Wahrnehmungsstereotype die gesellschaftlichen und historischen Veränderungen überdauern; ihr Inhalt bleibt konstant, nur die ihnen zugeordneten Erklärungen und Wertungen werden den aktuellen Paradigmen angepasst.[12] Franz K. Stenzel betont demgegenüber, dass historische Umbrüche Stereotype verändern können. Das trage aber nicht unbedingt zur differenzierteren Wahrnehmung des Fremden bei, sondern könne lediglich zu einer neuen Akzentuierung, Modifizierung oder Verkehrung der traditionellen Vorstellungen führen.[13] Als Beispiel kann die Wandlung von anti- zu philosemitischen Beschreibungsmustern in der deutschen Literatur nach 1945 genannt werden.
Für die Literaturwissenschaft ist die Tatsache, dass Stereotype nicht von den Unterschichten, sondern von den Intellektuellen und Künstlern geformt und weitergegeben werden, von besonderer Bedeutung. Die von diesen meinungsbildenden Schichten getroffenen Aussagen orientieren sich – trotz ihrer gesellschaftlichen Relevanz – nicht an ihrer Wahrheitsnähe, sondern oft an ihrem Funktionswert in einer politischen Schrift, einem Reisebericht oder einer Komödie: Sie können eine Interaktion mit der fremden Kultur vorbereiten, begleiten oder stören. Deshalb ist es wichtig, die Frage nach den politisch-institutionellen Zusammenhängen und sozio-kulturellen Bedingungen der Entstehung der Länderbilder zu stellen.[14] Diese in der Ikonographie und in der Literatur entstandenen Bilder prägen die Wahrnehmung des Fremden: Sie dienen als Folie für eigene Beobachtungen und strukturieren den Blick auf Fremdes: Das schon Bekannte wird als wichtig erkannt, das Unbekannte aber als unbedeutend übersehen. Die zufällig ausgesuchten Merkmale der fremden Nation verlieren, wenn sie durch Wiederholungen ins Bewusstsein geprägt werden, ihre anfängliche Funktion eines Erkennungsmerkmals und bekommen einen Universalitätsstatus als ein essentieller Wesenszug eines Angehörigen der Fremden zugesprochen.[15]
Der im 19. Jahrhundert entstandene Umgang mit den Begriffen Volk und Nation[16] ist im Alltagswissen von den neueren wissenschaftlichen Tendenzen fast unberührt geblieben. Obwohl seit über achtzig Jahren die These von Max Weber, dass eine Nation nur ein den bürokratischen Staat legitimierendes Konstrukt sei,[17] immer größeren Zuspruch in den Gesellschaftswissenschaften findet,[18] bleibt das Alltagswissen von den alten Vorstellungen über die angeborenen Eigenschaften einer Nation geprägt.
Für die Sozialwissenschaften bedeutet diese Änderung des Paradigmas auch ein Begrifflichkeitsproblem: Man spricht von Stereotypen, Imagotypen, Bildern, Vorurteilen, Fremdenbildern, ohne die einzelnen Ausdrücke zu differenzieren.[19] Die Bezeichnung Stereotyp ist am breitesten akzeptiert, wird aber unterschiedlich verstanden und beurteilt. Seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts – seit Walter Lippmann die Funktion der Stereotypen als „Ökonomisierung des Aufwandes bei der Erkenntnis der Welt im Sinne einer ‚A-priori-Strukturierung’ der Wahrnehmung“[20] beschrieben hat, ist allgemein anerkannt, dass die Stereotype hauptsächlich eine psychologische und keine das Wissen fördernde Funktion haben. Diese wird jedoch unterschiedlich bewertet. Gerd Hentschel betont in seinem Aufsatz die wertende Konnotation von Stereotypen:
Jetzt kann auch der Begriff ‚Stereotyp’ um einen Schritt weiter präzisiert werden: Es ist eine (potentielle oder reale) Verwendung einer prototypisch aufgebauten Kategorie mit Aktualisierung nichtnotwendiger emotional wertender Eigenschaften dieser Kategorie.[21]
Hans Hennig Hahn betrachtet dagegen Stereotype vor allem als Integrationsfaktoren, als identitätsstiftende Elemente. Deswegen möchte er die Stereotypenforschung als eine Art „Brückenschlag“ begreifen – zwischen Mentalitätsgeschichte, Politikgeschichte, Nationalismusforschung und der Geschichte interkultureller Kontakte. Damit werden die Stereotypen aus der kümmerlichen Ecke „falsche Wahrnehmung“ herausgeholt – nicht in dem Sinne, daß ihnen ein wie auch immer zu definierender Wahrheitsanspruch bzw. Realitätsbezug zugebilligt wird, sondern daß ihre Relevanz für mentale Einstellungen, für kollektive Identitätsbildung, für politisches Handeln und für zwischenmenschliche bzw. interkulturelle (internationale) Kontakte deutlich wird und sie damit als diesbezügliche Wirkungsfaktoren untersucht werden. Stereotypen sind keine Spiegelungen der Welt, die auf ihren Wahrheitsgehalt hin untersucht werden müssen, sondern sie stellen selbst aufgrund ihrer Existenz in den Köpfen der Menschen und in zwischenmenschlichen Beziehungen eine gesellschaftliche Realität dar.[22]
Nach dieser Auffassung sind Stereotype „Grundlagen menschlicher sozialer Existenz“[23] und sollen als ein wichtiger Wirkungsfaktor vorbehaltlos beobachtet und untersucht werden. Hahn plädiert also für einen vorurteilsfreien Umgang mit Stereotypen, für die Untersuchung ihrer Genese, ihrer inhaltlichen und formellen Veränderungen und ihrer möglichen Bedeutungen. Genauso sorgfältig sollen nach Hahn auch Geschichtsbilder untersucht werden, weil sie – sobald geglaubt wird zu wissen, wie die Vergangenheit aussieht und wie sie zu bewerten ist – die Struktur und Funktionen eines Stereotyps einnehmen können.[24] In dieser Form können sie zur Identifikation, Legitimation, als Argument oder Orientierungshilfe in politischen und ideologischen Diskursen dienen, aber auch als Propagandamittel missbraucht werden.[25]
2.2. Transnationale Perzeptionsforschung
Im Unterschied zu dem viel breiteren Beschäftigungsfeld der Stereotypenforschung untersucht die transnationale Perzeptionsforschung ausschließlich die Wahrnehmung der eigenen und der anderen Nationen und fragt nach den Quellen der bestehenden Wahrnehmungsmuster. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind von den theoretischen Voraussetzungen abhängig, die ihrerseits die Forschungsmethoden bestimmen: Die Befürworter des konstruktivistischen Konzepts gehen bei der Entstehung der nationalen Identitäten von einer politischen Absicht der meinungsbildenden Schichten aus, und fragen, „welche Gruppen oder Personen aus welchen Motiven und mit welchen Strategien die Attribute der jeweils anderen Nation in der eigenen nationalen Öffentlichkeit glaubwürdig definieren und fixieren“[26] ; die Vertreter des sogenannten ontologisierenden Konzepts forschen nach einem natürlichen Urspruch des Nationalbewusstseins, und stellen die fremdnationalen Wahrnehmungsmuster als Ableitungen „des nationalen Referenzsystems wie Volksgeist, Nationalcharakter, politische Kultur des Ursprungslandes des Beobachters“[27] dar. Beide Richtungen suchen nach den Fehlerquellen: die einen bei der Identitätszuschreibung, die anderen bei der Identitätserschließung.[28]
In vielen Studien wurden die deutsch-französischen Wahrnehmungsmuster untersucht. Schon Victor Klemperer musste – von dem ontologischen Standpunkt ausgehend – feststellen:
Zunächst fällt ein ständiger Wechsel in Blickrichtung und Werturteil auf. Deutschland und Frankreich sind lebendige Völker; jedes entwickelt sich in sich selber, und Verhältnis und Standort der beiden zueinander bleiben sich nicht gleich. Anders muß das deutsche Frankreichbild sein, wenn es im 17. Jahrhundert literarisch, im 18. philosophisch, im 19. und 20. politisch und sozial bestimmt ist; anders in den Köpfen eines neutralen, eines unterdrückten, eines siegreichen Volkes; anders unter der Wirkung einer idealistischen und einer positivistischen Weltanschauung; anders aus kleinstädtischer Besinnlichkeit und aus weltwirtschaftlichem Getriebe heraus.[29]
Klemperer zeigt deutlich, dass Fremdbilder nicht nur durch die eigene nationale Zugehörigkeit bestimmt werden, sondern im Gegenteil hauptsächlich durch die historische, politische oder soziale Position des Betrachters. Er stellte auch fest, dass die affektive Vaterlandsliebe, der Patriotismus in der Neuzeit entstanden ist, und erst später in der Gemeinsamkeit der Rasse, des Wohngebiets, der Sprache, der Geschichte, der Sitten und der Gesetze nach eine Legitimierung suchte.[30] Von dieser Feststellung ausgehend behaupten Vertreter der transnationalen Perzeptionsforschung, dass die Beschäftigung mit der fremdnationalen Kultur nicht deren Verstehen dient, sondern sich auf die Andersartigkeit und Fremdheit des Anderen konzentriert, um die eigene Besonderheit und Gruppenzugehörigkeit zu betonen. Aber:
Sobald man diese gleichsam naive Auffassung von der natürlichen Identität und Unterschiedlichkeit der Nationen und der durch sie bedingten Wahrnehmungsmöglichkeiten zwischen ihnen hinter sich lässt und den konstruktivistischen Standpunkt oberhalb des nationalistischen Diskurses einzunehmen versucht, so zeichnen sich unvermeidlich neue Dimensionen der transnationalen Perzeptionsthematik ab. Diese stellt sich nicht mehr als reaktive Annährung an eine feststehende fremdnationale Identität dar, sondern als interaktive Projektion, an der sowohl der (von einer Nationalkultur geprägte) Beobachter als auch die Nation, die Objekt der Wahrnehmung ist, beteiligt sind.[31]
Die Theoretiker der transnationalen Perzeptionsforschung untersuchen verschiedene Textsorten: erzählende Literatur, Artikel in Kulturzeitschriften, Essays, Reiseberichte, Propagandaschriften, Rundfunk- und Fernsehbeiträge. Sie stellten fest, dass die Beliebigkeit der Fremdbilder durch die Notwendigkeit der Glaubwürdigkeit begrenzt wird. Deswegen beziehen ihre Urheber die Selbstzuschreibungen und Eigenbilder der zu beschreibenden Nation ein, und deuten sie gegebenenfalls um;[32] so kann zum Beispiel die von den Polen sich selbst zugeschriebene Freiheitsliebe in Neigung zu Unordnung und Anarchie umgedeutet werden. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit der Wechselwirkung zwischen den Eigen- und Fremdwahrnehmungsmustern auch ein wichtiges Thema bei dem Versuch, die Funktionen der Identitätszuschreibungen zu verstehen.
2.3. Diskursanalytischer Ansatz
Sozialwissenschaftliche Forschung wird auf der Ebene der Wissenschaftstheorie von den Überlegungen und Ergebnissen der Diskursanalyse, die vor allem den Prozess der Stereotypenentstehung zu verstehen helfen, unterstützt. Die Konstruktionen der nationalen Identität werden mit den Methoden der kritischen Diskursanalyse an dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien erforscht. Diskursive Ereignisse werden in ihren sozialen, politischen und institutionellen Kontext eingebettet, mit historischen Hintergrundinformationen verglichen, in ihrer jeweiligen Entwicklung und sozialen Wirkung beobachtet. Verschiedene Diskursstrategien bei der Konstruktion eigener Identität – konstruktive, bewahrende, rechtfertigende, transformatorische oder demontierende – werden im Sinne einer hermeneutisch-interpretativen Tradition erforscht.[33] Dabei wird – wie bei vielen anderen Ansätzen – festgestellt, dass die Konstrukte trotz ihres imaginären Charakters in der Gesellschaft fälschlicherweise als Ausdruck eines unveränderlichen, soliden Charakters einer Gruppe gesehen werden.[34]
Diese Zuschreibungen ignorieren die Individualität, die auf Anerkennung der Einzigartigkeit des Einzelnen basiert. Sie geben eine feste Kategorisierung vor, die narrativ entsteht: „Die narrative Identität ermöglicht es, vielfältige, differente, zum Teil widersprüchliche Zustände und Erfahrungen in eine zusammenhängende Temporalstruktur zu integrieren“.[35] Die komplexe Vielfalt und die Differenzen werden dabei im Diskurs zu einer homogenen Identität, die als Nationalidentität bezeichnet wird, simplifiziert:
Wenn die Nation eine vorgestellte Gemeinschaft, mithin ein mentales Konstrukt, ein imaginärer Vorstellungskomplex ist, der – zumindest – die Bestimmungselemente der kollektiven Einheit und Gleichheit, der Begrenzung und der Autonomie enthält, dann kommt dieser Imagination soweit Realität zu, wie man von ihr überzeugt ist, wie man sie beziehungsweise an sie glaubt und sich emotional mit ihr identifiziert. Die Frage, wie diese imaginäre Vorstellung in die Köpfe derer gelangt, die von ihr überzeugt sind, läßt sich leicht beantworten: Sie wird diskursiv konstruiert und in Diskursen vermittelt, und zwar in erster Linie in Erzählungen der Nationalkultur. Die nationale Identität ist somit das Produkt von Diskursen.[36]
Literatur, Nationalgeschichten, Medien und Alltagskultur sind die wichtigsten Plattformen dieses Diskurses. Sie stellen Verbindungen zwischen Geschichten, Landschaften, Symbolen und Menschen her, erfinden und überliefern Traditionen, konstruieren den Ursprungsmythos der Gemeinschaft. Narrativität erschafft Erklärungs- und Argumentationsmuster, stellt zeitliche, räumliche und teleologische Kausalitäten zwischen Ereignissen, Erzählungen und Wahrnehmungsmustern her.[37]
3. Literaturwissenschaft und das Fremde
Die Erfahrung des Fremden, die damit verbundene Irritation und Herausforderung gehören zu den Grundimpulsen literarischer Produktivität.[38] Dennoch sind Vorurteile, Stereotype, Klischees lange Zeit von der Literaturwissenschaft nicht untersucht worden: Man glaubte, dass sie nur in dem Bereich der Trivialliteratur – die als Gegenstand der Untersuchungen vernachlässigt wurde – vorkommen und „daß der Dichter sich im Schaffensprozeß seiner persönlichen Vorurteile entledige“[39]. Aber auch die gehobene Literatur ist von „erstarrte[n] Schematisierungen“[40] nicht frei. Im Gegenteil gerade in der Literatur werden bestimmte Wahrnehmungsmuster tradiert und befestigt. Ein Zeichen dafür ist eine verblüffende Übereinstimmung der in verschiedenen europäischen Nationalliteraturen den jeweiligen Nationen zugeschriebenen Eigenschaften. Die tatsächlichen, historischen Erfahrungen, die europäische Völker miteinander gemacht haben, hätten zu einer stärkeren Differenzierung dieser Bilder führen müssen.[41] Dabei sind es oft willkürlich ausgewählte Eigenschaften des Fremden, denen die „typenbildende Prominenz“ zugewiesen wird.[42] Deren Entdeckung und die Auseinandersetzung mit ihnen gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer Literaturwissenschaft, die die Literatur „nicht länger nur als Kunst, sondern auch als eine Form des Wissens“[43] sehen möchte. Dabei sollte ein neutrales Verständnis des Stereotyps angestrebt werden, damit nicht jede Schematisierung als unzulässig gebrandmarkt wird – die Figur eines Tee trinkenden Engländers in einer Komödie muss nicht notwendigerweise diskriminierend sein –, gleichzeitig dürfen „negative und verhetzende Stereotype“[44] nicht verharmlost werden.[45]
Literatur kann im Gegensatz zu anderen Medien komplexere Bilder anbieten, die „zur Identifikation führen oder zur Konfrontation herausfordern“[46]. Die besondere Verantwortung der Kunst im Vergleich zu Feuilleton und anderen journalistischen Formen betont János Riesz, indem er auf ihre Doppelfunktion hinweist: Sie schafft Bilder und mit ihnen ein bildliches oder symbolisches Universum. Gleichzeitig liegt ihre besondere Bedeutung in der Überwindung und Zerstörung der erstarrten Vorstellungen und Klischees.[47] Literatur bewegt sich zwischen den an sie gestellten Ansprüchen auf Universalität und Diversität. Seit der Antike wird ihr ein Universalitätsauftrag zugesprochen: Die Dichter sollen das darstellen, was allen oder den meisten Menschen gemeinsam ist; sie sollen das Individuelle dem Allgemeinmenschlichen unterordnen. Das entgegengesetzte Interesse am Individuellen und Einzigartigen, an der Diversität, die sogar die Ausschließlichkeit der klassischen Kategorien des Ästhetischen in Frage stellt, kündigt sich seit dem 18. Jahrhundert an.[48]
Literaturwissenschaftliche Forschung, die sich mit der Darstellung und Funktion des Fremden in fiktionalen Texten beschäftigt, versucht, abhängig von eigenen Interessenschwerpunkten, dieses Problem mit unterschiedlichen theoretischen Ansätzen zu erörtern, die in folgenden Abschnitten kurz dargestellt werden sollen.
3.1. Hermeneutik
Wenn die Möglichkeit der Übertragung der Sinnzusammenhänge aus einer anderen in die eigene Welt als Hauptthema der Hermeneutik gesehen wird, dann kann sie für die Erforschung des Fremden eine sehr fruchtbare theoretische Grundlage sein.[49] Hans Robert Jauß stellt sogar fest, dass „Hermeneutik in ihrer modernen Gestalt [...] Hermeneutik der Alterität [ist]“[50]. Ein Versuch des Verstehens des Fremden kann sich auf das Erkennen des Eigenen im Fremden begrenzen, kann aber auch zur Anerkennung des Anderen in seiner Andersheit und zum Verstehen des Eigenen gerade angesichts des Widerstands des Fremden führen. Diese Prozesse können in dem Bereich der Künste leichter vermittelt werden, weil „das Ästhetische per se auf ein Sinnverstehen angelegt ist, das die Kontingenz situationsgebundener Erfahrung [...] übersteigt“[51].
Ein für die Literaturwissenschaften wichtiger neuerer hermeneutischer Ansatz kommt von dem französischen Philosophen Paul Ricoeur. Ausgehend von der gegen den Poststrukturalismus gerichteten Annahme, dass die Sprache stets einen Gegenstandbezug aufweist, spricht er einem Text „eine Enthüllungs- und Vermittlungsfunktion hinsichtlich der Welt“[52] zu. Hermeneutik versteht Ricoeur als „Theorie der Operationen des Verstehens in ihrem Bezug zur Interpretation von Texten“[53], die als schriftlich fixierter Diskurs verstanden werden. Eine Deutung des Textes kann nicht auf das Verstehen der einzelnen Sätze reduziert werden oder auf die Frage nach der Intention des Autors. Eine Interpretation geht also über die linguistische, historische und psychologische Untersuchung hinaus: „Ein Text muß sich [...] in einer Weise dekontextualisieren können, die die Rekontextualisierung in einer neuen Situation erlaubt.“[54] In der Literatur ist der Weltbezug verdeckt, deshalb kann eine „Quasi-Welt“ erschaffen werden, die von der direkten Situationsgebundenheit suspendiert ist, wodurch sie an ein universelles Publikum adressiert werden kann, und nicht nur an ein ursprüngliches, zeitlich und räumlich dem Autor nahe stehendes. Das Verstehen bezieht sich also „allein auf die autonome Bedeutung des Textes“[55]. Das in ihm festgehaltene Diskursereignis wird durch den Werkcharakter des Textes verfremdet und bekommt ein eigenes Bedeutungspotential, das im Prozess der Lektüre aktualisiert wird und über das festgelegte, etablierte Weltverständnis hinausgeht. Der Leser beginnt die Lektüre in seinen Sinnstrukturen und Vor-Urteilen verhaftet; durch das Lesen wird seine Einbildungskraft von einer Einheit der für ihn vorher nicht zusammengehörenden Elemente herausgefordert, die sein Vor-Verständnis in ein bereichertes oder umgewandeltes Nach-Verständnis neu umgestaltet.[56] Durch Produktion und Rezeption der Texte werden aber nicht nur Bedeutungen verschoben, auch die Zeitlichkeit des Daseins wird erfasst, indem die sukzessive und die phänomenologische Zeit im Erzählen ineinander greifen. Das ermöglicht die Entstehung einer narrativen Identität, die Personen oder Gemeinschaften zugeschrieben wird.[57] Die Vorstellungskraft hat - laut Ricoeur - in Form des ‚sozialen Imaginären’ auch eine soziale Funktion, die als Ideologie oder als Utopie auftreten kann. Die Ideologie als reproduktive Vorstellungskraft bildet Traditionen, integriert, konstituiert den Sinn und bringt das narrative Gedächtnis zum Ausdruck; die Utopie als produktive Vorstellungskraft stellt Innovationen und Hoffnungen dar, korrigiert die erstarrten Formen.[58]
Von der Hermeneutik Ricouers ausgehend, wurden in Frankreich weitere Ansätze zur Untersuchung der Fremdwahrnehmung entwickelt. Daniel-Henri Pageaux führte den Begriff des ‚kulturellen Imaginären’ ein, das aus Elementen des kulturellen Diskurses über das Fremde, das Andere und das Eigene besteht.[59] Diese Vorstellungen des Fremden verweisen nicht auf eine richtige oder falsche Widerspiegelung der Wirklichkeit, sondern auf eine sekundäre, konstruierte. Stereotype als elementare Formen der Images sind emblematisch erstarrte Diskurselemente einer bestimmten Kultur [...] Ausdruck des kollektiven Wissens in jedem historischen Moment gültig, [sie] stell[en] eine konstante Hierarchie und Dichotomie der Kulturen dar, eine Verbindung zwischen moralischen und sozialen Normen.[60]
Pageaux schlägt eine textnahe deskriptiv-historische Interpretationsmethode vor. Er untersucht die Wortfelder einer Epoche oder einer Kultur, wodurch er die – für die Rezipienten und Schriftsteller gemeinsamen – begrifflichen und emotionalen Verbindungen rekonstruiert. Zusätzlich erforscht er die narrativen Sequenzen in Texten und den kulturellen und historischen Kontext ihrer Entstehung.[61]
Pageaux’ Schüller Jean-Marc Moura beschäftigt sich mit Image an sich und mit seinen Beziehungen zum sozialen Imaginären. Er knüpft an Ricoeurs Theorie der reproduktiven und produktiven Imagination an, indem er sowohl die stereotypen – der gängigen Vorstellungen entsprechenden –, als auch die kreativen – individuelle Visionen des Fremden darstellenden – Aspekte der in einem literarischen Werk vorkommenden Images untersucht. Ein Image befindet sich im Spannungsfeld zwischen Ideologie und Utopie, es kann „entweder eine ideologisch-integrative oder utopisch-subversive Funktion aufweisen“[62].
Wenn Literatur im Zusammenhang mit kulturell vermittelter Ideologie und Utopie gesehen wird, dann ist auch die textimmanente Rolle der Figuren der Fremden oder der Anderen mit diesen Kategorien bestimmbar.
3.2. Rezeptionsästhetik
Erst in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts hat die Literaturwissenschaft ihr Interesse nicht nur dem Autor, sondern auch verstärkt dem Leser gewidmet. Der paradigmatische Wechsel von der Produktions- zur Rezeptions- und Wirkungsästhetik ist von der Literatursoziologie, der Hermeneutik und dem Strukturalismus beeinflusst worden. Als Ausgang der Textverstehensanalyse kann die Feststellung, dass die im Text vorhandenen ‚Sinnpotentiale’ im Akt des Lesens aktualisiert werden, angenommen werden. Diese Sinnkonstruktion entsteht im Kommunikationsprozess zwischen dem Leser und dem Text.[63] Jeder Rezeptionsvorgang ist eine Konkretisierung des Sinnpotentials, die individuell durch Erfahrungen, Geschmack und Situation des Lesers bestimmt wird, aber vor allem durch das Assoziationspotenzial des Textes. Viele Assoziationen werden durch die Benennung bestimmter Eigenschaften weitgehend vorprogrammiert. Dazu gehören nationale Stereotype, die „eine Flut von Assoziationen hervorrufen, die sowohl außerliterarisch, im sozio-kulturellen Kontext, als auch in der Literatur selbst verankert sein können“[64] und wie Schlüsselworte funktionieren, die den Schreibenden eine knappe, aber wirksame Ausdrucksweise ermöglichen. Franz K. Stanzel schreibt über die Wahrnehmung der mit einer fremden Nationalität gekennzeichneten Figuren:
Diese meist nur ganz knapp in einer beiläufigen Ankündigung oder in einer Gebärde, in Kostüm oder im Ausspracheakzent signalisierte Information beansprucht nämlich meistens über alle Gebühr die Aufmerksamkeit von Zuschauern oder Leser. Alles, was eine derart gekennzeichnete Person tut, sagt, denkt und fühlt, wird vom Zuschauer oder Leser mit der Information „ein Schotte“, „ein Italiener“ oder „ein Amerikaner“ in Beziehung gesetzt.[65]
Von dem Assoziationspotenzial nationaler Stereotype ausgehend, kann gefragt werden, „wie Autoren mit Stereotypen umgehen und was sie mit dieser assoziationsbeladenen Materie machen“[66]. Manfred Beller unterscheidet zwischen drei Typen von Urteilen: Erstens kann der Autor die Parallelen und Gleichartigkeit des Anderen betonen, zweitens kann er Unterschiede und Kontraste darstellen, drittens kann er seine eigene ethnozentrische Perspektive ablehnen und im Anderen „Anderes und Eigenes zugleich sehen“[67]. Die Stereotype können verschiedene außertextuelle und werkimmanente Funktionen übernehmen. Die Art der Darstellung des Fremden und des Eigenen kann von den angenommenen Erwartungen der Leser, von der Notwendigkeit bei der Schilderung der sozialen Realität oder auch von propagandistischen Zwecken, wenn Informationen, die dem negativen Bild widersprechen, bewusst ausgelassen werden, bestimmt sein. Deswegen soll eine Analyse der Fremdenbilder die Frage nach dem, was der Autor bewirken wollte, was er sich von dem Dargestellten versprach, beinhalten.[68] Emer O`Sullivan fasst die außerliterarischen Funktionen der nationalen Stereotype wie folgt zusammen:
[Sie] werden meistens durch Kontrastierung erzeugt. Dem Eigenbild wird das Fremdbild gegenübergestellt, um das Bewußtsein der eigenen Identität zu stärken, um vor der eigenen Schwäche zu warnen, um vermeintlich unerwünschte Faktoren eines erstrebten Eigenbildes scharf zu kritisieren oder um mögliche Szenarios eines zukünftigen Lebens und einer zu erwerbenden Identität durchzuspielen. Die Darstellung anderer Nationen kann auch dazu dienen, Sehnsüchte innerhalb der eigenen Nation zu befriedigen oder sich literarisch zu rächen.[69]
Für die Rezeptionsästhetik ist nicht nur die Frage nach dem Zweck der stereotypen Darstellung des Fremden wichtig, sondern auch die nach der Art des Umgangs mit ihnen. Stereotype – als ein bei dem Leser vorauszusetzendes Wissen – sind eine Folie, auf der jede Beschreibung einer anderen Nation aufgezeichnet und gelesen wird. Der Autor kann sie aufrecht erhalten, mit ihnen spielen, sie durchbrechen und verkehren oder die Erwartungen der Leser frustrieren, indem er keine nationalen Zuschreibungen vornimmt.
Eine Untersuchung der Stereotypenfunktion in einem literarischen Text kann auch für die Einschätzung seines ästhetischen Werts dienlich sein: Wenn der ästhetische Wert eines Werks an seinem Irritationsgrad und daran gemessen wird, ob er den Leser dazu zwingt seine gewohnten Denkmuster zu hinterfragen, dann wäre die Art des Umgangs mit nationalen Stereotypen ein Unterscheidungsmerkmal zwischen anspruchsvoller und trivialer Literatur. Eine den gängigen Wahrnehmungsmustern der Leser entsprechende Schilderung entspräche einem trivialen Text, eine Durchbrechung der Klischees charakterisierte einen ästhetisch höher einzuschätzenden.[70]
3.3. Literarische Imagologie
Die Feststellung, dass der Literatur eine besondere Rolle bei der Entstehung und Tradierung von Fremdenbildern zukommt, führte dazu, dass sich im Rahmen der literaturwissenschaftlichen Komparatistik[71] in der Mitte des 20. Jahrhunderts die komparatistische Imagologie als eine der jüngsten Forschungsgebiete herauskristallisierte. Diesen Vorgang beschreibt zutreffend Angelika Cirbineau-Hoffmann:
Die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft [...] hat es insgesamt mit Fremdheit zu tun: mit dem Einfluß (der Rezeption) von Literatur in fremden Sprachen, mit der literarischen Übersetzung als Mittel, das Fremde vertraut zu machen, mit der Untersuchung von Themen und Motiven in den Literaturen verschiedener Sprachen und Kulturkreise. Allerdings ist die für das Fachverständnis konstitutive Fremdheit nicht auf den innerliterarischen Bereich beschränkt. Neuere Konzeptionen der Komparatistik betonen in verstärktem Maße auch die – verfremdeten – Relationen zwischen Literatur und anderen Bereichen des Wissens. [...] Unter diesem Aspekt hätte der literarische Text auch Verbindungen zu anderen Diskursen, so wie sie die Wissenschaften prägen. Dort, wo die Fremdheit Züge einer nationalen Imago, eines Bildes vom anderen Land (und von dessen Bewohnern) annimmt, spricht man von komparatistischer Imagologie.[72]
Wenn komparatistische Imagologie auf der Schnittstelle zwischen mehreren Geistes- und Gesellschaftswissenschaften steht, dann können für sie nicht nur die ästhetischen Qualitäten eines Werkes bedeutend sein, sondern hauptsächlich ihre Wirkung. Diese Feststellung führte zu einer Auseinandersetzung über die Bestimmung des komparatistischen Forschungsgegenstandes und über den Sinn und die Zielsetzung der Komparatistik schlechthin. Einige Literaturwissenschaftler behaupteten, dass die Komparatistik „zu einer Art Hilfswissenschaft der internationalen politischen Beziehungen degradieren könne“[73]. Andere Wissenschaftler fanden, dass gerade die Literatur – in der Abgrenzung zu anderen Medien – mit ihrer besonderen Aufgabe Bilder zu schaffen, einzusetzen und zu reflektieren, nicht nur auf die Untersuchung des Ästhetischen begrenzt werden solle.[74]
Zu den Befürwortern der Imagologie gehören in Deutschland vor allem die Forscher der Aachener Gruppe um Hugo Dyserinck[75], die die Komparatistik nicht als eine Hilfswissenschaft, aber auch nicht als eine Superdisziplin sehen, sondern als eine Teildisziplin mit einem „eigenen Standort und eine[m] eigenen Blickwinkel bei der Analyse von Literatur“[76]. Die Beschäftigung mit der komparatistischen Imagologie sei eine sinnvolle Verschiebung der Untersuchungen von der Einfluss- hin zur Rezeptionsforschung, die als ihr Kernproblem die Erfahrung der Fremdheit zwischen nationalen Literaturen und Kulturen sieht. Die Aachener Komparatisten betonen, dass das Bild eines Landes, das in der Literatur tradiert wird, selten eine direkte Übernahme der bestehenden Stereotype oder kulturell-nationalen Images sei, sondern im literarischen Text konstituiert und besonders angebunden sei, so dass es einen ästhetischen Wert einnimmt. So verstanden, sind fiktionale Texte zwar Teile eines breiteren Diskurses, aber im Gegensatz zu politischen oder soziologischen Diskurssträngen, die sich mit geographisch gebundenen Orten beschäftigen, entstehen in dem literarischen Diskurs – dadurch, dass das Fremde ästhetisiert wird und eine eigene Rolle in einer fiktionalen Welt bekommt – metaphorische, imaginäre Bilder, die eine werkimmanente Rolle innehaben, diese aber ihrerseits ohne imagologische Analyse nicht verstanden werden kann. Auch die Möglichkeit der Beeinflussung der Literaturkritik, der Verbreitung und der Rezeption der literarischen Texte außerhalb ihres Sprachraumes durch Fremdbilder unterstreicht die Rolle der imagologischen Forschung innerhalb der Literaturwissenschaft.[77] Zu den wichtigsten Ergebnissen der Imageforschung gehört vor allem die Erkenntnis „des Mangels an echtem nachweisbarem Wahrheitsgehalt“[78] der Länderbilder, die Feststellung, dass die imagotypen Strukturen im Rahmen der literarischen oder der literaturkritischen Werke hervorgebracht werden[79] und die Untersuchung des Einflusses der von der Literaturkritik hervorbrachten Bilder auf die Verbreitung der fremdsprachigen Literatur in einzelnen Ländern.[80] Dennoch geht auch Dyserinck davon aus, dass die Imagologie „unter bestimmten Umständen durchaus noch eine ‚ethnopsychologische’ Funktion erfüllen“[81] kann. Aber weil er davon ausgeht, dass es keinen Nationalcharakter und keine Eigenart der Völker gibt, sondern „nur noch Gemeinschaften, die sich gegenseitig als jeweils ‚anders’ betrachten“[82] und sich nur mit Erscheinungsformen, Entstehung und Wirkung der Fremdbilder beschäftigt, ist ihm diese Funktion der Imagologie sogar willkommen:
Denn es ist für die Literaturwissenschaft nicht nur keine Schande, wenn sie durch ihre Forschungen etwa zu einem besseren Verständnis der Völker untereinander beiträgt, sondern es wäre vielmehr unverzeihlich, wenn man vor offensichtlich vorhandenen Erkenntnismöglichkeiten bei der Erforschung des literarischen Geschehens die Augen verschließen würde, bloß weil sie zu Ergebnissen führen können, die noch eine andere als ästhetische Tragweite haben.[83]
Nichtsdestoweniger sollen auch für die Komparatisten literarische und literaturwissenschaftliche Texte der Ausgang- und der Endpunkt jeder imagologischen Untersuchung sein.[84]
Ihrer ideologiekritischen Einstellung wegen ist komparatistische Imagologie in den neunziger Jahren erneut in die Kritik geraten. Der Aachener Schule wurde eine einseitig deskriptiv-empirische Einstellung und eine übertriebene Konzentration auf die Aufgabe der Entideologisierung der Fremdforschung vorgeworfen.[85] Auch die Ablehnung der Kategorie der Nation, die mit der spezifischen Lage der deutschen Germanistik nach 1945 und mit der Konzentration der Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler auf allgemeine Menschenrechte und individuelle Freiheit erklärt werden kann[86], wurde als unwissenschaftlich und rein politisch motiviert kritisiert. Jens Stüben schreibt fast ermahnend:
Die literaturwissenschaftliche Imagologie hat Eigenschaftenzuschreibungen zu dokumentieren und kritisch zu prüfen, muß sich jedoch davor hüten, Fremdbilder vorschnell als Klischees abzuqualifizieren. Die Imagologie sollte die Möglichkeit, daß es in einer fremden Ethnie typische Denk- und Verhaltensweisen gibt, nicht nur nicht leugnen, sondern sich bemühen, deren Andersartigkeit differenziert wahrzunehmen, um kulturelle Eigenarten besser verstehen und respektieren zu helfen. Andernfalls würde sie weder das Fremde noch das vermeintlich Menschlich-Allgemeine, sondern nur ihre eigene Betrachtungsweise bzw. den ihr vertrauten Wirklichkeitsausschnitt zur Grundlage ihrer Aussagen machen.[87]
3.4. Grundbegriffe
3.4.1.Image
Die Bezeichnung des literarischen Bildes des Fremden als ‚image’ oder als ‚mirage’ wurde von den französischen Komparatisten eingeführt worden, die die Bezeichnung Mirage einem falschen Bild also einem Trugbild und die Bezeichnung Image einem objektiven Bild zuordneten.[88] Diese Deutung wurde aber - spätestens seit sich die Imagologie von völkerpsychologischen Vorstellungen distanzierte und den konstruktivistischen Charakter der ‚Bilder im Kopfe’ betonte – nicht mehr haltbar, so dass in der französischen Forschung nur noch ‚image’ und in der deutschen Forschung Image oder Bild als Terminus üblich sind. Die Vertreter der Aachener Komparatistik nehmen an, dass ein Image „auf eine mit Historizität belegte, strukturierte Gesamtheit von Einzeln- und Kollektivaussagen, auf ein äußerst komplexes Zusammenwirken von ‚Vorstellungen’ über Andersnationales“[89] verweist. Es beinhaltet bildhafte Typisierungen alltäglicher und besonderer Merkmale von Fremden, deren Handeln, Denken und Wesen. Es sind Wertzuordnungen ohne rationale Begründung. Diese Bilder müssen keine objektive, allumfassende Aussage über das Fremde machen, sie können eine perspektivische Darstellung einer Wahrnehmung sein, die einen einzelnen Aspekt besonders scharf beleuchtet.[90] Imagologie ist nicht an der Kritik des Images interessiert: Ein Image wird in seiner Struktur, Herkunft und Wirkung, ohne Frage nach dem Wahrheitsgehalt untersucht.
Eine komplexe, viele einzelne Images umfassende Aussage wird - in Abgrenzung zum sozialpsychologischen Begriff des Stereotyps - Imagotyp genannt. Dadurch soll eine besondere literaturwissenschaftliche Perspektive deutlich gekennzeichnet werden, die auch den Unterschied zwischen Stereotypenforschung und literarischer Imagologie präzisiert: Image kann den gängigen, vorgeprägten Vorstellungen entsprechen, es kann aber auch von Autor selbst konstruiert sein und den tradierten Bildern sogar ein Gegenbild entgegenstellen.
Das Image-Konzept wird seit den siebziger Jahren weiter differenziert: Das Bild des Fremden wird als Heteroimage bezeichnet und das Bild des Eigenen als Autoimage. Die Erforschung des Heteroimages führte notwendigerweise zur Analyse des Autoimages, „d.h. der Bilder, die konstitutionell für eigene Identitätszuschreibung der jeweiligen Gruppe und Gemeinschaft sind“[91]. Dabei funktioniert ein Heteroimage als ein Negativ des Autoimages: Das Fremde kann beanstandet werden, um das Eigene als besonders schätzenswert darzustellen, oder es wird gepriesen, um das Eigene zu kritisieren.[92] Diese Zuschreibungen können explizit oder implizit sein: Das Urteil über eine Person oder Gruppe kann von dem Erzähler oder seinen Figuren direkt ausgesprochen werden, es kann aber auch nur aus dem dargestellten Charakter, dem Verhalten und den Gedanken der zu beurteilenden Person ableitbar sein.[93]
Um die Ziele des Autors oder die Wirkung eines Images auf die Rezipienten einschätzen zu können, soll der Argumentationszusammenhang und die Stellung der getroffenen Aussagen im Gesamttext beachtet werden. Außerdem werden Images in ihrem historischen Kontext unter Berücksichtigung des Zeitgeistes, der politischen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten analysiert.[94]
3.4.2. Imagem und Imagothème
Image oder Bild sind als Bezeichnungen der Phänomene der Fremdwahrnehmung sehr unterschiedlich definiert und eingesetzt worden. Deswegen wurden von Jean-Marc Moura die Begriffe Imagem und Imagothème eingeführt.[95] Imagothème ist ein Oberbegriff, seine einzelnen Bestandteile werden Imageme genannt. Ein Imagem kann aus verschiedenen Elementen bestehen: positiven oder negativen Stereotypen, fremden –fiktiven oder authentischen – Figuren, Erwähnungen des fremden Landes, seiner Geschichte, Kultur und Landschaft. Imageme können einzeln oder als ein komplexes Imagothème vorkommen. Sie können nur in einem oder auch in mehreren Texten auffindbar sein. Sie können dem Bereich der Ideologie oder der Utopie entstammen.
Obwohl Imagem und Imagothème für imagologische Arbeiten nützliche und klar anwendbare Beschreibungskategorien wären, werden sie in der Forschung nur vereinzelt gebraucht. Deswegen werden sie auch in dieser Arbeit nicht benutzt.
3.4.3. Alterität und Alienität
Der Begriff Alterität weist grundsätzlich auf eine reflexive Relation zwischen einem erkennenden Subjekt und einem zu erkennenden Objekt hin. In der Literaturwissenschaft wurde er zuerst in hermeneutischen Ansätzen angewandt, um die historische Distanz zwischen dem Interpreten und einem älteren Text zu beschreiben. Zu diesem ursprünglich zeitlich gedachten Unterschied kamen Überlegungen über eine räumliche Distanz, die als kulturelle Alterität bezeichnet wird, welche ihrerseits als kognitiv oder als normativ Fremdes vorkommen kann. Der Begriff des kognitiv Fremden ist wertneutral und bezeichnet das Unbekannte, noch nicht Erkannte. Das normativ Fremde ist eine wertende Kategorie: Es bezieht sich auf die geltenden Normen und schließt das ihnen nicht Entsprechende aus.[96] Von der hermeneutischen Annahme von der Existenz eines das Fremde zu verstehen versuchenden Subjekts ausgehend, kann festgehalten werden, dass im Prozess des Verstehens der geschichtlichen Ereignisse sowohl die historische als auch die kulturelle Alterität berücksichtigt werden müssen: „Die historische Rekonstruktion muß daher konkurrierende Gedächtnisse, unterschiedliche Erfahrungen und Deutungen einer gemeinsamen, aber vielschichtigen Geschichte unterscheiden.“[97]
Das Begriffspaar Alterität und Alienität[98] verdeutlicht, dass im traditionellen Verständnis das Fremde, das uns in der Literatur begegnet, eigentlich nicht fremd sondern anders ist. Fremdes muss nicht fremd bleiben, sondern kann durch ein Auseinandersetzung mit ihm seine Fremdheit verlieren.[99] Gleichzeitig bewirkt aber die Umbenennung des Fremden in das bloß Andere seine Domestizierung. Der als bedrohlich empfundene Fremde steht als Anderer „in unmittelbarer Beziehung zu einem Selbst, und ist so harmlos wie nur ein Gast, der durch das Gastrecht gezwungen wird, sich zu benehmen“[100]. Dadurch wird eine Auseinandersetzung nicht mehr nötig, eigene Wertvorstellungen, Wahrnehmung- und Denkmuster werden ungefragt auf den Anderen übertragen.
Alterität und Alienität sind auch aus anderen Gründen für eine literaturwissenschaftliche Untersuchung problematische Begriffe: Sie können sozialphänomenologisch, hermeneutisch, geschichtsphilosophisch, soziologisch, psychoanalytisch oder feministisch interpretiert werden, wodurch eine begriffliche Verwirrung entstehen kann.[101] Diese Unklarheit führt dazu, dass in den meisten Untersuchungen, aber auch bei vielen Theorieansätzen das Andere und das Fremde synonym gebraucht werden.[102]
4. Das Polenbild in der deutschen Öffentlichkeit und Literatur
Die wechselhafte und oft sehr problematische Nachbarschaft der Deutschen und der Polen spiegelt sich auch in der Literatur der beiden Nationen wider. Das Interesse an der jeweils anderen war und ist aber nicht symmetrisch: Im Gegensatz zur der sehr intensiven Beschäftigung mit Deutschland und den Deutschen in der polnischen Literatur wird Polen in der deutschen Literatur wenig thematisiert.[103] Nur im Vormärz war das kurzzeitig anders, aber auch das Interesse an den zu der Zeit zahlreich verfassten Polenlieder hatte nicht zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der Situation der Polen geführt. Dieter Arendt wirft die Frage auf, ob das ästhetische oder volks-psychologische Ursachen habe, ob die deutschen Dichter die polnische Tragödie adäquat nicht darzustellen vermöchten, oder ob sie dabei „auf taube Ohren der Rezipienten“[104] stoßen.
Einer der ersten Texte in der deutschen Literatur, in denen Polen dargestellt wird, ist das 1660 entstandene Drama Piastus von Andreas Gryphius, der die Geschichte des polnischen Königsgeschlechts beschreibt. Einige andere schlesische Barockdichter priesen Polen als ein Land der Toleranz und des Friedens, nachdem viele Schlesier während des Dreißigjährigen Krieges in Polen Zuflucht gefunden hatten. Sie knüpften Kontakte zwischen der deutschen und der polnischen Literatur, auch indem sie polnische Texte ins Deutsche übersetzten.[105] Insgesamt war Polen aber bis zum 18. Jahrhundert im Bewusstsein der Deutschen kaum vorhanden. Das kalte Land mit der sonderbaren Form der Adelsdemokratie galt in Europa als christliches Bollwerk „gegen die vordringenden mohammedanischen Türken“[106] ; polnischem Adel wurde Gastfreundschaft, Patriotismus und Tapferkeit zugesprochen, den polnischen Bauern Aberglaube und Ängstlichkeit.[107]
4.1. ‚Polnische Wirtschaft’
Hubert Orlowski stellte die Hypothese auf, dass das deutsche Polenbild der Neuzeit grundsätzlich von dem Stereotyp ‚polnische Wirtschaft’ bestimmt ist und eine Dissonanz in der zivilisatorischen und kulturellen Entwicklung in Mitteleuropa suggeriert. Das Stereotyp beinhaltet eine Infragestellung der wirtschaftlichen und politischen Effizienz im polnischen Staat, moralische Entrüstung über angebliche Verschwendungssucht des polnischen Adels und ästhetischen Ekel gegenüber den den Polen ebenfalls unterstellten Hang zu Schmutz und Ungepflegtheit.[108]
Eine erste Beschreibung der polnischen Rückständigkeit ist in der 1502 erschienenen Sammlung Quattour libri amorum secundum quattuor latera Germaniae des deutschen Humanisten Konrad Celtis zu finden. Aus dem sonnigen Italien in Krakau angekommen, beklagt er den jämmerlichen Zustand dieses kalten und schmutzigen Landes, „wo der barbarische Sarmate den mageren Acker pflügt“[109]. Dass Celtis’ Beschreibungen mit polnischen Gegebenheiten wenig zu tun haben und nur die besondere Schönheit des Südens untersteichen sollen, zeigt sich daran, dass er – der zwei Jahre in Krakau lebte – nicht über das Leben in der Stadt oder die berühmte Universität schreibt, sondern über die Bauern, die er in der Stadt gar nicht kennen lernen konnte. Eine – im Gegensatz zu Celits – nicht wertende Darstellung der Lage der polnischen Bauern stammt von Daniel Speer. Der Autor lässt den Protagonisten seines 1683 veröffentlichten Ungarischen und Dacianischen Simplicissmus in einem polnischen Bauernhaus übernachten, wo:
Küh, Kälber, Schwein, Gänse, Kinds-Wiegen und in Summa allerley Creaturen der Welt gleichsam in Compendio, oder einer nach dem verjüngten Maßstab gebauten Arche Noah beysammen und untereinander standen.[110]
Diese Beschreibung ist sachlich, detailliert, humorvoll und entspricht den damaligen Zuständen sowohl in Polen, als auch in mehreren anderen europäischen Ländern.
Während der Aufklärung entstand ein größeres Interesse am polnischen Staat, auch als Folge seines Untergangs. In dieser Zeit wurde die Redewendung ‚polnische Wirtschaft’, die sich in diesen Zeiten des Zusammenbruchs der Adelsrepublik, der politischen und wirtschaftlichen Krise etablierte, noch nicht auf das Land und die Menschen an sich bezogen, sondern auf konkrete Zustände und Haltungen.[111] Johann Georg Forster, in dessen Briefen aus Wilna die Redewendung zum ersten Male auftaucht, verwendet sie, um den desolaten Zustand der Häuser und Ländereien zu beschreiben. Schmutz, Rohheit, Geschmacklosigkeit, Rückständigkeit, unbefahrbare Straßen und schlechte Wirtshäuser werden von ihm beklagt. Forster, der mit Herder und Lichtenberg korrespondierte, schreibt in einem Brief:
[D]ie Polen sind Schweine von Haus aus, so Herren als Diener [...], doch ganze Bogen reichen nicht zu, um Ihnen einen Begriff von dem zu geben, was in den angrenzenden Gegenden Deutschlands, mit einem emphatischen Ausdruck, polnische Wirtschaft genannt wird.[112]
Forster argumentiert vom Standpunkt eines Aufklärers aus: Er bereiste die beschriebenen Gebiete, verglich sie mit den vom protestantischen Bürgertum geprägten, sich modernisierenden Ländern, in denen die Tugenden der Ordnung, Sparsamkeit, Zielorientiertheit, Arbeitsamkeit und Wirtschaftlichkeit die Moralvorstellungen bestimmten und stellte fest, dass in Polen feudale Strukturen, Verschwendung und Rechtlosigkeit herrschten, die er, als aufgeklärter Gelehrter, ablehnen musste. So wurde – den Zuständen und Vorstellungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts entsprechend – die ‚polnische Wirtschaft’ ein Gegenbegriff zur ‚bürgerlichen Klugheit’.[113] Dadurch verfestigte sich die Überzeugung von der Existenz eines von Westen nach Osten verlaufenden Kulturgefälles.
Diese historisch verankerte Konnotation emanzipierte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts von ihrem früheren konkreten zeitlichen und räumlichen Entstehungshintergrund und verselbstständigte sich als ein Stereotyp, das nicht nur der Verdeutlichung der Unterschiede zwischen dem Eigenen und dem Fremden, sondern auch der Legitimierung der Teilung Polens und der späteren Politik gegenüber den polnischen Bestrebungen nach staatlicher Unabhängigkeit diente. Schon 1802 schrieb Herder:
Der Geist, der unter Johann Sobieski den Charakter der Polen achtbar gemacht hatte, erlosch mit ihm völlig, an dessen Stelle Pracht, Luxus und Üppigkeit traten. [...] und da in Polen der erwerbende Mittelstand, die Säule eines Staats, fehlte, auch niemand daran dachte, daß, wenn alle umliegenden Länder ungeheure Fortschritte machen, ein in üppiger Barbarei zurückbleibendes Mittelland um so ärmer, schwächer und verächtlicher, zuletzt aber gewiß den Stärkeren zur Beute werde, was gegen das Ende des Jahrhunderts rasch erfolgt ist“[114]
Goethe – der schon 1795 die Einführung der deutschen Sprache in Polen „um eine höhere Kultur der niedern Klasse zu bewirken“[115] postulierte – verteidigte 1832 das Verbot der ‚polenbegeisterten’ Broschüre Polens Untergang, indem er sagte: „Die Polen wären doch untergegangen, mussten nach ihrer ganzen verwirrten Sinnesweise untergehen.“[116] In der Frankfurter Nationalversammlung 1848 argumentierte der Abgeordnete Wilhelm Jordan gegen die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Polens:
Hat der Deutsche [...] Straßen und Kanäle angelegt, Dörfer gebaut und Städte gegründet, um den Epigonen des exilirten hundertköpfigen polnischen Despotenthums neue Schmarotzernester zu bereiten?[117]
Ein anderer Abgeordnete legitimierte die Beschlüsse der Nationalversammlung, indem er über die Teilung Polens sagte:
[Sie] war das gerechte Gericht über ein verrottetes Volkstum, das keine eigene Kraft besaß, das Feudalwesen zu brechen, dessen Zerstörung die Kultur gebieterisch forderte.[118]
Der imaginäre Charakter dieser Äußerungen wird deutlich, wenn berücksichtigt wird, dass sie die polnische Reform-Verfassung vom 3. Mai 1791 ignorierten: Diese Verfassung hätte aufgrund ihrer Fortschrittlichkeit die polnische Adelsrepublik in eine aufgeklärte Monarchie mit gesicherten Bürgerrechten umgewandelt, wäre es nicht zu weiteren Teilungen des Landes durch die aufgeschreckten Mächte gekommen. Allein Karl Marx pries die polnische Konstitution als „das einzige Freiheitswerk, das Osteuropa je selbständig aufgerichtet hat“[119].
Eine der bekanntesten Darstellungen der ‚polnischen Wirtschaft’ in der deutschsprachigen Literatur Gustav Freytags 1855 erschienener Roman Soll und Haben. Ein fleißiger, strebsamer, ehrlicher deutscher Kaufmann fährt durch die von Polen bewohnten Gebiete, die verwüstet, verdreckt, kalt und öde sind. Die Menschen sind arm, roh, gewalttätig und hasserfüllt, sie können nicht wirtschaften, sie lügen und betrügen, zerstören alles, was ihnen anvertraut wird.[120] Der Protagonist kann nun mit Überzeugung feststellen:
Welches Geschäft auch mich, den Einzelnen, hierher geführt hat, ich stehe hier als einer von den Eroberern, welche für freie Arbeit und menschliche Cultur einer schwächeren Race die Herrschaft über diesen Boden abgenommen haben. Wir und die Slaven, es ist ein alter Kampf. Und mit Stolz empfinden wir: auf unserer Seite ist die Bildung, die Arbeitslust, der Credit.[121]
Freytag interessiert sich nicht für die Ursachen der Unterschiede zwischen den Deutschen und den Polen, er entwirft ein polarisierendes, ideologisch gefärbtes Bild des Guten und des Bösen. Sein Roman ist in mehr als neunzig Auflagen gedruckt worden und war eine Schulpflichtlektüre in preußischen Gymnasien bis ins 20. Jahrhundert hinein, wodurch er das deutsche Polenbild maßgeblich prägte.[122] Er wurde zu einer paradigmatischen Vorlage für viele andere Romane, vor allem Heimatromane aus den Provinzen Posen und Schlesien, die zwar fast ausschließlich der Trivialliteratur zugeordnet werden müssen, aber durch ihre Verbreitung und Beschäftigung mit aktuellen politischen und sozialen Problemen wie Ansiedlungs-, Konfessions- und Sprachfragen, großen meinungsbildenden Einfluss ausübten.[123]
Mit dem Bild der ‚polnischen Wirtschaft’ ist auch das des ‚polnischen Reichstags’ verbunden: Das Land könne sich nicht entwickeln, weil die Polen ununterbrochen stritten und niemals zu einem Entschluss kämen, jede polnische Versammlung verlaufe chaotisch und bleibe ergebnislos.[124]
Die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert brachte eine qualitative Veränderung des deutschen Polenbildes und des polnischen Deutschlandbildes. Die politischen, sozialen, aber auch die wissenschaftlichen Diskurse führten dazu, dass verschiedene Vorurteile, Stereotype, Vorstellungen und Ressentiments zu einem ethnisch, national und religiös begründeten Feindbild konsolidiert wurden.[125]
4.2. ‚Polnische Freiheitsliebe’
In der deutschen Literatur und Öffentlichkeit gibt es nicht nur negative Einstellungen Polen gegenüber. Die ersten begeisterten Polenlieder und Erzählungen entstanden nach 1683, um König Jan Sobieski, den ‚Befreier Wiens’, zu preisen. Die nächste Sympathiewelle gab es nach der Zerschlagung des Aufstandes 1794 .[126] In der Zeit des Vormärz und des Völkerfrühlings entstand eine Sympathie den geschlagenen polnischen Freiheitskämpfern gegenüber, die nach dem von den Russen zerschlagenen Novemberaufstand 1830/31 über Deutschland nach Frankreich emigrierten. Ein Gefühl der ideellen Kampf- und Schicksalsgemeinschaft verband die Deutschen mit den Polen als Vertreter des heroischen Kampfes der Völker Europas gegen ihre Unterdrücker. In den Städten wurden Polen-Komitees gegründet, Benefizbälle und –soirées gegeben, viele Dichter schrieben begeisterte Polenlieder. Die Polen wurden als „Retter Europas vor dem Joch der Tyrannei“, und „als die edelste Nation auf Gotteserde“[127] gepriesen, zum christlichen und aufgeklärten Vorposten des Abendlandes gegenüber der russischen Barbarei stilisiert. ‚Polnische Freiheitsliebe’, die im 18. Jahrhundert noch mit dem Klischee des ‚polnischen Reichstags’ stark verbunden war und als Anarchie und Zügellosigkeit gesehen wurde, wandelte sich für kurze Zeit in ein neues, positiv assoziiertes Schlagwort um.
Als Träger der ‚polnischen Freiheitsliebe’ wurde der ‚edle Pole’ gesehen: Ein polnischer Patriot, ein politischer Märtyrer, der für die Freiheit kämpft, sein Leben und Gut bereitwillig dem geliebten Vaterlande opfert, mutig und stolz ist und zudem ein guter Tänzer und Charmeur. Als Vorlage diente die Gestalt Tadeusz Kościuszko, des Führers des Aufstandes von 1794. Dieses Bild entsprach dem Autostereotyp der Polen, die sich als große Patrioten, treue Katholiken und tapfere Kämpfer sahen. Nach der Abkühlung der Polenbegeisterung wurde der ‚polnische Freiheitskämpfer’ mit Sentimentalität, Leidenschaftlichkeit, Theatralität, Verantwortungslosigkeit und mit politischem Leichtsinn in Verbindung gebracht. So wurde der Bogen zu dem luxussüchtigen polnischen Adligen des 18. Jahrhunderts wieder geschlagen: Der Pole sei ein Verschwender der Güter und der eigenen Kräfte; anstatt fleißig zu arbeiten, stifte er überall Unruhe, erreiche damit nur die Zerstörung seines Landes und – nicht zuletzt – bringe auch andere in Gefahr.[128]
Die Polenbegeisterung dauerte also so lange, wie sie mit deutschen Interessen vereinbarbar war; schon 1848 wurde sie als „schwachsinnige Sentimentalität“[129] der kosmopolitischen Idealisten abgetan.[130] ‚Polnische Freiheit’ wurde wieder zum Inbegriff des Chaos, der Verwirrung und der Anarchie, wurde also in das Bedeutungsfeld der ‚polnischen Wirtschaft’ eingebunden. Dies beeinflusste auch die polnische Selbstwahrnehmung und führte dazu, dass in der Literatur des Positivismus[131] – als Gegenbild zu dem Aufständischen – das Bild eines fleißigen, pflichtbewussten Bürgers, der seine patriotische Gesinnung durch die harte Arbeit für den Erhalt des polnischen Eigentums zeigt, propagiert wurde.[132]
Das ausgewogenste Polenbild des Vormärz stammt von Heinrich Heine, der 1822 die Familie eines polnischen Kommilitonen bei Gnesen besuchte und seine Eindrücke in der Reiseskizze Über Polen veröffentlichte. Es sind Schilderungen der eintönigen und melancholischen polnischen Landschaft, der wackeren und braven Adligen, der rückständigen und versoffenen Bauer. Heine sucht nach Erklärungen für die Lage des Landes, versucht es mehrdimensional und differenziert darzustellen. In seinen Pariser Jahren distanzierte er sich allerdings von polnischen Emigranten: 1840 schrieb er in der Denkschrift Ludwig Börne von der „Verwirrung und Unzuverlässigkeit“ der Polen, von „kleine[r] polnische[r] Schlauheit“ und „flinke[r] Ritterlichkeit“[133]. Er war auch der erste deutsche Schriftsteller, der die stigmatisierten sprechenden Namen auf –ski einführte: Es sind „Crapülinski und Waschlapski, Polen aus der Polackey“[134]. Später kamen dazu Schelmufsky, Eselinski, Kapitalinski, Wudski, Kanaillowski, Beschaisky und Schafskopsky.[135]
In Heines Über Polen wird noch ein anderes, in der deutschen Literatur oft vorkommendes Klischee präsentiert – das der ‚schönen Polin’. Heine bewundert Polinnen als „Weichsel-Aphroditen“[136], als Ehefrau wünscht er sich aber eine Deutsche aus dem Bürgerstande: „Muster von Häuslichkeit, Kindererziehung, fromme Demut und alle jenen stillen Tugenden der deutschen Frauen wird man wenige unter den Polinnen finden.“[137]
Schon 1787 schrieb A.H. Traunpaur:
Die Weiber haben überhaupt in Pohlen ungemein mehr Verstand, Einsicht und Beurtheilung als ihre Herrn Gemahle. Übrigens sind beide Geschlechter sehr eingenommen für – den Putz, den Tanz, die Komplimente, den Trunk und – die Geistlichen.[138]
Ende des 19. Jahrhunderts mutierte das Bild der ‚schönen Polin’ zum Bild der ‚schönen polnischen Hexe’, die anständige deutsche Männer in Gefahr bringt. Die Polin ist ‚die Mutter aller Rebellion’, sie verbreitet den polnischen Patriotismus, wodurch sie sich und ihre Umgebung bedroht.[139] Das Illustrierte Konversations-Lexikon der Frau (1900) bringt unter dem Stichwort „Ausländerinnen“ Folgendes:
Die Polin – pikant, liebenswürdig, kokett selbst mit dem Hotelportier, der ihr die Theaterbillets besorgt, mehr Puder auf dem Gesicht als unbedingt notwendig, lebhafte Augen, die mehr blitzen als sprechen – eine der reizvollsten A[usländerin], ein wohlerzogener charmanter Gast. Alles auf die Facade hingearbeitet – eine entzückende Facade, mit der wehenden Flagge Polens. Allerliebste Patriotin, mit dem Bewusstsein, daß ‚Trauer’ sie kleidet. Raucht in der Jugend, um die hübsche Hand zu zeigen, im Alter aus Passion. Im Alter bleibt sie lieber zu Hause, besucht Kirchen und spricht Politik.[140]
In der Weimarer Republik wurde das Polenbild durch die politischen Konflikte bestimmt. In der Trivialliteratur wird der lächerliche polnische Nationalstolz, Religiosität und Aberglaube, Falschheit und Heimtücke beschrieben. Der ‚edle Pole’ ist erfolglos und dadurch schwermütig, die ‚schöne Polin’ ist kokett, politisch engagiert, dem fanatisch katholisch-nationalistischen ‚polnischen Geistlichen’ hörig.[141] Die Stimmen der Autoren, die sich um ein redliches Polenbild bemühten, wie etwa Heinrich Manns, Erich Weinerts und Alfred Döblins, werden nach 1933 nicht mehr wahrgenommen.
4.3. Deutsches Polenbild nach 1945
Nach 1945 kam eine neue Konnotation dazu: ‚Schauplatz Polen’ als Ort des größten Verbrechen der Neuzeit. Im kollektiven Erinnern findet eine spontane Identifikation der Ereignisse mit den Orten statt, die durch das Bild Polens als eines traditionell antisemitischen Landes begünstigt wird. In der Holocaust-Literatur dient Polen oft als Codewort für die Angst und Vernichtung, auch weil für die Darstellung von Auschwitz kein Begriff gefunden werden kann.[142] Es ist ein mythisches Bild, in dem das Land Polen, wie es sich in den letzten sechzig Jahren entwickelte, nicht berücksichtigt wird.
Eine Auseinandersetzung mit dem Nachkriegspolen findet sich in Heinrich Bölls Reise nach Warschau von 1957 oder Hans Magnus Enzensbergers Polnische Zufälle von 1987. Bölls Erzähler relativiert und hinterfragt ständig die eigenen Erwartungen und vergleicht sie mit denen seiner Gesprächspartner, Enzensberger beschreibt die Erfahrung der kulturellen und alltäglichen Unterschiede, spricht eigene und polnische Vorurteile direkt an, übt sich in dem Perspektivwechsel, was ihn davor bewahrt, eigene Vorstellungen auf die andere Kultur zu projizieren.[143] Bei Günter Grass finden sich „Polens wildblühende[...] und dennoch immer wieder Früchte tragende Wirtschaft“[144] und der „Pan Kiehot [...] ein reingebürtiger Pole von traurig edler Gestalt“[145].
In Unterhaltungsromanen der deutschen Gegenwartsliteratur und in der deutschen Öffentlichkeit werden aber immer noch die Stereotype der ‚polnischen Wirtschaft’, des ‚edlen Polen’ und der ‚schönen Polin’ tradiert.[146] 1982 – angesichts der Solidarność-Bewegung und der Einführung des Kriegsrechts in Polen– reflektierte Wolf Biermann: „Es herrscht eine Stimmung des Hochmuts gegenüber den Polen, die es nicht besser verdient haben, die endlich arbeiten sollen.“[147] Andererseits wurde ‚polnische Wirtschaft’ nach 1945 auch als ein Bild einer Gesellschaft, die sich dem Leistungszwang nicht unterwirft, mit Lust und Genuss lebt, präsentiert.[148] Peter R. Frank stellt eine gewagte These auf: In dem Wechsel des deutschen Polenbildes sieht er ein Symptom des Zustandes der deutschen Gesellschaft, wenn ein feindliches Polenbild überhand gewinnt, dann „gerät Deutschland auf eine fragwürdige Bahn“[149].
4.4. Das Polenbild in der deutsch-jüdischen Literatur
Die Zeit der Aufklärung markiert die Entstehung der ersten literarischen Werke jüdischer Autoren in der deutschen Sprache. Diese Texte tradieren nicht nur die in der deutschen Literatur vorkommenden stereotypen Bilder Polens, sondern beschäftigen sich auch mit den spezifischen Problemen der deutsch-jüdisch-polnischen Beziehungen und mit der Situation der Juden, die oft zwischen Deutschen und Polen standen. Heinrich Heine, Leopold Kompert, Aron Bernstein, Joseph Roth, Alfred Döblin und viele andere setzten sich mit diesen Problemen auseinander. Seit Ende des 18. Jahrhunderts werden vor allem zwei Themen angesprochen: die Einstellung der Polen den Juden gegenüber und die Eigenart der polnischen Juden. Die Beurteilung der polnischen Juden – oft mit Ostjuden gleichgesetzt – war vor allem vom Eigenbild des Verfassers als Westjude, also von der Bewertung der Assimilationstendenzen der reformierten Gemeinden in Deutschland abhängig.
Bevor aber Westjuden in ihren Werken über Ostjuden schrieben, veröffentlichte 1772 Isachar Falkensohn Behr seine Gedichte von einem polhnischen Juden.[150] Mit dem Bewusstsein eigener Fremdheit schriebt er in der Vorrede:
Erregen nicht die Worte: pohlnischer Jude, in der Seele das Bild eines Mannes, schwartzvermummt, das Gesicht verwachsen, die Blicke finster, und rauh die Stimme? Wird die angewöhnte misverstandene Frömmigkeit einiger zärtlicher Leserinnen, das Bild nicht gräßlicher malen, als es meine armen Landesleute wirklich sind?[151]
Falkensohn Behr verdeutlicht den imaginären Charakter dieser Vorurteile, indem er in einem Gedicht schreibt: „Ihr müsst mich sehn,/Ich bin nicht wild,/vielleicht gar schön!“[152]
Eins der ersten von einem deutschen Juden gezeichneten Bilder seiner polnischen Glaubensbrüder stammt von Heinrich Heine, in dessen Schriften „schon fast das ganze Spektrum der möglichen Nuancen, Facetten und Auswüchse des Ostjudenbildes bis in unsere Gegenwart“[153] zu finden ist. Heine zeichnet ein vielschichtiges Bild:
Das Aeußere des polnischen Juden ist schrecklich. [...] Dennoch wurde der Ekel bald verdrängt von Mitleid, nachdem ich den Zustand dieser Menschen näher betrachtete, und die schweinestallartigen Löcher sah, worin sie wohnen, mauscheln, beten, schachern und – elend sind. Ihre Sprache ist ein mit Hebräisch durchwirktes, und mit Polnisch façonnirtes Deutsch. Sie sind in sehr frühen Zeiten wegen Religions-Verfolgung aus Deutschland nach Polen eingewandert; denn die Polen haben sich in solchen Fällen immer durch Toleranz ausgezeichnet. [...] Aber sie sind offenbar mit der europäischen Cultur nicht fortgeschritten und ihre Geisteswelt versumpfte zu einem unerquicklichen Aberglauben, den eine spitzfindige Scholastik in tausenderley wunderliche Formen hinein quetscht. Dennoch, trotz der barbarischen Ideen, die denselben füllen, schätze ich den polnischen Juden weit höher als so manchen deutschen Juden, der seinen Bolivar auf dem Kopf, und seinen Jean Paul im Kopfe trägt. In der schroffen Abgeschlossenheit wurde der Charakter des polnischen Juden ein Ganzes; durch das einatmen toleranter Luft bekam dieser Charakter den Stempel der Freyheit.[154]
Anders beurteilt Heine die polnischen und deutschen Juden in seinem Buch Ludwig Börne. Eine Denkschrift. Einer Kritik der Berliner assimilierten Juden folgt diese Feststellung:
Widerwärtiger war mir noch der Anblick von schmutzigen Bartjuden, die aus ihren polnischen Kloaken kamen, von der Bekehrungsgesellschaft in Berlin für den Himmel angeworben wurden, und in ihrem mundfaulen Dialekte das Christentum predigten und so entsetzlich dabey stanken. Es wäre jedenfalls wünschenswert, wenn man dergleichen polnisches Läusevolk nicht mit gewöhnlichem Wasser, sondern mit Eau-de-Cologne taufen ließe.[155]
Polnische Juden sind für Heine ein Beispiel der armen, aber freien und traditionstreuen Juden; sobald sie aber ihr östliches Schtetle verlassen und sich in einen Westjuden verwandeln wollen, sind sie nur noch schmutzig, arm und unselbständig.
In der Ghettoliteratur des 19. Jahrhunderts wird ein Bild der rückständigen, sich von ihrem Umfeld isolierenden Ostjuden gezeichnet, die die junge Generation in ihrer Entwicklung und Emanzipation behindern. Viele Romane beschreiben den beschwerlichen Weg der Jugendlichen, die nach Berlin, Wien oder Posen auswandern, um an der westlichen Kultur teilhaben zu können.[156] Es erscheinen aber auch Texte, die ein verklärtes, fast mythisches Bild der polnischen Juden als der Bewahrer des wahren Judentum zeichnen.[157]
Ein eindeutig negatives Bild der polnischen Juden präsentiert Martin Buber. Für ihn sind sie rückständig, wirklichkeitsfremd und sektiererisch. Arnold Zweig dagegen schreibt den Ostjuden viele positive Eigenschaften zu: Sie verachten das Geld, den Gewaltstaat, sind stolz und biedern sich den anderen Nationen nicht an.[158] Alfred Döblin betont, dass nur in Polen die echten Juden zu finden sind: „Es ist ein Volk. [...] Sie haben eigene Tracht, eigene Sprache, Religion, Gebräuche, ihr uraltes Nationalgefühl und Nationalbewusstsein.“[159] Er bemerkt aber auch die Armut, Zerlumptheit und den Aberglauben vieler Juden, vor allem in Zentralpolen.
Neben der Auseinandersetzung mit dem Ostjudentum ist auch die Stellung der Juden innerhalb der polnischen Gesellschaft ein wichtiges Thema für deutsch-jüdische Autoren. In einem der ersten Sprichwörterbücher aus dem Jahre 1837 wird folgendes Sprichwort zitiert: „Polen ist der Bauern Hölle, der Bürger Fegefeuer, der Fremden Goldgrube, der Edelleute Himmel, und der Juden Paradies“.[160] Heinrich Heine unterstreicht die Toleranz, die den Juden in Polen entgegengebracht wurde. Den Unterschied zwischen der rechtlichen Stellung und den alltäglichen Erfahrungen beschreibt der jüdische Gelehrte Salomon Maimon in seiner 1792 herausgegeben Lebensgeschichte. Er bemerkt, dass die Juden zwar einerseits religiöse und bürgerliche Freiheit samt eigener Gerichtsbarkeit genießen, andererseits aber von den Polen verabscheut werden.[161] Für die meisten der deutsch-jüdischen Autoren ist Polen jedoch nur das Land der Pogrome, der religiös, national und ökonomisch begründeten Judenfeindschaft. Die Polen kämpfen nur für ihre eigene Freiheit und unterdrücken dabei die der anderen.[162]
Aber auch Gegenmeinungen wurden geäußert. Eine der bedeutendsten jüdischen Kulturzeitschriften Ost und West . Illustrierte Monatsschrift für das gesamte Judentum veröffentlichte 1916 ein Feuilleton zum Thema der Lage der polnischen Juden. Darin wird festgehalten, dass die Juden sich zu sehr absondern und dass es nur „dem durchaus gutartigen, jeder religiöser und nationaler Verfolgung abgeneigten Naturell der Polen zuzuschreiben [ist]“, dass die Juden und Polen „mit einander trotzdem sechs oder acht Jahrhunderte sich viel besser vertrugen, als anderswo in der Welt“[163]. Ein ausdifferenziertes Bild der polnisch-jüdischen Beziehungen stellte Alfred Döblin dar. Während seiner Reise durch mehrere polnische Städte im Jahre 1924 setzte er sich mit verschiedenen Beispielen des Zusammen- und Gegeneinanderlebens der Polen und Juden auseinander, analysierte die Schwierigkeiten des neuentstandenen polnischen Staates und die Rolle der Minderheiten beim Aufbau der demokratischen Strukturen. Er beklagte, dass er vor seiner Reise kaum etwas über polnische Literatur und Kultur wusste. Sein Reisebericht bietet keine eindeutigen Zuordnungen, keine einfachen Lösungen und Verurteilungen, es ist ein Text, der vorhandene Stereotype dekonstruiert und die Entstehung neuer erschwert.[164]
Besonders oft wurden polnische Themen in Texten deutsch-jüdischer Autoren aus den Grenzregionen angesprochen. Als ein Beispiel kann der Roman Am Alten Markt zu Posen. Polenroman aus der deutschen Ostmark von Max Berg gesehen werden. In diesem Text, der zur viel gelesenen Trivialliteratur gehört, finden sich fast alle stereotypen Polenbilder wieder: Eine begabte, schüchterne Jüdin und eine sparsame, praktische Deutsche aus Posen haben als Freundin „die braune, hübsche Polin“[165] Jadwiga, in deren Elternhaus sie sich oft treffen, weil die gastfreundlichen, verschwenderischen Polen sie reichlich beköstigen. Jadwigas „slavische Sprechweise [scheint] das germanische Idiom vergewaltigt zu haben“[166], als ihre Pflicht als Polin sieht sie an, „die Männer zum Kampfe gegen die deutschen Hundeblute geistig anzuregen“[167]. Die Polen betätigen sich lieber bei der Flasche anstatt zu arbeiten; die Adligen, deren Besitzungen „durch ‚polnische Wirtschaft’ gänzlich verwahrlost“[168] sind; hängen „großpolnischen Traumgebilden“[169] nach, die Geistlichen nutzen den Aberglauben aus, hetzen gegen die Deutschen und rufen zu Unruhen auf. Die Juden versuchen zwischen den Polen und den Deutschen zu vermitteln, um jenen deutlich zu machen, dass sie von diesen „die Kultur des Geistes und des materiellen Besitzes“[170] erlernen können. Die Polen verharren aber in ihren antideutschen und antijüdischen Meinungen. Jadwigas Bruder, der gut aussehende, fleißige, edle Jan, der sich die deutsche Arbeitsmoral und Staatstreue zueigen macht, wird von seinen Landsleuten als Verräter angesehen und ermordet.
5. Deutsch-jüdische Gegenwartsliteratur
Nach 1945 meinten viele Kritiker und Wissenschaftler, in Deutschland werde niemals wieder eine lebendige jüdische Kultur – damit auch Literatur – entstehen. Entgegen dieser Einschätzung sind in den letzten dreißig Jahren viele literarische Texte von jungen Schriftstellern, die sich selbst als jüdische Autoren bezeichnen, publiziert worden. 1995 schrieb Maxim Biller, dass außer Israel Deutschland das einzige Land ist, wo „noch eine ganze Weile eine originäre, selbstbestimmte jüdische Literatur entstehen wird“[171]. Als Bezeichnung dieses Phänomens hat sich – trotz zahlreicher Fragen und Einwände – der Begriff ‚deutsch-jüdische Literatur’ als eine literatur- und kulturwissenschaftliche Beschreibungskategorie etabliert. Dabei ist man sich einig, dass die Zuordnung einzelner Schriftsteller zu diesem Bereich der deutschen Literatur nicht aufgrund ethnischer, religiöser oder sozialer Kriterien, sondern nur aufgrund der Selbstzuordnung der betreffenden Autoren erfolgen kann.[172]
Zur der Gegenwartsliteratur können Werke zweier Schriftstellergenerationen zugerechnet werden: Zu der ersten gehören die Ende der zwanziger und in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts geborenen Autoren, deren Kindheit durch die Shoah-Erfahrung geprägt war, und die in den Nachkriegsjahren debütierten, zu der zweiten zählt man die Nachgeborenen. Beiden Generationen ist das Bewusstsein einer Notwendigkeit der Neuorientierung, der Unmöglichkeit des Rückgriffs auf eine kontinuierliche literarische Tradition gemeinsam. Den Glauben ihrer Vorfahren an die Möglichkeit einer deutsch-jüdischen Symbiose lehnen sie ab[173] und beobachten die Gegenwart in Deutschland beziehungsweise Österreich, ohne die Shoah zu vergessen. Trotz der thematischen Nähe darf nicht vergessen werden, dass die Autoren keine einheitliche ästhetische oder politische Schule bilden.[174]
Die Autoren der ersten Generation müssen sich mit dem eigenen Trauma auseinandersetzen. In ihren fiktionalen Texten verarbeiten sie eigene Erlebnisse: die Verfolgung und Vernichtung ihrer Familien, die Zerstörung der Welt ihrer Kindheit. Ein bevorzugtes Genre dieser Generation ist die autobiographische Erinnerungsliteratur, obwohl es auch Versuche gibt, das autobiographische und dokumentarische Schreiben durch komplexere Schreibweise – Selbstironie, Groteske und Satire – zu durchbrechen. Trotzdem wurde vielen Texten von vornherein jeglicher Kunstcharakter abgesprochen, oder sie wurden ausschließlich als Zeitzeugnisse gelesen, ohne Berücksichtigung ihres ästhetischen Werts.[175] Gleichzeitig zu der Aufgabe, das Leid der Juden ästhetisch verfremdet darstellen zu wollen, stehen diese Autoren unter Rechtfertigungszwang, weil sie in der deutschen Sprache schreiben und teilweise in Deutschland leben. Die von Rafael Seligmann geprägte Formel vom ‚Wohn-(nicht Heimat)Land’[176] löst nicht, sondern verschärft dieses Dilemma, weil sie die Ambivalenz der Autoren noch verdeutlicht.
Von der deutschen Öffentlichkeit wurde nach 1945 die deutsch-jüdische Literatur als ein besonderer Bereich der deutschsprachigen Literatur kaum wahrgenommen, auch weil das Attribut ‚jüdisch’ in Bezug auf die in deutscher Sprache schreibenden Autoren aus falsch verstandener Rücksichtsnahme gemieden wurde. Zahlreiche Autoren wollten in der Öffentlichkeit nicht als jüdische Schriftsteller gesehen werden, weil sie den Anti- und Philosemitismus fürchteten.[177] Seit den siebziger Jahren wurde aber zunehmend die Bedeutung der jüdischen Herkunft der Autoren für die Deutung ihrer Werke bemerkt und diskutiert. Die Weigerung sie als jüdische Autoren zu benennen, wurde zunehmend als „eine Verweigerung der Identität“[178] wahrgenommen.
Die zweite Generation besteht aus Nachkommen der Shoah-Überlebenden oder der Exilanten, die zwar nach 1945 geboren wurden, aber – durch die geschichtlichen Überlieferungen und Erzählungen der Angehörigen – von der Shoah geprägt wurden. Thomas Nolden bezeichnet die Schreibstrategie dieser Autoren als konzentrisches Schreiben, als ein Schreiben, das ein nicht-gelingen-wollender Annährungsversuch sowohl an die nichtjüdische Mehrheit als auch an die unbegreifliche Geschichte der eigenen Vorfahren ist.[179] Dieses Schreiben ist eine Reaktion auf die Assimilationsbestrebungen vorheriger Generationen, und ein Versuch eine eigene nicht von außen zugetragene Identität zu finden. Die junge deutsch-jüdische Literatur steht also in einem Spannungsverhältnis sowohl zur jüdischen Tradition als auch zur gesellschaftlichen Mehrheit, sie ist charakterisiert durch die Suche nach einer neuen jüdischen Identität im heutigen Deutschland beziehungsweise Österreich. Konflikte mit der Generation der Überlebenden, Versuche deren Sprachlosigkeit zu überwinden, die Motive für ihres Verbleiben oder ihre Ansiedlung im Nachkriegsdeutschland zu verstehen, die Frage nach der Möglichkeit des jüdischen Lebens in Deutschland, aber auch die Aufklärung der nichtjüdischen Zeitgenossen gehören zu den wichtigsten Themen der gegenwärtigen deutsch-jüdischen Literatur. Dabei kann das Verhältnis zu den eigenen Eltern und deren Generation zwischen zwei Extremen oszillieren: zwischen Identifikation – ihres Leids wegen – und eindeutiger Ablehnung, wegen der angenommenen Anbiederung an die Mehrheitsgesellschaft.[180] Zusätzlich werden die Autoren mit der Erwartung der Vertreter der jüdischen Gemeinden konfrontiert, „angesichts der Abwesenheit eines religiösen und nationalen jüdischen Rahmens [...] eine deshalb rein intellektuelle jüdische Kultur“[181] in Deutschland zu stiften. Diese Forderung zwingt die Autoren eine literarische Kompensationsleistung zu vollbringen, die – dadurch, dass sie als Sprecher eines Kollektivs auftreten sollen – eine eigene schriftstellerische Entfaltung hemmen kann.
Die in deutscher Sprache verfassten Texte der jüdischen Autoren werden vor allem im deutschsprachigen Raum publiziert, werden also hauptsächlich von nicht-jüdischen Lesern rezipiert. Das Bewusstsein, ein Mitglied und ein Außenstehender der Gesellschaft gleichzeitig zu sein, begünstigt und fördert eine engagierte, aufklärerische Position den Lesern gegenüber.[182] Die Auseinandersetzungen mit Deutschland und den Deutschen werden meistens sehr intensiv, leidenschaftlich und tiefgreifend geführt. Durch den Rückgriff auf direkte Erfahrungen und kritische Beobachtungen bleibt sie von den stereotypen Mustern weitgehend frei. In der deutsch-jüdischen Literatur werden nicht-jüdische Figuren als komplexe Charaktere gezeichnet, die als gleichwertige Gesprächspartner gesehen werden.[183] Die Differenziertheit des Deutschlandbildes wird auch dadurch begünstigt, dass die Autoren viele Orientierungs- und Bezugspunkte haben: Sie sind in Deutschland, aber auch in Israel, den USA, Russland, Polen oder Tschechien geboren und leben in verschiedenen Staaten, so dass „die für Durchschnittdeutsche und –österreicher noch ausstehende emotionale Integration eines in der Verschmelzung begriffenen Europas oder einer übernationalen Weltkultur [...] bei diesen Schriftstellern, wie bei den meisten anderen jüdischen Autoren der Post-Shoah-Generation bereits vollzogen [ist]“[184]. Dieses Selbstverständnis ist ein Gegensatz zu deutschen Autoren, die das Fremde entweder politisch motiviert beschreiben, wie es vor allem im Kontext der 68er Bewegung geschah, oder als Ort der Sehnsüchte, der Exotik und Erotik wählen.[185] Amy Colin fasst zusammen:
Gerade aufgrund der von Ausgrenzung und Vertreibung markierten Geschichte ihres Volkes und der Shoah sind deutsch-jüdische Autoren prädestiniert, über die Notwendigkeit der wechselseitigen Anerkennung in der öffentlichen und privaten Sphäre zu schreiben, das Verständnis für den anderen, den Fremden, den politischen Flüchtling zu wecken. Gerade weil sie Opfer von Völkerhaß oder Nachfahren verfolgter Juden sind, fühlen sich deutsch-jüdische Autoren berufen, jüngere Generationen vor den Folgen von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu warnen. Aufgrund ihrer Lebensgeschichten, ihrer divergenten Erfahrungen in verschiedenen Ländern, aber auch ihrer so unterschiedlichen Auffassungen des Judentums wie des Deutschtums leisten diese Autoren zugleich einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung zwischen verschiedensprachigen Völkern, bauen Brücken zwischen heterogenen Kulturen sowie zwischen den unterschiedlichen Denkrichtungen im Judentum selbst.[186]
Damit ist auch der Anspruch formuliert, den die deutsch-jüdische Gegenwartsliteratur an sich selbst stellt. Dieser unterscheidet die deutsch-jüdische Literatur von der übrigen deutschen Gegenwartsliteratur: Während die die Nachkriegsjahre prägende Generation angesichts der Wende des Jahres 1989 Abschied nimmt, und junge Autoren ihre Bücher im Zeichen der herrschenden Massenkultur und Verlagspolitik verfassen,[187] suchen deutsch-jüdische Autoren nach Möglichkeiten der gesellschaftlichen Einflussnahme, indem ihr Schreiben „die diskursiven Praktiken der Mehrheitskultur diskursiv destabilisiert“[188].
6. Untersuchungsmethode
In dieser Arbeit soll untersucht werden, welche Funktionen die Darstellungen Polens und polnischer Figuren in den Werken deutsch-jüdischer Gegenwartsautoren erfüllen. Ob sie dem Verständnis der fremden Kultur dienen oder ideologisch missbraucht werden; inwieweit sie der kreativen, die Klischees durchbrechenden Einbildungskraft des jeweiligen Autors zugeordnet werden können und in welchem Maße den stereotypen, vorgeprägten Wahrnehmungsmustern der deutschen Kultur, also dem kulturell Imaginären entsprechen.
Einzelne Texte der jeweiligen Autoren werden in der chronologischen Abfolge untersucht. Erst nach den Einzelanalysen werden thematische Gemeinsamkeiten der Texte und der Autoren aufgezeichnet. Diese Methode soll verhindern, dass die Texte von Anbeginn an einem vorgegebenen – aber nicht notwendigerweise zutreffenden – Muster untergeordnet werden.
Bei der Analyse der einzelnen Texte werden der historische und politische Kontext ihrer Entstehung wie auch die beschriebenen Ereignisse berücksichtigt, vor allem wenn in den fiktionalen Werken historische Fakten und Personen vorkommen. Die inhaltliche Analyse wird sich auf folgende Fragen konzentrieren: Ist die Fremdheit den gängigen Stereotypen entsprechend eingesetzt oder durchbricht sie die Erwartungen der Leser? Ist sie in nationalen oder in sozialen, politischen und psychologischen Unterschieden verankert? Wird sie erklärt oder nur festgestellt? Wird sie implizit oder explizit dargestellt? Sind die fremdnationalen Figuren konstante oder sich verändernde Personen? Sind sie eindimensional oder vielseitig charakterisiert? Ist ihr Auftreten in der textimmanenten Logik begründet oder haben sie keine textbezogene Funktion? Kommen sie einzeln vor oder in einer Konstellation mit weiteren Fremden? Haben sie Eigennamen oder werden sie nur durch Nationszuschreibungen benannt? Gibt es nur einen oder mehrere Vertreter dieser Nation? Wird die fremde Nationalität direkt genannt oder ist sie aus dem Kontext ablesbar? Auch formelle Aspekte sollen berücksichtigt werden: Soll das Fremde den Rezipienten näher gebracht werden oder lediglich als Kontrast zum Eigenbild dienen? Handelt es sich um Haupt-, Neben- oder Randfiguren? Aus welcher Erzählperspektive werden sie beschrieben, in der direkten, indirekten oder erlebten Rede? Von welchen Figuren und mit welchen Sprachmitteln?
Die Autorin dieser Arbeit hält die These der Komparatisten über die Nicht-Existenz nationaler Eigenschaften für eine durch politisches Denken bedingte, aber nicht zutreffende Aussage, weil Geschichte, Traditionen, Sprache, Sitten und Gebräuche auch mentale Eigenschaften und Verhaltensweisen in bestimmten Gruppen zu bestimmten Zeiten begünstigen, so dass sie häufig vorkommen. Da diese in der Kultur tradierten Wahrnehmungsmuster leider als zeitlos gültig erscheinen, gehört es zur Aufgabe der Literaturwissenschaft, ihren historischen Entstehungsrahmen aufzuzeigen. Deshalb ist es zulässig, die Darstellungen der fremden Nationen nicht nur in ihrer Funktion zu beschreiben, sondern auch ihre Aktualität und Realitätsnähe zu werten.
7. Textauswahl
Gegenstand der Analyse der folgenden Untersuchung sind Prosatexte deutsch-jüdische Autoren, die zwischen 1974 und 2004 erschienen sind. Die meisten Werke der ausgewählten Texte wurden in den achtziger und neunziger Jahren veröffentlicht. Entscheidendes Kriterium für die Aufnahme eines Textes in den Korpus der zu untersuchenden Primärliteratur ist das Vorkommen Elemente eines Polenbildes. Nicht berücksichtigt werden autobiographische Texte, die keinerlei literarischen Charakter haben. Der ästhetische Wert der Werke allein, ist allerdings kein relevantes Kriterium, weil für eine imagologische Untersuchung die Rezeption der Texte besonders wichtig ist: Ein Unterhaltungsroman mit mehreren Auflagen kann größere Bedeutung für die Verbreitung eines Fremdenbildes haben, als ein von den Kritikern hoch geschätztes, aber kaum gelesenes Werk.
In dieser Arbeit werden nur Prosatexte analysiert, weil sie am besten geeignet sind komplexe Bilder darzustellen und weil Romane und Erzählungen, in denen die Beschreibung der inneren Konflikte einer Person am differenziertesten dargestellt werden können, die bevorzugten Gattungen der deutsch-jüdischen Gegenwartsliteratur sind.[189]
Neben literarischen Werken werden auch einzelne nichtfiktionale Texte der jeweiligen Autoren – soweit sie für das Thema von Relevanz sind – berücksichtigt. Sie können die gewonnenen Erkenntnisse bestätigen oder in einem anderen Licht erscheinen lassen. Da das Ziel dieser Arbeit nicht nur die funktionale Beschreibung, sondern auch ein Versuch einer Wertung ist, sind essayistische und publizistische Texte von großer Bedeutung, weil sie – als die in der Öffentlichkeit präsentierten Meinungen der Autoren – eine interessante Vergleichmöglichkeit für Ergebnisse einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung der fiktionalen Texte sind.
8. Einzelanalysen
8.1. Die erste Generation
8.1.1. Jeannette Lander
Die 1931 in New York geborene Tochter jüdisch-polnischer Einwanderer lebt seit 1960 als freie Schriftstellerin und Publizistin in Berlin. Mit mehreren Romanen, die sich mit der Suche nach einer jüdischen Identität von Frauen beschäftigen, machte die Autorin auf sich aufmerksam. Ihre Figuren versuchen sich in den vielschichtigen Strukturen der deutschen oder der amerikanischen Gesellschaft, die eine eindeutige Zuschreibung von Opfer- und Täterrollen unmöglich machen, zurecht zu finden: als Jüdinnen, als Frauen sind sie oft Opfer, als Mitglieder des Mittelstandes sind sie selbst Unterdrücker.[190]
In ihrem 1976 erschienen Roman Die Töchter schildert Lander eine Reise dreier Schwestern, die nach Spuren ihres 1941 aus Vichy-Frankreich nach Polen zurückgegangenen Vaters suchen, und dabei sich selbst zu finden hoffen.
Julie ist mit einem Deutschen verheiratet, den sie während des Krieges kennen lernte und nach seiner Desertierung versteckte. In Berlin, wohin beide nach dem Krieg gezogen sind, fühlt sich Julie fremd und unverstanden. Sie hofft sich selbst zu finden, indem sie den letzten Weg ihres Vaters nachgeht. Sie erinnert sich seiner nostalgischen Worte: „As ich bin gewe’en kleen, hob ich gewoint in Poilen. Es is a scheene Land...“ (S. 179)[191]. Sie entschließt sich nach Polen zu fahren. Auf die Frage ihrer Tochter Katinka, ob es ihr besser gehe, antwortet sie:„ ‚Ja. Ich glaube ich bin – auf dem Wege.’ Katinka lacht: ‚Auf dem Wege nach Polen.’“(S. 51) Julie bittet ihre Schwestern Minouche und Hélène mitzukommen.
Minouche ist nach dem Krieg in die USA ausgewandert, sie hat dort geheiratet, Kinder geboren. Sie führt nun das bequeme, aber leere Leben der Mittelklasse. Als sie die erbärmlichen Lebensbedingungen und die Polizeigewalt in einem Schwarzen-Ghetto wahrnimmt, gerät sie in eine Krise. Deshalb entscheidet sie sich mit ihrer Schwester nach Polen zu fahren und spricht darüber mit ihrem Ehemann Mike:
„Ich fahre nach Polen, Mike.“
„Was?“
„Ich fahre nach Polen.“
„Da kriegst du mich nicht hin. Bist wohl total – Aber nicht Mike Siegal, nicht ich!“
„Ich weiß.“ (S. 123)
Hélène lebt in Israel. Als sie von Julies Reiseplänen hört, kann sie keinen Sinn darin erkennen:
Was willst du nach Polen? Nach Israel! Hierher! Hier werden wir wandern. Hier werden wir uns erkennen. Du brauchst nicht Spuren der Vergangenheit zu suchen. Wir tragen unsere Geschichte gegenwärtig! Der Rest ist Sand.
Ich will nicht nach Europa zurück. Auch nicht auf einer Reise. Auch nicht um dich zu sehen, Julie, dich und Minouche. Ach, wie will ich euch sehen – aber Polen – ist eng, schwarz, übel, beängstigend. Ich könnte in Polen nicht atmen, nicht gehen. (S. 127)
Nachdem ihre Wohnung jedoch von der Polizei durchsucht wurde, weil ihr Sohn mit arabischen Jugendlichen gesehen worden war und unter Verdach steht, arabische Sender gehört zu haben, gerät auch ihre neue israelische Identität ins Wanken. Sie beobachtet aufmerksam ihre aus Europa stammenden Bekannten:
Verpflanzte. Ihnen stirbt die Wurzel ab. [...]
Verpflanzte wie papa. Warum soll er sonst wieder zurückgegangen sein? Müssen wir nach Polen fahren, um das herauszufinden? Er ist gegangen! Genug davon.
Unrast. Die alte Unrast. Heimweh. Fernweh. In der Ferne ist Heem, immer in der Ferne ist vielleicht Heem. Heimat. Ehe man fortfährt, ist sie noch vor einem, wenn man ankommt, hat man sie hinter sich gelassen. (S. 142)
Sie entscheidet sich doch nach Polen zu fahren und ihren Sohn Benjamin mitzunehmen.
Die drei Schwestern wollen sich in Warschau treffen, fahren aber dorthin auf verschiedenen Wegen. Julie fährt über Breslau, Posen und Lodz, weil ihr Ehemann die ehemaligen deutschen Städte besuchen möchte. Im Zug begegnet ihr
[j]ener bleilächelnde Blick. Dieser Ausspuck-Laut. Jene Bleiblick-Frau macht bei ‚Jud’ diesen Ausspuck-Laut, den jene Deutschen bei diesen ‚Polacken’ machen, bei ‚Jud’ auch: darin ist man sich einig. (S. 175)
Sie glaubt die Gedanken der Polen mitzuhören:
Was wollt ihr denn wieder? Der Tochter ihr gestohlenes Erbe vorführen? Die Jugend aufstacheln gegen uns wie die Alten? (S. 174)
Es sind aber nicht Worte der Polen, sondern Julies eigene Einschätzung deren möglichen Reaktion auf die Einstellung ihres Mannes. Denn als er von seiner Tochter des Revisionismus bezichtigt wird, weil er sich über die Rückständigkeit der polnischen Landwirtschaft empört, beschuldigt er „die Pfaffen“ (S. 175) dem Fortschritt in Polen entgegenzuwirken. Während Julie in Posen überlegt, die Stadt sei „nicht mehr Deutschland, noch nicht Polen. Polen war schon immer noch nicht Polen. Noch ist Polen nicht gefunden“ (S. 179), bemerkt ihr Mann, die Stadt wirke nicht polnisch, worauf sie nur fragt: „Was stellt man sich unter ‚polnisch’ vor?“ (S. 181)
Als sie in Breslau auf einen Markt gehen, ruft ein zufällig gehörtes Wort ‚Smietana’ Erinnerungen an Worte ihres Vaters hervor:
„A Schälele Smietana a poilnische! Un awade mit Jagdes mit frischen! Aseleche Jagdes sennen nicht oif der Welt wie in Poilen die Jagdes!“
„Mmmm: Smietana mit Jagdes “ [Sahne mit Blaubeeren], sagt Julie, [...] und Julie ißt Smietana mit Jagdes auf dem Markt in der Markthalle in Wrocław in papas Poilen. Da kommt Julie in Polen an. Nun ist sie da in dem Land der Papaerzählungen, nun ist sie da. (S. 187)
Minouche fährt direkt nach Warschau. Während der Zugfahrt beobachtet sie ein junges Mädchen mit rot lackierten Nägeln, die Kleider aus einer Modezeitschrift nachzeichnet und verschönert. Das Mädchen erinnert sie an ihre französische Mutter und macht ihr den Kontrast zu amerikanischen Frauen, die sie als fantasie- und geschmacklos wahrnimmt, deutlich. In der polnischen Hauptstadt angekommen, geht sie ziellos durch die Straßen, beobachtet Menschen und Geschäfte, findet nichts, das ihre Wahrnehmungen zu einem Ganzen verbindet. In einem Andenkenladen sieht sie einen afrikanischen Speer und denkt: „Ganz hübsch, nur nicht polnisch. Was ist denn polnisch? Was stellt man sich unter ‚polnisch’ vor?“ (S. 184)
Hélène fährt mit Benjamin von Wien über Krakau zuerst nach Izbica, dem Geburtsort ihres Vaters. Die Ortschaft liegt in Ostpolen und Hélène will, dass Benjamin „wenigstens einen dieser Schreckensorte [erlebt], damit er verinnerlicht, warum Israel ist“ (S. 176). Sie fahren durch das „junigrüne Land“ (S. 173): sie starrt aus dem Fenster, um die „Leute mit Krätze an den Händen, mit roten Hälsen“ (S. 177) nicht zu sehen, Benjamin aber „nimmt Blicke auf, erwidert Blicke“ (S. 173). Ihnen gegenüber sitzt eine sehr junge Mutter mit ihrem Kind. Hélène bemerkt ihr zu hoch rutschendes Kleid, den zu tiefen Ausschnitt. Benjamin ist von der Zuneigung der jungen Mutter ihrem Kind gegenüber angetan, er lächelt sie an und wird von ihr mit Gesten aufgefordert von ihren Vorräten mitzuessen. Hélène ist sprachlos.
Schlampen und Besoffene. Benjamin isst treefenes Fleisch. Dreck. Ruß. Wo man hinfasst. Aus dem Elend nie heraus. Enge, Elend, Armut, Dreck und Trunk und Kinder. Europa, ich hasse dich, ich lasse dich wieder, bald, bald, bald... (S. 179)
In Izbica hilft ihnen ein französisch sprechender Pole ein Essen zu bestellen:
„Können Sie uns etwas Fleischloses empfehlen“, fragt Benjamin. „Sind Sie Vegetarier?“
„Nein“, sagt Benjamin, „Juden.“
Bei dem Wort atmet Hélène Alarm:
Nous sommes mortes! Nous sommes mortes!
Benjamin aber sagt selbstverständlich, gelassen, wir sind Juden. „Wir kommen aus Israel.“
„Ah, ich verstehe“, sagt der Mann.
„Dann: Piroggen. Sie sind gefüllt mit Kasche und Weißkäse. ‚Kasche’: ich weiß nicht auf französisch ‚Kasche’.“
„’Kasche’ heißt es in Israel auch.“
„Ich finde gut: Israel“, sagt der Mann. (S.182)
In einem Dorf finden sie den ehemaligen Laden von Onkel Simche, den Hélènes Vater in seiner Kindheit oft besuchte. Alles sieht so aus, wie in seinen Erzählungen. Ihnen begegnen die gleichen trotz der Armut zufriedenen Menschen. Im Geschäft
atmet Hélène die Anspruchslosigkeit des kühlschattigen Dorfladens ein. Die Papa -Anspruchslosigkeit, sein eigentlich Nichts-Wollen, das maman verrückt machte. Hier ist es, sein Nichts-Wollen, sein So-Sein, das ihm genügte. Ihr eigener Laden in Haifa, weißgleißend, hell, kommt ihr voll in den Sinn. [...] Nichts verkauf ich da, was zum Leben notwendig wäre. (S. 190)
Auf der Straße werden sie angestarrt. Hélène empfindet die Blicke als feindselig, sie macht sich Vorwürfe:
[D]ie Idylle von gestern abend war Trug. Sie ist ärgerlich, daß sie Frieden empfinden konnte in diesem rückständigen Dorf, wo die Frauen Wasser schleppen wie Ochsen. Sogar Araber leben besser. (S. 202f.)
Benjamin entgegnet ihr, dass die Blicke bloß neugierig seien: „Fremde kommen wohl nicht oft bis hierher.“ (S. 203)
Nachdem die Schwestern sich in Warschau getroffen haben, fahren sie zusammen nach Zamość, um die Lieblingsstadt ihres Vaters zu besuchen. Sie finden die alten Stätten, vergleichen ihre Erfahrungen, streiten und erkennen, dass sie nur als Individuen eine Identität finden können. Hélène bleibt mit der an ihre Schwestern gerichteten Frage: „Womit wollt ihr Familie und Nation ersetzen?“ (S. 226) alleine.
In dem Roman Die Töchter stellt Jeannette Lander die Suche dreier Schwestern nach ihrem Vater, ihren Wurzeln, ihrer Identität dar. Diese Suche soll durch eine Reise in das Geburts- und Todesland des Vaters erleichtert werden. Das Land selbst dient als Katalysator für unterdrückte Gefühle, als Folie für eigene Wahrnehmungen, Denkweisen und Hoffnungen.
Minouches Ehemann, der amerikanische Jude Mike, will nicht nach Polen fahren, er ist nicht bereit seine negativen Klischees zu hinterfragen. Kurt - der deutsche Ehemann von Julie – will nur die verlorenen deutschen Gebiete besuchen, er ist in seinen stereotypen Wahrnehmungsmustern verhaftet. Alles, was er sieht, verbindet er mit ‚polnischer Wirtschaft’, ‚polnischer Rückständigkeit’ und ‚polnischen Pfaffen’. Die beiden Männer haben also ein ideologisch vorgeprägtes, starres Bild von Polen.
Die drei Schwestern dagegen fahren in das fremde Land mit verschiedenen Erwartungen und machen unterschiedliche Erfahrungen.
Für Julie ist Polen die magische Heimat ihres Vaters, das schöne Land von Blaubeeren mit Sahne, wo ihre utopischen Hoffnungen wahr werden sollen. Das noch nicht gefundene Land.
Minouche möchte vor allem ihre Schwestern sehen, ihrer Ehe, ihrem Leben in den Vereinigten Staaten entkommen. Sie beobachtet emotionslos die Menschen und hat nur eine diffuse Vorstellung von dem Land. Sie weiß nicht, was ‚polnisch’ ist, verbindet damit nichts Bestimmtes oder Bedeutendes.
Viel komplizierter ist die Wahrnehmung von Hélène. Polen bedeutet für sie die schreckliche Vergangenheit, die Angst vor Pogromen, aber auch die Fremdheit ihres Vaters. Polen ist – stellvertretend für ganz Europa – der Inbegriff des Leidens ihres Volkes. Polens Existenz ist eine Erklärung für die Notwendigkeit der Existenz von Israel, das im Gegensatz zur polnischen Enge, zur Dunkelheit, zum Dreck und zur Rückständigkeit hell, modern und sicher ist. Sie definiert ihre neue israelische Identität durch den Kontrast zu ihrer vorherigen europäischen, und versteht die in Israel lebenden alten Juden, die ihrer osteuropäischen Heimat nachtrauern, nicht. Ihre Ängste und Vorurteile verhindern eine Annäherung an zufällig getroffene Polen, bringen sie dazu, ihre Gesten und Blicke negativ zu interpretieren. Auch das „Juligrün“ kann sie nicht wahrnehmen. Der kurze Moment der Entspannung, als sie auf dem Wege durch die ostpolnischen Dörfer ihren Vater zu verstehen glaubt, als sie sein „Nichts-Wollen“ als einen Ausdruck der Zufriedenheit und Harmonie und nicht der Rückständigkeit und Ergeizlosigkeit sieht, wird schnell verdrängt. Die alten Vorurteile und Stereotypen lassen sie dieses Erlebnis umdeuten und nach Gegenbeispielen suchen.
Katinka und Benjamin, beide aus der Nachgeborenengeneration, fahren mit offenen Augen durch das unbekannte Land. Sie sind nicht vorbelastet, haben keine Vorstellungen, keine Vor-Urteile. Sie lassen sich von den Vorstellungen der Eltern nicht beeinflussen: Katinka wehrt sich gegen Bemerkungen ihres Vaters, Benjamin bleibt von den Ängsten und Meinungen seiner Mutter unberührt. Er ist, im Gegensatz zu ihr, den Polen gegenüber genauso offen, wie den Arabern in Israel.
Jeannette Lander zeichnet in ihrem Roman kein komplexes Polenbild. Sie ist an dem Land als solches nicht interessiert. Trotzdem gelingt es ihr, ein differenziertes, vielseitiges Spektrum der möglichen Wahrnehmungsmuster eines fremden Landes zu zeichnen. Ihre große Leistung liegt in der Konfrontation der verschiedenen Perspektiven, wodurch sie den subjektiven Charakter der Perzeption und die Fragwürdigkeit der vorgefundenen Urteilsmuster deutlich zeigt. Dadurch, dass ihre Protagonisten mit dem unbekannten Land konfrontiert werden, sich mit Fremden und Eigenen auseinander setzten müssen, zeigt Lander, dass die Identitätsfrage von jedem einzelnen nur individuell beantwortet werden kann, weil Familie oder Nation keine Grundlage für eine feste, authentische Selbstbeschreibung sein können.
8.1.2. Edgar Hilsenrath
Der 1926 in Leipzig geborene Edgar Hilsenrath verbrachte die Kriegsjahre in der Bukowina, zuerst bei seinen Großeltern, dann in einem Ghetto. Später lebte er in Israel, Frankreich und in den Vereinigten Staaten, bis er 1975, seines „Liebesverhältnis[ses] mit der Deutschen Sprache“[192] wegen, nach Berlin übersiedelte. Hilsenrath beschäftigt sich in seinen Romanen hauptsächlich mit dem Schicksal der deutschen und galizischen Juden. Dieses Hauptthema variiert er mithilfe verschiedener Formen des Erzählens: In Nacht verwendet er hypernaturalistische Erzählformen, in Der Nazi & der Friseur groteske, autobiographische in Bronskys Geständnis und in Die Abenteuer des Ruben Jablonski, in Jossel Wassermanns Heimkehr traditionelle jüdische Erzählform. Hilsenrath war einer der ersten Schriftsteller, der „den stillschweigenden ästhetischen Gesellschaftsvertrag in der Darstellung der Shoah in der Gattung des Roman aufkündigte[n]“[193].
Der 1977 erschienene Roman Der Nazi & der Friseur ist eine illusionslose Abrechnung mit dem deutschen Anti- und Philosemitismus. Mit groteskem, bitterbösem Humor wird aus dem Leben eines opportunistischen KZ-Aufsehers erzählt, der nach dem Krieg die Identität seines jüdischen Jugendfreundes annimmt. Hilsenrath setzt sich mit Vor- und Nachkriegsstereotypen auseinander. Er zeigt, dass der bundesrepublikanische Philosemitismus nur die Umkehrung des alten Antisemitismus ist. Er zeichnet auch ein differenziertes Bild Israels, wohin Max Schulz alias Itzig Finkelstein Ende der vierziger Jahre auswandert.
Während des Krieges dient Schulz in Polen in einer Einheit, die zuerst polnische Führungsschichten und danach Juden ermordet. Im Januar 1945 muss er sich vor näher rückenden sowjetischen Truppen verstecken. Er flieht in einen Wald:
„Wissen Sie, wie ein polnischer Wald im Januar aussieht?“ fragte Max Schulz[...]
„...eine fremde Landschaft mit einer kalten roten Sonne, finsteren Bäumen, von deren knorrigen Zweigen die Eiszapfen wie spitze Drachenzähne herabhingen... hängende Zähne, die die Erde anfletschen, als wollten sie die Erde aufspießen... und all das und noch mehr war eingedeckt mit einem weißen Leichentuch und mit seltsamen grauen Schleiern verwoben.“ (S. 98)[194]
In „dem verdammten polnischen Wald“ (S. 99) wohnt eine alte polnische Hexe, die Schulz zwar versteckt, aber missbraucht. Er versucht nicht zu entkommen, erduldet alles, weil er nirgendwo sonst bis zum Kriegsende warten kann. Die Bauern fürchtet er:
„Morgen wirst du alleine bleiben“, sagte die Alte. „Denn morgen geh ich ins Dorf. Hast du schon mal ein polnisches Dorf gesehen?“
Ich sagte: „Ja. Polnische Dörfer... die kenne ich zur Genüge.“ (S. 103)
Als er endlich nach Deutschland zurückkommt und sich als Itzig Finkelstein der Bestrafung zu entziehen versucht, muss er vor einer Prüfungskommission seine Jüdischkeit beweisen. Er erzählt von seiner Flucht aus einem Transport:
Wohin ich flüchtete? Wohin kann ein Jude in Polen flüchten? In den Wald natürlich. Ich traute den Polen nicht, denn das waren noch schlimmere Antisemiten als die deutschen Nazis. (S. 135)
Die Kommission schätzt seine Aussage als glaubwürdig ein.
In diesem Roman erscheint Polen als ein fremdes, dunkles, kaltes Land, mit einer unheimlichen, bedrohlichen Landschaft. Es ist der Schauplatz des grausamen Mordens, bewohnt von alten Hexen und primitiven, gewalttätigen, die Juden hassenden Bauern.
Der Ich-Erzähler in dem 1980 veröffentlichten Roman Bronskys Geständnis ist ein Mensch mit handfesten Problemen eines unbekannten und mittellosen Schriftstellers, vor allem aber, eines deutschen Schriftstellers jüdischer Abstammung in einem fremden Land, einem Land, das [er] nicht begreif[t] und das [ihn] nicht begreift. (S. 296)[195]
Er gehört zu den Emigranten, deren Familien „damals in Polen spurlos verschwunden [sind]“ (S. 56). Seiner amerikanischen Psychiaterin erzählt er von seinem Leben im Ghetto und von den Versuchen, für seine Familie Lebensmittel in den umliegenden Dörfern zu besorgen:
Ich versteckte mich im Feld. Dort fanden mich polnische Bauern. Die prügelten mich windelweich und nahmen mir das Geld weg. [...]
Nachts brach ich bei einem polnischen Bauern ein. [...] aber diesmal hatte ich Pech. Der Bauer wartete vor dem Hühnerstall mit einem großen Knüppel auf mich.
Ich wehrte mich verzweifelt, aber der Bauer war stärker als ich. Er schlug mich bewusstlos und ließ mich im Hof liegen.
Als ich erwachte, hörte ich schon von weitem die Stimmen der Soldaten und die Stimme des Bauern, der sie geholt hatte. (S. 277)
Auch wenn manche Bauern nicht brutal sind, helfen wollen sie einem Juden nicht:
Die Bauern steckten mir manchmal ein Stück Brot zu oder ließen mich von ihrer Suppe kosten, aber keiner gab mir ein paar Hühner oder einen Sack Mehl, obwohl ich ihnen erklärte, daß ich Lebensmittel brauchte, einen Wochenvorrat oder mehr, damit meine Mutter nicht hungerte. (S. 278)
Als er in das Ghetto zurückkommt, ist kein Jude mehr da, die Polen plündern die verlassenen Wohnungen aus, ohne sich um das Schicksal der abtransportierten Juden zu kümmern.
Hilsenrath zeichnet Bronskys Geständnis ein Bild der egoistischen, mitleidlosen, antisemitischen polnischen Bauern. Sie bereichern sich am Leid der Juden, indem sie sich ihr verlassenes Gut aneignen, wollen sie aber in ihrer Not nicht unterstützen. Der Leser erfährt nichts über die Lage der Bauern, beispielsweise, ob sie selbst genug Lebensmittel haben, um jemandem einen „Wochenvorrat“ abgeben zu können. Er gewinnt auch den Eindruck, dass die Bauern mit deutschen Soldaten eng zusammenarbeiten und von dem Krieg nicht betroffen sind. Weil der Ich-Erzähler die Bauern nur als „polnische Bauern“ benennt und verurteilt, ohne zusätzliche Informationen über deren Lage zu geben, lässt er ein Bild entstehen, das den historischen Fakten nur bedingt entspricht.
In Bronskys Geständnis werden auch die Vorurteile gegen Ostjuden aufgezeigt. Bronsky sucht in New York eine Unterkunft bei einer Dame, die nur in der deutsch-jüdischen Emigrantenzeitung annonciert, weil „sie kein Neger und auch kein Puertoricaner [liest]“ (S. 53). Sie hofft, dass der neue aus Deutschland stammende Mieter von der Nachbarschaft eines osteuropäischen Juden nicht abgestoßen wird, weil er zwar Ostjude ist, aber ein Philologe, der ein gutes Deutsch spricht. Die Vorurteile der Vermieterin wirken lächerlich, weil der ungeliebte Ostjude ein ruhiger Mieter mit einem guten Arbeitsplatz ist, und der deutsche Jude ein Nachtmensch ohne feste Anstellung, von der alten Frau aber sofort als der vornehmere Mieter angesehen wird.
Der 1983 erschienene Roman Zibulsky oder Antenne im Bauch gehört zu den schwächeren und weniger beachteten Werken Hilsenraths. Der Text ist eine groteske Zusammenstellung realistisch dargestellter Dialogszenen, die sich mit der bundesrepublikanischen Gegenwart auseinandersetzen. In einem der Dialoge bezeichnen zwei Gesprächpartner einen Journalisten als Lügner, weil er behauptet, dass der Bürgermeister während des Krieges bei Krakau an der Ermordung von Juden und polnischen Führungsschichten beteiligt war. In einem anderen Dialog sprechen zwei alte Männer auf einer Parkbank sitzend über ihre zukünftige Rückkehr nach Breslau:
„Früher oder später“, sagt der eine, „wird uns der Ami die Atombombe überlassen; dann scheißen die verdammten Polacken in die Hosen“ [...]
„Die Ostgebiete müssen wieder deutsch werden!“
„Was Recht ist, ist Recht“
„Jawohl.“ (S. 135)[196]
Ein Reisender sucht nach einer Damentoilette, weil die Herrentoilette außer Betrieb ist:
„Wenn ich mich nicht irre, ist das hier ein Bahnhof.“
„Natürlich ist das ein Bahnhof.“
„Ein deutscher Bahnhof?“
„Jawohl.“
„Haben sie schon einen deutschen Bahnhof gesehen mit einer nicht funktionierenden Herrentoilette?“
„Nein.“
„Dann ist das vielleicht kein deutscher Bahnhof?“
„Das ist möglich.“
„Vielleicht ein polnischer?“
„Wie meinen Sie das?“
„Weil mich das an polnische Zustände erinnert.“
„Wann waren Sie in Polen?“
„Während des Krieges.“
„Welchen Krieg meinen Sie?“
„Unseren Krieg.“
„Den Krieg für Führer und Vaterland?“
„Jawohl.“
„Und wie war das mit den öffentlichen Toiletten?“
„Damals in Polen?“
„Ja.“
„Es war eben so und so.“
„Wie denn?“
„Dort gab’s nur Toiletten für Untermenschen.“
„Und was habt ihr gemacht?“
„Sie meinen die Herrenmenschen?“
„Ja.“
„Wir bauten unsere eigenen.“
„Funktionierten die?“
„Selbstverständlich.“
In diesen knappen Dialogen spielt Hilsenrath mit den Vorurteilen seiner Figuren und seiner Leser. Nur unter der Voraussetzung, dass die Rezipienten die Stereotypen der ‚polnischen Wirtschaft’ und der ‚deutschen Ordnung’ kennen, können die satirischen und grotesken Mittel ihre angestrebte Wirkung zeigen und die Lächerlichkeit der Argumente der Sprecher enthüllen.
In dem 1993 veröffentlichten Roman Jossel Wassermanns Heimkehr erinnert sich ein alter Züricher Jude auf seinem Sterbebett an seinen Weg von einem Schtetle in Galizien bis in die moderne Welt Westeuropas. In diesem Schtetle möchte er begraben werden, der Sarg soll bis dorthin mit einem Wagen gefahren werden, weil „die polnische Eisenbahn [...] verdreckt und außerdem unzuverlässig [ist]“ (S. 54).[197] Währenddessen – es ist Herbst 1939 – müssen die Einwohner seines Geburtsortes, die er in seinem Testament begünstigen möchte, ihr Schtetle verlassen. Sie werden von den Nationalsozialisten in einen Waggon getrieben und abtransportiert.
Auf der ersten Seite des Romans wird der Gang der Juden zum Bahnhof von polnischen und ukrainischen Arbeitern beobachtet. Sie unterhalten sich über deren Schicksal:
„Ich hab neulich von Popen gehört, daß die Juden zur Zwangsarbeit fahren“, sagte einer der Ruthenen.
„Und ich hab auch was gehört“, sagte einer der Polen. „Aber was ganz anderes. Ich habe gehört, daß die Juden ins Feuer fahren.“
Die polnischen und ruthenischen Arbeiter redeten noch eine Weile, wie man eben so redet, über dies und das, zum Beispiel über die Häuser der Juden, die man ihnen versprochen hatte, sie redeten über Möbel und Federbetten und sonstiges Zeug, alles brauchbare Dinge, aber vor allem über die kostbaren Pelzmäntel. Denn es war sicher: Alles hatten die Juden nicht mitgenommen. Sie sprachen auch über Hacken und Schaufeln, die notwendig waren, um das vergrabene Gold und die Juwelen der Juden zu finden. (S. 9f.)
Die Polen und Ukrainer wissen, dass die Juden umgebracht werden, es interessiert sie aber nicht. Dem Schicksal der rechtmäßigen Besitzer gegenüber gleichgültig, unberührt von deren Leiden, freuen sie sich auf die Gegenstände und Kostbarkeiten, die sie zu finden hoffen, und die ihnen von den Nationalsozialisten als Belohnung für ihre Kooperation überlassen werden sollen.
Auf den letzten Seiten wird die Flucht eines deutschen Deserteurs durch das kalte Polen, wo „es sogar bei klarem Himmel schneit“ (S. 310), geschildert. Um nicht erkannt zu werden, trägt er einen jüdischen Kaftan. Als er von polnischen Hilfspolizisten gefangen genommen wird, gibt er seine Identität preis, was ihm das Leben rettet. Die Polen stellen fest:
„Wenn du Jude wärest“, sagte einer der Polen, „dann würden wir mit dir keine Faxen machen. Je mehr von diesem Pack umgelegt werden, um so besser.“ (S. 316)
Das Buch beginnt und endet mit einer Darstellung des polnischen Antisemitismus in der Zeit des Krieges. Jossel Wassermann erzählt aber auch von Zeiten, in denen Juden, Polen, Ukrainer, Ungarn und Deutsche friedlich zusammenlebten. Er erinnert an die Zeiten der Inquisition, als die Juden in ganz Europa nach einer neuen Heimat suchten:
Auch von Gottes Stimme könnte ich erzählen, die zu den flüchtenden Juden gesagt hatte: ‚ Po-lin ’! Hier sollst du ruhen! Hebräisch ist das. Aber die meisten Juden verstanden das falsch, weil viele nicht mehr richtig Hebräisch konnten. Und sie sagten sich: Po-lin ? Das klingt wie Polen. Also auf nach Polen. Und so zogen sie, die vorher keiner Himmelsrichtung mehr getraut hatten, in Richtung Osten. Und sie kamen nach Polen. Und dort ging es ihnen gut. (S. 85)
Obwohl der Gang nach Polen durch eine falsche Deutung der Worte Gottes entstand, brachte er beiden Seiten Vorteile: Die Juden belebten die Wirtschaft, und der König „wusste es den Juden zu lohnen“ (S. 86). Weiter erzählte Jossel Wassermann, wie der Judenhass in Polen entstand:
Die Juden zeugten viele Kinder und vermehrten sich. [...] Je mehr sie aber wurden, um so mehr kriegten die Polen Angst. In den kommenden Generationen ging es ihnen immer schlechter. Die Bauern waren neidisch, und sie haßten die Juden, weil die Juden ihre Ausbeuter vertraten, die Adligen und die Gutsherren, [...] Den Juden sah der Bauer täglich. Und er haßte seinen Bart und seine Schläfenlocken, [...], die Sprache der Juden, die er nicht verstand, [...] die Gesten der Juden [...]. Sie haßten vor allem den Sabbat [...] Und die Kirchenfürsten haßten die Juden, weil sie starsinnig waren und dem Holzgott nicht huldigten an ihren Kreuzen. Die Popen und Pfaffen predigten den Haß von der Kanzel. (S. 87f.)
Trotzdem aßen die Polen in der Schenke von Jossels Großeltern jahrlang ihre bevorzugten Kartoffeln und Bohnen, tranken zusammen mit Ukrainern und Rumänen Wodka, prügelten sich mit ihnen, waren „oft gute Nachbarn [...] und [machten] Geschäfte mit den Juden“ (S. 168). Die Situation veränderte sich, nachdem während des Ersten Weltkrieges die einzelnen Völker ihre Unabhängigkeit verlangten, und nur die Juden kaisertreu blieben. Jossel kämpft in der Armee.
Alle wollen sich von Österreich lösen, mit Ausnahme der Juden. Wir lieben den Kaiser und wir sind bereit, für ihn zu sterben. (S. 263)
Hilsenraths Erzähler zeichnet die Entwicklung der Einstellung der Polen den Juden gegenüber von der anfänglichen Toleranz im 15. Jahrhundert bis zum mörderischen Hass des 20. Jahrhunderts nach. Er sieht den Judenhass im Neid, in religiöser und kultureller Fremdheit und dem Streben der Polen nach einem unabhängigen Nationalstaat begründet.
Das Buch Die Abenteuer des Ruben Jablonski aus dem Jahr 1997 ist ein autobiographischer Roman, der das Leben eines jüdischen Jünglings schildert: Er wird 1944 aus einem ukrainischen Ghetto befreit, kommt auf abenteuerlichen Wegen nach Israel, um dort nach einer neuen Heimat zu suchen, scheitert, kehrt nach Europa zurück und wandert schließlich in die USA aus. Auf seinem Weg trifft er andere Juden, die ihm von ihren schrecklichen Erlebnissen erzählen. Ein Mann berichtet, wie er aus einem Todeszug sprang und fliehen konnte. Er überlebte im Wald versteckt, in die Dörfer ging er nicht, weil „die polnischen Bauern [...] die Juden [hassen]“ (S. 245).[198] Iwonna, ein Mädchen aus Warschau, in das Ruben verliebt ist, erzählt, wie sie nach der Flucht – der Kälte und des Hungers wegen – zu den Bauern ging:
[Sie] ging [...] in ein polnisches Dorf und bat einen Bauern um Hilfe. Der war ein wüster Antisemit und beschimpfte Iwonna und ihre jüdische Sippschaft. Er nahm sie aber vorübergehend in sein Haus auf. [...] Er schleppte Iwonna in die Holzkammer und vergewaltigte sie dort. Sie hatte Angst vor den Deutschen, dem Wald, dem Hunger und der Kälte. Deshalb ertrug sie alles. Der Bauer vergewaltigte sie tagtäglich, und er schlug sie mit der Pferdepeitsche. (S. 124f.)
Als das gepeinigte Mädchen zurück nach Warschau geht und sich dem Widerstand anschließt, wird sie wieder von den Polen verraten.
Oben erwarteten uns zwei Polen, die uns mit Waffen beliefern sollten. Es klappte auch alles. Wir nahmen die Waffen in Empfang und zahlten bar in Zlotys. Plötzlich wie aus dem Nichts tauchte polnische Miliz auf. Wir waren verraten worden. (S. 126)
Ruben und Iwonna treffen auf dem Weg von der Ukraine nach Rumänien ukrainische, ungarische und rumänische Bauern. Sie sind ausnahmslos freundlich und hilfsbereit. Mit einem ungarischen Bauern unterhalten sie sich über die Anständigkeit der Bulgaren, die trotz einer faschistischen Regierung „die Juden während des ganzen Krieges geschützt“ (S. 141) haben. Nur die polnischen Bauern hassen Juden, verraten und missbrauchen sie.
In allen Werken von Edgar Hilsenrath finden sich gleiche Elemente eines Polenbildes: Das Land ist kalt, dreckig, mit dunklen Wäldern bedeckt; die Polen sind primitiv und unzuverlässig, die Führungsschichten sind nicht existent, weil entweder umgebracht oder von vornherein nicht vorhanden, das einfache Volk, am Beispiel der Bauern dargestellt, ist antisemitisch, brutal, neidisch und nutzt die Notlage der Juden aus. Die fruchtbare gemeinsame Geschichte der Juden und Polen gehört endgültig der Vergangenheit an. Der Antisemitismus der Polen wird durch deren Xenophobie und den Einfluss der katholischen Kirche erklärt. Die Lage der Polen unter der deutschen Besatzung wird nicht thematisiert, so dass der Leser ihr Verhalten nicht in den äußeren Gegebenheiten, sondern in dauerhaften Einstellungen begründet sieht. Dieser Eindruck wird auch durch den Vergleich mit anderen osteuropäischen Bauern untermauert. Die polnischen Juden werden mit großer Sympathie gezeichnet, die Vorurteile ihnen gegenüber werden als grundlos entlarvt. Das Nachkriegspolen existiert im Bewusstsein der Figuren nur als Schauplatz des schrecklichsten Verbrechens. Nur in Zibulsky oder Antenne im Bauch wird das Polenbild der Deutschen thematisiert, indem ihre Vorurteile den Polen gegenüber durch eine groteske Überzeichnung verlacht werden. Dies soll aber nicht der Korrektur des deutschen Polenbildes dienen, sondern das Verdrängen der unbewältigten deutschen Vergangenheit unterstreichen.
8.1.3. André Kaminski
André Kaminski ist der einzige deutschsprachige Schriftsteller der Gegenwart, der in Polen gelebt hat. Er wurde 1923 in Genf geboren und verstarb 1991 in Zürich. Der Sohn polnischer Juden war, wie seine Eltern, ein Kommunist. In der Hoffnung eine neue Welt mitgestalten zu können, emigrierte der habilitierte Historiker 1950 nach Polen, machte dort Karriere als Fernsehregisseur und Journalist. Nach der antisemitischen Hetzkampagne des Jahres 1968 wanderte er zuerst nach Israel aus, um schließlich in die Schweiz zurückzukehren.
Kaminskis Bücher, die eher der populären Literatur zugerechnet werden, sind durch eigene Erfahrungen und durch die Geschichte seiner Familie inspiriert. Seine Bücher bezeichnete er in einem Interview als „Humoresken über [sein] eigenes Versagen“[199]. Die Auseinandersetzung mit Deutschland oder der Schweiz ist für ihn nebensächlich, Polen bleibt für ihn sein Leben lang ein ‚Faszinosum’.[200] Seine Prosa charakterisiert eine größere Versöhnlichkeit gegenüber den Deutschen als sie die meisten anderen Autoren der deutsch-jüdischen Literatur an den Tag legen, eine gewisse Distanz zur Shoah, insgesamt das Schreiben aus der Perspektive eines ‚Zaungastes’. Diese Merkmale werden von vielen Kritikern als typisch für die deutschsprachige schweizerisch-jüdische Literatur gesehen.
In der Erzählung Satan und der Fakir aus seinem ersten Erzählungsband Herzflattern. Neun wilde Geschichten, berichtet der Ich-Erzähler von seinen Erfahrungen als Jungkommunist. Bei einem internationalen Jugendtreffen in der Schweiz wird mit der Zahl der Opfer des Faschismus im eigenen Land geprahlt:
Als erster stieg ein Russe auf die Tribüne, denn er hatte 16 Millionen Tote anzumelden. [...] Dann kam der Chinese mit 8 Millionen Opfern, und er schämte sich, nur an zweiter Stelle zu stehen. Als dritter sprach ein Pole mit sechs Millionen Leichen, wobei er gleich ein paar Millionen Juden mitzählte, die er sonst nicht zum polnischen Volk zu rechnen pflegte. (S. 47)[201]
An dieser Stelle werden die Polen als den Juden gegenüber herablassend dargestellt. Sie sind nicht bereit, die Juden als gleichberechtigte Bürger zu akzeptieren, nutzen aber deren Leid zur Eigendarstellung.
Auf die Bestsellerliste kam der 1986 veröffentlichte Roman Nächstes Jahr in Jerusalem. In einem humorvollen, leichten Stil – der von den Kritikern entweder als brillant oder als trivial beurteilt wird[202] – erzählt Kaminski die fiktionalisierte Geschichte seiner Familie. Der Vater des Ich-Erzählers - Sohn eines Warschauer Kaufmanns – ist gleichzeitig Kommunist und polnischer Patriot. Er nimmt mit seinen Brüdern an der Revolution von 1905 teil, wird verhaftet und soll zusammen mit anderen Aufständischen, Polen und Juden, nach Sibirien verschickt werden. Er flieht, lebt in verschiedenen Ländern, bis er 1911 nach Wien kommt und seine zukünftige Frau Malwa kennen lernt.
Die Familie der Mutter des Ich-Erzählers stammt aus Galizien. Eines Tages wollte die spätere Großmutter des Ich-Erzählers einen Kutscher bestellen:
Jana ging zu Bojtschuk, dem Fuhrhalter hinter der Marienkirche, und fragte, ob er sie mit dem Schlitten zur Bistschitza bringen könnte.
„Können kann ich, prosche pani, aber ob ich will, weiß ich nicht.“[...]
„Wieviel, panie Bojtschuk?“
„Zwanzig Kreuzer die Maile, prosche pani, und für Juden dreißig.“
„Warum der Unterschied?“ fragte Jana empört.
„Wegen dem Herrn Jesus, prosche pani.“ (S. 23)[203]
Einige Jahre später will sie ihre Perlenkette gegen einen Diamanten tauschen. Sie geht zu einem polnischen Juwelier, der als ein „Lebemann und Frauenheld bekannt war“ (S. 64). Er macht ihr ein Angebot:
Wenn Sie abends noch einmal vorbeikommen möchten, würden wir die Frage in aller Muße besprechen. Bei einem Gläschen Likör, vous comprenez, und Kerzenlicht, wenn Sie nichts dagegen haben. Sie begreifen doch, ein reicher Mann und eine reizende Dame werden immer handelseinig. (S. 65)
Als ihre Tochter Altgriechisch lernen soll, macht sie Bekanntschaft mit dem Altphilologen und Sozialistenführer Daschynski. Er ist ein typischer Pole, stolz und impulsiv [...] Ein Pole, wie er im Buche steht. Aber dennoch ganz anders. Die Polen verachten uns und verpassen keine Gelegenheit, uns zu erniedrigen. Dabei sehen sie aus wie besoffene Frösche. Daschynski erniedrigt niemanden. (S. 109-112)
Noch vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges begeistert Daschynski die Massen mit seinen patriotischen Reden:
„Der Krieg der Monarchen wäre der letzt Krieg, der unseren Planeten erschüttert. Er wäre der Anbeginn einer Epoche des Friedens. Aus den Trümmern des letzten Krieges, Genossinnen und Genossen, würde auch unser Vaterland neu erstehen, unsere geliebte, polnische Heimat...“
Daschynski konnte nicht weiterreden. Alle Anwesenden, Frauen und Männer, standen auf ihren Stühlen und stimmten die Nationalhymne an:
„Jeszcze Polska nie zginęła
póki my zyjemy
Noch ist Polen nicht verloren
Denn wir kämpfen weiter...“ ( 117)
Mit seinen Ansprachen erobert er auch das Herz von Jana und ihrer Tochter Malwa.
Malwas Familie muss – wegen eines Streits mit den Korporationsstudenten – ihre Heimatstadt verlassen. Sie zieht nach Wien um, wo sie 1911 ein Zimmer an Henryk/Herschel Kaminski vermietet. Während des Ersten Weltkrieges fahren Malwa und Henryk, die inzwischen verheiratet sind, als Emissäre nach Polen um Antikriegsflugblätter zu verteilen. Malwa erzählt später, wie ein Kutscher sie über die grüne Grenze brachte. Er behauptete „ein typischer Pole [zu sein], der weder Tod noch Teufel fürchtet[...]“ (S. 313). Tatsächlich war er aber ein Trunkenbold. Dreckig und verlaust. [...] Eine Null war er und genauso bestechlich wie alle Polen. Für eine Flasche Alkohol kutschierte er uns durch die Minenfelder des deutsch-russischen Kampfgebietes. (S. 313)
Henryk, seiner Liebe zu Polen wegen, verklärt die Geschehnisse und denkt, der Kutscher sei ein etwas rauer Sozialist. Malwa als distanzierte Österreicherin sieht ihn als einen Maulhelden an und ist den Polen gegenüber grundsätzlich sehr misstrauisch, denn „für Schnaps gibt der Pole alles her“ (S. 314).
Die Ereignisse des Ersten Weltkrieges werden vom Ich-Erzähler kommentiert. Aus einem Brief des preußischen Generals Ludendorff zitiert er Folgendes: „Der Pole ist ein guter Soldat. [...] bilden wir doch ein Großfürstentum Polen [...] und dann eine polnische Armee unter deutscher Führung.“ (S. 301) Der Ich-Erzähler empört sich über das Ausnutzen der Polen:
Die Polacken, wie man sie freundlicherweise zu nennen pflegte, wurden zwangsgermanisiert oder zwangsrussifiziert, aber sieh da! Plötzlich richtete sich das zärtliche Auge des preußischen Heerführers auf Polen, denn – so geruhte er sich auszudrücken – der Pole ist ein guter Soldat. [...] Die deutsche Führung wusste zwar, daß die Polen gute Soldaten sind, vergaß aber, [...] daß sie nur unter ganz bestimmten Bedingungen Lust haben, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. In den vergangenen hundert Jahren hatten sie sechs Revolutionen gemacht. Sechsmal wurden sie zu Zehntausenden niedergeschossen, aufgehängt, an die Wand gestellt, aber nicht, weil sie Lust hatten zu sterben. Im Gegenteil. Weil sie Lust hatten zu leben, und zwar als Polen. Als freie Menschen in einem unabhängigen Vaterland. (S. 302f.)
Der Ich-Erzähler zeichnet das Bild eines freiheitsliebenden Polen, der dem Vormärz-Bild des ‚edlen Polen’ entspricht. Er deutet auch an, dass die spätere Unterstellung, die Polen kämpften, weil sie nichts anderes leisten könnten, nicht zutreffend ist. Sie kämpfen, um ein klar definiertes Ziel zu erreichen. Die deutsche Geringschätzung der Polen ist ungerecht und bezeugt die deutsche Überheblichkeit.
Nach dem Krieg will Henryk nach Polen übersiedeln, „wo das Elend noch bedrückender war als anderswo in Europa“ (S. 340), und helfen ein neues gerechteres Land aufzubauen. Er will zurück „zum Geburtshaus, zur Familie, zu den Freunden, zur Quelle seines Glücks“ (S. 340f.). Obwohl er gewarnt wird, dass er falschen Vorstellungen nachgeht, verlässt er die Schweiz, in der er miterweile mit Malwa lebt, und fährt nach Warschau. Im Zug unterhalten sich der Schaffner und ein Deutscher über die Polen und Juden. Der Schaffner behauptet: „Wenn die Polacken könnten, würden sie alle Juden totschlagen“ (S. 343), ein Pole bestätigt es, indem er sagt: „Wenn uns etwas zusammenhält, ist es der Haß gegen die Juden.“ (S. 343) Henryk reagiert auf diese Angriffe und wird deswegen von dem Polen als Jude und Kommunist beschimpft:
„Mit mir wirst du vielleicht fertig, koszerna swinio, du koschere Sau. Aber nimms doch mal mit uns allen auf!“
Henryks Stimme überschlug sich: „Mit uns allen, sagen Sie? Reden Sie in Namen des ganzen Zugabteils?“
„Jawohl. Ich rede im Namen von 30 Millionen Polen. Im Namen des ganzen katholischen Volkes, wenn du überhaupt weißt, was das ist.“ (S. 345)
Henryk kehrt in die Schweiz zurück und gibt seinen Traum vom Leben und Arbeiten in Polen auf.
In Nächstes Jahr in Jerusalem schreibt Kaminski über verschiedene Schichten der polnischen Gesellschaft und macht die Unterschiede zwischen ihnen deutlich. Die Intellektuellen sind stolz, gebildet, freiheitsliebend und patriotisch. Die Städter genießen das Leben, sind Angeber, Frauenhelden und Lebemänner. Die Bauern sind primitiv, geldgierig, von der katholischen Kirche indoktriniert, sie leben in Dreck und Elend, und für Alkohol tun sie alles. Unabhängig von der sozialen Schicht lehnen fast alle Polen Juden ab, vor allem als einen Teil der polnischen Gesellschaft ab. Die in Polen lebenden Juden dagegen sind polnische Patrioten und sehen Polen als ihre Heimat an. Der Kampf um Polens Freiheit kann Juden und Polen zwar verbinden, aber nicht zu einer echten Gemeinschaft zusammenwachsen lassen, weil der Antisemitismus – besonders nach den Jahren der Teilung und der unterschiedlichen Entwicklung der einzelnen Provinzen – der kleinste gemeinsame Nenner aller Polen ist.
Das 1988 veröffentlichte Buch Kiebitz spiegelt Kaminskis in Polen gemachten Erfahrungen. In der Form eines Briefromans werden die Ursachen der Sprachlosigkeit des Protagonisten ergründet. Er schreibt an seinen Psychiater über seine Jugend in der Schweiz, seine Entscheidung nach Polen zu gehen, sein dortiges Leben, seine Freundschaften, seine Karriere und schließlich über die antisemitische Kampagne, die ihn aus Polen vertrieb.
Anfang der fünfziger Jahre bricht der junge Protagonist mit seiner Frau auf, um in den „gelobte[n] Garten Gottes, wo Milch und Honig von den Bäumen tropfen“ (S. 14)[204] zu fahren. Er weiß noch nicht, dass es eine Reise „[z]um Ende der Welt [, z]um absoluten Nullpunkt“ (S. 14) sein wird.
Während der Zugfahrt begegnet er einer Frau, die später seine zweite Ehefrau sein wird:
Plötzlich gewahrte ich eine Erscheinung: Im Korridor, fünf Schritte von mir, stand eine – wie soll ich das nennen – Hexe oder Nymphe oder weiß der Kuckuck, was das war. Eine korallenfarbene Pfirsichblüte. Eine rotschöpfige Undine. Sie lehnte sich an die Verglasung, rauchte und wippte mit dem Fuß. (S. 28)
Diese Beschreibung erinnert an Heines ‚Weichselaphrodite’, die einer Lotosblüte ähnelt.
In Warschau bekommt er eine Stelle beim polnischen Fernsehen:
Die besten Schauspieler Polens kamen in unser Studio, herrliche Frauen und überirdische Männer, die hoch über dem Morast des Alltags zu stehen schienen. (S. 35)
Als er nach einer besonders gelungenen Theateraufführung von Nestroys Talisman einen Regisseur nach dem Ursprung der Ausdruckkraft eines Schauspielers fragt, antwortet der:
Er ist ein Pole – das ist alles. Er war – wie fast alle von uns – in der Hölle. [...] Wir sind ein Volk, das seit Jahrhunderten zu kurz kommt. Nicht nur jeder für sich, sondern alle miteinander. Wir sind Riesen und müssen die Rolle von Zwergen spielen. Man macht uns zu Unterhunden. Man zwingt uns, mit dem Schwanz zu wedeln. Dabei wollen wir beißen. (S. 220)
Der Regisseur beschreibt die Selbstwahrnehmung der Polen: Sie sehen sich selbst als ein verhindertes Volk. Sie arbeiten mit verschiedenen Tricks, die „zum polnischen Nationalsport [gehören], der darin besteht, ungeschoren die Paragraphen zu umgehen. [...] Wer schwindelte, beging eine patriotische Tat“ (S. 215), und „es gibt niemanden, der hier nicht schummelt. Betrug ist unser Existenzprinzip.“(S. 251) Sie gehen in die Kirche nicht um zu beten, sondern um gegen die Regierung zu demonstrieren: „Das Beten ist verboten. Also betet man.“ (S. 269)
Kiebitz findet schnell neue Freunde, einer von ihnen hat „eine dünne polnische Nase und kleine Äuglein“ (S. 110). Die Freundschaft wird durch „abgrundtiefe Besäufnisse“ gestärkt, die seine „Zugehörigkeit zu diesem Volk noch zementiert[en]“ (S. 216).
In seinen Sendungen berichtet er über verschiedene Gerichtsfälle und bietet den Zuschauern eine Möglichkeit, die Urteile zu kommentieren. In der ersten Sendung wird das Schicksal einer Frau erörtert. Sie hat ihren Mann, eine „Bestie“, einen „polnischen Durchschnittsdespoten, wovon es bei uns ein paar Millionen gibt“ (S. 183), mit dem sie „inmitten der Sümpfe von Masowien, wo es weder Licht gibt in den Elendshütten noch fließendes Wasser“ (S. 191), lebte, ermordet. Die Bauern unter den Zuschauern sind gegen die Frau eingestellt: „Wer sein Weib nicht schlägt, ist ein Schlappschwanz. Ohne Stock fällt die Familie auseinander und der Staat gleichfalls...“ (S. 192). Die Großstädter aber sind anderer Meinung: „Die Bäuerin ist gut. Sie zeigt uns, daß man sich wehren soll. Die kennt keine Angst mehr. Eine echte Polin wie in den guten Zeiten.“ (S. 196)
Kiebitz bewundert die Polen als ein Volk, das zielstrebig um eigene Freiheit kämpft:
Die Polen sind zwar ein Heldenvolk, aber Dummköpfe sind sie nicht: Sie schlagen sich bis zum letzten Blutstropfen, wenn sie auch nur eine Chance sehen, etwas zu erreichen; sie sterben, ohne mit der Wimper zu zucken, doch wollen sie wissen, ob sich der Blutzoll auch lohnt. (S. 174)
Eine andere Deutung der Widerstandsbereitschaft der Polen zeichnet einer seiner Freunde:
Wir leben in Polen. Wir sind eine Männergesellschaft, ein katholischer Turnverein. Was bei uns zählt ist der Vater. Alles dreht sich um den Patriarchen. Um den ojciec. Um seine Autorität, die wir vergöttern und verabscheuen. Bis zum Tode erheben wir uns gegen den Vater und bleiben pubertäre Jünglinge. Pfadfinder. Soldaten für irgendeine Rebellion gegen die Obrigkeit. (S. 228)
Einer der Freunde ist Sohn eines Deutschen, der seine Mutter während des Krieges vergewaltigt hatte. An seinem Beispiel erklären Kiebitz’ Freunde noch eine Absurdität des polnischen Ehrenkodex:
Sie war ohne Schuld. Aber die Polen sehen es anders. Ein Pole darf sich nicht schänden lassen, und schon gar nicht von seinem Todfeind. Sie hätte ihn töten, und wenn das nicht möglich war, hätte sie sich selber umbringen müssen. (S. 234)
Als der Sohn herausfand, dass die Mutter danach freiwillig bei dem Deutschen geblieben war, brachte er sie um und zeigte sich daraufhin selbst an. Dem Schweizer erzählt er:
„Der Wachtmeister schrieb alles auf. Pedantisch und sauber.“
„Und ohne mit der Wimper zu zucken, wenn ich recht verstehe?“
„Natürlich. Weil es eine polnische Geschichte ist.“ (S. 236)
Kibitz’ Freunde sind Gegner des kommunistischen Regimes, wodurch sein in der bürgerlichen Schweiz entstandenes kommunistisch-idealistisches Weltbild ins Wanken gerät. Später berichtet er seinem Psychiater von Stalins Totenfeier in Warschau und stellt fest: „[N]irgendwo auf der Welt war der Tyrann so verhasst wie in Warschau.“ (S. 90) Es ist für ihn sehr schwierig sich von den an eine übernationale Gemeinschaft alle Menschen hoffen lassenden kommunistischen Vorstellungen zu trennen, weil ihm die christlich-nationalen Machthaber im Vorkriegspolen als „ein selbstgefälliger Abschaum von faschistischen Krautjunkern, lärmigen Pogromhelden und Judenfressern ekelhaftester Prägung“ (S. 173) verhasst waren. Als er hört, dass ein Bekannter bei einem Verhör von der neuen Staatssicherheitpolizei als Judenschwein bezeichnet wurde, kann er es nicht glauben: „Im sozialistischen Polen, wenige Jahre nach dem Sieg über Hitler?“ (S. 69)
Als Kiebitz über den Ingenieur Aaron Finkelstein berichtet, der im Streit mit einem nichtjüdischen Kollegen liegt, wird er mit dem „polnischen Wahnsinn und vor allem mit dem polnischen Antisemitismus konfrontiert“ (S. 268). Er merkt erschreckt: „Das war der Startschuß! Es drohte alles erneut zu beginnen im Lande von Treblinka, Majdanek und Auschwitz.“ (S. 277) Ein besonderer Freund und Vertrauter von Kiebitz - Itzek Jungerwirth, ein Zahnarzt, der sich als Jude und Pole bezeichnet - erklärt ihm, dass „[j]ede Regierung, die hier regieren will, [...] gegen uns lästern [muß]. So will es der Pöbel“ (S. 278). Kiebitz’ polnische Assistentin will ihn bei der Vorbereitung der kontroversen Sendung unterstützen. Als er ihr sagt, es sei nicht ihre Sache, erwidert sie:
Ich gehöre dazu. Ich kann nicht zusehen, daß man hier Juden verfolgt. Die Nazis haben hier sechs Millionen Juden vergast. Und was haben wir getan, um das zu verhindern? Wir rühmten uns, Widerstand geleistet zu haben, und dennoch sollten wir uns schämen. [...] Jedes Kind wusste, daß man in Auschwitz die Juden vergaste. Und was unternahmen wir dagegen? Nichts. Nichts Komma nichts. Ein Volk von Helden sind wir. So steht es in den Schulbüchern. Nie haben wir uns unterkriegen lassen und zwölf Revolutionen im Verlauf von zweihundert Jahren entzündet. Ein Weltrekord. Daß ich nicht lache! Ein Volk von Hosenscheißern sind wir geworden. (S. 286)
Im Antisemitismus ihrer Landsleute glaubt sie einen Ausdruck der Angst vor der Intelligenz zu sehen und beschuldigt sie einer selbstverschuldeten Beschränktheit, die trotz der offenstehenden Universitäten nicht überwunden werden kann, weil die Polen zu faul sind: „Sie versaufen ihr Leben. Sie verlumpen ihre Zeit, und dann hassen sie die Mitbürger, die gescheiter sind als sie“. (S. 286) Andere Journalistenkollegen wollen aber mit diesem Thema nichts zu tun haben. Sie behandeln es wie eine peinliche Krankheit. „Jeder weiß, daß es da ein Problem gibt. Ein Geschwür. Eine ekelhafte Tatsache – aber man klammert sie aus.“ (S. 289)
Während der Sendung hetzt der polnische Ingenieur, der „wie die Quintessenz aller Polen [aussieht], [e]ine knochige Visage, [n]assblaue Augen und eine schnurgerade Nase“ (S. 305), gegen seinen jüdischen Kollegen. Das Publikum schimpft mit, und „niemand fordert[...] den Abbruch der Sendung“ (S. 315). Kiebitz wird des Landes verwiesen. Er schreibt in seinem Abschiedsbrief:
Mit Unterstützung des schmutzigen Pöbels schiebt man die Schuld für den Staatsbankrott den Juden in die Schuhe. Die Denkenden sagen nichts. [...] Ihr seid nicht besser als die Deutschen. Auch sie haben geschwiegen. Von heute an ist der Judenmord eine gemeinsame Ruhmestat von Deutschen und Polen. (S. 316)
Jungerwirth wandert nach Israel aus. Weinend zieht er ein Resümee, in dem Kiebitz eine „zärtliche Leidenschaft für den Gegenstand seines Hasses“ (S. 354) erkennt:
Ich haßte die Polen, und die Polen haßten mich. Wir waren wie ein altes Ehepaar. Jeder Morgen war für mich ein Hoffnungsstrahl, daß ich neue Argumente finden würde, diese Meute zu verabscheuen. [...] Wir wünschten uns gegenseitig das Schlimmste, und das Leben war ein Kasperletheater. Wen werden die Polen bespucken, wenn wir alle weg sind? Sie werden sich zu Tode langweilen. [...]
[In Israel] wird [es] noch schlimmer sein als in Polen, Herr Kiebitz. Ich werde besser essen, besser trinken, besser schlafen als in Warschau. Aber ohne Leidenschaft. Wen soll ich dort hassen? Die Araber? Die sind meine Verwandten.[...]
Bleiben? In Polen? Dieses Vergnügen gönne ich ihnen nicht, den verdammten Lumpen. [...] Sie sollen wehklagen, lamentieren, ein Jammergeschrei erheben, daß ihnen ihre geliebten Feinde davonlaufen. [...]
Sie bewundern uns. Sie meinen, daß wir begabter sind als sie. Sie haben eine ohnmächtige Wut auf uns, und wenn man genau hinhört, bemerkt man so etwas wie Achtung. [...]
Das Heilige Land ist voll von Juden, und nur die Juden wissen, wie teuer ihnen die Polen sind, wie unentbehrlich und lebenswichtig. Ich stochere meinen Landsleuten in den Zähnen herum, ich bohre und quäle und foltere sie, doch ich narkotisiere sie mit süßen Flüchen über den Todfeind. Polen ist das einzige Thema, mit dem man die Juden faszinieren kann. (352ff.)
In seinem Roman zeichnet Kaminski ein vielschichtiges, ausdifferenziertes Bild der Nachkriegszeit in Polen. Die ‚polnische Wirtschaft’ funktioniert trotz – oder dank – des Betrugs, der Lüge und der Tricks, die eine Art des Widerstandes gegen die von außen aufgezwungene Macht sind. Obwohl die polnische Gesellschaft patriarchalisch und konservativ-katholisch ist, sind polnische Frauen selbständig, selbstbewusst, vertreten leidenschaftlich eigene Meinungen. Die polnische Gesellschaft teilt Kaminski in zwei unterschiedliche Gruppen. Auf der einen Seite befinden sich die gebildeten Großstädter. Sie sind geistreich, kreativ, humorvoll, offen, ihren Freunden treu ergeben. Sie lieben die Freiheit, sind kritische Patrioten ohne Xenophobie. Auf der anderen Seite stehen die ungebildeten Massen: rückständig, gewalttätig, versoffen, faul, schadenfroh, fromm und fremdenfeindlich. Die gebildeten haben ein kritisches Selbstbild, aber obwohl sie polnische Mythen in Frage stellen, nehmen sie sie als unveränderbar an, und verhalten sich ihnen gegenüber konform. Deren größte Schwäche ist ihre Unfähigkeit auf die Massen Einfluss auszuüben. Sie scheuen ihre Verantwortung, indem sie den antisemitischen Parolen keinen Widerstand bieten, obwohl sie sich ihretwegen schämen und sie für eine Krankheit der Gesellschaft halten. Die Polen und die Juden verbindet eine „zärtliche Hassliebe“, beide bekämpfen sich und ziehen sich doch gegenseitig an.
In den Erzählungen des 1990 veröffentlichten Bands Flimmergeschichten kommen mehrere polnische Figuren vor. In der Geschichte Der Mann im Wohnwagen wird ein flüchtiger französischer Kriegsgefangener von einem polnischen Wiederstandskämpfer aufgenommen. Sie unterhalten sich auf Französisch, weil wie der Pole sagt, „[j]eder gebildete Pole französisch [spricht]“ (S. 52)[205]. In Zwei Leichen im Dreivierteltakt überlegt ein besorgter Protagonist, wie er seinen betrübten Bekannten dazu bringen kann, ihm seine Sorgen anzuvertrauen: „Ich sollte... jetzt weiß ich’s. Ich gehe zu Küchenmeister und kaufe zehn Flaschen Schnaps. Auf gut polnisch. Oder 20 Flaschen Schnaps, damit sich die ganze Belegschaft besaufen kann.“ (S. 86). Barbara, die Protagonistin der Erzählung Der Schweizer fliegt ihrem Geliebten bis nach China nach. Sie ist „eine Kreuzung zwischen russischer Tollwut und polnischer Verbissenheit. Eine Tochter zweier Nationen, die seit jeher die Gesetze der Schwerkraft für ungültig erklären.“ (S. 121) Sie ist „unvernünftig [...], verrückt und maßlos [...] leidenschaftlich bis zu Raserei“ (S. 125). Im Milieu der polnischen Einwanderer in Chicago spielt die Geschichte Der Weihnachtsmann. Ein polnischer Taxifahrer, der von seiner Frau verlassen wurde, versucht die Ursachen zu erklären:
Weil ich nicht rede mit ihr, hat sie gesagt. Weil ich sie anschweige und nach Fusel rieche. Aber was willst du? Wir Polacken sind halt so. Wir gehen zur Arbeit, bringen Geld nach Hause, und hin und wieder besaufen wir uns, weil alles so beschissen ist. (S. 162)
Sein Chef bestätigt diese Selbstwahrnehmung:
Sie sind fleißige Leute. Niemand kann sich beklagen, aber kein Hund weiß, was die denken. Saufen sich voll, kneifen die Kiefer zusammen und sind beleidigt. (S. 160)
Auch in diesem Band stellt Kaminski einige stereotype Elemente eines Polenbildes vor: die schöne, leidenschaftliche Polin, der edle Freiheitskämpfer, der versoffene Arbeiter. Im Unterschied zu anderen Autoren gelingt es Kaminski, seine Figuren, trotz der stereotypen Elemente, mit Humor und einer nicht-urteilenden Zuneigung zu zeichnen.
In André Kaminskis Texten wird ein vielschichtiges und konstantes Polenbild präsentiert. Die polnische Geschichte ist durch den zwei Jahrhunderte dauernden Kampf gegen die Fremdherrschaft der Russen, Österreicher, Preußen im 19. und der Deutschen und Sowjetrussen im 20. Jahrhundert gekennzeichnet. Der Patriotismus und damit verbundene Opferbereitschaft sind aber kein Zweck an sich, sondern werden von den Polen bewusst in den Kampf für die Unabhängigkeit des Landes eingesetzt. Allerdings streben sie einen Nationalstaat an, ohne die Interessen der Minderheiten zu bedenken, da diese nicht als gleichwertige Mitbürger angesehen werden.
Nach Kaminski sind alle Polen leidenschaftlich, stolz und impulsiv, sie sind Patrioten und Träumer, die „die Gesetze der Schwerkraft für ungültig erklären“, aber auch Angeber, Judenhasser und Trinker. Ihr Stolz kann tragische Folgen haben, weil er höher als ein menschliches Leben angesehen wird. Die Intellektuellen sind geistreich, offen, selbstkritisch, stellen sogar eigene Heldenmythen in Frage. Sie leben aber von den anderen Gesellschaftsschichten isoliert und nehmen ihre Verantwortung für die öffentliche Meinungsbildung nicht an. Die Frauen sind leidenschaftlich, anziehend und nehmen ihr Schicksal in die eigenen Hände. Polnische Bauern hassen die Juden „wegen dem Herrn Jesus“, sind geldgierig, rückständig, verschlossen, gewalttätig und ignorant. Ihre Beschränktheit hindert sie, die Chancen auf Bildung und Fortschritt wahrzunehmen. Die Polen selbst sehen sich als ein durch die Geschichte gepeinigtes Volk an. In ihrem ständigen Kampf gegen die fremden Mächte haben sie gelernt, durch Tricks und Betrug eigene Interessen durchzusetzen und sehen darin kein Unrecht. Das, was von Außenstehenden als Chaos wahrgenommen wird, sehen die Polen als ihre geordnete, unter widrigen Umständen wohl funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft.
Für viele Juden war Polen eine Heimat, die sie liebten und für die sie arbeiten wollten. Leider entpuppte sich das Land als ein „Ende der Welt“, als ein „absoluter Nullpunkt“. Auch nach der Shoah haben die Polen ihren Judenhass nicht hinterfragt. Der Antisemitismus des polnischen Pöbels ist sogar stärker als sein Antikommunismus, deswegen kann er von den Regierenden manipuliert und zur Ablenkung von eigener Misswirtschaft benutzt werden.
8.1.4. Ruth Klüger
Die 1931 in Wien geborene amerikanische Germanistin Ruth Klüger veröffentlichte 1992 ihren bis jetzt einzigen, aber mehrfach preisgekrönten Prosaband weiter leben. Eine Jugend. Der Text ist ein literarisch gestalteter Bericht über die Jahre ihrer Verfolgung in Wien, über ihr leidvolles Leben in Theresienstadt, Auschwitz und Christianstadt, über die Nachkriegsjahre in Deutschland und über ihr späteres Leben in den Vereinigten Staaten. Das Buch schrieb die Autorin in Deutschland, während sie eine Gastprofessur in Göttingen innehatte. Es ist den Göttinger Freunden gewidmet. Der Text, der aus der Perspektive einer großen zeitlichen Distanz geschrieben ist, beschäftigt sich hauptsächlich mit Gedächtnisbildern, verschiedenen Interpretationen der Shoah und den Formen des Gedenkens. Die kritische Offenheit und subtile Darstellung der Nuancen extremer Gefühle werden von Kritikern als ein großes Verdienst Ruth Klügers gesehen.[206]
Im ersten Teil berichtet die Autorin von einem Gefühl der relativen Sicherheit, das ihre Familie vor dem Krieg in Wien empfand: „Man meinte, man lebe ja nicht in Polen, dem traditionellen Land der Pogrome.“ (S. 63)[207] Nach dem Krieg ist Deutschland, wo die Ich-Erzählerin seit 1945 lebt, sicherer als Polen:
Und ich sprach mit polnischen Juden, die nach dem KZ in ihre Geburtsstädte zurückgekehrt waren und von polnischen Christen, die sich wünschten, die Nazis hätten gründlicher mit den Juden aufgeräumt, unter Drohungen wieder vertrieben wurden. Straubing, eine deutsche Stadt und somit eine unerwünschte Adresse, war zumindest nicht lebensgefährlich. (S. 193)
Die Autorin schreibt auch über ihre Auseinandersetzungen mit jungen Deutschen, die nach Auschwitz gefahren sind um dort für den Erhalt der Gedenkstätte zu arbeiten, und die zwischen den jüdischen und polnischen Opfern nicht zu unterscheiden vermögen. Sie weigerten sich hartnäckig, den Unterschied zwischen Polen und Juden zuzugeben und den Antisemitismus der polnischen Bevölkerung in ihre Besinnungsstunden und Beschaulichkeiten miteinzubeziehen. (S. 71)
Die jungen Deutschen sind für ihre Argumente nicht offen:
Mein Einwand, die Polen sollten nicht einfach die polnischen Juden als polnische Opfer zählen, denn vergast worden seien ja vor allem die Juden [...] wurde von den beiden abgelehnt. [...] Dabei hatte ich meinen letzten Hintergedanken gar nicht ausgesprochen, den über die Devisen, die durch die Juden auf Wallfahrt, besonders die amerikanischen Juden, nach Polen kommen und durch die Auschwitz vermutlich zu einer einträglichen Einkommensquelle für Polen geworden ist. (S. 78)
In ihrem, den Deutschen gegenüber versöhnlichen, zu einer „streitsüchtigen Auseinandersetzung“ (S. 142) auf der Basis gegenseitiger Toleranz einladenden Buch, zeichnet Ruth Klüger ein eindeutiges Bild Polens, als das eines Landes des traditionellen, unreflektierten Antisemitismus.[208] Die in Polen lebenden Juden waren und sind einer lebensbedrohlichen Gefahr von der Seite der polnischen Christen ausgesetzt. In Deutschland wird dies geleugnet, weil die gutgläubigen deutschen Jugendlichen nicht von ihren klaren Opfer- und Täterrollen Zuschreibungen abweichen wollen (Vgl. S. 71). In Polen wird diese Naivität und das schlechte Gewissen der Deutschen ausgenutzt, auch um finanzielle Vorteile zu bekommen. Das Bild wird an keiner Stelle durchbrochen oder relativiert.
8.1.5. Zwischenresümee
Das von der ersten deutsch-jüdischen Schriftstellergeneration nach der Shoah gezeichnete Polenbild ist nicht homogen. André Kaminski, der als einziger der Autoren in Polen lebte, zeigt eine differenzierte Wahrnehmung der polnischen Gegenwart und Geschichte. In seinen Texten kommen einige stereotype Elemente eines Polenbilden vor, andere aber werden verkehrt, modifiziert und sogar direkt angesprochen. Den Stereotypen entsprechend werden das Aussehen der Polen, die Landschaft und die Frauen beschrieben: Das Aussehen der Polen wird als Kontrast zum stereotypen Judenbild beschrieben – sie haben gerade, dünne Nasen, blaue Augen und knochige Gesichter –; die Landschaft ist sumpfig und öde; die Beschreibungen der Frauen bewegen sich in Rahmen des Stereotyps ‚schöne Polin’ – sie sind weiblich, leidenschaftlich, patriotisch, den Männern überlegen, an der Politik interessiert und opferbereit. Andere Darstellungen durchbrechen die Klischees: Die ‚polnische Wirtschaft’ funktioniert, die Polen arbeiten und sind – trotz der widrigen Umstände – erfolgreich; manche Regionen sind zwar rückständig, andere entwickeln sich jedoch. Wieder andere Stereotype spricht Kaminski direkt an: Die ‚polnische Freiheitsliebe’ bringt er wieder in den Kontext der Aufstände gegen eine Fremdherrschaft, dadurch widerlegt er ihre im späten 19. Jahrhundert entstandene Deutung als unheilsbringende Anarchie und Vernunftlosigkeit. Kaminski beschreibt seine polnischen Protagonisten aus verschiedenen historischen und räumlichen Perspektiven, auch ihre Selbstwahrnehmung wird angesprochen. Trotzdem schafft es der Autor nicht, jegliche Stereotypisierungen zu vermeiden: Er zeichnet ein zweigeteiltes Land – die Bauern und die gebildeten Großstädter bilden relativ homogene, als gegensätzlich gekennzeichnete Gruppen. Auch die Einschätzung des Ausmaßes des polnischen Antisemitismus als eine die ganze Gesellschaft verbindende, im Katholizismus und wirtschaftlichen Neid begründete Leidenschaft pauschalisiert und verhindert das Verstehen dieses Übels.
Ein klischeefreies Polenbild präsentiert Jeanette Lander. Sie spricht alte Stereotype an und zeigt ein breites Spektrum möglicher Interpretationen der individuellen Wahrnehmungen. Gleichzeitig beschreibt sie die Mechanismen der selektiven Perzeption, die zu einer Verfestigung der Stereotype führen und eine objektivere Beurteilung verhindern.
Edgar Hilsenrath und Ruth Klüger setzten sich ausschließlich mit dem Problem des Antisemitismus in Polen auseinander. Während Hilsenrath – trotz eindeutiger Verurteilung der Polen – an die gemeinsame friedliche Vergangenheit der Juden und Polen erinnert, verurteilt Klüger alle Polen ohne jegliche Ausnahme.
Eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Polen können die verschiedenen Erfahrungen sein, die die vier besprochenen Autoren mit der Fremdenwahrnehmung machten. Jeanette Lander und André Kaminski – beide stammen aus jüdisch-polnischen Familien – sind in Gesellschaften aufgewachsen, in denen sie nicht primär als Juden gesehen oder sogar verfolgt wurden. So war ihre jüdische Herkunft für ihr Schaffen nicht determinierend: Kaminski definierte sich lange Zeit über seine politischen Überzeugungen, Lander sucht nach einer femininen Perspektive. Hilsenrath und Klüger – beide aus assimilierten deutschsprachigen Familien stammend – wurden in ihrer Kindheit als Juden zuerst aus der Gesellschaft ausgeschlossen, dann verfolgt, wodurch ihrer Jüdischkeit für sie zu einer zentralen Kategorie aufstieg und zu einem wichtigen Thema ihres Schaffens wurde.
8.2. Die Generation der Nachgeborenen
8.2.1. Robert Schindel
Der 1944 in Bad Hall geborene Robert Schindel gehört zwar formal zur Generation der Überlebenden, aber die Themen seiner literarischen Texte lassen eine Zuordnung zu der Generation der Nachgeborenen zu. Seit Mitte der achtziger Jahre ist die Reflexion über jüdische Identitäten sein zentrales Thema. In dieser Zeit setzt sich der in Wien lebende Autor verstärkt mit der eigenen Jüdischkeit auseinander, die – aufgrund seiner kommunistischen Überzeugung – bislang für ihn zweitrangig war. Sein 1992 veröffentlichter Roman Gebürtig ist für Kritiker ein Beispiel eines spezifisch jüdischen Schreibens, das ein Medium der Identitätsfindung ist und gleichzeitig hohem ästhetischen Anspruch gerecht wird.[209] Eine jüdische Identität kann für Schindel nur in der Tradition von „Humanismus, Toleranz, Emanzipation und Solidarität mit den Beleidigten, Verjagten, Vernichteten“[210] gefunden werden.
Der Roman, der in den achtziger Jahren in Wien, Norddeutschland und in den Vereinigten Staaten spielt, ist „gleichsam ein Kompendium möglicher Reaktionsweisen auf die Vergangenheit“[211]. Schindel zeigt verschiedene Möglichkeiten des jüdischen Lebens inmitten einer nichtjüdischen Mehrheit, indem er zahlreiche Figuren unterschiedlichen Alters und ihrer Erfahrungshorizonte miteinander konfrontiert. Ein bekannter Theaterregisseur aus Hamburg, der seine Familie in Polen verloren hat, verleugnet seine Jüdischkeit. Ein angesehener Schriftsteller, der in den USA lebt, will Österreich und Polen niemals wieder besuchen:
Ich werde Polen nicht betreten mit seinem Waldvolk, das nie was anderes gelernt hat als Juden zu quälen und auf den Knien vor der tschenstochauer Madonna zu rutschen. (S. 89)[212]
Seine Eltern sind „nach Polen gebracht [worden]. Aus Tarnow sind sie gekommen, nach Auschwitz sind sie gegangen“ (S. 89). Seine schlaflosen Nächte verbringt er mit polnischen Jüdinnen:
Die meisten von ihnen sind in Polen vertilgt worden, deswegen liegen sie ja neben mir. Ich bin sicher, für mich gibt’s keine Frauen mehr auf der ganzen Welt, außer jenen. Ach, ich brauch die Finsternis gar nicht zu bezeichnen; es genügt die Herkunft aus dem Nacht- und Nebelland, und ich kann’s spüren, wenn auch nur für kurze Zeit, wo sie da sind, die Jüdinnen aus Polen. (S.89)
Eine Österreicherin, deren Vater als Kommunist in denselben Lagern wie der Schriftsteller war, versucht ihn zu überzeugen, dass alle Verfolgten den gleichen Gegner hatten. Er wehrt sich gegen diese Interpretation:
Ah, sagen Sie das nicht. Die Roten im Lager waren bloß auf der anderen Seite. Die waren aus Leoben oder Salzburg, gute, reinrassige Deutsche. Aber wir, wir und die Polacken und der Iwan, wir waren die Wanzen. Wir übrigens noch mehr als die Polen und Russen. (S. 170)
Eine andere Figur, ein Theaterkritiker, wird nachts von Albträumen geplagt, in denen er sich mit seinem Vater, der Kommandant eines Lagers bei Krakau war und „Polen und Juden als Wanzen“ (S. 54) bezeichnete, auseinandersetzt.
In Schindels Roman ist Polen vor allem als Schauplatz des Mordes, als das Land der Konzentrationslager präsent. Für die zentrale Figur, die auch eine Moralinstanz repräsentiert, ist Polen das „Nacht- und Nebelland“ des Antisemitismus und der rückständigen Frömmigkeit. Die „Polacken“, obwohl sie während des Krieges selbst auch verfolgt wurden, sind ein ‚Waldvolk der Judenquäler’ geblieben. Die polnischen Jüdinnen sind von den Ereignissen der Shoah für ihr ganzes Leben geprägt, deswegen finster und nicht fähig in der neuen Umgebung einen Neuanfang zu wagen.
8.2.2. Rafael Seligmann
Sowohl mit seinen fiktionalen als auch in seinen publizistischen Texten versucht der 1947 in Tel Aviv geborene, seit 1957 in München lebende Rafael Seligmann die Deutschen und die in Deutschland lebenden Juden zu einer Auseinandersetzung anzuregen. Seine Romane werden als „ein echtes Stück Bekenntnisliteratur der trivialen Art“[213] gesehen, die beiden Seiten zeigen wollen, dass eine deutsch-jüdische Identität, trotz des Schattens der Shoah, möglich ist.[214] Seligmann provoziert mit zahlreichen Tabubrüchen ohne ausreichende Differenzierung, was ihm viel Popularität beim nicht-jüdischen, aber die Beschimpfung als Nestbeschmutzer beim jüdischen Publikum beschert.[215]
In dem 1997 veröffentlichten Roman Musterjude schreibt die Hauptfigur - ein deutsch-jüdischer Journalist – einen Artikel über den nationalsozialistischen Antisemitismus und die Beteiligung der Massen an der Verfolgung der Juden. Er überlegt:
Was hat diese Menschen in die Arme Hitlers getrieben? [...] Franzosen, Russen und vor allem Polen waren gewiß vehementere Judenfeinde als die Deutschen. Warum wählten sie nicht ebenfalls einen Hitler zu ihrem Führer? (S. 148)[216]
Gleichzeitig hat er ein polnisches Hausmädchen, Jadwiga, die morgens „den Cherrn Bernstein zu Fristick in Garten“(S. 204) bittet. Die Nationalität des Hausmädchens hat keine Funktion in dem Aufbau des Romans, es wird nur kurz erwähnt und dient der Schilderung des Milieus.
In Schalom meine Liebe schildert der auktoriale Erzähler das Leben der aus Lodz stammenden Großeltern des Protagonisten. Nach der Gründung der Polnischen Republik waren „die antisemitischen Schikanen und Diskriminierungen der polnischen Republik [...] lästig“ (S. 25), sein Großvater spielte deshalb „mit dem Gedanken, seine Religion aufzugeben und sich in die polnische Gesellschaft zu assimilieren, doch deren Antisemitismus stieß ihn ab“ (S. 25f.). Nach dem Krieg blieb die Großmutter in Deutschland. Genauso wie sie, wollten die meisten Displaced Persons „in ihre ehemaligen Heimatländer in Osteuropa [...] nicht zurückkehren“ (S. 29). Jahre später wird die Familie des Ich-Erzählers von ehemaligen Freunden aus Lodz besucht. Einer von ihnen erzählt von seinem Schicksal:
1942 gelang meinen Eltern die Flucht aus dem Ghetto von Lodz. Wir wurden von polnischen Bauern versteckt. 1944 hat uns die Rote Armee befreit. Meine Eltern hatten genug von Polen. Wir gingen nach Russland. (S. 143)
1999 erschien Seligmanns Roman Der Milchmann. Es ist eine Geschichte über das Leben der im Nachkriegsdeutschland lebenden Juden. Der Protagonist – Jacob Weinberg – rettete während des Krieges viele Menschen vor dem Hungertod, indem er den von ihm bei der Arbeit außerhalb des Arbeitslagers gefundenen Sack mit Milchpulver unter den Mitgefangenen verteilte. Nach dem Krieg hat er sich in München angesiedelt, wo auch viele seiner Freunde leben. Sie unterhalten sich oft über das Lager: „Die Polacken soffen Wodka, die Mörder Bier, die Jidn Milch“. (S. 19)[217] Sie sprechen auch darüber, wie sie überlebten. Einer von ihnen hatte sich aus dem Ghetto von Lodz gestohlen. Zunächst hatte er versucht, sich den polnischen Partisanen anzuschließen, doch die wollten nichts mit einem Juden zu tun haben. (S. 230)
Sie trauern um ihre Familien:
Weinbergs Mischpoche besaß keine Gräber mehr. Deutsche und Polen hatten die letzten Ruhestätten seiner Vorfahren im galizischen Rudnik verwüstet. Weinbergs Eltern und sein Bruder Nathan wurden in den Himmel Polens geblasen. (S. 122)
Auch für die aktuellen politischen Ereignisse interessieren sie sich:
Die Polen waren verrückt! Seit Jahrhunderten kämpften sie gegen die russischen Erzfeinde um ihre Unabhängigkeit. [...] Und nun schickten sich die Idioten an, den ehemaligen kommunistischen Funktionär Kwasniewski freiwillig zu ihrem Staatschef zu wählen. (S. 273f.)
Die polnischen Juden werden den deutschen Juden gegenüber gestellt:
Die deutschen Juden waren Prinzipienreiter. Genau wie ihre deutschen Landsleute. Der Unterschied war, daß die Deutschen zu allem fähig waren, und die Jeckes zu gar nichts. Blumenthal und Adler waren zwar Idioten, aber sie waren polnische Jidn wie er, und sie hatten ebenso wie er das Lager überstanden. Levy dagegen war ein blasierter Jecke, der während der Hitlerzeit in Palästina überwintert hatte. Statt dort zu bleiben und für einen jüdischen Staat zu kämpfen, war er nach Hitler wieder zu den deutschen Antisemiten gekrochen. (S. 84)
Polen kommt in Seligmanns Romanen nur in Randbemerkungen vor, die von dem auktorialen Erzähler oder von jüdischen Protagonisten getroffen werden. Keine der Äußerungen wird von anderen Figuren bezweifelt, mit einem Gegenbeispiel beantwortet oder ironisch gebrochen. Es sind direkte Aussagen, die von integren Figuren geäußert werden. Der gemeinsame Nenner der Bemerkungen ist der polnische Antisemitismus, mit dem die Juden vor, während und nach dem Krieg konfrontiert wurden. In den zwanziger Jahren war es eine staatlich unterstützte, das öffentliche Leben betreffende Diskriminierung, während des Krieges wurden Juden von den Partisanen abgelehnt, nach dem Krieg hatten sie „genug von Polen“. Polen ist der Ort des Mordes an den Juden und der Schändung ihrer Friedhöfe, „Polacken“ trinken Wodka, sind politisch unreif und treffen auch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus keine vernünftigen Entscheidungen. Polnische Juden werden als ein Gegensatz zu deutschen Juden charakterisiert. Jene sind stolz, gewitzt, fähig unter widrigen Umständen zu überleben, halten zusammen und unterstützen sich gegenseitig.
8.2.3. Barbara Honigmann
Barbara Honigmanns nuancierte und stilistisch anspruchsvolle Prosa ist einer der bedeutendsten Beiträge deutsch-jüdischer Autoren zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Die 1949 in Ostberlin geborene Autorin, deren Eltern – aufgrund ihrer kommunistischen Überzeugungen – nach dem Krieg aus ihrem englischen Exil mit der Hoffnung auf eine postnationale Gesellschaft nach Ostberlin kamen, emigrierte in den achtziger Jahren nach Frankreich, wo sie in einer orthodoxen Gemeinde als freie Schriftstellerin lebt.[218] In ihren Werken beschäftigt sie sich mit den Themen des Exils, der Fremdheit, des Grenzüberschreitens. Nicht die Gegenüberstellung von Juden und Nicht-Juden, sondern die Vielfältigkeit jüdischer Identitäten ist paradigmatisch für ihr Schreiben.[219]
In der Erzählung Doppeltes Grab aus dem Band Roman von einem Kinde trifft die Ich-Erzählerin in Berlin den jüdischen Religionshistoriker Gerschom Scholem, der ihr von einer jüdisch-messianischen Sekte in Polen der Frühneuzeit erzählt, deren Mitglieder zum Katholizismus konvertierten und geadelt wurden. Zu der Zeit hatte in Polen ein intensives, vielseitiges jüdisches Leben entstehen können.
Der 1996 veröffentlichte Kurzroman Soharas Reise erzählt vom Leben einer sephardischen[220] Jüdin, die nach ihrer Flucht aus Algier in Straßburg wohnt. Aufgrund von Erzählungen ihrer aschkenasischen Nachbarn und von Fernsehsendungen entseht bei ihr ein diffuses Polenbild: Polen ist ein Land mit einer „unheimliche[n] Landschaft. Eine Landschaft des Schreckens, mit polnischen und deutschen Ortsnamen darin, Auschwitz, Warschau, Treblinka“ (S. 24)[221]. Sie beobachtet Mitglieder der Straßburger jüdischen Gemeinde:
Es scheint, daß die Aschkenasim an jedes Essen noch Zucker tun, auch an Fleisch und Fisch, das haben sie von den Polen gelernt, die ja auch sonst ihre schlimmsten Feinde sind, dabei reden sie von Warschau wie von Jerusalem und haben alle den Stadtplan in Kopf. (S. 72f.)
Ihre aus Deutschland stammende Nachbarin nimmt an den Gemeindeaktivitäten nicht teil und verachtet polnische Juden:
Sie mag Rabbiner umso weniger, wenn sie aus entlegenen polnischen Orten stammen und versuchen, eine gemäßigte westeuropäische Gemeinde nach den beschränkten Vorstellungen ihres Schtetle umzuwandeln. (S. 91)
Die Protagonistin hat keine Möglichkeit sich ein differenziertes Polenbild zu machen. Polen ist für sie ein fernes und fremdes Land, eine „Landschaft des Schreckens“, das negative Affekte bei aschkenasischen Juden hervorruft: Bei den aus Polen stammenden Juden beobachtet sie eine starke Abneigung, die aber paradoxerweise mit einer geleugneten Affinität einherzugehen scheint; bei den Westjuden dienen die als „polnisch“ gekennzeichneten Eigenschaften wie Rückständigkeit, Beschränktheit und Verschlossenheit der Abgrenzung den Ostjuden gegenüber.
Der Band Damals, dann und danach aus dem Jahre 1999 sammelt Erzählungen über das Leben der Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Straßburg. Hinter der Grande Schul handelt von einem jungen Lehrer, dessen Großvater in den zwanziger Jahren nach Frankreich kam.
Er war ein armes Schneiderlein, aber besser als in Polen war es allemal, auch wenn die Begrüßung durch die elsässischen Glaubensbrüder nicht so grandios war und man sich als „Hergelaufener“ bezeichnen lassen [...] musste. (S. 57)
Eine Figur aus Meine sephardischen Freundinnen hat Kinder, die „blond und ziemlich kugelrund sind“ (S. 64), weil deren Großeltern aus Polen stammen.
In der Erzählung Der Untergang von Wien stellt die Ich-Erzählerin fest, dass ihre Vorfahren in vielen Ländern Europas gelebt haben, wo sie ihre Spuren auch in der Landessprache hinterlassen haben, es sind „Ausdrücke [...] und Redewendungen der spanischen, polnischen oder ungarischen Sprache, die meistens nichts Gutes bedeuten“ (S. 89). Vom jüdischen Leben in diesen Ländern sind nur die antijüdischen Schimpfworte als Erinnerung an ein langes, fruchtbares Zusammenleben übriggeblieben.
In ihrem autobiographischen Prosaband Am Sonntag spielt der Rabbi Fußball aus dem Jahr 1998 schreibt Barbara Honigmann über verschieden Ereignisse aus dem Leben einer deutsch-jüdischen Schriftstellerin. In dem Text Trialog berichtet sie von einem deutsch-französisch-polnischen Autorentreffen:
Aber meistens saßen doch die Nationalitäten, zumindest am Anfang, unter sich, an getrennten Tischen, die Franzosen, die Deutschen, die Polen. Besonders bei den Franzosen mangelt es ja an der Fähigkeit, eine andere als ihre eigene Sprache zu sprechen, bei den Deutschen waren wir immerhin schon zwei, die wenigstens Französisch parlieren konnten, und die Polen sprachen fast alle Deutsch oder Französisch. [...] So bildeten sich dann tatsächlich zum Ende der drei Tage auch gemischte Tische. (S. 42f.)[222]
In diesem Text werden polnische Schriftsteller der Gegenwart kurz dargestellt. Für die Protagonistin unterscheiden sie sich nicht von ihren französischen oder deutschen Kollegen: Nicht ihre nationale Zugehörigkeit, sondern fehlende gemeinsame Sprache kann eine Barriere für nähere Kontakte und Verständnis sein.
In Barbara Honigmanns Werken kommen nur wenige Elemente eines Polenbildes vor. Sie dienen zur Differenzierung zwischen verschiedenen jüdischen Selbst- und Fremdzuschreibungen in einer heterogenen jüdischen Gemeinde im Frankreich der Gegenwart. Sephardische Juden können kein direktes, verifizierbares Polenbild entwickeln, also bleibt das Land für sie ein unheimlicher Ort des Schreckens. Die deutschen Juden sehen sich der westeuropäischen Kultur und Zivilisation besonders verbunden und halten die polnischen Juden für rückständig, beschränkt und provinziell. Die aus Polen stammenden Juden hassen das Land, in dem ihre Vorfahren viele Jahrhunderte lang gelebt haben. Nur wenige erinnern sich an die Blüte der jüdischen Kultur in Polen, obwohl sie sogar in ihrem Aussehen – „blond und ziemlich kugelrund“ – durch das Land geprägt sind. Sie sind überzeugt, dass sie überall besser als in Polen leben können. Weil nicht explizit erklärt wird, weswegen, kann der Leser nur eigene Vorstellungen über Polen aktivieren, und als Ursache entweder den polnischen Antisemitismus oder die polnische Rückständigkeit vermuten. Die nicht-polnischen Juden bemerken aber, dass die Feindschaft gegenüber Polen mit einer unbewussten Zuneigung verbunden ist. Honigmanns Darstellungen der Konflikte mit Fremden zeigen oft die Unfähigkeit des Verstehens, das Fehlen der gemeinsamen Erfahrungen und Sprache, die die kulturell, religiös oder in den Geschlechtern begründete Andersartigkeit als Fremdheit sehen lassen.
8.2.4. Irene Dische
Irene Dische ist 1952 als Tochter deutscher Juden in New York geboren und katholisch erzogen worden. Seit 1980 lebt sie in Berlin. Neben literarischen Texten schreibt sie auch Reportagen, Musical-Libretti und Kinderbücher. Ihre erste literarische Veröffentlichung, der Erzählband Fromme Lügen wurde 1989 zum Buchereignis der Saison gekürt. Diese Erzählungen, die sich hauptsächlich mit den Lebensläufen der vom Holocaust geprägten Menschen beschäftigen, sind frei von jedem Betroffenheitsgestus, voller ironischer Brechungen und überraschender Wendungen. Ihre Texte spielen hauptsächlich in Deutschland, einem Land, in dem – laut Dische – Ost und West, Juden und Christen, Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderstoßen und für Konflikte sorgen. Einige Kritiker bezeichnen Disches Schreibweise als Herzlosigkeit, die nur durch ihre jüdische Herkunft legitimiert wird.[223]
In der Erzählung Mr. Lustgarten verliebt sich aus dem Band Fromme Lügen fragt die Familie des Titelhelden bei einem katholischen Pfarrer nach einer Haushälterin für den alten Vater.
„Ich wüsste da schon jemand. Eine Seele von einer Frau“, erklärte der Pfarrer. „Ehrlich, pünktlich und so weiter. Einziges Problem: sie ist Polin. Manche mögen es nicht. Es gibt plötzlich so viele Polen hier.“ (S. 75)[224]
Der aus einem deutschsprachigen Elternhaus stammende Protagonist ist senil, seine Mehrsprachigkeit geht verloren, am Ende „blieb nur noch das von [s]einen Eltern so verachtete Polnisch“ (S. 76), das er von seinem Kindermädchen gelernt hat. Für ihn ist seine neue Haushälterin eine „Quintessenz der Weiblichkeit“ (S. 78), er ist überzeugt, dass „[i]hre weiße Haut, ihr rotes Haar, ihr weibliches Wesen [...] unweigerlich auch anderen Männern auffallen“ (S. 81) müssen. Anna ist bescheiden, altmodisch und fromm, sie sorgt vorbildlich für den alten Mann und gewinnt auch das Herz seiner Kinder:
Unter Kruzifixen und Weihwasser, frommen Büchern, getrockneten Blumen und Fotos von Neffen und Nichten und jungen Hunden erschien sie ihnen scheu, fromm und weltabgewandt; aufopfernd und darum über die Maßen verdienstvoll. (S. 84)
Eine andere Erzählung aus dem Band Fromme Lügen mit dem Titel Ein kleiner Selbstmordversuch spielt im Berlin der achtziger Jahre. Eine deutsche Familie beschäftigt eine Polin als Kindermädchen, deren Äußeres wie folgt beschrieben wird:
entsagende Wangenknochen, die Nase schön noch im Leiden, Lippen und Kinn und die ganze Gestalt darunter so geheimnisvoll und freigebig wie die polnische Erde, auch mit so ähnlichen Umrissen. (S. 86)
Aber die junge Frau ist faul, eingebildet, unzuverlässig, und vernachlässigt das Kind. Sie nutzt das Vertrauen ihrer Arbeitgeber aus und stiehlt. Sie schmuggelt Zigaretten und Spirituosen, verkauft sie am Bahnhof Zoo und nimmt das Kind „oft ein bisschen mit an die frische Luft des Spielcasinos“ (S. 87). Das alles hat sie von ihrem Vater gelernt, der als Altenpfleger in Warschau die Bewohner des Altenheims bestiehlt. Obwohl „polnische Arbeitskräfte [...] dieses Jahr so billig [waren]“ (S. 90), trauen sich die Deutschen nicht die Polin zu entlassen, weil sie ihnen durch ihren Selbstmordversuch ein schlechtes Gewissen einredet.
In der Erzählung Fromme Lügen aus dem gleichnamigen Band trennt sich die Protagonistin von ihrem aus Polen stammenden Mann. Er beschimpft sie: „’Dumme Gans!’ schrie er mit seinem polnischen Akzent. ‚Dómę gąź biszt dó!’“ (S. 143) Er ist ein seltsamer jüdischer Wissenschaftler, der „auf polnisch vor sich hin [mault]“ (S. 221), und der sich in den Augen seiner katholisch-konservativ erzogenen Kinder „zum Narren macht[...], indem er in dieser gottlosen Sprache mit seinen Chemikalien redet[...]“ (S. 221). Er ist „klein, gebeugt, schäbig wie Galizien“ (S. 243). Als Einwanderer aus Osteuropa gehört er, trotz eines Nobelpreises, zu den unterbezahlten Wissenschaftlern, sein Laborpersonal besteht aus Polinnen, Frauen mit „breiten Gesichtern, weißblonden Haaren und kurzen dicken Beinen“ (S. 259).
In der Erzählung Der Doktor braucht ein Heim aus dem Jahre 1990 beklagt der Ich-Erzähler auf der ersten Seite das ihm von den Frauen angetane Leid:
Eine der Frauen heißt Barbara, sie war meine Haushälterin. Sie war bildschön, blond und sinnlich, ihr Auftreten und ihre Art zu sprechen hatten etwas aufregend Gewöhnliches – eine polnische Madonna. (S. 7)[225]
Das polnische Mädchen ist vulgär, riecht nach „Kleingeld und billigen Süßigkeiten“ (S. 8). Als der Ich-Erzähler sie in flagranti mit einem puertoricanischen Fahrlehrer erwischt, richtete [sie] sich zu ihrer ganzen prachtvollen Größe auf, so daß ihr Gehänge vor meiner Nase wippte, packte mich, wie Kongresspolen in seinen schönsten Träumen nach Galizien griff, und schleuderte mich ins nächste Zimmer, daß mein Blut Zeichen an der Wand hinterließ. (S. 8)
Nach diesem Ereignis wird der verwirrte Doktor von seiner Tochter in einem Heim untergebracht.
In den in der Gegenwart spielenden Erzählungen von Irene Dische sind einige polnische Randfiguren vorhanden. Es handelt sich bei ihnen vor allem um billige Arbeitskräfte: Haushälterinnen und Kindermädchen, also polnische Gastarbeiter in der westlichen Welt. Eine der Figuren ist eine ehrliche, fleißige, fromme Frau, eine andere ist eine Diebin und Betrügerin, die ihre gutgläubigen Arbeitgeber ausnutzt, eine dritte ist gewalttätig und vulgär. Alle sind auf eine gewöhnliche Art anziehend: blond oder rothaarig, füllig und sinnlich. Polnische Jüdinnen werden ebenfalls als blond und kurzbeinig wie die Polen dargestellt. Die polnischen Juden sind klein und gebeugt, sie halten alle zusammen, sprechen Polnisch, haben sonderbare Schrullen und sind nicht in die neue Gesellschaft integriert.
1993 veröffentlichte Irene Dische ihren Roman Ein fremdes Gefühl oder Veränderungen über einen Deutschen, der sich mit der deutschen Nachwende-Situation beschäftigt. Der schwerkranke Protagonist möchte ein Kind adoptieren. Auf seine Anzeige antwortet eine Russin, die ihm ihr Kind zu Adoption anbietet. Mit der Russin und ihrem Kind, sowie mit einer neuen Haushälterin, die vor der Wende bei der SED-Führung arbeitete verlässt der Protagonist Berlin und fährt zu einem Familiensitz auf dem Lande. Vor der Abreise unterhält er sich mit der Hausmeisterin seiner Berliner Wohnung, die sich über Vieles aufregt. Sie ist besorgt, weil „die Polen [...] jetzt überall [seien], sie würden riechen“ (S. 64)[226]. Sie ruft: „Ab mit Ihnen, Geld verdienen!“ (S. 64) Auf einem Rastplatz sehen sie eine polnische Familie. Die aus Ostberlin stammende Haushälterin erzählt:
Dem Osten gegenüber waren wir immer sehr großzügig. Die Polen sind habgierig. Die haben uns ausgebeutet, haben uns alles weggekauft. Alles, was wir hatten. Die denken nur ans Geld. (S. 135)
Das zweiunddreißigste Kapitel beginnt folgendermaßen:
AM ERSTEN SEPTEMBER starben in Deutschland vier Menschen an Salmonellenvergiftung, nachdem sie ungekochte polnische Importeier gegessen hatten. (S. 393)
Diese Textstelle ist der Ausgangpunkt für einen reigenartigen Schluss. Für den Aufbau der Schlussszene oder andere Inhalte des Romans ist die Herkunft der besagten Eier irrelevant. Zusammen mit der Aussage „Dem Osten gegenüber waren wir immer sehr großzügig“, die von der eingebildeten, unsympathischen Haushälterin getroffen wird, kann sie als eine Verkehrung, ein Spiel mit dem Stereotyp der ‚polnischen Wirtschaft’ gelesen werden. Auch das Datum des aus Polen nach Deutschland kommenden Todes – Anspielung auf den 1. September 1939 – hat keine Funktion in dem Text. Es ist eine ironische Verkehrung, die dem Leser zeigt, dass über geschichtliche Ereignisse auch ohne Pathos reflektiert werden kann. Diese Interpretation ist zulässig, weil der Roman eine humorvolle, ironische Abrechnung mit dem Pathos der Wiedervereinigung ist. Offen bleibt, ob obige Textstelle, stammte sie von einem nicht-jüdischen Autor, auch als humorvoll aufgefasst worden wäre.
1994 veröffentlichte Dische der Band Die intimen Geständnisse des Oliver Weinstock. In der dokumentarischen Erzählung Die reichen Juden in Deutschland stellt sie Ost- und Westjuden gegenüber. Die Gäste einer Bar-Mizwa-Feier unterhalten sich über die Anwesenden:
Tatsächlich ist an den Frankfurter Geschäftsmachern etwas viel spezifischer Jüdisches als bloß ihre Nasen oder auch ihre Religion: das ist ihre Herkunft, ihre Geschichte. Die Spekulanten sind eine bemerkenswert homogene Gruppe; sie alle sind polnischer Herkunft, [...]. Daß sie Osteuropäer sind, unterscheidet sie fundamental von ihren deutsch-jüdischen Kollegen. Das polnische Judentum kennt keine Tradition der Assimilierung; die polnischen Juden waren immer orthodox, lebten im Ghetto und sprachen Jiddisch. [...] Heute sind die Ostjuden Fremde selbst unter den deutschen Juden, die oft genug am wenigsten Verständnis für sie haben. (S. 26)[227]
Unter den Gästen ist auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland Ignaz Bubis. Er erzählt von seinem Überleben im Ghetto in einer polnischen Stadt, deren Einwohner die Juden für ein Pfund Zucker an die Deutschen verrieten. Bubis sagt:
„Ich hasse und verachte die Polen. [...] Sogar als sie selbst geknechtet waren, haben sie ihren Antisemitismus nicht aufgegeben. Bei den Deutschen war es eingeimpft“, meint er verständnisvoll, „aber bei Leuten, die selbst unterdrückt werden? Das verachte ich.“ (S. 42f.)
Der Erzähler stellt fest, dass Bubis jede Kritik an den Deutschen vermeidet und es damit entschuldigt, dass er „niemand in die Schuldecke stellen“ (S. 45) will.
In der Geschichte Noch eine Romanze erinnert sich ein alter, in Paris wohnender Jude an seine Jugend in Krakau. Er war in die Tochter eines katholischen Bäckers verliebt, deren Haar „betörend rot“ (S. 109) war. Er trennte sich von ihr, nachdem sie ihn gebeten hatte zum Katholizismus zu konvertieren.
Das Geschenk ist eine vierseitige humorvolle Geschichte über Fremdheit und Toleranz. Die Ich-Erzählerin – Besitzerin eines eleganten Möbelgeschäftes – hilft einem Russen, der sich in Berlin verirrt hat, und bekommt von ihm eine Deodorantdose geschenkt. Ihre aus Ostberlin stammende Putzfrau ist entsetzt, es sei die billige Marke, die die Polen kaufen, und der Geruch sei widerwärtig. [...] Schlechter Geschmack und Luxus sind keine Laster, die aus Deutschland stammen. [...] Die Polen riechen alle so. Endlich ist es soweit, daß man laut und deutlich sagen kann: Wir Deutsche mögen so was nicht. (S. 243)
Nach dem Mauerfall sind viele gehobene Boutiquen in der Nachbarschaft durch Geschäfte, die Billigware an polnische Kunden verkaufen, ersetzt worden. Auch die Ich-Erzählerin erweitert ihr Angebot. Die Folge sind Busladungen von Polen, die bei ihr einkaufen wollen. Die Ich-Erzählerin findet, dass es „jetzt [...] richtig nett in [ihrem] überfüllten Laden“ (S. 246) ist. Die Putzfrau kündigt.
Irene Dische beschäftigt sich in ihren Texten mit der bundesrepublikanischen und amerikanischen Gegenwart. Polnische Figuren kommen dabei nicht oft vor. Es sind vor allem polnische Gastarbeiterinnen, die sich durch ihr weiblich-üppiges Aussehen auszeichnen, und Kleinhändler, die billige Ware in Berlin kaufen. Unter ihnen gibt es Betrüger, fromme Katholiken, sympathische und abstoßende Personen. Die Westdeutschen nehmen ihre Dienste in Anspruch oder sind ihnen gegenüber gleichgültig, die Ostdeutschen pflegen negative Vorurteile den Polen gegenüber, die zum Spektrum des Stereotyps ‚polnische Wirtschaft’ gehören. Polnische Juden bilden in der Bundesrepublik eine geschlossene Gruppe, die auch fünfzig Jahre nach dem Krieg und ihrer Ansiedlung in Deutschland, trotz der gemachten Karriere und trotz des Wohlstands, mit den sonstigen Teilen der Gesellschaft nicht integriert ist. Sie zeigen Verständnis für die Deutschen, die Polen werden von ihnen als Antisemiten gehasst.
8.2.5. Maxim Biller
Maxim Biller wurde 1960 in Prag als Sohn aus der Sowjetunion emigrierter Juden geboren. Als er zehn Jahre alt war, siedelte seine Familie nach Deutschland um, wo der Autor bis heute lebt. Seit Anfang der neunziger Jahre macht er mit provokanten Artikeln über jüdisches Leben in Deutschland auf sich aufmerksam. Mit wohl inszenierten Tabubrüchen versucht er dazu beizutragen, das Juden und Nicht-Juden zu einem unverkrampften Umgang miteinander finden[228]. Seine literarischen Texte sind stark autobiographisch gefärbt: Die meisten Ich-Erzähler in seinen Geschichten sind Journalisten oder Schriftsteller, die über die Situation der alten und der jungen Juden in Deutschland schreiben.[229]
In der Erzählung Meine Tage mit Frenkel aus dem 1990 publizierten Erzählband Wenn ich einmal reich und tot bin beschäftigt ein jüdischer Fabrikant einen Ingenieur, „dessen großer ruthenischer Kopf auf einem schmächtigen polnischen Körper ruhte“ (S. 51)[230].
Die Erzählung Roboter, eine Geschichte über zwei polnisch-jüdische Kinder, die sich während des Krieges zu verstecken versuchen, beginnt folgendermaßen:
In Polen ist der Himmel weiß, und unter diesem Himmel liegt eine riesige Ebene mit Städten, Wiesen und trockenen Feldern. Eine gut überschaubare Gegend. [...] [A]ber es leben in diesem Land einfach zu viele Menschen, [...] alte Bekannte, Nachbarn oder professionelle Schmalzowniki, lauter Gojim also, ohne Gefühl für die Probleme ihrer jüdischen Landsleute, denen die Nazis gerade ihre Hakenkreuze und SS-Runen in die Ärsche einbrennen. (S. 66)
Sie leben lange Zeit im Wald, unter den „riesigen polnischen Stahlwolken“ (S. 68). Als sie entdeckt werden, rennt einer von ihnen weg.
Er hatte die polnische Pampa vor sich, diese unendliche Weite [...] Natürlich gab es auch Polen, die ein jüdisches Kind nicht verrieten. Aber allzulange hielt die Geduld der Bauern mit Salek nie, dafür war er zu wenig demütig und dankbar. (S. 68)
In Harlem Holocaust stellt ein in Deutschland lebender aber aus den USA stammender jüdischer Schriftsteller das westeuropäische kosmopolitisch-jüdische Bildungsbürgertum den „kryptofaschistischen Mazzeknödel-Phantasien eines Haufens polnischer Juden, die im Adenauer-Deutschland lesen und schreiben gelernt hatten“ (S. 93) gegenüber. Diese Neureichen sitzen ständig im koscheren Restaurant und erzählen, wie der „weiße polnische Himmel schwarz wurde“ (S. 121).
Die Frauen hatten gelbe, ernste Gesichter, die Männer bewegten sich langsam [...] Ein Gruselkabinett, eine richtige Hexenküche also, wurde doch in diesen Wänden außerdem fast ausschließlich Polnisch und Jiddisch gesprochen [...] in diesen zwei Sprachen Mord und Tod einander nur so belauern. (S. 103)
Die Protagonistin der Erzählung Cilly ist ein verwöhntes Kind neureicher Frankfurter Juden. Die Familie hat seit zwanzig Jahren ein polnisches Dienstmädchen. Jadwiga trug über einem weißen Chiffonrock eine winzige weiße Schürze, an ihren Ohren hingen Chanel-Imitate, sie war noch stärker geschminkt als Cillys Mutter, und sie hatte einen Busen so groß wie die Karpaten. (S. 151)
Sie ist hysterisch, katholisch fromm, aber sie kocht „wie ein Gott“ (S. 152).
Die Mutter des Protagonisten der Erzählung Verrat überlebte die Shoah „bei polnischen Bauern, unter oft erniedrigenden Umständen“ (S. 189). In der Titelgeschichte des Bandes unterhalten sich zwei Frankfurter Juden über die „Zuckerboim-Polacken [, die] 1968, auf dem Höhepunkt von Gomulkas Judenfresser-Show, aus Polen nach Deutschland gekommen“ (S. 234) waren.
Billers zweiter Erzählband Land der Väter und Verräter wurde 1994 publiziert und beinhaltet sechzehn Geschichten, die in Deutschland, Israel und Osteuropa in Phasen historischer Umbrüche spielen. Sie handeln vom entwurzelten, heimatlosen Menschen, von ihrer Suche nach einer neuen Identität, ihren damit verbundenen Verdrängungsversuchen und Selbsttäuschungen.[231] Die Geschichte Der perfekte Roman erzählt von zwei Juden, die sich zuerst in Polen kurz nach dem Krieg, dann zwanzig Jahre später in Deutschland und schließlich nach weiteren zwanzig Jahren in Israel treffen. Geherman wird in Polen wegen seiner Tätigkeit für den kommunistischen Sicherheitsdienst „Roter Tod“ (S. 229) genannt, später in Deutschland – als berühmter Literaturkritiker - „Germanias Gewissen“ (S. 229); der Schriftsteller Pulwer verliert in Polen seine Freunde, in Deutschland seine Fähigkeit zu schreiben. 1946 wohnt Pulwer mit zweihundert anderen ehemaligen KZ-Gefangenen in einem Gemeindehaus in Tarnów und wartet auf die Ausreise nach Palästina. Die Polen nennen die Unterkunft „Judenhaus“:
Ja, Judenhaus, wie sonst, aber das war überhaupt nicht abschätzig gemeint gewesen, denn in den ersten Wochen und Monaten des Friedens hatten die Einheimischen sogar mit den Juden ein Nachsehen gehabt. Daß die Polen die Juden, diese dunklen Menschen mit den klaren Gesichtzügen, die vor neunhundert Jahren in ihr Land gekommen waren, schon immer gehasst hatten, stand auf einem anderen Blatt geschrieben, und dieses Blatt wurde für eine Weile in eine der hinteren Schubladen der Geschichte abgelegt, denn erstens waren fast alle Juden tot, und zweitens gab es nun einen neuen, größeren, mächtigeren Feind, und der kam aus Russland. Natürlich, es sollte schon bald der Tag anbrechen, an dem die Polen zu der Überzeugung gelangen würden, daß der Kommunismus ein jüdisches Werk sei. (S. 233)[232]
Die Zuneigung der polnischen Juden zum Kommunismus erklärt der auktoriale Erzähler so:
Die nationalistische Armia Krajowa hatte die dunklen Menschen mit den klaren Gesichtzügen nicht haben wollen, sie schlug und tötete sie sechs Jahre lang, wo immer sie sie fand. Die Kommunisten dagegen nahmen sie sofort. (S. 233)[233]
Als in der Stadt ein Kind vermisst wird, denken die Einwohner sofort, dass es von den Juden entführt wurde. Sie gehen, mit Äxten und Latten bewaffnet, zum Gemeindehaus:
Was hinterher geschah, folgte einer altehrwürdigen Dramaturgie. Sie standen eine Weile – plötzlich verstummt – vor dem Judenhaus [...] dann schrie jemand laut, mit hartem ausländischen Akzent: „Sie haben ihn geschlachtet! Sie trinken gerade sein Blut!“ Und nun gab es entgültig kein Halten mehr, sie brachen die Tür auf, sie stürmten das Judenhaus [...] und manche Tarnówer, die besonders wütend und traurig waren, packten die jüdischen Kinder, sie trugen sie ans Fenster und warfen sie wie Müll hinaus. (S. 237f.)
Der Erzähler enthüllt, dass Geherman den polnischen Jungen mit Hilfe einer Tafel Schokolade überredet hatte, sich zu verstecken, um ein Pogrom zu provozieren. Er hatte Karriere in der Kommunistischen Partei machen wollen, wurde aber „schließlich jedoch selbst als Jude weggesäubert“ (S. 251).
In der Erzählung Lurie damals und heute versucht ein deutscher Historiker den Shoah-Überlebenden Luria zu einem Gespräch über seine wundersame Rettung bei einem Massaker, über seine dreijährige Flucht vor „dem deutschen Sicherheitsdienst und später auch den Verbänden der polnischen Armia Krajowa“ (S. 297) zu überreden. Lurie erinnert sich, wie er aus einem Massengrab heraussprang, nackt und mit Blut beschmiert durch die Felder lief und dann [...] auch die Polen bei der Osterprozession [sah], die ihm zuriefen, er, der Jude, solle zurück in sein Grab, aber er brüllte sie in einer plötzlichen Eingebung an: „Ich sehe aus wie Jesus, als er vom Kreuz genommen wurde, so voller Blut, so bin ich!“, worauf sie vor Schreck und Ehrfurcht zusammenfuhren und ihn laufenließen. (S. 300)
In der Erzählung Ich bin’s, George kommen im Gegenwartsdeutschland Deutsche, Juden, Ungarn und Polen zusammen. Die Deutschen sind schuldbewusst und den Juden gegenüber überkorrekt, die Ungarn haben den Juden auch während des Krieges geholfen, allein die Polen hassen Juden, interessieren sich nur für Geld und sind größenwahnsinnig. Ihre Einstellung kommt in der Textstelle, die einen in einem Restaurant arbeitenden Mann beschreibt, zum Ausdruck.
[Er] ist Pole, und vielleicht grinst er deshalb ständig so frech und eingebildet vor sich hin. Geld ist das einzige, was ihn interessiert, er hat drei Jobs gleichzeitig, er lebt mit seiner Familie in einer billigen Hausmeisterwohnung [...] und ich weiß genau, daß er vorhat, schon bald in seine Heimat zurückzugehen und das Warschauer Königsschloß aufzukaufen. (S. 354)
In Billers Erzählungen ist Polen ein ödes, weites, graues Land, das von Menschen bewohnt wird, die häufig als brutale, primitive, abergläubische Katholiken und unbelehrbare Antisemiten dargestellt werden. Währen der Shoah halfen sie den Juden nicht, und die polnische Untergrundarmee war für jüdische Flüchtlinge genauso gefährlich wie die deutschen Soldaten. Nach dem Ende des Krieges ließen sich Polen zu Pogromen provozieren, verfolgten die Überlebenden, wollten sich an deren Hinterlassenschaft bereichern und machten die Juden sogar für den Kommunismus verantwortlich. Das Polen der Gegenwart wird durch Dienstmädchen und Gastarbeiter repräsentiert. Die Frauen sind katholisch-fromm, dick, geschmacklos gekleidet und geschminkt; die Männer sind geldgierig und eingebildet, dazu fremdenfeindlich und primitiv. Die polnischen Juden in Deutschland bilden eine in sich geschlossene Gruppe. Sie bemühen sich nicht um Integration, obwohl sie erst in Deutschland die Möglichkeit hatten, Bildung und Wohlstand zu erlangen. Sie sind konservativ und bilden ein „Gruselkabinett“. Sie sind auf die Vergangenheit fixiert und sprechen nur über die Shoah.
1991 veröffentlichte Maxim Biller einen Essayband unter den Titel Die Tempojahre. Von einer Reise nach Polen berichtet Biller in dem Text Auschwitz sehen und sterben. Eine Gruppe junger Juden aus Deutschland fährt nach Polen, um dort mehrere Städte und Lager zu besichtigen. Zuerst kommen sie nach Krakau, wo die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde erzählt, wie sie „dieser antisemitischen Polacken-Bande das Minimum an Toleranz und Duldsamkeit [abtrotzt]“ (S. 115)[234].
In dem Text wird – im Zusammenhang mit der Shoah – von ‚den Polen’, aber selten von ‚den Deutschen’ gesprochen, sonder stattdessen von „den Nazi-Arschlöchern“ (S. 116) oder „HitlerHimmlerEichmann“ (S. 117). Deutschland „ist ein Ort des Vergessens“, der falschen Reue und des krankhaften Philosemitismus (S. 116). Deshalb haben die Jugendlichen in Polen ihr „erstes authentisches antisemitisches Erlebnis“ (S. 118) und lernen eine „lebendige[...] Judenfeindschaft“ (S. 120) kennen. Sie werden von den „Hep-Hep-Polacken“ (S. 119) mit einer „Leidenschaftlichkeit und obszönem Erfindungsreichtum“ (S. 125) beschimpft. Die Reisenden erinnern sich, dass die Polen während des Krieges die Juden verraten, und später „in einigen saftigen Pogromen“ (S. 119) viele der Shoah-Überlebenden umgebracht haben. Die Jugendlichen sind überzeugt, dass „die Deutschen den Löwenanteil ihrer Drecksarbeit gerade in Polen erledigten: weil sie hier auf Verständnis und Kooperation und Stillschweigen der Einheimischen zählen konnten“ (S. 120). Es kann auch zu keinem Dialog mit den Polen kommen, weil sie „mit bleichen, hochwangigen Gesichtern, [...] nun in ehemaligen jüdischen Häusern wohn[...]en und träge in ihren feindseligen Erinnerungen kram[...]en“ (S. 129). Erst bei der Rückfahrt diskutieren die Reisenden, ob es richtig gewesen war, die ganze Zeit über nur auf die Schweine-Polen zu schimpfen, die uns ja in der Tat mit einem frischen, authentischen Antisemitismus beschenkt hatten, während es so aussah, als hätten wir vergessen, wer die KZs erfunden und den Holocaust angezettelt hatte. Jetzt also endlich, nach einigem polemischen Hin und Her, erinnerten wir uns in einem kameradschaftlichen Konsens, daß es die Deutschen gewesen waren: allein die Deutschen. Und wir begriffen nun auch, weshalb wir ihre Schuld in den letzten zehn Tagen so kunstvoll verdrängt hatten: Wir lebten, wieder, in ihrem Land. (S. 130)
In seinem Essay Auschwitz sehen und sterben schreibt Biller über Polenwahrnehmungen und Einstellungen der Polen gegenüber den jüdischen – in Deutschland lebenden – Jugendlichen. Während der ganzen Reise nehmen sie nur den Antisemitismus der Polen wahr, andere Aspekte der polnischen Realität ignorieren sie. Sie erfahren Polen als ein Land der Pogrome und des Verrats. Die Polen waren und bleiben Judenhasser, die sogar nach der Shoah ihre Einstellung nicht ändern. Der offene Antisemitismus der Polen, der von dem Autor dem Verdrängen, aber auch der Reue der Deutschen gegenüber gestellt wird, lässt die Jugendlichen vergessen, dass die Lager auf polnischem Gebiet nicht von den Polen errichtet worden waren. Erst am Ende der Reise erkennen sie, dass sie durch die Konzentration auf den polnischen Antisemitismus nur davon ablenken wollen, dass sie in Deutschland – dem wahren Land der Täter – leben.
Seinen ersten Roman Die Tochter veröffentlichte Maxim Biller im Jahre 2000. Es ist die Geschichte eines Israeli, der in Deutschland Ruhe und Glück zu finden hofft. Er arbeitet als Türsteher im Restaurant der jüdischen Gemeinde in München. Er spricht von Deutschen und Polen, und für den Leser ist es nicht sofort ersichtlich, dass er damit die deutschen und die aus Polen stammenden Juden meint. Die Polen sind alt, reden „immer nur über die Lager“ (S. 146)[235], und das auf Polnisch oder Jiddisch (S. 254), deren Kinder sind depressiv, „verzogen und zugleich so seltsam in sich gekehrt“ (S. 94), sie lächeln mit „diesem deprimierten polnischen Lächeln“ (S. 321). Der Protagonist ist schockiert, als er erkennen muss, dass gerade in Deutschland und obendrein in seiner nächsten Umgebung, der Antisemitismus immer noch lebendig ist. Er stellt fest, dass seine deutsche Frau über ihn und seine Eltern „mit derselben Verachtung und Kälte [schimpft] [...], wie es sonst nur die primitivsten der primitiven Polen tun“ (S. 351). Viele Juden sind nach Israel ausgewandert, weil Deutschland sie zu sehr an Polen erinnerte (S. 238). Die in Israel lebenden, aber aus Deutschland stammenden Eltern des Protagonisten, die das deutsche Bildungsbürgertum in der neuen Heimat pflegen, empören sich über die „beiden Polacks“ (S. 344), die ein Antiquariat führen dürfen.
In dem Roman Die Tochter werden ‚Polen’ und ‚polnisch’ als Unterscheidungsmerkmale zwischen deutschen und den aus Polen stammenden Juden – aber auch deren Kindern – gebraucht. Die vom Autor als polnisch bezeichneten Juden werden mit konservativem Denken, Konzentriertheit auf die Shoah, neurotischen Störungen und Gewöhnlichkeit assoziiert. Die deutschen Juden sind – auch wenn sie außerhalb Deutschlands leben – mit der Kultur ihres Herkunftslandes tief verbunden und betonen den Unterschied zwischen ihnen und den ihrer Meinung nach unkultivierten polnischen Juden.
In der Erzählung Der echte Liebermann aus dem im Jahr 2004 veröffentlichten Band Bernsteintage wird das Thema Polen nur kurz gestreift. Einmal, indem der Ich-Erzähler von einem Bekannten, der „Lederjacken und veraltete deutsche Schulbücher nach Polen“ (S. 47)[236] schmuggelt, berichtet. Ein weiteres Mal, indem er von einem Freund erzählt, der sich in seinen Forschungen „mit derselben Verbissenheit [vertieft], der er sein Überleben in den polnischen KZs verdankte“ (S. 68).
Maxim Billers Texte weisen kein komplexes Polenbild auf. „Polacken“ werden hauptsächlich als Feinde der Juden und Unterstützer der Nazis dargestellt. Die Aussagen werden entweder von den als polnische oder deutsche Juden gekennzeichneten Figuren, oder von einem Erzähler getroffen. Außer in Auschwitz sehen und sterben werden sie nicht mit einer Gegendarstellung kontriert oder diskutiert, obwohl sich Biller in seinen Erzählungen sehr intensiv mit Vorurteilen, Projektionen und ideologisch vorgeprägten Meinungen auseinandersetzt.[237] Das Attribut ‚polnisch’ wird in Billers Prosa auch zur Grenzziehung zwischen West- und Ostjuden samt deren Nachkommen benutzt, und soll die als ‚Polen’ gekennzeichneten Figuren als vergangenheitsbezogen, rückständig, geistlos, neurotisch, wertkonservativ, rücksichtslos im Geschäftsleben, trotz Wohlstands sozial abgesondert, charakterisieren. Die Bezeichnung der aus Polen stammenden Juden als Polen ist – obwohl eindeutig negativ konnotiert – hinnehmbar. Dass die nationalsozialistischen Konzentrationslager „polnische KZs“ genannt werden, ist aber – bei einem Autor, der sich die Enttarnung falscher Geschichtsbilder auf die Fahnen schreibt – eine unzulässige Abkürzung. Billers Darstellungen begünstigen trotz aller Tabubrüche nicht die Entstehung eines tieferen Geschichtsbewusstseins, sondern konstruieren neue Geschichtsbilder, die sowohl die Shoah als auch das Leben der Juden im Deutschland der Gegenwart eindimensional interpretieren und verklären.
8.2.6. Doron Rabinovici
Doron Rabinovici wurde 1961 als Sohn osteuropäischer Juden in Tel Aviv geboren, lebt aber seit seinem dritten Lebensjahr in Wien. Er ist Publizist und Historiker, der sich auch im politischen Leben Österreichs rege engagiert. Sein literarisches Schaffen wird durch das Interesse an Bedingungen und Möglichkeiten des jüdischen Lebens in Österreich und Israel bestimmt.[238] Auch Polen wird in seinen Romanen gelegentlich thematisiert.
1997 veröffentlichte Rabinovici den Roman Suche nach M., der das Verhältnis der jungen Juden in Österreich zu ihren - durch die Shoah-Erfahrungen geprägten – Eltern und zu dem nicht-jüdischen Umfeld darstellt.[239] Die Eltern der beiden Protagonisten stammen aus Krakau. Einer der Väter machte dort vor dem Krieg eine akademische Karriere, „die den antisemitischen Verhältnissen in Polen und den Quoten, dem Numerus clausus für Juden, abgetrotzt war“ (S. 13)[240]. Der andere überlebte die Shoah, von „nichtjüdischen Freunden unterstützt“ (S. 28), am Stadtrand von Warschau. Jahrelang musste er reg- und sprachlos in seinem Versteck liegen bleiben. Trotzdem wurden er und seine Familie kurz vor dem Kriegsende von den Nachbarn entdeckt und denunziert. Die Eltern, trotz der in Polen gemachten Erfahrungen, fühlen sich noch mit dem Land und vor allem mit der Sprache verbunden. Auch zwanzig Jahre nach dem Krieg sprechen also diese Krakauer Juden, wenn sie etwas besonders Wichtiges oder Intimes besprechen wollen, polnisch. (S. 17)
In einem Kapitel wird ein Mann zufällig Zeuge eines Mordes. Die Polizei kann er aber nicht benachrichtigen, weil er dann zugeben müsste, mit einer polnischen Prostituierten, die ihm seine Geldbörse gestohlen hat, in einem Gebüsch gewesen zu sein. (S. 68) Der Zeuge und die Polin werden in dem Roman einzig an dieser Stelle erwähnt, die Szene hat keine Bedeutung für den Romanaufbau und dient nur der Milieuschilderung eines Stadtviertels der gesetzlichen Grenzzone, zu der nun polnische Prostituierte gehören sollen.
Ein Panorama des gegenwärtigen, multikulturellen Wiens wird in dem 2004 erschienenen Roman Ohnehin präsentiert. Der Protagonist wandert über den Gemüsemarkt, spricht mit den Händlern, beispielweise mit dem Sauerkrautverkäufer, der eine polnische Aushilfe beschäftigt. (S. 11)[241] Sie gehört zu dem multikulturellen Milieu, ist eine von vielen in Wien lebenden Ausländern.
Für Rabinovici ist Polen das Herkunftsland vieler in Deutschland lebender Juden. Auch in seinen Romanen wird der Antisemitismus der Polen angesprochen, aber nicht nur die verräterischen, sondern auch die Hilfe leistenden Polen werden erwähnt. Die aus Polen stammenden Juden hassen das Land nicht, Polnisch ist für sie immer noch die Sprache, in der sie ihre intimsten Gedanken am besten ausdrücken können. Gegenwartspolen wird durch Aushilfskräfte und Prostituierte vertreten. Im Gegensatz zu anderen Autoren ruft Polen keine starken Emotionen bei den Protagonisten hervor.
8.2.7. Vladimir Vertlib
Viele Erfahrungen mit fremden Kulturen machte Vladimir Vertlib. Der 1966 in Leningrad geborene Schriftsteller lebte in der Sowjetunion, in Israel, Italien, den USA, den Niederlanden und schließlich in Österreich. Emigrantenschicksale, Heimatlosigkeit, Integrationsschwierigkeiten und die Kälte und Lieblosigkeit der westlichen Gesellschaft sind die Hauptthemen seiner Texte.[242]
Die neunzigjährige Ich-Erzählerin des Romans Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur ist Anfang der neunziger Jahre aus Petersburg in eine deutsche Kleinstadt ausgewandert. Als eine Jahrhundertzeugin soll sie für ein Festbuch der Stadt von ihrem ereignisreichen Leben erzählen. Sie erinnert sich an ihre Kindheit an der polnisch-weißrussischen Grenze, wo sie als eins von vielen Kindern eines frommen Juden zur Welt kam. Ihre Schwester ist in den zwanziger Jahren nach Kanada ausgewandert und schrieb begeisterte Briefe über ihre neue Heimat:
Und jeden Tag marschieren junge Männer und Frauen zu den Bahnhöfen, um sich auf den Weg in den Westen zu machen, wo ganze Städte über Nacht entstehen. [...] Auch unsere ehemaligen lieben Nachbarn sind sehr zahlreich: Russen, Weißrussen, Ukrainer, Polen. Jeden Tag sehe ich ihre versoffenen Gesichter. Höre ich die schrillen Laute ihrer Sprachen, zucke ich zusammen. Doch sogar sie scheint der Wohlstand und Optimismus Kanadas milder und menschlicher gestimmt zu haben. Nie habe ich ein böses Wort von ihnen gehört. (S. 46)[243]
Deshalb versucht die Mutter den Vater zu überreden, mit der ganzen Familie auszuwandern:
In Kanada hat jeder Erfolg, der den Erfolg anstrebt. Hier aber, in diesem rückständigen Land mit seinen Mörderbanden, willigen Sklaven, Kürbisköpfen und brüchigen Gehirnen, wo Armut, Elend und Tristesse immer die Oberhand behalten und die Dummheit eine Kaiserkrone trägt, willst du, daß unsere Kinder aufwachsen? [...] Sie werden unsere Häuser niederbrennen! Man wird unsere Kinder erschlagen, wenn es das nächste Mal losgeht! (S. 48f.)
Während der Kriegsjahre[244] wurde das Dorf nacheinander von deutschen, russischen und polnischen Soldaten besetzt. Jüdische Familien verloren ihr Eigentum und oft auch ihr Leben: „Ein polnischer Soldat tritt meine schwangere Tante mit dem Stiefel in den Bauch. Sie stirbt unter schweren Krämpfen.“ (S. 86) 1922 kommen die Polen wieder:
Als die ersten polnischen Ulanen über die Hauptstraße unseres Dorfes ritten, kauerten die meisten Bewohner ängstlich in ihren Häusern. Fensterläden und Türen waren mit Brettern vernagelt. Wir befürchteten das Schlimmste. In einer ukrainischen Kleinstadt, erzählte man, hätten die Polen fast alle Juden in die Synagoge getrieben und diese dann angezündet, später die Asche der Toten von den noch lebenden Juden der Stadt auf Schubkarren laden und in den Fluß kippen lassen.
Die polnischen Eroberer von Witschi hatten aber offenbar nicht vor, die Juden des Dorfes bei lebendigem Leib zu rösten. Sie töteten und raubten vorerst nicht. (S. 88)
Später wurde das Dorf von einem polnischen Offizier regiert: „Pan Knofelewski mochte keine Juden, aber zu antisemitischen Ausschreitungen kam es nicht, solange er Herrscher unseres Dorfes war.“ (S. 85) Knofelewski war elegant, gepflegt, höflich, den Frauen gegenüber galant, deswegen wurde er zuerst bewundert. Leider entpuppte er sich als ein skrupelloser Gauner: Mit gefälschten Schuldscheinen raubte er den Juden ihr ganzes Eigentum.
Weigerte sich jemand zu verkaufen, wurde Pan Knofelewski nie laut, grob oder gar ausfallend. Er drohte nie, er handelte. Den Verweigerer ließ er nach einiger Zeit unter einem Vorwand festnehmen und ins Innere Polens deportieren. Sein Vermögen wurde nun ganz offiziell konfisziert. [...] Der katholischen Kirche spendete der Pan eine lebensgroße Statue der Mutter Gottes aus Marmor mit goldener Krone. [...] Die Menschen murrten, sie litten, sie beteten, aber jeder hatte Angst, die Ungnade des polnischen Pan auf sich zu ziehen. (S. 90f.)
Als die Sowjets das Dorf wieder übernahmen, ging die Ich-Erzählerin nach Leningrad, wo sie Germanistik studierte und mehrere Jahrzehnte lebte. Als Leningrad wieder Petersburg wurde und die Lage der Juden sich verschlechterte, wanderte ihr Sohn nach Deutschland aus. Sie folgte ihm. Dort – es ist die Jetztzeit des Romans - wird sie Zeugin der Festnahmen eines „völlig dunkelhäutigen Neger[s]“ (S. 95), der russisch spricht. Rosa übersetzt das Verhör und erfährt, dass der Afrikaner in Russland studierte und über Polen nach Deutschland reisen wollte. In Warschau wurde er aber „in einer Seitengasse niedergeschlagen und bestohlen“ (S. 101), deswegen kann er sich nicht ausweisen. Rosa glaubt nicht einen Moment, die Geschichte sei erfunden. Sie kennt die Grausamkeit der Polen den Fremden gegenüber.
In Vladimir Vertlibs Roman Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur wird das Ostpolen der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts geschildert. Die Polen sind versoffen, geldgierig, rau und rückständig. Sie leben im Elend und hassen ihre jüdischen Nachbarn. Ihre Sprache besteht aus schrillen Lauten. Polnische Soldaten, die für die Freiheit ihres Landes kämpfen, sind brutal und grausam. Der edle polnische Offizier ist ein galanter Betrüger und Erpresser. Die durch Pogrome gepeinigten Juden haben Angst vor den Polen und erzählen sich Geschichten über deren Grausamkeit, die sie alle für glaubwürdig halten, auch wenn sie selbst nicht betroffen sind. Dieses Polenbild hat sich bei ihnen offensichtlich so verfestigt, dass sie auch siebzig Jahre später, im Deutschland der neunziger Jahre es nicht in Frage stellen.
2003 veröffentlichte Vladimir Vertlib seinen neuesten Roman Letzter Wunsch. Ein junger assimilierter deutscher Jude muss die Beerdigung seines Vaters vorbereiten. Er erinnert sich an das Schamgefühl, das er während seines letzten Besuches in der Synagoge verspürte. Damals musste er mit seiner Schulklasse im Rahmen des ‚Vergangenheitsbewältigungsrituals’ eine jüdische Einrichtung aufsuchen und einen Vortrag des Gemeindevorstehers anhören, der mit einem unangenehm fremden polnischen Akzent von Schicksalen der Gemeindemitglieder erzählte. Die meisten von ihnen stammen aus Osteuropa, viele waren nach dem Krieg aus Polen geflüchtet. Der Vater des Rabbiners beispielweise, der den Krieg von polnischen Bauern versteckt überlebt hatte, „war 1946 vor den antisemitischen Ausschreitungen in seinem Heimatland Polen nach Deutschland geflüchtet“ (S. 288)[245]. Ein anderer Überlebender erzählt von seinem Weg nach Deutschland:
Nach dem Krieg wollte ich nach Palästina. Ich schlug mich in den Westen durch, eine abenteuerliche Reise durch Polen und die Tschechoslowakei. Da kann ich ihnen Geschichten erzählen. Immer wieder dieselben Schweinsgesichter, nur in anderen Uniformen...(S. 153)
Der Ich-Erzähler – ein junger Mann Mitte dreißig – hat keine eigenen Erfahrungen mit Polen, er kennt das Land nur aus den Erzählungen zufällig getroffener Juden. Sie berichten hauptsächlich über Pogrome, die auch nach 1945 stattfanden. Dabei ist ein detaillierter Bericht nicht notwendig, eine Andeutung, eine Erwähnung der „Schweinsgesichter“ reicht, damit die Gesprächspartner – und der Leser – seine Vorstellungen von den in Polen verübten Grausamkeiten aktivieren. So wird Polen – zu Beginn des 21. Jahrhunderts – zum Stichwort für das Leiden des jüdischen Volkes.
8.2.8. Zwischenresümee
Die deutsch-jüdischen Autoren aus der Generation der Nachgeborenen benutzen in ihren Texten Elemente eines Polenbildes insbesondere, um die Differenz zwischen West- und Ostjuden zu betonen und die eigene Entscheidung in Deutschland zu leben zu begründen.
Von Irene Dische werden polnische Juden als sonderbar und der westlichen Welt unangepasst beschrieben. Für Maxim Biller besteht ein unüberwindbarer Unterschied zwischen deutschen und polnischen Juden: Obwohl sie alle seit Jahrzehnten in Deutschland leben, bilden sie zwei sich ausschließende Gruppen. Billers Darstellungen sind polarisierend, schematisch und klischeehaft. Er geht davon aus, dass die aus Polen stammenden Juden dem assimilierten Westjudentum normativ fremd sind. Da Biller hauptsächlich für ein nicht-jüdisches Publikum schreibt, drängt sich die These auf, dass seine Autostereotypisierungen als Westjude den Erwartungen der Leser angepasst sind. Im Gegensatz zu Biller, der polnischen Juden pauschal negative Eigenschaften und Abneigung gegen Westjuden zuschreibt, betont Wladimir Vertlib, dass es die Westjuden sind, die Vorurteile gegen die Ostjuden hegen, weil sie ihnen gegenüber den deutschen Nichtjuden peinlich sind. Bei Rafael Seligmann indessen sind es polnische Juden, die sich den Westjuden überlegen fühlen. Nur Doron Rabinovici und Robert Schindel versuchen die Eigenart polnischer Juden zu verstehen ohne sie mit deutschen Juden zu vergleichen. Diese Autoren sehen zwar den Unterschied zwischen den beiden Gruppen, deuten ihn aber als eine kognitive Alterität und suchen nach Möglichkeiten des gegenseitigen Verstehens.
Für viele der jungen deutsch-jüdischen Autoren ist die von ihren Eltern getroffene Entscheidung, in Deutschland zu wohnen, eine große intellektuelle und emotionale Herausforderung. In ihren Texten setzen sie sich damit auseinander und versuchen die Motive ihrer Eltern zu verstehen. Bei Biller, Seligmann, Schindel und Vertlib ist die Antwort sehr ähnlich: Das Leben in den Herkunftsländern – hauptsächlich in Polen – war nicht möglich. Die Polen sind schlimmere Antisemiten als die Deutschen, in Polen waren und sind die Juden gefährdet. Keiner dieser Autoren bemüht sich um ein differenziertes Bild, die Polen werden pauschal verurteilt. Allein Seligmann deutet das Phänomen einer jüdisch-polnischen Hassliebe an. Rabinovici hingegen beschreibt den polnischen Antisemitismus als Grund für die Auswanderung vieler seiner Protagonisten, verurteilt aber nicht die Polen insgesamt, sondern zeigt in kurzen Polen betreffenden Passagen ein ambivalentes Bild an.
Wie aber selbst durch kurze Randbemerkungen ein differenziertes Polenbild gezeichnet werden kann, zeigt in ihren Texten Barbara Honigmann. Die Autorin durchbricht stereotype Wahrnehmungsmuster und entblößt starre Denkstrukturen. Die stereotypen Äußerungen der einzelnen Figuren werden von den aus anderen Kulturkreisen stammenden Beobachtern verständnislos aufgenommen und so in ihrer Inkonsequenz und Brüchigkeit entkräftet. Die von der Autorin dargestellte Konfrontation der Erfahrungen und Sichtweisen, die nicht abstrakt behandelt, sondern an konkrete Schicksale der meist entwurzelten Protagonisten geknüpft wird, baut keine neue Fremdheit auf. Im Gegenteil: Honigmann schafft Möglichkeiten des Verstehens. Auch die Werke von Irene Dische entwerfen kein eindimensionales Bild. Ihre polnischen Figuren entstammen alle dem Gastarbeitermilieu, werden jedoch unterschiedlich charakterisiert. Dische verwendet zwar viele stereotype Elemente – einige Figuren entsprechen dem Bild polnischer Frömmigkeit, Ruckständigkeit und betrügerischer Wirtschaft, andere sind an das karikierte Bild der ‚schönen Polin’, als einer weiblichen, wirkungsbewussten, übertrieben geschminkten und sogar gewaltbereiten gewöhnlichen Schönheit angelehnt –, diese Stereotype werden jedoch oft ironisch durchbrochen.
9. Zusammenfassung
Die Darstellung Polens und der Polen gehört in den Werken der deutsch-jüdischen Gegenwartsautoren – sowohl bei den Schriftstellern der ersten, als auch bei denen der zweiten Generation – nicht zu den wichtigen Themen. Es kann darin begründet sein, dass das zwischen Deutschland und Polen vielseitig verflochtene jüdische Leben mit der Shoah vernichtet wurde. Polen ist nicht mehr das Heimatland des orthodoxen Judentums, das viele der deutschsprachigen Autoren vor der Shoah zu einer Auseinadersetzung mit ihrer eigener Jüdischkeit bewegte.
Von den elf Autoren, deren Werke in dieser Arbeit analysiert wurden, hat nur André Kaminski direkte Erfahrungen mit dem Land und seinen Bürgern gemacht. Für alle anderen ist Polen entweder das Herkunftsland ihrer Vorfahren oder ein fremdes, unbekanntes Land zu dem sie keine persönliche Beziehung haben. Trotzdem kommen in ihren Texten Elemente eines Polenbildes – einzelne als Polen gekennzeichnete Figuren oder allgemeine Urteile über Polen – vor. In dieser Arbeit sollten mögliche Funktionen dieser Darstellungen untersucht werden.
Die Art der Fremdendarstellung wird von ästhetischen Überzeugungen und der Selbstwahrnehmung der eigenen gesellschaftlichen Rolle als Autor bestimmt. Diejenigen Autoren, die eine Aufklärerposition ihrer nicht-jüdischen Lesermehrheit gegenüber annehmen, versuchen bei der Darstellung des Eigenen und des Fremden das Universalitätskriterium zu erfüllen: Sie suchen nach Eigenschaften, die die Mehrheit der zu beschreibenden Gruppe charakterisieren sollen. Bei Maxim Biller und Rafael Seligmann sind es polarisierende Eigenschaften, die Kontraste aufbauen. Andere Autoren dagegen – wie Barbara Honigmann oder Irene Dische –, die dem Prinzip der Diversität entsprechend die Einmaligkeit ihrer Protagonisten zeigen, brauchen keine Kollektivkontraste zu konstruieren.
Ausgehend von der Feststellung, dass sich deutsch-jüdische Autoren nach 1945 zuerst mit der Verarbeitung der eigenen Kriegstraumata, später aber vor allem mit der Suche nach ihrer jüdischen Identität in Deutschland beschäftigen, dabei den Anspruch auf Realitätsnähe und gesellschaftliche Wirksamkeit stellen und sich als Anwälte aller unterdrückten Minderheiten sehen, kann behauptet werden, dass diese Merkmale auch die Darstellung der Fremden in ihren Texten beeinflussen.
Die sich auf der Suche nach ihrer eigenen jüdischen Identität befindenden Autoren benutzen verschiedene Strategien: Einige konstruieren eine Kollektividentität der Gesamtheit der deutschen Juden, andere versuchen unterschiedliche Identitäten innerhalb des Judentums zu beschreiben, wieder andere suchen nach ihrer eigenen unverwechselbaren Identität. Zu den letzten gehört Jeannette Lander. Ihre Protagonisten erfahren, dass Familie, Nation oder Geschlecht keine Kategorien der Identifikation sein können, dass nur auf Grund des eigenen Bemühens eine Selbstbeschreibung erfolgen kann. Das Gleiche lassen sie für alle anderen gelten, deshalb sind Fremde nicht auf Grund irgendwelcher abstrakter Zuschreibungen einschätzbar. Lander zeichnet sie stattdessen von verschiedenen Perspektiven aus, ohne eindeutige Identitätszuschreibungen vorzunehmen. Vergleichbar verfährt André Kaminski. Lander und Kaminski – obwohl beide vor dem Krieg geboren – waren von seinen Folgen nicht direkt betroffen. Beide lebten in Ländern, in denen Juden nicht verfolgt oder diskriminiert und nicht als ein homogenes Kollektiv gesehen wurden. In einer toleranten Gesellschaft brauchen Autoren sich keinen gesellschaftlichen Zwängen unterordnen, sondern können ihre Werke – wie alle anderen Schriftsteller – nach eigenen ästhetischen Prinzipien gestalten.
Anders sieht die Situation der Autoren aus, die glauben ihre Gemeinschaft darstellen, konstituieren oder sogar verteidigen zu müssen. Die Suche nach der Identität der eigenen Gemeinschaft zwingt sie zu klaren Zuschreibungen, die das Eigene vom Fremden unterscheiden. Leider wird das Fremde von Autoren wie Maxim Biller, Rafael Seligmann oder Ruth Klüger als das normativ Fremde dargestellt. Es ist kein Anderes, das man kennen lernen könnte, das Fremde wird dem Eigenen als Kontrast, als Bedrohung, als Feind gegenübergestellt. Diese Autoren nutzen unreflektiert den Fundus an alten Stereotypen und verfestigen damit die bestehenden Vorurteile.[246]
Eine interessante Ausnahme stellt die Prosa von Barbara Honigmann dar. Die Autorin zeigt unterschiedliche jüdische Gemeinden und deren gegenseitige Wahrnehmung, dabei werden andere Gruppen genauso differenziert vorgestellt. Die Pluralität der jüdischen Identitäten erlaubt auch eine Pluralität der Fremden, die als kognitiv fremd gesehen werden. Vergleichbar beschreibt Irene Dische die differenzierte Gesellschaft Deutschlands. Ohne zu werten, schildert sie Ereignisse aus dem gegenwärtigen Großstadtleben. Alte Ressentiments und Vorurteile werden in ihren Texten in alltäglichen Situationen geprüft und ironisch gebrochen.
Auch die Autoren, die das jüdische Leben in Deutschland als selbstverständlich betrachten, sehen sich nicht gezwungen die eigene Gemeinschaft verteidigen oder angreifen zu müssen. Einige Autoren dagegen versuchen ihr Verbleiben in dem Lande der Täter zu erklären oder sogar zu entschuldigen. Da viele Eltern der heute in Deutschland lebenden Juden aus Osteuropa stammen, versuchen deren Kinder ihre Entscheidung in Deutschland zu bleiben mit der Unmöglichkeit des Lebens in den Herkunftsländern zu erklären: Deshalb müssen die Polen schlimmer als die Deutschen sein.
Neben diesen neuen Themen wird in der deutsch-jüdischen Gegenwartsliteratur eine alte Kontroverse weiter fortgesetzt: die Auseinandersetzung zwischen West- und Ostjuden, zwischen den Befürwortern der Assimilation und den Bewahrern der kulturellen Eigenständigkeit. Dabei werden die alten Stereotype angewendet. Die Autoren, die sich als ein Teil der deutschen Gesellschaft sehen, die selbst areligiös sind und für ein modernes Judentum plädieren, sehen die traditionellen Juden als fremd an. Die orthodoxen Tendenzen werden von ihnen auch heute mit polnischen Juden in Verbindung gebracht, was einerseits den literarischen Vorbildern entspricht, anderseits auch durch die starke Präsenz der orthodoxen aus Osteuropa stammenden Juden im heutigen Israel beeinflusst sein kann. Diejenigen Autoren, die sich gegen eine Assimilation deutscher Juden aussprechen, weil sie den Verlust ihrer Identität fürchten, sehen in ‚polnischen Juden’ die Wächter von Tradition und Kultur.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die gegenwärtige deutsch-jüdische Literatur den alten Diskurs über die jüdische Identität in Deutschland weiterführt. Seine Inhalte haben sich – geprägt durch die Ereignisse der letzten fünfzig Jahre – geändert, sein Ziel ist seit Moses Mendelssohn und Heinrich Heine dasselbe geblieben. Und wie im 19. Jahrhundert bemühen sich einige Autoren um ein redliches Bild der Polen, und andere – durch Vorurteile und negative Emotionen beeinflusst – stellen das Land und seine Einwohner als das feindliche Fremde dar. So unterscheidet sich die deutsch-jüdische Literatur – trotz ihrer an sich selbst gestellten Ansprüche – nicht von anderen Literaturen.[247] Sie ist kein Gewissen und keine Mahninstanz per se, sondern besteht aus unterschiedlichen Texten, die das ganze Spektrum der möglichen Fremdendarstellungen beinhaltet.
10. Literaturverzeichnis
10.1. Primärliteratur
Biller, Maxim: Wenn ich einmal reich und tot bin. Erzählungen. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1990
Ders.: Die Tempojahre. München, dtv, 1991
Ders.: Land der Väter und Verräter. Erzählungen. München, dtv, 1997 (Erstauflage: Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1994)
Ders.: Die Töchter. Roman. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2000
Ders.: Bernsteintage. Sechs neue Geschichten. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2004
Dische, Irene: Fromme Lügen. Sieben Erzählungen. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1992 (Erstauflage: Frankfurt a.M., Eichborn, 1989)
Dies.: Der Doktor braucht ein Heim. Erzählung. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1990
Dies.: Ein fremdes Gefühl oder Veränderungen über einen Deutschen. Roman. Berlin, Rowohlt, 1993
Dies.: Die intimen Geständnisse des Oliver Weinstock. Wahre und erfundene Geschichten. Berlin, Rowohlt, 1994
Hilsenrath, Edgar: Der Nazi & der Friseur. 9. Aufl., München, Piper, 2001 (Erstauflage: Köln, Braun, 1977)
Ders.: Bronskys Geständnis. Roman. München u. Wien, Langen u. Müller, 1980
Ders.: Zibulsky oder Antenne im Bauch. Düsseldorf, Classen, 1983
Ders.: Jossel Wassermanns Heimkehr. München, Piper, 1993
Ders.: Die Abenteuer des Ruben Jablonski. Ein autobiographischer Roman. München, Piper, 1997
Honigmann, Barbara: Soharas Reise. Berlin, Rowohlt, 1996
Dies.: Am Sonntag spielt der Rabbi Fußball. Kleine Prosa. Heidelberg, Wunderhorn, 1998
Dies.: Damals, dann und danach. München, Hanser, 1999
Kaminski, André: Herzflattern. Neun wilde Geschichten. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1984
Ders.: Nächstes Jahr in Jerusalem. Roman. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1988 (Erstauflage: Frankfurt a.M. , Insel, 1986)
Ders.: Kiebitz. Roman. Frankfurt a.M., Insel, 1988
Ders.: Flimmergeschichten. Frankfurt a.M., Insel, 1990
Klüger, Ruth: weiter leben. Eine Jugend. 8. Aufl., München, dtv, 1994 (Erstauflage: Göttingen, Wallenstein, 1992)
Lander, Jeannette: Die Töchter. Frankfurt a.M., Insel, 1976
Rabinovici, Doron: Suche nach M.. Roman in zwölf Episoden. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1997
Ders.: Ohnehin. Roman. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2004
Schindel, Robert: Gebürtig. Roman. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1992
Seligmann, Rafael: Mit beschränkter Hoffnung. Juden, Deutsche, Israelis. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1991
Ders.: Musterjude. Hildesheim, Classen, 1997
Ders.: Schalom meine Liebe. Roman. München, dtv, 1998
Ders.: Der Milchmann. Roman. München, dtv, 1999
Vertlib, Vladimir: Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur. Wien u. Frankfurt a.M., Deuticke, 2001
Ders.: Letzter Wunsch. Roman. Wien u. Frankfurt a.M., Deuticke, 2003
10.2. Sekundärliteratur
Ackermann, Irmgard: Deutsche ver-fremdet gesehen. Die Darstellung des „Anderen“ in der „Ausländerliteratur“. In: Schreiben zwischen den Kulturen. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. / Hrsg. von Paul Michael Lützeler. Frankfurt a.M., Fischer (=Kultur und Medien; 12962), 1996. S. 211-221
Angelova, Penka: Narrative Topoi nationaler Identität. Der Historismus als Erklärungsmuster. In: Narrative Konstruktion nationaler Identität. / Hrsg. von Eva Reichmann. St. Ingbert, Röhring, 2000. S. 83-95
Anonym: Die kulturelle Rückständigkeit der polnischen Juden und ihre Hauptursache. In: Ost und West. Illustrierte Monatsschrift für das gesamte Judentum. 16. Jg. H. 1 (1916). Sp. 53-66
Arendt, Dieter: Geschicke und Geschichte in der deutschen Literatur oder „Noch ist Polen nicht verloren“. In: Hebbel-Jb. 1983. S. 41-88
Barese, Stephan: Überlieferungen. Zu einigen Deutschland-Erfahrungen jüdischer Autoren der ersten Generation. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, Schmidt (=Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie, 11), 2002. S. 17-28
Becker, Jurek: Der Tausendfüßler. In: Schreiben zwischen den Kulturen. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. / Hrsg. von Paul Michael Lützeler. Frankfurt a.M., Fischer (=Kultur und Medien; 12962), 1996. S. 55-64
Beller, Manfred: Vorurteils- und Stereotypenforschung – Interferenzen zwischen Literaturwissenschaft und Sozialpsychologie. In: Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. / Hrsg. von Alois Wierlacher. München, Iudicium (=Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik; 3), 1987. S. 665-678
Ders.: Typologia reciproca. Über die Erhellung des deutschen Nationalcharakters durch Reisen. In: Rom – Paris – London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler in den fremden Metropolen. Ein Symposion. / Hrsg. von Conrad Wiedemann. Stuttgart, Metzler (=Germanistische Symposien Berichtsbände; 8), 1988. S. 30-47
Berg, Max: Am Alten Markt zu Posen. Polenroman aus der deutschen Ostmark. Lissa, Ebbeckes, 1907
Bleicher, Günther: Einleitung des Herausgebers. Bedingungen literarischer Stereotypisierung. In: Erstarrtes Denken. Studien zu Klischee, Stereotyp und Vorurteil in englischsprachiger Literatur. / Hrsg. von Günther Bleicher. Tübingen, Narr, 1987. S. 9-25
Bleicher, Thomas: Elemente einer komparatistischen Imagologie. In: Komparatistische Hefte; 2 (1983) S. 12-24
Bock, Hans Manfred: Nation als vorgegebene oder vorgestellte Wirklichkeit? Anmerkungen zur Analyse fremdnationaler Identitätszuschreibungen. In: Nation als Stereotyp. Fremdwahrnehmung und Identität in deutscher und französischer Literatur. / Hrsg. von Ruth Florack. Tübingen, Niemeyer, 2000. S. 11-36
Brandt, Marion: „Polnische Freiheitsliebe“ – Anmerkungen zur Geschichte einer stereotypen Polenwahrnehmung. In: Convivium; germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn, DAAD, 2002. S. 253-279
Breysach, Barbara: “Schauplatz Polen”. Polenbilder und Polenmetaphern in deutschsprachiger Holocaust-Literatur. In: Convivium; germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn, DAAD, 1999. S. 163-186
Büker, Petra; Kammler, Clemens: Das Fremde und das Andere in der Kinder- und Jugendliteratur. In: Das Fremde und das Andere. Interpretationen und didaktische Analysen zeitgenössischer Kinder- und Jugendbücher. / Hrsg. von Petra Büker und Clemens Kammler. Weinheim u. München, Juventa (=Lesesozialisation und Medien), 2003. S. 7-39
Colin, Amy: Multikulturalismus und das Prinzip der Anerkennung in der zeitgenössischen deutsch-jüdischen Literatur. In: Schreiben zwischen den Kulturen. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. / Hrsg. von Paul Michael Lützeler. Frankfurt a.M., Fischer (=Kultur und Medien; 12962), 1996. S. 165-195
Corbineau-Hoffmann, Angelika: Einführung in die Komparatistik. Berlin, Schmidt, 2000
Chamot, Marek: Polnische Auto- und Heterostereotypen während des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Historische Stereotypenforschung. / Hrsg. von Heinz Henning Hahn. Oldenburg, Bis, 1995. S. 139-149
Eke, Norbert Otto: „Was wollen sie“ Die Absolution?“ Opfer und Täterprojektionen bei Maxim Biller. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, Schmidt (=Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie; 11), 2002. S. 89-107
Eshel, Amir: Zeit der Zäsur. Jüdische Dichter im Angesicht der Shoah. Heidelberg, Winter (=Beiträge zur neueren Literaturgeschichte; 169),1999
Döblin, Alfred: Reise in Polen. Olten u. Freiburg i.Br., Walter, 1968
Dyserinck, Hugo: Über neue und erneuerte Perspektiven der komparatistischen Imagologie angesichts der Reaktivierung der Beziehungen zum osteuropäischen Raum. In: Imagologica slavica. Bilder vom eigenen und dem anderen Land. / Hrsg. von Elke Mehnert. Frankfurt a.M., Lang (=Studien zur Reiseliteratur und Imagologieforschung; 1), 1997. S. 12-28
Ders.: Komparatistik als Europaforschung. In: Komparatistik und Europaforschung. Perspektiven vergleichender Literatur- und Kulturwissenschaft. / Hrsg. von Hugo Dyserinck und Karl Ulrich Syndram. Bonn u. Berlin, Bouvier (=Aachener Beiträge zur Komparatistik; 9), 1992. S. 31-62
Ders.: Komparatistische Imagologie. Zur politischen Tragweite einer europäischen Wissenschaft von der Literatur. In: Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. / Hrsg. von Hugo Dyserinck und Karl Ulrich Syndram. Bonn, Bouvier (=Aachener Beiträge zur Komparatistik; 8), 1988. S. 13-38
Ders.: Zur Entwicklung der komparatistischen Imagologie. In: Colloquium Helveticum; 7 (1988). S. 19-42
Ders.: Komparatistik. Eine Einführung. 2. durchges. Aufl. Bonn, Bouvier, (=Aachener Beiträge zur Komparatistik; 1), 1981
Ders.: Zum Problem der ‚image’ und ‚mirage’ und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft. In: Arcadia. Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft; 1 (1966). S.107-120
Feinberg, Anat: Die Splitter auf dem Boden. Deutsprachige jüdische Autoren und der Holocaust. In: Text und Kritik; Literatur und Holocaust; 144 (1999). S. 48-58
Feindt, Hendrik: Dreißig, sechsundvierzig, achtundvierzig, dreiundsechzig. Polnische Aufstände in drei Romanen von Freytag, Raabe und Schweichel. In: Studien zur Kulturgeschichte des deutschen Polenbildes 1848-1939. / Hrsg. von Hendrik Feindt. Wiesbaden, Harrassowitz (=Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt; 9), 1995. S. 15-40
Fischer, Manfred: Literarische Imagologie am Scheideweg. Die Erforschung des „Bildes vom anderen Land“ in der Literatur-Komparatistik. In: Erstarrtes Denken. Studien zu Klischee, Stereotyp und Vorurteil in englischsprachiger Literatur. / Hrsg. von Günther Bleicher. Tübingen, Narr, 1987. S. 55-71
Ders.: Nationale Images als Gegenstand vergleichender Literaturgeschichte. Untersuchungen zur Entstehung der komparatistischen Imagologie. Bonn, Bouvier, (=Aachener Beiträge zur Komparatistik; 6) 1981
Frank, Peter R.: Spiegelungen Polens in der deutschen Literatur von Opitz bis zu Grass. Skizzen zum Image/Mirage eines Volkes und zum historischen Hintergrund. In: Erkennen und Deuten. Essays zur Literatur und Literaturtheorie Edgar Lohner in memoriam. / Hrsg. von Martha Woodmansee und Walter F.W. Lohnes. Berlin, Schmidt, 1983, S. 172-195
Friedrich, Dorothea: Das Bild Polens in der Literatur der Weimarer Republik. Frankfurt a. M. [u.a.], Lang (=Europäische Hochschulschriften;1, 772), 1984
Geisenhanslüke, Achim: Einführung in die Literaturtheorie. Von der Hermeneutik zur Medienwissenschaft. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (=Einführungen Germanistik), 2003
Gilman, Sander L.: Rasse, Sexualität und Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der westlichen Kultur. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1992
Glasenapp, Gabriele von: Annäherung an Preußens östliche Kulturlandschaften. Oberschlesien und die Provinz Posen im Werk von Ulla Frankfurter-Wolff und Isaak Herzberg. In: Jüdische Autoren Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert. / Hrsg. von Hans Henning Hahn und Jens Stüben. 2. Aufl. Frankfurt a.M., (=Mitteleuropa – Osteuropa; 1), 2002. S. 20-24
Dies.: Aus der Judengasse. Zur Entstehung und Ausprägung deutschsprachiger Ghettoliteratur im 19. Jahrhundert. Tübingen, Niemeyer (=Conditio Judaica; 11),1996
Golczewski, Frank: Die Heimatarmee und die Juden. In: Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg. / Hrsg. von Bernhard Chiari unter Mitarb. Von Jerzy Kochanowski. München, Oldenbourg (=Beiträge zur Militärgeschichte; 57), 2003. S. 635-678
Hahn, Hans Henning: Einleitung. In: Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und empirische Befunde. / Hrsg. von Heinz Henning Hahn. Oldenburg, Bis, 1995. S. 7-13
Ders.: Stereotypen in der Geschichte und Geschichte im Stereotyp. In: Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und empirische Befunde. / Hrsg. von Heinz Henning Hahn. Oldenburg, Bis, 1995. S. 190-204
Heine, Heinrich: Über Polen. In: Ders.: Werke; Bd. 2. 5. Aufl., Frankfurt a.M., Insel, 2002.S. 75
Ders.: Ludwig Börne. Eine Denkschrift. In: Ders.: Werke; Bd. 4. 5. Aufl., Frankfurt a.M., 2002. S. 362
Hentschel, Gerd: Stereotyp und Prototyp. Überlegungen zur begrifflichen Abgrenzung vom linguistischen Standpunkt. In: Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und empirische Befunde. / Hrsg. von Heinz Henning Hahn. Oldenburg, Bis, 1995. S. 14-39
Jauß, Hans Robert: Wege des Verstehens. München, Fink, 1994
Jung, Werner: Neuere Hermeneutikkonzepte. Methodisches Verfahren oder geniale Anschauung? In: Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. / Hrsg. von Klaus-Michael Bogdal. 2. bearb. Aufl. Opladen, Westdeutscher Verl. (=WV studium; 156), 1997. S. 159-180
Kaiser, Gerhard R.: Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft. Forschungen – Kritik – Aufgaben. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980
Kilcher, Andreas B.: Exterritorialitäten. Zur kulturellen Selbstreflexion der aktuellen deutsch-jüdischen Literatur. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, Schmidt (=Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie, 11), 2002. S. 131-146
Ders.: “Was ist deutsch-jüdische Literatur?” In: Weimarer Beiträge; 45 (1999,4) S. 485-517
Klüger, Ruth: Dichten über die Shoah. Zum Problem des literarischen Umgangs mit dem Massenmord. In: Spuren der Verfolgung. Seelische Auswirkungen des Holocaust auf die Opfer und ihre Kinder. / Hrsg. von Gertrud Hardtmann. Gerlingen, Bleicher, 1992. S. 203-221
Kluge, Rolf-Dieter: Deutsche und Polen. Eine neuralgische Nachbarschaft im Spiegel der Literatur. In: Slavische Literaturen im Dialog. Festschrift für Reinhard Lauer zum 65. Geburtstag. / Hrsg. von Ulrike Jekusch und Walter Kroll. Wiesbaden, Harrassowitz, 2000. S. 439-457
Koch, Gertrud: Corporate Identities. Zur Prosa von Dische, Biller und Seligmann. In: Babylon: Beiträge zur jüdischen Gegenwart; 7. Frankfurt a.M., 1990. S. 139-142
Koenen, Gerd: „Vormärz“ und „Völkerfrühling“ – ein deutsch-polnischer Honigmond? In: Deutsche und Polen. Hundert Schlüsselbegriffe. / Hrsg. von Ewa Kobylinska, Andreas Lewaty und Rüdiger Stephan. München u. Zürich, Piper (=Serie Piper; 1538), 1992. S. 79-84
Köppen, Manuel: Auschwitz im Blick der zweiten Generation. Tendenzen der Gegenwartsprosa (Biller, Grossman, Schindel). In: Kunst und Literatur nach Auschwitz. / Hrsg. von Manuel Köppen. Berlin, Schmidt, 1993. S. 67-82
Koller, Werner: Stereotypes und Stereotype. Sozialpsychologische und linguistische Aspekte. In: Muttersprache; 108 (1998,1) S. 38-53
Konstantinovic, Zoran: Vergleichende Literaturwissenschaft. Bestandsaufnahme und Ausblicke. Bern [u.a.], Lang (=Germanistische Lehrbuchsammlung; 81), 1988
Koziełek, Gerard: Polen – der fremde Nachbarn. Zur Entstehung von Images. In: Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo 1990. Begegnungen mit dem „Fremden“; Grenzen – Traditionen – Vergleiche. Bd. 2: Theorie der Alterität. / Hrsg. von Eijiro Iwasaki. München, Iudicium, 1991. S. 271-279
Kraft, Thomas: The show must go on. Zur literarischen Situation der neunziger Jahre. In: Aufgerissen. Zur Literatur der 90er. / Hrsg. von Thomas Kraft, München u. Zürich, Piper, 2000. S. 11-22
Krause, Burkhardt: Mentalitätsgeschichte als vergleichende Kulturforschung. In: Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. / Hrsg. von Alois Wierlacher. München, Iudicium (=Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik; 3), 1987. S. 475-488
Król, Cezary: Stereotypy w stosunkach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. In: Tematy polsko-niemieckie. / Hrsg. von Elzbieta Traby, Robert Traby und Jörg Hackmann. Olsztyn, Borussia (=Biblioteka Borussii; 8), 1997. S. 43-93
Lamping, Dieter: „Deine Texte werden immer jüdischer“. Robert Schindels Gedicht „Nachthalm (Pour Celan)“. In: Deutch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, Schmidt (=Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie, 11), 2002. S. 29-43
Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2003
Lorenz, Dagmar C.G.: Erinnerung um die Jahrtausendwende. Vergangenheit und Identität bei jüdischen Autoren der Nachkriegsgeneration. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, Schmidt (=Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie, 11), 2002. S. 147-161
Mattern, Jens: Ricoeur zur Einführung. Hamburg, Junius (=Zur Einführung; 119), 1996
Mecklenburg, Norbert: Über kulturelle und poetische Alterität. Kultur- und literaturtheoretische Grundprobleme einer interkulturellen Germanistik. In: Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. / Hrsg. von Alois Wierlacher. München, Iudicium (=Publikationen der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik; 3), 1987. S. 563-583
Mestan, Antonin: Historische Prosa, historische Dramen und Filme als Wegbereiter der nationalen und nationalistischen Ideologie. Einige Beispiele aus slawischen Literaturen. In: Narrative Konstruktion nationaler Identität. / Hrsg. von Eva Reichmann. St. Ingbert, Röhrig, 2000. S. 43-52
Nolden, Thomas: Junge jüdische Literatur. Konzentrisches Schreiben in der Gegenwart. Würzburg, Königshausen und Neumann, 1995
Oberwalleney, Barbara: Heterogenes Schreiben. Positionen der deutschsprachigen jüdischen Literatur (1986-1998). München, Iudicium (=Cursus; 19), 2001
Orłowski, Hubert: Polnische Wirtschaft. Zur Karriere eines Stereotyps. In: Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung. / Hrsg. von Andrea Rudolph und Ute Scholz. Dettelbach, Röll (=Kulturwissenschaftliche Beiträge. Quellen und Forschungen; 1), 2002. S.173-193
Ders.: Polnische Wirtschaft. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit. Wiesbaden, Harrassowitz (=Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund, 21), 1996
Ders.: „Polnische Wirtschaft“. Zur Tiefenstruktur des deutschen Polenbildes. In: Fiktion des Fremden. Erkundung kultureller Grenzen in Literatur und Publizistik. / Hrsg. von Dietrich Harth. Frankfurt a.M., Fischer, 1994. S. 113-136
O’Sullivan, Emer: Das ästhetische Potential nationaler Stereotypen in literarischen Texten. Auf der Grundlage einer Untersuchung des Englandbildes in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur nach 1960. Tübingen, Stauffenburg (=Stauffenburg Colloquium; 8), 1989
Pinto, Diana: Juden im multikulturellen Europa? In: Babylon: Beiträge zur jüdischen Gegenwart; 19. Frankfurt a.M., 1999. S. 119-127
Połczynska, Edyta; Wojtczak, Maria: Die Provinz Posen in der deutschen Literatur um die Jahrhundertwende. In: Convivium, germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn, DAAD, 1996. S. 83-104
Reichardt, Ulfried: Alterität und Geschichte. Funktionen der Sklavendarstellung im amerikanischen Romanen. Heidelberg, Winter (=American studies; 86), 2001
Remmler, Karen: Orte des Eingedenkens in den Werken Barbara Honigmanns. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, Schmidt (=Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie, 11), 2002. S. 43-58
Rothe, Hans: Fremd- und Eigenbilder von und über Slaven, vornehmlich bei Polen und Russen. In: Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. / Hrsg. von Hugo Dyserinck und Karl Ulrich Syndram. Bonn, Bouvier (=Aachener Beiträge zur Komparatistik; 8), 1988. S. 295-319
Sauerland, Karol: „Das ostjüdische Antlitz“ in den Augen von Gustav Landauer, Arnold Zweig, Alfred Döblin und Joseph Roth. In: Convivium; germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn, DAAD, 1996. S. 107-132
Schindel, Robert: Schweigend ins Gespräch vertieft. Anmerkungen zu Geschichte und Gegenwart des jüdisch-nichtjüdischen Verhältnisses in den Täterländern. In: Text und Kritik; Literatur und Holocaust; 144 (1999). S. 3-8
Schmitz-Emans, Monika: Seetiefen und Seelentiefen. Literarische Spiegelungen innerer und äußerer Fremde. Würzburg, Könighausen und Neumann (=Saarbrücker Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft; 22), 2003
Schulze, Hagen: Das Europa der Nationen. In: Mythos und Nation. / Hrsg. von Helmut Berding. Frankfurt a.M., Suhrkamp (=Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, 3), 1996. S. 65-83
Schütze, Jochen K.: Von der mangelnden Fremdheit des Anderen. In: Jenseits des Diskurses. Literatur und Sprache in der Postmoderne. / Hrsg. von Albert Berger und Gerda Elisabeth Moser. Wien, Passagen (=Passagen Literatur), 1994. S. 57-75
Shedletzky, Itta: Ost und West in der deutsch-jüdischen Literatur von Heinrich Heine bis Joseph Roth. In: Von Franzos bis Canetti. Jüdische Autoren aus Österreich. Neue Studien. / Hrsg. von Mark H. Gelber. Tübingen, Niemeyer (=Conditio Judaica, 14), 1996. S. 189-200
Six, Bernd: Stereotype und Vorurteile im Kontext sozialpsychologischer Forschung. In: Erstarrtes Denken. Studien zu Klischee, Stereotyp und Vorurteil in englischsprachiger Literatur. / Hrsg. von Günther Bleicher. Tübingen, Narr, 1987. S. 41-53
Steinecke, Hartmut: „Deutsch-jüdische“ Literatur heute. Die Generation nach der Shoah. Zur Einführung. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, Schmidt (=Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie; 11), 2002. S. 9-16
Ders.: Deutsch-jüdische Literatur der „zweiten“ Generation und die Wende. „Geht jetzt wieder alles von vorne los“? In: Mentalitätswandel in der deutschen Literatur zur Einheit (1990-2000). / Hrsg. von Volker Wehdeking. Berlin, Schmidt (=Philologische Studien und Quellen; 165), 2000. S. 189-200
Stenzel, Franz K.: Der literarische Aspekt unserer Vorstellungen vom Charakter fremder Völker. In: Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; philosophisch-historische Klasse; 4 (1974). S. 63-82
Strümpel, Jan: Im Sog der Erinnerungskultur. Holocaust und Literatur – „Normalität“ und ihre Grenzen. Text und Kritik; Literatur und Holocaust; 144(1999). S. 9-18
Stüben, Jens: Deutsche Polen-Bilder. Aspekte ethnischer Imagotype und Stereotype in der Literatur. In: Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und empirische Befunde. / Hrsg. von Heinz Henning Hahn. Oldenburg, Bis, 1995. S. 41-74
Świderska, Małgorzata: Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie. Das literarische Werk F.M. Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung Polens. München, Sagner (=Slavistische Beiträge; 412), 2001
Syndram, Karl Ulrich: Ästhetische und nationale Urteile. Zur Problematik des Verhältnisses von künstlerischem Wert und nationaler Eigenart. In: Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. / Hrsg. von Hugo Dyserinck und Karl Ulrich Syndram. Bonn, Bouvier (=Aachener Beiträge zur Komparatistik; 8), 1988. S. 229-243
Szyrocki, Marian: Das Bild des Polen in der deutschen Literatur und das Bild des Deutschen in der Literatur der Volksrepublik Polen. Düsseldorf, Deutsche Fraternitas, 1974
Turk, Horst: Alienität und Alterität als Schlüsselbegriffe einer Kultursemantik. In: Jahrbuch für die internationale Germanistik; 22 (1/1990). S. 8-31
Wagenknecht, Christian: Isachar Falkensohn Behrs Gedichte von einem pohlnischen Juden. Ein Kapitel aus der Literaturgeschichte der Judenemanzipation. In: Juden in der deutschen Literatur. Ein deutsch-israelitisches Symposium. / Hrsg. von Stéphan Moses und Albrecht Schöne. Frankfurt a.M., Suhrkamp (=Materialien, 2063), 1986. S. 77-87
Wallas, Armin A.: Narrative Konstruktionen jüdischer Nationalität. In: Narrative Konstruktion nationaler Identität. / Hrsg. von Eva Reichmann. St. Ingbert, Röhring, 2000. S. 157-177
Weigel, Siegrid: Literatur der Fremde – Literatur in der Fremde. In: Gegenwartsliteratur seit 1968. / Hrsg. von Klaus Briegleb und Sigrid Weigel. München u. Wien, Hanser (=Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart; 12), 1992. S. 182-229
Wodak, Ruth; Cillia, Rudolf de, Reisigl, Martin; Liebhart, Karin; Hofstätter, Klaus; Kargl, Maria: Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität. Frankfurt a.M., Suhrkamp (=Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1349), 1998
Wolting, Stephan: „Lügen über Polen?“ Xenologische Betrachtungen zum Reisebericht am Beispiel von Polenreise in der deutschen Literatur nach 1945 In: Convivium; germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn, DAAD, 1998. S. 321-340
Zimniak, Pawel: Geschichte und Literatur. Zum Problem eines geschichtlichen Ereignisses in fiktionalen Texten. In: Convivium; germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn, DAAD, 1999. S. 9-22
Zitzewitz, Hasso von: Das deutsche Polenbild in der Geschichte. Entstehung – Einflüsse – Auswirkungen. Weimar u. Wien, Böhlau, 1992
Hiermit versichere ich, dass ich die vorgelegte Arbeit selbständig verfasste und keine anderen als die angegebenen und im Text als solche gekennzeichneten Quellen benutzte.
Mülheim a.d. Ruhr, 03.11.2004
[...]
[1] Vgl. dazu: Hugo Dyserinck: Komparatistik als Europaforschung. In: Komparatistik und Europaforschung. Perspektiven vergleichender Literatur- und Kulturwissenschaft. / Hrsg. von Hugo Dyserinck und Karl Ulrich Syndram. Bonn u. Berlin, 1992. S. 50f.
[2] Vgl. dazu: Antonin Mestan: Historische Prosa, historische Dramen und Filme als Wegbereiter der nationalen und nationalistischen Ideologie. Einige Beispiele aus slawischen Literaturen. In: Narrative Konstruktion nationaler Identität. / Hrsg. von Eva Reichmann. St. Ingbert, 2000. S. 43f.
[3] Hartmut Steine>
[4] Eine Erklärung des historischen Hintergrunds der deutsch-polnisch-jüdischen Beziehungen wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen. In den letzten Jahren ist dieses Thema ausführlich beschrieben worden. Vgl. dazu: Zwischen Abgrenzung und Assimilation. Deutsche, Polen und Juden. Schauplätze ihres Zusammenlebens von der Zeit der Aufklärung bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. / Hrsg. von Robert Maier und Georg Stöber. Hannover, 1996 oder: Deutsche – Juden – Polen. Ihre Beziehung von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. Beiträge zu einer Tagung. / Hrsg. von Stefi Jersch-Wenzel. Berlin, 1987
[5] Vgl. dazu: Gabriele von Glasenapp: Annäherung an Preußens östliche Kulturlandschaften. Oberschlesien und die Provinz Posen im Werk von Ulla Frankfurter-Wolff und Isaak Herzberg. In: Jüdische Autoren Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert. / Hrsg. von Hans Henning Hahn und Jens Stüben. 2. Aufl. Frankfurt a.M. [u.a.], 2002. S. 20-24
[6] Thomas Nolden: Junge jüdische Literatur. Konzentrisches Schreiben in der Gegenwart. Würzburg, 1995. S. 56f.
[7] Diana Pinto: Juden im multikulturellen Europa? In: Babylon: Beiträge zur jüdischen Gegenwart; 19 (1999). Frankfurt a.M., S. 120
[8] Vgl. dazu: Pawel Zimniak: Geschichte und Literatur. Zum Problem eines geschichtlichen Ereignisses in fiktionalen Texten. In: Convivium, 1999. S. 14f.
[9] Viele der jüngeren deutsch-jüdische Autoren sind auch als Feuilletonisten tätig, z.B. Maxim Biller und Rafael Seligmann, die in ihren Feuilletons oft Stellung zu aktuellen Ereignissen aus dem deutsch-jüdischen Zusammenleben nehmen. Als ein weiteres Kriterium des bewussten Bekenntnisses zu der genannten Gruppe kann auch die Zustimmung für die Aufnahme in das Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Stuttgart, 2000
[10] Kritisches Lexikon zur deutsprachigen Gegenwartsliteratur. 67. Nlg. 3/01
[11] Jurek Becker, der 1937 in Lódź geboren worden ist und in dessen Elternhaus Polnisch die Umgangssprache war, schreibt: „Mit polnischen Angelegenheiten beschäftige ich mich nie, die kenne ich nicht. Ich habe all das Polnische, mit dem ich je zu tun hatte, gründlich vergessen, und mein Vater, der es als einziger hätte verhindern können, hat sich nie als Pole gefühlt und war obendrein nicht gut auf Polen zu sprechen.“ Jurek Becker: Der Tausendfüßler. In: Schreiben zwischen den Kulturen. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. / Hrsg. von Paul Michel Lützeler. Tübingen, 1996. S. 56
[12] Die angeblichen ‚französischen Eigenschaften’ wie Leichtsinn, Oberflächlichkeit können mit physiologischen, rassistischen, psychologischen oder soziologischen Kategorien erklärt werden. Sie bleiben konstant, ihre Deutung passt sich den wissenschaftlichen Moden an. Vgl. dazu: Hans Manfred Bock: Nation als vorgegebene oder vorgestellte Wirklichkeit? Anmerkungen zur Analyse fremdnationaler Identitätszuschreibungen. In: Nation als Stereotyp. Fremdwahrnehmung und Identität in deutscher und französischer Literatur. / Hrsg. von Ruth Florack. Tübingen, 2000. S. 2f.
[13] Vgl. dazu: Franz K. Stenzel: Der literarische Aspekt unserer Vorstellungen vom Charakter fremder Völker. In: Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; 4 (1974). S. 68
[14] Anthony D. Smith schrieb 1992: „Es sind die Intellektuellen – Dichter, Musiker, Maler, Bildhauer, Romanciers, Historiker und Archäologen, Bühnenautoren, Philologen, Anthropologen und Volkskundler – die die Begriffe und die Sprache der Nation und des Nationalismus vorgeschlagen und ausgearbeitet haben vermittels ihrer Gedankenarbeit und ihrer Forschungen; sie haben den weiteren Bestrebungen einen Ausdruck verliehen, den sie in entsprechenden Bildern, Mythen und Symbolen vermittelt haben.“ Zit. nach: Bock, S. 35
[15] Vgl. dazu: Stenzel, S. 67
[16] Im Gegensatz zum französischen Konzept der Nation als einer politischen Gemeinschaft, entwickelte sich in Deutschland die Vorstellung der Nation als einer Kultur- und Sprachgemeinschaft. Auf Grund dessen konnte in dem Deutschen Wörterbuch aus dem Jahre 1776 die Nation so beschrieben werden: „Eine ausgezeichnete Denk- und Handlungsweise oder den Nationalgeist“. Die Denker der Romantik, vor allem J.G. Herder, sahen die Seele des Volkes in seinen Märchen und Liedern als eine „spirituelle menschliche Gemeinschaft“, ein Kollektivindividuum, dem jedes Mitglied schicksalhaft verbunden sei, offenbart. Jede Nation habe ein eigenes Wesen, aber keine habe einen Vorrang vor den anderen. Die Idee der Nation ersetzte also im säkularisierten Staat die religiöse Legitimierung der Macht, wurde zum Prinzip der Orientierung und Transzendenz. Vgl. dazu: Hagen Schulze: Das Europa der Nationen. In: Mythos und Nation. / Hrsg. von Helmut Berding. Frankfurt a.M., 1996. S. 70-75
[17] Horst Thomé: Vorbemerkung. In: Nation als Stereotyp. Fremdwahrnehmung und Identität in deutscher und französischer Literatur. / Hrsg. von Ruth Florack. Tübingen, 2000, S. 4
[18] Der Sozialwissenschaftler H.M. Bock schreibt über die Verbreitung der „Annahme, dass es sich bei der Kategorie >nationale Identität< um eine politisch-intellektuelle Projektion, um eine >vorgestellte< Wirklichkeit, nicht jedoch um einen naturgegebenen Sachverhalt oder um eine wesentliche >vorgegebene< Wirklichkeit handele“. Bock, S. 11. Auch in der Kulturanthropologie, Ethnologie oder Mentalitätsgeschichte hat die Auseinandersetzung mit dem Aspekt des Imaginären zur Entwicklung neuer Konzepte beigetragen. Vgl. dazu: Burkhardt Krause: Mentalitätsgeschichte als vergleichende Kulturforschung. In: Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. / Hrsg. von Alois Wierlacher. München, 1987. S. 482ff.
[19] Vgl. dazu: Hans Henning Hahn: Einleitung. In: Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und empirische Befunde. / Hrsg. von Hans Henning Hahn. Oldenburg, 1995. S. 8f.
[20] Zit. nach: Gerd Hentschel: Stereotyp und Prototyp. Überlegungen zur begrifflichen Abgrenzung vom linguistischen Standpunkt. In: Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und empirische Befunde. / Hrsg. von Hans Henning Hahn. Oldenburg, 1995. S.16
[21] Ebd. S. 34
[22] Hahn (1995), S. 12f.
[23] Ebd. S. 191
[24] Ebd. S. 203f. H.H. Hahn räumt aber auch die Möglichkeit des Entstehens eines Geschichtsbewusstseins ein, das durch „wenig resistente“ Geschichtsbilder hervorgerufen wird, indem man die „historische Erfahrung“ als einen „ständigen Prozeß versteht, als ein kontinuierliches Sich-Aneignen neuer Erfahrungen, die ihrerseits immer wieder alte Erfahrungen in Frage stellen, modifizieren oder gar umstoßen“. (S. 204)
[25] Hasso von Zitzewitz: Das deutsche Polenbild in der Geschichte. Entstehung – Einflüsse – Auswirkungen. Weimar u. Wien, 1992. S. 96f.
[26] Bock, S. 12
[27] Ebd., S. 12
[28] Interessanterweise waren es nicht die Geisteswissenschaftler, sondern die Nationalökonomen, Staatsrechtler und Historiker, die als erste ihre Zweifel an dem Vorhandensein der objektiven Volkscharaktere angemeldet hatten. Vgl. dazu Bock, S. 17f.
[29] Victor Klemperer: Das neue Frankreichbild (1914-1933). Ein historischer Überblick. In: Beiträge zur romanischen Philologie 1961. S. 30
[30] Ebd. S. 42f.
[31] Ebd. S. 32
[32] Ebd. S. 32f.
[33] Ruth Wodak [u.a.]: Zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität. Frankfurt a.M., 1998. S. 41ff.
[34] Bei der Analyse der Landes- und Nationsbeschreibungen ist es notwendig, eine historische Perspektive anzunehmen, da eine ahistorische Betrachtung die Gefahr einer Fehlinterpretation erhöht. Vgl. dazu: Manfred Beller: Vorurteils- und Stereotypenforschung – Interferenzen zwischen Literaturwissenschaft und Sozialpsychologie. In: Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. / Hrsg. von Alois Wierlacher. München, 1987. S. 670ff.
[35] Wodak, S 55
[36] Ebd., S. 61
[37] Vgl. dazu: Penka Angelova: Narrative Topoi nationaler Identität. Der Historismus als Erklärungsmuster. In: Narrative Konstruktion nationaler Identität. / Hrsg. von Eva Reichmann. St. Ingbert, 2000. S. 83f.
[38] Vgl. dazu: Monika Schmitz-Emans: Seetiefen und Seelentiefen. Literarische Spiegelungen innerer und äußerer Fremde. Würzburg, 2003. S. 25f.
[39] Günther Bleicher: Einleitung des Herausgebers: Bedingungen literarischer Stereotypisierung. In: Erstarrtes Denken. Studien zu Klischee, Stereotyp und Vorurteil in englischsprachiger Literatur. / Hrsg. von Günther Bleicher. Tübingen, 1987. S. 9f.
[40] Werner Koller: Stereotypes und Stereotype. Sozialpsychologische und linguistische Aspekte. In: Muttersprache; 108 (1/1998). S. 41
[41] Eine Erläuterung zu den in den literaturwissenschaftlichen Arbeiten benutzten Begriffen, die dem sozialwissenschaftlichen Begriff Stereotyp entsprechen, wird im Kapitel 3.4. gegeben.
[42] Vgl. dazu: Stanzel, S. 68f.
[43] Achim Geisenhanslüke: Einführung in die Literaturtheorie. Von der Hermeneutik zur Medienwissenschaft. Darmstadt, 2003. S. 11
[44] Koller, S. 42
[45] Eine literaturwissenschaftliche Untersuchung der Fremdenbilder darf nicht von ideologischem Denken beeinflusst werden. Es ist notwendig festzustellen, ob die in einem Text vorkommenden Klischees dazu dienen die Gunst der Leser zu erreichen, oder ob sie verwendet werden um später ad absurdum geführt zu werden; entstehen sie gewollt oder unbewusst? Wichtig ist auch zu untersuchen, ob es sich dabei um sorgfältig charakterisierte Protagonisten oder um Randfiguren handelt, die aus Gründen der Darstellbarkeit meistens sehr schematisch gezeichnet werden. Und schließlich ist es sehr wichtig, aus welcher Erzählperspektive die Merkmale des Fremden präsentiert werden, ob sie im auktorialen Kommentar, in der direkten oder erlebten Rede auftreten. Vgl. dazu: G. Bleicher, S. 13-19
[46] Thomas Bleicher: Elemente einer komparatistischen Imagologie. In: Komparatistische Hefte; 2 (1983). S. 12
[47] János Riesz: Zur Omnipräsenz nationaler und ethnischer Stereotype. In: Komparatistische Hefte; 2 (1983) S. 10f.
[48] Als universale menschliche Bestimmungen nannte Aristoteles Alter, Geschlecht, Stand und eben Land der Herkunft. Während der Klassizismus dem Universalitätsanspruch und den Kategorien des Schönen und des Erhabenen verbunden war, interessierten sich die Dichter der Romantik für das Neue, Ungewöhnliche, Irreguläre. Das Überraschende wurde zu einer neuen Quelle des ästhetischen Genusses. Vgl. dazu: Stanzel, S. 65-72
[49] Vgl. dazu: Werner Jung: Neuere Hermeneutikkonzepte. Methodisches Verfahren oder geniale Anschauung? In: Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. / Hrsg. von Klaus-Michael Bogdal. 2. bearb. Aufl. Opladen, 1997. S. 159
[50] Hans Robert Jauß: Wege des Verstehens. München, 1994. S. 22
[51] Ebd., S. 23
[52] Jens Mattern: Ricoeur zur Einführung. Hamburg, 1996. S. 76
[53] Ebd., S. 75
[54] Ebd., S. 101
[55] Ebd., S. 103
[56] Ebd., S. 117-133
[57] Ebd., S. 175f.
[58] Vgl. dazu: Malgorzata Swiderska: Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie; das literarische Werk F.M. Dostoevskijs aus imagologischer Sicht mit besonderer Berücksichtigung der Darstellung Polens. München, 2001. S. 82ff.
[59] Ebd., S. 59
[60] Ebd., S. 60
[61] Ebd., S. 61
[62] Ebd., S. 63
[63] Vgl. dazu: Emer O’Sullivan: Das ästhetische Potential nationaler Stereotypen in literarischen Texten. Auf der Grundlage einer Untersuchung des Englandbildes in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur nach 1960. Tübingen, 1989. S. 50
[64] Ebd. S. 54
[65] Stanzel, S. 69
[66] O’Sullivan, S. 58. Jegliche Überlegungen über Absichten des Autors sind nur unter der Voraussetzung der Existenz einer objektiven Wirklichkeit möglich. Deswegen sehen Konstruktivisten in einem Text keinen Bedeutungsstifter, sondern nur einen bloßen Reiz, der von dem Leser interpretativ verarbeitet wird. Vgl. dazu: Geisenhanslüke, S. 63
[67] Beller nennt drei Typen von Urteilen: Typologia analogica, Typologia antithetica und Typologia reciproca. Manfred Beller: Typologia reciproca. Über die Erhellung des deutschen Nationalcharakters durch Reisen. In: Rom – Paris – London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler in den fremden Metropolen. Ein Symposion. / Hrsg. von Conrad Wiedemann. Stuttgart, 1988. S. 41
[68] O’Sullivan, S. 62ff.
[69] Ebd., S. 66
[70] Ebd., S. 212ff.
[71] Zu Aufgaben der Komparatistik gehören laut Hugo Dyserinck: „Die Erforschung der Beziehungen zwischen mehreren Literaturen, um damit das Funktionieren der von der Literatur hervorgerufenen und von ihr getragenen Geistesbeziehungen zwischen den Sprach- und Kulturgebieten zu analysieren; die Erforschung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen verschiedenen Literaturen innerhalb bestimmter Perioden der internationalen Literaturgeschichte; ferner das Vergleichen – über die Grenzen hinweg – der Literaturtheorien, die in den jeweiligen zur Betrachtung herangezogenen Literaturgebieten entstanden sind; und schließlich auch die vergleichende Erfassung und Untersuchung der diversen literaturwissenschaftlichen Methoden in den betreffenden Gebieten.“ Hugo Dyserinck: Komparatistik. Eine Einführung. 2. Aufl., Bonn, 1981. S. 85
[72] Angelika Corbineau-Hoffmann: Einführung in die Komparatistik. Berlin, 2000. S. 171
[73] Ebd., S. 177. Als bedeutendster Kritiker der komparatistischen Imagologie ist René Wellek - als Vertreter der Meinung, dass Literaturwissenschaft sich mit ästhetischen und nicht gesellschaftlichen Phänomenen beschäftigen soll - zu nennen. Nachdem Jean-Marie Carré 1951 seine Auffassung, dass die Komparatistik sich v.a. mit den Vorstellungen von den anderen Ländern, die in den nationalen Literaturen präsent sind, beschäftigen soll, fragte Wellek, ob so verstandene Komparatistik noch zu der Literaturwissenschaft gehöre, oder ein Studium der öffentlichen Meinung, Völkerpsychologie und Soziologie sei. Vgl. dazu: Zoran Konstantinovic: Vergleichende Literaturwissenschaft. Bestandsaufnahme und Ausblicke. Bern [u.a.], 1988. S. 44ff. Außerdem warf Wellek den französischen Komparatisten vor, dass sie durch vergleichende Studien nur die Bedeutung der eigenen Nationalliteratur hervorheben wollten und an der Literatur selbst überhaupt nicht interessiert seien. Vgl. dazu: Dyserinck (1981), S. 54-57
[74] Vgl. dazu. Konstantinovic, S. 180-183
[75] Als Vordenker der Komparatistik in Deutschland sieht Dyserick unter anderen Johann Gottfried Herder als Erfinder des modernen Volksbegriffes, Hugo von Meltzl, der im Jahre 1877 die Zeitschrift Acta Comparationis Litterarum Universarum begründete und Max Koch, den Herausgeber der Zeitschrift für Vergleichende Literaturgeschichte. Dyserinck (1981), S. 19-27. Hugo Dyserinck selbst gehört zu den wichtigsten Image-Forschern in Deutschland. Er versteht Imagologie als eine ideologiefreie Disziplin der Literaturwissenschaft, und versucht die begrifflichen und methodologischen Schwierigkeiten zu beseitigen. Vgl. dazu: Swiderska, S. 24-29
[76] Dyserinck (1981), S. 85
[77] Vgl. dazu. Dyserinck (1981), S. 127-133
[78] Hugo Dyserinck: Zur Entwicklung der komparatistischen Imagologie. In: Colloquium Helveticum; 7 (1988). S. 26
[79] Die Beschäftigung mit den imagotypen Strukturen, die ihren Ursprung in der Literatur, Literaturkritik oder Literaturwissenschaft haben, erklärt Dyserinck nicht mit der selbstauferlegten Beschränkung auf den Forschungsbereich der traditionellen Literaturwissenschaft, sondern damit, dass es Elemente sind „die zum großen Teil in der Literatur entstehen, sich dort sehr deutlich manifestieren und von dort auch auf die politischen und sozialen Prozesse einwirken.“ Dyserinck, (1988; CH), S. 30
[80] Als Beispiel kann die Rezeption der flämischen Literatur in Deutschland dienen. Die meisten Übersetzungen und damit sehr breites Leserpublikum erreichen Werke, die dem gängigen Flamenbild entsprechen. Avantgardisten – wie z.B. Paul van Ostaijen, der zu den bedeutendsten Autoren des niederländischen Sprachraums gehört – finden keine Beachtung und keinen Verleger. Vgl. dazu: Hugo Dyserinck: Zum Problem der ‚image’ und ‚mirage’ und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft. In: Arcadia; Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft; 1 (1966). S. 115ff.
[81] Dyserinck (1981), S. 132. Vgl. auch: Hugo Dyserinck: Über neue und erneuerte Perspektiven der komparatistischen Imagologie angesichts der Reaktivierung der Beziehungen zum osteuropäischen Raum. In: Imagologica slavica. Bilder vom eigenen und dem anderen Land. / Hrsg. von Elke Mehnert. Frankfurt a.M., 1997. S. 18ff.
[82] Dyserinck (1997). S. 18
[83] Dyserinck (1981), S. 133
[84] Manfred Fischer: Nationale Images als Gegenstand vergleichender Literaturgeschichte. Untersuchungen zur Entstehung der komparatistischen Imagologie. Bonn, 1981. S. 23
[85] Vgl. dazu: Swiderska, S. 34ff. und 84f.
[86] Vgl. dazu: Conrad Wiedemann: Das Eigene und das Fremde. Zur hermeneutischen und geschichtlichen Problematik des Gegenstands. Einführendes Referat. In: Rom – Paris – London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler in den fremden Metropolen. Ein Symposion. / Hrsg. von Conrad Wiedemann. Stuttgart, 1988. S. 21ff.
[87] Jens Stüben: Deutsche Polen-Bilder. Aspekte ethnischer Imagotype und Stereotype in der Literatur. In: Historische Stereotypenforschung. / Hrsg. von Heinz Henning Hahn. Oldenburg, 1995. S. 54
[88] Vgl. dazu: Gerhard R. Kaiser: Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft. Forschungen – Kritik – Aufgaben. Darmstadt, 1980. S. 65
[89] Manfred Fischer: Literarische Imagologie am Scheideweg. Die Erforschung des „Bildes vom anderen Land“ in der Literatur-Komparatistik. In: Erstarrtes Denken. Studien zu Klischee, Stereotyp und Vorurteil in englischsprachiger Literatur. / Hrsg. von Günther Bleicher. Tübingen, 1987. S. 57
[90] Irmgard Ackermann: Deutsche ver-fremdet gesehen. Die Darstellung des „Anderen“ in der „Ausländerliteratur“. In: Schreiben zwischen den Kulturen. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. / Hrsg. von Paul Michael Lützeler. Tübingen, 1996. S. 211
[91] Laut Dyserinck setzt das Konzept des Heteroimages stillschweigend die Existenz eines Autoimages als Ausdruck des Verlangens nach Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft voraus. Bei dieser Voraussetzung ist folgende Frage berechtigt: „Warum sollte dieses Verlangen – etwa in der Form des Wunsches nach ‚Heimat’ und verbunden mit einem Bewusstsein von ‚Eigenheit’ – der Gruppen bzw. ‚Gemeinschaften’ nicht als ‚echtes’ Empfinden (statt als Ideologie bzw. Hordendenken) anerkannt werden dürfen? Und warum sollten diese ‚echten’ Gefühle nicht genauso aus der Literatur abgelesen werden können wie seinerzeit das so erfolgreiche falsche Bewusstsein des nationalen oder nationalistischen Denkens?“ Dyserinck (1992), S. 48
[92] Vgl. dazu: Bleicher, S. 18
[93] Vgl. dazu: Stüben, S. 42
[94] Vgl. dazu: Karl Ulrich Syndram: Ästhetische und nationale Urteile. Zur Problematik des Verhältnisses von künstlerischem Wert und nationaler Eigenart. In: Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. / Hrsg. von Hugo Dyserinck und Karl Ulrich Syndram. Bonn, 1988. S. 236f.
[95] Die Begriffe werden nicht ins Deutsche übersetzt, weil sie dadurch von den anderen gängigen Bezeichnungen nicht unterschieden werden könnten. Vgl. dazu: Swiderska, S. 128ff.
[96] Vgl. dazu: Ulfried Reichardt: Alterität und Geschichte. Funktionen der Sklavendarstellung im amerikanischen Romanen. Heidelberg, 2001. S. 45-59
[97] Ebd. S. 48
[98] Die Bezeichnungen Alienität und Alterität entstammen den lateinischen Adjektiven alius – anderer und alienus – fremder. Vgl. dazu: Swiderska, S. 16
[99] Vgl. dazu: Horst Turk: Alienität und Alterität als Schlüsselbegriffe einer Kultursemantik. In: Jahrbuch für die internationale Germanistik; 22 (1/1990). S. 8-11
[100] Jochen K. Schütze: Von der mangelnden Fremdheit des Anderen. In: Jenseits des Diskurses. Literatur und Sprache in der Postmoderne. / Hrsg. von Albert Berger und Gerda Elisabeth Moser. Wien, 1994. S.63f.
[101] Norbert Mecklenburg: Über kulturelle und poetische Alterität. Kultur- und literaturtheoretische Grundprobleme einer interkulturellen Germanistik. In: Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. / Hrsg. von Alois Wierlacher. München, 1987. S. 563-567
[102] Vgl. dazu: Petra Büker; Clemens Kammler: Das Fremde und das Andere in der Kinder- und Jugendliteratur. In: Das Fremde und das Andere. Interpretationen und didaktische Analysen zeitgenössischer Kinder- und Jugendbücher. / Hrsg. von Petra Büker und Clemens Kammler. Weinheim u. München, 2003. S. 9
[103] Vgl. dazu: Rolf-Dieter Kluge: Deutsche und Polen. Eine neuralgische Nachbarschaft im Spiegel der Literatur. In: Slavische Literaturen im Dialog. Festschrift für Reinhard Lauer zum 65. Geburtstag. / Hrsg. von Ulrike Jekusch und Walter Kroll. Wiesbaden, 2000. S. 446
[104] Dieter Arendt: Geschicke und Geschichte in der deutschen Literatur oder „Noch ist Polen nicht verloren“. In: Hebbel-Jb. 1983. S. 41f.
[105] Vgl. dazu: Marian Szyrocki: Das Bild des Polen in der deutschen Literatur und das Bild des Deutschen in der Literatur der Volksrepublik Polen. Düsseldorf, 1974. S. 3
[106] Hans Rothe: Fremd- und Eigenbilder von und über Slaven, vornehmlich bei Polen und Russen. In: Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. / Hrsg. von Hugo Dyserinck und Karl Ulrich Syndram. Bonn, 1988. S. 297f.
[107] Vgl. dazu. Cezary Król: Stereotypy w stosunkach polsko-niemieckich i niemiecko-polskich. In: Tematy polsko-niemieckie. / Hrsg. von Elzbieta Traby, Robert Traby und Jörg Hackmann. Olsztyn, 1997. S. 57f.
[108] Hubert Orłowski: „Polnische Wirtschaft“. Zur Tiefenstruktur des deutschen Polenbildes. In: Fiktion des Fremden. Erkundung kultureller Grenzen in Literatur und Publizistik. / Hrsg. von Dietrich Harth. Frankfurt a.M., 1994. S. 113f.
[109] Zit. nach: Gerhard Koziełek: Polen – der fremde Nachbar. Zur Entstehung von Images. In: Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo 1990. Begegnungen mit dem „Fremden“; Grenzen – Traditionen – Vergleiche. Bd. 2: Theorie der Alterität. / Hrsg. von Eijiro Iwasaki. München, 1991. S. 274f.
[110] Zit. nach: Kluge, S. 443
[111] Auf Menschen bezogene Urteile gab es jedoch auch, z.B. in den Briefen von Johann Gottfried Seume: „...überhaupt ist Dreck, wie Du wohl weißt, der Polen Element.“ Zit. nach: Hubert Orłowski: Polnische Wirtschaft. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit. Wiesbaden, 1996. S. 322
[112] Zit. nach: Orłowski (1994), S, 115
[113] Ebd., S, 116ff.
[114] J.G. Herder: August von Polen und Stanislaus der Erste. Zit. nach: Orłowski (1994), S. 118
[115] Zit. nach. Kluge, S. 445
[116] Zit. nach: Orłowski (1994), S. 123
[117] Zit. nach: Orłowski (1996), S. 331f.
[118] Ebd., S. 425f.
[119] Karl Marx: Manuskripte über die polnische Frage (1863-1864). Zit. nach: Frank, S. 181
[120] Vgl. dazu: Hendrik Feindt: Dreißig, sechsundvierzig, achtundvierzig, dreiundsechzig. Polnische Aufstände in drei Romanen von Freytag, Raabe und Schweichel. In: Studien zur Kulturgeschichte des deutschen Polenbildes 1848-1939. / Hrsg. von Hendrik Feindt. Wiesbaden 1995. S.19-30
[121] Gustav Freytag: Soll und Haben. Bd. 2. Leipzig, 1896. S. 155
[122] Vgl. dazu: Zitzewitz, S. 118ff. Orłowski bezeichnete Freytags Roman als “die ‘Bibel’ des wilhelminischen Leistungsbürgers”. Orlowski (1994), S. 125
[123] Vgl. dazu: Edyta Połczynska; Maria Wojtczak: Die Provinz Posen in der deutschen Literatur um die Jahrhundertwende. In: Convivium, 1996. S. 90-104
[124] Schon 1741 im Zedlers Grossen vollständigen Universal-Lexicon wird diese Bedeutung der Redewendung ‚polnischer Reichstag’ angegeben. Zit. nach: Orlowski (1994), S. 121f.
[125] Vgl. dazu: Król, S. 58
[126] Vgl. dazu: Peter R. Frank: Spiegelungen Polens in der deutschen Literatur von Opitz bis zu Grass. Skizzen zum Image/Mirage eines Volkes und zum historischen Hintergrund. In: Erkennen und Deuten. Essays zur Literatur und Literaturtheorie Edgar Lohner in memoriam. / Hrsg. von Martha Woodmansee und Walter F.W. Lohnes. Berlin, 1983, S. 180-184
[127] Gerd Koenen: „Vormärz“ und „Völkerfrühling“ – ein deutsch-polnischer Honigmond? In: Deutsche und Polen. Hundert Schlüsselbegriffe. / Hrsg. von Ewy Kobylinska, Andreas Lewaty und Rüdiger Stephan. München u. Zürich, 1992. S. 79-83
[128] Vgl. dazu: Marion Brandt: „Polnische Freiheitsliebe“ – Anmerkungen zur Geschichte einer stereotypen Polenwahrnehmung. In: Convivium, 2002. S. 253-264
[129] Der Abgeordnete W. Jordan argumentierte 1848: „Polen bloß deßwegen herstellen zu wollen, weil sein Untergang uns mit gerechter Trauer erfüllt, das nenne ich eine schwachsinnige Sentimentalität.“ Zit. nach: Hubert Orłowski: Polnische Wirtschaft. Zur Karriere eines Stereotyps. In: Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung. / Hrsg. von Andrea Rudolph und Ute Scholz. Dettelbach, 2002. S. 185
[130] Koenen, S. 84
[131] Als Epoche des Positivismus in der polnischen Literatur wird die Zeit zwischen Januaraufstand 1863 und der Revolution des Jahres 1905 bezeichnet.
[132] Vgl. dazu: Marek Chamot: Polnische Auto- und Heterostereotypen während des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Historische Stereotypenforschung. / Hrsg. von Heinz Henning Hahn. Oldenburg, 1995. S. 145f.
[133] Heinrich Heine: Ludwig Börne. Eine Denkschrift. In: Ders.: Werke; Bd. 4. 5. Aufl., Frankfurt a.M., 2002. S. 406ff. In derselben Schrift schreibt Heine aber auch: „Nein, Polen ist noch nicht verloren... Mit seiner politischen Existenz ist sein wirkliches Leben noch nicht abgeschlossen. [...] Es sind diesem Volke vielleicht noch Taten vorbehalten, die der Genius der Menschheit höher schätzt, als die gewonnenen Schlachten und das rittertümliche Schwertergeklirre nebst Pferdegetrampel seiner nationalen Vergangenheit!“. (S. 408)
[134] Heinrich Heine: Zwei Ritter. In: Ders.: Werke; Bd. 1. 5. Aufl., Frankfurt a.M., 2002. S. 136. In der polnischen Forschung wird aber betont, dass es Heine vor allem um eine Auseinandersetzung mit den deutschen Polenliedern geht, und nicht um ein Polenbild im imagologischen Sinne. Vgl. dazu: Stephan Wolting: „Lügen über Polen?“ Xenologische Betrachtungen zum Reisebericht am Beispiel von Polenreisen in der deutschen Literatur nach 1945 In: Convivium, 1998 S. 327f.
[135] Orłowski (1996), S. 191-207
[136] Heinrich Heine: Über Polen. In: Ders.: Werke; Bd. 2. 5. Aufl., Frankfurt a.M., 2002. S. 73
[137] Ebd., S. 75
[138] Alphons Heinrich Traupaur: Dreyßig Briefe über Galizien oder Beobachtungen eines unpartheyischen Mannes, der sich mehr als nur ein paar Monate in diesem Königreiche umgesehen hat. Zit. nach: Orłowski (1996), S. 216
[139] Orłowski (1996), S. 215
[140] Zit. nach: Orłowski (1996), S. 224
[141] Vgl. dazu: Dorothea Friedrich: Das Bild Polens in der Literatur der Weimarer Republik. Frankfurt a. M. [u.a.], 1984. S. 25-120
[142] Vgl. dazu: Barbara Breysach: “Schauplatz Polen”. Polenbilder und Polenmetaphern in deutschsprachiger Holocaust-Literatur. In: Convivium. 1999, S. 163-173
[143] Wolting, S. 329-334
[144] Zit. nach: Stüben, S. 63
[145] Zit. nach: Arendt, S. 78
[146] Vgl. dazu: Stüben, S. 65-74
[147] Die Tageszeitung; 12. Februar 1982. Zit. nach: Orłowski (1996), S. 383; Rudolf Augstein schrieb 1981 im Spiegel: „Daß die polnische Großmacht-Romantik vor der polnischen Ohnmacht war, kann ernstlich niemand bestreiten. Aber wenn der Chauvinismus aus der Schwäche entstanden ist, woher dann die Schwäche?“ Zit. nach: Marion Brandt: „Polnische Freiheitsliebe“ – Anmerkungen zur Geschichte einer stereotypen Polenwahrnehmung. In: Convivium, 2002. S. 264
[148] Ebd. S. 261
[149] Frank, S. 174
[150] Über Falkensohn Behr ist nicht viel bekannt: Er ist 1754 in Ostpolen oder Litauen geboren, war Moses Mendelssohns Schützling, studierte Medizin und arbeitete schließlich als Militärarzt in der Ukraine. Als Musterschüler ahmte er die deutschen Dichter nach, um als Fremde doch an der deutschen Kultur teilnehmen zu können. Vgl. dazu: Christian Wagenknecht: Isachar Falkensohn Behrs Gedichte von einem pohlnischen Juden. Ein Kapitel aus der Literaturgeschichte der Judenemanzipation. In: Juden in der deutschen Literatur. Ein deutsch-israelitisches Symposium. / Hrsg. von Stéphan Moses und Albrecht Schöne. Frankfurt a.M., 1986. S. 78-86
[151] Ebd., S. 84
[152] Ebd., S. 85
[153] Itta Shedletzky: Ost und West in der deutsch-jüdischen Literatur von Heinrich Heine bis Joseph Roth. In: Von Franzos bis Canetti. Jüdische Autoren aus Österreich. Neue Studien. / Hrsg. von Mark H. Gelber. Tübingen, 1996. S. 193
[154] Heine, Über Polen, S. 67f.
[155] Heine: Ludwig Börne. S. 362
[156] Vgl. dazu: Gabriele von Glasenapp: Aus der Judengasse. Zur Entstehung und Ausprägung deutschsprachiger Ghettoliteratur im 19. Jahrhundert. Tübingen, 1996. S. 1-6
[157] Vgl. dazu: Shedletzky, S. 192ff.
[158] Vgl. dazu: Karol Sauerland: „Das ostjüdische Antlitz“ in den Augen von Gustav Landauer, Arnold Zweig, Alfred Döblin und Joseph Roth. In: Convivium, 1996. S. 119
[159] Alfred Döblin: Reise in Polen. Olten u. Freiburg i.Br., 1968. S. 73. Über Lodz schreibend bemerkt Döblin: „Schrecklicher Haß der Deutschen und Polen! Die Völker schieben sich von Osten und Westen ineinander.“ Ebd. S. 310
[160] Zit. nach: Orłowski (2002), S. 179
[161] Vgl. dazu: Frank, S. 182
[162] Vgl. dazu: Sauerland, S. 115-123
[163] Anonym: Die kulturelle Rückständigkeit der polnischen Juden und ihre Hauptursache. In: Ost und West. Illustrierte Monatsschrift für das gesamte Judentum. 16. Jg. H. 1 (1916). Sp. 53-66
[164] Vgl. dazu: Friedrich, S. 309-313
[165] Max Berg: Am Alten Markt zu Posen. Polenroman aus der deutschen Ostmark. Lissa, 1907. S. 8
[166] Ebd., S. 12
[167] Ebd., S. 29
[168] Ebd., S. 89
[169] Ebd., S. 42
[170] Ebd., S. 39
[171] Frankfurter Rundschau 52 (1995). Zit. nach: Nolden, S. 26
[172] Eine chronologische Darstellung der Auseinandersetzung mit den Begriffen und Kategorien findet sich bei Andreas Kilcher. Andreas B. Kilcher: Was ist “deutsch-jüdische Literatur”? Eine historische Diskursanalyse. In: Weimarer Beiträge; 45 (4/1999). S. 485-517
[173] Der österreichische Schriftsteller Robert Schindel formuliert folgende Diagnose: „Das nichtjüdisch-jüdische Verhältnis hierzuorten war stets ein Täuschungsverhältnis, eine einseitige Gemeinheit, eine Perfidie, ein Skandal, ein Verbrechen; niemals symbiotisch, nie freundschaftlich, zu keiner Zeit egalitär, es war miserabel.“ Robert Schindel: Schweigend ins Gespräch vertieft. Anmerkungen zu Geschichte und Gegenwart des jüdisch-nichtjüdischen Verhältnisses in den Täterländern. In: Text und Kritik; Literatur und Holocaust; 144 (1999). S. 3
[174] Als ein Beispiel für unterschiedliche ästhetische Strategien kann ein Vergleich zwischen Maxim Biller und Doran Rabinovici dienen. Während Biller die Strategie der Polemik, der Polarisierung und des Zynismus wählt, benutzt Rabinovici das Erzählverfahren des Witzes. Beide wollen das Verschwiegene zur Sprache bringen: jener durch einen Schock, dieser mit Hilfe des Lachens. Vgl. dazu: Andreas B. Kilcher: Exterritorialitäten. Zur kulturellen Selbstreflexion der aktuellen deutsch-jüdischen Literatur. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, 2002. S. 141-146
[175] Vgl. dazu: Stephan Barese: Überlieferungen. Zu einigen Deutschland-Erfahrungen jüdischer Autoren der ersten Generation. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, 2002. S.23f.
[176] Rafael Seligmann: Mit beschränkter Hoffnung. Juden, Deutsche, Israelis. Hamburg, 1991. S. 80
[177] Vgl. dazu: Hartmut Steine>
[178] Sander L. Gilman: Rasse, Sexualität und Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der westlichen Kultur. Reinbek bei Hamburg, 1992. S. 254
[179] Vgl. dazu: Nolden, S. 9ff.
[180] Vgl. dazu: Barbara Oberwalleney: Heterogenes Schreiben. Positionen der deutschsprachigen jüdischen Literatur (1986-1998). München, 2001. S. 81f.
[181] Ebd., S. 71
[182] Ebd., S. 8f.
[183] Vgl. dazu: Dagmar C.G. Lorenz: Erinnerung um die Jahrtausendwende. Vergangenheit und Identität bei jüdischen Autoren der Nachkriegsgeneration. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah./ Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, 2002. S. 161
[184] Lorenz, S. 154
[185] Sigrid Weigel: Literatur der Fremde – Literatur in der Fremde. In: Gegenwartsliteratur seit 1968. / Hrsg. von Klaus Briegleb und Sigrid Weigel. München u. Wien, 1992. S. 193-207
[186] Amy Colin: Multikulturalismus und das Prinzip der Anerkennung in der zeitgenössischen deutsch-jüdischen Literatur. In: Schreiben zwischen den Kulturen. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. / Hrsg. von Paul Michael Lützeler. Tübingen, 1996. S. 174
[187] Thomas Kraft: The show must go on. Zur literarischen Situation der neunziger Jahre. In: Aufgerissen. Zur Literatur der 90er. / Hrsg. von Thomas Kraft, München u. Zürich, 2000. S. 11ff.
[188] Lorenz, S. 161
[189] Vgl. dazu: Nolden, S. 101
[190] Vgl. dazu: Jutta Dick: Lander, Jeannette. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 369ff.
[191] Alle Zitate nach der Ausgabe: Jeannette Lander: Die Töchter. Frankfurt a.M., 1976
[192] Hans Otto Horch: Edgar Hilsenrath. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 250
[193] Hilsenrath durchbricht in seinen Texten sowohl die anti- als auch die nach 1945 verlagspolitikkonformen philosemitischen Darstellungsmuster. Nolden, S. 82
[194] Alle Zitate nach der Ausgabe: Edgar Hilsenrath: Der Nazi & der Friseur. 9. Aufl., München, 2001
[195] Alle Zitate nach der Ausgabe: Edgar Hilsenrath: Bronskys Geständnis. Roman. München u. Wien, 1980
[196] Alle Zitate nach der Ausgabe: Edgar Hilsenrath: Zibulsky oder Antenne im Bauch. Düsseldorf, 1983
[197] Alle Zitate nach der Ausgabe: Edgar Hilsenrath: Jossel Wassermanns Heimkehr. München, 1993
[198] Alle Zitate nach der Ausgabe: Edgar Hilsenrath: Die Abenteuer des Ruben Jablonski. Ein autobiographischer Roman. München, 1997
[199] Zit. nach: Jan Strüpel: André Kaminski. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 53. Nlg. 02/96. S.3
[200] Vgl. dazu: Eva Lezzi: Kaminski, André. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 290-293
[201] Alle Zitate nach der Ausgabe: André Kaminski: Herzflattern. Neun wilde Geschichten. Frankfurt a.M., 1984
[202] Lezzi, S. 290
[203] Alle Zitate nach der Ausgabe: André Kaminski: Nächstes Jahr in Jerusalem. Roman. Frankfurt a.M., 1988
[204] Alle Zitate nach der Ausgabe: André Kaminski: Kiebitz. Roman. Frankfurt a.M., 1988
[205] Alle Zitate nach der Ausgabe: André Kaminski: Flimmergeschichten. Frankfurt a.M., 1990
[206] Vgl. dazu: Barbara Breysach: Klüger, Ruth. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 320f.
[207] Alle Zitate nach der Ausgabe: Ruth Klüger: weiter leben. Eine Jugend. 8. Aufl., München, 1994
[208] Ruth Klüger geht es in ihrem Buch nicht um eine Erklärung für die von ihr geschilderten antisemitischen Ausschreitungen in Polen. Sie quittiert es mit der Bemerkung, sie seien traditionell. In anderen Texten, wie beispielweise in ihrem Aufsatz über Jerzy Kosinskis Roman Der bemalte Vogel, vermochte sie aber durchaus von „Menschen, die aus Not und physischem Elend mitleidlos geworden sind nicht nur mit diesem Kind, sondern auch miteinander“ zu schreiben. Ruth Klüger: Dichten über Shoah. Zum Problem des literarischen Umgangs mit dem Massenmord. In: Spuren der Verfolgung. Seelische Auswirkungen des Holocaust auf die Opfer und ihre Kinder. / Hrsg. von Gertrud Hardtmann. Gerlingen, 1992. S. 217
[209] Vgl. dazu: Helene Schruff: Schindel, Robert. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 515ff.
[210] Dieter Lamping: „Deine Texte werden immer jüdischer“. Robert Schindels Gedicht „Nachthalm (Pour Celan)“. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, 2002. S. 31
[211] Manuel Köppen: Auschwitz im Blick der zweiten Generation. Tendenzen der Gegenwartsprosa (Biller, Grossman, Schindel). In: Kunst und Literatur nach Auschwitz. / Hrsg. von Manuel Köppen. Berlin, 1993. S. 71
[212] Alle Zitate nach der Ausgabe: Robert Schindel: Gebürtig. Roman. Frankfurt a.M., 1992
[213] Gertrud Koch: Corporate Identities. Zur Prosa von Dische, Biller und Seligmann. In: Babylon. Beiträge zur jüdischen Gegenwart; 7. Frankfurt a.M., 1990. S. 139
[214] Vlg. dazu: Helene Schruff: Seligmann, Rafael. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 528ff.
[215] Vgl. dazu: Anat Feinberg: Die Splitter auf dem Boden. Deutschsprachige jüdische Autoren und der Holocaust. In: Text und Kritik; Literatur und Holocaust; 144 (1999). S. 53
[216] Alle Zitate nach der Ausgabe: Rafael Seligmann: Musterjude. Hildesheim, 1997
[217] Alle Zitate nach der Ausgabe: Rafael Seligmann: Der Milchmann. Roman. München, 1999
[218] Vgl. dazu: Helene Schruff: Honigmann, Barbara. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 266ff.
[219] Vgl. dazu: Karen Remmler: Orte des Eingedenkens in den Werken Barbara Honigmanns. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah. / Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, 2002. S. 43
[220] Zu sephardischen Juden werden spanisch-portugiesische, afrikanische und orientalische Juden gerechnet. Mittel- und Osteuropäische Juden werden als Aschkenasim bezeichnet.
[221] Alle Zitate nach der Ausgabe: Barbara Honigmann: Soharas Reise. Berlin, 1996
[222] Barbara Honigmann: Am Sonntag spielt der Rabbi Fußball. Kleine Prosa. Heidelberg, 1998
[223] Jan Strümpel: Irene Dische. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 67. Nlg. 3/01. S. 2
[224] Alle Zitate nach der Ausgabe: Irene Dische: Fromme Lügen. Sieben Erzählungen. Reinbek bei Hamburg, 1992
[225] Alle Zitate nach der Ausgabe: Irene Dische: Der Doktor braucht ein Heim. Erzählung. Frankfurt a.M., 1990
[226] Alle Zitate nach der Ausgabe: Irene Dische: Ein fremdes Gefühl oder Veränderungen über einen Deutschen. Roman. Berlin, 1993
[227] Alle Zitate nach der Ausgabe: Irene Dische: Die intimen Geständnisse des Oliver Weinstock. Wahre und erfundene Geschichten. Berlin, 1994
[228] In den Jahren 1985 bis 1996 war Biller Kolumnist für das Zeitgeist-Magazin Tempo; seine Kolumne hieß „Hundert Zeilen Haß“. Vgl. dazu: Jan Strümpel: Maxim Biller. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 62. Nlg. 6/99. S. 2
[229] Vgl. dazu: Helene Schruff: Biller, Maxim. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M. 2003. S. 68ff.
[230] Alle Zitate nach der Ausgabe: Maxim Biller: Wenn ich einmal reich und tot bin. Erzählungen. Köln, 1990
[231] Strümpel, S. 4
[232] Alle Zitate nach der Ausgabe: Maxim Biller: Land der Täter und Verräter. Erzählungen. München, 1997
[233] Die Stellung der Armia Krajowa den Juden gegenüber war sehr differenziert. Einerseits leistete ein ihr untergeordnetes Judenreferat Hilfe für die Untergetauchten und lieferte jüdischen Kämpfern Waffen, anderseits dienten in der AK auch Soldaten, die aufgrund ihrer antisemitischen Vorurteile, oder weil sie unterstellten, dass die Juden die sowjetischen Kommunisten bevorzugen, nicht bereit waren, sie zu unterstützen. Eindeutig antisemitisch waren die Nationalen Streitkräfte (NSZ), die dem ultrarechten Flügel der polnischen Vorkriegsgesellschaft entstammen, aber im Vergleich mit AK nur eine kleine Untergrundgruppe bildeten. Eine differenzierte Analyse des Verhältnisses der Armia Krajowa zu Juden findet sich in: Frank Golczewski: Die Heimatarmee und die Juden. In: Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg. / Hrsg. von Bernhard Chiari unter Mitarb. von Jerzy Kochanowski. München, 2003, S. 635-678
[234] Alle Zitate nach der Ausgabe: Maxim Biller: Die Tempojahre. München, 1991
[235] Alle Zitate nach der Ausgabe: Maxim Biller: Die Tochter. Roman. Köln, 2000
[236] Alle Zitate nach der Ausgabe: Maxim Biller: Bernsteintage. Sechs neue Geschichten. Köln, 2004
[237] Vgl. dazu: Norbert Otto Eke: „Was wollen sie?“ Die Absolution?“. Opfer und Täterprojektionen bei Maxim Biller. In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah./ Hrsg. von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke. Berlin, 2002. S.96
[238] Helene Schruff: Rabinovici, Doron. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 477f.
[239] Vgl. dazu: Lorenz, S. 151
[240] Alle Zitate nach der Ausgabe: Rabinovici, Doron: Suche nach M.. Roman in zwölf Episoden. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1997
[241] Doron Rabinovici: Ohnehin. Roman. Frankfurt a.M., 2004
[242] Siglinde Bolbecher: Vertlib, Vladimir. In: Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. / Hrsg. von Andreas B. Kilcher. Frankfurt a.M., 2003. S. 584ff.
[243] Alle Zitate nach der Ausgabe: Vladimir Vertlib,: Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur. Wien u. Frankfurt a.M., 2001
[244] Gemeint ist der Erste Weltkrieg und der Krieg zwischen Polen und Sowjetrussland in den Jahren 1920 bis 1922.
[245] Alle Zitate nach der Ausgabe: Vladimir Vertlib: Letzter Wunsch. Roman. Wien u. Frankfurt a.M., 2003
[246] Diese Unreflektiertheit wird dadurch begünstigt, dass es sich hauptsächlich um Randbemerkungen oder Randfiguren handelt, Figuren also, die oft ohne besondere Aufmerksamkeit gezeichnet, oberflächlich skizziert und nur mit einzelnen typenbildenden Merkmalen ausgestattet werden.
[247] Andererseits darf nicht verschwiegen werden, dass nicht alle deutsch-jüdischen Autoren an sich selbst diesen Anspruch stellen, aber diejenigen, die es tun in der Öffentlichkeit und vor allem in den literaturwissenschaftlichen Arbeiten besonders viel Aufmerksamkeit finden. Das kann das Bild der gesamten deutsch-jüdischen Literatur verzerren. Die falschen Bilder der Literaturwissenschaftler wären aber ein Thema für eine andere Arbeit.
- Arbeit zitieren
- M.A. Beata Mache (Autor:in), 2005, Polenbilder in der deutsch-jüdischen Gegenwartsprosa, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109764
Kostenlos Autor werden

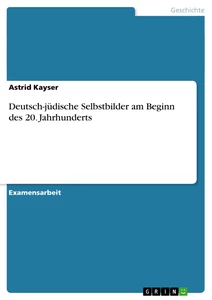












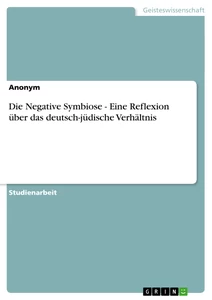







Kommentare