Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Person und Funktion eines Gesandten
2.1 Die Idealvorstellung vom Gesandten
2.2 Welcher Personenkreis kam tatsächlich in Frage?
2.3 Pflichten und Aufgaben von Gesandten
2.4 Hauptformen und Grundtypen von Gesandtschaften
3. Der Gesandte auf Mission
3.1 Begleitung und Zusammensetzung von Gesandtschaften
3.2 Die Reise
3.2.1 Das Geleitwesen
3.2.2 Weitere Strapazen und Gefahren
3.2.3 Geheimdiplomatie
3.3 Das Empfangszeremoniell
4. Die Übermittlung der diplomatischen Korrespondenz
5. Die Einrichtung ständiger Gesandtschaften
5.1 Erklärungen zu ihrem Aufkommen
5.2 Das Besondere an ständigen Gesandtschaften
6. Zusammenfassung
7. Literaturverzeichnis und Kurzzitate
1. Einleitung
Zur Begriffsabgrenzung sei vorausgeschickt: Während ein Gesandter diplomatische oder politische Gespräche stellvertretend für einen Herrscher am Hofe eines anderen führt, ist ein Bote ein einfacher Überbringer eines Briefes oder einer Nachricht. Kurier nennt man einen Boten, der Briefe eines Herrschers befördert (oft betrifft das den Briefwechsel zwischen einem Herrscher und seinen Gesandten).
Diplomatie bezeichnet die Summe des außenpolitischen Lebens eines Staates. Auf das 15. und 16. Jahrhundert angewandt, klingt der Begriff „Diplomatie“ eher ahistorisch, denn er erhielt seinen uns jetzt bekannten Sinn erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Davor verwendete man in der „allein maßgebenden Sprache der europäischen Wissenschaft“, dem Latein, nur die Wörter legatus und legatio – auf deutsch „Gesandter“, „Gesandtschaft“.[1]
Das Thema dieser Arbeit geht aus dem Schwerpunkt „Kommunikation“ des Proseminars hervor, wobei unter anderem über das mittelalterliche Botenwesen und die Entstehung des Postwesens im Heiligen Römischen Reich unter Kaiser Maximilian I. referiert wurde.
Da gegen Ende des 15. Jahrhunderts auch in der Diplomatie der damaligen Zeit, also im Gesandtschaftswesen, langsam eine umwälzende Neuerung Einzug gehalten hat, nämlich die der „ständigen Gesandtschaften“, und auch dies sich zeitlich in etwa mit dem Beginn der Neuzeit um 1500, wie wir ihn heute weiterhin anzusetzen gewohnt sind, deckt, ist es in einem Proseminar, in dem es um Periodisierung und Epochengrenzen geht, äußerst sinnvoll und interessant, das Gesandtschaftswesen dieser Zeit hier zu behandeln. Ein weiterer Grund, die Zeit Kaiser Maximilians I. (und das Reich) hervorzuheben, sind die umfassenden diesbezüglichen Forschungsarbeiten des Grazer Professors Wiesflecker, woraufhin in Graz einige Studien zu diesem Thema erschienen sind.
Da für meine Arbeit der Rahmen sehr begrenzt ist, habe ich mir das Ziel gesteckt, Allgemeines über das Gesandtschaftswesen zu dieser Zeit zu veranschaulichen und die eingetretene Innovation zu erklären. Da diese sich aus dem humanistisch-italienischen Raum heraus zu verbreiten begonnen hat und die Republik Venedig in ihrer verwaltungstechnischen Organisation besonders fortschrittlich gewesen ist, werde ich mich nicht nur auf das kaiserliche Reich festlegen, sondern auch den italienischen Raum, sowie punktuell die westeuropäischen Großmächte und Russland, in meine Beobachtung miteinbeziehen. Nicht eingehen werde ich jedoch auf die außenpolitischen Beziehungen und Verwicklungen der Mächte untereinander, sowie auf deren innere Strukturen oder allzu viele konkrete Namen, wie es in der Literatur über die Diplomatie und das Gesandtschaftswesen zahlreich der Fall ist und auch sein muss.
Da die Literatur und Forschungstradition zu meinem Thema mittlerweile so umfangreich ist, erwähne ich vorab nur einige wichtige der von mir benützten Autoren und Titel, die auf die älteren, grundlegenden Werke (mit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert) Bezug nehmen.[2] Den besten Überblick über die Forschungsgeschichte geben Christina Lutter, Politische Kommunikation an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit [3], Seite 13f, im Folgenden als Lutter, Politische Kommunikation zitiert, wobei es im Anhang auch ein großartig zusammengestelltes Literaturverzeichnis gibt, sowie Hermann Wiesflecker, Neue Beiträge zum Gesandtschaftswesen Maximilians I. [4], Seite 316f., zitiert als Wiesflecker, Neue Beiträge. Darüber hinaus seien der Aufsatz von Fritz Ernst, Über Gesandtschaftswesen und Diplomatie an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit [5], der die bisherige Forschung auf den Seiten 66-71 behandelt, in Folge als Ernst, Über Gesandtschaftswesen zitiert, und die in Wiesfleckers Tradition stehenden Höflechner und Naschenweng erwähnt: Walter Höflechners Anmerkungen zu Diplomatie und Gesandtschaftswesen am Ende des 15. Jahrhunderts [6], Seite 1, zitiert als Höflechner, Anmerkungen (mit diesem Beitrag publiziert er Ausführungen aus dem Teil II seiner Dissertation Beiträge zur Geschichte der Diplomatie und des Gesandtschaftswesens unter Maximilian I. 1490-1500 [7], zitiert als Höflechner, Diss. Bd.1), und Hannes P. Naschenwengs Dissertation Beiträge zur Geschichte der Diplomatie und des Gesandtschaftswesens unter Maximilian I. 1500-1508 [8], in deren Band 2, zitiert als Naschenweng, Diss. Bd.2, auf Seite 55f eine Literaturkritik zu finden ist.
2. Die Person und Funktion eines Gesandten
2.1 Die Idealvorstellung vom Gesandten
Bei Höflechner, Diss. Bd.1, sind zwei vielsagende Definitionen angeführt: „Gesandte sind Personen, die gewöhnlich von Fürsten ausgesandt werden, auf dass sie etwas zurückverlangen, Kriege erklären, Verträge schließen und alle notwendigen Geschäfte führen“. Dagegen wurden sie auch als „tüchtige Männer“ bezeichnet, „abgesendet, um fürs Vaterland zu lügen“. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, muss der Gesandte gewisse Eigenschaften besitzen.[9]
Deutsche Humanisten, Italiener und Franzosen haben (vor allem im 16. Jahrhundert) fast völlig übereinstimmend in Traktaten über das Gesandtschaftswesen ein Idealbild eines Gesandten mit seinen notwendigen Eigenschaften entworfen, das zeitlos ist und, auch auf heutige Diplomaten bezogen, nicht veraltet anmutet.
Dabei spielt etwa sein Alter eine Rolle: die Jugend ist für den Gesandtendienst untauglich. So beträgt z.B. das Mindestalter von venezianischen Gesandten 38 Jahre. Neben Erfahrung sind Tatkraft und Wissen weitere Grundforderungen. Ein für die damalige Zeit wesentliches Problem war es, welchen Standes der Gesandte sein sollte. Hier war man der Meinung, jeder sollte sich Gesandte aus seinem eigenen Stand nehmen. Vor allem aber waren Geistliche gefragt. Charakterlich gesehen soll der Gesandte ein aufrechter, tapferer, mäßiger, ausgeglichener und besonnener Mann sein, frei von allen Übeln, einer missgestalteten Figur oder körperlicher Invalidität. Ebenso sollte er selbstbeherrscht sein und sich vor Zorn und Ehrgeiz hüten, die ihn von seinen Pflichten ablenken würden. Überheblichkeit sei besonders tadelnswert. Das weibliche Geschlecht wurde, außer in Ausnahmefällen, nicht in Erwägung gezogen. Auch Bildung in den verschiedensten Bereichen und zeitgeschichtliches Wissen waren für Gesandte unumgänglich. Wesentlich ist also, dass in dieser Zeit nicht mehr die Geburt allein, sondern auch die sittlich-geistigen Eigenschaften von Gesandten maßgebend waren. Man war sich der Wichtigkeit des Amtes bewusst und hat erkannt, dass der Staat nicht nur durch einen hohen Adeligen mit entsprechend prächtigem und selbstbewusstem Auftreten repräsentiert werden kann, wenn diesem die notwendigen persönlichen Eigenschaften fehlen.[10]
Nach Bernard du Rosier, Erzbischof von Toulouse in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, sei es dagegen wesentlich, dass der Rang des Gesandten der Bedeutung seines Auftrages und der Würde des Adressaten entspreche. Denn es sei schädlich, hochrangige Persönlichkeiten mit geringen Angelegenheiten zu betrauen oder zu weniger würdigen Adressaten zu schicken. Ebenso sei es gefährlich, Personen niedrigen Ranges oder unerfahrene Gesandte in wichtigen Dingen zu bedeutenden Persönlichkeiten abzuordnen. Die von du Rosier geforderten persönlichen Eigenschaften entsprechen dem humanistischen Menschenbild. So dürfe ein fähiger Gesandter nicht stolz oder gar hochmütig sein, nicht neidisch und geizig, weder in Worten noch in Taten unehrlich, nicht verdrießlich, jähzornig, bösartig oder unverschämt. Er dürfe kein Spötter oder Einflüsterer sein, auch nicht abergläubisch oder zudringlich, weder ungerecht noch undankbar in seinen Gesten oder Worten. Weiters sei es ungünstig, wenn er genuss- oder trunksüchtig, geschwätzig, waghalsig und auf Ruhm bedacht wäre und sich überall vordränge. Außerdem dürfe er nicht kleinmütig, weder ungeduldig, noch träge, nicht falsch, kriecherisch, noch heuchlerisch sein. Hingegen müsse er rechtschaffen und ehrlich, demütig und bescheiden sein, maßvoll und diskret, offen und anständig, gerecht und fromm, freigiebig, klug, heiter und hochherzig, friedlich und freundlich, geschickt und mutig, umgänglich und zugänglich, sowie brillant und tapfer in allem, wofür er sich einsetze. Die Gesandten sollen sich bei den Verhandlungen „so klug wie Schlangen verhalten und so harmlos wie Tauben benehmen.“[11]
Dass solche ideellen Forderungen als unerfüllbar zu betrachten sind, leuchtet ein. Sie konnten der viel komplexeren Wirklichkeit kaum gerecht werden.
2.2 Welcher Personenkreis kam tatsächlich in Frage?
Klargestellt werden muss: Solange Gesandtschaften grundsätzlich nur ad hoc ins Ausland geschickt wurden, besteht kaum die Möglichkeit, Diplomatie als Beruf zu betrachten. Ein derartiger Beruf entwickelte sich erst sehr viel später, und die ersten Schulen zur Erziehung zukünftiger Diplomaten entstanden erst im 18. Jahrhundert.[12]
Bei Lutter, Politische Kommunikation, sind die Kriterien, nach denen Kaiser Maximilian I. seine Gesandten ausgewählt hat, am ausführlichsten erklärt.
Während die venezianischen oratores[13] im Wesentlichen die Führungsschicht der Republik repräsentierten, waren die Gesandten des Reiches dagegen nach regionaler Herkunft, sozialem Rang, Alter, Ausbildung und sonstigen Qualifikationen höchst verschieden. Ihre Entsendung erfolgte aus bestimmtem Anlass, für kurze Dauer und in großer Zahl. Auf Kontinuität wurde wenig Wert gelegt.[14] Im Ganzen waren etwa 300 Gesandte für Maximilian während seiner 25 Regierungsjahre unterwegs.[15]
Die wichtigsten Kriterien für Bestellung und Auswahl bestanden in der Finanzkraft der Kandidaten und in ihren bisherigen Verdiensten und Erfahrungen. Demgegenüber hat die „Unabhängigkeit von fremden Fürsten bzw. Mächten“ auf höchster Ebene kaum eine Rolle gespielt. (Gerade im maximilianischen Gesandtschaftswesen finden sich zahlreiche Personen, die im Laufe ihrer diplomatischen Tätigkeit nacheinander oder gleichzeitig, offiziell oder inoffiziell Diener mehrerer Herren waren[16] ). Bei der territorialen Herkunft waren in erster Linie die persönlichen Bindungen des Königs in den Gebieten seiner Hausmacht und in den königsnahen Landschaften von Bedeutung. Die soziale Herkunft hat ebenfalls kein ausschlaggebendes Kriterium dargestellt. Träger verantwortungsvoller Positionen waren bei ihrem Amtsantritt meist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Persönliche Eigenschaften, wie Unbestechlichkeit oder Verschwiegenheit, wurden zwar in ihrem Diensteid festgelegt, jedoch sind großteils praktische Erwägungen bei der Auswahl ausschlaggebend gewesen.
Die wichtigsten Gruppen der maximilianischen Gesandten bestanden aus hohen geistlichen Würdenträgern, engen Ratgebern des Königs und Mitgliedern des Innsbrucker Regiments. Ebenfalls aus gelehrten Juristen, die meist gleichzeitig dem geistlichen Stand angehörten, Hauptleuten aus den südöstlichen Grenzgebieten der habsburgischen Herrschaft sowie Personen italienischer Herkunft, die Maximilian aus den Diensten anderer Fürsten (besonders nach dem Ende der Unabhängigkeit des Königreichs Neapel und des Herzogtums Mailand) übernommen hatte.[17]
Aber auch „hervorragende Bürger aus Reichsstädten“ konnten zu diplomatischen Aufgaben herangezogen werden. Der Stand der Gesandten richtete sich meist nach der Wichtigkeit der Mission und dem Ansehen des Adressaten.[18]
Da also der Repräsentationscharakter von Gesandtschaften eine Rolle spielte, waren etwa beim Einsatz hoher geistlicher Würdenträger und hochrangiger wie enger Ratgeber des Königs die Aspekte der Finanzkraft, des sozialen Ranges und des Einflusses bei Hof, sowie der genauen Kenntnis der politischen Pläne Maximilians ausschlaggebend. Ein Großteil jener Personen, die an Vertrags- und anderen maßgeblichen Verhandlungen beteiligt waren (wozu z.B. auch die Abschlüsse der großen Heiratsverträge zählen[19] ), sind dieser Gruppe zuzurechnen, wie die Bischöfe von Brixen (Melchior von Meckau) und Trient (Ulrich von Liechtenstein, Georg von Neideck).[20] Als die „hervorragendsten Vertrauensleute des Kaisers“ seien Florian Waldauf, Wolfgang Polheim, Zyprian Serntein, Matthäus Lang, Johann Cuspinian oder Matthäus Schiner genannt.[21]
Der Aspekt der persönlichen Finanzkraft spielte auch bei den venezianischen Diplomaten eine nicht unerhebliche Rolle. Während diese jedoch ein gesetzlich festgelegtes monatliches Entgelt erhielten, erfolgte die Besoldung maximilianischer Gesandter wesentlich weniger regelmäßig und war um einiges bescheidener. Oft trugen die höheren Würdenträger Maximilians I., dessen Finanzorganisation sich erst im Aufbau befand, die Kosten der diplomatischen Aufträge selbst.[22]
Besonders für das „Reich“ markant war, dass zur Austragung der zahlreichen Grenzstreitigkeiten zwischen Maximilian und Venedig, aber auch zur Erörterung des geplanten Romzugs des Königs durch venezianisches Gebiet, zumeist Hauptleute aus dem Grenzgebiet eingesetzt wurden.[23] Aber auch Pfleger oder Richter. Diese hatten von ihren Standorten aus die politischen Vorgänge in der Nachbarschaft zu verfolgen, darüber zu berichten und nicht selten über kaiserlichen Auftrag als Unterhändler oder Gesandte über die Grenzen hinweg zu wirken.[24] Der doppelte Vorteil dieser „Nachbarschaftsdiplomatie“ bestand darin, dass diese Gesandten meist gleichzeitig Amtsträger Maximilians waren (sie standen an der Spitze eines Hochstifts, eines Klosters oder einer Domprobstei und verfügten über Besitz oder Lehen in unmittelbarer Nachbarschaft[25] ) und aus der Gegend stammten. So konnte der König sowohl von ihrer profunden Sach- und Personenkenntnis als auch von ihrem persönlichen Interesse an der Lösung des jeweiligen Problems ausgehen.[26] Auch konnten sie ohne großen Zeitverlust eingreifen.[27]
Daneben versuchte der Kaiser auch innerhalb der Nachbarländer, etwa in der Eidgenossenschaft oder am ungarischen Hof, Vertrauensleute zu halten und zu bezahlen, welche die Aufträge des Kaisers und des Reiches ständig vertreten sollten.[28]
Die zahlreichen maximilianischen Gesandten, welche aus italienischsprachigen Gebieten stammten, wurden vor allem für die „italienischen“ Angelegenheiten Maximilians eingesetzt. Dazu zählte etwa die diplomatische Kommunikation mit dem Papst (wobei sich besonders Luca de Renaldis auszeichnen konnte[29] ) sowie die Vertretung in Angelegenheiten der traditionell beanspruchten Reichsrechte in Italien.[30]
Naheliegend ist auch, dass Kaufleute und Bankiers dem Herrscher mitunter diplomatische Hilfe leisteten, ebenso hohe Finanzbeamte des Monarchen, wie etwa Jakob Villinger. Diplomatische Post hat man nicht selten den zuverlässigen Verbindungen der Fugger und Welser zur Besorgung übergeben. Die von der Familie Taxis in dieser Zeit eingerichtete Post war in ihren Ursprüngen hauptsächlich diplomatischer Kurierdienst.[31]
Bei all dieser scheinbar ungeordneten Vielfalt diplomatischer Dienste blieb stets der Kaiser selber der Kopf der Politik und Diplomatie. Er leitete und ordnete alles und betonte stets, dass ohne sein Vorwissen nichts Wichtiges geschehen dürfe. So liefen am (was zu dieser Zeit wieder eigentümlich für das Reich ist) wandernden Kaiserhof letzten Endes alle Fäden zusammen. Später trat der persönliche Sekretär des Kaisers, auch Rat und Kardinalminister, Matthäus Lang immer mehr hervor, den Maximilian fallweise sogar als seinen Stellvertreter oder Statthalter bezeichnete und mit den größten außenpolitischen Aufgaben betraute.[32]
2.3 Pflichten und Aufgaben von Gesandten
Besonders Höflechner, Diss. Bd.1, hat diese Frage umfangreich ausgearbeitet. Jedoch wird sie erst in späteren Kapiteln weitreichender beantwortet werden.
Der venezianische Diplomat Navagero gab folgende Definition: „Die Geschäfte des Gesandten sind dreifach: Verstehen, wozu Einsicht, Unterhandeln, wozu Geschicklichkeit, Referieren, wozu Urteil gehört, um das Notwendige und das Nützliche zu sagen“.
Die Grundbedingung lautete, dass der Gesandte keinem fremden Auftrag folgen und nichts nach seinem eigenen Willen tun solle. Gehorsam dem eigenen Herrn gegenüber war also die Grundlage, auf der das Vertrauensverhältnis des Gesandten zu seinem Herrn aufgebaut war. Denn dieser händigte ihm eine Vollmacht aus – eine Instruktion – in seinem Sinne zu handeln.[33]
Am genauesten und deutlichsten waren die Verhältnisse in der Signorie [34] von Venedig geordnet. Dort gab es „echte und gültige“, mehrmals erneuerte Gesetze für Gesandtschaften. Diese befassten sich unter anderem eingehend mit der Frage, was denn zu unternehmen sei, wenn sich der Erwählte weigerte, seinen Gesandtschaftsdienst anzunehmen. Denn ein Gesandtenamt zu übernehmen, dürfte zu allen Zeiten eine teure Angelegenheit gewesen sein. Aber auch der venezianische Edle wird nicht immer mit einer Nominierung für eine Gesandtschaft etwa nach England (wegen der Strapazen und Gefahren, worauf ich noch eingehen werde) erbaut gewesen sein. Da in Venedig der Kreis der Wählbaren stark eingeschränkt war, legten die Venezianer in vielen Verordnungen seit dem Jahr 1271[35] fest, dass das Gesandtenamt angenommen werden müsse. Im Falle einer Weigerung wurde die Zahlung hoher Geldstrafen angeordnet, die nicht gnadenhalber erlassen werden durfte. Seine Abreise an seinen Bestimmungsort musste innerhalb einer festgelegten Frist erfolgen. Als Entschuldigungsgrund sollte allein schwere Krankheit gelten. Im Reich unter Maximilian I. war es dagegen möglich, sich von einer Gesandtschaft durch Entschuldigung frei zu machen.[36]
Die zweite Pflicht nach dem Gehorsam war jene der Berichterstattung. Überall sind Anweisungen an den Gesandten zu finden, er möge berichten und wieder berichten. So sind Gesandtenberichte wichtige Quellen für die Geschichtsforschung, auch für die politische Geschichte. Die wertvollsten Berichte sind die venezianischen dispacci (Depeschen), kurze briefliche Zwischenberichte, die noch unter dem Eindruck des geschilderten Ereignisses geschrieben sind.[37] Sie wurden von den Gesandten unterwegs oder von seinem Bestimmungsort aus abgefertigt, und zwar je nach Dringlichkeit der Situation und Informationsfülle bis zu täglich. Diese Briefe enthalten detaillierte Informationen über Audienzen und Gespräche mit dem Adressaten, aber auch mit den Personen seiner Umgebung, und darüber hinaus über alle Vorgänge, die in irgendeiner Weise für die Republik von Interesse sein konnten.
Davon zu unterscheiden sind die relazioni (Relationen) venezianischer Gesandter, jene Abschlussberichte ihrer Missionen, die längstens 15 Tage nach deren Heimkehr (so war es seit 1268 gesetzlich geregelt) dem Senat mündlich vorgetragen und seit 1425 auch schriftlich abgeliefert werden mussten.[38]
Im Reich Maximilians dagegen wurden solche Finalrelationen in schriftlicher Form nicht verlangt, ihm dürften die Gesandten nach deren Rückkehr wohl nur mündlich berichtet haben.[39]
Gesandtenberichte enthalten verschiedenste Mitteilungen, so unter anderem auch über die eigenen Spione, sofern diese nicht sogar dem Gesandten unbekannt waren. Speziell bei einer größeren Mission war der Gesandte das Zentrum eines eigenen Apparates im Ausland.
Darüber hinaus ist der Gesandtenbericht ein wichtiger Faktor im Ablauf der Diplomatie. Nach seinen Angaben wurden oft genug die Ziele der Außenpolitik gesteckt, und die Verhandlungen und anzuwendenden Methoden waren völlig von ihm abhängig.
Schließlich waren Gesandtenberichte auch die Grundlage für die Verhandlungen der Konstituenten (das sind jene, die den Gesandten auf Mission geschickt haben) mit den Gesandten des Partners, der ihm gegenüberstehenden Macht. So erhielten z.B. die spanischen Könige schon vorher Nachricht, wer als Gesandter erscheinen und was er etwa fordern werde.[40]
War ein Gesandtschaftsverhältnis einseitig, hatte also nur die eine Macht einen Gesandten beim Partner akkreditiert, so hatte dieser Gesandte eine zweifache Vermittleraufgabe. Er berichtete nicht nur an seine Konstituenten, sondern auch an den Adressaten über seine Auftraggeber. Damit ging fast die gesamte Korrespondenz zwischen beiden Staaten über eine Person.[41]
Grundlage für die Berichterstattung waren wiederum andere Pflichten des Gesandten: die Beobachtung und Auswertung aller Informationsquellen. Er wurde immer wieder aufgefordert, alles, was er wahrnehmen könne, scharf zu beobachten. So etwa die Kampfweise der Truppen im fremden Staat, die Befestigungen, die Seefahrt, Verwandtschaften, Feindschaften etc. Doch konnte der Gesandte allein nicht alles sehen, was notwendig wäre, und gewisse Sphären blieben ihm verborgen, während er sich beim Adressaten und in dessen Land aufhielt, wenn er nicht, wie der bekannte spanische Gesandte Rodrigo Gondisalvo de Puebla, in die untersten Schichten der Bevölkerung hinabging, die oft recht ergiebige Quellen waren. Zu diesem Zweck dienten die Konfidenten, Spione und Spitzel, all die geheimen Nachrichten- und Zuträgersysteme, die sich gleichermaßen aus Kaufleuten rekrutierten wie aus höchsten Persönlichkeiten, die sich im Pensionsverhältnis zum Konstituenten befanden.
Der Gesandte musste z.B. aber auch auf kleinste Unterschiede beim Zeremoniell achten, die nur schwer erkennbar waren. Denn es war von Bedeutung, ob er stehend oder sitzend empfangen wurde, wo er empfangen wurde oder wann er seine Antrittsaudienz beim Adressaten erhielt.
Selbstverständlich war es, dass der Gesandte so lange auf einem Posten ausharrte, wie es sein Auftraggeber forderte, und nicht etwa aus eigener Initiative heimkehrte.[42]
Neben diesen Aufgaben hatten die Gesandten auch noch Repräsentationspflichten, die sich meist auf Besuche bei den einflussreichsten Persönlichkeiten beschränkten. (Doch auch repräsentative Aufgaben bei Hochzeiten, Krönungen und Weihen gehören hierher[43] ). Auch auf der Reise selbst hatten sie derartige Pflichten, falls sie solchen Personen begegnen sollten.
Der Gesandte war aber nicht nur Organ seiner Regierung, sondern vertrat auch die Interessen seiner eigenen Landsleute im betreffenden Land. Unter Umständen hatte er auch die Gerichtsgewalt über seine Landsleute. Solche Abmachungen bestanden aber nur dann, wenn ein Gesandter länger im Lande weilte und wenn eine größere Zahl von Landsleuten im betreffenden Land lebte.
Teilweise, scheinbar nur in Venedig, haben Gesandte sogar ihre Abschiedsgeschenke vom Adressaten bei der Heimkehr abgeben müssen, nur um objektiv zu bleiben. Benefizien und Lehen durften sie entweder gar nicht, oder aber nur mit Zustimmung der Konstituenten annehmen. Sich zum Ritter schlagen zu lassen, war ihnen dagegen gestattet.
Dass der Gesandte zur Geheimhaltung seiner Aufträge und Korrespondenzen verpflichtet war, versteht sich von selbst.[44] Auch sollte er seine Reise auf dem schnellsten Weg hinter sich bringen und sich beim Adressaten um eine Audienz bemühen.[45]
2.4 Hauptformen und Grundtypen von Gesandtschaften
Schon am Ende des 19. Jahrhunderts teilte Adolf Schaube, einer der wichtigsten und ältesten deutschen Forscher über das Gesandtschaftswesen, in seinem Artikel Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Gesandtschaften [46], in Folge als Schaube, Entstehungsgeschichte zitiert, die (ursprünglichen) gelegentlichen Gesandtschaften, also jene, die von Fall zu Fall ausgesandt wurden, in drei Hauptformen ein:
die Höflichkeitsgesandtschaft, die die Teilnahme einer Regierung oder eines Staates an einem „für das Wohl und Weh“ eines anderen Staates bedeutungsvollen Ereignis (wie z.B. einer Hochzeit oder einem Todesfall) zum Ausdruck bringt oder demselben ein ähnliches den eigenen Staat betreffendes Ereignis meldet die verhandelnde Gesandtschaft, die einen vertragsmäßigen Rechtszustand zwischen zwei Staaten schaffen, einen bestehenden abändern, einen verletzten herstellen, oder auch nur bestimmte einzelne Vorteile erlangen oder Nachteile abwenden will und die Aufklärungsgesandtschaft, die bestimmte Erklärungen erlangen will oder abgibt.
Demgegenüber diente die ständige Gesandtschaft (auf die ich noch kommen werde) dem regelmäßigen Mitteilungsbedürfnis zweier Staaten.
Die einfachste Form der gelegentlichen Gesandtschaft war die, dass sie einen bestimmten Auftrag erhielt, denselben ausführte, sofort nach der Ausführung zurückkehrte und über dieselbe bei der Rückkehr mündlich oder schriftlich Bericht erstattete. Nicht selten aber zogen sich die Verhandlungen in die Länge, unvorhergesehene Ereignisse traten ein, die die Ausführung des ursprünglichen Auftrages unmöglich machten. So wandte sich der Gesandte berichtend an die Regierung und erbat neue Instruktionen. Andererseits konnten auch im eigenen Land oder in der Beziehung desselben zu anderen Ländern Verhältnisse eintreten, die eine Abänderung der ursprünglichen Instruktion erforderten.[47]
Auch Fritz Ernst stellte drei Grundtypen von Gesandtschaften heraus, die sich von obigen unterscheiden:
Die Gesandtschaft, der im wesentlichen die Übermittlung einer Mitteilung oder ein Verhandlungsthema (bzw. eine Gruppe von Themen) zugrunde lag. Dazu gehörten auch die reinen Zeremonialgesandtschaften, die etwa Glückwünsche aus besonderem Anlass überbrachten. (Diese entsprechen Schaubes „Höflichkeitsgesandtschaften“). Allerdings wurde bei diesen oft durch den „ostensiblen“ (augenscheinlichen) Grund ein Verhandlungszweck überdeckt.
Der zweite Typ bildet einen Kontakt, eine Verhandlung, deren Dauer sich nicht nur aus dem Verhandlungsthema selbst und seinem Schicksal ableitete, sondern von Faktoren außerhalb abhängig war. So etwa vom Beginn eines Kriegszuges, den der Gesandte decken sollte, indem er den Partner eine Zeit lang „bearbeitete“, oder von der Entwicklung eines Kriegsbündnisses.
Drittens die ständigen Gesandtschaften, die bestrebt waren, eine dauernde Vertretung aufrecht zu erhalten.[48]
3. Der Gesandte auf Mission
3.1 Begleitung und Zusammensetzung von Gesandtschaften
Auch hier halte ich mich an Höflechner, Diss. Bd. 1.
Die Mission begann mit der Abreise vom Hof des Konstituenten. Je nach Zweck der Mission wurde die Ausrüstung des Gesandten festgelegt, aber auch, ob man eine Gesandtschaft oder nur einen einzelnen Gesandten mit mehr oder weniger großer Begleitung abfertigen soll. Nur in den ersten Anfängen der abendländischen Gesandtschaften reisten die Gesandten allein. Später befanden sie sich in Begleitung eines eigenen Stabes von Mitarbeitern und Dienern, deren Anwesenheit Voraussetzung für die Bewältigung der häufig schon sehr umfangreichen Aufgaben war. (Dass ein Gesandter alleine gereist ist, ist aber noch oft genug vorgekommen. Es war nur nicht mehr die Regel. Noch 1506 ist ein Mann wie Serntein im Dienste Maximilians I. völlig allein Tag und Nacht hindurch nach Blois geritten, lediglich das notwendige Staatskleid hinten am Pferd festgeschnallt, um die wesentlichste Phase der Verhandlungen dort selbst zu führen).
Nach Höflechner kann man den personellen Umfang bei großen Gesandtschaften nur ungefähr abschätzen, da meist nur die Zahl der Pferde angegeben wurde und diese in einem ungesicherten Verhältnis zur Anzahl der Personen steht. Die umfangreichsten Gesandtschaften jener Zeit dürften jedoch die Franzosen abgefertigt haben – im Jahr 1500 soll eine französische Gesandtschaft in Ungarn 500 Pferde umfasst haben[49] (dabei sind vor allem die Versorgungsschwierigkeiten und die Durchzugsfrage durch das Reich oder Italien zu bedenken). Es ist klar, dass es sich dabei um eine außergewöhnlich große Gesandtschaft handelte, die vornehmlich zeremoniellen Charakters war, eine echte Schaustellung und Demonstration der Macht und des Ansehens des französischen Köngis Ludwig XII. Vermutlich dürften darunter jedoch nur etwa 20 Gesandte (mit ungeheurem Tross) gewesen sein. Als Normen sind die venezianischen Gesandtschaften anzunehmen, die, durch eine Verordnung von 1483 geregelt, nicht mehr als 12 Pferde mit sich führen durften. Auch eine Reichsgesandtschaft von 1500, mit 30 Pferden angegeben (3 Gesandte waren darunter), scheint eine mittlere, normal ausgestattete Verhandlungsgesandtschaft gewesen zu sein.[50]
Auch der einzelne Gesandte hatte Begleitpersonen, unter denen der Sekretär (sofern er vorhanden war) die wichtigste Rolle spielte. Er erledigte die Schreibarbeiten, die Organisation des gesamten Gesandtschaftsapparates bei längeren Aufenthalten (Chiffrieren und Dechiffrieren von Depeschen[51], Kontakt Halten mit Spionen, Kaufleuten und den Gesandten des eigenen Staates in den umliegenden Ländern, die Besorgung der Quartiere und Lebensmittel, oft genug auch die Vermittlung der Audienz und Unterredungen, die Absendung der Kuriere – also eine nicht zu unterschätzende Arbeit) und in Zeiten der Ablöse des Gesandten auch noch die offizielle Geschäftsführung. Diese Sekretäre stammten aus den zweitrangigen Adelsfamilien und konnten selbst niemals Gesandte werden. Sie kamen höchstens für kurierähnliche Aufgaben oder als Beobachter in Frage.
Neben den Sekretären begleitete eine mehr oder weniger zahlreiche Dienerschaft den Gesandten und, wenn notwendig, auch ein Dolmetscher. (Dies war besonders bei russischen Gesandten notwendig, denn im Westen war allgemein das Latein die Verhandlungssprache). Die Diener waren meist zugleich auch Kuriere, aber sie wurden in vielfältiger Weise verwendet. An erster Stelle stand die Verwendung als Spione. So waren die Diener die „Fühler des Gesandten“, sie ermöglichten erst den Kontakt mit den untersten Volksschichten, aus dem sich der Gesandte oft ein Urteil über den Stand der diplomatischen Dinge oder die Einstellung des Adressaten zu den bevorstehenden Verhandlungen bilden konnte.[52]
Die Gesandten Kaiser Maximilians I. hatten in der Regel eher kurze Gesandtschaften auszuführen und dürften daher nicht selten allein oder nur mit geringster Begleitung gereist sein. So ist deutlich eine Steigerung festzustellen: von den noch ungeregelten Verhältnissen im Reich bis zur Klarheit und kühlen Berechnung der Signorie von Venedig. Die romanischen Staaten waren im Allgemeinen schon weiter fortgeschritten.[53]
3.2 Die Reise
Die Reise selbst ging langsam vor sich, wenn es sich um eine umfangreiche Gesandtschaft handelte, die, durch ihren unmäßigen Tross behindert, gleich einer Handelskarawane durch die Landschaft zog. Der Gesandte, dessen wahre Aufgabe allein die Führung der Geschäfte und dessen Begleitung gering und zweckentsprechend war, reiste wesentlich schneller, schneller als jeder Private (oftmals gleich den Kurieren, „in voller Hast“).
Auf dem Landweg bediente man sich des Pferdes. Auch Ersatzpferde führte man mit und konnte so verhältnismäßig rasch reisen. Wenn es Vorteile brachte, benützte man auch die Wasserwege.
Oft übernahm im Ausland der betreffende Herrscher die Organisation der Reise des fremden Gesandten – nicht aber aus Fürsorge oder Menschenfreundlichkeit, sondern meist, um ihn auf Umwegen umherzuführen, während er selbst sich bemühte, Erkundigungen über ihn und seine Absichten einzuholen. (Besonders auffällig und regelmäßig in Russland. Hier durfte der Gesandte erst gar nicht weiter reisen, ehe nicht vom Großfürsten aus Moskau die Erlaubnis dazu eingelangt war. Mit der Erlaubnis aus Moskau kamen auch genaue Anweisungen über die Reiseroute). Oft trachtete der Herrscher, die fremde Gesandtschaft zu isolieren oder zu überwachen. So gab er ihnen eine Begleitung bei, in Russland war das etwa ein Pristav. Dieser wurde jedem Gesandten beigestellt, der Russland betrat, ohne sich in Begleitung einer rückkehrenden russischen Gesandtschaft zu befinden. Der Pristav hatte die Funktion eines Reiseleiters, „Polizeibeamten“, Spitzels und Laufburschen. Er begleitete den Gesandten so lange, bis er die Grenzen des Großfürstenreiches wieder überschritt. (Denn es war nicht nur in Russland so, dass Gesandtschaften als Spione der fremden Macht angesehen wurden[54] ).
Je nach der Landessitte wurden die Gesandten schon unterwegs vom Adressaten verpflegt, sobald sie dessen Gebiet betraten. Auch dies war in Russland der Brauch. Die Eigenverpflegung wäre auch nicht nach den Absichten des Großfürsten gewesen, hätte sie doch den Kontakt mit der russischen Bevölkerung erfordert.
Im Westen, besonders in Italien und vielleicht auch in Frankreich, gab es auch noch die Möglichkeit des Reisens mit der Post. Hierbei schloss sich der Gesandte dem Postboten an und gelangte so in den Genuss des Pferdewechsels. Er benützte also die Personenpost, die es in Frankreich für die französischen Beamten und Kuriere seit 1464 gab. Im Reich (wo die erste Postlinie drei Jahrzehnte später eingerichtet wurde) dürfte dies, wenigstens offiziell, nicht möglich gewesen sein, da hier die Beförderung von Personen verboten war – wenn es auch der Brauch gewesen sein dürfte, dass sich die Reisenden den Postboten anschlossen, die oft in Eigenregie Pferde für Reisende unterhielten.
Zur See benützten die Gesandten in der Regel die Schiffe der Kaufleute, die sich in der Macht ihres Herrn befanden. Ein Vorteil der Seereise war es, dass Gesandte nicht so leicht abgefangen werden konnten.
Es kam auch öfters vor, dass Gesandte gemeinsam reisten, soweit es die Strecke zuließ.
Nicht immer reiste der Gesandte ohne Pause. Besonders die Gesandten aus dem Osten hielten sich anfangs gerne länger in einer Stadt auf, wohl um sich über die Lage im Westen[55] zu informieren.
Für die Sicherheit der Reise boten die Geleitschreiben nur recht geringe Gewähr, die Gesandten kamen oft in „missliche Situationen“ – so konnte es natürlich vorkommen, dass sie unterwegs überfallen, gefangen genommen oder (wovon allerdings nur Einzelfälle bekannt sind) gar ermordet wurden.
Der erste Kontakt mit dem Adressaten war der Empfang durch seine Organe, oft schon an der Reichsgrenze, oft erst bei Betreten der Residenz.[56]
3.2.1 Das Geleitwesen
Da der Gesandte sehr oft gerade in Ausnahmezuständen in Erscheinung trat und seines Vermittleramtes waltete, bedurfte er des besonderen Schutzes aller, wenn er seiner Tätigkeit zwischen den streitenden Parteien nachgehen sollte, ohne sich selber und so auch das Gelingen seiner Absicht zu gefährden. So gesehen stand es nicht allein in der Absicht einer Partei, dem Gesandten verschiedene Rechte einzuräumen, die ihn außerhalb der Gemeinschaften erscheinen ließen, zwischen denen er vermittelte.[57] (Er stand unter völkerrechtlichem Schutz[58] ).
Eines dieser besonderen Rechte des Gesandten war das des freien Geleits. Das Geleit war auch im späten Mittelalter noch eine besondere Form des alten Königsfriedens (doch zur Zeit Maximilians I. war das Geleitrecht im Reich längst an die Landesherren übergegangen). Auf dem Gesandten, dem das Geleit zugesichert war, ruhte der besondere Schutz des Geleit gebietenden Herrschers.[59]
Im Ausgang des Mittelalters war es üblich, die Gesandten einander vorher anzukündigen und bei dieser Gelegenheit um das Geleit für sie im fremden Land anzusuchen. Auch in allen jenen Ländern hat man darum angesucht, durch die der Gesandte reisen sollte, vor allem, wenn sie mit dem Staat des Konstituenten in gespanntem oder gar feindlichem Verhältnis standen.
Zur Sicherung dieses Privilegs wurde dem Gesandten der Geleitbrief ausgestellt, ein Schriftstück, in dem der Konstituent auf den Charakter seiner Mission hinwies und seinen besonderen Schutz aussprach. Je nach dem Charakter der Mission erhielten die Gesandten Maximilians I. einen adressierten oder einen allgemeinen Geleitbrief, der für das gesamte Reichsgebiet verbindlich war.
Bei besonders großen Gesandtschaften wurde ein eigener Bote oder auch Gesandter mit der Mission betraut, sich um das Geleit für die nachfolgende Gesandtschaft zu kümmern.[60]
Doch die Einhaltung dieses Friedens über dem Gesandten wurde nicht allzu genau genommen, man rechnete erst gar nicht damit. Kein Monarch schien vom Gegenüber zu erwarten, dass er sich an dieses ungeschriebene Gesetz halten würde. Der Gesandte konnte von Glück reden, wenn er das Land, das mit seinem Konstituenten gerade in Kriegszustand getreten war, noch unbeschadet verlassen konnte.[61]
3.2.2 Weitere Strapazen und Gefahren
Um die Bedingungen weiter auszuloten, unter denen diplomatische Kommunikation zu Beginn der Neuzeit gestanden ist, seien hier noch weitere Beispiele genannt.
Vor allem das Reisekönigtum Maximilians stellte große Anforderungen an die Gesandten. Wechselte der König seinen Aufenthaltsort, musste ihm der Gesandte (des fremden Landes) folgen. Dementsprechend viele Klagen über die schlechten Unterkünfte, die Strapazen des dauernden Reisens und über die zusätzlichen persönlichen Ausgaben für ihre Unterbringung gab es in deren Depeschen. Der Venezianer Francesco Foscari etwa klagte 1496 auch, er sei Tag und Nacht damit beschäftigt, die laufenden Ereignisse in Erfahrung zu bringen.[62]
Die Reisebedingungen waren oft lebensgefährlich. Allein der Weg von Venedig über die Alpen und zurück bedeutete für die Gesandten enorme Schwierigkeiten, denn die Alpen wurden in der kalten Jahreszeit und wegen der schlecht ausgebauten Straßen mitunter unüberwindbar. Alvise Mocenigo aus Venedig z.B. berichtete im Dezember 1502, er habe größte Probleme, mit seinem Gefolge im Pferdewagen den Brenner zu überqueren; Fuhrleute seien bereits im Schnee umgekommen. Er hätte so etwas nicht für möglich gehalten, hätte er es nicht mit eigenen Augen gesehen.[63]
Zu Witterungsverhältnissen, körperlichen Anstrengungen und den oft unzulänglichen Unterkünften, die massiv die Gesundheit der Gesandten bedrohten, kam die ständige Seuchengefahr, da sie durch die verschiedensten Gebiete mussten. Venezianische Vertreter schrieben darüber regelmäßig und nüchtern: 1497 berichtete Sanuto von der Rückkehr des Giorgio Pisani von seiner Gesandtschaft beim Römischen König, er sei viele Monate in Innsbruck gewesen, wo die Menschen gegenwärtig von einer Seuche dahingerafft würden.[64]
Das Sicherheitsproblem scheint nördlich der Alpen immer noch besonders groß gewesen zu sein. Vincenzo Querini, wieder ein Venezianer, begründete (durch althergebrachte Stereotypen gefärbt) in seiner relazione 1507 die Häufigkeit der Überfälle jenseits der Alpen im Zusammenhang mit der Lebensweise der deutschen Fürsten. Viele von ihnen seien sehr arm, andererseits jedoch so überheblich und den Stadtbürgern so feindlich gesinnt, dass sie jegliche verwandtschaftliche Verbindung mit Kaufleuten ablehnten. Wenn daher kein Krieg geführt würde, könnten sie ihren Lebensunterhalt bloß auf der Jagd oder aber durch Straßenraub verdienen. Es gäbe keine strenge Verfolgung dieses Unwesens, und daher könne man sich nirgends im deutschen Reich sicher fortbewegen.[65]
3.2.3 Geheimdiplomatie
In einer Zeit, in der noch (fast) jede Gesandtschaft auf einen bestimmten Anlass hin ausgesandt wurde, bedeutete das von außen her gesehen, dass jedes Abgehen oder Eintreffen einer Gesandtschaft bei einer Macht und (besonders) ihr Durchzug durch große Städte, vor allem solche, in denen sich viele Fremde sammelten (so etwa die Kaufleute und Bankvertreter in Brügge oder Lyon) Aufsehen und vor allem die Frage erregte, was als Anlass dahinter steckt. Das führte zu einer besonderen Form der geheimen Diplomatie: Zu der Bemühung, für jede Gesandtschaft einen ostensiblen Grund zu schaffen, ganz unabhängig davon, ob dieser Grund auch der wirkliche war. So bediente sich die immer raffiniertere Geheimdiplomatie der von Fall zu Fall geschickten Gesandtschaften. Man versuchte, den wahren Zweck dieser zu verschleiern, und zwar so weit, dass es für den modernen Beobachter sehr schwer war, bis zum innersten Kern der wahren Absichten vorzudringen. Audienzen, die vor dem Hof gehalten wurden und deren Inhalt dadurch zu den Chronisten gelangte, brauchen über den wahren Zweck einer Gesandtschaft gar nichts auszusagen. Gerade der Zwang, jeder Gesandtschaft nach außen einen Sinn zu geben, entwickelte die Raffinesse der Diplomatie aufs Stärkste.
Jedoch verheimlichte man nicht nur. Es lag auch nahe, durch Gesandtschaften, die keinen wichtigen Auftrag hatten, dritte Mächte zu beunruhigen und den Eindruck einer bedeutsamen diplomatischen Tätigkeit hervorzurufen.[66]
Wenn in späteren Jahrhunderten die Fäden von der einen zur anderen Seite regelmäßig liefen, fiel der Zwang zur Tarnung, aber auch die Möglichkeit großer Scheinmanöver in dieser Richtung weg. Zu jener Zeit aber, als jedes mal neue Fäden geknüpft und wieder zerschnitten wurden, war die Voraussetzung für Täuschung und Spekulation gegeben.
Man darf auch nicht vergessen, dass es bei den Gesandtschaften, wenn man sie nach ihrem öffentlichen Eindruck beurteilt, verschiedene Grade der äußeren Gewichtigkeit und Vornehmheit gab. Eine aus mehreren Gesandten hohen Ranges zusammengesetzte Mission mit entsprechend zahlreicher Begleitung fiel stärker auf als ein allein mit seinem Diener (und vielleicht noch mit seinem Sekretär) reisender Gesandter.
Aber den Kenner konnten solche Unterschiede nicht irreführen. Er zog seine Schlüsse auf die Wichtigkeit des Anlasses aus anderen Indizien: aus der Gesamtlage und wohl vor allem aus dem Grad der Vertrautheit zwischen Auftraggeber und Gesandten. Er war sich auch klar, dass er nicht alle Fäden überschauen konnte, dass wichtige Botschaften durch geheime Agenten geleitet wurden, durch Pilger und Geistliche, oder durch Personen, die sich als einfache Kaufleute verkleidet hatten.[67]
Begegnungen zwischen den Fürsten selbst waren auch im 15. Jahrhundert im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ihre Häufigkeit war natürlich begrenzt, und die Verheimlichung ihres Zweckes war schwieriger als bei den Gesandtschaften.[68] Diese Zusammenkünfte der Herrscher und ihrer leitenden Staatsmänner wurden deshalb betrieben, weil man hoffte, damit in kürzester Zeit mehr zu erreichen als die Diplomaten in langen Verhandlungen, aber auch wegen des großen Eindrucks, den solche Treffen auf die Nachbarstaaten machten.[69] Doch nach Isaak Bernays, Die Diplomatie um 1500, haben fast alle diese Veranstaltungen nur geringe Ergebnisse gebracht, und das Renommee, das sie einbrachten, war solcherart, dass man damit Gerüchte verbreiten konnte, man habe einen Herrscher einer anderen Macht auf seine Seite ziehen können.[70]
3.3 Das Empfangszeremoniell
Der Empfang war die erste und – rechnet man auch noch die Antrittsaudienz hinzu – die prunkvollste Phase des Zeremoniells. Im Empfangszeremoniell kam wieder der Gedanke zum Durchbruch, dass der Gesandte einen Staat, einen Herrscher oder eine so hohe Behörde wie etwa die Signorie von Venedig verkörpert, und dem Ansehen des Staates nach ist der Gesandte zu behandeln. Aus der Ehre, die man ihm beim Empfang, beim Einzug in das fremde Land, in die fremde Residenz erwies, vermochte der kundige Diplomat oft schon den Erfolg seiner Mission, die Einstellung seiner Verhandlungspartner erkennen.[71]
Ich habe mich entschieden, als Beispiel das Empfangszeremoniell an der römischen Kurie, beim Papst, heranzuziehen, da es durch seine Tradition so prunkvoll wie an keinem anderen Hofe war und zur Veranschaulichung besonders dienlich ist.
An der Kurie befanden sich zwei Kreise, denen der Gesandte seine Aufwartung machen musste: der Papst und seine Umgebung (die Kardinäle etc.) und das Kardinalskollegium als eigene Institution innerhalb der katholischen Kirche.
Die Ankunft des Gesandten wurde schon weit voraus gemeldet und die Stunde der Annäherung an die Stadt Rom war genau bekannt. Beide Seiten trafen ihre Vorbereitungen, um sich im entscheidenden Augenblick in würdiger Weise den Vertretern des Partners stellen zu können. Die Gesandten kehrten etwa eine Meile vor Rom in eine Schenke ein, wo sie sich in die prächtigen Staatskleider hüllten, während die Diener den Pferden und Mauleseln prunkvolle Decken über legten und – wenn es eine besonders reich ausgestattete Gesandtschaft war – wohl auch selbst ihre besten Kleider in den Farben ihrer Herren anzogen.
Währenddessen näherte sich aus der Stadt der Zug, den die Kardinäle und der päpstliche Hof zur Einholung der Gesandten aufgeboten hatten: bei Gesandten gekrönter Häupter wohl Kardinäle selbst, der Hofstaat aller in Rom anwesender Kardinäle und des Papstes, die anwesenden Erzbischöfe und Bischöfe, verschiedene Prälaten, die Gesandten der Könige und Fürsten in der Rangordnung ihrer Staaten und Herren – als Leiter des Zuges aber stets der päpstliche Zeremonienmeister.
Dieser Prozession zog nun die Gesandtschaft in feierlichem Gepräge entgegen. Dabei war der Zug des päpstlichen Hofstaates und der des übrigen Empfangskomitees weit auseinander gezogen, sodass praktisch jedes Glied des Zuges allein auf die Gesandten traf. Als erster war dies in der Regel der päpstliche Zeremonienmeister, der die Gesandten mit einer kurzen lateinischen Ansprache begrüßte, worauf der Gesandtschaftsführer antwortete. Danach schwenkte der Zeremonienmeister mit seiner Begleitung in den Zug ein, er und sein höchster Begleiter zur Rechten und zur Linken des Gesandtschaftsführers, seine Dienerschaft aber schloss sich der Dienerschaft des Gesandten an der Spitze des Zuges an. Und so kamen nun die Vertreter der Kardinäle oder gar sie selbst in langer Reihe an die Gesandten heran, begrüßten sie und vernahmen den Dank des Gesandtschaftsführers für die erwiesene Ehre. So vergrößerte sich der Zug stetig, streckte sich, dass die Spitzen der Dienerschaft längst durch die Tore der Ewigen Stadt einzogen, während die Gesandten kaum wenige Schritte weiter gekommen waren. Erst wenn die Begrüßung vor der Stadt beendet war, zogen auch die Gesandten feierlich in die Stadt ein. Alle begleiteten die Gesandten zu ihrem Quartier; wohnten sie aber einzeln, so geleitete man nur bis zum Quartier des Gesandtschaftsführers, wo sich der Zug auflöste.[72]
Am nächsten Tag schickte der Papst den Gesandten zu ihrem Unterhalt verschiedene Nahrungsmittel ins Haus.
Die Empfangsaudienz fand in der Regel am zweiten Tag im Konsistorium statt. (Die Vorbedingung war nämlich, dass die Gesandten den Kardinaldekan und alle Kardinäle einzeln besucht hatten, worauf ihnen der Kardinaldekan den Gegenbesuch abstattete). Bei der Empfangsaudienz zogen die Gesandten, vom Zeremonienmeister geleitet, ins Konsistorium ein, wo sich der Papst und die Kardinäle in Erwartung der Gesandten aufhielten. Sie schritten bis zum Thronstuhl des Papstes, dem sie den Fußkuss leisteten. Nun reichte der jüngste Gesandte die Briefe des Auftraggebers seinen Kollegen dem Alter nach weiter, wobei jeder die Briefe küsste. Der Gesandtschaftsführer schließlich übergab sie dem Papst, der sie seinem Sekretär zur Verlesung reichte. Die Gesandten zogen sich in die Reihen der Kardinäle zurück, und der päpstliche Sekretär verlas die Briefe. Daraufhin begann der Gesandte, der dazu auserwählt wurde, die Ansprache an den Papst – der nun seinerseits antwortet, ebenso wohlgesetzt und feierlich, wie dies zuvor der Gesandte getan hatte.[73] Nach diesen Handlungen wurden die Briefe an das Kardinalskonsistorium dem Vizekanzler übergeben, der sie vom Sekretär des Kollegiums verlesen ließ.
Hierauf verließ der Papst im Geleit der Kardinäle und der Gesandten den Audienzsaal; dem Gesandtschaftsführer wurde dabei die Ehre zu Teil, seine Schleppe zu tragen. Nach einem kurzen Höflichkeitsgespräch in einem der weitläufigen Vorräume, in dessen Verlauf sich die Begleitung des Papstes unauffällig zurückzog, verabschiedete der Papst die Gesandten.[74]
Damit war die Empfangszeremonie einschließlich der Empfangsaudienz in der Regel beendet. Nur selten soll als letzter Ausklang die Überreichung eines Ehrenkleides an den Gesandten oder den Führer der Gesandtschaft erfolgt sein, das dieser dann bei der nächsten Papstmesse zur Schau trug.[75]
Ein Empfang dieser Art wurde aber nur den Gesandten gekrönter Häupter zugestanden. Dies waren jene der Signorie von Venedig, Mantua, Ferrara, Montferrat und vermutlich auch der Signorie von Florenz.[76]
Im Reich unter Maximilian I. war das diplomatische Zeremoniell im Allgemeinen recht einfach, da der Kaiser keine feste Residenz bewohnte, sondern die Gesandten meist unterwegs empfangen musste, wo er sich eben gerade befand: dies konnte in einem Zelt auf freiem Feld sein (was einem anderen Herrscher dieser Zeit kaum eingefallen wäre, es sei denn, er hätte sich auf einem Kriegszug befunden[77] ), in einem Bauernhaus, in einem bescheidenen Schloss, in einem Kloster oder in einem städtischen Rathaus. Nicht oft gab es die Gelegenheit, in einer großen Stadt im Gefolge des Kaisers feierlich aufzumarschieren. Wenn es möglich war, führte Maximilian die Gesandten, die an seinen Hof gekommen waren, anlässlich eines Festes dem staunenden Volk vor – besonders einen türkischen Gesandten versuchte er im Reiche herum zu zeigen.
Der Kaiserhof zog nach der römischen Kurie weitaus die meisten Gesandtschaften an und war damit, trotz der Ohnmacht des Reiches, einer der wichtigsten Mittelpunkte der damaligen Welt.[78]
4. Die Übermittlung der diplomatischen Korrespondenz
Die Kuriere waren zur Beförderung der herrscherlichen Schreiben (und zur Übermittlung der Depeschen ihrer Gesandten) besonders ausersehen. Der Grund für diese Stellung der Kuriere lag darin, dass sie im Gegensatz zu den Postboten (das Postwesen in Mitteleuropa ist im letzten Jahrzehnt vor 1500 aufgekommen[79] ), wenn sie eine Depesche einmal übernommen hatten, in der Regel sofort abgingen und die Depesche auch wieder persönlich dem Empfänger überreichten, da sie die ganze Strecke selbst zurückzulegen pflegten.[80] (Auch in allen Gebieten abseits der noch nicht sehr zahlreich eingerichteten Poststrecken wurden natürlich Kuriere verwendet[81], mitunter in kombiniertem Betrieb mit der Post, und zwar auf Strecken, die sich teilweise mit festen Postlinien überschnitten[82] ). Dies war weniger ein Kriterium für die Geschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung (denn die Post hatte dagegen den Vorteil von Pferde- und auch Reiterwechselmöglichkeiten in in einem bestimmten Abstand eingerichteten Aufenthaltsstationen, wodurch die Zeitverluste, die sich bei einem einfachen Kurier aufgrund seiner notwendigen Ruhepausen ergaben, verringert werden konnten[83] ), wohl aber ein Positivum für die Sicherheit der Übermittlung, soweit es eben vom Kurier, der der eigenen Organisation angehörte, abhing, ob ein Schreiben überhaupt jemals ankam oder nicht.[84] Denn ein Vorteil der eigenen Kuriere war, dass man sie kannnte und sich auf sie verlassen konnte. Man konnte ihre Erfahrung einschätzen und ihnen bei Bedarf auch weitere Aufgaben zusätzlich zur Beförderung der Briefe übertragen. Außerdem waren sie flexibler: Einen Boten (Kurier) konnte man je nach Dringlichkeit zu jeder Tages- oder Nachtzeit losschicken, egal, wo man sich befand und wie es um die institutionellen Kommunikationsmittel bestellt war. So etwa auch von den Tiroler Bergen aus.[85]
Nach Höflechner dürfte der Kurier auch wesentlich billiger gewesen sein als die Post, da ja bei der Post die gesamte Strecke erhalten werden musste, gleichgültig, welche Frequenz sie hatte, während der Kurier bei seinen Reisen wesentlich rentabler arbeitete.[86] Lutter beurteilt dagegen die Kosten für berittene Boten höher (als jene für die Post). Deren Bezahlung richtete sich vor allem nach der Länge der Strecke und der Geschwindigkeit der Beförderung. Zusätzlich zu den Botenlöhnen mussten noch die Unterhaltskosten für den Kurier und sein Pferd bezahlt werden. (Fußboten dagegen waren weitaus billiger[87] ). So kostete z.B. die Beförderung von zwei Briefen 1507 von Straßburg nach Venedig etwas mehr als 30 Dukaten, was dem mittleren Jahresanfangsgehalt eines Sekretärs in der Kanzlei des Dogen in Venedig entsprach![88]
Nochmals zurück zur Geschwindigkeitszunahme der Nachrichtenübermittlung durch die Einrichtung der Postlinien: Auf diese Weise konnte die Beförderungsgeschwindigkeit von 20-30 auf 100-150 Kilometer pro Tag erhöht werden.[89] So wurde z.B. die 764 Kilometer lange Strecke von Mechelen (im heutigen Belgien) nach Innsbruck in 5 ½ Tagen zurückgelegt.[90] Höflechner spricht sogar von Spitzenwerten von 250 Kilometern pro Tag.[91]
Andererseits konnten nach Schäffer, Zur Geschwindigkeit des „staatlichen“ Nachrichtenverkehrs im Spätmittelalter[92], auch Boten (wie Kuriere) schon Tagesleistungen von etwa 100 Kilometern pro Tag erbringen. Dies geht aus vielen von ihm gebrachten Beispielen hervor, wie z.B., dass die Nachricht von der Königswahl Maximilians I. (vom 16. Februar 1486) in Frankfurt/Main in höchstens sieben Tagen (am 23. Februar) im 750 Kilometer (Landweg) entfernten Wien bekannt wurde.[93] Auch Höflechner, Die Entwicklung österreichischer Diplomatie im Mittelalter und die Außenpolitik Maximilians I. [94], berichtet von Leistungen damaliger Kuriere, die die Strecke Venedig – Brügge in 16 Tagen und London – Venedig in 21 Tagen zurücklegten, wobei es sich um Schnitte von über 70 km pro Tag handelte, und das durch drei Wochen hindurch.[95]
Die Masse der Depeschen wurde also von Kurieren befördert, von denen je nach Bedeutung des Gesandten und seiner Mission bereits eine gewisse Anzahl den Gesandten bei der Abreise vom Konstituenten begleitete. Nach und nach wurden sie mit Nachrichten zurückgesandt und durch die neue Nachrichten vom Konstituenten bringenden Kuriere ergänzt. Bei Kurieren über größere Distanzen war es – schon aus finanziellen Gründen – selbstverständlich, dass sie, sofern es die Route und die Dringlichkeit ermöglichten, von anderen Informationsstellen ihres Herrn weitere Depeschen übernahmen. Hin und wieder beförderten sie nicht nur Schriftgut, sondern auch kleinere Geschenke – wenn diese selbst laufen konnten, wie etwa ein Pferd, so auch größere. Sie überbrachten den Gesandten auch mündliche Informationen. Auch konnte es vorkommen, dass der Kurier als Überbringer eines Briefes eines Souveräns an den anderen, wenn kein Gesandter vorhanden war, vom Empfänger empfangen und in ein informatives Gespräch verwickelt wurde.[96]
Kuriere reisten allein, und dies oftmals auf derselben Route. Sie abzufangen und sich des Inhalts ihrer beförderten Schriftstücke zu bemächtigen, war – wenn es sich aus Gründen des Staatsinteresses empfahl – unter Hinwegsetzung über die etwas geschützte Rechtsstellung des Kuriers eine Selbstverständlichkeit. Es geschah dies so häufig, dass der Hinweis auf eine auf diese Weise verloren gegangene Nachricht eine der gängigsten Entschuldigungen und Ausreden für das Nichtreagieren auf Nachrichten war. Besonders dieser Gefahr ausgesetzt waren natürlich Routen, die an Feindesland vorbei, wenn nicht manchmal durch dieses hindurch, führten. Kuriere wurden immer wieder abgefangen, mancher landete in einem Kerker, mancher verschwand wohl für immer. Diese Unsicherheit führte zu der Gewohnheit, nach der Entsendung einer Originalnachricht solange Kopien derselben den nachfolgenden neuen Originaldepeschen beizulegen, bis der Empfang eines Exemplares – unter knapper Resümierung des Inhalts – bestätigt wurde. – Originale wie Kopien wurden in ihren chiffrierten Fassungen eigens als solche gekennzeichnet. Besonders wichtige Stücke wurden auch auf verschiedenen Routen gleichzeitig abgesandt. Den spanischen Königen z.B. galt generell die Seeroute (nach England) als sicherer – besonders die Route nach Bristol, auf der sogar nichtchiffrierte Depeschen befördert wurden, die vom Kurier im Falle der Kaperung in das Wasser zu werfen waren.[97]
Neben den Kurierdiensten und der Benützung verschiedener Postlinien, die sich anboten, verfügten zumindest die führenden italienischen Stadtstaaten, wie etwa die Signorie von Venedig, Florenz und auch Mailand, über ein sehr wirksames Nachrichten- und Transportsystem in Form ihrer Handelshäuser, die dafür ihrem Staat zur Verfügung standen. (Vor allem die italienischen Bankhäuser, unter ihnen besonders die der Medici, sind dabei hervorzuheben[98] ). Für im Ausland weilende Venezianer war es eine selbstverständliche Pflicht, alles von Belang an die Signorie zu melden, aber auch die Beförderung von Depeschen zu übernehmen bzw. zu unterstützen.[99] Die Bankdirektoren in Lyon wurden sogar zur politischen Berichterstattung verpflichtet.[100]
Nach Lutter scheint die Mitbenützung des funktionierenden Nachrichtenwesens der Kaufleute (namentlich der Welser und auch der Fugger) vor der Einrichtung der königlichen Postkurse (im Reich) eines der besten Mittel gewesen zu sein, Informationen rasch weiterzuleiten und die Kosten für Einzelboten zu sparen.[101]
Nicht zuletzt gab man diplomatische Schriftstücke auch Personen mit, die sich gerade auf der Durchreise befanden. Darunter waren wiederum Kaufleute, wie auch andere Gesandte, denen man offenbar vertraute und die in die gewünschte Richtung unterwegs waren oder einen nahe gelegenen Verkehrsknotenpunkt passierten. Aber auch Geistliche fungierten gelegentlich als Kuriere.[102]
5. Die Einrichtung ständiger Gesandtschaften
Zuletzt widme ich mich noch dem bereits öfters angesprochenen Phänomen der ständigen Gesandtschaften, der Neuerung und bedeutenden Weiterentwicklung in der Diplomatie, von der ich eingangs gesprochen habe, sie ist zeitlich in etwa mit dem Beginn der Neuzeit zusammen gefallen. Eine ganze Reihe der von mir benützten Arbeiten nimmt zu diesem Thema Stellung.
5.1 Erklärungen zu ihrem Aufkommen
Das Mittelalter, sowie das Altertum, kannten nur die ad-hoc-Gesantschaften, die in einer besonderen und zeitbegrenzten Mission sich ins Ausland begaben. Präzedenzfälle von ständigen Missionen, die man hie und da zu entdecken versucht, sind (nach Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte) in Zeit und Raum zu zerstreut und ohne Folgen geblieben, um sie als Anfänge der bewussten Bildung der fortwährend bestehenden und allgemein anerkannten ständigen Gesandtschaften betrachten zu können.
Als solche kann man laut Nahlik nur Situationen betrachten, wo im zweiseitigen Verkehr eine jede der zwei Seiten an die andere eine Gesandtschaft richtete, mit der Absicht, sie dauerhaft bei der anderen verbleiben zu lassen und nach Ableben bzw. Abberufung des Gesandten ihn durch einen Nachfolger zu ersetzen.
Solche Absicht kann man zuerst (und darüber sind sich die zahlreichen Forschungen im Großen und Ganzen einig) in gegenseitigen Beziehungen zwischen den italienischen Kleinstaaten nachweisen. Die Frage, ob diese Absicht zuerst in Venedig, in Florenz oder in Mailand auftauchte, ist (seit Anbeginn der Forschungen) strittig. Für Nahlik brachte der Mexikaner Weckmann überzeugende Beweise, dass der erste völlig absichtliche Austausch von ständigen Gesandten in der zweiten Hälfte des fünften Jahrzehntes des 15. Jahrhunderts, 1446-1450, in gegenseitigen Beziehungen zwischen Cosimo de Medici und Francesco Sforza, also zwischen Florenz und Mailand, stattfand. Fest stehe, dass es zuerst eine grundsätzlich italienische „Erfindung“ war, die jedenfalls um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstand und seither nicht mehr aufgegeben wurde. (Andere Forschungen hingegen zeigen, dass bereits im 13. Jahrhundert im Mittelmeerraum ständige Konsuln tätig waren, denen häufig politisch-diplomatische Aufgaben zukamen. Man ist sich uneinig.[103] ). Die Großmächte folgten nicht ohne Zögern allmählich dem italienischen Beispiel. Der Pionier der neuen Institution außerhalb Italiens war, laut Nahlik, Ferdinand der Katholische von Spanien, der einzige unter den größeren Herrschern, der ein paar ständige Gesandtschaften bereits im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts einsetzte. Allmählich, nach der Epoche der „italienischen Kriege“ (also erst im 16. Jahrhundert), in welchen manche der italienischen Staaten untergingen, sei die Rolle des Vorkämpfers der ständigen Diplomatie auf Frankreich übergegangen, nämlich seit Franz I.[104]
Vor 1500 war die ständige Diplomatie besonders gut bei den Venezianern entwickelt, während der Kaiser, aber auch die römische Kurie (als die beiden Häupter der Christenheit) immer noch glaubten, es entspreche ihrer Würde besser, Gesandte wohl zu empfangen, aber solche nur in seltenen Fällen abzusenden.[105] Die Heilige Liga von Venedig (im März 1495), die das italienische System des Gleichgewichts auf die gesamte europäische Staatenwelt übertrug, gab auch der Einrichtung ständiger gegenseitiger Gesandtschaften, zumindest unter den Verbündeten, den entscheidenden Anstoß.[106]
So kristallisierte sich nach 1495 eine kleine Zahl von zwischenstaatlichen Beziehungen heraus, die sich einigermaßen konstant erwiesen und durch ständige Gesandte betreut wurden: Spanien bei England und später Venedig bei Frankreich waren zwei der stabilsten Verbindungen um 1500. Doch war bis ins 16. Jahrhundert hinein das Institut der ständigen Gesandtschaft außerhalb Italiens eher eine Ausnahme, nicht alle Mächte traten in ständigen diplomatischen Kontakt. Eine Veranlassung dazu war nur gegeben, wenn einigermaßen gute Beziehungen herrschten und auch offene Fragen oder gemeinsame Pläne vorhanden waren, deren Behandlung und Verfolgung ausstand.
Eine ständige Vertretung bedeutete einen nicht unwesentlichen Kostenaufwand, einmal in der Bezahlung des Gesandten, aber vor allem durch die Nachrichtenverbindung, die man aus Sicherheitsgründen (trotz des schon hoch entwickelten Chiffrierwesens) selbst besorgen wollte. Weiters hatte man in vielen Ländern eine Abneigung gegen die ständigen Gesandten (eines fremden Landes), die man nicht ganz zu Unrecht als Spione oder wenigstens als unerwünschte, dauernd fließende Informationsquelle ansah. So verhielt es sich z.B. in Russland oder in Frankreich.[107] So antwortete etwa der französische König Ludwig XI. 1464 auf den Wunsch des Herzogs Franz Sforza von Mailand, künftig „dauernd einen der Seinigen beim König zu halten“, der Brauch in Frankreich sei nicht wie der in Italien, „hier bei uns erscheint das Halten eines ständigen Gesandten als Sache des Mißtrauens und nicht der Freundschaft; bei euch ist es das Gegenteil“. Wenn sich aber etwas ereigne, solle er jemand schicken, „und sie sollten gehen und kommen und nicht ständig bleiben“.[108]
Maßnahmen zur Überwachung der Gesandten (nicht nur der ständigen) und zur Abschirmung gewisser Bereiche gegen ihren Einblick hat es überall gegeben.[109]
Die Signorie von Venedig z.B. leistete sich dagegen – auch aus handelspolitischen Gründen – schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine ständige Vertretung bei einer größeren Zahl italienischer, aber auch außeritalienischer Mächte.[110]
Der wichtigste Einwand gegen die Zulassung ständiger Gesandtschaften war also die Furcht, sie würden sich hauptsächlich mit Spionage beschäftigen. Dazu gesellte sich bei manchen Humanisten noch ein anderer Grund: Die griechische und römische Antike, die man zu jener Zeit „fast blind“ verehrte, kannte ständige Missionen nicht.[111] Noch 1646 betonte Hugo Grotius, das Beispiel der Antike zeige, dass ständige Gesandtschaften nicht notwendig seien. (Sie seien im Völkerrecht nicht vorgesehen, wie Wicquefort sogar gegen 1700 noch feststellte).[112]
Erst durch die französischen Erfolge im 30-jährigen Krieg, die Frankreich nicht bloß seinen Feldherren, sondern auch der Geschicklichkeit seiner Diplomaten verdankt haben soll, kam man fast überall in Europa zur Überzeugung, dass die Vorteile der ständigen Diplomatie ihre Nachteile doch überragen.[113]
Lanzer gibt zum Aufkommen der ständigen Gesandtschaften in ganz Europa die Erklärung, dass zu Beginn des 16. Jahrhunderts die politische Struktur Europas sich von einer hierarchisch gegliederten Staatenordnung zu einem „europäischen politischen System“ gewandelt hatte, das gekennzeichnet war durch das mehr oder minder gleichrangige Nebeneinander unabhängiger Staaten. Dieses System des europäischen Gleichgewichts war naturgemäß schwieriger im Lot zu halten als eine hierarchische Gliederung. Da ein „ständiger“ Kriegszustand schon allein aus wirtschaftlichen Erwägungen unmöglich geworden sei, griffen die Fürsten (langsam) zum Mittel der institutionalisierten Diplomatie, um dieses System der Mächte zu sichern.
Da die wesentlichste Aufgabe der Diplomatie immer gewesen sei, einen Kriegszustand zu beenden bzw. ihn abzuwenden, sei es auch erklärlich, dass das Gesandtschaftswesen dort seine rascheste Entwicklung und Blüte erlebte, wo auf begrenztem Raum eine Vielzahl von Machtgebilden ums Überleben kämpfte, wie in Italien. Natürlich wird es für kleine und kleinste Gebiete – wie die italienischen Stadtstaaten – weit wichtiger gewesen sein, ja sogar lebensnotwendig, in ständigem friedlichen Kontakt miteinander zu stehen, als für Großreiche. Erst als sich auch im übrigen Europa der Gedanke des politischen Gleichgewichts durchgesetzt hatte, griffen die Machtzentren auf Mittel der Diplomatie zurück. Im Anschluss an den Zug Karls VIII. von Frankreich nach Italien 1494/95 starteten die restlichen Staaten den ersten gesamteuropäischen Versuch, die Stabilität des politischen Systems, des Gleichgewichts, mit Hilfe der Diplomatie zu retten. So kamen 1495 (wie oben schon erwähnt) die Gesandten der Mächte in Venedig zu einem „Gipfeltreffen“ zusammen, dessen Ergebnis die Heilige Liga gegen Frankreich war. Auch wenn sie sich nicht lange gehalten hat, wie auch alle anderen europäischen Ligen in ihrem Gefolge, sei doch dabei die Methodik der modernen Diplomatie, die sich in Italien entwickelt hatte, erstmals in den gesamteuropäischen Raum hinaus getreten.[114] So hat z.B. Spanien ab 1494/95 bei allen wichtigen Mächten Europas praktisch kontinuierlich – oft in langdauernden Missionen von über fünf Jahren – besetzte Gesandtschaften unterhalten. Als es 1494 Rodrigo Puebla als ständigen Gesandten nach London entsandte, habe es damit den ältesten durchgehend bis in unsere Zeit besetzten Gesandtenposten eröffnet.[115]
Auch für Lanzer lässt sich die genaue Entstehungszeit der ständigen Gesandtschaften schwer festlegen, man könne aber sagen, dass die Entwicklung in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Oberitalien ihren Ausgang nahm (allgemein gelte der Aufenthalt des Mailänders Nikodemus von Pontremoli in Florenz 1446-1466 als erste ständige Mission[116] ), aber nur sehr langsam fortschritt. Im Jahr 1500 haben sich zwar die meisten europäischen Länder ständiger Gesandter bedient, doch waren sie im Verhältnis zu den Spezialgesandten noch immer in der Minderzahl.[117] Das Schwergewicht der großen Politik lag auch noch im beginnenden 16. Jahrhundert auf den gelegentlichen Gesandtschaften.[118]
5.2 Das Besondere an ständigen Gesandtschaften
Das Kennzeichen der ständigen Gesandten besteht (nach Lanzer) nicht darin, dass die Dauer ihres Aufenthaltes einfach verlängert wurde. Spezialgesandtschaften reisten mit einem ganz bestimmten Auftrag an den fremden Hof, seien dies nun Vertragsverhandlungen, Höflichkeitsbesuche oder ähnliches. Nach Erfüllung ihrer Aufgabe – wie lange dies auch dauern mag; es konnten auch Jahre sein – kehrten sie in die Heimat zurück. (Und dies im Einverständnis mit Konstituent und Adressat. Natürlich konnte es auch nach dem endgültigen Scheitern ihrer Aufgabe sein[119] ). Demgegenüber wurden ständige Gesandte von vornherein mit der Absicht ins Ausland gesandt, dort lange zu bleiben, um die Freundschaft zwischen zwei Staaten aufrecht zu erhalten, seinen Staat dort zu repräsentieren und ihn in allen Belangen zu vertreten. Dies brachte mit sich, dass die Vollmacht eines ständigen Gesandten viel weitreichender und unbestimmter war, der Staat also mehr Vertrauen in ihn setzen musste. Man umging dies aber dadurch, dass zu speziellen Anlässen (wie etwa Vertragsverhandlungen) weiterhin Sondergesandte geschickt wurden, sodass es also oft ein Nebeneinander von beiden Gesandtentypen an einem Hof gab. Dabei war der Spezialgesandte dem Ständigen übergeordnet.[120]
Bei der Einsetzung ständiger Gesandter gab es auch das Problem, dass man deren Aufenthaltsdauer beim Adressaten im Auge behalten musste – er durfte nicht zu lange den Einflüssen des Empfängerstaates ausgesetzt werden (um ihn einer bewussten, aber auch einer vielleicht unbewussten Hinwendung zum Adressaten zu entziehen[121] ), sollte sich aber andererseits dort einleben können (um sich voll zu entfalten[122] ). Venedig hat deshalb den Aufenthalt bei einem Adressaten erst auf zwei, später auf drei Jahre begrenzt. Relativ lange Aufenthaltszeiten ergaben sich wegen der weiten Entfernungen für spanische Gesandte. Im Unterschied zum Spezialgesandten, durfte der ständige Gesandte nur auf besondere Weisung seines Konstituenten heimkehren.[123]
Auch Nahlik gibt eine aufschlussreiche Unterscheidung der noch häufigeren ad-hoc-Gesandten (wie er sie nennt) von den auch schon eingesetzten Ständigen: Verhandlungen wurden grundsätzlich nur durch die ad-hoc-Gesandten geführt, denen ziemlich lange ein höherer Rang und ein größeres Ansehen gebührte (Zugrunde liegt natürlich die Auffassung, der aus besonderem Anlass und zuletzt Geschickte sei der unmittelbarste Vertreter seines Souveräns bzw. seiner Regierung[124] ). Die ständigen Gesandten hatten dagegen zur besonderen Aufgabe, alles Wesentliche, was sich im Empfangsland abspielte, zu beobachten und darüber zu berichten. Gerade dies vermehrte noch die Befürchtungen, dass solche Beobachtung allzu leicht in Spionage übergehen würde.[125]
„Ueber das, was Tag für Tag sich zuträgt, wirst du uns fleissig Nachricht geben, indem du uns häufig während der Dauer deiner Gesandtschaft schreibst und uns wohl unterrichtet hältst über alles das, was du für nützlich und zweckdienlich erachtest“.[126]
Nach Schaube war seine referierende Tätigkeit nicht nur auf seine eigene Regierung hin bezogen, sondern auch jener gegenüber, bei welcher er beglaubigt war. In erster Linie stehe das Bedürfnis, zuverlässige und fortlaufende Informationen über politisch wichtige Ereignisse im Ausland durch vertrauenswürdige Personen zu erhalten, in zweiter das, der fremden Regierung ähnliche Informationen in einer dem eigenen Interesse entsprechenden Form zukommen zu lassen.[127]
Wenn sich also die Tätigkeit der Berichterstattung auch nach beiden Richtungen hin erstreckte, so war dafür trotzdem nicht unbedingt ein Gesandter erforderlich, wie Höflechner anmerkt. Denn oft versahen angesehene Handelsleute in inoffizieller oder halboffizieller Stellung diese Aufgabe zur Befriedigung beider Seiten. Was die ständigen Gesandten von anderen referierenden Persönlichkeiten abhob, das war, nach Höflechner, ihre Aufgabe, auch alle anfallenden Geschäfte für ihren Staat im Lande des anderen zu erledigen. Somit bedeutet die Institution der ständigen Gesandten einen großen Fortschritt in der Vertretung der Staaten, denn man wagte es, dem Gesandten so umfassende Vollmachten zu erteilen, dass zwar nicht gerade das Schicksal seines Vaterlandes in seine Hand gelegt war, aber doch mehr denn früher dessen Ruf und Vorteil.[128]
Darüber hinaus betont Strohmeyer in seinem Artikel über Kulturtransfer durch Diplomatie[129] auch den interkulturellen Austausch, den er anhand der und durch die ersten ständigen Gesandtschaften zwischen dem kaiserlichen Reich und dem spanischen Königshof ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts festgestellt hat. Demnach wurden die in gegenseitigem Verhältnis eingerichteten Gesandtschaften aufgrund ihrer sehr weit gesteckten Arbeitsfelder auch zu Vermittlern und Übersetzern in einem fassettenreichen Kulturtransfer. Dies sei (unter anderem) in den „drei zentralen“ Tätigkeitsfeldern ständiger Gesandter im 16. Jahrhundert, nämlich in den politischen Verhandlungen, im Erwerb und der Übersendung von Luxusgütern und in der Informationsbeschaffung, erfolgt.[130] An politischen Elementen, Handlungskriterien oder Wertvorstellungen ist damit etwa der Transfer der besonderen Bedeutung des dynastischen Prinzips an den spanischen Hof[131] gemeint, wodurch die Solidarität zwischen den beiden habsburgischen Linien (in Heiratsbeziehungen, der Türkenabwehr oder dem Aufstand der Niederlande[132] ) verstärkt werden sollte. Des weiteren fungierten die ständigen Gesandten (von 1574 bis 1606, seinem Todesjahr, residierte Hans Khevenhüller als „Langzeitdiplomat“ in Spanien[133] ) als Schaltstelle bei der Beschaffung und Übersendung fremdartiger Kunst-, Kultur- und Naturgüter für den Kaiserhof, dessen Sammlungen auch der politischen Propaganda und der Reputation des Herrschers dienten.[134] Edelsteine z.B. standen für die Allmacht Gottes und verwiesen auf die Universalität der kaiserlichen Herrschaft.[135] Die „Botschafter“ benutzten daher ihre Stellung am königlichen Hof, ihre sozialen Kontakte und ihre politischen Beziehungen, um (als weitere Beispiele) exotische Pflanzen und ihre Samen, seltene Mineralien, Magnetsteine, Diamanten, Stoßzähne, indianisches Kunsthandwerk, Federdecken, Gemälde, Waffen, modische Kleidung, Porzellan oder sogar lebende Tiere für den Kaiser zu erwerben.[136] Zum Dritten vermittelten die „Botschafter“ im Rahmen ihrer Informationsbeschaffung ein spezifisches Wissen über die spanischen Königreiche an den Kaiserhof[137], wozu etwa deren Innen- und Außenpolitik, Ämterbesetzungen, Hoftratsch, Hochzeiten, Geburten und Todesfälle, Nachrichten über die Neue Welt, Überfälle türkischer Korsaren auf spanische Handelsschiffe, die Gesundheit und Erkrankungen der königlichen Familie, Epidemien, Umweltkatastrophen und sogar das Wetter gehörten.[138]
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich Diplomatie als Berufslaufbahn im Zusammenhang mit der Entwicklung des ständigen Gesandtschaftswesens herausgebildet hat. Gerade im 16. und 17. Jahrhundert bekleideten juristisch gebildete Personen bürgerlicher Herkunft Gesandtenposten, wogegen später, im 18. und 19. Jahrhundert, die Spitzenposten der Diplomatie Reservat der Aristokratie gewesen sind.[139]
6. Zusammenfassung
Vielleicht konnte diese Arbeit, die, unter Einfluss der inhaltlichen Ausrichtung der Referate zum Themenbereich „Kommunikation“ im Proseminar, wie etwa der Einzug des Postwesens oder der Einsatz von Flugblättern in der frühen Neuzeit, mehr Wert auf die Rahmenbedingungen des Gesandtschaftswesens als auf deren eigentliche Ausführung gelegt hat, wozu etwa konkrete Umstände des Verhandelns gehört hätten, einen tieferen Einblick in die diplomatischen Verhältnisse der Staatenwelt, und damit auch in einen kleinen Ausschnitt der uns heute zu einem großen Teil fremd gewordenen Lebenswelt zu Beginn jener Epoche erbringen, die auch die heutige Geschichtsforschung immer noch als „Neuzeit“ zu bezeichnen gewohnt ist, und was daher im Schulunterricht weiterhin so gelehrt wird. Auch wenn es damals, vor 500 Jahren, besonders was von den charakterlichen Eigenschaften eines Diplomaten (oder Gesandten) erwartet wurde, wie wir sehen konnten, schon viel uns heute noch Vertrautes, viele Parallelitäten zu unserer heutigen Welt, unseren heutigen Vorstellungen gegeben hat, muss doch immer wieder angemerkt werden, wie sehr sich die Verhältnisse gewandelt haben, und dass wir für die Gegenwart im Allgemeinen immer noch die selbe periodische Begrifflichkeit verwenden.
Diese Darstellung hat aufgezeigt: nach welchen Kriterien man damals die Vertreter zur Ausführung der herrschaftlichen Interessen ausgewählt hat – nämlich im Heiligen Römischen Reich nach allen möglichen pragmatischen Gesichtspunkten, aber immer mit Bevorzugung von Vertrauensleuten, während man in Venedig fast ausschließlich die Führungsschicht der Republik dafür herangezogen hat. Weiters ist zu erkennen, wie auch die Pflichten und Aufgaben von Gesandtschaften, nämlich der unbedingte Gehorsam seinem Souverän gegenüber und möglichst umfangreiche Berichterstattung über alles, was man im fremden Land beobachten konnte, in Venedig besonders streng (gesetzlich) geregelt war. So fällt die deutliche Steigerung von den noch ungeregelten Verhältnissen im Reich, wie es unter vielen anderen Beispielen etwa im diplomatischen Zeremoniell ersichtlich ist, bis zur Klarheit und kühlen Berechnung der Signorie von Venedig besonders ins Auge. Auch die romanischen Staaten waren im Allgemeinen schon weiter fortgeschritten, wie es unter anderem die früher eingerichteten Postlinien in Frankreich bezeugten, für die auch der Personentransport schon zugelassen war, was die, wie wir sehen konnten, überaus problematischen Bedingungen der Bewältigung von weiten Strecken, wie die strapaziösen und gefährlichen Reisen eines Gesandtschaftszuges oder die unverzichtbare und rasch zu erfolgende Übermittlung von Nachrichten, auch wenn die Masse der diplomatischen Korrespondenz weiterhin von Kurieren befördert wurde, etwas abgeschwächt und das Reisen sicherer, rationeller und schneller gemacht hat.
Die Besonderheit dieser Zeit, was mein Thema anbelangt, das, was am augenscheinlichsten ist, war wohl die Verbreitung von ständig besetzten Gesandtenposten über einen Großteil der damaligen europäischen Staatenwelt, auch wenn das Schwergewicht der (Außen-) Politik auch noch im beginnenden 16. Jahrhundert auf den von Fall zu Fall eingesetzten Gesandtschaften ruhte. Dies war auch der Grund, weshalb ich die Innovation dieser Zeit, die ständigen Gesandtschaften, und damit ist nicht ihr (nicht restlos geklärtes) erstes Aufkommen, sondern ihre (gelegentliche) Ausweitung auf fast ganz Europa gemeint, erst an den Schluss meiner Arbeit gestellt habe, da zu dieser Zeit noch andere Formen des diplomatischen Verkehrs maßgebend waren. Und doch war, so wie sich unser heutiger Beruf des Diplomaten erst durch die Entwicklung der ständigen Gesandtschaften herausbilden konnte, mit dieser neuen Einrichtung „ein Gipfelpunkt in der Entwicklung der modernen Diplomatie erklommen“, wie es auch Höflechner[140] ausgedrückt hat, denn mit den weitreichenden Vollmachten, mit dem Vertrauen, das man in die Hände des ständigen Gesandten legte, hat „eine gewisse geistige Großzügigkeit und Libertät“[141] in der abendländischen Diplomatie Einzug gehalten. Doch dazu seien noch die Worte von Ernst hinzugefügt, nämlich, dass „die ständige Gesandtschaft ihre sichere Stellung in der Entwicklung der Diplomatie [jedoch] erst auf der Stufe erobert hat, auf der sie aufhört, ein Zeichen der besonderen Verbundenheit zwischen zwei Staaten zu sein.“[142]
7. Literaturverzeichnis und Kurzzitate
Isaak BERNAYS, Die Diplomatie um 1500. In: Historische Zeitschrift 138 (1928), 1-23.
[ kein Kurzzitat ]
Ernst, Über Gesandtschaftswesen =
Fritz ERNST, Über Gesandtschaftswesen und Diplomatie an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. In: Archiv für Kulturgeschichte 33 (1951), 64-95.
Gollwitzer, Geschichte der Diplomatie =
Heinz GOLLWITZER, Zur Geschichte der Diplomatie im Zeitalter Maximilians I.
In: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 74 (1955), 189-199.
Höflechner, Anmerkungen =
Walter HÖFLECHNER, Anmerkungen zu Diplomatie und Gesandtschaftswesen am Ende des 15. Jahrhunderts. In: MÖStA 32 (1979), 1-23.
Höflechner, Diss. Bd.1 =
Walter HÖFLECHNER, Beiträge zur Geschichte der Diplomatie und des Gesandtschaftswesens unter Maximilian I. 1490-1500. 3 Teile in 2 Bdn. (Teil II = Bd. 1), Masch. phil. Diss., Graz 1967.
Höflechner, Entwicklung =
Walter HÖFLECHNER, Die Entwicklung österreichischer Diplomatie im Mittelalter und die Außenpolitik Maximilians I. In: Erich Zöllner (Hg.), Diplomatie und Außenpolitik Österreichs. 11 Beiträge zu ihrer Geschichte (= Schriften des Institutes für Österreichkunde, Bd. 30). Wien 1977, 28-44.
Lanzer, Im Westen =
Andrea LANZER, Das Gesandtschaftswesen im Westen zu Beginn des 16. Jahrhunderts.
In: Gerhard Pferschy (Hg.), Siegmund von Herberstein. Kaiserlicher Gesandter und Begründer der Rußlandkunde und die europäische Diplomatie (= VStLA, Bd. 17). Graz 1989, 63-77.
Lutter, Politische Kommunikation =
Christina LUTTER, Politische Kommunikation an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Venedig und Maximilian I. (1495-1508) (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 34). Wien, München 1998.
Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte =
Stanislaw E. NAHLIK, Völkerrechtliche Aspekte der frühen Diplomatie. In: Gerhard Pferschy (Hg.), Siegmund von Herberstein. Kaiserlicher Gesandter und Begründer der Rußlandkunde und die europäische Diplomatie (= VStLA, Bd. 17). Graz 1989, 43-62.
Naschenweng, Diss. Bd.2 =
Hannes P. NASCHENWENG, Beiträge zur Geschichte der Diplomatie und des Gesandtschaftswesens unter Maximilian I. 1500-1508. 3 Teile in 2 Bdn. (Teil II = Bd. 2), Masch. phil. Diss., Graz 1978.
Hanna POGANTSCH-BISSINGER, Lucas de Renaldis im Dienste Kaiser Maximilians I. in den Jahren 1497-1509. Masch. phil. Diss., Graz 1976.
[ kein Kurzzitat ]
Schäffer, Geschwindigkeit =
Roland SCHÄFFER, Zur Geschwindigkeit des „staatlichen“ Nachrichtenverkehrs im Spätmittelalter. In: ZHVSt 76 (1985), 101-119.
Schaube, Entstehungsgeschichte =
Adolf SCHAUBE, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Gesandtschaften. In: MIÖG 10 (1889), 501-552.
Stourzh, Außenpolitik =
Gerald STOURZH, Außenpolitik, Diplomatie, Gesandtschaftswesen: zur Begriffserklärung und historischen Einführung. In: Erich Zöllner (Hg.), Diplomatie und Außenpolitik Österreichs. 11 Beiträge zu ihrer Geschichte (= Schriften des Institutes für Österreichkunde, Bd. 30). Wien 1977, 10-27.
Arno STROHMEYER, Kulturtransfer durch Diplomatie: Die kaiserlichen Botschafter in Spanien im Zeitalter Philipps II. und das Werden der Habsburgermonarchie (1560-1598).
In: Wolfgang Schmale (Hg.), Kulturtransfer. Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert (= Wiener Schriften zur Geschichte der Neuzeit, Bd. 2). Innsbruck 2003, 205-230.
[ kein Kurzzitat ]
Wiesflecker, Neue Beiträge =
Hermann WIESFLECKER, Neue Beiträge zum Gesandtschaftswesen Maximilians I.
In: Römische Historische Mitteilungen 23 (1981), 303-317.
[...]
[1] Stanislaw E. Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte der frühen Diplomatie. In: Gerhard Pferschy (Hg.), Siegmund von Herberstein. Kaiserlicher Gesandter und Begründer der Rußlandkunde und die europäische Diplomatie
(= VStLA, Bd. 17). Graz 1989, 43-62. Zitiert aus Seite 43. Im Folgenden kurz: Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte.
[2] Die bedeutendsten der älteren und/oder grundlegenden Arbeiten stammen u.a. von Maulde-La-Clavière, Reumont, Krauske, Schaube und Queller.
[3] Christina Lutter, Politische Kommunikation an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Venedig und Maximilian I. (1495-1508) (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Bd. 34). Wien, München 1998.
[4] Hermann Wiesflecker, Neue Beiträge zum Gesandtschaftswesen Maximilians I. In: Römische Historische Mitteilungen 23 (1981), 303-317.
[5] Fritz Ernst, Über Gesandtschaftswesen und Diplomatie an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. In: Archiv für Kulturgeschichte 33 (1951), 64-95.
[6] Walter Höflechner, Anmerkungen zu Diplomatie und Gesandtschaftswesen am Ende des 15. Jahrhunderts.
In: MÖStA 32 (1979), 1-23.
[7] Walter Höflechner, Beiträge zur Geschichte der Diplomatie und des Gesandtschaftswesens unter Maximilian I. 1490-1500. 3 Teile in 2 Bdn. (Teil II = Bd. 1), Masch. phil. Diss., Graz 1967.
[8] Hannes P. Naschenweng, Beiträge zur Geschichte der Diplomatie und des Gesandtschaftswesens unter Maximilian I. 1500-1508. 3 Teile in 2 Bdn. (Teil II = Bd. 2), Masch. phil. Diss., Graz 1978.
[9] Höflechner, Diss. Bd.1, 191f sowie 192, Anm. 1.
[10] Ebda, 191-193.
[11] Lutter, Politische Kommunikation, 181f.
[12] Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte, 51.
[13] In venezianischen Quellen werden die Gesandten der Republik meist als oratores, nie aber als legati bezeichnet. Häufig ist auch der Begriff ambassatores. Lutter, Politische Kommunikation, 32.
[14] Lutter, Politische Kommunikation, 191.
[15] Wiesflecker, Neue Beiträge, 304.
[16] Lutter, Politische Kommunikation, 199.
[17] Ebda, 192.
[18] Wiesflecker, Neue Beiträge, 304.
[19] Ebda.
[20] Lutter, Politische Kommunikation, 192.
[21] Wiesflecker, Neue Beiträge, 304.
[22] Lutter, Politische Kommunikation, 194.
[23] Ebda, 195.
[24] Wiesflecker, Neue Beiträge, 304.
[25] Heinz Gollwitzer, Zur Geschichte der Diplomatie im Zeitalter Maximilians I. In: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 74 (1955), 189-199. Zitiert aus Seite 190. Im Folgenden kurz: Gollwitzer, Geschichte der Diplomatie .
[26] Lutter, Politische Kommunikation, 195.
[27] Wiesflecker, Neue Beiträge, 304, sowie Gollwitzer, Geschichte der Diplomatie, 190.
[28] Wiesflecker, Neue Beiträge, 304. Hier schreibt Wiesflecker „...ständig vertreten...“, ohne es aber in irgendeinen Zusammenhang mit den sich in dieser Zeit entwickelnden „ständigen Gesandtschaften“ zu bringen, die ich noch behandeln werde. Offenbar handelt es sich hier nicht um ein und das selbe.
[29] Gollwitzer, Geschichte der Diplomatie, 192. Eine weitere Namensvariante ist: Lucas de Renaldis.
[30] Lutter, Politische Kommunikation, 195.
[31] Gollwitzer, Geschichte der Diplomatie, 191.
[32] Wiesflecker, Neue Beiträge, 305.
[33] Höflechner, Diss. Bd.1, 194.
[34] Die Signorie war der „dogale Rat“ und präsentierte offiziell die Republik Venedig. Man kann den Begriff in diesem Sinne als Synonym für die Republik bezeichnen. Lutter, Politische Kommunikation, 218.
[35] Weiter unten wird dagegen ein Gesetz schon aus dem Jahre 1268 erwähnt.
[36] Höflechner, Diss. Bd.1, 194-196.
[37] Ebda, 196.
[38] Lutter, Politische Kommunikation, 18-20.
[39] Höflechner, Diss. Bd.1, 197.
[40] Ebda, 197f.
[41] Ebda, 198.
[42] Ebda, 198f.
[43] Lutter, Politische Kommunikation, 45.
[44] Höflechner, Diss. Bd.1, 199f.
[45] Lutter, Politische Kommunikation, 43.
[46] Adolf Schaube, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Gesandtschaften. In: MIÖG 10 (1889), 501-552.
[47] Schaube, Entstehungsgeschichte, 536f.
[48] Ernst, Über Gesandtschaftswesen, 88f.
[49] Die Diarii des Marino Sanuto geben für 37 Jahre (1496-1533) so umfangreich wie keine andere Quelle Aufschluss über die internen Angelegenheiten Venedigs, aber auch über die diplomatischen und politischen Aktivitäten der Republik. Lutter, Politische Kommunikation, 17, sowie
Andrea Lanzer, Das Gesandtschaftswesen im Westen zu Beginn des 16. Jahrhunderts. In: Gerhard Pferschy (Hg.), Siegmund von Herberstein. Kaiserlicher Gesandter und Begründer der Rußlandkunde und die europäische Diplomatie (= VStLA, Bd. 17). Graz 1989, 63-77. Zitiert aus Seite 65. Im Folgenden kurz: Lanzer, Im Westen .
Da Höflechner an dieser Stelle Sanuto zitiert, dürfte jenem auch dies nicht entgangen sein.
[50] Höflechner, Diss. Bd. 1, 202f.
[51] Der meiste Briefverkehr, zumindest wichtige Stellen in den Depeschen, waren in einer Chiffre (Geheimschrift) geschrieben, da die Briefe oft abgefangen wurden und in falsche Hände gerieten.
[52] Höflechner, Diss. Bd. 1, 203f.
[53] Ebda, 205f.
[54] Ebda, 225.
[55] Diese strengen begrifflichen Unterscheidungen in „Osten“ und „Westen“ mögen vielleicht dem Zeitgeist Höflechners entstammen.
[56] Höflechner, Diss. Bd.1, 207-209.
[57] Ebda, 250.
[58] Ebda, 268.
Eine treffendere Bezeichnung wäre natürlich das ius gentium. Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte, 48.
[59] Höflechner, Diss. Bd.1, 250.
[60] Ebda, 250f.
[61] Ebda, 251.
[62] Lutter, Politische Kommunikation, 61.
[63] Ebda, 63.
[64] Ebda, 65.
[65] Ebda, 64.
[66] Ernst, Über Gesandtschaftswesen, 74f.
[67] Ebda, 75f.
[68] Ebda, 76.
[69] Wiesflecker, Neue Beiträge, 315.
[70] Isaak Bernays, Die Diplomatie um 1500. In: Historische Zeitschrift 138 (1928), 1-23. Zitiert aus Seite 16f.
[71] Höflechner, Diss. Bd.1, 209.
[72] Ebda, 210f.
[73] In der Regel ließ sich der Papst die Ausarbeitung der Rede, die der Gesandte zu halten beabsichtigte, am Abend davor bringen, um sich entsprechend vorbereiten zu können. Höflechner, Diss. Bd.1, 211, Anm. 7.
[74] Hadrian VI. habe dies mit dem Hinweis getan, die Gesandten seien vom langen Stehen in den schweren Gewändern wohl müde und bedürften der Ruhe. Höflechner, Diss. Bd.1, 212, Anm. 2.
[75] Höflechner, Diss. Bd.1, 211f.
[76] Ebda, 212.
[77] Ebda, 224.
[78] Wiesflecker, Neue Beiträge, 314.
[79] Im Reich existierte spätestens 1489 eine Postlinie – also eine feste Reiterstafette – die Innsbruck mit den Niederlanden verband. Seit 1494 war der süddeutsche Raum mit Mailand verbunden. In Frankreich wurde die Post 1464 begründet und stand sogar den Kurieren und Gesandten befreundeter Mächte zur Verfügung. Italien gilt als das Ursprungsland der Post, wobei für Mailand der älteste Beleg von einem Boten mit wechselnden Pferden bekannt ist. Für das Jahr 1444 ist für das Königreich Neapel eine echte Stafettenkette bezeugt. Höflechner, Anmerkungen, 18f, Anm. 42 und 43.
[80] Höflechner, Diss. Bd.1, 266.
[81] Ebda, Anm. 1.
[82] Höflechner, Anmerkungen, 12, Anm. 25.
[83] Lutter, Politische Kommunikation, 107.
[84] Höflechner, Diss. Bd.1, 266.
[85] Lutter, Politische Kommunikation, 110.
[86] Höflechner, Diss. Bd.1, 266f.
[87] Lutter, Politische Kommunikation, 113.
[88] Lutter, Politische Kommunikation, 111f.
Ein Gesandter erhielt üblicherweise 120, gelegentlich 150 Dukaten für seine monatlichen Lebenshaltungskosten im Rahmen der Vertretung der Signorie bei einem auswärtingen Adressaten! Ebda.
An diesen Beispielen sind die ungeheuren Kosten von Diplomatie und Nachrichtenübermittlung eines damaligen Herrschers bestens verdeutlicht.
[89] Lutter, Politische Kommunikation, 107.
[90] Höflechner, Anmerkungen, 19, Anm. 42.
[91] Ebda, 19.
[92] Roland Schäffer, Zur Geschwindigkeit des „staatlichen“ Nachrichtenverkehrs im Spätmittelalter.
In: ZHVSt 76 (1985), 101-119. Im Folgenden kurz: Schäffer, Geschwindigkeit.
[93] Schäffer, Geschwindigkeit, 103.
[94] Walter Höflechner, Die Entwicklung österreichischer Diplomatie im Mittelalter und die Außenpolitik Maximilians I. In: Erich Zöllner (Hg.), Diplomatie und Außenpolitik Österreichs. 11 Beiträge zu ihrer Geschichte (= Schriften des Institutes für Österreichkunde, Bd. 30). Wien 1977, 28-44. Im Folgenden kurz: Höflechner, Entwicklung.
[95] Höflechner, Entwicklung, 37.
[96] Höflechner, Anmkerungen, 11, Anm. 25.
[97] Ebda.
[98] Ebda, 17, Anm. 39.
[99] Ebda, 16f.
[100] Höflechner, Diss. Bd.1, 274.
[101] Lutter, Politische Kommunikation, 109.
[102] Ebda.
[103] Gerald Stourzh, Außenpolitik, Diplomatie, Gesandtschaftswesen: zur Begriffserklärung und historischen Einführung. In: Erich Zöllner (Hg.), Diplomatie und Außenpolitik Österreichs. 11 Beiträge zu ihrer Geschichte (= Schriften des Institutes für Österreichkunde, Bd. 30). Wien 1977, 10-27. Zitiert aus Seite 24. Im Folgenden kurz: Stourzh, Außenpolitik.
[104] Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte, 49f.
[105] Wiesflecker, Neue Beiträge, 303.
Es sollte die gebende Funktion beider, besonders der Kurie, betont und ihre Erhabenheit über den Lauf der Dinge, die an sie herangetragen, nicht aber von ihnen mit banger Anteilnahme verfolgt werden, demonstriert werden. Freilich hat sich dieses Ideal nicht ganz verwirklichen lassen. Höflechner, Diss. Bd.1, 289.
[106] Wiesflecker, Neue Beiträge, 303.
[107] Höflechner, Anmerkungen, 13-15.
[108] Ernst, Über Gesandtschaftswesen, 76f.
[109] Höflechner, Anmerkungen, 14.
[110] Ebda, 15.
[111] Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte, 50.
[112] Ernst, Über Gesandtschaftswesen, 93f. Daher konnten ständige Gesandtschaften, im Gegensatz zu den gelegentlichen, ohne Angabe eines Grundes zurückgewiesen werden. Ebda, 94.
[113] Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte, 50.
[114] Lanzer, Im Westen, 63f.
Ernst hingegen hält die These von der Übertragung des italienischen Gleichgewichts (welches eine Konstruktion aus dem Kreis um Lorenzo Medici gewesen sein soll) auf Europa für anfechtbar. Für ihn sind die ersten ständigen Gesandtschaften weniger der Audruck eines Gleichgewichts als sich festigender Interessengemeinschaften und Bündnisse zwischen einzelnen Mächten. Ernst, Über Gesandtschaftswesen, 95.
Denn, in einer Zeit, in der Allianzen leichtfertig geschlossen und wieder aufgelöst wurden, in der die Regierungen mit Kräften rechnen mussten, deren militärisch-politische Bedeutung sie nur unvollkommen kannten, und nicht zuletzt, um rechtzeitig über Pläne der Rivalen informiert zu werden und daraufhin eventuell eine Gegenkoalition ins Leben zu rufen, sei die Errichtung ständiger Gesandtschaften erforderlich geworden. Hanna Pogantsch-Bissinger, Lucas de Renaldis im Dienste Kaiser Maximilians I. in den Jahren 1497-1509. Masch. phil. Diss., Graz 1976. Zitiert aus Seite 156.
[115] Lanzer, Im Westen, 67.
[116] Wie schon oben erwähnt. Ebda, 70, Anm. 54.
Stourzh dagegen setzt den ersten ständigen Gesandten schon mit 1431 an, als Venedig Geronimo Contareno mit dem Auftrag nach Rom sandte, dort zu residieren und sich aller die Republik betreffenden Angelegenheiten anzunehmen. Stourzh, Außenpolitik, 24.
Naschenweng ortet die ersten ständigen Gesandten schon im 14. Jahrhundert, wobei seine Quelle Clark ist. Naschenweng, Diss. Bd.2, 3.
[117] Lanzer, Im Westen, 70.
[118] Ernst, Über Gesandtschaftswesen, 92.
[119] Höflechner, Diss. Bd.1, 286.
[120] Lanzer, Im Westen, 70f.
[121] Höflechner, Diss. Bd.1, 287.
[122] Ebda.
[123] Lanzer, Im Westen, 71.
[124] Ernst, Über Gesandtschaftswesen, 94f.
[125] Nahlik, Völkerrechtliche Aspekte, 52f.
[126] Aus einer Instruktion eines ständigen Gesandten. Schaube, Entstehungsgeschichte, 516.
[127] Ebda, 535.
[128] Höflechner, Diss. Bd.1, 286f.
[129] Arno Strohmeyer, Kulturtransfer durch Diplomatie: Die kaiserlichen Botschafter in Spanien im Zeitalter Philipps II. und das Werden der Habsburgermonarchie (1560-1598). In: Wolfgang Schmale (Hg.), Kulturtransfer. Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert (= Wiener Schriften zur Geschichte der Neuzeit, Bd. 2). Innsbruck 2003, 205-230.
[130] Ebda, 206f. Natürlich kam es auch durch die traditionellen, von Fall zu Fall geschickten Gesandtschaften zu einem Kulturaustausch zwischen den einzelnen Mächten.
[131] Ebda, 219.
[132] Ebda, 207.
[133] Ebda, 206.
[134] Ebda, 212 bzw. 215.
[135] Ebda, 214.
[136] Ebda, 212.
[137] Ebda, 219.
[138] Ebda, 216.
[139] Stourzh, Außenpolitik, 25.
[140] Höflechner, Diss. Bd.1, 288.
[141] Ebda.
[142] Ernst, Über Gesandtschaftswesen, 93.
- Arbeit zitieren
- Helmut Hödl (Autor:in), 2005, Allgemeines zum GESANDTSCHAFTSWESEN in Mitteleuropa zu Beginn der Neuzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109536
Kostenlos Autor werden







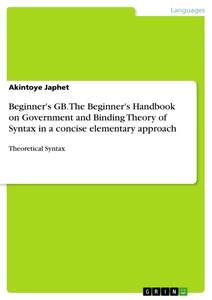
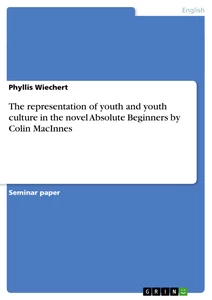

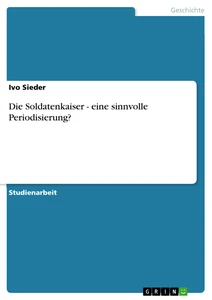




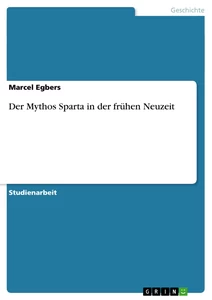
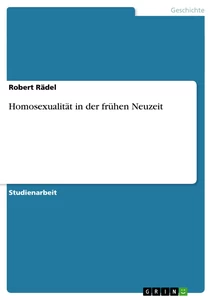
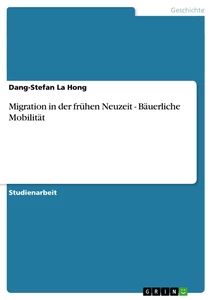


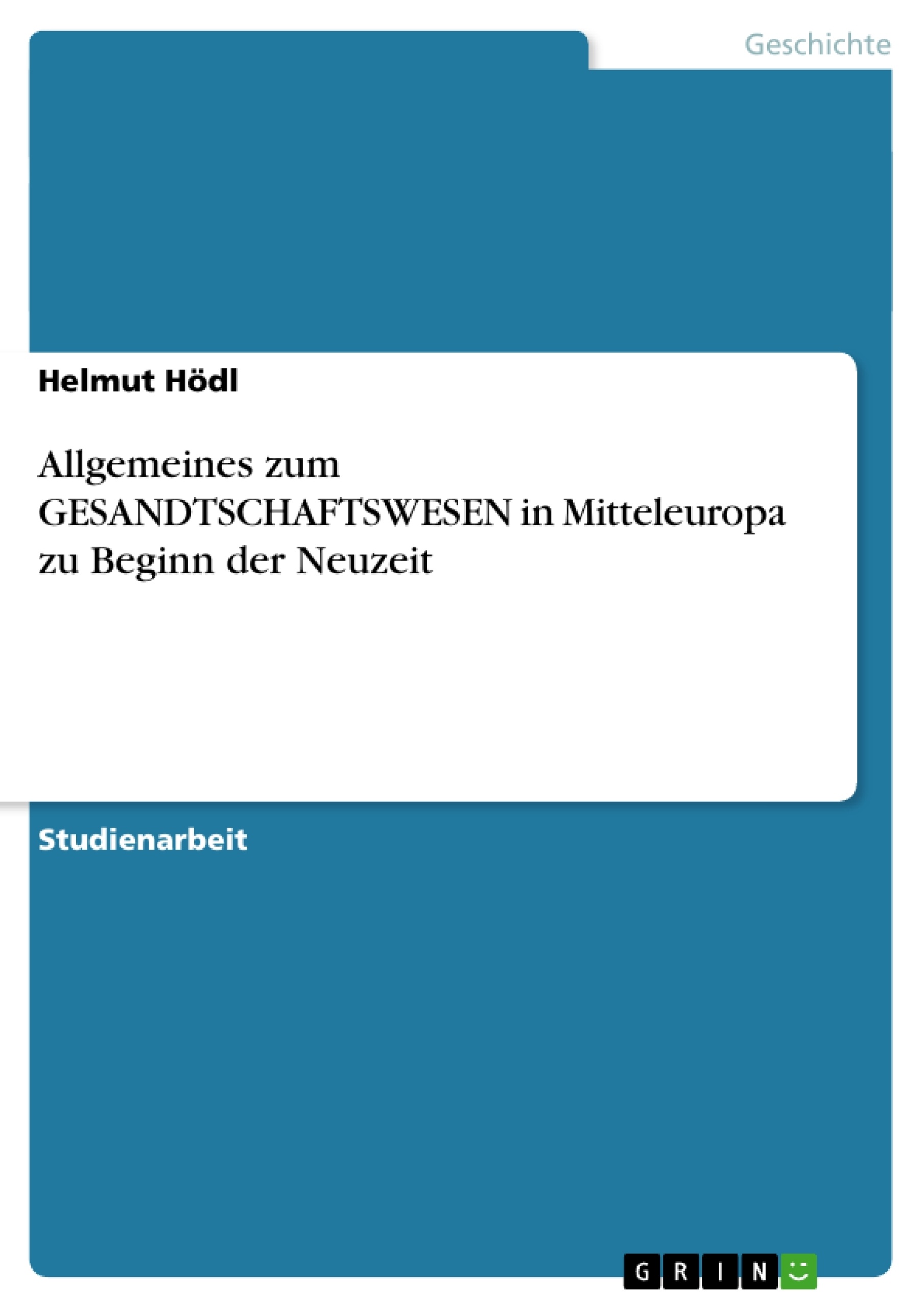

Kommentare