Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. „Endspiel“ von Samuel Beckett
2. Rollenspiele bei Beckett
2.1. Soziale Rollenspiele
2.2. Andere Rollenspiele
2.3. Hamm und Clov als Schauspieler
3. Taboris Inszenierung „Fin de Partie”
4. Rollenspiele bei Tabori
4.1. Das Schauspielerpaar
4.2. Parodie des Rollenspielens
4.3. Die scheinbare Meta-Ebene
5. Intertextualität bei Beckett und Tabori
6. Theater als Kommunikationssystem
7. Fazit
Literaturverzeichnis
0. Einleitung
Wenn Theater sich selbst zum Thema macht, dann muss es nicht unbedingt durch ein „Spiel im Spiel“ geschehen, wie bei Shakespeares „Hamlet“. Auch müssen die Figuren nicht notwendigerweise konkret über Theater diskutieren. Samuel Becketts „Endspiel“ reflektiert Theater in vielen Facetten ohne es offen zu thematisieren. Es ist ausschließlich vom „Spiel“ die Rede. Obzwar Beckett darauf bestand, es sei „bloßes Spiel“, scheint der Schritt vom Spiel zum Schau-Spiel nur ein kleiner zu sein.
Dies deutet bereits die Schwierigkeit der Beckett-Rezeption an. Der Zugang zu seinen Werken ist nicht einfach. Sie sind voller Rätsel und diese bewahrte sich der Autor auch sorgfältig, selbst wenn er seine eigenen Stück als Regisseur in Szene setzte. Michael Haerdter befragte Beckett zu „Endspiel“: Ob der Autor eine Lösung dieser Rätsel parat haben müsse? Becketts Antwort: „Der dieses Spieles nicht.“(zit. nach Haerdter S.6) Die Forschungsmeinungen zu Becketts Werk gehen in einigen Punkten weit auseinander, während andere einheitlich interpretiert werden. Ich habe versucht verschiedene Sichtweisen zusammen zu fassen.
Meine Arbeit untersucht die Problematik der Selbstreflexivität im „Endspiel“, genauer die Selbstreflexion des Theaters. Dabei interessiert die Frage: Auf welche Weise gelingt es Beckett Theater zu reflektieren, ohne es direkt zu thematisieren? Der Theaterbegriff ist hierbei in seinem umfassendsten Sinn gemeint. Weiterhin soll untersucht werden, wie Tabori in seiner Inszenierung mit der Selbstreflexion im „Endspiel“ umgeht? Die vorliegende Arbeit versucht allerdings keine Transformationsanalyse, sondern möchte mit der Analyse der Aufführung zusätzliche Dimensionen der Selbstreflexion des Theaters im „Endspiel“-Stoff herausarbeiten. Dabei ist vor allem das Spiel jenseits des Originaltextes interessant, so dass vorwiegend darauf eingegangen wird.
Bentleys Formel des Theaters: „A als B vor C“[1] kennzeichnet das Spielen von Rollen („als B“) und die Anwesenheit von Zuschauern („C“) als charakteristisch für Theater. Davon ausgehend liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Analyse von Rollenspielen im „Endspiel“. Des Weiteren möchte ich auf die Reflexion des Kommunikationssystems zwischen Bühne und Publikum sowie auf intertextuelle Bezüge und Verweise in Text und Inszenierung eingehen, da Theater immer auch seine Geschichte reflektiert. Auf Grund des beschränkten Umfangs der Hausarbeit konnten nicht alle Ansätze in angemessener Gründlichkeit behandelt werden und wurden daher zusammengefasst.
Es erscheint mir sinnvoll einige Bemerkungen voraus zu schicken: Wenn im Folgenden von Rollenspielen die Rede ist, sind keineswegs pädagogische oder psychologische Rollenspiele gemeint, die stets einen bestimmten Zweck erfüllen sollen. Genau das fehlt den Rollenspielen im „Endspiel“. Gemeint ist schlichtweg das Spielen von und mit (Theater)Rollen. Um Verwechslungen vorzubeugen habe ich bei Gedanken zum Theatertext den Titel der deutschen Übertragung: „Endspiel“ verwendet, da die Inszenierung Taboris den Originaltitel trägt. Zur besseren Verdeutlichung meiner Argumente habe ich von Fall zu Fall aus dem französischen Original oder Becketts eigener englischen Übertragung zitiert.
1. „Endspiel“ von Samuel Beckett
Beckett selbst betrachtete sein zwischen 1954 und 1956 in zwei Fassungen entstandenes „Endspiel“ (frz. Original: „Fin de partie“) als Gipfel seines Schaffens. Doch zunächst fand sich kein französisches Theater, das es produzieren wollte. Die Uraufführung ging deshalb am 3. April 1957 am Royal Court Theatre, London in französischer Sprache über die Bühne. Danach trat es seinen „Siegeszug“ um die Welt an, erreichte aber nie den Erfolg seines Vorgängers „En attendant Godot“(1952). Wurde es in seiner Anfangszeit (deutsche Erstaufführung: 30.9.1957 im Schloßpark-Theater, Berlin) teilweise mit Befremden und Ablehnung aufgenommen, zählt es heute bereits zu den Klassikern der Moderne.
Der Ire Beckett, geboren am 13. April 1906 in Dublin, siedelte 1937 nach Frankreich über und veröffentlichte seine beiden längeren Theaterstücke in französischer Sprache, nachdem zwei Romane („Murphy“,1938 und „Watt“,1942) bereits in englisch erschienen waren. In Paris lernte er seinen Landsmann und literarischen Lehrmeister James Joyce (1882-1941) kennen. Beiden wurde ein Hang zum Schweigen nachgesagt.(vgl. Hensel S.1325) Alfred Simon will das Paar Joyce-Beckett gar im „Endspiel“ als Hamm und Clov wiedererkannt haben.(vgl. Simon S.260, auch Hensel S.1325) 1969 erhielt Beckett den Literaturnobelpreis. Er starb am 22. Dezember 1989 in Paris.
Beckett bevorzugte existentielle Themen: Ängste, Sehnsüchte, Schmerz, das Scheitern. Er umspielt in seinem Werk den Bereich des Unsagbaren und widerspiegelt auch im Stillstand des „Endspiels“ die fatale Situation des Künstlers: „The expression that there is nothing to express, nothing with which to express, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, together with the obligation to express.“[2]
Becketts besondere Beachtung galt der Sprache und so zeichnen sich auch seine Theatertexte durch hohe Musikalität und besondere Rhythmik aus. Die Interpretation seiner Stücke gestaltet sich schwierig. Sie sind meist handlungsarm, die meisten Zusammenhänge lassen sich nur andeuten. Sie sind voller Wortspiele und eine Identifikation mit den Figuren ist kaum möglich. „Becketts Stücke lassen sich nicht ausdeuten, denn die Pointe dieser Spiele besteht eben gerade darin, daß sie nichts anderes als Spiele sind [...]“(Hensel S.1327). „Endspiel“ stellt dabei den Beginn seines schriftstellerischen Strebens nach höchster Präzision auf der Bühne dar, das sich in „Acte sans paroles“[3] und „Krapp's last tape“(1958) fortsetzt. Nahezu jede Geste, jede Haltung der Figuren wird in den immer umfangreicher werdenden Regieanweisungen vorgegeben.
Der Autor, der auch als Regisseur tätig war, hielt sich mit Deutungen stets zurück. Seine Inszenierungen eigener Theatertexte sind keine Selbstinterpretationen, sondern „[...] sind zu verstehen als Versuche, die akustisch-visuellen und musikalisch-strukturellen Sachverhalte seiner Spiel-Partituren mit äußerster Präzision und Werktreue zu verdeutlichen.“(Laass/Schröder S.22f) Michael Haerdter berichtet von den Proben zu Becketts Berliner „Endspiel“-Inszenierung 1967:
„Detailarbeit. Beckett greift ständig in den Ablauf ein. Clovs Lachen soll nur eine Andeutung sein, fern vom Zwerchfell, erstickt zwischen Zunge und Gaumen. [...] Schröders Bewegung beim Putzen der Brille und Falten des Tuchs ist Beckett zu groß: 'Bitte nicht die Arme, nur die Hände bewegen.'“ (Haerdter S.99)
Zum Inhalt: Auf der „Endspiel“-Bühne treten zunächst zwei Krüppel auf. Der blinde gelähmte Hamm, der im Rollstuhl sitzt, sich zum Mittelpunkt allen Geschehens aufspielt und sich von seinem Diener Clov, der stinkt und angeblich nicht sitzen kann, die Welt erklären lässt. Die beiden stehen in einem eigenartigen Herr-Knecht-Verhältnis. Clov will nichts als die Ruhe und Ordnung seiner Küche und kündigt immer wieder an Hamm zu verlassen. Dennoch lässt er sich von ihm herum kommandieren, beleidigen und „tanzt“ nach dessen Pfeife. Ihre Dialoge kreisen um immer gleiche Phrasen und das Hauptthema: das Ende. In den beiden Mülltonnen, die auf der Bühne stehen, vegetieren Nagg und Nell, Hamms verhasste Eltern, vor sich hin. Sie haben keine Beine mehr. Außerhalb des bunkerartigen Unterschlupfs ist „die andere Hölle“. Alles deutet darauf hin, dass diese vier die letzten Lebewesen sind und die Vorräte gehen zur Neige.
Es ist ein seltsames Spiel, das die Figuren spielen. Offenbar existieren feste Regeln, die weder den Figuren noch den Zuschauern gänzlich bekannt sind. Aber dass es sich um Spiel handelt, machen die Figuren von Beginn an deutlich: Hamm spielt vom ersten Monolog: „... A ... bâillements... à moi. Un temps. De jouer.“(DDI[4] S.212) bis zum letzten: „Puisque ça se joue comme ça ...[...] jouons ça comme ça [...].“(DDI S.314). Clov spielt, auch wenn er es leid ist: „ implorant: Cessons de jouer!“(DDI S.304).
Das Spiel ist das wichtigste Beschäftigungselement der Figuren. Georg Hensel zählt eine Menge an Spielen auf:
„[...] das Blindekuh-Spiel, mit dem sie sich ihrer gegenseitigen Anwesenheit versichern; das Rollstuhl-Spiel, mit dem sie sich die Beschränktheit ihrer Welt bestätigen, in der gleichwohl der Herr die Mitte einnehmen will; das Religions-Spiel, das ihnen mit seinem unerfüllten Geist erneut ihr Dasein als unbegreiflich klarmacht; das Kunst-Spiel, diese Erfindung eines logisch entwickelten Romans, für den sie sich nur interessieren können, wenn sie sich gegenseitig das Interesse an den Konventionen der Kunst einreden.“(Hensel S.1334f)
Daneben erweisen sich das Spielen mit der eigenen Identität und das Spielen mit (Theater)Rollen als charakteristisch für die „Endspiel“-Figuren.
Die suggerierte Totalität und Endlosigkeit[5] des Spiels schließt „[...] alle gegenteiligen Begriffe wie Ernst oder Realität“(Becker S.60) mit ein. Bei „gewöhnlichen“ Spielen sind Regeldiskussionen lediglich auf einer Meta-Ebene möglich, die nur erreicht werden kann, wenn das Spiel endet oder unterbrochen wird. Da dieses Spiel aber weder enden noch unterbrochen werden kann, gibt es auch keine Meta-Ebene. Alle Diskussionen über Spielregeln, sowie Clovs Ausbruchsversuche gehören selbst zum Spiel.
2. Rollenspiele bei Beckett
In der extremen Isolation der Figuren ist ihnen einzig das Spiel geblieben: „[...] Hamm und Clov spielen sich das Leben vor.“(Hensel S.1334) Dabei erscheinen ihre sozialen Rollen ebenso spielerisch und auswechselbar, wie Theaterrollen, die die Schauspieler nach Ende der Aufführung einfach ablegen können. Die Identität der Figuren lässt sich nicht anhand der von ihnen gespielten Rollen festmachen. Im diesem Kapitel soll untersucht werden, welche Rollen die Figuren spielen.
2.1. Soziale Rollenspiele
Zweifelsfrei lässt sich inhaltlich zwischen Hamm und Clov ein, wenn auch eigenartiges, Herr-Diener-Verhältnis herausarbeiten. Dieses könne aber, laut Gabriele Schwab, nicht sozial interpretiert werden, da der soziale Kontext fehle.(vgl. Schwab S.83) In einer Welt, wo diese zwei und Hamms Eltern die einzigen Lebewesen zu sein scheinen, ist die Aufteilung in Herr und Knecht nichts weiter als eine Verabredung, ein Rollenspiel. Clov fragt sich, warum er den Diener spielt: „Fais ceci, fais cela, est je le fais. Je ne refuse jamais. Pourquoi?“(DDI S.260) oder „[...] Pourquoi je t'obéis toujours? [...]“(DDI S.302). Im endlosen „Endspiel“ sind Begriff wie Herr und Diener austauschbar. Beide benutzen mehrmals nahezu identische, und demnach austauschbare, Repliken[6] und ähnliche Anspielung auf die Hirsekörner des Zenon (Clov S.210, DDI und Hamm S.294, DDI).
In Hamms Geschichte, die er sein „chronicle“ nennt, verdichten sich die Hinweise auf eine Vater-Sohn-Beziehung zwischen ihm und Clov. Sind die Andeutungen auch zahlreich[7], so liegen sie doch in der Vergangenheit oder Fiktion der Figuren. Da Hamm mit seiner Geschichte den Anschein erweckt, er könne seine eigene Vergangenheit beeinflussen, ist es für den Zuschauer kaum möglich, dessen „chronicle“ zum Spielgeschehen in Beziehung zu setzen. Wenn überhaupt, so ließe sich eine Vater-Sohn-Beziehung nur als weiteres Rollenspiel einordnen.
2.2. Andere Rollenspiele
Neben ihren sozialen Rollen spielen die Figuren auch mit Theaterrollen. Sie bedienen sich dabei bestimmter Rollenklischees der Theatergeschichte:
„In ihrer ausweglosen Patt-Situation beginnen die Figuren (Theater-)Rollen zu spielen: Hamm z.B. als matter Tragödienheld, Magister ludi und Erzähler, Clov als buffoneske Dienerfigur und Beobachter der Außenwelt, etc. Clov (Nomen est Omen) fällt auch gestisch ins Rollenfach des Clowns, da er sich mit steifen, wankenden Schritten [...] automatenhaft bewegt.“(Becker S.68)
Nicht nur als Schöpfer seines Romans offenbart sich Hamm als Künstler. Er ist auch Regisseur und Moderator im „Endspiel“. Hamm „[...] führt Regie, diktiert den anderen ihre Rollen und inszeniert die Erzählung seiner Lebensgeschichte.“(Fischer-Lichte S.253) Beispielsweise fordert er Clov auf, sich nur an bestimmten Stellen des Raumes aufzuhalten und gibt sich und Clov Regieanweisungen: „Hamm: [...] Jeter. Il jette la gaffe, [...]“(DDI S.312). Ein weiteres Beispiel:
„Hamm: [...] J'ai avancé mon histoire. Un temps. Je l'ai bien avancé. Un temps. Demande-moi où j'en suis. / Clov: Oh, à propos, ton histoire? / Hamm très surpris: Quelle histoire? / Clov: Celle que tu te racontes depuis toujours. / Hamm: Ah, tu veux dire mon roman? / Clov: Voilà. / Un temps. / Hamm avec colère: Mais pousse plus loin, bon sang, pousse plus loin!“(DDI S.280)
Hamm muss ständig Mittelpunkt der Handlung, wie des Raumes sein. Dennoch ist Hamm Teil des Spiels und seinen Regeln unterworfen. Selbst wenn er sich am Ende des Stückes mit seinem Tuch das Gesicht verhängt, „solange der Zuschauer ihn wahrnimmt, kann er nicht enden.“(Fischer-Lichte S.253)
Bereits der Titel des Stückes „Fin de partie“ (oder besser noch die englische Fassung: „Endgame“) assoziiert das Ende einer Partie Schach. Wenn nur noch der König(Hamm) und sein Springer(Clov) (vgl. Fischer-Lichte S.248) übrig sind, dann zieht sich das Spiel in die Länge und macht keinen Sinn mehr. Die Ausweglosigkeit einer Patt-Situation lässt sich mit dem Stillstand des „Endspiels“ durchaus vergleichen. Außerdem bekräftigt dieses Rollenspiel die These, die Figuren spielten nicht selbst, sondern „[...] gehorchen Zug um Zug den Gesetzen eines Spieles oder Dialoges [...], der sie auf der Bühne festhält.“(Becker S.62)
Ulrich Meier sieht noch ein weiteres Rollenspiel: Das Spiel versuchter Emanzipation. Die Spannung des Stückes besteht aus der Frage, ob es Clov gelingen wird, sich von seinem Unterdrücker zu befreien. Aber Beckett verzichtet auf das Zeigen einer Lösung des Problems: Clov wird seinen Peiniger weder erschlagen noch verlassen.
„Die Unabgeschlossenheit von gespielten Situationen erzeugt Enttäuschung beim Zuschauer; Lösungen, auf die man wartet werden verweigert; Katharsis entfällt. [...] Beckett macht der Welt nichts vor. Auch er überschätzt die Rolle der Kunst nicht. Seine Weigerung, unbewältigte Situationen fiktiv zu schließen, ist unter anderem der Erfahrung geschuldet, daß ästhetische Erziehungsprogramme und Kunstrevolutionen, besonders die der Avantgarde, in der bürgerlichen Gesellschaft ohne relevante soziale Konsequenzen blieben.“(Meier S.140)
2.3. Hamm und Clov als Schauspieler
Das Spielen von Rollen macht die Figuren zum einen mit zwei Schauspielern vergleichbar, die fast bruchlos zwischen verschiedenen Rollen aus ihrem Repertoire hin- und herspringen, zum anderen ist die Schauspielerrolle gleichfalls eine Rolle aus „ihrem Repertoire“.
Bereits die Namen deuten auf die Schauspieler-Identität der Figuren hin: „Hamm ist ein Schauspieler (ham-actor heißt auf englisch: Schmierenkomödiant). Er weiß sich auf einer Bühne. [...] Wie Pozzo liebt er die Posse.“(Laass/Schröder S.54) Außerdem deklamiert Hamm gern und verfügt über mehrere Sprechweisen. Auch Clov ist sich seiner Bühnenpräsenz bewusst, er übernimmt den clownhaften Gegenpart zu Hamms Rolle. Die Figuren thematisieren den Dialog und damit ihr Theaterdasein, das im handlungsarmen „Endspiel“ fast ausschließlich aus Gesprächen besteht: „Clov: I’ll leave you. / Hamm: No! / Clov: What is there to keep me here? / Hamm: The dialogue.“(DDI S.488) Ute Drechsler bringt einen Vergleich von Hamms Taschentuch mit einem Theatervorhang: „Indem er das Taschentuch von seinem Gesicht lüftet, verwandelt er sich aus seiner Nicht-Existenz in einen Akteur, wie auf den früheren Bühnen nach Heben des Vorhangs die Figuren allmählich zum Leben erwachen.“(Drechsler S.123) Das Stück endet, indem Hamm andeutet sein Taschentuch wieder über den Kopf zu ziehen, der Vorhang fällt.
Für Theater ist die Anwesenheit von Zuschauern essentiell,[8] auch dies wird im „Endspiel“ reflektiert. Die Figuren gehen „[...] von einem Wahrgenommenwerden aus, ohne diese stückbestimmende Annahme weiter zu hinterfragen.“(Becker S.61) Sie denken sich ein „vernunftbegabtes Wesen“, aus dessen Sicht ihr Spiel, ihre Existenz vielleicht einen Sinn macht. Bereits auf der Figurenebene wird das Buhlen um Zuhörer deutlich: Hamm besticht seinen Vater mit Pralinen, damit der sich seine Geschichte anhöre und zwingt Clov zum mehrmaligen Nachfragen über den Stand der Geschichte.
„Esse est percipi“ (Sein heißt Gesehenwerden), das Leitmotiv der Philosophie des irischen Empiristen George Berkeley (1685-1753), den Beckett mit Vorliebe zitiert haben soll (vgl. Fischer-Lichte S.252), gilt, wie für Theaterschauspieler, auch für die Figuren des „Endspiels“. Doch die gedachten Zuschauer gehören, wie die Figuren, zur Spiellogik des Spiels dazu, sodass sie „[...] gerade deshalb nicht auf einer Meta-Ebene überprüft werden können.“(Becker S.64) Die Figuren werden zum Teil einer Theateraufführung, von der sie zwar ahnen, aber nur mutmaßen können: „Quelque chose suit son cours.“(DDI S.224, 248)
So wie Hamm einen Zuhörer für seine Geschichte braucht, legitimiert erst die Anwesenheit des Publikums das Spiel der Schauspieler jeder Theateraufführung. Damit reflektiert das „Endspiel“ die Kunstform Theater als Vorgang gleichzeitiger und kollektiver Produktion und Rezeption.
Auch Hamm und Clov kommentieren – so wie „richtige“ Schauspieler es gelegentlich bei Proben (zum besseren Kennenlernen ihrer Rolle oder Einstudieren von komplexen Handlungsfolgen) zu tun pflegen – ständig ihre Rollen, Gesten und Denkansätze:
„Clov: Je suis retour, avec la lunette. Il va vers la fenêtre droite, la regarde. Il me faut l'escabeau. [...] Entre Clov avec l'escabeau, mais sans le lunette. Clov: J'apporte l'escabeau. Il installe l'escabeau sous le fenêtre à droite, monte dessus, se rend compte qu'il n'a pas la lunette, descend de l'escabeau. Il me faut la lunette. [...]“(DDI S.242)[9]
Hamms Geschichte ist immer wieder unterbrochen von Kommentaren wie: „Non, ça je l'ai fait.“ oder: „Ça va aller.“(DDI S.270). Ebenso benutzen die Figuren Begriffe aus dem Theateralltag, die ihnen, wüssten sie nicht um ihr Bühnendasein, kaum bekannt sein dürften: „Hamm avec colère: Un aparté! Con! C'est le première fois que tu entends un aparté? Un temps. J'amorce mon dernier soliloque.“(DDI S.304); „Clov: C'est ce que nous appelons gagner la sortie.“(DDI S.314)
Hamm und Clov führen sich auf wie zwei alte Schauspieler, denen nichts von ihrem früheren Leben geblieben ist, als ihre alten Rollen. Die ultimative Interpretation aller Brüche und Unsicherheiten über die Identität der Figuren ist das allerdings nicht. Gabriele Schwab stellt fest, „[...] daß es eine ‚Identität‘ der Figur gibt, die nicht in der Rolle des Schauspielers aufgeht.“(Schwab S.85) Auch die Schauspielerrolle ist eine Rolle neben anderen: „Explizit führt er (Hamm, d.Verf.) sich als Schauspieler ein, gähnend jedoch, in der Distanzierung von der zu spielenden Rolle also schon ein Signal setzend, daß er als Figur nicht auf die Rolle des Schauspielers reduzierbar sei.“(Schwab S.84)
Festhalten lässt sich, dass hinter den vielfältigen Rollenspielen der Figuren keine klare Figurenidentität steht. Allerdings darf man nicht der Gefahr unterliegen, die Figuren und ihre Rollen zu psychologisieren, wie Martin Esslin:
„Hamm und Clov, Pozzo und Lucky, Wladimir und Estragon, Nagg und Nell sind keine Individuen, sondern Verkörperungen grundsätzlicher menschlicher Verhaltensweisen; man könnte sie mit den personifizierten Tugenden und Lastern in mittelalterlichen Moralitäten oder spanischen auto sacramentales vergleichen.“(Esslin S.86)
Sicher verleitet das „Endspiel“ zu philosophischen Interpretationen, vergessen werden darf dabei aber nicht, was Beckett immer wieder betonte: Es ist „nichts weniger“ als ein Spiel. Als solches darf es in der Interpretation nicht überbewertet werden.
Hamm und Clov zeichnen sich durch ihr „diskontinuierliches Bewusstsein“(vgl. Becker S.73) aus. Sie bedürfen keiner biografisch gesicherten Identität, für sie ist das Spielen von Rollen identitätsstiftend. Dazu gehören das Herr-Knecht-Spiel, das Schauspieler-Regisseur-Spiel, die Theaterrollen. Sie legen beim Rollenspiel die Routine eines alten Schauspielerpaares an den Tag und sind dabei voneinander abhängig wie ein altes Ehepaar[10].
„Endspiel“ spiegelt Theater als Spielen von inszenierten Rollen vor einem Publikum wider, in dem Hamm auf der Bühne das Erzählen seines Romans inszeniert und dabei ständig die Sprecherrolle wechselt. Es ist eine parodierende Reflexion, da Hamm sein Publikum zum Zuhören zwingen muss. Weiterhin werden durch die verschiedenen Rollenspiele das Schauspielerdasein, die Regisseur-Schauspieler-Beziehung und historische Theaterrollen reflektiert. „Endspiel“ verdeutlicht auch Becketts ästhetische Position, dass diskutierte Probleme auf der Bühne nie endgültig gelöst werden können.
3. Taboris Inszenierung „Fin de Partie“
Taboris Inszenierung (Premiere am 31. Januar 1998 im Akademietheater des Wiener Burgtheaters) setzt bei der vermuteten Schauspieler-Identität der Figuren an: Er stellt zwei sich explizit als Schauspieler einführende Figuren auf die Bühne, die in einer „öffentlichen Probe“ das „Endspiel“ erarbeiten. Es gibt kein Bühnenbild, nur zwei Stühle auf denen Ignaz Kirchner (spielt Clov) und Gerd Voss (spielt Hamm) Platz nehmen und das Stück „probieren“ wollen. Dabei gehen sie zunächst strikt nach Becketts Originaltext vor, zeichnen sich mit Kreide einen „Innenraum ohne Möbel“ auf die Bühne und stellen Clovs erste Pantomime durch. Doch dann geraten die beiden Akteure immer mehr in slapstickartige Zankereien und lassen das Publikum an einer unterhaltsamen Schauspielübungsstunde teilhaben. Dabei gibt Voss die Anweisungen, er legt Beckett aus und erklärt seinem Kollegen das Stück. Ständig unterbricht er Kirchner um ihm Bewegung und Artikulation Clovs vorzumachen, nicht zufällig wärmen die beiden dabei so manches Schauspielerklischee auf. Aber ihr Spiel wirkt echt und frei improvisiert.
„Mit Lachen, Pointen, Bonmots und Theateranekdoten geht es weiter. Ungefähr dreißig Minuten ein Feuerwerk: Höhen und Tiefen der Schauspielkunst. Es kann nicht niedrig genug sein. Es geht kaum höher hinauf. Eine Gratwanderung. Die Darsteller sind immer absturzgefährdet.“(Merschmeier(a) S.46)
Stehen auch Hamm und Clov noch nicht von Beginn an auf der Bühne, so sind „Herr“ und „Knecht“ bereits verteilt. Voss diktiert, inszeniert; Kirchner führt aus, protestiert und beugt sich doch. Immer mehr steigen die Schauspieler-Figuren in den Originaltext ein und irgendwann ist die Probe ganz verschwunden:
„Das war ein schwieriger Vorgang, die Öse zu finden, durch die wir dann in die Spur des Stückes gelangt sind. Der Moment ist auch nicht richtig festgelegt, sondern ändert sich – wie ja überhaupt die gesamte Aufführung aus improvisatorischen Teilen besteht. Das ist ihr Reiz und auch ihre Gefahr. Wenn man nicht gut improvisiert – und das kommt vor – , dann kann der Abend abrutschen. Dann gibt es kein Netz, das einen halten kann wie bei einer 'normalen' Aufführung.“ (Gerd Voss im Interview mit Theater heute Jahrbuch 1998 S.51f)
George Tabori, der 1914 in Budapest geboren wurde, seine Jugend in Deutschland verbrachte und Mitte der 30er Jahre vor den Nationalsozialisten nach England floh, begann seine Kariere als Theatermacher in Amerika. Er wurde als Autor, Regisseur und Brechtinterpret in New York bekannt und kehrte 1969 in die BRD zurück. Bereits als Leiter des „Theaterlabors“ am Bremer Theater von 1975-79 zeigte er, „[...] daß er sich für den Produktionsprozeß mehr als für das fertige Produkt interessierte.“(Hensel S.1079) Dies spiegelt sich nicht nur in der „Endspiel“-Inszenierung am Akademietheater wider, an dem er seit Ende der 1980er Jahr mehrere Produktionen heraus brachte, sondern auch in den Stücken des von ihm gegründeten Wiener Theaters „Der Kreis“. Tabori, Voss und Kirchner arbeiten bei „Fin de Partie“ nicht das erste Mal zusammen. Wie bereits für ihre Rollen in Taboris geistreich theologischer Komödie „Goldberg Variationen“ (Akademietheater, 1992) wurden Voss und Kirchner auch für „Fin de Partie“ beim Berliner Theatertreffen 1998 zum besten Schauspielerpaar des Jahres gewählt.
Taboris Lesart des „Endspiels“ manifestiert sich aus den das Theater reflektierenden Elementen des Stückes. Diese kann er durch die direkte Thematisierung des Theaters in der „öffentlichen Probe“ auf eine andere Weise als im Originaltext deutlich machen. Außerdem erlaubt die Probensituation Tabori eine Vielzahl von Möglichkeiten Rollenspiele vor zu führen ohne sich im Sinne einer künstlerischen Gesamtdramaturgie rechtfertigen zu müssen – es wird ja „nur“ ausprobiert. Letztlich ließe sich nunmehr fast jede Mehrdeutigkeit der Beckettschen Figuren, durch die Schauspieleridentität Taboris Figuren erklären. Das erleichtert zwar den Zugang zum Stück[11], nimmt ihm aber gewiss eine Menge seiner mystischen Verschwommenheit. Allein durch den äußeren Umstand, dass es eben keine öffentliche Probe, sondern eine Aufführung ist, gewinnt dieses Theaterspiel seine hohe Selbstreflexivität.
Dazu gehört, dass das im „Vorspiel“[12] scheinbar improvisierte private Gespräch der beiden Schauspieler, ihre clownhaften Versuche die Bühnenanweisungen Becketts exakt um zu setzen und ihre Streitereien, an denen die Zuschauer so viel Gefallen finden, Arbeitsalltag und Konventionen des Theaters aufdecken. Von Beginn an zeigt die Inszenierung eine parodierend Sicht auf das Theater mit seinen Arbeitsbedingungen als scheinbar unorganisierten Betrieb mit egozentrischen kommunikationsgestörten Mitarbeitern. In Gerd Voss‘ Frage, ob es für Kirchner keinen Einruf gegeben habe, führt er die Person und die Aufgaben der Inspizientin ein und stuft sie in ihrem Status, ihm gegenüber, durch abfällige Gestik herab. Kurz darauf spricht er die Lichttechniker an, die in fast allen Theatern, hinter den Zuschauern sitzend, den Vorstellungsablauf steuern, und bittet um trübes Licht. Auch das funktioniert nicht wie gewünscht. Hier wird mit Klischees gespielt, denn tatsächlich sind Theater hochgradig organisierte Betriebe.
4. Rollenspiele bei Tabori
Etliche Rollenspiele lassen sich aus der Inszenierung herausarbeiten: Da ist zunächst das Schauspielerpaar Voss und Kirchner, wie es sich vorbereitet das Stück zu „probieren“, dann das Beckett-Paar Hamm und Clov, des weiteren spielen die beiden Schauspieler, in Ermangelung weiteren Personals, auch die Rollen Nagg und Nell, außerdem springt Kirchner, alias Clov, auch noch in die Rolle eines Hundes.
4.1. Das Schauspielerpaar
Das Schauspielerpaar hat mit dem Figurenpaar einige Gemeinsamkeiten. Wie Hamm und Clov kennen sich Kirchner und Voss sehr lange Zeit[13] und sind auch dem Publikum des Wiener Burgtheaters als Paar auf der Bühne bekannt.[14] Das Statusgefälle zwischen den Schauspieler-Figuren ist dem der Stückfiguren vergleichbar.
Voss ist nicht nur Schauspieler, er ist auch Regisseur, inszeniert sich und alle anderen Rollen. Großspurig fragt er, ob es für Kirchner in Ordnung sei, auf dem kleinen Stuhl zu sitzen, wohl wissend, dass der ihm den großen nicht absprechen würde. Ständig nörgelt er an Kirchners Clov herum, wie Clov redet, wie er sich bewegt. Selbst wie er einen Vorhang zur Seite zu ziehen habe, gibt Voss vor. Er belehrt Kirchner über die Regeln des Schau-Spiels und erklärt ihm „seine“ Interpretation des „Endspiels“. Kirchner versucht – seinen Unmut teils präsentierend, teils verbergend – diese Spielanweisungen so gut es geht zu verwirklichen – eine Regisseur-Schauspieler-Beziehung, wie man sie sich vorstellen könnte.
Mag der Zuschauer, Stückkenntnis vorausgesetzt, zu Beginn der Aufführung noch in der Lage sein zu unterscheiden, ob der Schauspieler oder seine Rolle spricht, so wird das mit zunehmender Dauer schwieriger. Die Schauspieler gleiten in ihre Rollen und die Aufführung in den Originaltext:
„Die scheinbar völlig freischwebende Aufführung hat ein klares System, das die gesamte Inszenierung durchwirkt: aus Voss wird Voss/Hamm wird Hamm/Voss wird Hamm; und aus Kirchner wird Kirchner/Clov wird Clov/Kirchner wird Clov.“(Merschmeier(a) S.48)
Als Schauspieler verfügen Gerd Voss und Ignaz Kirchner selbstverständlich auch über das Begriffsrepertoire der Bühne. Tauchten bei Beckett nur vereinzelt solche Begriff auf, setzen die Schauspielerfiguren (Voss: „Du treibst immer so, Ignaz.“[15] ) in Taboris Inszenierung bewusst und zahlreich solche Termini ein. Damit kennzeichnen sie das Bühnengeschehen als Theater, als nicht real und sich selbst wiederum als Schauspieler. Beispielsweise soll Kirchner/Clov das Herumfahren Hamms mit dem Rollstuhl „markieren“, in dem er sich hinter den Stuhl stellt. Die Passage, in der Clov erklärt, es gebe keine Fahrräder mehr und er hätte seine Botengänge „manchmal zu Roß“(DDI S.219) erledigt, muss dreimal wiederholt werden, da Kirchner Reitgeräusche zu dem Wort „Roß“ „anbieten“ wollte. Voss tadelt missbilligend: Kirchner solle das „Illustrieren“ lassen. Dass Schauspieler dem Regisseur Angebote machen, gehört zum Probenalltag am Theater, der u.a. auch durch das Offenlegen dieses Vorgangs reflektiert wird. Kirchner macht noch weitere „Angebote“, die allerdings eher belustigender Art sind und allesamt von Voss abgelehnt werden. So zum Beispiel eine Gehhilfe für Clov oder ein kalauerndes „Herein“, wenn Hamm gegen die Wand klopft und über die „andere Hölle“ sinniert.
Schon von Beginn an ist das Spiel voller Kommentare. Was Becketts Figuren bereits andeuten[16], zeigt sich bei Voss und Kirchner wiederum deutlich verstärkt. Sie kommentieren ständig die Textvorlage, ihr Spiel, deuten Gesten und Bewegungen nur an und sitzen nach dem „Vorspiel“ für den Rest der Aufführung fast ausschließlich auf ihren Stühlen. Der Kommentar ist ein wesentliches Element dieser Inszenierung und wird als solcher von den Schauspielern auch thematisiert und entlarvt. Kirchner: „Musst du alles kommentieren?“ oder Voss, der sich beschwert, dass Kirchner die Regieanweisung nur vor sich her sagt, statt sie auszuführen: „Aber nicht sagen – spielen!“ Dies stellt einen Höhepunkt der Selbstreflexion dieser Inszenierung dar. Die Schauspieler, deren Beruf es ist zu spielen, „ertappen“ sich dabei, wie sie statt dessen in Diskussionen und Andeutungen schwelgen. Sie reflektieren damit Aufgaben und Gefahren ihres Berufes.
4.2. Parodie des Rollenspielens
In der ersten Passage von Nagg und Nell problematisiert die Inszenierung deutlich das Spielen von Rollen im Theater. Hamms Eltern müssen, da keine weiteren Darsteller anwesend sind, auch von Kirchner und Voss gespielt werden. Hier vermischen sich die Figuren, die zu Beginn als Schauspieler und seine Rolle eingeführt worden sind. Voss steigt zwar aus dem Hamm-Text aus und weist Kirchner an, ihn in die Mülltonne zu heben, behält aber Hamms Lähmung bei und springt gleichzeitig in den Nell-Text. Deshalb Kirchners irritierte Frage: „Spielst du schon?“ – „Ja, natürlich.“
Die Figuren weisen sich im Spiel Rollen zu und vermögen es fast bruchlos zwischen ihnen hin und her zu springen, sie zur Verwirrung und Unterhaltung des Publikums sogar zu vermischen. Sie benutzen die Rollen wie Bälle, die sie sich zuspielen. Unversehens tauschen sie unter sich die Nell- und Nagg-Rolle. Kaum drei Sätze später bricht Voss schon wieder mit der Rolle: „Geh doch richtig in die Mülltonne rein.“ – Kirchner war aus dem die Tonne andeutenden Kreidekreis herausgekommen. Kirchner: „Wieso siehst du denn jetzt, bitte?“ – „Nein, ich spüre das!“ Durch die schnellen Rollenwechsel und das Vermischen parodieren die Darsteller nicht nur die u.a. von Stanislawski gestellte Forderung des Einfühlens in die Rolle (was bei dieser Geschwindigkeit gar nicht möglich ist), sondern nähern sich auch den von Beckett geschaffenen Figuren an. Auch diese werfen sich ihre Repliken wie Bälle zu und spielen mit ihrer Identität.
Die Parodie des Rollenspielens findet einen Höhepunkt in der Umsetzung des Hosen-Witzes den Nagg erzählt. „Ich erzähl' ihn schlecht“, resigniert Voss/Hamm/Nagg. Sein Spielpartner soll die Pointe bringen. Dazu fordert Voss Kirchner auf, einen Schnurrbart und eine Perücke aufzusetzen, damit der Engländer „besser charakterisiert“ sei. Zu allem Überfluss befiehlt Voss, Kirchner solle den Engländer so spielen, als wäre er ein Chinese: er soll das „r“ durch ein „l“ ersetzen – „die alte Nummer“. Was dabei herauskommt ist wirklich absurd und verfehlt seine unterhaltende Wirkung auf das Publikum nicht. Doch wer nach dem tieferen Sinn dieser Szene Taboris sucht, wird sich ebenso verirren, wie bei Beckett. Aus verschiedenen Kostümelementen und Rollenklischees wird hier ein Subjekt „zusammengeflickt“, dass nur noch als Parodie einer klar umgrenzten Rolle gelten kann. Durch Übertreibung und Übereinanderlegen verschiedener Rollen parodieren die Figuren hiermit ihr eigens Rollenspiel.
4.3. Die scheinbare Meta-Ebene
Das teilweise private „Geschwätz“ von Kirchner („Lass‘ den Kaffee bitte stehen!”) und Voss („Du vergisst doch immer alles.“), sowie ihre Kommentare zum Text fügen dem „Endspiel“ eine scheinbare Meta-Ebene hinzu, die es bei Beckett nicht haben kann[17]. Die Schauspieler treten, so scheint es, aus ihren Rollen Hamm und Clov heraus um sie zu kommentieren. Doch keineswegs alle Kommentare sind frei improvisiert. Der Rezensent Michael Merschmeier bemerkt:
„[...] alles ist genauestens kalkuliert, wenn auch nicht bis ins Letzte festgelegt. Die privat anmutenden Improvisationen (Voss zu Kirchner: ‚Jetzt laß dich doch mal auf was ein! Nicht immer nur schimpfen!‘) münden schließlich wie zufällig in den Anfang vom ‚Endspiel‘. Natürlich gibt es dafür winzige Zäsuren und beiläufig eingestreute Stichwörter, die den Umschwung von der schieren, fast schrankenlosen Freiheit des Ausprobierens in die strenge Rhythmik der Beckettschen Texte einleitet. Aus den Capriccios entwickelt sich die Kunst der Fuge.“(Merschmeier(a) S.47)
Auch das Kommentieren der Rolle Hamm oder Clov gehört zu der Rolle des Schauspielers, die auf der Bühne zu sehen sind. Oder: Auch das Spiel mit den Kommentaren gehört zur Spiellogik dieser Inszenierung dazu. Denn natürlich sind das nicht Voss und Kirchner privat, die auf der Bühne agieren. Auch diese Schauspieler-Figuren sind erfunden und erarbeitet. Mögen sie auch ein gewisse Ähnlichkeit zu ihren Darstellern besitzen, sind sie doch inszeniert und spielen ihre are vor. Nicht durch Zufall zeigen die Schauspieler-Figuren dasselbe Statusgefälle wie ihre Rollen. Diese Kommentarebene stellt nur scheinbar eine Meta-Ebene zu Becketts Original dar, da sich ohne die Bemerkungen diese Inszenierung nicht denken ließe. Sie „tragen“ diese Inszenierung und sind durch ihre Unablösbarkeit nicht als Metakommunikation zu verstehen. Tabori schafft also ein neues Stück und hat Becketts Text als „Vorlage für ein Spiel“ benutzt, dass auf unterhaltsame Weise und im Sinne Becketts, Beckett und das Theater diskutiert.
Das Auftreten der Schauspieler-Figuren in „Fin de Partie“ diskutiert in erster Linie das Wesen des Schauspielerberufs. Dass dabei auf witzige Klischees zurückgegriffen wird, macht es für das Publikum interessanter und zeigt, dass für Tabori die Unterhaltungsfunktion einen großen Teil der gesellschaftlichen Rolle des Theaters ausmacht. Gleichfalls setzen die Schauspieler, die mit ihren Rollen erstaunlich viel gemeinsam haben, das „Endspiel“ auf einer anderen Ebene fort und spielen auf menschliche Grundbedürfnisse an:
„'Fin de Partie' zeigt aufs genauste, daß man sich gegenseitig braucht, um einen Dialog zustandezubringen. Clov geht – wie der Schauspieler – nicht weg, bleibt stehen, denn wenn er ginge, hätte er keinen Lebenspartner mehr – wie der Schauspiel keinen Spielpartner.“ (Ignaz Kirchner im Interview mit Theater heute Jahrbuch 1998 S.52)
Sie reflektieren, immer farcenhaft verzerrt, die Probenarbeit und das Theater als Arbeitsstätte. In den Textstellen von Nagg und Nell parodieren sie das theatrale Rollenspielen durch Übertreibung.
5. Intertextualität bei Beckett und Tabori
Theater begreift sich immer auch als Teil der Kulturgeschichte. Die Wurzeln der europäischen Theatertradition, die antiken Dramen Griechenlands, werden als kulturelles Erbe noch in den heutigen Theaterspielplänen gepflegt und geehrt. Etliche Dramatiker spiegeln historische und soziale Ereignisse und sogar andere Dramen in ihren Werken wider. Intertextuelle Verweise, Zitate und Anspielungen auf Philosophie, Literatur und Theater reflektieren im „Endspiel“ das Theater als Teil seiner Kulturgeschichte und machen die Bühne zum Ort poetologischer und kulturhistorischer Diskussionen.
Erika Fischer-Lichte hat Bezüge und Verweise im „Endspiel“-Text untersucht (vgl. Fischer-Lichte S.243ff), hier seien einige wiedergegeben:
Unüberlesbar sind die Anspielungen auf die Philosophie. Erst Clov und später auch Hamm sprechen vom „unmöglichen Haufen“ des Vorsokratikers Zenon, der fragte, wann aus einer Anhäufung Körner ein Haufen wird. Descartes‘ „Cogito ergo sum“ wird von Hamm parodiert, wenn er Naggs Existenz durch dessen Weinen begründet.[18]
„Schopenhauer wird durch den Witz vom Schneider und seiner Hose [...] und durch den ‚Pudel‘ [...] der deutschen Fassung ins Spiel gebracht, der sich allerdings auch auf Goethes Faust beziehen kann. Nietzsches ‚Gott ist tot‘ hallt in Hamms Ausruf nach dem Vaterunser: ‚Le salaud! Il n’existe pas!‘ nach.“(Fischer-Lichte S.243)
Es lassen sich auch Verweise auf Bibeltexte finden, etwa die Schöpfungsgeschichte, die Sintflut und die Arche Noah. Die erste Fassung des Stückes von 1956, dessen Manuskript in der Ohio State University liegt, sei, nach Angaben Alfred Simons, „[...] voll von Anspielungen auf die Bibel, die später dann fast alle verschwinden.“(Simon S.258)
Von den Verweisen auf andere Theatertexte seien hier zum einen Shakespeare-Stücke genannt: „Hamm [...] Frenziedly: My kingdom for a nightman!“(DDI S.468) – ein Parodie auf den berühmten Ausspruch Richards in König Richard III.; „Our revels now are ended.“(DDI S.487) – wörtlich zitiert Hamm hier Prospero aus „Der Sturm“, 4.Akt, 1.Szene. Fischer-Lichte weist zum anderen auch auf einige Parallelen zu August Strindbergs „Totentanz“(1900) hin.(vgl. Fischer-Lichte S.244) Dessen Fabel von dem alten Ehepaar Alice und Edgar erzählt, dass weit abgeschieden lebt und deren Beziehung von Hass und gegenseitiger Demütigung gezeichnet ist. Auch Edgar und Alice wiederholen ständig ihre alten Repliken und versuchen unentwegt sich zu trennen. Auch sie wünschen sich nichts sehnlicher als den Tod des anderen.
Bei genauerer Untersuchung des Stückes fällt die Ähnlichkeit zu Becketts „En attendant Godot“ auf. Nicht nur, dass die Figurenpaarung bei „Godot“ (Wladimir/Estragon, Pozzo/Lucky, Knabe) der des „Endspiels“ entspricht – obwohl nicht eindeutig ist, ob der Knabe tatsächlich existiert – weisen auch die Anfänge Gemeinsamkeiten auf. Beide Stücke beginnen mit einer längeren Pantomime und stehen sogleich im Zeichen des Endes. „Hier wie dort stellt sich der erste Satz als das Ineinander einer sehr konkreten Bedeutung, nämlich des Kommentars der ‚Handlung‘ der Pantomime, und mehrerer übergreifender Bezüge dar, die teilweise erst im Verlauf des Stückes erkennbar werden.“ (Laass/Schröder S.53) Auch Clovs Beschreibung des Gesamteindrucks durch das Fernrohr: „Mortibus“(DDI S.244) erinnert „[...] an einen Abschnitt aus Luckys Monolog in En attendant Godot, in dem er die Erde als gut für die Steine beschreibt ‚ ... le terre fait pour les pierres ...‘ (DDI 92).“(Becker S.65)
Becketts Theaterspiele sind sich dahingehend ähnlich, als sie den für Becketts ästhetische Position bestimmenden Widerspruch reflektieren, dass es nichts zu sagen gebe und man dennoch fortfahren müsse es zu sagen. Becketts Figuren sind Artisten des Misslingens und bringen seinen Zweifel an der Möglichkeit Wirklichkeit auf der Bühne darzustellen zum Ausdruck:
„Allen Spielen liegt, für den Zuschauer mehr oder minder einsichtlich, eine Versuchsanordnung zugrunde, die ihr Scheitern im Sinne eines künstlerischen Mißlingens gewährleistet. Das Bühnengeschehen läßt keinen Sinn aufscheinen [...]. Es ist vielmehr ein Spiel, das insofern ambivalenten Charakter trägt, als alles Handeln und Sprechen folgenlos bleibt, weil alles ohnehin immer weitergeht. Becketts Stücke demonstrieren Konfigurationen der Vergeblichkeit. Ihre Helden sind keine sich bewährenden oder scheiternden Individuen, sondern vom Leben gezeichnete, die immer schon Gescheitert sind, weil sie gelegt haben.“(Laass/Schröder S.84)
So wie der Text aus Versatzstücken besteht, sind auch die „Endspiel“-Figuren, so behauptet Erika Fischer-Lichte, aus verstümmelten Bruchstücken der abendländischen Kultur zusammengesetzt und verweisen somit auf die europäische Theatertradition.(vgl. Fischer-Lichte S.247f) Sie gibt folgende Beispiele:
Hamm kann als Zusammensetzung tragischer Helden und großer Persönlichkeiten betrachtet werden: Verweise führen u.a. zu Shakespeare (blind wie Lear, Gloster; Name erinnert an Hamlet; Zitate aus „König Richard III.“ und „Der Sturm“). Die für den Helden im Sturm und Drang charakteristische Auflehnung des Sohnes gegen den Vater, sowie des Menschen gegen Gott, findet sich ebenfalls im „Endspiel“. Hamm entspricht auch dem Künstlerbild der Romantik, indem er sich mit Gott, aber auch dem Satan, gleichsetzt und ständig im Mittelpunkt stehen muss. Clov sei aus verschiedenen Dienerfiguren des komischen Theaters zusammengeflickt und verweist
„[...]auf die Diener des Plautus und Terenz, auf Arlecchino und Brighella aus der Commedia dell’Arte sowie auf den gracioso des spanischen Theaters, auf die Narren Shakespeares und die Diener Molières, auf Hanswurst und seine Nachfolger im Wiener Volkstheater, auf die Clowns aus dem Zirkus, auf Charlie Chaplin und Buster Keaton.“(Fischer-Lichte S.248)
Doch diese Bruchstücke zusammengesetzt ergeben keine klare Identität. Die Figuren parodieren die von ihnen zitierten Rollenklischees, indem sie auf Fragmente und Rudimente verweisen.
Auch Taboris „Fin de Partie“ am Wiener Akademietheater verweist auf andere Inszenierungen. In der „Vorbereitung“ dieser „öffentlichen Probe“ machen sich die beiden Schauspieler auch an die Erarbeitung der Charaktere Hamm und Clov. Voss nörgelt, wie fast die ganze Zeit, auch an der Art wie Kirchner sich als Clov bewegt. Kirchner macht ein Angebot: Er kommt mit eingeknicktem, herunter hängendem Oberkörper auf die Szene und kommentiert: „Das ist die Bollmann-Haltung.“ Das Publikum lacht und wundert sich, Voss sorgt für Aufklärung. Er erklärt Kirchner, und damit dem Publikum, dass diese eine Erfindung Becketts und Bollmanns bei der Beckettschen Inszenierung von 1967 in Berlin sei. Bollmann wäre die ganze Zeit mit steifen Knien und heruntergefallenem Oberkörper aufgetreten. Taboris Figuren zitieren Beckett als Regisseur und stellen sofort klar, dass dies ein Zitat, vielleicht eine Ehrung, ist. Voss: „Willst du dich etwa mit dem vergleichen?“
Kurz nach Beginn der Aufführung steht folgende Sequenz: Kirchner betritt eben die Bühne,
„[...] hat einen Eimer mit auf die Bühne gebracht und stellt ihn ab. ‚Ist das dein Ernst oder ist das ein Zitat?‘, kalauert Voss, insiderisch anspielend auf Einar Schleefs ehemaliges Lieblingsrequisit. ‚Das ist der Aschenbecher, die Feuerpolizei, das weißt du doch‘, kontert Kirchner.“(Merschmeier(a) S.46)
Ob es tatsächlich ein Schleef-Zitat ist oder nicht, Voss nimmt dem Publikum die Interpretation vorweg und führt ihm gleichsam vor, was im Theater, und bei Beckett-Stücken im Besonderen, so gefährlich ist: Die Suche nach Bedeutung in jedem Detail. Neben dieser vorausgeschickten „Warnung“ gehört auch Kirchners Hinweis auf das Klischee, Schauspieler seien notorische Kettenraucher, zur Selbstreflexivität der Inszenierung.
Nicht vergessen werden darf, dass Tabori mit dieser Inszenierung nicht nur Beckett, sondern auch sich selbst zitiert. 1984 hatte er an den Münchner Kammerspielen Becketts Welterfolg „En attendant Godot“ auf spektakuläre Weise inszeniert. Er schickte
„[...] Peter Lühr und Thomas Holtzmann als Darsteller von Schauspielern auf die Probebühne [...], wo sie lässig am Tisch sitzend, begannen, aus dem Suhrkamp-Bändchen ihre Dialoge samt Regieanweisungen zu lesen. Aus dieser Leseprobe erstand im Werkraum der Münchner Kammerspiele wie nebenbei eine ‚richtige‘ Aufführung, Holtzmann und Lühr wurden zu Wladimir und Estragon [...]. Einer der Theaterhöhepunkte der achtziger Jahre.“(Merschmeier(b) S.12)
Nun bringt Tabori das Konzept der inszenierten Probe, bei der der Spielpartner abermals den Beginn verpasst, noch einmal. Doch 1998 geht er noch einen Schritt weiter. Tabori zeigt nicht nur, wie bei „Godot“ Figuren, die sich als Schauspieler bühnenwirksam inszenieren können, sondern deklariert es direkt als öffentliche Probe und lässt die Schauspieler-Figuren neben dem Originaltext auch über ihre Vorlage und den Theateralltag plaudern. Er legt „Endspiel“ nicht nur aus, sondern schafft ein neues Stück, mit neuen Figuren. Eben jenen Schauspielern, die sich explizit als solche begreifen. Viel konsequenter als bei „Godot“ setzt Tabori Brüche und spielt auf das Theater als Kommunikationssystem[19], als Institution, als Arbeitsstätte und auf Theaterklischees an.
Das „Endspiel“ und seine Figuren, als zusammengesetzte Konstrukte, verweisen auf viele Texte der abendländischen Philosophie, Literatur und Dramatik. Diese erscheinen allerdings „[...] wie ferne Echos, in denen die einst bedeutungsvollen Worte, Sätze, Theoreme und Verse nur noch hohl und leer widerhallen.“(Fischer-Lichte S.245) Es sind leere Verweise, die zwar ihre Herkunft offenbaren, aber selbst keine Bedeutung haben und auch dem „Endspiel“ keinen Sinn verleihen können. Das Stück reflektiert die Kulturgeschichte, an deren Ende es steht, als sinn- und funktionslosen „Kulturmüll“[20], der nicht kritiklos hingenommen werden darf. Für Beckett kann „[...] schöpferischer Fortschritt immer nur konkret in der Auseinandersetzung mit tradierten Formen und Stilen erfolgen [...]“(Laass/Schröder S.23).
Die Anspielungen in der Inszenierung auf Bollmann, Schleef, Beckett und andere haben ebenfalls keinerlei Bedeutung für die Auslegung der Inszenierung (abgesehen vielleicht von der Komik), aber die Besonderheit, dass sie als Zitate gekennzeichnet sind. Somit reflektiert „Fin de Partie“ nicht nur diese anderen Inszenierungen, sondern auch das Wesen der intertextuellen Inszenierung und das Verwenden von Zitaten als Stilmittel im Theater.
6. Theater als Kommunikationssystem
Charakteristisch für das Theater ist die Kommunikationsbeziehung zwischen Bühne und Publikum. Auch diese wird im „Endspiel“-Text an zahlreichen Stellen reflektiert. Abgesehen vom Bühnen- bzw. Publikumsbewusstsein der Figuren, möchte ich im Folgenden einige Beispiele in Bezug auf Bedeutungsproduktion und Humor untersuchen.
Das Problem der Bedeutungsproduktion in Becketts Dramatik wurde viel diskutiert. Gabriele Schwab geht davon aus, dass der Zuschauer bei der ständigen Suche nach einem Sinnzusammenhang „[...] selbst zu einer Figur des aufgeführten Dramas“(Schwab S.116) wird. In diesem Punkt widerspricht Joachim Becker, denn bereits „[...] im Scheitern von Sinnerwartungen kann er (der Zuschauer, d.Verf.) sich seines projektiven Anteils an der Visualisierung des Stückes sehr wohl bewusst werden.“(Becker S.75) Regisseur Peter Brook spricht sich generell gegen Sinnsuche aus: „Das ganze geschlossene Werk ist ein Symbol, das zahlreiche andere Symbole in sich birgt, doch keins von ihnen gehört zu jenen, die für etwas stehen; es bringt nicht weiter, wenn wir fragen, was sie bedeuten. Denn hier ist das Symbol zum Objekt geworden.“(Brook S.32)
Auch die Figuren selbst thematisieren dieses Problem. Hamm fragt sich: „We're not beginning to... to... mean something?“(DDI S.473) Ohne überhaupt auf die Frage eingehen zu wollen, beginnt Clov an dieser Stelle sein Spiel mit dem Floh und lenkt ab. Hamms Frage wirkt wie eine Abfuhr Becketts an alle diejenigen, die schon in „En attendant Godot“ zu viel hinein interpretiert hatten und nun auch einen Sinn im „Endspiel“ entdeckt haben wollen. „Es ist ein Spiel, nichts weniger.“(zit. nach Melchinger S.114) hat Beckett gesagt und sich, wie fast immer, zu etwaigen Deutungen ausgeschwiegen. Dazu findet sich auch eine entsprechende Stelle im Stücktext: „Nagg: Qu'est-ce que ça veut dire? Un temps. Ça ne veut rien dire. [...]“(DDI S.232) Nagg gibt sich selbst die Antwort, es gibt keine Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist möglicherweise auch Hamms Text: „[...] Ah les gens, les gens, il faut tout leur expliquer.“(DDI S.260) zu verstehen. Anstatt die absurde „Endspiel“-Situation als Ganzes auf sich wirken zu lassen, verlieren sich die Zuschauer in Deutungen aller möglicher Einzelheiten, weil „[...] der ideale Rezipient zunächst einmal davon ausgeht, daß jedes Detail bezeichnend und bedeutsam ist [...]“(Pfister S.222). Genau diese Haltung parodiert das „Endspiel“.
Die Figuren diskutieren auch ihren Unterhaltungswert. Nach „En attendant Godot“ hatten sich die Theaterzuschauer mit dem eigenartigen Witz und Slapstick der Beckett-Figuren vertraut gemacht. Hamm, als Regisseur, könnte sich Gedanken machen, ob er den Zuschauererwartungen gerecht wird, wenn er feststellt: „C'est moins gai que tantôt. [...]“(DDI S.224) An anderen Stellen scheinen die Figuren zur Hebung der Stimmung Witze oder Pointen bringen zu wollen. Beispielsweise spricht Hamm über die körperlichen Verstümmelungen der beiden Hauptfiguren: „Chacun sa spécialité! Un temps. Pas de coup de téléphone? Un temps. On ne rit pas?“(DDI S.220) Eine Frage, die durchaus ans Publikum gerichtet sein könnte. Hat es soviel Humor über diese im Spiel gefangenen Krüppel zu lachen? Ist es gar bereit, über Krüppel, die über ihre Behinderung auch noch Witze machen zu lachen? Diese Aspekte lotet Hamms Frage möglicherweise aus.
Clovs Suche mit dem Fernrohr gegen das Publikum ergibt: „[...] Je vois ... une foule en délire. [...] Alors? On ne rit pas?“(DDI S.244) Hier überwindet Clov die Distanz zwischen seiner Welt und der des Zuschauers. Eine für den Zuschauer und den Theaterwissenschaftler höchst spannungsvolle Situation, deren Wirkung absichtlich verpufft, da Clov die Spannung ignoriert und nur auf seine Pointe aus zu sein scheint.
Das „Endspiel“ ist voller Ironie, Parodien und Slapstickeinlagen. Die Figuren wollen das Publikum mit Witzen unterhalten, warten auf Reaktionen, die aber zunächst ausblieben, da die Figuren nicht den Humor der Zuschauer teilen: „Das Spiel des Endspiels ist fortlaufend komisch, aber wir kommen niemals ins Einverständnis damit.“(Brook S.29)
In Taboris „Fin de Partie“ wird dafür umso mehr gelacht, denn seine Figuren können die Anwesenheit des Publikums direkt thematisiert. Die deklarierte Probe beginnt und die Darsteller stellen sich ihre Stühle so auf die Bühne, dass sie mit dem Rücken zum Saal sitzen. Dann erst bemerken sie die Anwesenheit des Publikums. Voss: „Ich kann auch nichts dafür – ist halt ‘ne öffentliche Probe. [...] Macht es dich nervös? Wir können die auch rausschmeißen.“ Voss provoziert einen Lacher, denn er kann die Leute gerade nicht rausschmeißen, ebenso wenig wie Hamm „Un peu de poésie.“(DDI S.314) verlangen kann und es Clov gelingen wird das Spiel zu verlassen. Das Publikum erst legitimieren die Existenz der Schauspieler auf der Bühne – außerdem hat es für eine Vorstellung bezahlt.
Wie für Beckett so ist auch für Tabori (bei dieser Inszenierung) die Reduktion ein wesentliches Stilmittel. Er reduziert Theater auf ein Minimum: zwei Schauspieler, zwei Stühle, zwei Textbücher, einen Eimer. Tabori sagte selbst dazu: „Das Wichtigste am Theater ist nicht das Bühnenbild, nicht die Regie – die Schauspieler sind die Wichtigsten. Das Stück ist keine Literatur, sondern die Vorlage für ein Spiel.“(Tabori im Interview Theater heute Jahrbuch 1998 S.48f) Gerd Voss bringt im „Vorspiel“ einen wichtigen Satz, der nicht nur zur Maxime des ganzen Abends wird, sondern Theater generell kennzeichnet: Als die Beleuchter nicht das „Trübes Licht“ bieten, was er sich wünscht, sagt er: „Naja, dann stellen wir's uns eben vor.“ Nicht nur die beiden Spieler, sondern auch das Publikum muss sich Licht, Bühnenbild und vieles weitere auf der reduzierten Bühne vorstellen. Damit reflektiert Voss das Theater als Vereinbarung zwischen Zuschauer und Bühne, Dargestelltes und Angedeutetes für die Dauer der Vorstellung als Chiffre und Zeichen anzunehmen. Wo im Hintergrund beispielsweise drei Bäume auf Pergament gemalt sind, ist der Zuschauer bereit sich einen Wald vorzustellen. Wenn Taboris Clov auf dem Stuhl sitzend mit den Füßen scharrt, dann sind Rezipienten unter bestimmten Voraussetzungen bereit dies als Gehen anzuerkennen.
Taboris Schauspieler-Figuren plaudern nicht nur unterhaltsam aus dem Nähkästchen jahrelanger Bühnenerfahrung, sie brechen dabei auch Verabredungen und decken Konventionen der Theaterillusion auf. So greifen Voss‘ Bemerkungen zur Bühnenkreide: „Auf der Bühne ist immer alles etwas größer.“ und die Anspielung auf die „vierte Wand“, die Kirchner auf den Boden malen soll, zwei Begriffe des Illusionstheaters auf. Vor allem seit dem neunzehnten Jahrhundert hat Theater versucht den Zuschauern die perfekte Illusion mit möglichst naturalistischer Darstellung von Figuren und Handlung zu bieten. Die Bühne sollte nicht als Theaterbühne, sondern als realer Schauplatz des Geschehens wahrgenommen werden. Bis heute ist diese Illusionsabsicht vor allem im Repertoiretheater weit verbreitet. Die ironische Reflexion dieser Begriffe in der Inszenierung wird deutlich, da Kirchner seine „vierte Wand“ nicht in Richtung Zuschauerraum, sondern links einzeichnet und später lamentiert: „Das ist doch Naturalismus!“ - „Eben nicht!“. Die Illusionsabsicht des Theaters deutlich zu machen, also die Desillusionierung, kann daher auch als ein Anliegen der Inszenierung betrachtet werden.
Festhalten lässt sich: Becketts Text reflektiert das Theater als Kommunikationssystem, wo Akteure, wie Zuschauer Produzenten sind, indem er dem Publikum die (voreilige) Produktion von Bedeutung „unterstellt“. Die Figuren ahnen die Anwesenheit des Publikums und versuchen es mit Pointen zu unterhalten. Tabori kann mit seiner „öffentlichen Probe“ die Anwesenheit des Publikums direkt thematisieren. Seine Inszenierung verdeutlicht Theater als besonderen Ort, wo bestimmte Kodes unsere Wahrnehmungsweise verändern und deckt die Illusionsabsicht des Theaters auf.
7. Fazit
Becketts „Endspiel“ steckt voller selbstreflexiver Momente. Das Theater wird im Text auf vielfältige Weise thematisiert und problematisiert.
Die Spezifik der Kunstform Theater reflektiert sich in Becketts Text vor allem durch das offensichtliche Rollenspiel der Figuren und Hamms inszeniertes Erzählen seiner „chronicle“. Nach Becketts Auffassung bedarf das Drama eher der Selbstreflexion „[...] als der Intention, etwas über einen Gegenstand auszudrücken.“(Laass/Schröder S.21) Dies zeigt sich hier durch die Thematisierung des Dialoges, Anspielungen auf die Anwesenheit von Zuschauern/Auditoren und Anspielungen auf den Rezeptionsvorgang als Produktionsvorgang, sowie die Aufhebung der Repräsentationsfunktion des Theaters(vgl. Schwab S.88).
Ebenso geht es bei den zahlreichen Verweise auf andere (Theater)Texte wohl eher um die Selbstreflexion von Kunst, als um den konkreten Gegenstand des Zitates. Der Verweis allein, als Andeutung einer Auseinandersetzung mit dem Original, ist wichtiger, als dessen eigentlicher Inhalt. Der Widerspruch zwischen den „bedeutenden“ Texten (Philosophie, Shakespeare) und deren parodierter Verwendung als deformierte Zitate verdeutlicht Becketts radikale Infragestellung überlieferter ästhetischer Konventionen.
Im „Endspiel“-Text klingt zwischen Hamm und Clov eine Regisseur-Schauspieler-Beziehung an, die Theater als Arbeits- und Lebensraum reflektiert. In ihrer Rolle als Schauspieler verdeutlichen die Figuren u.a., dass Schauspieler nie mit ihrer Rolle gleichgesetzt werden können, indem sie auf eine Identität jenseits der Schauspieler-Rolle verweisen. Sogleich aber parodieren sie diese Erkenntnis, da sich diese Identität (bei ihnen) durch das Spielen von Rollen auszeichnet. Dies bringt den Begriff des Theatrum mundi, der Welt als Bühne, ins Spiel, denn letztlich spielen nahezu alle Menschen, soziologisch betrachtet, fast immer eine/unsere Rolle.
Wie geht die Wiener Inszenierung nun mit den selbstreflexiven Elementen des „Endspiels“ um? Tabori lässt seine Schauspieler-Figuren Beckett diskutieren und kommentieren. In ihrer gespielten Probe zitieren sie ihn sogar szenisch, liefern dabei aber ebenso wenig eine Deutung des Stoffes, wie Beckett bei eigenen Inszenierungen. Man könnte vermuten, dass Tabori die Rollenspiele der Beckett-Figuren leicht verändert, aber mit ähnlichen Spielregeln, auf die Schauspieler-Figuren überträgt und auf dieser anderen Ebene fortsetzen lässt.
Auch von den „Figuren“ Kirchner und Voss erfährt der Zuschauer in der Aufführung – abgesehen von Kirchners Paar Privatstrümpfe und, dass er angeblich sehr vergesslich ist – nichts über die Privatpersonen der Schauspieler. Ihr Gesprächshorizont geht nie über die Theaterprobe und Becketts Vorlage hinaus. Alles was die Zuschauer (im Regelfall) über die Figuren wissen könnten, liegt in deren Vergangenheit, also vorherigen Theaterproduktionen oder Medienberichten. Darin gleichen sie Becketts Figuren. Außerdem hat auch Tabori sich zu Zielen und Deutungen seiner Inszenierung, die sich bewusst vom eigentlichen Titel der deutschen Übersetzung distanziert, ausgeschwiegen – wie einst Beckett es tat. (vgl. Merschmeier(a) S.48)
Beckett ist ein Klassiker der Moderne. Kaum einem anderen Autoren gelang es wie ihm, durch die krasse Infragestellung der Kunst, Zerstörung ihrer Form und permanente Selbstreflexion, Formen in Dramatik, Lyrik und Prosa zu finden, die noch immer das Publikum begeistern: „Nun, Becketts Stücke haben die Eigenart von Panzerwagen und Idioten – man kann sie beschießen, man kann sie mit Crèmetorten bewerfen: sie setzen ihren Weg gelassen fort.“(Brook S.27)
8. Literaturverzeichnis
Balme, Christopher: Einführung in die Theaterwissenschaft. Berlin, 2003.
Becker, Joachim: Nicht-Ich-Identität.Ästhetische Subjektivität in Samuel Becketts Arbeiten für Theater, Radio, Film und Fernsehen. Tübingen, 1988.
Brook, Peter: Mit Beckett leben. In: Materialien zu Becketts „Endspiel“. Frankfurt a.M., 1968, S. 27-35.
Drechsler, Ute: Die "absurde Farce" bei Beckett, Pinter und Ionesco.Tübingen, 1988.
Esslin, Martin: Das Theater des Absurden. Reinbek, 1965.
Fischer-Lichte, Erika: Geschichte des Dramas 2. Von der Romantik bis zur Gegenwart. Tübingen, 1990.
Haerdter, Michael: Samuel Beckett inszeniert das „Endspiel“. Bericht von den Proben der Berliner Inszenierung 1967. In: Materialien zu Becketts „Endspiel“. Frankfurt a.M., 1968, S. 36-111.
Hensel, Georg: Spielplan. Schauspielführer von der Antike bis zur Gegenwart. München, 2001.
Laass, Henner; Schröder, Wolfgang: Samuel Beckett. München, 1984.
Meier, Ulrich: Zum Protestanteil Beckettscher Dichtung. In: Engelhardt, Hartmut (Hg.): Samuel Beckett. Frankfurt a.M., 1984.
Melchinger, Siegfried: Nichts weniger als ein Spiel. In: Engelhardt, Hartmut (Hg.): Samuel Beckett. Frankfurt a.M, 1984.
Merschmeier(a), Michael: Das Doppelspiel von Herr und Knecht. In: Theater heute Jahrbuch 1998, S.46-55.
ders.(b): Play it again, George. In: Theater heute, Jg. 39, H. 3, S. 12-13.
Pfister, Manfred: Das Drama. Theorie und Analyse. München, 2000.
Schwab, Gabriele: Samuel Becketts Endspiel mit der Subjektivität. Stuttgart, 1981.
Simon, Alfred: Beckett. Frankfurt a.M., 1988.
[...]
[1] Dass diese klassische, am Kunsttheater entwickelte Formel mit der Erweiterung des Theaterbegriffs nicht mehr als umfassend gilt, soll bei meiner Betrachtung ungeachtet bleiben.
[2] Aus „Three Dialogues“, die Beckett, basierend auf Gesprächen mit Georges Duthuit, 1949 in der Zeitschrift transition 49 S.97-103 veröffentlicht.
[3] als Zugabe zur „Fin de partie“-Uraufführung 1957 in London gegeben
[4] Die Seitenangaben der Stückzitate beziehen sich auf Samuel Beckett. Dramatische Dichtung Band I. Frankfurt am Main, 1963 englische Übertragung von Samuel Beckett, Deutsch von Elmar Tophoven.
[5] Hamms Antwort auf Clovs oben zitierte Bitte, das Spiel zu beenden, ist: „Jamais!“ (DDI S.304).
[6] Clov: „[...] Finished, it’s finished, nearly finished [...]“(DDI S.456) und Hamm: „[...] It’s finished, we’re finished. Pause. Nearly finished“(DDI S.483)
[7] Clov: „Quand il y avait encore des bicyclettes j'ai pleuré pour en avoir une. Je me suis traîné à tes pieds. [...]“(DDI S.218); Hamm: „[...] C'est moi qui t'ai servi de père.“(DDI S.254) oder „[...] j'aurai appelé mon... il hésite...mon fils.“(DDI S.294)
[8] „Es ist der Zuschauvorgang, der das Wahrgenommene zum Theater macht.“ (Balme S.129)
[9] In vielen Interpretationen wird Clovs Kommentieren damit begründet, er wolle dem blinden Hamm alle Vorgänge beschreiben. Geht man aber davon aus, dass dieses „Endspiel“ schon sehr lange Zeit geht („Hamm: Yesterday! What does that mean? Yesterday! / Clov violently: That means that bloody awful day, long ago, before this bloody awful day.[...]“ DDI S.479) und sich Hamm und Clov dadurch gut kennen, sind diese, von Hamm nicht einmal geforderten, Erklärungen überflüssig.
[10] Beckett soll einmal das Figurenpaar Hamm und Clov mit sich und seiner Frau Suzanne vergleichen haben. (vgl. Simon S.260)
[11] „Das Stück, derart seiner heiligen Unantastbarkeit, auf der vor allem Beckett selbst lange Zeit bestand, entkleidet, wirkte wie in die Gegenwart hinein befreit, entlastet von aller überbordenden Sinn-Schwere eines mittlerweile altbackenen Absurden Theaters.“(Merschmeier(a) S.46f)
[12] Damit ist im Folgenden die erste halbe Stunde der Aufführung gemeint, die hauptsächlich aus Improvisationen besteht.
[13] Erstmalig traten die beiden in den siebziger Jahren in Stuttgart in Claus Peymanns ‚Käthchen von Heilbronn‘ als Ritter Freiburg und Flammberg auf (vgl. Merschmeier(a) S.52).
[14] 1988 in Peter Zadeks „Der Kaufmann von Venedig“ (Burgtheater), 1990 in Taboris „Othello“ (Akademietheater), 1992 in Taboris „Goldberg Variationen“ (Akademietheater).
[15] Meiner Analyse und den verwendeten Zitaten liegt der Mitschnitt einer TV-Live-Übertragung einer Aufführung aus der Freien Volksbühne Berlin zugrunde. Fernsehregie: Volker Weicker
[16] vgl. Kapitel 2.3.
[17] vgl. Kapitel 1
[18] Clov: „Il pleure. [...] / Hamm: Donc il vit.“(DDI S.284)
[19] vgl. Kapitel 6
[20] Theodor W. Adorno, Versuch das Endspiel zu verstehen, Frankfurt am Main, 1972, S.167
- Arbeit zitieren
- Roland Bedrich (Autor:in), 2004, Selbstreflexion des Theaters in Samuel Becketts »Endspiel«, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109348
Kostenlos Autor werden
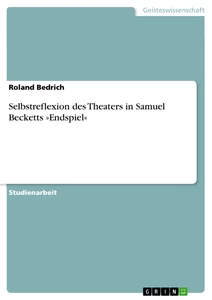



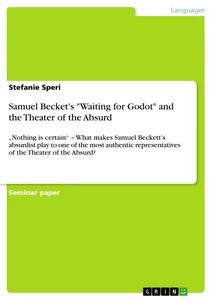


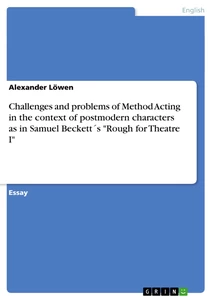


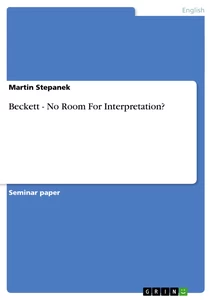






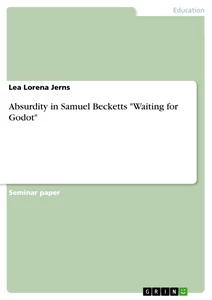


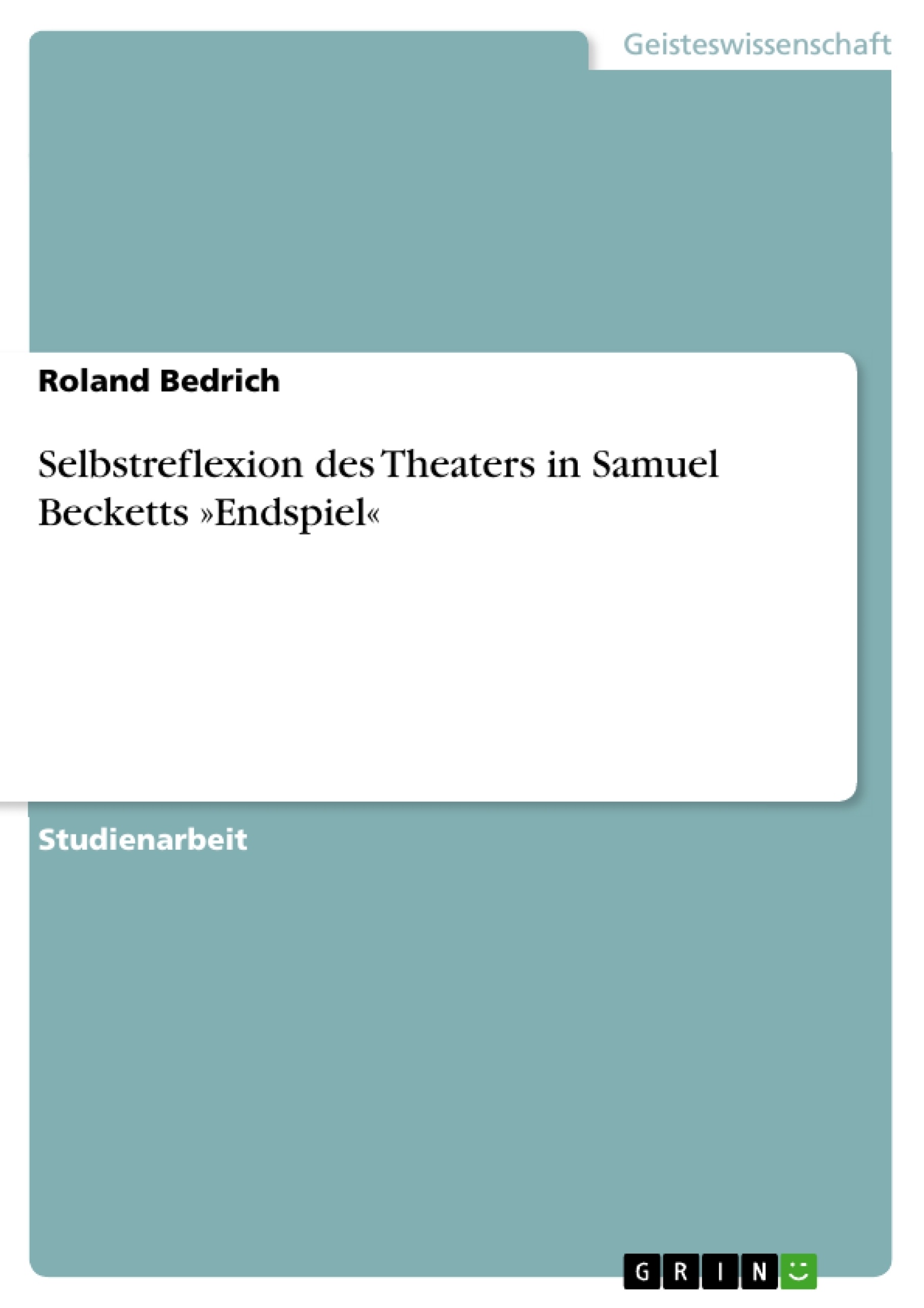

Kommentare