Excerpt
Inhaltsverzeichnis:
I. Einleitung
II. Heranführung und grundlegende Begriffe
a. Diskurs über den Begriff der Freiheit
b. Die Konzeption des Republikanismus
c. Die Konzeption des Liberalismus
III. Rousseaus Staatskonstruktion
IV. Zuordnungen /strong>
a. Republikanische Elemente in Rousseaus Staatskonstruktion
b. Liberale Elemente in Rousseaus Staatskonstruktion
V. Resümee und Schlussfolgerung
VI. Literaturliste
I. Einleitung
„Republik nenne ich deshalb jeden durch Gesetze regierten Staat, gleichgültig, unter welcher Regierungsform dies geschieht: weil nur hier das öffentliche Interesse herrscht und die öffentliche Angelegenheit etwas gilt. Jede gesetzmäßige Regierung ist republikanisch (...). Die Gesetze sind eigentlich nur die Bedingungen der bürgerlichen Vereinigung. Das den Gesetzen unterworfene Volk muss deren Urheber sein“ (Rousseau 1977: 41/42), so schreibt Jean-Jacques Rousseau, einer der berühmtesten französischen Philosophen und Staatstheoretiker überhaupt. Er veröffentlichte im April 1762 sein Werk „Gesellschaftsvertrag“ oder „Contrat Social“, in dem er die Frage zu beantworten versucht, was einem Staat Rechtmäßigkeit verleiht (vgl. Rousseau 1977: 5) und der sich zur Aufgabe stellt, eine Form des Zusammenschlusses zu finden, „die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor“ (Rousseau, 1977: 17). Doch klingen die Zeilen „Republik nenne ich deshalb jeden durch Gesetze regierten Staat...“ eher nach einer willkürlichen Bezeichnung ohne eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit. Es stellt sich die Frage: was verbirgt sich eigentlich hinter dem Ausdruck ´Republik´? Ist Rousseaus Staat – nur weil er ihn eine Republik nennt – auch tatsächlich dem Ursprung nach mit der Idee des Republikanismus verbunden? Und wenn dem so ist – was ist dann überhaupt ein republikanischer Gedanke? Der am 28.6.1712 in Genf geborene Staatstheoretiker ist nämlich durchaus nicht immer eindeutig zu interpretieren. In der französischen Revolution diente sein Werk als Legitimation für die grausamen Morde und viele andere Greultaten, den Sozialisten war Rousseau ein Vorbild, unter anderem aufgrund seiner Neigung zur möglichst umfassenden Gleichheit der Menschen, und mittlerweile stammen bedeutende kommentierte Ausgaben des ´Contrat Social´ sogar von streng konservativen Theoretikern (vgl. Spaemann 1992: 17).
So gerät die Diskussion um die Idee seiner Staatskonstruktion also auch in die Debatte um die Theorien des Republikanismus und Liberalismus – zwei der bedeutendsten Ideen auf dem Gebiet der politischen Theorie. Der Philosophieprofessor und Spezialist für politische Theorien, Wolfgang Kersting, schreibt dazu: „(...) Alle Begriffe, vom Vertrag bis zum Gesetzgeber, vom Gemeinwillen bis zum Gesetz werden uminterpretiert, gewinnen eine neue, zumeist schillernde, alte Bedeutungsschichten mit neuem Firnis überziehende Bedeutung. Die das gesamte Werk prägende Liberalismus- Republikanismus- Spannung färbt sie ein und gibt ihnen eine doppelte Lesart“ (Kersting 2002: 13). Der emeritierte Frankfurter Politologieprofessor Iring Fetscher lässt Rousseau erst gar nicht als liberalen Theoretiker durchgehen, er meint: „Rousseau war gewiss nicht totalitär, aber mindestens ebenso wenig liberal“ (Fetscher 1975: 256).
Diese Arbeit beschäftigt sich eben mit diesem Thema – nämlich mit der Frage, welche liberalen und republikanischen Elemente in Rousseaus Konstruktion eines idealen Staates identifiziert- und als dominierend bewertet werden können. Der Versuch, eine differenzierte Einordnung der rousseauischen Konzeption im ideellen Spannungsfeld der beiden großen Theorien vorzunehmen, bildet jedoch lediglich eine Interpretationsmöglichkeit – sicherlich werden andere Ansätze mit anderen Perspektiven auch andere Ergebnisse mit sich bringen.
Der Arbeitsaufbau ist folgendermaßen gestaltet: zunächst widmet sich der Text einem kurzen Diskurs über die Freiheit – vor allem deshalb, da die beiden aufgeführten Freiheitskonstruktionen jeweils charakteristisch für die Ideen des Republikanismus, sowie des Liberalismus sind. Rousseau – so wird später festgestellt – verbindet beide Freiheiten in seinem ´Contrat Social´ - die daraus resultierenden Widersprüche werden anschließend als fundamentale Problembereiche identifiziert. Im Anschluss an den Freiheitsdiskurs werden die Ideen des Republikanismus, sowie des Liberalismus kurz umrissen und ein struktureller Rahmen der rousseauischen Staatskonstruktion entworfen. Anhand dieser Texte lassen sich in den folgenden Kapiteln Vergleiche und Einordnungen hinsichtlich der beiden Ideen vornehmen, die in der ´Schlussfolgerung´ interpretiert und zu einem Ergebnis zusammengefasst werden.
Vor dem Einstieg in die Materie zitiere ich bewusst noch die Vorbemerkung zum ´Contrat Social´, in der es heißt: „Diese kleine Abhandlung ist einem umfassenden Werk entnommen, das ich, ohne vorher meine Kräfte zu befragen, einmal begonnen und schon vor langer Zeit beiseite gelegt habe. Von den verschiedenen Stücken, die man aus dem Vorhandenen auswählen konnte, ist dies das ansehnlichste; es schien mir am wenigsten unwürdig, der Öffentlichkeit vorgelegt zu werden. Der Rest ist bereits nicht mehr“ (Rousseau 1977: 4). Ob sich der bedeutende Philosoph bei dem Versuch eines analytisch und deduktiv konzipierten Staates über seine Kräfte und sein Vermögen hinausarbeitete? - Das einzuschätzen bleibt dem Leser am Ende dieser Arbeit selbst überlassen.
II. Heranführung und grundlegende Begriffe
a. Diskurs über den Begriff der Freiheit
Der Begriff der Freiheit spielt in den angesprochenen Ideen eine herausragende Rolle, so dass er ein besonderes Augenmerk verdient. Ich stütze mich in diesem Zusammenhang vor allem auf die Ausarbeitung einer Theorie von Isaiah Berlin:
Berlin diskutierte in seinem Text "Zwei Freiheitsbegriffe" die Notwendigkeit und die Möglichkeiten, durch welche Gesetze die Menschen zu lenken versuchen. Er leitet seinen Diskurs mit der Frage nach der Legitimität von Zwang ein, welche in den Fragen "Warum soll ich nicht so leben, wie es mir gefällt? - Muss ich gehorchen? - Darf, wenn ich nicht gehorche, Zwang gegen mich ausgeübt werden? Von wem, in welchem Maße, in wessen Namen und um wessentwillen?" (Berlin 1995: 200) zum Ausdruck kommt. Um der ´Porösität´ dieses Begriffes ´Freiheit´ zu entgehen, gliedert ihn Berlin in die ´negative-´ und ´positive Freiheit´ und schafft somit als erster eine neue Dimension der Erörterung des Freiheitsbegriffs.
Nach der Theorie der ´ negativen Freiheit ´ ist der Mensch - auf politischer Ebene - so lange frei, wie er sich ungehindert jeglicher Restriktionen durch andere Bewegen kann (vgl. Berlin 1995: 201). „ Politische Unfreiheit herrscht nur dort, wo man von Menschen daran gehindert wird, ein Ziel zu erreichen “ (Berlin 1995: 202). Er folgert also, dass die Freiheit umso größer ist, je ausgedehnter sich der ´Bereich der Ungestörtheit´ präsentiert. Um jedoch das friedliche Zusammenleben der Menschen zu garantieren erkennt Berlin – anschließend an eine lange Liste von Philosophen und Staatstheoretikern – dass die Freiheit, der Ordnung und Sicherheit zuliebe, gewissen Einschränkungen bedarf („Die Freiheit der Wölfe ist der Tod der Lämmer“ (Berlin 1995: 204)). Schon Hobbes stellte im 17. Jahrhundert fest: „Sooft sich aber Zwei ein- und dasselbe wünschen, dessen sie aber nicht zugleich teilhaftig werden können, so wird einer des anderen Feind und um das gesetzte Ziel, welches mit der Selbsterhaltung immer verbunden ist, zu erreichen, werden beide danach trachten, sich den anderen entweder unterwürfig zu machen oder ihn zu töten“ (Hobbes 1970: 115). Begründet auf den Gesetzen muss der Staat einen Mittelweg zwischen Einschränkung und Zugeständnis eines Mindestfreiraumes finden, in dem der Mensch jene natürlichen Fähigkeiten entwickeln kann, „die es ihm überhaupt erst ermöglichen, die verschiedenen Zwecke, die Menschen für gut und richtig oder heilig halten, zu verfolgen oder auch nur zu erkennen“ (Berlin 1995: 203). Bezogen auf die Regierungsform, in der diese Art der Freiheit durch Gesetze Anwendung finden kann, stellt Berlin fest, dass Freiheit in diesem Sinne „nicht oder zumindest nicht logisch mit Demokratie oder Selbstverwaltung verknüpft ist“ (Berlin 1995: 210). Zwar räumt er ein, dass Selbstverwaltung eine bessere Garantie der bürgerlichen Freiheiten gewährleisten kann, doch negiert er vehement einen notwendigen Zusammenhang, wobei er den Vergleich der folgenden Fragestellungen anführt: „Wer regiert mich?“ und „Wie weit engen Staat oder Regierung mich ein?“ (Berlin 1995: 210). Diese Fragestellungen betonen die fundamentale Differenz in Anbetracht der Ziele, welche die Verfechter einer jeweiligen Fragestellung ins Auge fassen. Nachdem die zweite Frage als Kennzeichen der ´negativen Freiheit´ bereits hinreichend erläutert wurde, wird im Folgenden der Begriff der ´positiven Freiheit´, welche auf die erstgenannte Frage antwortet, erklärt:
„Die ´positive´ Bedeutung des Wortes ´Freiheit´“ - so Berlin – „leitet sich aus dem Wunsch des Individuums ab, sein eigener Herr zu sein“ (Berlin 1995: 211) und zielt somit auf eine aktive Position des Bürgers im Staate ab, welcher durch sein eigenes Zutun an der Gestaltung des politischen Lebens teilhaben soll. Aufgabe der Gesetze ist in diesem Fall die Beseitigung von Irrationalitäten in der Entscheidungsfindung der Bürger, es soll ihnen also nahe gebracht werden, welche Entscheidungen sie für ihr eigenes Wohl favorisieren sollten. Praktisch lässt sich durch die Gesetze ein Schutz der Bürger vor sich selbst – im Gegensatz zu der liberalen Idee des Gesetzes als Schutz vor dem Nachbarn oder Staat - interpretieren. Im Idealfall liegt die ´positive Freiheit´ also in den Gesetzen begründet, beziehungsweise spiegeln die Gesetze die Freiheit wider.
b. Zur Konzeption des Republikanismus:
Die Idee des Republikanismus hat ihren Ursprung in der Antike, wo sie sich bewusst in einer Gegenform zur Monarchie entwickelte. Grundsätzlich lässt sich der Republikanismus als eine Negation der Alleinherrschaft und der Favorisierung einer Teilhabe der Bürger an politischen Entscheidungsprozessen beschreiben. Der römische Begriff der ´res publica´, also der ´Sache des Volkes´, bezeichnet das Gemeinwesen, welches die Herrschaft anstelle einer physischen Person ausüben sollte. Tocqueville liefert in diesem Zusammenhang eine grobe Definition der grundlegenden Republikanismus-Idee, indem er schreibt: „Das Volk ist Anfang aller Dinge; alles geht vom Volk aus, alles geht in ihm auf“ (Tocqueville 1985: 49). Die politische Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft genießen in diesem Zusammenhang eine besondere strategische Bedeutung, als dass die Politik einen sittlichen Lebenszusammenhang zwischen Staat und Gesellschaft reflektiert, welcher dem liberalen Ansatz einer Vermittlungsfunktion des Staates entgegensteht (vgl. Habermas 1999: 278). Die Politik steht konstitutiv für den Vergesellschaftungsprozess im Ganzen, was vor allem von Rödel/Frankenberg/Dubiel in ihren Diskursen über die amerikanische Gründerzeit hervorgehoben wird. Sie betrachten das Volk als autonom handlungsfähiges „Volk von Gleichen“, das sich also „ohne Bindung an heterogene Autoritäten eine eigene politische Verfassung zu geben vermag“ (Rödel/Frankenheim/Dubiel 1989: 58). Von Niccolo Machiavelli im 15. Jahrhundert über Montesquieu und Rousseau bis in die heutige Zeit ist die Thematik niemals gänzlich aus den Debatten verschwunden, sie wurde lediglich in Frage gestellt und das vor allem von den Verfechtern der Idee der Liberalismus, welche den demokratischen Prozess, der von Habermas als grundlegender Differenzierungsaspekt zwischen Republikanismus und Liberalismus gesehen wird, als Vermittler zwischen Bürger und Staatsapparat begriffen, um „den Staat im Interesse der Gesellschaft zu programmieren“ (Habermas 1999: 277).
Diese grundsätzliche Differenz zwischen den beiden Konzeptionen ruft weitere Uneinigkeiten bezüglich verschiedener Definitionen hervor, entlang welcher im Folgenden der Republikanismus und im nächsten Kapitel auch der Liberalismus skizziert werden sollen.
Habermas gliedert das Feld der Konsequenzen, welche sich aus den grundsätzlich verschiedenen Ansätzen des Republikanismus und Liberalismus ergeben, grob in drei Teile: a) das Konzept des Staatsbürgers, b) den Begriff des Rechts und c) die Natur des politischen Prozesses:
Der Staatsbürger wird nach republikanischer Auffassung durch politische Teilnahme- und Kommunikationsrechte bestimmt, welche Berlin - wie erwähnt - als ´positive Rechte´ definiert („Von was oder wem geht die Kontrolle oder die Einmischung aus, die jemanden dazu bringen kann, dieses zu tun oder zu sein und nicht jenes andere?“ (Berlin 1995: 201)). Garantiert wird in diesem Zusammenhang nicht die Freiheit von äußerem Zwang, sondern die „Beteiligung an einer gemeinsamen Praxis, durch deren Ausübung die Bürger sich erst zu dem machen können, was sie sein wollen - zu politisch verantwortlichen Subjekten einer Gesellschaft von Freien und Gleichen“ (Habermas 1999: 279), in der dem republikanischen Staatsbürger die Ausrichtung und Handlungsintention auf gemeinsame Ziele und Normen hin zugemutet werden. Rödel/Frankenberg/Dubiel bringen an dieser Stelle zusätzlich die Gründungszeit der Republik ins Spiel, in welcher sich durch gemeinsame Vereinbarungen und vor allem durch „produktive und innovative Leistung ihrer politischen Imagination“ (Rödel/Frankenberg/Dubiel 1989: 58) ein neues politisches Gemeinwesen an die Stelle der „absoluten Tyrannei“ (Rödel/Frankenberg/Dubiel 1989: 58) setzte.
Der Begriff des Rechts spielt in der republikanischen Auffassung eine stark normative Rolle. Hingegen der eher individuellen Ausrichtung des Rechts nach liberalem Ansatz (s. nächstes Kapitel), zielt der Rechtsbegriff im Republikanismus auf eine „objektive Rechtsordnung, welche die Integrität eines gleichberechtigten, autonomen und auf gegenseitiger Achtung beruhenden Zusammenlebens zugleich ermöglicht und garantiert“ (Habermas 1999: 280). Die Rechte zielen also primär auf objektivrechtliche Gültigkeit, ihre subjektive und individuelle Gültigkeit steht diesem Primat hinten an. Diese Bindung der Gesetze an das demokratische Verfahren wahrt den internen Zusammenhang zwischen Selbstbestimmungspraxis des Volkes und der unpersönlichen Herrschaft der Gesetze und das Wahlrecht, welches die ´positive Freiheit´ repräsentiert, wird somit zum Paradigma von Rechten überhaupt, weil sowohl die politische Selbstbestimmung, wie auch die Berechtigung aller Bürger zu gleichgewerteten Beiträgen zur ´Sache des Volkes´ davon abhängen (vgl. Habermas 1999: 281).
Der demokratische Prozess ist ebenfalls ein Punkt des Dissenses zwischen Republikanern und Liberalen, der in enger Verbindung zu den vorhergegangenen Streitpunkten Betrachtung finden muss. Hingegen der Machtkonkurrenzsituation des liberalen Ansatzes geht der Republikaner von einer verständigungsorientierten öffentlichen Kommunikation aus, welche nicht Markt-, sondern Gesprächs- und Vernunftorientiert ist (vgl. Habermas 1999: 282). Die Vernunft, welche in den Diskussionen oft mit dem lateinischen ´vertu´ bezeichnet wird, spielt dabei eine Primärrolle und greift in eine lang andauernde Tradition – so findet sich dieser Ansatz bereits bei Machiavelli, welcher die Weisheit und Vernunft (ähnlich wie später bei Rousseau) bei einem nahezu gottesähnlichen ´Gesetzgeber´ (vgl. z.B. Machiavelli 1977: 11) vorhanden sehen will. Aber auch bei Rousseau, Tocqueville und anderen spielt die ´Bürgertugend´ oder die guten ´Sitten´ eine herausragende Rolle (vgl. z.B. Rousseau 1977: 41/ Tocqueville 1985: 45). Bellah schreibt beinahe pathetisch: „Da Republiken sich gewissermaßen gegen die Schwerkraft bewegen, ist es für das Überleben einer Republik entscheidend, dass sie tatkräftig um die Erziehung ihrer Bürger besorgt ist, dass die die Korruption (in diesem Fall ist damit der Sittenverfall gemeint, Anm. d. Autors) ausrottet und die Tugenden unterstützt“ (Bellah 1986: 48). Die erzieherische Funktion nimmt in Rousseaus Fall der (im nächsten Kapitel näher erläuterte) ´Gesetzgeber´ ein, welcher dem Volke Normen vermittelt, die in einer Art Katalog festgelegt sind – der Grundlage der von Rousseau geschaffenen ´Zivilreligion´ ist. Eine Ausarbeitung des Themas der Zivilreligion sei hier jedoch nur am Rande erwähnt, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Ihre Bedeutung sei damit jedoch nicht geschmälert – Bellah und andere halten sie für „unentbehrlich“ in der Republikanismus-Diskussion (Bellah 1986: 51).
Betrachtet man die Ausübung der Macht im Republikanismus, so stellt Habermas fest, dass nach republikanischer Idee die kommunikative Macht, welche auf diskursiv gebildeten Mehrheitsmeinungen beruht über der administrativen Macht thront, welche in der liberalen Anschauung das oberste Gebot des politischen Prozesses symbolisiert und auf die ausschließliche Legitimität der Machtausübung seitens des Staatsapparates abzielt (vgl. Habermas 1999: 282/283).
Soweit die Konstruktion eines Topos der republikanischen Theorie, im folgenden Kapitel wird vergleichend und angelehnt an diese Theorie, der Liberalismus untersucht und dargestellt.
c. Die Konzeption des Liberalismus:
Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln angedeutet, beinhaltet die Idee des Liberalismus allen voran die Freiheit des Individuums als zentralen Wert und Orientierungsnorm. „Die ungehindert freie Entfaltung des Menschen in allen Lebensbereichen (in Politik, Wirtschaft und Kultur) soll nicht nur die Voraussetzung für eine bestmögliche individuelle sittlich-geistige Persönlichkeits- und Wohlstandsentwicklung sein, sondern zugleich zu einer bestmöglichen sittlich-geistigen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft insgesamt führen“ (Autengruber 2002: 3). Rousseaus einleitende Worte zu seinem „Gesellschaftsvertrag“ bringen die Forderung der Liberalen auf einen Nenner; er beklagt: „Der Mensch ist frei geboren, doch überall liegt er in Ketten“ (Rousseau 1977: 5) – das freie Geborensein und die Ausstattung aller mit gleichen Rechten und Pflichten, sowie die Chance, sein Leben selbst zu gestalten und Verantwortung zu tragen, ist ein Grundprinzip dieses Konzeptes (vgl. Autengruber 2002: 3). Als weiterer Grundbauastein der Idee gilt das Prinzip der Trennung von Staat und Gesellschaft, welches äußerst deutlich den Dissens zum Republikanismus markiert: die Gesellschaft wird von den Liberalisten als ein marktwirtschaftlich strukturierter Verkehr von Privatpersonen und ihrer gesellschaftlichen Arbeit begriffen (vgl. Habermas 1999: 277). Diese steht einem Apparat der öffentlichen Verwaltung gegenüber, welcher seine politische Macht zur Erreichung kollektiver Ziele einsetzt. Die Funktion des demokratischen Prozesses besteht nun in der Bündelung und Durchsetzung von Privatinteressen gegen diese öffentliche Administration – er erfüllt folglich eine Art Programmierungsfunktion des Staates im Interesse der davon unabhängigen Gesellschaft (vgl. Habermas 1999: 277).
Entlang der Differenzierung, welche in dem Kapitel über die Konzeption des Republikanismus bereits dargestellt wurde, entwirft Habermas eine Charakterisierung des Liberalismus:
Zunächst bestimmt sich der Status der Bürger nach Maßgabe der subjektiven Rechte, die sie gegenüber Staat und anderen Bürgern haben (vgl. Habermas 1999: 278). Dabei spielen vor allem die subjektiven- oder negativen Rechte eine bedeutende Rolle, welche – wie im Kapitel über die Freiheit erläutert – vor allem auf den gewährten Optionsspielraum seitens des Staates, also auf das Ausmaß der Abwesenheit von äußerlichen Zwängen abzielen. Privatinteressen verdienen nach der Idee des Liberalismus besonderen Schutz des Staates, auch gegenüber dem Staate selbst. Mit den politischen Rechten verhält es sich genauso: „Sie geben den Staatsbürgern die Möglichkeit, ihre privaten Interessen so zur Geltung zu bringen, dass dies am Ende über Stimmabgabe, Zusammensetzung parlamentarischer Körperschaften und Regierungsbildung mit anderen Privatinteressen zu einem auf die Administration einwirkenden politischen Willen aggregieren können“ (Habermas 1999: 279). Diese Form der Demokratie ermöglicht es den Bürgern, eine Kontrolle über die ansonsten von der Gesellschaft losgelösten Regierung auszuüben.
Der ´Begriff des Rechts´ als zweiter Differenzierungsaspekt zum Republikanismus besitzt im Liberalismus seine Sinnhaftigkeit in der Feststellung, welchen Individuen welche Rechte zustehen. Im Gegensatz zu dem bereits erwähnten ´objektivrechtlichen Primat´ des Republikanismus (s. Kapitel über Republikanismus) rücken die Liberalisten die subjektiven Rechte in den Vordergrund des Rechtsbegriffs (vgl. Habermas 1999: 281). Dabei sticht Kritikern, wie zum Beispiel Michael J. Sandel, vor allem die These des ´Vorrangs des Rechts vor dem Guten´ ins Auge. Diese wird vor allem von dem jüngst verstorbenen Philosophen John Rawls vertieft, der feststellt, dass eine politische Gerechtigkeitskonzeption genügend Raum für die Lebensformen bieten muss, welche bei den Bürgern aktive Unterstützung finden (vgl. Rawls 1992: 365). Er vertritt also den Standpunkt, dass die verschiedenen Ideen des Guten in der Gesellschaft durchaus ihren Platz haben, doch müssen sie sich – seiner Meinung nach – im Rahmen einer Gerechtigkeitskonzeption entfalten, so dass sie „von freien und gleichen Bürgern geteilt werden oder geteilt werden könnten und (...) nicht irgendeine besondere vollständig (oder teilweise) umfassende Lehre voraussetzen“ (Rawls 1992: 366). Folglich genießt das Recht in diesem Verhältnis – anders als im Republikanismus, in dem Gesetz und Freiheit im Idealfall zusammenfallen – eine deutliche Priorität.
Schließlich betrachtet Habermas den Liberalismus unter dem Aspekt der ´Natur des politischen Prozesses´. Hierbei stellt er fest, dass Politik in diesem Sinne im Wesentlichen einen Kampf um Positionen und um die Verfügung über administrative Macht inkorporiert. Gegenüber dem auf Partizipation ausgerichteten republikanischen Konzept ist im Liberalismus die freie Konkurrenz maßgebend; die politische Meinungs- und Willensbildung in Öffentlichkeit und Parlament resultiert aus strategisch handelnden Akteuren, welche um Machtpositionen ringen und deren Erfolg in Wählerstimmen messbar gemacht wird (vgl. Habermas 1999: 282). Habermas veranschaulicht diesen Prozess mit einem Vergleich aus der Privatwirtschaft, indem er von „Stimmen-Input“ und „Macht-Output“ spricht, welche „demselben Muster strategischen Handelns“ entsprechen (Habermas 1999: 282).
Damit sind die unterschiedlichen Grundzüge von Republikanismus und Liberalismus hinsichtlich der Aspekte des Staatsbürgerkonzeptes, des Rechtsbegriffs und der Natur des politischen Prozesses entwickelt. Im Anschluss wird auf die hier entwickelte Interpretationsfolie zurückgegriffen, um die leitende Frage nach der Verortung der rousseauischen Konstruktion, im Spannungsfeld zwischen liberaler und republikanischer Konzeption zu beantworten.
III. Rousseaus Staatskonstruktion
Der folgende Teil dieser Arbeit beschäftigt sich im Wesentlichen mit Rousseaus Staatskonstruktion – primär basierend auf seinem Buch „Gesellschaftsvertrag“. Anhand seiner Ideen zur Schaffung eines idealen Staates lassen sich die verschiedenen Elemente republikanischer-, sowie liberaler Ideen identifizieren. Dieses Kapitel soll zunächst einen Überblick über Rousseaus Vorstellung eines ´idealen Staates´ geben.
Orientiert am Modell seiner Heimatstadt Genf – einer überschaubaren Gemeinschaft von Bürgern – versucht Rousseau eine Verfassung direkter Demokratie zu entwerfen (vgl. Braun/Heine/Opolka 1996: 178). Wie bereits viele andere Philosophen und Staatstheoretiker vor ihm, arbeitet er dabei mit dem Begriff des ´Naturzustands´. Dabei spiegelt der Begriff ´Natur´ das Anfängliche wider (vgl. Spaemann, 1992: 66). In einer deutlichen Kritik in Richtung Thomas Hobbes stellt Rousseau heraus, dass sein Naturzustandskonzept bereits vor dem von Hobbes entworfenen Naturzustand beginnt. Dieser hätte zwar die Institutionen des Staates abstrahiert, doch wäre vor dem Staat noch kein natürlicher Zustand vorzufinden gewesen – die Menschen hätten bereits mit einer Vergesellschaftung begonnen, deren Krönung der Staatsvertrag letztlich gewesen sei (vgl. Spaemann, 1992: 67). Rousseaus Naturzustand beginnt folglich mit einem Zustand, in dem die Menschen selbstgenügsam und isoliert leben (vgl. Fetscher/Münkler 1985: 480/481). Bedeutend ist in diesem Zusammenhang die Freiheit, welche die fundamentale Differenz zwischen Hobbes´ und Rousseaus´ Verträgen begründet: Während Hobbes auf die Freiheit zugunsten der Sicherheit verzichten möchte, steht Rousseau für einen Kompromiss bzw. eine Erfüllung beider Ansprüche ein. Genau an dieser Stelle spannt Rousseau den Bogen zu einer fundamentalen Staatskritik seiner Gegenwart: der Staat konnte – in seinen Augen – zwar den Frieden herstellen und zeitweise erhalten, dies war jedoch nur aufgrund einer Freiheitsberaubung seiner Untertanen möglich (vgl.: Mayer-Tasch 1991: 26) – er spricht im ersten Kapitel des ´Gesellschaftsvertrag´ von den „Ketten“, die den Menschen in seiner Freiheit begrenzen (vgl. Rousseau, 1977: 5). Und so wie Hobbes alles dem Primat der Ordnung im Staate unterstellt, so sollen die Individuen bei Rousseau in erster Linie ihre Souveränität – allerdings im Rahmen der staatlichen Autorität – wahren (vgl. Mayer-Tasch 1991: 25).
Beide – sowohl Hobbes, als auch Rousseau – kommen letztlich jedoch zu ähnlichen Schlüssen. Sie stimmen darin überein, dass die Staatskonstruktion aus einem menschlichen Friedensbedürfnis resultiert, welches durch Zweckrationalität hervorgerufen wird.
Rousseau begründet den Zusammenschluss der Menschen folgendermaßen: „Ich unterstelle, dass die Menschen jenen Punkt erreicht haben, an dem die Hindernisse, die ihrem Fortbestehen im Naturzustand schaden, in ihrem Widerstand den Sieg davontragen über die Kräfte, die jedes Individuum einsetzen kann, um sich in diesem Zustand zu halten. Dann kann dieser ursprüngliche Zustand nicht weiterbestehen, und das Menschengeschlecht würde zugrunde gehen, wenn es die Art seines Daseins nicht änderte“ (Rousseau, 1977: 16).
Die Menschen schließen folglich einen Vertrag eines jeden mit einem jeden. Dieser beinhaltet neben der formalen Reziprozitätsbeziehung zwischen den Naturzustandsbewohnern eine Entäußerungs- und eine Herrschaftsbeziehung, die sich in jedem Individuum reproduziert (vgl. Kersting, 1996: 162) und dem Individuum sowohl die Rolle eines Herrschers, wie auch die eines Beherrschten zukommen lässt. Als Herrscher ist das Individuum absoluter Monarch – Meyer- Tasch veranschaulicht dies durch den berühmten Ausspruch des Sonnenkönigs Louis XIV: „L´état, c´est moi“ (vgl. Meyer-Tasch 1991: 134). Durch ihren Zusammenschluss schaffen die Menschen „eine Gesamtkörperschaft, die aus ebenso vielen Gliedern besteht, wie die Versammlung Stimmen hat, und die durch ebendiesen Akt ihre Einheit, ihr gemeinschaftliches Ich, ihr Leben und ihren Willen erhält“ (Rousseau 1977: 18). Diese Person nennt Rousseau ´Polis´ oder ´Republik´ – in deutlicher Abgrenzung zur Stadt, genauso wie die Bewohner der Stadt ´Bourgeois´ und der Polis ´Citoyen´ heißen. Von ihren Gliedern wird die Republik ´Staat´, von ihresgleichen eine ´Macht´ genannt (vgl. Rousseau 1977: 18/19).
Aufgebaut ist Rousseaus ideale Republik auf dem Souverän, der allmächtig auftritt und unantastbar ist. Ihm kommt im Staate hauptsächlich die Legislativfunktion zu, was nicht bedeutet, dass er dadurch in seiner Allmächtigkeit und Letztinstanzlichkeit eingeschränkt würde. Er besteht aus der Gesamtheit und wird durch den Gemeinwillen geleitet. Dieser Gemeinwille, der ´volonté générale´, ist in keinem Fall mit dem ´volonté de tous´, dem Willen aller zu verwechseln – er unterscheidet sich von letzterem durch seinen allgemeinen Charakter und durch den Anspruch, von der ´vertu´ - der Vernunft – geleitet zu sein. Zuwiderhandlungen gegen den Souverän bedeuten im gleichen Atemzug also auch einen Angriff auf die Gesamtheit, woraus Rousseau das Recht ableitet, dem Einzelnen – im Notfall gewalttätig – den Gemeinwillen nahezubringen (vgl. Fetscher/Münkler 1985: 486). Hierarchisch unter dem Souverän konstituiert sich eine Exekutive – genannt: der Fürst. Die Exekutive hat die Aufgabe, die Brücke zwischen dem Staat und dem Souverän zu bauen, sie ist sozusagen der Geschäftsführer der öffentlichen Gewalt, welcher die Gesetze des Souveräns zusammenfasst und gemäß den Anweisungen des Gemeinwillens ins Werk setzt (vgl. Rousseau 1977: 62). Wie eine Regierung beschaffen und aufgebaut sein sollte, macht Rousseau von diversen Umständen im Staate und des Volkes abhängig, deren Erläuterungen hier wohl zu weit führen würden. Die Exekutive kann Rousseau zufolge die Form einer Monarchie, Aristokratie oder Demokratie annehmen, wobei die Aristokratie jedoch ausdrücklich präferiert wird. Zur Demokratie bemerkt Rousseau: „Wenn es ein Volk von Göttern gäbe, würde es sich demokratisch regieren. Eine so vollkommene Regierung passt für den Menschen nicht“ (Rousseau 1977: 74).
Als letzten Teil seiner Überlegungen bringt Rousseau eine merkwürdige – für sein gesamtes Werk jedoch höchst bedeutende – Konstruktion ins Spiel. Diese besteht in der Form einer Person, welche die Aufgabe und Fähigkeiten haben muss, den Menschen die guten Gesetze nahezubringen, sie aufzuklären und in die richtige Richtung zu leiten. Denn, so schreibt Rousseau, „es bedürfte der Götter, um den Menschen Gesetze zu geben“ (Rousseau 1977: 43). Er nennt diese Person den ´Gesetzgeber´. Diese „höhere Vernunft“ (Rousseau 1977: 43) wird in Rousseaus Staatskonstruktion notwendig, denn „die Einzelnen sehen das Gute und weisen es zurück: die Öffentlichkeit will das Gute und sieht es nicht. Beide bedürfen gleichermaßen der Führung“ (Rousseau 1977: 42). Um das Volk also gewissermaßen auf den ´rechten Weg´ zu bringen und dafür Sorge zu tragen, dass die ´guten Werte´ im Staate verankert werden, soll eine übermächtige Gestalt einschreiten. Braun/Heine/Opolka sehen in diesem Konstrukt eines übermächtigen und gottesähnlichen Gesetzgebers eine Form von Resignation – Rousseau stellte fest, dass die menschliche Vernunft nicht dazu ausreicht, um eine gute Verfassung zu entwerfen, also müsste ein Wesen, dass alle guten Eigenschaften, die der Mensch besitzen kann, in sich vereint, den Staat zur gesellschaftlichen Ordnung bringen. Dass dieses Wesen kaum zu finden ist, war Rousseau wohl bewusst (vgl. Braun/Heine/Opolka, S.181) – mehr dazu im letzen Teil dieser Arbeit, dem Resümee.
Zusammenfassend lässt sich der Staat als ein Gebilde aus einem alles beherrschenden Souverän (der sich in einer direkten Wechselwirkung mit dem Volk befindet), einer untergeordneten Regierung (Fürst genannt) und einem gesondert positionierten Gesetzgeber begreifen. Letzterer arbeitet transzendent von dieser Ebene, da er auf die Vernunft der Menschen einwirkt und sie für eine Republik vorbereitet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese grobe Zusammenfassung zum Staatsaufbau soll zunächst genügen und dem besseren Verständnis bei den folgenden Theoriedebatten dienen, die sich mit der Frage beschäftigen, welche republikanischen oder liberalen Elemente Rousseau in seinem Staatskonzept berücksichtigte und welche eventuell überwiegen.
IV. Zuordnungen
In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit soll Jean-Jacques Rousseaus ´Gesellschaftsvertrag´ auf Elemente republikanischer und liberaler Ideen hin untersucht werden. Angelehnt an die zu Beginn unternommene grundsätzliche Differenzierung zwischen den Theorien, soll sich am Ende eine Schlussfolgerung ergeben, die Aufschluss über die grundsätzliche Orientierung (eher republikanisch oder eher liberal) von Rousseaus ´idealem Staat´ geben kann. Zunächst richten wir unser Augenmerk also auf die republikanischen Elemente im ´Contrat Social´:
a. Republikanische Elemente in Rousseaus Staatskonstruktion
Im Zentrum des Republikanismus steht – wie bereits erläutert – die Bürgertugend, Sitte oder ´vertu´. Und auch Rousseaus Werk basiert fundamental auf diesem Gedanken – seinen Vertrag sieht Kersting als eine „Stätte der Verwandlung“ (Kersting 1996: 198), in dem die Menschen ihr Wolfsdasein verlassen und zu zivilisierten, kultivierten und moralischen Bürgern werden. Die ´vertu´ äußert sich bei Rousseau im ´volonté générale´, der maßgeblich für die Existenz und das Funktionieren des Staates verantwortlich ist und ohne welchen die Republik verloren ist (vgl. Piper, S. 486). Um im Staat eine unverfälschte Form des Gemeinwillens zu erhalten, lehnt Rousseau jegliche Form der Repräsentation strikt ab (vgl. Braun/Heine/Opolka: 177). Vorschläge, wie ein großer Staat, in welchem die Bürger sich nicht zu regelmäßigen und gemeinsamen Treffen versammeln können, in die Tat umgesetzt werden könnte, löst er mit dem Vorschlag ständig wechselnder Versammlungsorte – man erkennt jedoch sehr deutlich, dass seine Republik im Grunde an der Vorgabe eines Stadtstaates oder eines kleinen Staatsgebietes orientiert ist. In seinem vierten Buch schreibt er, dass in einem glücklichen Volk, „eine Schar Bauern die Staatsgeschäfte unter einer Eiche erledigt“ und dass ein derart regierter Staat sehr wenig Gesetze brauche, und im Falle der Notwendigkeit eines solchen Gesetzes würde derjenige, der als erster einen derartigen Willen ausspräche, nur aussprechen, „was alle schon gefühlt haben“ (Rousseau 1977: 112). Man erkennt also unschwer, dass Rousseau in seinem Staatsentwurf alles auf dem Gemeinwillen aufbaut – wo dieser nicht verwirklicht werden kann, da sieht er keine Chance für das Entstehen einer glücklichen Republik; er schreibt: „Wenn schließlich der Staat seinem Untergang nahe ist und nur noch als eine eingebildete und leere Form besteht, wenn das gesellschaftliche Band in allen Herzen zerrissen ist, wenn das niedrigste Interesse die Stirn hat, sich mit dem geheiligten Namen des Gemeinwohls zu schmücken: dann verstummt der Gemeinwille (...) und unter dem Namen von Gesetzen bringt man fälschlicherweise Verordnungen durch, die nur das Sonderinteresse zum Ziel haben“ (Rousseau 1977: 113).
Neben dem Drang oder Trieb der Menschen nach einem Leben in Freiheit und Sicherheit, leistet die Person des ´Gesetzgebers´ einen bedeutenden Beitrag zur Etablierung einer ´vertu´ im Staate. Er spielt den zweiten Part in Rousseaus Gesetzgebungskonstruktion, neben dem staatlich-formalen Gesetzgeber, „der durch die Assoziationslogik des Gesellschaftsvertrages definiert ist“ (Kersting 2002: 160). Seine Aufgabe besteht darin, den Bürgern genau die Dispositionen und Tugenden zu vermitteln, die für die Wahrnehmung ihrer demokratischen Gesetzgebungsfunktion unerlässlich sind. Er sorgt durch sein Erziehungswerk dafür, „ dass der zur Gesetzgebung berechtigte Bürger über die notwendige legislatorische Kompetenz verfügt“ (Kersting 2002: 160) – dies ist der Fall, wenn er gemeinwohlfähig ist, das heißt, dass sich sein Denken, Fühlen und Handeln am Gemeinwohl orientiert.
Ein weiteres – auch bereits in den ersten Kapiteln als bedeutend herausgestelltes Merkmal des Republikanismus ist die positive Freiheit. Nur wo sie vorhanden ist, institutionalisiert sich eine Republik, in der die Bürger gleichberechtigt an den Geschäften des Staates, der ´res publica´, teilnehmen können. Und gerade diese Gleichberechtigung spielt für Rousseau eine große Rolle, weshalb er „eine Gesellschaft von annährend gleich situierten Kleinbauern anstrebt“ (Fetscher 1975: 250) und den technischen Fortschritt zum Wohle der Republik nahezu unterbinden will. Nur so glaubt Rousseau, den vorgezeichneten Untergang des Staates herauszögern zu können – ein ewig währender Staat ist in seinen Augen unmöglich, denn „die politische Körperschaft beginnt so gut wie der menschliche Körper von Geburt an zu sterben und trägt die Keime ihrer Zerstörung in sich“ (Rousseau 1977: 96). Die Erfüllung des republikanischen Merkmales positiver Freiheit ist im ´Gesellschaftsvertrag´ besonders auffällig, denn bei ihm ist der Mensch nicht nur zur Teilhabe am politischen Geschehen berechtig – die Republik kann ohne seinen aktiven Beitrag als Teil der Gesetzgebung nicht fortbestehen. Der Dualismus des rousseauischen Menschenbildes wird in dieser Freiheit, die aus dem Selbstbestimmungsrecht des Bürgers als Souverän resultiert, überwunden: „In der konkreten freien Handlung ist die Zweiheit von Befehl und Gehorsam aufgehoben und zur Einheit geworden“ (Vossler 1963: 290).
Als nächstes fokussieren wir den Anspruch der Republikaner, einen Gegenpol zur Monarchie zu bilden. Ob sich der rousseauische Staat gegen die Monarchie an sich wendet kann, sollte von zwei verschiedenen Perspektiven aus betrachtet werden: zum einen berücksichtigt Rousseau die Monarchie durchaus, als legitime Form der Gestaltung des ´Fürsten´, also der Exekutive. Doch hier – und das wäre die zweite Ebene oder Perspektive – muss man unweigerlich erkennen, dass der Gemeinwille immer noch das leitende Subjekt im Staate ist. Die Monarchie existiert folglich unter einer allumfassenden Souveränität, die aus den Bürgern zusammengesetzt und durch ihren Gemeinwillen geleitet wird. Und auch in der untergeordneten Rolle des Fürsten schränkt Rousseau die Tauglichkeit der Monarchie ein, indem er schreibt: „Aber wenn es keine Regierung gibt, die mehr Kraft hat, so gibt es auch keine, wo der Sonderwille mehr Macht hat und alle anderen leichter beherrscht; es ist wahr, alles strebt dem gleichen Ziel zu, aber dieses Ziel ist nicht das des öffentlichen Glücks, und gerade die Kraft der Regierung schlägt unaufhörlich zum Nachteil des Staates aus“. Die Monarchie ist – wie er im Verlaufe seiner Erklärung deutlich macht – in seinen Augen zu stark der Gefahr des Abdriftens in ein Machtgefüge ausgesetzt, das dem Einzelnen die Stärke verleiht, die ihn zum Herrscher über die Bürger macht – und gerade dies möchte er mit seiner Staatskonstruktion nach eigenen Worten vermeiden („Der Mensch ist frei geboren, doch überall liegt er in Ketten (...). Wie ist dieser Wandel zustande gekommen? Ich weiß es nicht. Was kann ihm Rechtmäßigkeit verleihen? Diese Frage glaube ich beantworten zu können“ (Rousseau 1977: 5).).
All diese Punkte erwecken den Eindruck, die rousseauische Staatskonstruktion entspräche im Wesentlichen der republikanischen Idee – ob dies tatsächlich der Fall ist, lässt die Gegenprobe mit der konkurrierenden Idee des Liberalismus erschließen.
b. Liberale Elemente in Rousseaus Staatskonstruktion
Wie in Kapitel II.c. bereits herausgehoben, ist der Begriff der ´Freiheit´ ein fundamentales Kriterium für den Liberalismus. Vor allem die ´negative Freiheit´ ist dabei von Bedeutung – sie zielt auf den Schutz des Individuums vor Zwängen von außen, also auch vom Staate. Bei Rousseau ist dieses Verhältnis sehr schwierig – es wirkt beinahe gegensätzlich. Er stellt die Freiheit und den Zwang nicht in einen Gegensatz, sondern addiert die beiden Begriffe gleichberechtigt nebeneinander. Er schließt in seinem Freiheitsstaat den Zwang keineswegs aus, „im Gegenteil, dieser sei unentbehrlich, und stark solle er sein, nach Möglichkeit unüberwindlich“ (Vossler 1963: 290). Die Rechtfertigung dieser, auf den ersten Blick paradox klingenden Idee bezieht Rousseau konsequent aus den Gesetzen seines Staatsaufbaus, in dem der Gemeinwille – als Expression der Freiheit – eine übergeordnete Rolle inne hat. Der Zwang schützt in diesem Falle notwendigerweise die Freiheit, denn der Wille, der nicht dem Gemeinwillen entspricht ist nicht sein wirklicher Wille – er verkennt den guten Willen und muss folglich zu ihm gezwungen werden. Dieser Akt ist somit eine Hinführung zum Guten und kein Zwang gegen den eigenen Willen (vgl. Vossler 1963: 291). Die Rechte des Individuums beschränken sich auf eine freie Bewegung und freies Handeln, sofern dies mit dem Gesamtwerk des Staates, also dem Souverän bzw. dem Gemeinwillen, konform ist. Ein individuelles Entgegenstellen gegen das Werk und die Meinung aller bedeutet einen Verstoß gegen den Gesellschaftsvertrag und wird dementsprechend geahndet. Das Privatinteresse, das im Liberalismus eine herausragende und schützenswerte Stellung einnimmt, gilt im rousseauischen Staatskonstrukt als nur in dem Maße als schützenswert, wie es mit dem ´volonté générale´ Hand in Hand geht. Es lässt sich also konstatieren, dass dem liberalen ´Vorrang des Rechts vor dem Guten´ ein ´Vorrang des Guten vor dem Recht´ entgegengestellt wird.
Betrachten wir den nächsten, für den Liberalismus charakteristischen Punkt: die Trennung von Staat und Gesellschaft. Und auch hier sticht ins Auge, was bereits auf den ersten Punkt zutraf: Rousseaus Konstruktion folgt in geradliniger Weise dem Konzept des Republikanismus, denn, indem die Menschen im Staate sowohl Bürger wie auch Souverän verkörpern, ist der Staatsapparat keine transzendente, unabhängige Führungselite, wie im Liberalismus vorgesehen, sondern in ihm verwirklicht sich das Selbsterhaltungsinteresse der Gemeinschaft (vgl. Kersting 2002: 81). Jeder ist Teil des Staates und gleichzeitig sein eigener Untertan. Es geht folglich nicht um die Bündelung von Privatinteressen gegen eine öffentliche Administration (vgl. Habermas 1999: 277), sondern ein jeder hat ein reges Interesse an einem Zustandekommen von guten – das heißt der Allgemeinheit zugutekommenden – Gesetzen, denn: „Sobald jene Menge auf solche Art zu einer Körperschaft verschmolzen ist, kann man keines ihrer Glieder verletzen, ohne die Körperschaft anzugreifen; noch weniger kann man die Körperschaft verletzen, ohne dass die Glieder die Wirkung spüren“ (Rousseau 1977: 20). Ein jeder handelt also im eigenen Interesse (s.unten) und damit zwangsläufig im Interesse aller.
Ein weiterer Aspekt der liberalen Idee ist der Konkurrenzkampf um politische Ämter. An dieser übt Rousseau besondere Kritik – in seinen Augen ist diese Einstellung die Ursache für den monarchischen Absolutismus seiner Zeit (Fetscher/Münkler 1985: 479). Er blendet den Konkurrenzkampf in seinem Republikentwurf – zumindest teilweise – aus; denn die gesetzgebende Volksversammlung beinhaltet alle Bürger – niemand hat in diesem Fall die Möglichkeit, sich eine herausragende Stellung erarbeiten oder erkämpfen zu können. Anders sieht es hingegen im Falle der Regierung – des Fürsten – aus. Hier proposiert Rousseau, je nach Amt und Stellung, zwischen einer Rekrutierung per Los oder durch eine Wahl zu entscheiden. Bei Stellen, „die besondere Begabungen erfordern, wie die militärischen Stellen“ (Rousseau 1977: 120) präferiert er die Auswahl durch eine Wahl – bei Stellen, wo der „gesunde Menschenverstand“ (Rousseau 1977: 120) ausreicht, ist er für das Los, welches in seinen Augen eine größere demokratische Legitimation erfährt. Bei einer monarchischen Regierung kommt die Auswahl selbstverständlich nur dem Monarchen zu – beinahe amüsant wirkt in diesem Zusammenhang Rousseaus strikte Verfolgung seiner Gesetze, nach denen er einen Staat konzipieren will: Er stellt fest, dass der Abbé von Saint Pierre durch den Vorschlag zur Wahl der Königräte, eine Regierungsänderung vorschlug – denn in einer Monarchie rousseauischen Konzepts wäre ein Wahl in diesem Fall Zeichen einer anderen Regierungsform (vgl. Rousseau 1977: 120). Durch die absolute Dominanz der Volksversammlung im Staatsaufbau, im Vergleich zur Rolle der Regierung, lässt sich jedoch auch für diesen Punkt festhalten, dass der Konkurrenzkampf um (wichtige) Ämter im Großen und Ganzen ausgeschaltet- und einem direkt-demokratischen Versammlungsprinzip geopfert wurde.
Bislang gelang es also noch nicht, ein deutliches Indiz für einen liberalen Ansatz in Rousseaus Staatskonstruktion zu entdecken, doch wenden wir ums im nächsten Gedanken der Grundvoraussetzung seiner Idee zu: dem Menschenbild. In diesem Punkt knüpft Rousseau – wie auch andere Denker vor und nach ihm – an einen Zustand vor der eigentlichen Vergesellschaftung im Gesellschaftsvertrag an: er konstruiert den ´natürlichen Menschen´. Dieser lebt in seinen Ursprüngen isoliert und selbstgenügsam; er neigt zu keinerlei Abhängigkeit oder Machtstreben (Fetscher/Münkler 1985: 480). Durch die Gefahren der Natur, wie Waldbrände, Überschwemmungen oder wilde Tiere, treibt ihn sein Schutztrieb in kleine Gesellschaften. Es beginnt das „goldene Zeitalter“ (Fetscher/Münkler: 481), in dem die richtige Mitte zwischen der Unabhängigkeit des ursprünglichem Zustands und der Aktivität der Selbstsucht gefunden scheint. Doch bilden sich mit dem Herausbilden von Eigentum auch Machtverhältnisse und damit Neid und Missgunst, die zu einem kriegsartigen Zustand führen, in dem in Anlehnung an Thomas Hobbes ein jeder potentiell eines jeden Wolf ist. Und hier enttarnt sich ein liberales Element in Rousseaus Konstrukt, das – wie im letzten Kapitel noch einmal eingehender erläutert werden soll – sein gesamtes Konzept untergräbt: Die ´Großfamilie der Hirten´ des ´goldenen Zeitalters´ war wohl kaum liberal, doch die Idee des menschlichen Egoismus, die seit den Anfängen des Liberalismus, bis in die heutige Zeit dominant zu sein scheint, wird hier als fundamentale und unüberwindbare menschliche Eigenschaft dargestellt; zwar lebt der Mensch im Urzustand tugendhaft – so hilft er auch anderen Menschen, die zufällig seinen Weg kreuzen – doch aus eigenem Antrieb steuert der Mensch aus diesem Zustand heraus und schließt sich eigennützig mit anderen Menschen zusammen. Da er kein geselliges Wesen ist (bzw. nach Rousseau kein solches zu sein scheint), spielen eigene Interessen, wie Schutz und Komfort eine dominante Rolle für ihn. Sobald sich Eigentum bildet, tritt diese Neigung noch verstärkter in den Vordergrund: die Menschen beginnen, der Versuchung der Macht zu verfallen und enden in einer Situation, in der sie ununterbrochen um ihr Leben fürchten. An dieser Stelle handeln sie abermals egoistisch, indem sie sich – wieder einmal wider ihres angeblich ungeselligen Naturells – gegen eine Abkehr von der Gesellschaft, sondern für eine Institutionalisierung der Gleichen entscheiden. Sind die Individuen im Vertrage eingeschlossen, so treffen sich ihre Partikularinteressen an der Stelle, wo sie nicht im Einklang mit anderen stehen – also tritt auch dort eine egoistische Tendenz im menschlichen Gedankenfluss zutage. Trotz aller Bemühungen gelingt es Rousseau nicht, eine einleuchtend und final gültige Staatskonstruktion mit seinen Gesetzen aufzubauen, weshalb die Funktion des Gesetzgebers, quasi als externes Hilfsmittel, herangezogen wird. Es wirkt somit beinahe ironisch, dass ´Hilfe von oben´ das rousseauische Konstrukt vor den unübersehbaren Folgen der menschlichen Eigenschaften retten soll. Dieser Punkt ist von Rousseau zwar in vieler Hinsicht zu kaschieren und zu minimieren versucht worden, doch sticht er im Verlauf seiner Überlegungen immer häufiger als ´liberaler Doch´ in seine Überlegungen. Kersting sieht Rousseaus Vertragskonzept entsprechend als „ein ungeeignetes Vergesellschaftungsmodell“ (Kersting 1996: 178), da der Gemeinwille in seinen Augen zu komplex ist , um ihn in einem simplen Vertragsmodell abhandeln zu können.
V. Resümee und Schlussfolgerung:
In diesem letzten Teil der Arbeit soll nun ein abschließendes Fazit gezogen werden – es gilt sich den bisherigen Erkenntnissen zu widmen und nachzuvollziehen, inwiefern man Rousseaus Republik in den Kontrast zur liberalen Idee positionieren kann oder ob sich der Philosoph den liberalen Ansichten nicht sachbegründet verschließen konnte. Dabei sei auch auf die Anregung der Einleitung verwiesen, selbst zu entscheiden, ob Rousseau sich im Versuch der Beantwortung der Frage über die Legitimität und Rechtmäßigkeit von Herrschaft übernommen hat.
Ein Stolperstein in der Analyse Rousseaus ist dabei vor allem die Komplexität und teilweise Widersprüchlichkeit seiner Ideen. So schließt Fetscher: „wenn man die konstruktivistischen Elemente bei Rousseau eliminiert, kommt man zum rein konservativen Denken, wenn man sie steigert, zum sozialistischen“ (Fetscher 1975: 256). Das Spektrum der Auslegungsweise seiner Theorien ist folglich breit gefächert – es langt vom einen Ende politischer Sichtweisen zum anderen. So offenbart zum Beispiel die Person des Gesetzgebers ungeahnte Interpretationsmöglichkeiten: betrachtet man Rousseaus im Detail unbeantwortete Frage, auf welche Weise die Gesellschaft denn verändert werden sollte, so kann seine Figur durchaus verschiedene Weisen der Gesellschaftsveränderung abdecken „bis hin zum blutigen Terror, der sich auf die Verwirklichung des allgemeinen Wohls beruft“ (Braun/Heine/Oplka 1996: 183). Diese Beispiele veranschaulichen bereits, wie diffizil sich die Situation für Interpretationen darstellt und die Tatsache, dass sich sowohl Protagonisten der französischen Revolution, wie später auch einige Sozialisten auf den Philosoph beriefen verdeutlicht dies noch ein weiteres Mal.
Kommen wir also zu dem Versuch, einer Idee republikanischer oder liberaler Art mit Rousseau in Verbindung zu bringen. Fetscher resultiert in ihrem Werk über Rousseaus politische Philosophie, dass weder die bäuerliche Großfamilie der Hirten in Rousseaus Naturzustandskonzept, als auch die Tugend-Republik dem Geschmack eines Liberalen entsprechen würden (vgl. Fetscher 1975: 257). Keine Frage. Doch kann man deshalb folgern, Rousseau entbehre jeglicher liberaler Ansichten und säße voll und ganz auf dem Sattel des Republikanismus? – Im Grunde wird die Antwort im Kapitel IV.b. bereits vorweggenommen: Rousseaus Republik scheint sich vollkommen auf den republikanischen Werten und Normen zu begründen, doch dringen in seiner analytischen Ausarbeitung liberale Elemente und Ideen aus den Ecken in sein Konzept und führen zu einer Verwirrung und Hilflosigkeit. Fetschers Feststellung, „Rousseau war gewiss nicht totalitär, aber mindestens ebenso wenig liberal“ (Fetscher 1975: 256) kann man zwar so sehen, doch lassen andere Perspektiven auch andere Schlüsse zu.
So ist zunächst die Ausrichtung auf das Freiheitsprinzip, das bei Rousseau – wie gesehen – einen äußerst hohen Stellenwert besitzt, im Grunde die Erfüllung eines liberalen Gedankens, doch gepaart mit der Gleichheit der Menschen, die Rousseau zunächst durch Enteignungen und später durch Unterdrückung von Fortschritt erzwingen will, verkümmert der Vorschlag aus liberaler Sicht und kann nur noch schwach als ein solcher identifiziert werden. Grundlegend liberal ist jedoch die bereits angesprochene eigennutzorientierte Grundeinstellung des Menschen. Auch wenn Rousseau diesen Punkt nicht so ganz wahr haben möchte, so kristallisiert sich bei der Lektüre seines „Gesellschaftsvertrages“ deutlich heraus: er kann diesen Punkt in seiner analytischen Vorgehensweise nicht unter den Tisch kehren – sein Konzept wird gesprengt, der ´Gemeinwille´ schrumpft zur Utopie. Rousseau – so unterstelle Braun/Heine/Opolka – stelle resigniert fest, „dass der Naturzustand, den die Menschen um ihrer Selbsterhaltung willen verlassen mussten, ihnen keine wie auch immer geartete Garantie mit auf den Weg in die staatlich-gesellschaftliche Ordnung gegeben hat. Die Vernunft, die nun statt der Natur die Menschen durch die Feststellung ihres Gemeinwillens leiten sollte, reicht nicht zu. Es bleibt nur – und dies ist die Kehrseite der naturhaft-vernünftigen Konzeption Rousseaus – der Rückzug auf eine bewusst als Ideologie und Disziplinierungsinstanz angelegte gottgleiche Macht“ (Braun/Heine/Opolka 1996: 181). Der Gesetzgeber, aber auch die von Rousseau vorgeschlagenen Kriterien für Völker, die überhaupt für einen solchen Staat geeignet seien, fungieren also als Indiz für den eher experimentellen Charakter seines Werkes (vgl. Braun/Heine/Opolka 1996: 181) – das liberale Element der Eigennutzens – auch wenn es nicht direkt ausgesprochen wurde – zerstörte die sorgfältig geplante Konstruktion. Wolfgang Kersting schreibt dazu: „Im Gesellschaftsvertrag wird eine Republikkonzeption entwickelt, die, obwohl mit den Lesefrüchten aus der republikanischen Überlieferung garniert, eher an die Gemeinden puritanischer Sektierer erinnert, als an die Bürgergemeinschaft des politischen Aristotelismus oder das Rom der ´Discorsi´ Machiavellis und in ihrer individualistischen Fundierung und egalitaristischen Ausrichtung modernen Zuschnitts ist, jedoch zugleich einer kulturellen Homogenisierung das Wort redet, die den neuzeitlichen Tendenzen der Individualisierung und Pluralisierung direkt entgegengesetzt ist. Ihr begründungstheoretisches Fundament wird durch den Kontraktualismus bereitgestellt, aber nichts könnte dem neuzeitlichen Vertragsstaat und der durch ihn geschützten liberalen Gesellschaft fremder sein als die Rousseau´sche Republik des Gemeinwillens. Der durch die kontraktualistische Begründungsstruktur entwickelte Grundlagenliberalismus wird durch einen ethischen Republikanismus überformt; der Staat des Rechts versinkt in einer Gemeinschaft des Guten “ (Kersting 2002: 12).
Die anderen Punkte – sowohl auf republikanischer, wie auch auf liberaler Seite – wurden in den vorhergehenden Kapiteln bereits ´abgearbeitet´, so lohnt es sich nicht, sie noch einmal an dieser Stelle zu repetieren. Es hat sich gezeigt, dass Rousseau im Sinn hatte, einen auf republikanische Ideen aufgebauten Staat zu entwerfen. Die verarbeiteten Ideen entsprechen somit in großer Masse denen des Republikanismus – doch je mehr Rousseau versuchte, dies unter einem Anwendungsbezug zu durchdenken, umso deutlicher traten die immanenten Widersprüche seines Werkes zum Vorschein. Im Verlaufe seiner Konstruktion musste er seinen republikanisch erdachten Staat immer weiter einschränken, um die Anwendbarkeit erhalten zu können. Aber schon die Tatsache, dass Korsika, in seinen Augen, einer der wenigen Plätze Europas war, an dem er einen entsprechenden Staat (und das auch nur für einen gewissen Zeitraum) zu errichten für möglich glaubte, zeigt, dass er sich bereits zu weit von der Realität entfernt hatte.
So komme ich insgesamt zu dem Schluss, der bereits von Braun/Heine/Opolka trefflich auf den Punkt gebracht wurde, mit den Worten:
„Insgesamt artikuliert sich deshalb wohl in Rousseaus Werk vor allem die Widersprüchlichkeit einer Gesellschaft, die der Fragwürdigkeit ihrer Ziele inne wird und nicht die Möglichkeit hat, sich von ihrer eigenen Geschichte und ihren eigenen Bedingungen loszusagen“ (Braun/Heine/Opolka 1996: 183).
VI. Literaturliste:
- Autengruber, Peter, Mag. Dr. 2002: Liberalismus, von: www.oegb.or.at/oegb/pdf/pdf-dateien/pzg_04.pdf, Stand: 30.9.02
- Bellah, Robert N. 1986: Die Religion und die Legitimation der amerikanischen Republik, in: Kleger/Müller (Hrsg.): Religion des Bürgers. Zivilreligion in Amerika und Europa, München: Kaiser
- Berlin, Isaiah 1995: Freiheit: vier Versuche, Frankfurt a.M.: Fischer
- Brandt, Reinhard 1973: Rousseaus Philosophie der Gesellschaft, Stuttgart: Frommann
- Braun/Heine/Opolka 1996: Politische Philosophie, Reinbeck (Hamburg): Rowohlt
- Fetscher, Iring 1975: Rousseaus politische Philosophie, Frabkfurt a.M.: Suhrkamp
- Habermas, Jürgen 1999: Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp
- Hobbes, Thomas 1970: Leviathan, Stuttgart: Reclam
- Kersting, Wolfgang 1996: Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrages, Darmstadt: Primus
- Kersting, Wolfgang 2002: Jean-Jacques Rousseaus ´Gesellschaftsvertrag´, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- Machiavelli, Niccolo 1977: Discorsi: Gedanken für Politik und Staatsführung, Stuttgart: Kroener
- Mayer – Tasch, Peter Cornelius 1991: Hobbes und Rousseau, Aalen: Scientia
- Fetscher, Iring/ Münkler, Herfried (Hrsg.) 1985: Pipers Handbuch der politischen Ideen, München: Piper
- Spaemann, Robert 1992: Rousseau – Bürger ohne Vaterland, München: Piper
- Rawls, John 1992: Die Idee des politischen Liberalismus, Frankfurt a.M.: Suhrkamp
- Rödel, Ulrich/Frankenberg, Günter/Dubiel, Helmut 1989: Die demokratische Frage. Ein Essay., Frankfurt a.M.: Suhrkamp
- Rousseau, Jean-Jacques 1977: Gesellschaftsvertrag, Stuttgart: Reclam
- Tocqueville, Alexis de 1985: Über die Demokratie in Amerika, Stuttgart: Reclam
- Vossler, Otto 1963: Rousseaus Freiheitslehre, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Quote paper
- Benjamin Miethling (Author), 2002, Jean-Jacques Rousseaus Gesellschaftsvertrag: republikanisch oder liberal?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109140
Publish now - it's free











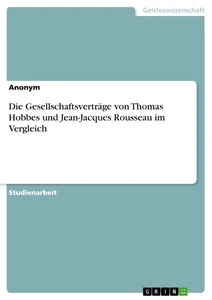










Comments