Leseprobe
Inhaltsverzeichnis:
I. Einleitung
II. Die Geschichte des Europäischen Parlaments
III. Die Aufgaben des Europäischen Parlaments
IV. Das Europäische Parlament als legitimitätsstiftendes Organ innerhalb der Europäischen Union
V. Gibt es ein europäisches Volk?
a. Gibt es eine ´europäische Identität´?
b. Kann man von einem ´europäischen Volk´ sprechen?
c. Folgerung
VI. Resümee und Ausblick
VII. Literaturliste
I. Einleitung
„Die Geschichte gönnt Europa keine Atempause. Nach dem Ende der machtpolitischen Statik, die vom Konflikt zwischen Ost und West geprägt war, wurde die Folgezeit durch die Dynamik der vielen Konflikte geprägt, aber auch durch eine Ratlosigkeit über die Baumuster für Europas Zukunft. Die Gleichzeitigkeit gegenläufiger Entwicklungen war das Kennzeichen dieser ´Ära ohne Namen´: Integration und relative Stabilität im Westen, Desintegration und Instabilität im Osten“ (Weidenfeld 1999: 19), so beschreibt der Politologe Werner Weidenfeld die jüngste Vergangenheit Europas. Nun wird in diesem Zusammenhang eine neue Ära eingeläutet: 10 neue Staaten – vorwiegend aus Osteuropa stammend – treten der Europäischen Union bei. Viele davon waren Teilrepubliken der ehemaligen UdSSR und damit bis vor kurzem noch durch den ´eisernen Vorhang´ von ihren baldigen Partnern getrennt. Die Vision, welche Sir Winston Churchill 1946 hatte, als er von den ´Vereinigten Staaten von Europa´ sprach, sie könnte in naher Zukunft Realität werden. Etwa 460 Millionen Menschen gehören der Europäischen Union nach dem Beitritt der zehn Neuen an und zusammen werden sie in gut einem Jahr das erste Mal gemeinsam ihr supranationales Parlament wählen. Und auch dieses hat bereits eine Geschichte und zwar eine, die, ebenso wie die neuen und alten Mitgliedsstaaten, ihre Höhen und Tiefen im gemeinsamen Miteinander überstanden hat. Mit der neuen Situation kommen alte Fragen wieder auf: Ist das Europäische Parlament imstande, der neuen, größeren EU durch die direkte Wahl seiner Abgeordneten die notwendige Akzeptanz und vor allem die benötigte Legitimität zu geben? Welche Aufgaben übernimmt das supranationale Organ in der Union? Soll und kann das Europäische Parlament nun als Stimme eines europäischen Volkes fungieren? Und wenn dem so sein sollte, kann man überhaupt von einem europäischen Volk sprechen? Die Meinungen gehen in diesen Punkten – wie wir im Laufe dieser Arbeit sehen werden – weit auseinander; manche bescheinigen zumindest den Westeuropäern eine gemeinsame kulturelle Basis (zum Beispiel aufgrund der gemeinsamen Einführung der Menschenrechte nach der französischen Revolution), andere sehen eine kulturelle Einheit der Europäer schon wegen der bestehenden Sprachenvielfalt für nicht existent (vgl. z.B. Reich 1999: 80).
All diese Fragen sollen in dieser Arbeit geklärt werden, wobei im Mittelpunkt das Problem des Parlaments ohne Volk steht, was sich mit der Frage ausdrücken lässt, ob es ein europäisches Volk gibt und ob dieses für die demokratische Legitimation des Parlamentes und damit auch der Europäischen Union überhaupt vonnöten ist.
Aus diesem Grund beginnt die Arbeit mit einem Überblick über die Geschichte des Europäischen Parlamentes – es soll die Anstrengungen, Fortschritte und Erfolge skizzieren, die das Europäische Parlament auf ihrem Weg bis zur Gegenwart durchlebt hat. Im nächsten Kapitel sollen die Aufgaben des Parlamentes näher beleuchtet werden, um im Anschluss zu klären, inwiefern das Parlament die Europäische Union als supranationale Staatengemeinschaft demokratisch legitimiert. Schließlich wird die Frage nach einer europäischen Identität und einem europäischen Volk beleuchtet. Im Resümee soll hinsichtlich der grundlegenden Fragestellung nach der Rolle des Parlamentes für die demokratische Legitimation der Europäischen Union und der Frage nach der Existenz und Notwendigkeit eines Europäischen Volkes eine Schlussfolgerung gezogen und damit verbunden ein Ausblick gewagt werden.
II. Die Geschichte des Europäischen Parlaments
„Demands for the creation of a European Parliament must be seen in the context of the postwar peace settlement“ (Smith 1999: 27). Die Politiker – nicht nur in Europa selbst, sondern auch in den Vereinigten Staaten – suchten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wegen, um Europa in Zukunft legitime demokratische supranationale Strukturen zu etablieren und damit Kriege zu vermeiden.
So entstand das Europäische Parlament aus einer „parlamentarischen Versammlung“, die als Haushaltsbehörde der ´Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl´ (EGKS, gegründet 1951 im Vertrag von Paris), der ´Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft´ (EWG) und der ´Europäischen Atomgemeinschaft´ (EURATOM, beide gegründet 1957 in den Römischen Verträgen) fungierte (vgl. Weidenfeld/Wessels 2002: 192). Über diese Funktion hinaus besaß sie Kontroll- und Informationsrechte gegenüber dem Rat und der Kommission, sowie das Recht, der Kommission das Misstrauen auszusprechen. Die Einflussmöglichkeiten waren also – vom heutigen Standpunkt aus betrachtet – eher mäßig bis irrelevant für die vergemeinschafteten Politikfelder (vgl. Weiler 1995: 16/17). Obwohl sich die ´parlamentarische Versammlung´ vom Jahr 1958 an selbst ´Parlament´ nannte, wurde dieser Begriff erst mit Inkrafttreten der ´Einheitlichen Europäischen Akte´ am 1. Juli 1987 zur offiziellen Bezeichnung (vgl. Weidenfeld/Wessels 2002: 193). Der Kompetenzgewinn, den das Parlament in dieser ´Akte´ verbuchen konnte, resultierte au seinem jahrelangen Ringen innerhalb des Machtgefüges der Gemeinschaft. Die ´parlamentarische Versammlung´ – nennen wir sie auch an dieser Stelle schon einmal ´Parlament´ – hatte bereits vor diesem Datum damit begonnnen, den Reformprozess der Europäischen Union, der bis dahin beinahe ausschließlich im ´Europäischen Rat´ ausgearbeitet wurde, zu beeinflussen. Dabei verfolgte man zwei verschiedene Strategien: zum einen die ´Politik der kleinen Schritte´ und zum anderen die ´Strategie der Totalrevision´ (vgl. Woyke 1998: 42/43). Die erste Strategie sollte „eine evolutionäre institutionelle Entwicklung der Gemeinschaftsorgane in ihrem Verhältnis zueinander“ (Woyke 1998: 43) bewirken, die letztere auf einen Vertrag zur Gründung einer ´Europäischen Union´ hinauslaufen. Am 14. Februar 1984 verabschiedete das Parlament einen ´Vertrag zur Gründung der Europäischen Union´, was faktisch einer europäischen Verfassung gleichkam. Nachdem sich auch mehrere Einzelstaaten dieser Idee angeschlossen hatten, einigte sich der Europäische Rat 1984 in Fontainebleau auf die Einsetzung eines Ausschusses, der einen Bericht über die institutionelle Reform der europäischen Gemeinschaft vorlegen sollte.
Das Europäische Parlament hatte sich also auf der politischen Bühne in Europa etabliert – doch bis dahin hatte man einen weiten und hindernisreichen Weg zurücklegen müssen:
Ein Problem für eine konstruktive Mitgestaltung der Gemeinschaft manifestierte sich unter anderem in dem Doppelmandat der Parlamentarier: die Abgeordneten des europäischen Parlamentes waren Entsandte der nationalen Parlamente und somit sowohl auf nationaler- wie auch auf gemeinschaftlicher Ebene tätig, eine arbeitsintensive und oft kontraproduktive Stellung, die dazu führte, dass das Parlament zwar eng mit den nationalen Parlamenten verzahnt war, den Innovations- und Fortschrittsprozess jedoch lähmte (vgl. Weiler 1995: 17/18). Erst durch das neue Haushaltsverfahren der EG (1970 und 1975), wonach die Matrikularbeiträge der Mitgliedsstaaten durch eigene Einnahmen der Gemeinschaft ersetzt wurden, stieg der Einfluss des in Haushaltsfragen traditionell einflussreichen Parlamentes wieder (vgl. Weiler 1995: 18), doch das Thema der direkten Wahl der Abgeordneten vom europäischen Volk war damit noch nicht vergessen – im Gegenteil: Bereits im Oktober 1958 – nur 18 Monate nach der Unterzeichnung der ´Römischen Verträge´ – beauftragte das Parlament eine Gruppe um den Franzosen Ferdinand Dehousse mit der Ausarbeitung eines Berichtes über die Reform des Wahlgesetzes (vgl.: Smith 1999: 52). Dehousse kam im Jahr 1960 zu der Schlussfolgerung, dass die von Technokraten dominierte Gemeinschaft ihre Impulse von außen – also aus den Nationalstaaten selbst – beziehen müsse. Somit wäre ein direkt gewähltes Parlament weitaus produktiver und innovativer als der status quo. Die Umsetzung dieses Gedankens brachte aber weitere Probleme mit sich. Vor allem die Suche nach dem Konzept einer solchen gemeinsamen direkten Wahl stellte die Dehousse- Gruppe vor Schwierigkeiten, da in vielen Mitgliedsstaaten unterschiedliche Wahlverfahren etabliert waren (und noch bis heute sind). Man einigte sich am Ende auf eine Lösung, die vorsah, dass jeder Mitgliedsstaat seine Wahlregeln für die Wahl der Abgeordneten zum Europäischen Parlament selbst bestimmen dürfe (vgl. Smith 1999: 53/54). Weiter wurde vorgeschlagen, nur 2/3 der Abgeordneten vom Volk direkt wählen zu lassen, während die übrigen Abgeordneten – der Integration in nationale Parlamente willen – Abgeordnete dieser nationalen Parlamente sein sollten.
Doch der Ministerrat sperrte sich gegen direkte Wahlen und darüber hinaus ließ der Aufstieg von Charles de Gaulle in Frankreich, der sich gegen supranationale Elemente in Europa aussprach, die Vorschläge von Dehousse versanden. Erst vehemente Forderungen des Parlamentes und die Präsidentschaft von Valéry Giscard d´Estaing in Frankreich (1974) brachten wieder Bewegung in die Diskussion und führten schließlich zur Einführung der direkten Wahl der Abgeordneten der Europäischen Parlamentes – zum ersten Mal im Mai 1979 (vgl. Smith 1999: 55 ff.), nachdem sich die EG-Staats- und Regierungschefs auf dem Pariser Gipfel 1974 grundsätzlich darüber verständigt hatten (vgl. Weiler 1995: 25).
Doch, wie bereits erwähnt, war den Parlamentariern nicht nur die direkte Wahl wichtig, sondern ebenfalls die Steigerung ihrer Befugnisse und Einflussmöglichkeiten. Vor allem im Bereich des EG-Haushalts – der originären Hauptaufgabe des Parlamentes – wollte sich die Institution weitere Mitsprache- und Interventionsrechte sichern. Neben der bereits erwähnten Eigenmittel-Regelung der Europäische Gemeinschaft, die durch die Beschlüsse von Luxemburg im April 1970 eingesetzt wurde, garantierten die Beschlüsse dem Parlament auch einen stufenweise gestalteten Kompetenzzuwachs. „Von 1971-1974 war das Europäische Parlament, wie bisher, berechtigt, dem Rat Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplans vorzuschlagen. Neu war jedoch an den Luxemburger Beschlüssen, dass der Rat die Haushaltsgewalt nicht mehr ohne jegliche formale Einschränkung ausüben konnte. Die Ablehnung einer vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Änderung, die nicht zur Erhöhung des Ausgabengesamtbetrags einer der Gemeinschaftsinstitutionen führte, hatte nun mit qualifizierter Ratsmehrheit zu erfolgen“ (Weiler 1995: 23). Ab dem 1.1.1975 wurde zwischen ´obligatorischen´ und ´nicht-obligatorischen´ Ausgaben unterschieden, welche das Europäische Parlament im ersten Fall lediglich in Form von Änderungsvorschlägen beeinflussen konnte; im Falle der nicht-obligatorischen Ausgaben der Gemeinschaft, womit vor allem gestaltende Politiken, wie Strukturfonds, Forschung und Entwicklung etc. gemeint war, konnte das Europäische Parlament „im Rahmen einer von der Kommission bestimmten Marge Ausgabenänderungen vornehmen und diese auch mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen endgültig entscheiden. Das ´letzte Wort´ des Parlamentes bei der Verabschiedung der nicht-obligatorischen Ausgaben stellte die wesentliche Neuerung der Luxemburger Beschlüsse dar“ (Weiler 1995: 23). Den Luxemburger Beschlüssen folgte eine Initiative der Kommission zur Stärkung des Parlamentseinflusses, der vorsah, dass das Parlament mit der Mehrheit seiner Stimmen oder 2/3 der abgegebenen Stimmen den Entwurf des Haushaltsplans ablehnen und eine neue Vorlage verlangen kann. Von dem am 22. Juli 1975 unterzeichneten Vertrag wurde bereits vier Jahre später in spektakulärer Weise Gebrauch gemacht, als man den Haushaltsplan für das Jahr 1980 ablehnte (vgl. Weiler 1995: 24). Eine weitere Neuerung dieses Vertrages war die Einführung des EWG-Vertrag-Artikels 206b, der dem Parlament die Aufgabe der Entlastung der Kommission bei der Ausführung des Haushaltsplans zukommen ließ. Doch das Europäische Parlament gab sich mit seiner gestärkten Rolle noch nicht zufrieden. Bislang präsentierte es sich in seiner Arbeit um die Fortentwicklung der EG eher als pragmatisch-orientiert (zum Beispiel luden sie Ratsminister in die entsprechenden Parlamentsausschüsse ein, um das Verhältnis Rat – Parlament zu intensivieren) – doch zu Beginn der 80er Jahre drängten die Parlamentarier wieder auf einen Kompetenzzuwachs. Es entstand die Forderung nach Schaffung eines institutionellen Ausschusses, dessen Aufgabe es sein sollte, Elemente einer europäischen Verfassung auszuarbeiten (vgl. Weiler 1995: 30). Der sogenannte ´Spinelli Bericht´ war ein Entwurf eines föderal gegliederten Europas, das auf parlamentarischer Demokratie basierte (vgl. Smith 1999: 60). Dieser Verfassungsentwurf – so Weiler – war der bis dato „weitestgehende und ehrgeizigste Vorschlag einer EG-Reform“ (Weiler 1995: 31). Das Europäische Parlament sollte laut ´Spinelli Bericht´, zusammen mit dem Rat echte Gesetzgebungsaufgaben im Rahmen eines Kodezisionsverfahrens wahrnehmen. Obwohl der Entwurf, aufgrund der Widerstände in einigen Mitgliedsstaaten, nicht 1:1 umsetzbar war, besaß er einen „hohen politischen Alternativwert“ (Weiler 1995: 32) und steuerte seinen Teil zu einer vorwärtsweisenden Diskussion um die Gestaltung der Europäischen Union bei.
Die nächste Etappe in der Geschichte des Europäischen Parlamentes war die Unterzeichnung der ´Einheitlichen Europäischen Akte´ am 17. Februar 1986. Sie stellte zwar noch nicht das mancherorts erhoffte große Reformwerk dar, leistete aber einen wichtigen Beitrag in der Erweiterung und Vervollständigung der bestehenden Verträge und bildete eine pragmatische Übergangslösung zur Europäischen Union (vgl. Woyke 1998: 46). Die wichtigste Bestimmung des Vertrages war die Vollendung des ´Gemeinsamen Binnenmarktes´ bis 1992. Woyke fasst die Ziele der Akte folgendermaßen zusammen:
„1. Die weitere Entfaltung des wirtschaftlichen und politischen Potentials der Gemeinschaft durch die Verwirklichung eines Raumes ohne Binnengrenzen
2. Die Stärkung der Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft nach innen und außen
3. Die Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments
4. Die Durchführung strukturpolitischer Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene, um allen Regionen eine Chance zu geben und insbesondere Regionen zu fördern, in denen ein Entwicklungsrückstand herrscht
5. Die Zusammenarbeit in Forschung und technologischer Entwicklung zu verbessern
6. Die Verbesserung der Zusammenarbeit in der Umweltpolitik und
7. Die konkrete Ausrichtung des (west-) europäischen Integrationsprozesses auf das Endziel einer Europäischen Union“ (Woyke 1998: 48).
Trotz ihres – im Vergleich zu den Erwartungen – eher mageren Ergebnisses, erfuhren die Kommission und das Parlament eine gewisse Aufwertung: so erhielt das Parlament durch die ´Einheitliche Europäische Akte´ ein echtes Mitentscheidungsrecht beim Beitritt und der Assoziierung neuer Mitglieder (vgl. Woyke 1998: 47). Gleichwohl stellte das Parlament bereits am 16. Januar 1986 – also schon vor der Unterzeichnung – fest, „dass die ´Einheitliche Europäische Akte´ nur in einigen Gemeinschaftsbereichen zu gewissen Fortschritten führen kann, aber keine echte Reform der Gemeinschaft darstellt“ (Sitzungsprotokoll des Europäisches Parlaments vom 16.1.1986, in: Weiler 1995: 36).
Der Weg zur Gründung der Europäischen Union endete am 7. Februar 1992 mit der Unterzeichnung des „Vertrag über die Europäische Union“ (´Maastrichter Vertrag´) durch die Außen- und Finanzminister der 12 Mitgliedsstaaten. Am 1. November 1993 trat der Vertrag in Kraft. Er vereinigte die drei Gründungsverträge (EKGS, EWG, EURATOM), beinhaltete eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), sowie eine gemeinsame Innen- und Justizpolitik. Der Vertrag sah ebenfalls auch eine Ausweitung der EU-Verantwortlichkeit auf neue Politikfelder, wie Verbraucherschutz, Gesundheitspolitik, Transport, Verkehr und Sozialpolitik vor (vgl. Woyke 1998: 55/56). Ein weiterer wichtiger Beschluss des ´Maastrichter Vertrages´ war die Einigung auf das ´Prinzip der Subsidiarität´, „wonach die Gemeinschaft nur in jenen Bereichen tätig wird, soweit die vorgesehenen Maßnahmen von den Mitgliedsstaaten nicht ausreichend geregelt werden können“ (Woyke 1998: 56). Für das Europäische Parlament enthielt der Vertrag ebenfalls wesentliche Neuerungen: im Mittelpunkt stand das mit dem Vertrag neu eingeführte Mitentscheidungsverfahren, welches nach der zweiten Lesung des Parlamentes die Einberufung eines Vermittlungsausschusses durch den Rat vorsah, wenn das Parlament zuvor die Ablehnung des gemeinsamen Standpunkts des Rates mit absoluter Mehrheit angekündigt hatte (vgl. Weiler 1995: 52). Auch wurde dem Parlament eingeräumt, mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder, Änderungen am Gemeinsamen Standpunkt des Rates vorzuschlagen. Bei Nichtbilligung der Änderungsanträge beruft der Präsident des Rates den Vermittlungsausschuss ein. Der Vorschlag des Ausschusses bedarf im Folgenden der Zustimmung beider Organe (Rat und Parlament) – kommt erst gar kein Kompromiss zustande, so kann das Parlament den Rechtsakt innerhalb von 6 Wochen mit absoluter Mehrheit ablehnen. „Mit diesem neuen Verfahren hat das Europäische Parlament nunmehr die Gelegenheit, im direkten Dialog mit dem Rat, Rechtsakte zu verhindern“ (Weiler 1995: 54). Diese Regelungen blieben jedoch deutlich hinter den Forderungen des Parlamentes zurück, das unter anderem ein Initiativrecht, ein Recht auf Mitentscheidung mit dem Rat über die Gesetzgebung der Gemeinschaft, sowie das Recht auf Wahl des Kommissionspräsidenten gefordert hatte (vgl. Weiler 1995: 55). Der ´Institutionelle Ausschuss´ des Europäischen Parlamentes arbeitete also weiter daran, umgehend neue Themen auf die Reformagenda der Union zu setzen.
Trotz einiger Initiativen und sogar einem Protokoll im Vertrag von Amsterdam 1997, das noch einmal eine bedeutendere Rolle der nationalen Parlamente forderte (vgl. Smith 1999: 62), hatte das Europäische Parlament seine Rechte und Kompetenzen bis dato bereits bedeutend erweitern können und es gelang sogar, diese in dem Vertrag von Amsterdam noch weiter auszubauen: dort wurde festgeschrieben, dass das Parlament in den Bereichen, in denen es bei gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften nach dem Mitentscheidungsverfahren teilnimmt, weitere Kompetenzerweiterungen erfährt. Die Zahl der Legislativverfahren wird auf drei (Mitentscheidung, Zustimmung, Anhörung) reduziert – „das Mitentscheidungsverfahren wird nunmehr in nahezu allen Bereichen Anwendung finden“ (Woyke 1998: 75). Das Verfahren der Zusammenarbeit gilt nur noch bei Bestimmungen über die Wirtschafts- und Währungsunion, während das Zustimmungsverfahren bei Sanktionen wegen schwerwiegender und anhaltender Verletzung der Grundrechte durch einen Mitgliedsstaat, Beitrittsanträgen etc. angewendet wird. Weiter sieht der Vertrag die Begrenzung der Abgeordnetensitze des Parlamentes auf 700 vor – auch nach einer Erweiterung. Ein letzter, aber äußerst wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang die Wahl des Kommissionspräsidenten durch das Europäische Parlament und dessen Kompetenzsteigerung (vgl. Woyke 1998: 76). Durch diese Kompetenz hat das Parlament eine direkte Verbindung zur Kommission und übt in dieser Form eine zusätzliche Kontrollfunktion aus.
Der anschließende Vertrag von Nizza erzielte bezüglich der Forderungen und Entwicklungsperspektiven des Parlamentes keinen Fortschritt, sondern dehnte den status quo. Der Repräsentant des Europäischen Parlamentes Dimitris Th. Tsatsos schrieb: „Die Lücken, die der Vertrag von Amsterdam in bezug auf die demokratische Legitimation der Gemeinschaftsgesetzgebung noch gelassen hatte, nämlich das Nebeneinander von Mehrheitsentscheidung des Rates und Beschränkung des Parlaments auf Abgabe einer Stellungnahme insbesondere in der Agrarpolitik und in der Wettbewerbspolitik einschließlich staatliche Beihilfen wurden nicht nur nicht beseitigt. Der Vertrag von Nizza hat dem sogar neue Fälle hinzugefügt (Zusammenarbeit mit Drittländern, Haushaltsordnung) in denen die Legitimationskette durch die nationalen Parlamente nicht ausreicht, weil der Rat mit Mehrheit entscheidet, und das Europäische Parlament die Legitimationslücke nicht wirksam schließen kann, weil es nur über ein Konsultationsrecht, nicht über das von uns erwünschte Mitentscheidungsrecht verfügt“ (Tsatsos 2000: 3).
Der Wille des Europäischen Parlamentes, sich in Zukunft weitere Kompetenzen zu eigen zu machen und seine demokratische Legitimation zu erhöhen, ist also weiterhin unverkennbar.
Im folgenden Kapitel soll nun beleuchtet werden, was genau das Europäische Parlament heute beschließen und entscheiden darf, beziehungsweise wo seine Interventionsmöglichkeiten und Einflussmöglichkeiten liegen, um im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich zu machen, wie das Europäische Parlament die Europäischen Union legitimiert und ob es überhaupt über ein in seiner Gestalt identifizierbares ´europäisches Volk´ verfügt, welches in dem Organ repräsentiert würde.
III. Die Aufgaben und Arbeitsweise des Europäischen Parlaments
Die Aufgaben, bzw. Kompetenzen und die Arbeitsweise des Europäischen Parlaments sollten in diesem Kapitel kurz im Überblick skizziert und erläutert werden.
Grundsätzlich stellt Woyke fest, dass das Europäische Parlament im gesamten Entscheidungsprozess formal nicht so eine starke Stellung einnimmt, wie die Kommission und der Rat. „Allerdings hat es durch die Reform von 1987 mit der EEA (Einheitliche Europäische Akte, Anm.d.Autors), dem Maastrichter Vertrag von 1992 sowie dem Amsterdamer Vertrag von 1997 seine Rolle innerhalb des Entscheidungsprozesses gestärkt und verfügt z.B. in besonderen Situationen über ein (aufschiebendes) Veto und echte Mitentscheidungsrechte“ (Woyke 1998: 144). Im Einzelnen stellen sich die Kompetenzen des Europäischen Parlaments folgendermaßen dar:
Neben den grundsätzlichen Beratungs- und Kontrollbefugnissen nach Art. 189 EGV, hat das Parlament die Möglichkeit, der Kommission das Misstrauen auszusprechen (Art. 201 EGV). Bei der Einsetzung eines neuen Kommissionspräsidenten, werden die Vorschläge der Mitgliedsländer dem Europäischen Parlament vorgelegt. „Die Benennung bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlamentes“ (Art. 214,2 EGV). Eine weitere Kompetenz des Parlamentes liegt in der selbstständigen Ernennung eines Bürgerbeauftragten, „der befugt ist, Beschwerden von jedem Bürger der Union oder von jeder natürlichen oder juristischen Person mit Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Missstände bei der Tätigkeit der Organe oder Institutionen der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz in Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen“ ( Art. 95,1 EGV). Weiter hat es ein Initiativrecht zur Ausarbeitung eines einheitlichen Wahlverfahrens für die Direktwahlen zum Parlament (Art. 190,4 EGV) inne, sowie Haushaltsrechte nach Art. 272 EGV. Ein weiterer bedeutender Aspekt sind in diesem Zusammenhang die Mitwirkungsrechte in den Entscheidungsverfahren, die bereits im letzten Kapitel erwähnt wurden. Diese Manifestieren sich folgendermaßen: das Europäische Parlament hat nach Artikel 39 EUV ein obligatorisches Anhörungsrecht im Rat, das lediglich in Justiz- und Innenpolitischen Belangen eingeschränkt ist (vgl. Maurer 2002: 192), sowie ein Zusammenarbeitsverfahren im Gesetzgebungsprozess nach Art. 252 EGV. Hier kann das Parlament einen vom Rat vorgelegten Gesetzesentwurf ablehnen, den der Rat im Anschluss noch einmal einstimmig beschließen muss. Dieses Verfahren wird vor allem in Umwelt-, Technologie-, Bildungs- und Wirtschaftsgesetzgebung angewandt (vgl. Art. 251 EGV). Im Falle von Beitritts- oder Assoziierungsabkommen muss das Parlament nach Artikel 48 und 49 EUV und Art. 310 EGV seine Zustimmung geben. Im Rahmen der ´Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik´ (GASP), sowie der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen besitzt das Parlament Frage- und Interpellationsrechte (vgl. Art. 21, 39 EUV).
Das Parlament ist aus multinationalen Fraktionen (vgl. Maurer 2002: 193), nicht aus Landesfraktionen zusammengesetzt, wobei die multinationalen Parteien bislang noch davon entfernt sind, einheitliche und konfliktarme Fraktionen dazustellen (vgl. BpB 1995: 18/19) (formal könnte man dieses System etwa mit dem Modell des Deutschen Bundestages vergleichen). Von den derzeit 626 Abgeordneten stellt Deutschland mit 99 Mitgliedern die meisten; dabei fallen nach den Wahlen von 1999 53 Abgeordnete der EVP-CD, also den Konservativen zu, 35 den Sozialdemokraten (SPE), 5 den Grünen und 6 den Liberalen. Der Vertrag von Nizza sieht für die anstehende Erweiterung der EU eine Höchstzahl der Abgeordneten von 732 vor. Um wirksame Entscheidungen fällen zu können, sind die beiden großen Fraktionen der Konservativen und Sozialdemokraten mit zusammen 314 Stimmen zu einer Art ´Großer Koalition´ gezwungen, um wirkungsvoll arbeiten zu können (vgl. Maurer 2002: 194).
Die Arbeitsweise des Europäischen Parlamentes gestaltet sich prinzipiell folgendermaßen: Falls im EG-Vertrag nicht anders vorgesehen, stimmt das Parlament mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen ab (eine gemeinsame Stimmabgabe von Konservativen und Sozialdemokraten wäre also eine ausreichende Vorbedingung für das Zustandekommen von Entscheidungen). Im Falle von Änderungsanträgen in Zusammenarbeits- und Mitentscheidungsverfahren, sowie bei vielen Beschlüssen im Zustimmungsverfahren ist jedoch die absolute Mehrheit der Parlamentarier erforderlich – andere Entscheidungen, wie ein Misstrauensantrag gegen die Kommission, Haushaltsentscheidungen und ähnliches, stimmt das Parlament so ab, wie es im EG-Vertrag festgeschrieben ist (z.B. Art. 201 EGV) (vgl. Maurer 2002: 194/195).
Beratungen und Zuarbeiten für das Parlament geschehen in der Regel in verschiedenen Gremien: Das ´Präsidium´ (Präsident und vierzehn Vizepräsidenten) entscheidet demnach über finanzielle Angelegenheiten, sowie die Organisation des Parlamentes, seines Sekretariats und seiner Teilorgane. Die ´Konferenz des Präsidenten´ (Präsident und Fraktionsvorsitzende) beschließt die Satzungsordnung, die Gesetzgebungsplanung, sowie die Aufgaben der Ausschüsse (s.u.). Die sogenannte ´Konferenz´ stellt die Tagesordnung der Plenarsitzungen auf, gibt Initiativberichte in Auftrag und besitzt eine allgemeine Organisationszuständigkeit in Fragen der Beziehungen des Europäischen Parlamentes zu anderen EU- Institutionen, sowie zu den nationalen Parlamenten der Mitgliedsstaaten (vgl. Maurer 2002: 195).
Den Ausschüsse obliegt die fachliche Vorarbeit der Sitzungen und sie sind somit – wie auch in den nationalen Parlamenten – unentbehrlich für den Entscheidungsfindungsprozess des Parlamentes. In den Ausschüssen werden neben den Beratungen zur Position des Parlamentes zu Gesetzesvorhaben auch eigene Initiativen und Entwürfe entwickelt, „mit denen sie auf den europäischen Politikgestaltungsprozess einwirken können“ (Maurer 2002: 195).
Soviel also zu den Aufgaben und den Gremien im Europäischen Parlament – der kurze Überblick soll dazu dienen, sich ein Bild von der Arbeitsweise des Parlamentes zu machen und dies später bei der Beantwortung der Frage nach dem Volk und den demokratischen Elementen als Hintergrundinformation verwenden zu können. Im Folgenden widmen wir uns nun aber der Frage nach der demokratischen Legitimation, die das Europäische Parlament der Gemeinschaft verleiht.
IV. Das Europäische Parlament als legitimitätsstiftendes Organ innerhalb der Europäischen Union
Im letzten Kapitel betrachteten wir also die speziellen Aufgaben des Europäischen Parlamentes im Regierungssystem der Europäischen Union – nun soll ein Blick auf die demokratische Legitimation geworfen werden, die ein direkt gewähltes Parlament der Union vermitteln kann. Ist das Parlament geeignet, der Union eine notwendige Legitimation zu geben und in wie weit ist seine Rolle eher kritisch einzuschätzen?
Zunächst stellt sich die Frage, ob das Europäische Parlament überhaupt unbestritten ein legitimiertes Organ innerhalb der Union verkörpert. „Zuweilen“ – so schreibt Höreth dazu – „wird die Auffassung vertreten, dass das Europäische Parlament die Bezeichnung gar nicht verdiene, da schon bei der Sitzverteilung eine gravierende Verletzung des demokratischen Gleichheitssatzes zugunsten der kleineren Mitgliedsstaaten zu verzeichnen ist. Das demokratische Prinzip „one man – one vote“ findet hier keine Anwendung“ (Höreth 1999: 45). Das Problem, welches auch im nächsten Kapitel noch einmal aufgegriffen wird, beantwortet Höreth mit dem Verweis darauf, dass das föderale Prinzip der Staatenrepräsentation dem demokratischen Prinzip der individuellen Repräsentation übergeordnet sei und sich eine herausragende Bedeutung der EU-Mitgliedsstaaten herauskristallisiere und er stellt klar, dass man diese jedoch unberücksichtigt lassen könne, da das Föderalismusprinzip selbst eine wichtige Legitimationsquelle für die Europäische Union sei. Änderungen, wie zum Beispiel die Verwirklichung des demokratischen Gleichheitssatzes in einem einheitlichen Wahlverfahren, müssten zwangsläufig auf Kosten der Arbeitsfähigkeit des Parlamentes gehen und seien somit unvorteilhaft für Union und Mitgliedsstaaten (vgl. Höreth 1999: 45). Man erkennt also sofort die außergewöhnliche Rolle des Europäischen Parlamentes, die sich auch auf dessen Abgeordneten auswirkt. Diese unterscheiden sich in ihrer Rolle fundamental von den Kollegen in den nationalen Parlamenten: sie repräsentieren – wie wir aus dem folgenden Kapitel erkennen können – kein Staatsvolk und auch nicht die Gesamtheit aller Unionsbürger. Eigentlich sollten sie als Vertreter der europäischen Parteien deren Parteiinteressen vertreten, doch noch immer begreifen die Abgeordneten ihre Arbeit zumeist als Repräsentation ihrer Länder auf EU-Ebene – eine Aufgabe, die eigentlich dem Rat zukommt. Man erkennt also unschwer, dass auch das augenscheinlich direkt von den Bürgern (den Begriff ´Volk´ vermeide ich in diesem Zusammenhang bewusst) legitimierte Parlament einer erheblichen Kritik ausgesetzt ist, die man bis zu dem Vorwurf des Demokratiedefizits ausweiten kann.
Das Kernelement dieses Vorwurfes besteht in dem Vorwurf der Schwäche des parlamentarischen Elements im Rechtsetzungsverfahren der Gemeinschaft (vgl. Höreth 1999:46). Auch wenn der Vertrag von Amsterdam – wie bereits in vorigen Kapiteln erwähnt – an dieser Stelle einiges zur Verbesserung der Situation beitragen konnte, werden viele Entscheidungen immer noch am europäischen und den nationalen Parlamenten vorbei beschlossen – ohne direkte oder vermittelte Legitimation durch die EU-Bürger (vgl. Schmidt, in: Höreth 1999: 46). Weitere Probleme zählt Tobias Weiler auf. Er führt dabei vor allem die (bereits besprochene) Nichtstaatlichkeit der EU auf, im Detail die nichtvorhandene Gebietshoheit und eine mangelnde umfassende Personalhoheit (vgl. Weiler 1995: 42). Weiter beklagt er eine Ausweitung der EU-Kompetenzen, welche nicht von institutionellen Reformen begleitet würden; d.h. die EU gerät mehr und mehr in einen Zustand, den weder die Verantwortlichen, schon gar nicht die Bürger überblicken können. Die heterogener werdende Mitgliederstruktur trägt ihren Teil dazu bei (vgl. Weiler 1995: 43).
Nach der Feststellung, dass auch das Europäische Parlament als Institution seine durchaus kritischen Seiten hat, geht es nun um die Frage, inwiefern es für die Gemeinschaft legitimitätsstiftend wirken kann. Eine ausführliche und ausgewogene Behandlung dieses Themas findet sich bei Dietmar O. Reich (1999) in seiner Arbeit über ´Rechte des Europäischen Parlamentes in Gegenwart und in Zukunft´, auf die in der folgenden Betrachtung weitgehend zurückgegriffen wird.
Die demokratische Legitimation der Europäischen Union kann entweder durch die Mitgliedsstaaten selbst oder durch EU-Organe geschehen. Letzteren kommt nach Höreth in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung zu, da Legitimitätsprobleme entstehen, wenn die Nationalstaaten in Abstimmungen (z.B. im Rat) überstimmt werden und somit in ihrem Land Hoheitsakte der Union durchgesetzt würden. Es entstünde eine Legitimationslücke, da die mit dem Mehrheitsprinzip verbundene Schwächung der indirekt über die Mitgliedsstaaten vermittelten demokratischen Legitimation nicht in allen Fällen kompensiert werden konnte (vgl. Höreth 1999: 50/51). In diesem Zusammenhang kommt dem Europäischen Parlament als direkt legitimiertes Legislativorgan eine besondere Bedeutung zu, auch wenn dem von vielen Seiten widersprochen wird. Doch, so Weiler, überwiegt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass das Europäische Parlament das einzige, direkt von den Bürgern legitimierte Organ innerhalb der Europäischen Union ist (vgl. Weiler 1995: 49). Auf die Frage nach dem Beitrag des Parlamentes zur Legitimation der gesamten Union muss man vor allem drei Grundfragen beantworten, die sich auf die Unmittelbarkeit der Ableitung europäischer Hoheitsgewalt und die Repräsentationsfähigkeit des Europäischen Parlamentes, auf die Europäische Willensbildung und schließlich auf die Beteiligung des EU-Parlamentes an der Rechtssetzung der Europäischen Union beziehen (vgl. Reich 1999: 58 ff.).
Die erste Frage zielt auf das dem demokratischen Ordnungskonzept der Europäischen Union zugrundeliegende Erfordernis unmittelbar abgeleiteter Hoheitsgewaltausübung. Diese muss nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfGE 89, 155, 184=LS2) sowohl durch die mitgliedsstaatlichen Parlamente, als auch durch eine ergänzende, unmittelbar demokratische Legitimation in Form von Wahlen zum Europäischen Parlament gesichert sein. Das Europäische Parlament dient dabei als Kontrollorgan auf Unionsebene; den Vorrang zur Legitimationsbefugnis erhalten, dem Bundesverfassungsgericht zufolge, jedoch die Mitgliedsländer (BVerfGE 89, 155, 184=LS 3. a), da sie das Demokratie- und Souveränitätsprinzip, aufgrund ihrer vom Volk erworbenen Kompetenzen, repräsentieren. Diese Zurückführung der Legitimation auf ein ´Staatsvolk´ hält Reich jedoch für unangemessen – er trennt nämlich die Frage nach einem europäischen Volk deutlich von der einer demokratischen Legitimation. „Gleichermaßen, wie auf nationaler oder staatlicher Ebene demokratische Entscheidungsstrukturen unabhängig von ethnisch-kulturellen Voraussetzungen bestehen, bedarf es dieser Kriterien für eine demokratische Entscheidungsfindung in überstaatlichen Organisationen und inhomogenen, ´multikulturellen´ Gesellschaften nicht“ – so schreibt Byrde (Byrde in Reich 1999: 71). Ob auf europäischer Ebene von einem ethnisch-kulturell heterogenen oder homogenen ´Volk´ gesprochen werden kann, wird im nächsten Kapitel behandelt, an dieser Stelle liegt die Betonung auf der Differenzierung zwischen den beiden Punkten demokratischer Legitimation und Existenz eines Volkes. Reich stellt fest, dass ausschließlich die Teilhaberechte von Unionsbürgern in Form von freien, allgemeinen und unmittelbaren Wahlen ausschlaggebend für die Legitimation europäischer Hoheitsgewalt sein sollen und folgert, dass den mitgliedsstaatlichen Parlamenten für die Aufgabe dieser Legitimation kein Vorrang einzuräumen ist, das Europäische Parlament aber durch die unmittelbaren Wahlen unverzichtbar für das demokratische Organisationsprinzip der Europäischen Union ist und auch mit Blick auf ein Fehlen eines einheitlichen Wahlverfahrens etc., die Gesamtheit der Unionsbürger vertritt (vgl. Reich 1999: 72).
Der Kritik aus Reihen der Nationalstaatsbefürworter, welche ein System der ´mittelbaren´ Demokratie befürworten, kann entgegengehalten werden, dass dieses Legitimationsketten beinhaltet, welche Kontroll- und Handlungsmöglichkeiten der EU beeinträchtigen, sowie Kontroll- und Legitimationsdefizite auf EU-Ebene verursachen (vgl. Reich 1999: 60). Auch der Vorschlag einer einmaligen Abstimmung der Bürger in den Mitgliedsstaaten zu einer Legitimation europäischer Hoheitsgewalt kann als unzureichend abgewiesen werden, da der Prozess der Integration und Hoheitsgewaltausübung eine kontinuierliche Mitwirkung der Bürger erfordert. Diese kann nur in einem supranationalen Parlament ausgeübt werden, bei dem man aus organisatorischen Gründen (z.B. Minderheitenschutz, Funktionsfähigkeit, etc.) auch auf eine Zusammensetzung und Wahl entgegen der klassischen Parlamentsvorstellung verzichten könnte (vgl. Reich 1999: 62/63).
Als nächstes Kriterium des allgemeinen Demokratiekonzeptes betrachten wir die Aufgabe der Europäischen Union, einen gerechten Interessenausgleich der partikularen Interessen der Organisationsmitglieder zu finden und somit stets nach dem Gesamtwillen zu handeln. Dieses gilt vor allem hinsichtlich einer auf diesem Gebiet eventuell besonders leistungsfähigen Rolle des Europäischen Parlamentes.
Dem Europäische Parlament kommt beim Willensbildungsprozess und Konsens im gesamteuropäischen Sinne tatsächlich eine besondere Bedeutung zu. Vor allem in den Ausschüssen und Fraktionen der Institution wird ein reger Meinungsaustausch betrieben, der den gesamten Apparat der EU antreibt (vgl. Reich 1999: 73) und die ständig gleiche Zusammensetzung des Parlamentes – im Gegensatz zum Rat – trägt ebenso ihren Teil zur besseren Verständigung untereinander bei. Weiter begünstigt die Loslösung von Vorgaben durch nationale Institutionen eine autonomere Haltung der Abgeordneten, die produktivere Ergebnisse nach sich zieht. Eine Loslösung von nationalen Interessen auf supranationaler Ebene (die zwar noch keine Realität geworden ist, sich jedoch auf einem guten Weg befindet) bedeutet für Habermas eine „´vernünftige´ Willensbildung (...), demzufolge die Legitimität des Rechts auf einem ´kommunikativen Arrangement´ basiert“ (Habermas in: Reich 1999: 82). Auch das Bundesverfassungsgericht wies bereits auf die Notwendigkeit einer solchen Kommunikation hin: „Demokratie, soll sie nicht lediglich formales Zurechnungsprinzip bleiben, ist vom Vorhandensein bestimmter Voraussetzungen abhängig, wie einer ständigen freien Auseinandersetzung zwischen sich begegnenden Kräften, Interessen und Ideen, in der sich auch politische Ziele klären und wandeln und aus der heraus eine öffentliche Meinung den politischen Willen verformt“ (BVerfGE 89, 155, 185). Als Ort eines entsprechenden demokratischen Prozesses kommt im Grunde nur das Europäische Parlament in Betracht, wo auch die für die Demokratie essentiell wichtigen Diskurse zwischen EU-Bürgern und EU-Abgeordneten, sowie zwischen der supranationalen Ebene und den Parteien der Nationalstaaten Anwendung finden (vgl. Reich 1999: 86/87).
Als letzter Punkt dieses Kapitels wird im folgenden die Beteiligung des Europäischen Parlamentes an der Rechtsetzung der Europäischen Union im Hinblick auf die damit verbundene demokratische Legitimation der EU behandelt. Es stellt sich also die Frage, inwieweit die Hoheitsausübung der EU durch Rechtsetzung der Beteiligung des Europäischen Parlamentes bedarf, um demokratisch legitimiert zu sein.
Zunächst lässt sich feststellen, dass eine Organisation wie die EU mit einigen hundert Millionen Mitgliedern einer repräsentativen Demokratieform – nicht aber einer direkten Demokratie – bedarf, um den Anforderungen der Effizienz und Beschlussfähigkeit genügen zu können (vgl. Reich 1999: 88/89). Doch wieso soll das Parlament bei der Gesetzgebung auf europäischer Ebene eingebunden werden? Zwei Gründe sind in diesem Zusammenhang von fundamentaler Bedeutung: zum einen, dass dem Gebot und Ziel sachlich (relativ) richtiger Entscheidungen im Europäischen Parlament am ehesten nachgekommen wird (vgl. Alexy, in: Reich 1999: 89 und s.o.); zum anderen können die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes bei einer Aufteilung der Legislative in mehrere Kammern die Rechtsetzung kontrollieren. Die Mitwirkung des Parlamentes trägt folglich zu einer Gewaltenteilung auf EU-Ebene bei (vgl. Madison, in: Reich 1999: 90). Weitere Gründe für eine Teilnahme des Parlamentes am Gesetzgebungsprozess liegen im Unmittelbarkeitsgrundsatz, nach dem die Hoheitsgewalt unmittelbar von den Wählern abzuleiten ist; der gesamteuropäischen Entscheidungsfindung, da nur hier freie, europäische Mandatsträger involviert sind; sowie der Verhinderung von Legitimationsketten, da diese effizienten Entscheidungsstrukturen zugegen laufen. Letztlich lässt sich noch die legitimationsstiftende, demokratische Symbolik eines einflussreichen Europäischen Parlamentes anführen (vgl. Reich 1999: 104).
Die Art der Teilnahme des Europäischen Parlamentes am Rechtsetzungsverfahren der Gemeinschaft kritisieren viele Autoren als ein Demokratiedefizit der Union (vgl. Höreth 1999: 46). Auch wenn der Vertrag von Amsterdam – wie bereits in vorigen Kapiteln erwähnt – an dieser Stelle einiges zur Verbesserung der Situation beitragen konnte, werden viele Entscheidungen immer noch am europäischen und den nationalen Parlamenten vorbei beschlossen – ohne direkte oder vermittelte Legitimation durch die EU-Bürger (vgl. Schmidt, in: Höreth 1999: 46), was als schwerwiegender Verstoß gegen demokratische Grundsätze gewertet wird. Wie man also unschwer erkennen kann, werden große Hoffnungen in das Europäische Parlament gesetzt – der Vertrag von Amsterdam, welcher die Kompetenzen des Organs weiter ausbaute, kann als ein Zeichen interpretiert werden, dass diese Signale auch aufgenommen und verarbeitet werden. Doch der Sinn und die Zielsetzungen der Verträge konfligieren nicht zuletzt mit der Umsetzbarkeit in der Praxis, wo sich die Bevölkerung des zusammenwachsenden Europas noch nicht an die gemeinsamen Regierungs- und Organisationsstrukturen gewöhnt hat. Die Frage, ob man dennoch von einem ´europäischen Volk´ sprechen kann, das alle fünf Jahre zur Wahl der Abgeordneten eines supranationalen Parlamentes aufgerufen ist, soll im nächsten Kapitel behandelt werden.
IV. Gibt es ein europäisches Volk?
Die Frage, mit der sich dieses Kapitel beschäftigt heißt: gibt es ein europäisches Volk? Verknüpft mit dieser Fragestellung stellt sich gleichzeitig die Frage: gibt es überhaupt eine, allen Europäern gemeinsame, europäische Identität? Peter Graf Kieselmannsegg beschreibt die Notwendigkeit und Relevanz der Frage nach der Identität folgendermaßen: „Demokratie gründet sich immer auf eine der Verfassung vorgegebene Bestimmung ihres kollektiven Subjekts, auf eine die Individuen verbindende kollektive Identität. (...) In dem jeder demokratischen Verfassung zugrundeliegenden Axiom der Volkssouveränität steckt begrifflich und gedanklich die Prämisse, dass die Antwort auf die Frage, wer das ´Volk´ sei, von dem ´alle Gewalt ausgeht´, immer schon gegeben ist, bevor Staatsgewalt demokratisch organisiert werden kann. (...) Nur eine gemeinsame, übergreifende Identität aller Entscheidungsbetroffenen macht die Unterscheidung zwischen dem zustimmungsfähigen Entscheidungsrecht der Mehrheit und der nicht zustimmungsfähigen Fremdherrschaft möglich“ (Kieselmansegg 1992: 23). Auch wenn diese These in Expertenkreisen höchst umstritten ist, möchte ich die Frage nach einem Europäischen Volk mit dieser Frage nach dem Vorhandensein einer europäischen Identität einleiten.
a. Gibt es eine europäische Identität?
Vor der Klärung des Vorhandenseins einer europäischen Identität, sollte der Begriff Identität zunächst etwas eingehender erläutert werden. Fast polemisch zieht Pöhle in seinem Artikel „Ist eine europäische Identität unmöglich?“ über diejenigen her, die den Begriff zu unterschiedlich interpretieren und damit Verwirrung stiften. In seinen Augen unterliegt der Begriff einem höchst inflatorischen Gebrauch. Im Grundbegriff ´die vollkommene Gleichheit in Bezug auf Dinge oder Personen´ bedeutend, verwendet man ´Identität´ heutzutage für viele Umstände und Zwecke, vor allem zur Stimmungsmache gegen ein vereintes Europa und für die Beibehaltung der Nationalstaaten. Doch – so Pöhle – richtet sich eine Identität nicht nach geographischen Grenzen, sondern nach einer (oftmals) unfreiwilligen Beziehung zu einer Gemeinschaft (z.B. Familie, Region, Staat). Für ihn ist dies ein Grund, warum sich auch Verfechter der unabhängigen Nationalstaaten daran gewöhnen sollten, dass die Europäische Union in Zukunft von immer mehr Menschen als neue Einheit wahrgenommen werden wird (vgl. Pöhle 1998).
Nach dieser kurzen Betrachtung des (Miss-) Verständnisses des Begriffs ´Identität´ folgt nun der Versuch, das Vorhandensein beziehungsweise das Entwicklungsstadium einer europäischen Identität zu untersuchen:
Woyke schreibt in seinem Werk ´Europäische Union´: „Europa ist durch eine über zweitausendjährige Geschichte gekennzeichnet. Die Schwierigkeiten beginnen aber mit dem Versuch, Europa zu definieren. Im Westen endet Europa zwar am Atlantik, im Norden am Polarmeer, im Süden am Mittelmeer. Doch bereits der Süden lässt Zweifel aufkommen, ob Staaten wie Malta und Zypern zu Europa gehören. Erst recht schwierig wird eine Begriffsbestimmung von Europa, wenn man sich die östliche Grenze anschaut. Territorial grenzt Europa sicherlich am Ural. Ob Russland zu Europa gehört, ist zumindest umstritten. Doch stellt sich die Frage aus völkerrechtlicher Sicht, ob ein Staat zweigeteilt sein kann, d.h. einen Teil seines Territoriums auf dem europäischen Kontinent und einen anderen Teil seines Territoriums auf dem asiatischen Kontinent haben kann“ (Woyke 1998: 9). – Wo selbst die Frage nach einer territorialen Zuordnung der Staaten zu Europa so schwierig ist, da gestaltet sich die Frage nach einer europäischen Identität umso diffiziler. Aus diesem Grund werde ich mich in diesem Artikel primär auf diejenigen Länder beschränken, die bereits Mitglied der Europäischen Union sind, denn auf Länder, wie Russland u.a. einzugehen. Zumal eine rein territoriale Betrachtung (s. Pöhle im vorigen Absatz) das Problem der Identität nicht zu lösen vermag.
Eine kulturell geistige Einheit der Europäer (wenn ich von Europäern spreche, seien hier zunächst die Westeuropäischen Mitgliedsstaaten der EU gemeint) von der Antike bis zur Gegenwart zu erkennen, fällt sehr schwer; denn eine grenzüberschreitende Einheit würde das Bewusstsein von Zusammengehörigkeit voraussetzen (vgl. Woyke 1998: 9). Dieses Bewusstsein war zwar in einigen Epochen aufgrund der (oft kurzlebigen) Existenz großflächiger Staaten vorhanden, doch werfen wir einen Blick auf das 19. oder den Beginn des 20. Jahrhunderts, so sticht bereits ins Auge, dass die Uneinigkeiten so gravierend zu sein schienen, dass Kriege auf dem europäischen Kontinent ´an der Tagesordnung´ waren. Trotzdem lässt sich konstatieren, dass die Westeuropäischen Staaten – der sogenannte Okzident – das Christentum und seit der französischen Revolution von 1789 die allgemeinen Menschen- und Freiheitsrechte internalisierten. Es bildete sich eine Art westeuropäische kulturelle Tradition, die – vor allem nach dem 2. Weltkrieg – dazu beitrug, die Westeuropäer zusammenzubringen und schließlich in der EG und späteren EU zusammenkommen zu lassen (vgl. Woyke 1998: 9). Heute – im Zuge der Osterweiterung – erkennt man die Unterschiede in Religion, Kultur und Weltanschauung, die Hindernisse, zum Beispiel bei der Aufnahme der Türkei in die EU, darstellen. Doch trotz der kulturellen Verbundenheit der westeuropäischen Staaten, ist Europa immer noch gekennzeichnet durch seine Zerstückelung und Vielfältigkeit (was in diesem Zusammenhang keineswegs negativ zu interpretieren ist) (vgl. Schulze 1999: 49/50) und folglich ist man unter dem Gesichtspunkt der europäischen Identität heute noch weit davon entfernt, ein europäisches Staatsvolk auszumachen (vgl. Schwarzer 2001). „Dennoch“ – so Schwarzer – „gibt es, knapp fünf Jahrzehnte nach der Gründung der EU, ein europäisches Identitätsgefühl – einen Wunsch nach Zusammenhalt, der sich trotz aller Kritik in der solidarischen Zahlungsbereitschaft der reichen Mitgliedsländer zeigt“ (Schwarzer 2001). Natürlich ist besonders die letzte Aussage über die Zahlungsbereitschaft – gerade bei der derzeit anhaltend schlechten Konjunktur – mit Sicherheit nicht unumstritten und eventuell auch mit einigen Beispielen zu widerlegen, doch der Weg zu einer europäischen Identität scheint – wie bereits beschrieben – bereits durch die Geschichte und Religion vorgeprägt (vgl. auch: Europa-Union Deutschland 1995: 3). Kurz- und mittelfristig wird in Europa jedoch aus verschiedenen Gründen noch der nationale Identitätsgedanke vorherrschen – heute bezeichnen sich lediglich vier Prozent der EU-Bürger als Europäer, im Gegensatz zu 40 Prozent, die sich als ´national´ definieren, und auch die Parlamentarier in Brüssel und Straßburg werden immer noch als nationale Repräsentanten interpretiert (vgl. Schwarzer 2001).
Auf dem Wege zu einer europäischen Identität – so stellt die Europa-Union Deutschland fest – bedarf es eines Zielkatalogs, den sie folgendermaßen umreißt:
Europa braucht
- „eine knapp gefasste und verständliche Verfassung der Europäischen Union, die die gemeinsame föderale Ordnung, einen verbindlichen Katalog der gemeinsamen Grund- und Menschenrechte sowie Sozialrechte garantiert und den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union zur Annahme vorgelegt wird;
- den weiteren Ausbau der Unionsbürgerschaft;
- eine gemeinsame Wirtschafts-, Währungs-, Sozial- und Umweltpolitik, deren oberstes Ziel sein muss, Arbeit für alle zu schaffen und unsere Erde vor weiterer Umweltzerstörung bewahrt;
- eine die europäische Identität fördernde Kultur- und Bildungspolitik der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten, die die Einheit in Vielfalt und die gemeinsamen Werte allen Bürgerinnen und Bürgern vermittelt. Europäer ist man nicht von Geburt, sondern wird es durch Bildung;
- die Mehrsprachigkeit fördern. Alle Europäer müssen möglichst frühzeitig Fremdsprachen erlernen. Die Unionsbürger müssen sich verständigen können.
- eine Deklaration der politischen Ziele, die die Europäische Union anstrebt. Ohne das vielgestaltige Erbe zu beschädigen, muss die Europäische Union in der Welt eine gemeinsame Politik betreiben“ (Europa-Union Deutschland 1995: 5/6).
Erst wenn dieser Katalog von Rechts-, Wirtschafts- und Bildungszielen in die Tat umgesetzt würde – so die Verfasser der ´Charta der europäischen Identität´ – könne diese Identität Wirklichkeit werden und zu einem weiteren Zusammenwachsen Europas führen.
Wir haben also festgestellt, dass die Europäer auf einem guten Weg, aber noch weit davon entfernt sind, eine einheitliche Identität auszubilden. Sie sehen sich zu einem großen Prozentsatz als ´Nationale´ und ihre Abgeordneten im EU-Parlament als Vertreter ihres Staates. Problematischerweise interpretieren die Parlamentarier selbst ihre Rolle oft ebenso. Es stellt sich also die Frage, ob man, ohne dass es überhaupt eine ausgeprägte gemeinsame Identität gibt, von einem ´europäischen Volk´ sprechen kann, bzw. was ein ´europäisches Volk´ überhaupt ausmachen könnte. Diesem Problem soll nun nachgegangen werden.
b. Kann man von einem europäischen Volk sprechen?
„Europa“ – so Schwarzer – „wird nie ein Volk im homogenen, nationalstaatlichen Sinne des Bundesverfassungsgerichts haben“ (Schwarzer 2001). Diese These zu bestätigen oder zu widerlegen, wird man wohl erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten vermögen; doch die Frage, wie die Lage heute aussieht und auf welchem Wege wir uns befinden, soll im Folgenden besprochen werden.
Der Begriff des Volkes lässt sich aus zwei Perspektiven heraus definieren – zum einen im soziologischen Sinne, zum anderen unter Hinzuziehung des Begriffes der ´Staatsangehörigkeit´ im juristischen Sinne (vgl. Suski 1996: 39).
Soziologisch ist ein Volk „jene Gesamtheit von Menschen, die sich durch ein nationales Zusammengehörigkeitsgefühl verbunden weiß“ (Simson 1991: 2). Was dieses Gefühl ausmacht, beruht jedoch auf einer Reihe von Faktoren, die zu erfassen von Mal zu Mal unterschiedlich ist. Manchmal resultiert ein Zusammengehörigkeitsgefühl aus einem einzigen, manchmal aus einer Reihe von Faktoren, wobei keiner für die Existenz dieses Gefühls unentbehrlich ist. Aus diesem Grunde fällt es schwer, eine eindeutige Aussage über die Existenz eines ´Volkes´ im soziologischen Sinne zu treffen – lediglich anhand von Umfragen könnte man diesbezüglich Einschätzungen vornehmen (Suski 1996: 40) und auch dabei variieren die Ergebnisse je nach Perspektive. Dementsprechend ist das Zusammengehörigkeitsgefühl relativ und bezogen auf die Europäische Union unter Soziologen umstritten (Suski 1996: 41). Ein weiteres soziologisches Kriterium für ein ´Volk´ ist, dass es der Staatsgründung nicht vorausgehen muss. „Die Schaffung einer Einheit kann umgekehrt einen emotionalen Zusammenhalt bewirken oder stärken“ (Zippelius, in: Suski 1996: 41). Doch diese eher wage soziologische Akzentuierung des Zugehörigkeitsgefühls bei der Definition des Volksbegriffs bedarf aufgrund ihrer Relativität einer juristisch erfassbaren Gemeinschaft. Die juristische Definition soll den soziologischen Begriff nicht ersetzen, sondern in juristisch handhabbare Form bringen und somit eine Grundlage für einen Vergleich oder eine Stellungnahme stellen (vgl. Suski 1996: 41/42).
„Unter dem ´Volk´ im juristischen Sinne ist die Gesamtheit der Angehörigen des betreffenden Staates zu verstehen“ (Besier, in: Suski 1996: 41). Ein ´Staatsangehöriger´ ist folglich lediglich durch die formale Zugehörigkeit zu einem Staat definiert. Der Begriff des ´Volkes´ muss jedoch von dem Begriff der ´Staatsbürgerschaft´ unterschieden werden, die eine aktive Partizipation des Bürgers an der Ausübung staatlicher Herrschaft vorsieht (vgl. Suski 1996: 42). Des weiteren definiert sich der Volksbegriff in Abgrenzung zum Begriff des ´Fremden´. Wer also nicht zu den Staatsangehörigen zählt, ist ein ´Fremder´ und somit rechtlich anders gestellt – näheres bestimmen die Regeln des jeweiligen Staates.
Nach der juristischen Klärung des Volksbegriffes als solcher soll nun die Beantwortung der Frage, ob es ein ´europäisches Volk´ gibt, begonnen werden, wobei zwischen dem Merkmal des ´Staatsangehörigenstatus´ und dem ´Volk im funktional-demokratischen Sinne´ differenziert wird. Ersterer Punkt zielt auf den juristische Sachbestand eines Volkes; letzterer will untersuchen, ob für die Teilbereiche, die für die Ausübung der Volkswillens entscheidend sind, eine Gleichheit zwischen den Unionsbürgern besteht, die ein demokratisches europäisches System rechtfertigt. Die beiden folgenden Absätze orientieren sich vor allem an der Arbeit von Birgit Suski aus dem Jahr 1996, da diese mir – auch aufgrund der verarbeiteten Literatur – als die ausführlichste und einleuchtendste in der Behandlung dieses Problems schien.
b.1. Der Status der ´Staatsangehörigkeit´
Der Status der ´Staatsangehörigkeit´ wird von Grabitz durch folgende Faktoren definiert: „Die Allgemeinheit, die Unmittelbarkeit, die exterritorial wirkende Personalhoheit, und die Gleichheit“ (Grabitz, in: Suski 1996: 45). Diese Punkte sollen zunächst näher beleuchtet werden.
Suski definiert die ´Staatsbürger´ unter dem Aspekt der ´Allgemeinheit´ als diejenigen Menschen, „die nach ´allgemeinen´ nationalen Normen eines Staates diesem zugerechnet werden“ (Suski 1996: 48). Den gemeinschaftlichen Status der Bürger in der Europäischen Union sieht Suski deshalb als gegeben an, weil es unter die Gemeinschaftsnormen subsummiert wird. Problematisch ist jedoch, dass sich der Status an bestimmten ökonomischen Funktionen der Personen orientiert. Wer diese Funktionen ausübt, fällt jedoch unter die Gemeinschaftsnormen, was auf ein allgemeines Gemeinschaftsrecht in der EU hinweist. Gleichzeitig ist bereits die potentiell privilegierte oder andersartige Stellung einer Person aufgrund seiner Mitgliedschaft zu einem EU-Land ein Grund, das Recht, welches sein Handeln in einem eventuell eintretenden Fall betreffen könnte, als allgemein bezeichnen zu können (vgl. Suski 1996: 49/50). Weiter liegt in der Allgemeinheit der Staatsbürgerrechte in den Einzelstaaten der EU die Grundlage, die eine Allgemeinheit in der Gemeinschaft selbst mit sich zieht, weil sich die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft über die Zusammenfassung der Staatsangehörigen manifestiert (vgl. Suski 1996: 51). Mit der Einführung der Unionsbürgerschaft nach Art. 8 Abs. 1 EGV, die sich an der Mitgliedschaft zu einem Mitgliedsstaat orientiert, wurde die Stellung des Unionsbürgers in dieser Hinsicht nicht verändert.
Der nächste Faktor, welcher einen ´Staatsangehörigen´ charakterisiert ist jener der ´Unmittelbarkeit´ – also vor allem „die allgemeine Unterworfenheit der natürlichen Personen, die Angehörige der Mitgliedsstaaten sind, sowie deren Unternehmen, Unternehmensvereinigungen und Gesellschaften unter die unmittelbare Geltungskraft der Verordnungen der EG und EAG, der allgemeinen Entscheidungen der EGKS sowie der Entscheidungen, die an einzelne gerichtet sind“ (Suski 1996: 54). Da die Einzelstaaten zwar ihre eigenen Staatsangehörigen bestimmen können – jedoch den damit verbundenen Unionsbürgerstatus nicht aberkennen können und weil diese Unionsbürger der übergeordneten Rechtssprechung der EU dann direkt untergeordnet sind, kann man von einer Unmittelbarkeit zwischen Gemeinschaft und Unionsbürger sprechen – dieser Punkt kann für die Bürger der Europäischen Union also positiv beantwortet werden. Ausschlaggebend für die das Kriterium der ´Unmittelbarkeit´ ist nämlich nur, dass unmittelbare Rechtsbeziehungen bestehen – nicht jedoch, wie diese entstanden. Da in der Union also unmittelbare Rechtsbeziehungen zu den Einzelstaatsangehörigen bestehen, scheitert die Staatsangehörigkeit nicht an diesem Punkt (vgl. Suski 1996: 61).
Die ´ exterritorial wirkende Personalhoheit´, welche als drittes Kriterium für eine Staatsangehörigkeit zur Europäischen Union aufgeführt wurde, zeigt ein weiteres Problem auf: In der Regel ist der Staatsangehörige von seinem Staat auch dann mit Rechten und Pflichten ausgestattet, wenn er sich außerhalb des Staatsgebietes aufhält. In den Gründungsverträgen der EG sind jedoch auf den ersten Blick keine derartigen Regelungen, wie diplomatischer Schutz oder ähnliches, enthalten. Doch tatsächlich gewährt die Union in diesem Fall beispielsweise subsidären Schutz – sollte also der Heimatstaat keine Vertretung in dem betreffenden Drittland unterhalten, so schreiten andere EU-Staaten als Vertreter der Rechte des Unionsbürgers ein. So ist zwar das Recht des Einzelnen durch die Ausweitung der Personalhoheit eines einzelnen Staates auch im Ausland geschützt, die EU selbst begründet damit aber keine eigene direkte exterritoriale Rechtspflicht. In anderen Fällen – wie zum Beispiel dem Wahlrecht – ist die Rechtslage ebenso verzwickt. Da sich beispielsweise das Wahlrecht zum EU-Parlament an die nationalen Wahlrechte koppelt, haben Franzosen und Spanier im Gegensatz zu anderen Staaten deutlich bessere Möglichkeiten, ihre Stimme abzugeben – nach ihren Gesetzen ist die Stimmabgabe von jedem Ort der Welt aus möglich. Folglich besteht in diesem Bereich nur für einige Angehörige von Mitgliedsstaaten ein Rechtsstatus, der auch außerhalb des Gemeinschaftsterritoriums seine Wirkung entfaltet (vgl. Suski 1996: 63).
Als letzten Punkt betrachten wir an dieser Stelle das Kriterium der ´ Gleichheit´, welches für Suski das wichtigste Kriterium im Zusammenhang mit dem Staatsangehörigenstatus darstellt. Gleichheit begründet sich rechtlich vor allem in der Homogenität der einzelnen Individuen, was historisch seit der Abschaffung der Stände wesentlich einfacher zu differenzieren ist. Ausschlaggebend ist nämlich wieder einmal die rechtliche Abgrenzung der Staatsangehörigen zu den ´Fremden´ – es herrscht also Gleichheit, wenn alle Bürger eines Staates gegenüber Fremden gleich behandelt werden (vgl. Suski 1996: 66). Die Diskriminierungsverbote des Gemeinschaftsrechts der Europäischen Union stellen diese Gleichbehandlung sicher – „eine Gleichbehandlung, wie sie den jeweiligen Staatsangehörigen in ihren Mitgliedsstaaten zukommt, kann jedoch nicht konstatiert werden“ (Suski 1996: 67), da sich der Vertrag größtenteils auf wirtschaftliche Belange konzentriert. Auch die jüngsten Erweiterungen des Gleichbehandlungsgebots auf Bereiche wie z.B. das Schulwesen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Diskriminierungsverbote nur im Rahmen des Vertrages gelten und die Gleichbehandlung der Individuen auch nach dem EU-Vertrag größtenteils nur in seiner Rolle als Wirtschaftsfaktor auf Gemeinschaftsebene greift (vgl. Suski 1996: 67/68/69). Das Kriterium der Gleichheit ist in den letzten Jahren zwar immer weiter ausgebaut worden, doch noch immer nicht in allen Mitgliedsstaaten ohne Einschränkung verwirklicht (z.B. House of Lords- Sitze in Großbritannien größtenteils vererbbar).
Aufgrund dieser Kriterien kann man das Merkmal der Staatsangehörigkeit und damit auch den Volksbegriff auf die Europäische Union derzeit als noch nicht hinreichend erfüllt bezeichnen. „Zwar fehlt es nicht an den Erfordernissen der Allgemeinheit sowie der exterritorialen Personalhoheit. Auch ist das Kriterium der Unmittelbarkeit (...) erfüllt. Jedoch bewirkt der nach wie vor bestehende Polizeivorbehalt Diskriminierungen zugunsten der öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit. Mithin fehlt es an der Gleichstellung aller Angehörigen der Mitgliedsstaaten“ (Suski 1996: 72). Im nächsten Teil soll untersucht werden, ob die eingeforderte Gleichheit denn zumindest für die Teilbereiche der Europäischen Union erfüllt ist, die für die Ausübung des Volkswillens und damit für die Demokratie unabdingbar sind – in denen der Bürger also zur politischen Entscheidung beiträgt.
b.2. Das Volk im funktional-demokratischen Sinne
Auch in diesem Punkt hebt Suski – wie gesehen – die Gleichheit als einen zentralen Punkt hervor, sie schreibt: „Demokratie und Gleichheit gehören aufs engste zusammen“ (Suski 1996: 73). Es gilt also, eine Untersuchung in Richtung auf die Ausgestaltung der diesbezüglichen Rechtspositionen auf europäischer Ebene vorzunehmen, wobei zwischen den ´aktivbürgerlichen Rechten´ und den ´politischen Grundrechten´ unterschieden werden soll. Die aktivbürgerlichen Rechte sind wiederum in das ´Wahl- und Stimmrecht´ und den ´Zugang zu öffentlichen Ämtern´ gegliedert, mit denen im Folgenden begonnen werden soll.
Nach Art. 8b EGV hat jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, sogar das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen und den Wahlen zum Europäischen Parlament. Da aber in Hinblick auf die Wahl zum Europäischen Parlament Ausnahmeregelungen aufgrund besonderer Probleme eines Mitgliedsstaats vorgesehen sind, kann man nicht mehr von einer völligen Gleichstellung des „(Auslands-) Unionsbürgers“ (Suski 1996: 80) sprechen. Gleiche Wahlen zum Europäischen Parlament werden dadurch und durch den nach wie vor ungleichen Proporz (s.o.) nicht möglich. Der Proporz gesteht Luxemburg eine statistisch positive Abweichung von 600% zu; Deutschland ist statistisch 24% unterrepräsentiert. So lange die kleinen Staaten als schützenswerte Minderheiten gesehen werden, lässt sich diese gewisse Ungleichheit zwar rechtfertigen (Luxemburg stellt trotzdem nicht einmal 1% aller Parlamentarier); sollte jedoch ein homogeneres europäisches Volk entstehen und die Parlamentarier ihre Arbeit nicht mehr national- sondern parteiorientiert betrachten, könnte zumindest diese Proporzregelung zugunsten der Gleichheit überdacht werden (vgl. Suski 1996: 81/82). Bis dahin muss man der Union die Erfüllung des Gleichheitsgrundsatzes bei der Wahl zum Parlament zumindest graduell absprechen.
Der Zugang zu öffentlichen Ämtern gestaltet sich als ein kompliziertes Untersuchungsproblem, da die Wahrnehmung der gemeinschaftlichen Aufgaben nicht im alleinigen Kompetenzbereich der Gemeinschaftsorgane liegt. Man ist demnach gezwungen, nach dem Zugang zu Ämtern der Europäischen Union und in den Mitgliedsländern zu unterscheiden. Auf EU-Ebene stellt Suski fest, dass „der Zugang zu öffentlichen Ämtern gewährleistet ist, aber durch einen Nationalitätenproporz eingeschränkt wird“ (Suski 1996: 86). Da dieser jedoch der gerechten Verteilung und Kontrolle nationaler Einflüsse dient, sei dies gerechtfertigt. Auf nationaler Ebene besteht kein Anspruch auf Zugang zu den öffentlichen Ämtern, die hoheitliche Befugnisse umfassen, da der EG-Vertrag (und dann auch der EU-Vertrag) von der Gewährleistung beruflicher Freiheit und Gleichheit die Beschäftigung in der ´öffentlichen Verwaltung´ ausnimmt. Neben der Einschränkung des Nationalitätenproporzes stellt diese Regelung die zweite Restriktion im Hinblick auf den Zugang zu Ämtern der EU dar. Die aktivbürgerliche Rolle des Unionsbürgers – folgt Suski – reicht in ihrem Ausmaß somit nicht an die des nationalen Bürgers heran (vgl. Suski 1996: 87/88).
Die politischen Grundrechte als zweites großes Charakteristikum für ein Volk im funktional-demokratischen Sinne manifestieren sich vor allem in den Grundrechten der Meinungs-, Presse-, Informations-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Diese unterstehen den Vorbehaltsgründen der öffentlichen Sicherheit, was im Falle einer Gefährdung der inneren Sicherheit des Aufenthaltsstaates durch einen ´Ausländer´ aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat (EU-Ausländer) zu einer Ausweisung oder einem Verbot seiner Tätigkeit führen könnte (vgl. Suski 1996: 88/89). Es besteht also auch in dieser Hinsicht immer noch eine stärkere Bindung der Person an sein Heimatland, als an die Gemeinschaft – ein ´Volk´ im funktional-demokratischen Sinne ist somit ebenfalls nicht zu erkennen.
c. Folgerung
Wie man also erkennen kann, ist die Europäische Union noch weit davon entfernt, eine einheitliche Identität zu entwickeln, geschweige denn ein ´einig Volk´ zu werden. Weder die zahllosen gemeinsamen historischen, rechts- und kunstgeschichtlichen Wurzeln aller europäischen Völker noch die Notwendigkeit zur solidarischen Bewältigung der Zukunft dürften bisher ein ausreichend intensives Gefühl der Zusammengehörigkeit ausgeprägt haben, zumal notwendige juristische Bestandteile noch fehlen. Außerdem gibt es keine eigenständige ´öffentliche Meinung´ der EU, sondern fünfzehn nationale. Zu viele Differenzen hinsichtlich der Mentalitäten, der Lebensbedingungen, aber auch der unterschiedlichen Rechtsstellungen in den Mitgliedsstaaten sind für die Tatsache verantwortlich, dass Europapolitik und europäische Identität noch stark ´nationallastig´ ausgeprägt sind. –
Das letzte Kapitel dieser Arbeit soll ein Fazit ziehen und dabei herausstellen, was das Europäische Parlament zur Legitimität der gesamten Union beiträgt und darüber hinaus, welche Probleme sich aus dem soeben herausgearbeiteten Problem der (Noch-) Nichtexistenz eines identifizierbaren europäischen Volkes ergeben.
VI. Resümee und Ausblick:
Das Europäische Parlament besitzt – wie wir gesehen haben – für viele Experten eine bedeutende Funktion im strukturellen Aufbau der Europäischen Union. Es hat seine zunächst sehr reduzierten Funktionen und Einflussmöglichkeiten im Verlauf der Jahre qualitativ und quantitativ erheblich ausweiten können und hat sich so zu einer Institution entwickelt, die vom Rat und der Kommission in vielen wichtigen Bereichen nicht übergangen werden kann und somit wirkungsvolle Kontrollrechte ausübt. Von diesen wurde bereits des öfteren Gebrauch gemacht – zum ersten Mal in wirkungsvoller Weise, als der Haushaltsplan für das Jahr 1976 vom Parlament abgelehnt wurde. Seine Stellung wird durch die Debatte um die Legitimität der Hoheitsgewaltausübung durch die Organe der Europäischen Union noch weiter verstärkt.
Insofern mag es verwundern, wenn die Frage aufkommt, inwieweit das Europäische Parlament überhaupt als echtes ´Parlament´ bezeichnet werden kann – da es doch noch weit davon entfernt sei, ein Volk zu repräsentieren. Smith stellt sogar fest, dass EU-Organe formale Legitimität genießen, jedoch durch einen Mangel an politischer und sozialer Legitimität charakterisiert sind (vgl. Smith 1999: 150) – Röper bietet in diesem Zusammenhang eine Antwort an, er schreibt: „Kein Volk schuf je sich seinen Staat. Immer gründeten ihn Fürsten, Diktatoren, Eroberer oder Kolonialherren auf zusammenerobertem oder -geheiratetem Gebiet. Zentralisierung und Hierarchisierung der Macht schaffen kollektive Identitäten, als institutionelle Vergemeinschaftung wachsen sie auch willkürlichen Grenzen nach. Mit oder ohne gemeinsame Sprache wird die Bevölkerung zum Volk; gemeinsame Sozialisation entwickelt völkische Eigenschaften“ (Röper 2002). Ein Volk entsteht also erst durch eine Zusammenfassung seitens der Regierungen. Beispiele dafür finden sich zuhauf – als prominenteste Vertreter dieser These können die Schweiz und die USA angeführt werden. In der Schweiz – die unbestritten als souveräner Staat zu betrachten ist – identifizieren sich Großteile der Bevölkerung zunächst mit ihrer Gemeinde, dann mit dem Kanton und erst an dritter Stelle mit dem Staat. Und dennoch spricht man von den ´Schweizern´ und wohl kaum jemand käme auf die Idee, der Schweiz ihre Staatlichkeit absprechen zu wollen. In den USA verhält es sich ähnlich: an den Präsidentenwahlen nehmen in der Regel nur etwa die Hälfte aller Wahlberechtigten teil – bei den Kongresswahlen ist es nur etwa ein Viertel. Und auch die Tatsache, dass im Westen und Süden des Staates die Wahlkämpfer ihre Reden zum Teil auf spanisch schwingen, ist kein Indiz für das Nichtvorhandensein eines amerikanischen Volkes (vgl. Röper 2002). „Zu verlangen, EU-Europa müsse ein ´Volk´ sein, bevor Dieter Grimm (Bundesverfassungsrichter, Anm.d.Autors) ihm Staat und Verfassung zugesteht, verkennt die Staatswerdungsprozesse“ (Röper 2002), folgert Röper. Der Staat wächst zusammen, indem er von der Regierung zusammengefasst wurde – und so könnte es auch mit Europa weitergehen. Die Tendenzen sind dabei schon deutlich zu erkennen:
Zum einen in dem Bedeutungsverlust der Nationalstaaten. Ausgreifende Wirtschaftsräume, Verteidigungsfragen, Verbrechensbekämpfung, Organisation der Verkehrs- und Kommunikationsnetze und – nicht zu vergessen – Umweltfragen werden heutzutage bereits in großem Rahmen supranational behandelt (vgl. Schulze 1999: 73).
Zum anderen im Zusammengehörigkeitsgefühl. Eine ´europäische Identität´ ist – wie wir gesehen haben, noch in ihren Anfängen begriffen, doch nimmt die Zahl derer zu, die in ihren Berufen, Ehen oder anderer Beziehung von dem Zusammenwachsen auf Regierungs- und Wirtschaftsebene profitieren. Vor allem in den kleinen Staaten, wie Luxemburg, hat die Europäische Union in vielen Bereichen einen immensen Bedeutungszuwachs erfahren – hier fallen die Veränderungen und das Zusammenwachsen der Nationen am ehesten ins Gewicht. Dies führt zu einer verstärkten Identifikation mit der Staatengemeinschaft und lässt für die Zukunft einiges erwarten (vgl. Pöhle 1998: 12).
Da man also auf politischer, wirtschaftlicher, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene ein – wenn auch manchmal zögerliches – Fortschreiten an Akzeptanz und Unterstützung der Europäischen Union und deren Organe erkennen kann, so wird die von Röper angeführte These von einem durch die Regierung geschaffenes Volk untermauert.
Die Beantwortung der Frage, ob das Europäische Parlament ein Volk entbehrt, muss zwar zunächst bejaht werden, doch ist dieses Volk – wie gesehen – für die Existenz des Organs nicht notwendig. Das Parlament bezieht seine Legitimität vor allem aus dem Umstand der direkten Wahl seiner Abgeordneten durch die Bevölkerung und kann diese – sofern es an politischen Entscheidungen beteiligt wird – auf die anderen Organe übertragen. Somit lässt sich entgegen aller Kritik, die von zu wenig Einfluss bis zu der Entbehrung eines einheitlichen Wahlsystems reicht, feststellen, dass das Europäische Parlament seiner Aufgabe und seinem Ziel sukzessive gerecht wird: es vereint die Bürger der Nationalstaaten in einem Gremium mit weiter wachsendem Einfluss und mit ihm wächst – wie die gesamte Organisation – das ´Projekt´ der Europäischen Union. Wenn am 1. Mai 2004 die Osterweiterung der Europäischen Union Realität wird, hat das Europäische Parlament in seinem Wachstumsprozess einen weiteren großen Schritt nach vorne gemacht – vor allem, weil dann weitere Millionen Menschen mit ihrer Stimme in dem Organ vertreten sind.. Was das für die Thematik der europäischen Identität und die Herausbildung eines europäischen Volkes bedeutet, lässt sich bislang noch nicht sagen. Die neuen großen Herausforderungen, die auf allen Ebenen entstehen und ihre kaum überschaubaren komplexen Wirkungszusammenhänge lassen für Befürchtungen wie Hoffnungen jegliche Spielräume. Eine Einheit Europas und damit verbunden ein Parlament, das eine homogene Einheit von Menschen repräsentiert, kann allerdings auch nicht Sinn der Europäischen Union sein, weil es Europa verkennen würde. Der Kontinent, der eigentlich nur aufgrund seiner besonderen topographischen, historischen und kulturellen Rolle, nicht aber aufgrund seiner Landmasse als eigener Kontinent gilt (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 14.12.02: 2), ist ein Kontinent, der historisch viele Konflikte und Unterschiede seiner – sich permanent wandelnden – Staaten offenbarte. „Nichts ist so europäisch wie Europas Zersplitterung in Nationalstaaten“ (Schulze 1999: 49), meint Hagen Schulze und bezeichnet die Vielfalt in der Einheit als Charakteristikum Europas. Diese – so Schulze – zeigt sich auf allen Ebenen: „Das beginnt mit den Landschaften: Gebirge, Ebenen, Seenplatten, Wald- und Heidelgebiete, die sich in Asien, in Amerika oder Afrika gleichförmig über immense Weiten erstrecken, liegen in Europa nahe beieinander. Daher auch die bunte Vielfalt der Art, wie die Menschen den Boden nutzen, ihre Nahrungsmittel erzeugen, Häuser, Städte und Straßen bauen. Nicht anders die Sprachen Europas; gewiss ist das Indoeuropäische gemeinsamer Sprachengrund fast aller europäischen Idiome, aber die sprachliche Fragmentierung, von den großen slawischen, lateinischen und germanischen Sprachfamilien bis hinunter in die regionalen Dialektabweichungen, ist der wichtigste Grund für die bleibende Vielfalt der Regionen, Völker und Staaten und für die Hindernisse, die einem einheitlichen Europa entgegenstehen“ (Schulze 1999: 49). Die Vielfalt der europäischen Völker sorgte in der Geschichte letztendlich dafür, dass sich große, dominante Staaten auf Dauer nicht halten konnten, sondern immer wieder zu kleineren zusammenfielen. Die Staatenwelt Europas stellt demnach eine dauerndes und entscheidendes Charakteristikum des Kontinents dar, in dem Streit und Antagonismus dazugehörten (vgl. Schulze 1999: 50/51). Insofern passt das Europäische Parlament ins Bild – es repräsentiert die gesamte Vielfalt der Bürger und – im Idealfall – nicht der Staaten, wodurch diese Antagonismen und Streitigkeiten auf politischer Bühne beigelegt werden können und die das Schlachtfeld zu einem historischen Schauplatz verkümmern lassen. Gleichzeitig repräsentiert das Europäische Parlament als Organ der Europäischen Union die Kraft des zersplitterten Kontinents nach außen. Wenn diese in wirtschaftlicher, politischer, kultureller und sozialer Hinsicht geschickt und sinnvoll eingesetzt wird, so kann dies für alle Bürger der Gemeinschaft einen Gewinn mit sich bringen und somit das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. Vielleicht erwächst aus diesem Gefühl dann doch ein Zusammenhalt und eine Identität auf gesellschaftlicher Ebene, so dass man in ferner Zukunft einmal von einem Europäischen Parlament mit einem europäischen Volk sprechen kann.
VII. Literaturliste:
- BpB (Bundeszentrale für politische Bildung) (Hrsg.) 1995: Europäische Union, München: Franzis´ print&media
- Brok, Elmar: Ein Jahr nach Amsterdam: Verfassungsperspektiven der Europäischen Union auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, auf http://www.rewi.hu-berlin.de/WHI/tagung98/brok/brok.doc, Stand: 2.12.02
- Bündnis90/Die Grünen: “Post Nizza” 2001 – Europa gemeinsam vertiefen, auf http://www1.europarl.eu.int/forum/greens-efa/dispatch.cgi/greenefaparlconf/showFile/100007/d20010705103229/No/.version1.doc, Stand: 30.11.02
- EGV: Konsolidierte Fassung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
- Europa-Union Deutschland 1995: Charta der europäischen Identität, auf: www.europa-web.de/europa/02wwswww/203chart/chartade.htm, Stand: 28.11.02
- EUV: Konsolidierte Fassung des Vertrages über die Europäische Union
- Höreth, Marcus 1999: Die Europäische Union im Legitimationstrilemma: Zur Rechtfertigung des Regierens jenseits der Staatlichkeit, Baden-Baden: Nomos
- Kieselmannsegg, Peter Graf 1992: Lässt sich die Europäische Gemeinschaft demokratisch verfassen?, in: Europäische Rundschau 22 (1992), S. 22-33
- Maurer, Andreas: Europäisches Parlament, in: Weidenfeld, Werner/ Wessels, Wolfgang (Hrsg.) 2002: Europa von A bis Z, Bonn: Europa Union Verlag
- Narr, Wolf-Dieter: Das demokratische Fiasko der EU, in Schlüter-Knauer, Carsten (Hrsg.) 1997: Die Demokratie überdenken, Berlin: Duncker und Humblot
- Pöhle, Klaus 1998: Ist europäische Identität unmöglich?, auf: http://www.fes.de/ipg/ipg3_98/artpoehle.html, Stand: 2.12.02
- Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Europäisches Parlament, auf http://www.adicor.de/europa.nsf/34ff2f82bed5217ac12566de0057818e/50428b16c1b2ad0ec1256700004aeb4b!OpenDocument, Stand: 2.12.02
- Reich, Dietmar O. 1999: Rechte des Europäischen Parlaments in Gegenwart und Zukunft, Berlin: Duncker und Humblot
- Röper Erich 2002: Staaten schaffen Völker, nicht Völker Staaten, auf: http://www.oeko-net.de/kommune/kommune12-99/TROEPER.htm, Stand: 28.11.02
- Smith, Julie 1999: Europe´s elected Parliament, Sheffield: Sheffield Academic Press Ltd.
- Scharf, Fritz W. 1999: Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch?, Frankfurt/New York: Campus
- Schulze, Hagen: Europa: Nation und Nationalstaat im Wandel, in: Weidenfeld, Werner (Hrsg.) 1999: Europa-Handbuch, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung
- Schwarzer, Daniela 2001: Regieren jenseits des Volkes, in: Financial Times Deutschland, Ausgabe vom 14.06.2001
- Simson, Werner von 1991: Was heißt in einer europäischen Verfassung "Das Volk"?, EuR 1991, 1 ff
- Suski, Birgit 1996: Das Europäische Parlament: Volksvertretung ohne Volk und Macht?, Berlin: Duncker und Humblot
- Tsatsos, Dimitris Th. 2000: Der Vertrag von Nizza – Ein Fehlschlag, der nur durch einen effizienten und konkretisierten Post-Nizza-Prozess korrigiert werden kann, auf: http://europa.eu.int/futurum/documents/contrib/doc080101_de.pdf, Stand: 27.11.02
- Weiler, Tobias 1995: Das Europäische Parlament und die Forschungs- und Technologiepolitik der EU, Baden-Baden: Nomos
- Woyke, Wichard 1998: Europäische Union: erfolgreiche Krisengemeinschaft, München: Oldenbourg
- Arbeit zitieren
- Benjamin Miethling (Autor:in), 2002, Das Europäische Parlament - Parlament ohne Volk?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109139
Kostenlos Autor werden

















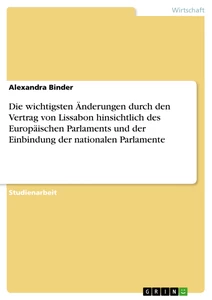




Kommentare