Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Umrisse von Sellars’ Theorie
3. Umrisse von Brandoms Theorie
4. Sellars’ Ansatz
5. Brandoms Ansatz
6. Schluss
7. Verwendete Literatur
1. Einleitung
Seitdem sich einige Philosophen entschlossen haben, den allgemein anerkannten Dualismus von Körper und Geist aufzugeben und ihn wie Ryle1 als „Mythos vom Gespenst in der Maschine“ zu brandmarken, sind (zumindest für diese Philosophen) einige wichtige philosophische Probleme verschwunden (z.B. das der mentalen Verursachung: Wie kommt es, dass mein Arm sich rührt, wenn ich es will? Oder die Frage: Wie gelangen Bilder aus dem Auge in den Geist? usw.) und andere völlig neu hinzugekommen: Infolge des Verzichts auf den Geist oder die Seele als eigenständige Instanz (oder sogar Substanz), mithilfe derer sich mentale Phänomene wie Gedanken, Wünsche, Erinnerungen oder Gefühle relativ einfach erklären ließen, tauchten Fragen auf, die zuvor nicht hatten gestellt werden müssen, z.B.: Was sind Klugheit, Ehrgeiz, Freundlichkeit oder Willensstärke, wenn nicht einfach Eigenschaften der Seele der betreffenden Person? Wie erklärt man Vorgänge wie Schlussfolgern, Sich- Erinnern oder jemanden Gernhaben, wenn nicht mit dem Hinweis darauf, dass diese „im Geiste“ stattfinden? Wie ist überhaupt der privilegierte Zugang jedes Einzelnen zu seinen eigenen Gefühlen, Wünschen und Erinnerungen zu verstehen? Die meisten dieser Fragen, zu denen man noch unzählige hinzufügen könnte, sind bis heute unbeantwortet geblieben, einige scheinen mehr oder weniger gut beantwortet worden zu sein, indem man ‚geistige Vorgänge’ anhand ihrer öffentlich sichtbaren Erscheinungsformen erklärte. Die Frage, was es eigentlich bedeutet, wenn man sagt, dass jemand oder man selbst gerade etwas denkt, gehört in diesen Fragenstrauß und beschäftigt(e) ganze Heerscharen von Philosophen, unter anderen auch Brandom und Sellars.
Diese beiden Philosophen nähern sich der Erklärung von „Denken“ aus unterschiedlichen Richtungen und mit unterschiedlichen Zielsetzungen auf der gemeinsamen Grundlage der Überzeugung, dass Denken und Sprache wesentlich zusammenhängen - eine Ansicht, die seit Herder und Humboldt nicht neu in der Philosophie ist. Die Frage, wie Denken und Sprache zusammenhängen, ist der Punkt, in dem sich beide Theorien berühren, und das Thema der vorliegenden Arbeit. Ich werde im Folgenden die beiden Ansätze Sellars’ und Brandoms skizzieren und anschließend näher darauf eingehen, wie jeder von ihnen die genannte Frage behandelt. Es werden sich grundlegende Gemeinsamkeiten, aber auch bemerkenswerte Unterschiede herausstellen, und im letzten Teil der Arbeit werde ich mich tendenziell für einen der Ansätze entscheiden sowie auf offengelassene Fragen bei beiden Theorien hinweisen.
2. Umrisse von Sellars’ Theorie
Wilfried Sellars unternimmt in EPG2 den (nicht erfolglosen) Versuch, die Grundannahme der traditionellen Erkenntnistheorien, dass es irgendetwas gebe, was man beim Nachdenken über den Erwerb von Wissen als gegeben voraussetzen könne, zu widerlegen. Er wendet sich insbesondere gegen empiristische Theorien, welche davon ausgehen, dass die Grundlage jeglichen Wissens sogenannte „Sinnesdaten“ seien. Er überführt diese „Sinnesdaten“ einer unzulässigen Doppeldeutigkeit, indem er nachweist, dass sie, um den ihnen von den Empiristen zugeschriebenen Zweck zu erfüllen, gleichzeitig sprachlicher als auch nichtsprachlicher Natur sein müssten. Nachdem er auf diese Weise die „Sinnesdaten“ aus der Welt geschafft hat, steht er vor der Aufgabe, eine Alternative vorzuschlagen, wie wir denn sonst zu Wissen kommen, wenn nicht über „Sinnesdaten“.
Sellars’ Antwort lautet, grob gesprochen: Es gibt kein Wissen vor der Sprache. Indem wir eine Sprache erlernen, erwerben wir - mit den Begriffen und deren Beziehungen zueinander - Wissen und die Fähigkeit, uns auf dieser Grundlage weiteres Wissen zu verschaffen. Diese These fußt natürlich auf derjenigen Wittgensteins, derzufolge der semantische Gehalt eines sprachlichen Ausdrucks in seinem Gebrauch besteht. Es ist klar, dass diese Theorie keine Spielart des „Mythos des Gegebenen“ ist, wie Sellars es nennt, da Sprache ja nichts Festes, Unveränderliches ist und ein einzelner Satz oder gar ein einziges Wort noch kein Wissen darstellt. Einen Begriff kennen und damit über Wissen verfügen kann man nach Sellars erst, wenn man weiß, wie dieser Begriff in sprachlichen Äußerungen verwendet wird und in welchen inferentiellen3 Beziehungen er zu anderen Begriffen steht. Zum Beispiel kennt man den Begriff „Kugel“ erst, wenn man behaupten kann, dass eine Kugel rund und nicht eckig ist.
Auf dem Weg zu einer Erklärung privater Episoden wie Empfindungen und Gefühle liefert Sellars eine Theorie von „Gedanken“, die den Gehalt von Gedanken auf der Basis des Gehalts von sprachlichen Äußerungen erklärt. Dies ist der Punkt, an dem Sellars’ Ausführungen für die vorliegende Arbeit relevant werden, und ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Vorher will ich aber noch andeuten, aus welcher Richtung Brandom auf das Thema zukommt.
3. Umrisse von Brandoms Theorie
Anders als Sellars interessiert sich Brandom in EV4 nicht für Erkenntnistheorie, sondern hat das Anliegen, eine philosophische Semantik zu entwickeln, die traditionellen repräsentationalistischen Erklärungsmodellen5 ausweicht. Statt also wie die jahrhundertealte Tradition zu fragen, auf welche Weise die Sprache die objektive Wirklichkeit abbildet bzw. auf sie Bezug nimmt, setzt er an der Stelle an, wo Wittgenstein aufgehört hat, und versucht dessen These, dass die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks in seinem Gebrauch bestehe, auszubuchstabieren. Bei einzelnen Wörtern wie ‚und’, ‚vielleicht’ und solchen Sätzen wie ‚Gib mir mal die Butter!’ ist es intuitiv klar, was es heißt, dass deren Bedeutung in ihrem Gebrauch bestehe. Im Laufe der Diskussionen über Wittgensteins Theorie hat sich aber herausgestellt, dass ihr gerade solche Arten von sprachlichen Äußerungen Schwierigkeiten bereiten, mit denen repräsentationalistische Theorien am wenigsten Probleme hatten, nämlich Behauptungen. Die Bedeutung eines Satzes wie ‚Die gegenwärtige Temperatur in München beträgt 32°C’ ist für repräsentationalistische Theorien relativ einfach zu erklären, wenn erst einmal gesagt worden ist, wofür die einzelnen Wörter jeweils stehen. Was soll es aber heißen, dass die Bedeutung dieses Satzes in seinem Gebrauch bestehe?
Sellars hatte gesagt, sprachliche Praxis sei in der Hauptsache ein „Spiel des Gebens und Forderns von Gründen“. Für ihn hängt der Begriff des Wissens wesentlich mit dem des Grundes zusammen: Sprache ist unter anderem ein Mittel, Wissen auszutauschen. Um einen anderen Gesprächsteilnehmer von etwas zu überzeugen, müssen wir ihm gute Gründe dafür liefern, das zu glauben. Theorien, die sich auf dieses „Spiel des Gebens und Forderns von Gründen“ stützen, nennt man „inferentialistisch“. Brandom postuliert nun, dass die grundlegende Art, dieses Spiel zu spielen, das Aufstellen von Behauptungen ist. Dies leuchtet spätestens dann ein, wenn man sich eine sprachliche Praxis vorzustellen versucht, die ohne Behauptungen auszukommen hat. Die sprachliche Praxis ist eine normative6 Praxis, und der Gehalt einer Behauptung, so Brandom, besteht gerade in ihren inferentiellen Beziehungen, also in den Gründen, die zu der Behauptung berechtigen, und in den Folgerungen, zu denen man sich selbst mit dem Aufstellen der Behauptung berechtigt bzw. auf die man sich festlegt. Das ist das Kernstück von Brandoms Theorie, was nur noch im Einzelnen erläutert zu werden braucht, worauf Brandom mehr als 1000 Seiten verwendet. Anders als bei Wittgensteins These drängen sich zum Beispiel bei Brandoms Variante alsbald die Fragen auf: Wie kommt denn der Gehalt in diese Gründe, Behauptungen und Schlussfolgerungen? Woher kommen die Normen? Auf diese Fragen wird weiter unten im Einzelnen eingegangen werden. Jetzt ist noch kurz zu klären, warum die Frage nach dem Geist für Brandom ein Problem darstellt. Das liegt daran, dass er den Gehalt von Behauptungen zunächst vollständig ohne Bezug auf den Geist und nur unter Rekurs auf normative Praktiken7 expliziert. Es ist aber nicht zu leugnen, dass die Teilnehmer an der sprachlichen Praxis nicht nur linguistische, sondern auch (und ich möchte behaupten: vor allem) intentionale Wesen sind. Die Sprachverwender behaupten nicht nur und tauschen Gründe aus, sondern sie wünschen und fürchten auch, sie glauben und beurteilen, sie erinnern sich und planen. Neben vielem anderen würden sie sich insbesondere gerne weiterhin als denkende Wesen bezeichnen, da (fast) jeder von ihnen aus eigener Erfahrung berichten kann, schon mal gedacht zu haben. Brandom erläutert intentionale Zustände über den Zusammenhang, der zwischen ihnen und ihrem Ausdruck durch offenes (sprachliches) Verhalten besteht. Da Gedanken in der Hauptsache durch Sprechen ausgedrückt werden, muss ihn der Zusammenhang von Gedanken und Sprache bzw. zwischen Sprechen und Denken interessieren.
4. Sellars’ Ansatz
Wegen der völligen methodischen Verschiedenheit des Herangehens an das Problem kann ich nicht, wie ich es gerne würde, die beiden Ansätze Sellars’ und Brandoms parallel darstellen, sondern muss sie nacheinander präsentieren. Was dabei an Vergleichen im Abschnitt über Sellars zunächst auf der Strecke bleiben muss, wird in dem Brandom gewidmeten und dem darauf folgenden Abschnitt nachgeholt. Ich habe gezeigt, mit welchen unterschiedlichen Ausgangsproblemen und Zielstellungen Sellars und Brandom auf das Problem des Zusammenhangs von Sprache und Denken stoßen, und meine Darstellung jeweils an dem Punkt unterbrochen, an dem das Problem für die jeweilige Theorie in den Blick gerät. Man wird sich erinnern, dass Sellars auf dem Weg zu einer antiempiristischen Erkenntnistheorie nachgewiesen hat, dass es vorbegriffliches Wissen und Denken nicht geben kann. „Nunmehr wird uns nämlich klar, dass es sich nicht etwa so verhält, dass wir über den Begriff von etwas verfügen, weil wir diese Art von Ding erkannt haben. Es verhält sich vielmehr so, dass die Fähigkeit, eine Art von Ding zu erkennen, voraussetzt, dass man bereits über den Begriff dieser Art von Ding verfügt.“8 Sellars fragt sich nun, wie man überhaupt dazu kommt, „die Idee eines Eindrucks oder einer Empfindung zu haben“9, und stellt sehr schnell fest, dass er damit im Prinzip fragt, „wie es möglich ist, dass es innere Episoden gibt - d.h. Episoden, die auf irgendeine Weise Privatheit (im Sinne der Tatsache, dass jeder von uns privilegierten Zugang zu seinen eigenen inneren Episoden hat) und Intersubjektivität (in dem Sinne, dass jeder von uns im Prinzip von den inneren Episoden der anderen wissen kann) miteinander verbinden.“10 Mit dem fernen Ziel zu zeigen, dass es solche Episoden (Empfindungen und Gefühle) gibt und dass sie sich „mit den Mitteln des intersubjektiven Diskurses beschreiben lassen“11 wendet er sich zunächst „inneren Episoden ganz anderer Art“12, nämlich Gedanken, zu.
„Diese Episoden können ablaufen, ohne durch offenes Sprachverhalten ‚ausgedrückt’ zu werden, obwohl Sprachverhalten - in einem wichtigen Sinn - ihr natürliches Erlebnis ist. Auch können wir ‚uns selber denken hören’, aber die Wortvorstellungen, die uns dies ermöglichen, sind ebenso wenig das Denken selbst wie es das offene Sprachverhalten ist, durch das es ausgedrückt und anderen mitgeteilt wird. Es ist ein Fehler anzunehmen, dass wir Wortvorstellungen - ja überhaupt Vorstellungsbilder - haben müssen, wenn wir ‚wissen, was wir denken’ - kurz, anzunehmen, dass der ‚privilegierte Zugang’ nach einem Wahrnehmungs- oder Quasiwahrnehmungsmodell konstruiert werden muss.“13
„In welchem Sinn aber, so wird sich der Leser vielleicht gefragt haben, können diese Episoden ‚innerlich’ sein, wenn sie keine unmittelbaren Erlebnisse sind? Und in welchem Sinn können sie ‚sprachlich’ sein, wenn sie weder Fälle offenen Sprachvollzugs noch Wortvorstellungen ‚ in forto interno ’ sind?“14
Um seine Antwort auf diese Frage verständlich zu machen, erzählt Sellars, ohne es auf andere Weise zu versuchen, einen selbstausgedachten Mythos, der erklären soll, wie ‚Gedanken’ auf der Basis eines Verständnisses von Sprache verstanden werden können. Diesen Mythos nennt Sellars witzigerweise „Unsere Ryleschen Vorfahren“ und sagt damit gleichzeitig, wovon er ausgeht und worüber er hinauszugehen beabsichtigt. Er bezieht sich nämlich mit diesem Titel auf Gilbert Ryle, einen philosophischen Behavioristen, der in seinem Hauptwerk „Der Begriff des Geistes“ so gründlich mit dem „Mythos vom Gespenst in der Maschine“ aufräumt, dass er am Ende sogar leugnet, dass es überhaupt innere Episoden gebe, zu denen die betroffene Person privilegierten Zugang hat. Nach Ryle müssten sich alle inneren Episoden und intentionalen Zustände vollständig anhand des öffentlich beobachtbaren Verhaltens erklären lassen, selbst für die Person, deren Zustände und Episoden dabei in Frage stehen. Dementsprechend benutzen Sellars’ „Rylesche Vorfahren“ eine solche Sprache, „deren grundlegendes beschreibendes Vokabular über öffentliche Eigenschaften öffentlicher Gegenstände spricht“15, und nicht über unbeobachtete Eigenschaften unbeobachteter Gegenstände. Insbesondere kennt diese Sprache kein intentionalistisches Vokabular, also solches, mit dem man sich gemeinhin auf innere Episoden und Zustände zu beziehen pflegt. Zunächst lernen diese Vorfahren, „ihr Sprachverhalten wechselseitig in semantischen Begriffen zu charakterisieren“16. Sie können nun also auf einer metasprachlichen Ebene über ihre eigene Sprache reden, z.B.: ‚‚Schimmel’ bedeutet ‚weißes Pferd’’, ‚‚Der Mensch ist ein Säugetier’ ist wahr’ oder ‚Ich meinte, dass Cola nicht das gesündeste Frühstück ist’. Als nächstes lernen die „Ryleschen Vorfahren“, Theorien zu entwickeln, die Modelle beinhalten. Das heißt, sie können jetzt bisher unerklärte Dinge verständlich machen, indem sie ein Modell zu Hilfe nehmen und dieses mit einem Kommentar versehen, der klarmacht, wie weit die Analogie vom Modell zum Erklärten geht. Die „Ryleschen Vorfahren“ entwickeln jetzt Theorien und Modelle, so wie wir beispielsweise die Erderwärmung am Modell eines Treibhauses erklären, aber unverzüglich hinzufügen, dass es keinen riesenhaften Gärtner gibt, der jeden Morgen hereinspaziert kommt, um nachzusehen, ob es allen gut geht. An dieser Stelle steht nun unter den „Ryleschen Vorfahren“ ein genialer Mann namens Jones auf, der „bei dem Erklärungsversuch für die Tatsache, dass seine Mitmenschen sich nicht nur dann intelligent verhalten, wenn eine Kette offener sprachlicher Episoden ihr Betragen durchzieht - was heißen soll, wie wir es ausdrücken würden, wenn sie ‚laut denken’ -, sondern auch, wenn kein bemerkbarer verbaler Output vorliegt, eine Theorie entwickelt, derzufolge offene Äußerungen bloß die Kulmination eines Prozesses bilden, der mit bestimmten inneren Episoden beginnt.“17 Der Pfiff an Jones’ Theorie besteht darin, „ dass sein Modell für diese Episoden, welche die Ereignisse einleiten, die in offenem sprachlichen Verhalten gipfeln, das des offenen sprachlichen Verhaltens selber ist. Mit anderen Worten, nämlich in der Sprache des Modells: die Theorie läuft darauf hinaus, dass offenes sprachliches Verhalten die Kulmination eines Prozesses ist, der mit‚innerer Rede’beginnt. “18 Jones nennt diese inneren Episoden „Gedanken“, und Sellars weist darauf hin, dass diese Gedanken „ gemäßihrer Einführung unbeobachtete“19, nämlich theoretische Entitäten sind. Der weitere Verlauf des Mythos’ ist schnell erzählt: Jones bringt seinen Landsleuten bei, gegenseitig ihr intelligentes Verhalten mithilfe der theoretischen Größe „Gedanken“ zu interpretieren, und in einem weiteren Schritt lernen sie, auch ihre eigenen Handlungen auf diese Weise zu verstehen: ‚Ich dachte, dass noch Tee in der Tasse ist, als ich sie anhob.’ „Unsere Vorfahren beginnen, von dem privilegierten Zugang zu reden, den jeder von uns zu seinen eigenen Gedanken hat. Was als eine Sprache mit rein theoretischem Gebrauch begann, hat berichtende Funktion gewonnen.“20
Dieser plötzliche Übergang erscheint mir einigermaßen unklar, wird aber von Sellars nicht weiter expliziert. Was ist es denn, wovon wir plötzlich zu berichten beginnen? Nach Sellars’ Mythos dürfte das, wovon wir berichten, von uns nicht wahrgenommen worden sein, bevor wir die theoretische Größe „Gedanken“ kennengelernt haben, weil die Rede von inneren Episoden wie „Gedanken“ eine zunächst theoretische Rede aus der Sicht von außen war. Sellars fügt zusammenfassend hinzu, „dass Begriffe, die sich auf solche inneren Episoden wie Gedanken beziehen, primär und ihrem Wesen nach intersubjektiv sind wie der Begriff eines Positrons, und dass die berichtende Funktion dieser Begriffe - die Tatsache, dass jeder von uns einen privilegierten Zugang zu seinen Gedanken hat - eine Gebrauchsdimension dieser Begriffe konstituiert, die auf diesem intersubjektivem Status aufgebaut ist und ihn voraussetzt.“21
Bertram & Liptow22 stellen fest, dass Sellars die Auffassung vertrete, „dass Gehalte von intentionalen Zuständen nur auf der Basis von Gehalten sprachlicher Ausdrücke zu verstehen sind und analoge Strukturen wie diese aufweisen.“23 Das bedeutet nicht, dass die intentionalen Zustände selbst eine der sprachlichen analoge Struktur haben, sondern nur ihre Gehalte, also das, wovon sie handeln, eine Struktur haben, die der des Gehaltes von sprachlichen Äußerungen ähnelt. In Bertrams & Liptows Worten: Sellars’ Theorie besagt, „dass der Begriff der Intentionalität nur auf der Basis bereits erklärter sprachlicher Praktiken eingeführt werden kann“24, aber sie behauptet nicht, „dass Intentionalität genau in den erklärten sprachlichen Praktiken ausgemacht werden kann.“25
In gewisser Hinsicht ist das unbefriedigend: Gewiss, Sellars’ Theorie bietet eine einleuchtende Erklärung des Zusammenhangs der Aussagen an, die sich über die Gehalte von Gesprochenem und Gedachtem machen lassen, aber was ich da tue, wenn ich denke, hat er nicht erklärt. Nach seiner Theorie, die sprachliche Ausdrücke als Modell für die theoretische Größe „Gedanken“ benutzt, könnte es sein, dass sich herausstellt, dass das Denken sprachlich funktioniert, muss aber nicht. Doch ist das nicht gerade der Punkt, der uns interessiert? Wie denken wir? Was passiert genau, wenn ‚uns ein Gedanke kommt’? Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass in dem ganzen philosophischen Reden über Sprache und Denken kurioserweise die Bedeutungen mehrerer Wörter vermischt zu werden scheinen: Da ist zum ersten der „Gedanke“ (engl. „thought“, wörtl. „Gedachtes“) als sprachlich formulierbares Ergebnis des Denkens, zum zweiten das „Gedachte“ zur Beschreibung von Sinnestäuschungen und anderen Irrtümern, wenn man z.B. sagt: ‚Ich dachte, da steht ein Pinguin’, zum dritten das „Denken“ in dem Sinne, in dem es manche Philosophen gebrauchen, wenn sie z.B. sagen, dass ‚die Sprache unser Denken beeinflusst’, zum vierten das Denken, das am deutlichsten in unserem Begriff des „Gedenkens“ zum Vorschein kommt und bei dem es nicht unbedingt darauf ankommt, sprachlich formulierbare Ergebnisse zu produzieren. Sicher habe ich noch einige Bedeutungsvarianten ausgelassen.
Sellars würde darauf vermutlich antworten, dass er mit „Denken“ keineswegs einen mysteriösen Vorgang im Kopf meint, sondern dass ‚denken, dass noch Tee in der Tasse ist’ analog zu ‚sehen, dass noch Tee in der Tasse ist’ zu verstehen sei. Damit äußert er sich nur über die Gehalte der Wahrnehmung und des Gedankens und verfängt sich meiner Meinung nach gerade in dieser Bedeutungsvermischung, denn ‚denken, dass noch Tee in der Tasse ist’ hat nicht viel mit dem zu tun, was wir meinen, wenn wir von jemandem sagen ‚er denkt’. Allerdings scheint dieses ‚Denken’ tatsächlich analoge Strukturen zu sprachlichen Äußerungen aufzuweisen, worauf die Redewendungen ‚sich fragen’ oder ‚bei sich sagen’ hinzuweisen scheinen. Ich werde am Ende der Arbeit nochmals auf diesen Punkt zurückkommen, wenn ich gezeigt habe, wie Brandom den Zusammenhang von Sprache und Denken konzipiert. Weil dieses Konzept eng mit seiner Semantik zusammenhängt, komme ich nicht umhin, im Folgenden etwas weiter auszuholen und auch Dinge darzustellen, die Sellars nicht interessiert zu haben scheinen.
5. Brandoms Ansatz
Brandom, der, wie wir schon gesehen haben, von der Seite der Semantik her auf das Problem des Zusammenhangs von Sprache und Denken losgeht, stellt drei große Fragen. Die wichtigste lautet: Was bedeutet es, dass Behauptungen einen Gehalt haben und dass dieser Gehalt in ihrem Gebrauch (also in sprachlichen Praktiken) besteht? Daraus ergibt sich die Frage, wie der Gehalt in die sprachlichen Praktiken kommt, und zu guter Letzt: Wie lassen sich intentionale Zustände und mentale Vorgänge wie das „Denken“ erklären, die ja nach allgemeiner Überzeugung auch mit Gehalten operieren?
Zur Beantwortung dieser Fragen zerlegt Brandom das Bild des Geistigen in drei Teile: „Zuerst versucht er Praktiken zu beschreiben, die als normative und so potentiell gehaltverleihende Praktiken zu verstehen sind. Dann widmet er sich sprachlichen Praktiken und beleuchtet die Spezifik dieser Praktiken. Zuletzt muss er den Transfer leisten, auch nicht- sprachliche Zustände, die einen bestimmten Gehalt haben, unter Rekurs auf die Strukturen zu erklären, die sprachliche Gehalte prägen. Die Rede von Teilen, aus denen Brandom das Bild zusammensetzt, impliziert eine wichtige theoretische Operation, die man als Schichtung der Vokabulare, mittels derer erklärt wird, bezeichnen kann.“26 Mit jeder Schicht wird ein Teil des Bildes erklärt. Für die Explikation jedes Teils dieses Bildes und damit für jede Schicht gilt, dass sie kein Vokabular einbeziehen darf, das erst in einer nachfolgenden Schicht eingeführt und erklärt wird. Zum Beispiel darf bei der Beschreibung der basalen Praktiken kein Begriff der Sprache oder des Geistes verwendet werden.
In der ersten Schicht werden basale normative Praktiken beschrieben mit dem Ziel, die normativen Begriffe „Festlegung“ und „Berechtigung“ zu erklären, die in der zweiten Schicht, zur Erklärung normativer sprachlicher Praktiken, gebraucht werden. Die Frage, die es jetzt zu beantworten gilt, lautet: Wie kommt Normativität (und damit potentiell Gehalt) in die nichtsprachlichen Praktiken? Vielleicht ist es an dieser Stelle interessant zu bemerken, dass in dem griechischen Wort „Praxis“ auch die Bedeutungen „Erfahrung“ und „Brauch“ stecken, es wird sich also bei den Handlungen, die man innerhalb einer Praxis betrachtet, in der Hauptsache nicht um besonders originelles oder gar zufälliges Verhalten handeln, sondern um solches, das mit anderem Verhalten in der Gruppe irgendwie zusammenhängt und in gewissem Sinne als ‚normal’ aufgefasst wird. Es ist unbestreitbar, dass sich solche Praktiken leicht auffinden lassen, man stelle sich nur mal eine größere Straßenkreuzung vor, an der auf jeder Seite auf verschiedenen Spuren eingeordnet Fahrzeuge stehen; andere fahren gerade, manche blinken. Ich habe bewusst ein so kompliziertes Beispiel gewählt, bei dem einem der Einwand auf der Zunge liegt, dass diese Praxis ja wohl keineswegs basal ist und dass das Verhalten der Autofahrer überdies von der Straßenverkehrsordnung geregelt wird. Ich denke aber, dass Brandom mit „basaler Praxis“ nicht meint, dass wir uns jetzt eine Gruppe von Urmenschen vorstellen sollen, die sich nur stumm zunicken und irgendwelche vorsprachlichen Laute von sich geben.27 Brandom will nicht die Entstehung der Sprache erklären, sondern er will zeigen, wie in einer beliebigen sozialen Gruppe nichtsprachliche (und in diesem Sinne basale) normative Praktiken (möglicherweise sogar gleichzeitig bestehenden) sprachlichen Praktiken Gehalte verleihen. Erst, wenn man Brandoms Idee verstanden hat, kann man sich Gedanken machen, ob auch eine Gruppe von Pavianen oder Bienen mit propositionalen Gehalten operiert. Doch das ist alles nicht unser Thema, und wir kehren zu meiner Kreuzung zurück.
Brandom beobachtet die Einstellungen der Praxisteilnehmer, d.h. ihre Dispositionen, andere Praxisteilnehmer als festgelegt auf etwas oder berechtigt zu etwas zu behandeln. Das heißt, in unserem Beispiel gesprochen: Wenn jemand an der Kreuzung auf der mittleren Spur steht, behandeln ihn die anderen Autofahrer als darauf festgelegt, dass er geradeaus über die Kreuzung fahren wird, sobald die Ampel Grün zeigt. Wie ist das zu verstehen? Indem man sich z.B. klarmacht, dass der dahinterstehende Fahrer auch anfährt, wenn die Ampel grün wird, und dass er sich sehr wundern würde, wenn unser erster Autofahrer plötzlich aussteigen oder rückwärts losfahren würde. Er würde sicherlich auch mit Sanktionen reagieren, z.B. selbst auch aussteigen und den Mann anbrüllen, dass er endlich losfahren soll, oder hupen.
Und das ist es, was Brandom mit Normativität meint, die durch Praktiken instituiert (eingesetzt) wird. Die Festlegung, geradeaus über die Kreuzung zu fahren, besteht erst ab dem Moment, in dem sich der Fahrer einordnet und auf eine bestimmte Spur stellt. Das heißt: Indem er sich dort hinstellt, weist er den anderen die Berechtigungzu, ihn als darauf festgelegt zu behandeln, beim Grünwerden der Ampel geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Man kann diese Sichtweise beliebig verkomplizieren, und es kommt dabei nur darauf an, was man betrachtet: Jemand der rechts steht und rechts blinkt, weist damit den anderen Fahrzeugführern die Berechtigung zu, ihn (1.) als dazu berechtigt zu behandeln, nach rechts zu fahren, ihn (2.) als darauf festgelegt zu behandeln, nicht nach links zu fahren, ihn (3.) als darauf festgelegt zu behandeln, sie als dazu berechtigt zu behandeln, links an ihm vorbeizufahren.
„Festlegung“ und „Berechtigung“ werden von Brandom „normative Status“ genannt, und es ist intuitiv einleuchtend, inwiefern diese Status von der Praxis instituiert werden, wenn auch Bertram & Liptow28 bezweifeln, dass sich komplexere Bezogenheiten von Einstellungen aufeinander tatsächlich unter Verzicht auf intentionales und semantisches Vokabular angemessen rekonstruieren lassen. Ich denke aber, dass das möglich ist, einfach aus dem Grund, dass diese Einstellungen ja keine Handlungen sind. Es gibt keinen ‚Akt des Zuweisens’, der erforderlich machte, dass ich mir im Voraus diese ganzen komplizierten Beziehungen klarmachte. Die Einstellungen bestehen einfach, und im Grunde sind sie nichts anderes als Dispositionen, so oder so zu handeln.
In diesem Lichte erscheint auch der zweite Hinweis von Brandom & Liptow29 nicht mehr ganz so problematisch wie er auf den ersten Blick aussieht: „Eingehen“ und „Zuweisen“ seien normalerweise mit „Wissen“ verknüpft. Brandom verwende die Begriffe aber so, dass jemand, der einem anderen eine Berechtigung zuweise, nicht wisse, dass er das tue. Problematisch könnte dieser Punkt aus dem folgenden Grund erscheinen: Weil „Wissen“ ein intentionaler Begriff ist, würde sich Brandom einer zirkulären Erklärweise schuldig machen, wenn die Praxisteilnehmer wüssten, dass sie anderen Berechtigungen zuweisen. Andererseits scheint das Zuweisen einer Berechtigung zu Sanktionen ohne Wissen davon aber ziemlich sinnlos zu sein. Der Betreffende würde sich dann über die Sanktionen wundern. Ich denke, Brandom hat nichts dagegen, wenn die Praxisteilnehmer sich in einigen Fällen auch ihrer Einstellungen bewusst sind. Dagegen, dass die Praxisteilnehmer von ihrem
Eingehen und Zuweisen von Festlegungen und Berechtigungen immer wissen müssen, lässt sich einwenden, dass es einfach unserer Erfahrung widerspräche, wollte man behaupten, dass es so ist. Ich habe oben demonstriert, wie mühelos man sich an einer ordinären Straßenkreuzung hochkomplizierte Bezogenheiten von Einstellungen aufeinander klarmachen kann. Es erscheint geradezu unmöglich, von allen diesen Einstellungen zu wissen. Trotzdem führen die meisten ein funktionierendes Leben, in dem zweifellos solche Einstellungen eine Rolle spielen. Normalerweise setzt man den Blinker und fährt dann bei Grün um die Ecke, ohne sich auch nur im Geringsten darum zu scheren, in welchem hochkomplizierten Geflecht von Einstellungen man sich gerade befindet. Wenn ich hiermit gezeigt habe, dass das Wissen vom Eingehen und Zuweisen von Festlegungen und Berechtigungen nicht immer bzw. in der Regel nicht notwendig ist, dann ist Brandom in diesem Punkt gerettet. Ich will es nun mit meiner Verteidigungsrede zu seinen Gunsten bewenden lassen und mich wieder seiner Theorie, namentlich der zweiten Erklärungsschicht, zuwenden, in der die Begriffe „Festlegung“ und „Berechtigung“ verwendet werden, um den Gehalt von Behauptungen zu erläutern.
Was ist der Gehalt einer Behauptung, fragt Brandom, und seine Antwort lautet: Die Inferenzenstruktur dieser Behauptung. Die Inferenzenstruktur einer Behauptung ist, um ein Bild von Sellars zu gebrauchen, das Netz von Gründen und Schlussfolgerungen, in das eine jede Behauptung eingebunden ist. Man kann bei jeder Behauptung nach Gründen fragen, und aus jeder Behauptung lassen sich Schlüsse ziehen. Anders gesagt, ist jede Behauptung der Schluss aus ihren Gründen und selbst Grund für andere Behauptungen. Überdies gibt es Behauptungen, die sich nicht miteinander vertragen, also inkompatibel sind. Beispielsweise kann man nicht gleichzeitig behaupten, dass in München die Lufttemperatur 32°C beträgt und dass dort Schnee liegt. Im Gegenteil ist man mit der ersten Behauptung darauf festgelegt, auch zu behaupten, dass in München kein Schnee liegt. Um ein anderes Beispiel zu strapazieren: Mit der Behauptung ‚Auf meinem Schoß liegt die Katze Minka’ lege ich mich auf eine Menge anderer Behauptungen fest, die z.B., dass Minka gerade nicht auf dem Schoß meiner Mutter liegt oder auf meinem Kopf sitzt und dass ich nicht gerade beim Brustschwimmen im Waldsee bin. Gleichzeitig bin ich auch zu einer Unmenge weiter Behauptungen berechtigt, die alle aus meiner Behauptung folgen, dass Minka auf meinem Schoß liege, so z.B.: ‚Ein Tier liegt auf meinem Schoß’, ‚Die Mäuse im Haus sind gerade sicher vor Minka’ oder ‚Ich weiß, wo die Katze Minka gerade ist’. Umgekehrt kann ich natürlich auch Gründe für meine Behauptung angeben, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Stattdessen wiederhole ich, dass Brandom sagt: Gerade diese Struktur von Gründen und Schlüssen, auf die man sich mit dem Aufstellen einer Behauptung festlegt bzw. zu denen man sich berechtigt bzw. als solches von anderen Gesprächsteilnehmern behandelt wird, macht den Gehalt der Behauptung aus. Dies ist dermaßen einleuchtend, dass ich sogleich zum Hauptthema fortschreiten kann, zur Erklärung des Gehalts intentionaler Begriffe und des Zusammenhangs von Sprache und Denken.
Vorher sei aber noch hinzugefügt, dass Brandom, um die Normativität auch der sprachlichen Praktiken zu erklären, noch das Modell des „deontischen Kontoführens“ einführt30. In der Kürze: Die Summe aller von mir vertretenen Behauptungen inklusive der zu ihnen gehörigen Berechtigungen und Festlegungen zu bzw. auf andere Behauptungen und insbesondere der Inkompatibilitäten zu anderen Behauptungen bildet meinen deontischen Punktestand. Alle Praxisteilnehmer sind unentwegt damit beschäftigt, diesen Punktestand von jedem anderen Praxisteilnehmer einzuschätzen und abzugleichen. Der Punktestand, der mir zugeschrieben wird, verändert sich mit jeder Behauptung, die ich mache, und mit jeder Behauptung, die ich höre. Im Prinzip ist diese deontische Kontoführerei nichts anderes als eine kompliziertere Variante der Bezogenheiten von Einstellungen aufeinander, die wir vorhin an der Straßenkreuzung betrachtet haben, & Brandom wünscht sie ebenso ‚unbewusst’ vorgestellt zu wissen wie diese. Nur, dass wir es jetzt nicht mit Berechtigungen zu nichtsprachlichen Handlungen zu tun haben (jedenfalls nicht ausschließlich), sondern mit Berechtigungen und Festlegungen zu bzw. auf propositionale Gehalte. Ebenso wie dort an der Kreuzung kann ein nicht den instituierten Normen entsprechendes Verhalten sanktioniert werden, z.B. durch den Hinweis auf Widersprüche (Inkompatibilitäten) und das Verlangen von Gründen oder Korrekturen. Auf diese Weise kommt über die Festlegungen und Berechtigungen wieder die Normativität ins Spiel des Gebens und Forderns von Gründen, die dafür sorgt, dass nicht gewisse Behauptungen gehaltlos werden, indem man sie unwidersprochen gleichzeitig mit mit ihnen inkompatiblen Behauptungen gelten lässt, so zum extremen Beispiel: ‚Ich habe mir gestern ein kugelrundes würfelförmiges Eis geleistet.’ Nun wollen wir aber sehen, ob sich Gedanken ebenso spielend erklären lassen wie die Gehalte von Behauptungen. Es ist dies der dritte Teil in Brandoms Bild, und in der dazugehörigen dritten Vokabularschicht stehen alle möglichen Begriffe, nur nicht die des Geistes, zur Verfügung. Die Grundannahme, von der Brandom wie Sellars ausgeht, ist die, dass Gedanken überhaupt Gehalte haben. Das ist insofern wichtig, als Brandom und auch Sellars unter „Gehalt“ automatisch einen propositionalen Gehalt verstehen, also etwas, das sich nötigenfalls durch eine Behauptung sprachlich ‚ausdrücken’ lässt. Weil aber, wie wir soeben gesehen haben, Behauptungen ihren Gehalt nur aus ihren inferentiellen Beziehungen zu anderen Behauptungen (mithin nicht aus dem Kopf des Sprechers) beziehen, ist zumindest Brandom darauf festgelegt, auch zu behaupten, dass Gedanken wesentlich mit sprachlicher Praxis zu tun haben. In seinem Kapitel über den Zusammenhang von Sprache und Denken tut er aber so, als sei das alles noch nicht klar und lässt sich viel Zeit damit, sämtliche Möglichkeiten anzuführen, die zur Konzeption des Zusammenhangs von Sprache und Denken in Betracht kommen. Sogar die Möglichkeit, den Gehalt sprachlicher Äußerungen auf der Basis des Gehaltes von Sprecherintentionen zu erklären, lässt er nicht aus. Dies alles natürlich nur um zu zeigen, warum alle diese Wege seiner Ansicht nach nicht gangbar sind, und ich erspare mir und dem Leser ein Referat dieser Betrachtungen und komme sofort zum Kern der Sache. Den Rand desselben bildet die Grundansicht: „Zustände, Einstellungen und Akte sind intentional gehaltvoll aufgrund ihrer Rolle in inferentiell gegliederten implizit normativen Praktiken.“31 Auch Sellars würde dem zustimmen, wenngleich er nicht solches Gewicht auf die Normativität legen würde. Uneingeschränkt zustimmen würde er hingegen Brandoms folgender Formulierung: „Repräsentationale mentale Zustände stellen die Welt dar, weil sie den elementarsten aller Darstellungen ähneln oder mit ihnen zu tun haben, den sprachlichen Ausdrücken.“32 Dies ist es, was Brandom das „linguistische Bild der Intentionalität“ nennt. Im Folgenden unterscheidet er zwischen „analogischen“ und „relationalen“ Spielarten des linguistischen Bildes der Intentionalität. Ersteres ist im Grunde nichts anderes als das, was Sellars vertritt, nämlich die Ansicht, „der gemäß der Gehaltbesitz von Zuständen dem von Ausdrücken nachgebildet ist“33, während die relationale Vorstellung besagt, dass „der Gehaltbesitz intentionaler Zustände in dem der sie ausdrückenden Sprechakte besteht oder wesentlich damit verbunden ist“34. Brandom wird sich im Verlaufe seiner Ausführungen für die relationale Ansicht entscheiden und sich damit in Opposition zu Sellars begeben, weshalb ich seine Argumentation zugunsten der relationalen Variante hier unzensiert wiedergeben möchte.
Er zitiert an dieser und den folgenden Stellen Davidson, der behauptet: „Weder die Sprache noch das Denken lässt sich vollständig im Sinne des jeweils anderen erklären, und keinem von beiden kommt eine begriffliche Vorrangstellung zu. Die beiden sind zwar tatsächlich miteinander verbunden, und zwar in dem Sinne, dass jedes des anderen bedarf, um verstanden zu werden; doch diese Verbindung ist nicht so vollständig, dass eines von beiden - selbst bei ziemlicher Verstärkung - ausreichen würde, um das andere zu explizieren.“35 Das ist zunächst nur eine Behauptung (aber immerhin die Kernbehauptung der von Brandom vertretenen relationalen Sichtweise) und kein wirkliches Argument gegen Sellars’ Auffassung. Um zu begründen, warum man diese Sichtweise einnehmen soll, muss Brandom zeigen, „was genau an dem Gehalt intentionaler Zustände dran ist, das nur anhand der Relation zwischen solchen Zuständen und spezifisch sprachlichen Performanzen erklärt werden kann.“36
Dazu zitiert er ein zweischrittiges Argument von Davidson, dessen erster Schritt lautet, dass man nur dann etwas glauben kann, „wenn man die Möglichkeit versteht, sich zu irren“37 und dass es dazu nötig ist, „dass man den Gegensatz zwischen Wahrheit und Irrtum - zwischen wahrem Glauben und falschem Glauben - begreift.“38 Dieser Gegensatz zwischen wahr und falsch offenbart sich aber erst - wie der zweite Schritt von Davidsons Argument besagt - wenn sich Praxisteilnehmer sprachlich über die Inhalte ihres Glaubens austauschen. Das heißt nichts anderes, als dass man nicht auf die Idee kommt, sich zu irren, wenn man die eigenen Überzeugungen nicht in Beziehung zu denen anderer oder möglichen Überzeugungen anderer sieht.
Mit diesem Argument wird zwar offensichtlich gezeigt, warum man intentionale Zustände nicht ohne Bezug auf sprachliche Praktiken erklären kann; es wird aber scheinbar nicht gezeigt, warum sprachliche Praktiken nicht ohne Bezug auf intentionale Zustände erklärt werden können. Es sei denn, man behauptet, dass der Gehalt einer sprachlichen Äußerung wie z.B. ‚Er glaubt, dass in München Schnee liegt’ nicht zu erklären ist, wenn man nicht auf den intentionalen Zustand des Glaubens (und damit laut Davidsons Argument des Wissens) Bezug nimmt. Ich nehme an, dass das zumindest die Richtung ist, in die Brandom denkt. Wieso aber kommt dann Sellars nicht zu demselben Ergebnis? Weil er, wie erinnerlich ist, in der Sprache seiner „Ryleschen Vorfahren“ intentionales Vokabular nicht vorkommen lässt. Es wird erst nachträglich auf der Basis des bereits bestehenden Vokabulars eingeführt und bleibt immer auf dieser Basis erklärbar.
Brandom scheint nun zu behaupten, dass dies nicht möglich ist, dass man sich mit anderen Worten eine sprachliche Praxis, in der intentionale Zustände wie ‚glauben, dass...’ nicht verstanden werden, nicht vorstellen kann. Eine andere Äußerung Brandoms scheint diese Sicht zu unterstützen: „Satzäußerungen können vielerlei Kraft oder pragmatische Signifikanz besitzen, doch wenn solche Performanzen die Signifikanz von Behauptungen haben, dann drücken sie eine Überzeugung aus oder haben dies im Sinn“39 Die Frage lautet also, vergröbert und zugespitzt, ob man behaupten kann ‚Er behauptet, dass in München Schnee liegt’ ohne sich damit auf die folgende Behauptung festzulegen: ‚Er glaubt, dass in München Schnee liegt.’ Oder anders gesagt, lautet die Frage, ob man eine Behauptung als solche verstehen kann, ohne zu verstehen, was es heißt, etwas zu glauben. Sellars würde sagen: Ja, wohingegen Brandom mit Nein antwortet40. Dies ist in der Tat nur ein haarfeiner
Unterschied, und für Brandoms Sicht spricht eigentlich nur die Intuition, oder besser gesagt, die Erfahrung: Wenn jemand eine Behauptung nicht nur hypothetisch und nicht in indirekter Rede äußert, sind wir geneigt, ihm einen Glauben entsprechenden Gehaltes zuzuschreiben - wenn nicht, sehen wir keinen Grund, ihn und seine Behauptung ernst zu nehmen.
6. Schluss
Dies alles hat uns aber nur sehr wenig weitergebracht auf dem Weg dahin zu verstehen, welcher Natur das Denken denn nun ist. Brandom gibt noch viel weniger als Sellars eine Antwort auf diese Frage41, wenn er auch, wie Bertram & Liptow treffend anmerken, „dem Denken offiziell einen größeren Stellenwert einräumt als Sellars“42. Beide Philosophen geben mehr oder weniger (Sellars weniger als Brandom) nur die methodische Richtung vor, in der Philosophen, die sich fortan diesem Thema verschreiben, weiterzuarbeiten haben. Wie es aussieht, muss man sich jetzt jeden einzelnen der intentionalen Begriffe vornehmen und im Rahmen dieser (wohl eher Brandoms) Theorien erläutern, wenngleich mir nichts weniger als klar ist, wie das genau aussehen soll. Denn bei aller Fokussierung auf die Sprache bei der Erklärung beispielsweise des Denkens ist es doch zum Beispiel nicht zu bestreiten, dass auch sogenannte „mentale Bilder“ einen Einfluss darauf haben, welchen Lauf unser Denken nimmt. Damit soll mitnichten behauptet werden, dass diese „Bilder“ allein das Denken ausmachen oder auch nur unabhängig von sprachlicher Praxis verstehbar wären, sondern nur darauf hingewiesen werden, dass die Erfahrung vieler Menschen der Ansicht widerspricht, dass das Denken bilderfrei vonstatten gehe bzw. die „Bilder“ nur eine Begleiterscheinung des Denkens seien. Im Gegenteil kann z.B. die Entscheidung für ein bestimmtes Urlaubsziel ganz wesentlich davon abhängen, welche „Bilder“ man sich davon macht. Der Eindruck, der sich mir aus diesen Bemerkungen und denen, die ich am Ende des Sellars-Abschnittes über die verschiedenen Bedeutungen von „Denken“ gemacht habe, ergibt, ist der, dass ein Philosoph, der sich an eine Erklärung des „Denkens“ macht, als Erstes eine Analyse dessen vorzulegen hat, in welchen Zusammenhängen der Terminus „Denken“ überhaupt auftaucht. Erst dann kann er die Bedeutung(en) dieses Wortes erklären und ist gegen Einwände wie den, dass Taubstumme nur in Bildern denken, gefeit.
7. Verwendete Literatur
Georg W. Bertram / Jasper Liptow: „Zu einer antidualistischen Rekonstruktion sprachlicher Bedeutung: Robert B. Brandom und Wilfried Sellars“ in: Philosophische Rundschau, Band 48 (2001), S. 273-300.
Robert B. Brandom: „Expressive Vernunft“, Frankfurt am Main 2000. Gilbert Ryle: „Der Begriff des Geistes“, Stuttgart 1969.
Wilfried Sellars: „Der Empirismus und die Philosophie des Geistes“, Paderborn 1999.
Wilfried Sellars: „Der Empirismus und die Philosophie des Geistes“, in: Peter Bieri (Hrsg.): „Analytische Philosophie des Geistes“, Königstein/Ts 1981, S. 184-197.
[...]
1 Gilbert Ryle: „Der Begriff des Geistes“, Stuttgart 1969. 1
2 Wilfried Sellars: „Der Empirismus und die Philosophie des Geistes“, Paderborn 1999, im Folgenden nur als „EPG“ mit Seitenzahl.
3 Von „Inferenz“, Sellars’ Wort für „Folgerung“. „Inferentielle Beziehungen“ sind also Beziehungen, die im Wesentlichen in Folgerungszusammenhängen bestehen.
4 Robert B. Brandom: „Expressive Vernunft“, Frankfurt am Main 2000, im Folgenden nur als „EV“ mit Seitenzahl.
5 Das sind solche Erklärungsmodelle, die sich in der Hauptsache danach fragen, wofür die einzelnen Wörter stehen, was sie repräsentieren. Erklärungen dieser Art sind verantwortlich für das seit Platon bekannte Universalienproblem, da es für sie eine Schwierigkeit darstellt zu erklären, wofür denn allgemeine Begriffe stehen.
6 Eine regelgeleitete Praxis. Brandom verwendet diesen Terminus, weil er sagen will, dass „Festlegung“ und „Berechtigung“ normative Begriffe sind. Das klingt besser, als wenn er sagen würde: regelnde.
7 Eine Praxis scheint für Brandom so etwas wie die Gesamtheit des Verhaltens in einer Gruppe von sozialen Wesen zu sein.
8 EPG, S. 76.
9 Ebd.
10 EPG, S. 76 f.
11 EPG, S. 77.
12 EPG, S. 78.
13 Wilfried Sellars: „Der Empirismus und die Philosophie des Geistes“, in: Peter Bieri (Hrsg.): „Analytische Philosophie des Geistes“, Königstein/Ts 1981, S. 184-197. Ich zitiere im Folgenden nach dieser Ausgabe („EPGB“ mit Seitenzahl), weil sie eine wesentlich bessere Übersetzung der für mein Thema wichtigen Kapitel enthält als die vollständige Ausgabe, aus der ich vorher zitiert habe. Dieses Zitat stammt von S. 185.
14 Ebd.
15 Ebd.
16 EPGB, S. 186.
17 EPGB, S.193.
18 Ebd.
19 EPGB, S. 194.
20 EPGB, S. 196.
21 Ebd.
22 Georg W. Bertram / Jasper Liptow: „Zu einer antidualistischen Rekonstruktion sprachlicher Bedeutung: Robert B. Brandom und Wilfried Sellars“ in: Philosophische Rundschau, Band 48 (2001), S. 273-300. Im Folgenden als „B&L“ mit Seitenzahl.
23 B&L, S. 286.
24 B&L, S. 287.
25 Ebd.
26 B&L, S. 287.
27 Meiner Ansicht nach gibt es überhaupt keine menschliche Praxis, die nicht irgendwie normativ ist und in der die Menschen nicht in irgendeinem Sinne Sprachverwender sind.
28 B&L, S. 289.
29 Ebd.
30 Es lohnt sich nicht, bei der Bestimmung des Gehaltes des Begriffs „deontisch“ allzu viel Zeit zu verschwenden; man akzeptiere einfach, dass Brandom diesen Begriff für das von mir im Folgenden beschriebene Phänomen verwendet.
31 EV, S. 228.
32 EV, S. 229.
33 EV, S. 230.
34 EV, S. 231.
35 Donald Davidson: „Thought and Talk“, 1984, wie auch die folgenden beiden Zitate; zitiert nach: EV, S. 232.
36 EV, S. 232.
37 Davidson nach EV, S. 233.
38 Ebd.
39 EV, S. 236.
40 Wenn Brandom auf S. 239 plötzlich das Gegenteil zu behaupten scheint, sehe ich das als eine Nachlässigkeit an, die, wenn sie ernst gemeint wäre, seiner gesamten Theorie widerspräche.
41 Zum Beispiel sagt er im Gegensatz zu Sellars nichts darüber, wie wir den privilegierten Zugang zu unseren eigenen Gedanken zu erklären haben.
42 B&L, S. 291.
- Arbeit zitieren
- Stefan Weise (Autor:in), 2003, Zum Zusammenhang von Sprache und Denken bei Sellars und Brandom, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108812
Kostenlos Autor werden




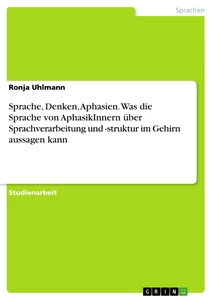















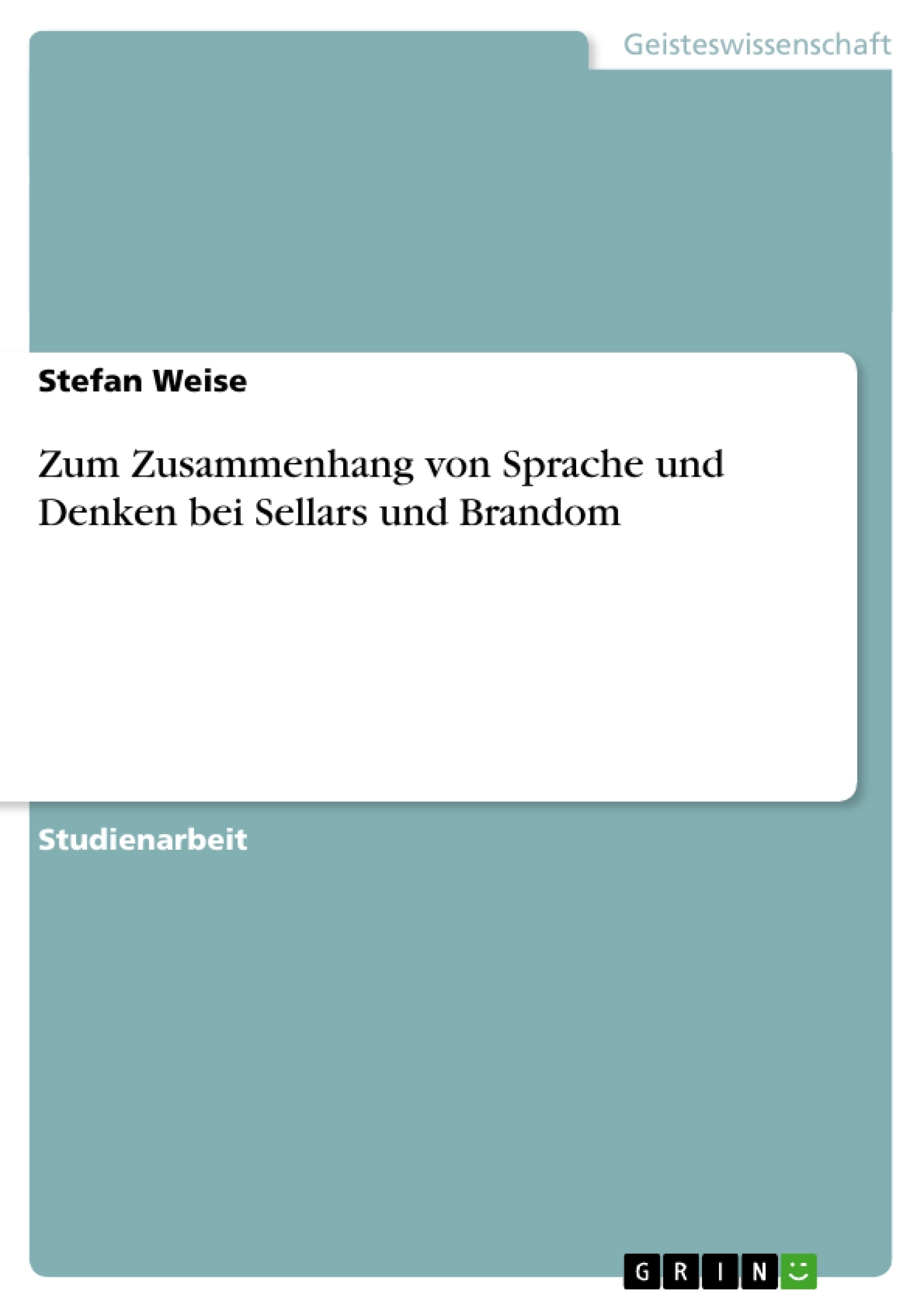

Kommentare