Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Voraussetzungen an die Form der direkten Demokratie
3. Erster Hinderungsgrund: Den Staaten Westeuropas und Nordamerikas fehlen die Voraussetzungen, um die direkte Demokratie intensivieren zu können
4. Zweiter Hinderungsgrund: Die direkte Demokratie ist der repräsentativen Demokratie unterlegen
4.1 Argumente für die direkte Demokratie
4.2 Argumente gegen die direkte Demokratie
4.3 Bewertung
5. Dritter Hinderungsgrund: Die direkte Demokratie ist gegen die Interessen der politischen Klasse
6. Voraussetzungen, die eine Intensivierung der direkten
Demokratie begünstigen
7. Ausblick
1. Einleitung
In den letzten zwanzig Jahren hat sich der Strukturtypus des liberalen demokratischen Verfassungsstaates gegenüber autoritären und totalitären politischen Organisations-alternativen überzeugend durchgesetzt.[1] Vorherrschend ist dabei jedoch weltweit der Typus der repräsentativen Demokratie, denn nur die Schweiz, einige US-Bundesstaaten und der Mikrostaat Liechtenstein kennen ausdifferenzierte direktdemokratische Elemente, während in allen anderen Staaten Volksabstimmungen über Sachfragen ausser-ordentliche politische Ereignisse darstellen.[2] Im folgenden soll nun der Frage nachgegangen werden, warum dies so ist, respektive was die Voraussetzungen und Hinderungsgründe einer Intensivierung der direkten Demokratie in Westeuropa und Nordamerika sind.
In einem ersten Schritt soll genauer erläutert werden, welche unter den vielen möglichen Formen der direkten Demokratie dieser Arbeit überhaupt zugrunde liegt und warum, was für den weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung ist. Sodann sollen drei mögliche Gründe untersucht werden, welche eine Intensivierung der direkten Demokratie verhin-dern könnten. Einerseits ist zu überprüfen, ob anderen Staaten im Gegensatz zur Schweiz gewisse notwendige Voraussetzungen fehlen, was eine Intensivierung der direkten Demokratie als unratsam erscheinen lässt. Dann könnte der Grund für die schwache Verbreitung der direkten Demokratie darin liegen, dass sie dem rein repräsen-tativen System prinzipiell unterlegen ist. Dazu werden die wichtigsten Argumente für und gegen die direkte Demokratie kurz aufgeführt, um anschliessend eine Bewertung derselben vorzunehmen. In einem dritten Erklärungsansatz wird die These untersucht, ob die Ablehnung einer Intensivierung der direkten Demokratie nicht auf den Eigen-interessen der politischen Klasse basiert. Nach der Besprechung der Hindernisse sollen die Voraussetzungen geprüft werden, unter denen eine Intensivierung der direkten Demokratie gute Chancen hat, wobei vor allem die Durchsetzung der direkten Demokratie in der Schweiz und den US-Bundesstaaten analysiert werden soll. Ein kleiner Ausblick rundet die Arbeit dann ab.
2. Voraussetzungen an die Form der direkten Demokratie
In den letzten zwei Jahrhunderten konnten mit verschiedenen Formen der direkten Demokratie, welche unter unterschiedlichen Bedingungen praktiziert wurde, Erfahrungen gesammelt werden. Um eine Intensivierung der direkten Demokratie erfolgreich zu gestalten, ist es meines Erachtens eine Voraussetzung, dass die aus der bisherigen direktdemokratischen Praxis herausgegangenen Erkenntnisse zu berücksichtigt werden. Zum anderen muss angesichts der Vielfalt der möglichen Formen festgelegt werden, was in dieser Arbeit genau unter dem Begriff direkte Demokratie und unter einer Intensivierung derselben verstanden wird.
Die Form, der eine direkten Demokratie zu genügen hat, wurde schon im Titel angedeutet, wo von „einer der Schweiz ähnlichen“ direkten Demokratie die Rede ist. Grundsätzlich sollen direktdemokratische Elemente, genauer obligatorische oder fakultative Initiativen und Referenden, das repräsentative System lediglich ergänzen und nicht ersetzen, die Gesetzgebung durch das Parlament bleibt somit der Normalfall.[3]
Die direktdemokratischen Einrichtungen müssen sodann so beschaffen sein, dass sie eine Partizipation von unten praktikabel machen, denn Volksabstimmungen sind bis jetzt eher ein Instrument der Machtausübung von oben nach unten als der Machtkontrolle von unten nach oben.[4] Die Referenden sollten nicht von der politischen Führung festgelegt werden, wie dies beispielsweise in Frankreich traditionell geschah, und so z.B. zu einer Waffe für einzelne politische Führungspersönlichkeiten zu werden.[5] Ein solcher Zustand kann geradezu als Karikatur einer direkten Demokratie bezeichnet werden.[6] Die Intensivierung der direkten Demokratie soll im Gegenteil dazu führen, dass die direkte Demokratie zu einem Routineverfahren wird, wo eine regelmässige Praxis verfassungsmässig fixierter und prozedural voll ausgebauter Systeme direktdemo-kratischer Entscheidungsfindung von unten herrscht.[7]
Um diesem Anliegen gerecht zu werden, sind insbesondere folgende Ausgestal-tungsmerkmale der direkten Demokratie zu beachten.
Als erstes sollten eine im Verhältnis zu den Stimmberechtigten moderate Anzahl Unterschriften zum Zustandekommen eines Referendums oder einer Initiative genügen und die entsprechende Sammelfrist sollte ausreichend lange ausgestaltet werden. In den deutschen Bundesländern werden laut Zach zum Teil groteske Unterschriftenquoren gefordert, so müssen in gewissen Bundesländern innerhalb von vierzehn Tagen die Unterschriften von 20 Prozent der Wahlberechtigten vorgelegt werden, damit es zu einer Auseinandersetzung mit einem Volksbegehren kommt.[8] Eine solcherart ausgestaltete direkte Demokratie kann angesichts so hoher Hürden nie zum Routineverfahren werden.
Weiter sollten auch keine Beteiligungs- oder Zustimmungsquoren eingeführt werden, da der Spielraum zwischen einem solchen Quorum, welches keine praktische Relevanz hat und einem solchen, welches die direkten Volksrechte ihrer Wirkung beraubt, sehr schmal ist.[9] In der Weimarer Republik führte ein Beteiligungsquorum für einfache Gesetze und ein Zustimmungsquorum für verfassungsändernde Gesetze von jeweils 50% der Stimmberechtigten dazu, dass Sachgegner[10] einfach der Urne fernblieben.[11]
Dann sollten pro Abstimmungstermin nicht zu viele Vorlagen angesetzt werden, ist doch in diesem Fall eine öffentliche Diskussion über Sachvorlagen nur noch bedingt möglich. Kalifornien, wo alle Abstimmungen an einem Tag gebündelt werden und die Wähler am z.B. 3. November 1998 über nicht weniger als zwölf Vorlagen und fünfzehn Wahlen entscheiden mussten, gilt diesbezüglich als schlechtes Beispiel.[12]
Weiter sollte ein genügender zeitlicher Abstand zwischen der Einreichung eines Begehrens und der Abstimmung darüber liegen, damit befürchtete emotionale Schnell-schüsse wie beispielsweise die Einführung der Todesstrafe nach einem spektakulären Verbrechen verhindert werden können.[13] Nimmt das Volksgesetzgebungsverfahren längere Zeit in Anspruch, ergeben sich ausgedehnte Abkühlungs- und Aufklärungs-phasen, welche einen Prozess des ruhigen Abwägens des Für und Wider begünstigen und überstürzte emotionale Entscheidungen verunmöglichen.[14]
Zudem sollte auch das Parlament in den Prozess der Beratung einer Initiative einbezogen werden und die Möglichkeit haben, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, denn der parlamentarische Diskussionsprozess mit dem Einbezug von Spezialisten ist in vielen Fällen notwendig, um zu ausgereiften Gesetzesvorlagen zu kommen. Durch den Gegenvorschlag nach schweizerischem Muster wird das amerikanische Problem von unausgereiften und schlecht formulierten, häufig sogar widersprüchlichen Vorlagen wirksam angegangen und es kommt zu viel positiveren Ergebnissen.[15]
Von Bedeutung ist sodann eine unabhängige Instanz, die über die Ungültigerklärung von Initiativen entscheidet. In Weimar wurden Volksbegehren durch Beschluss der Regierung abschliessend für ungültig erklärt, obwohl diese Abweisungen wohl einen Rechtsbruch darstellten.[16] Dies ist im übrigen auch ein Punkt, in dem die Schweiz Reformbedarf aufweist, beschliesst hier doch das Parlament abschliessend über die Ungültigerklärung von Initiativen und ist somit Richter in eigener Sache.[17]
Zu guter letzt soll sich die Abstimmungskompetenz des Volkes auf die ganze Politik beziehen, es sollen nicht z.B. finanzwirksame Politikbereiche davon ausgenommen werden.[18] Ein Ausschluss von Politikbereichen kann nur durch Argumente gestützt werden, die gegen die direkte Demokratie an und für sich sprechen, denn die erwähnten Finanzfragen beispielsweise, die zuoberst auf der Liste der auszuschliessenden Politikbereiche stehen, sind nicht prinzipiell komplexer als Wertfragen, z.B. die Grenzen der Gentechnologie.
Eine Intensivierung der direkten Demokratie soll sich zudem vor allem auf die obersten Ebenen eines Staates beziehen.
3. Erster Hinderungsgrund: Den Staaten Westeuropas und Nordamerikas fehlen die Voraussetzungen, um die direkte Demokratie zu intensivieren zu können
In den Debatten um die Intensivierung der direkten Demokratie kommen immer wieder zwei Argumente zum Zug, weshalb eine direkte Demokratie zwar in der Schweiz möglich sei, aber nicht in anderen Staaten. Zum einen ist der Grössenunterschied z.B. in Deutschland ein Argument gegen die Intensivierung der direkten Demokratie. So sei diese nur in einem kleinen Land möglich, das sich den Luxus leisten kann, auf Aussenpolitik zu verzichten.[19] Ist eine gewisse Kleinheit somit eine Voraussetzung eines Landes, damit die direkte Demokratie intensiviert werden kann?
Der technische Fortschritt ist einmal ein Argument, das dagegen spricht, denn die Existenz von elektronischer Kommunikation macht die physische Nähe von Bürgern nicht länger notwendig, um über politische Fragen zu diskutieren.[20] Sodann funktioniert die direkte Demokratie auch in Kalifornien, das mit 32.3 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 411500 Quadratkilometern nicht als klein bezeichnet werden kann.[21] Dass mit der direkten Demokratie auf eine Aussenpolitik verzichtet werden müsse, lässt sich aus Schweizer Erfahrungen nicht schliessen. Vielmehr trifft zu, dass das Land, wie es Bütler formuliert, aussenpolitisch gewissermassen „zu Fuss“ unterwegs ist, da es für alle wesentlichen Beschlüsse die Mehrheit des Volkes braucht.[22] Die direkte Demokratie ist in aussenpolitischen Belangen ein Instrument, das schnelles Handeln eher bremst und die Regierung und Diplomatie eines Landes beim politischen Disponieren zur Umsicht und Vorsicht zwingt.[23] Diese Position wird auch von diversen aussenpolitischen Abstimmungen europäischer Staaten gestützt. Die Erfahrungen, die mit Abstimmungen bei der europäischen Integration gemacht wurden, lassen wohl Tendenzen erahnen, wie sich eine Aussenpolitik mit Mitsprache des Volkes gestaltet. Eine solche wird anhand dieser Erfahrungen nicht verunmöglicht, wie z.B. die vielen Volksabstimmungen zeigen, die einen Beitritt eines Landes zur Europäischen Gemeinschaft befürworteten.[24] Die Regierungen wurden hingegen in einigen Abstimmungen zurückgebunden, so in Dänemark, und wären wohl zurückgebunden worden, wie Deutschland bei der Einführung des Euro.[25] Jetzt stellt sich die Frage, ob ein umsichtig und vorsichtig agierendes Grossland, das in kleinen Schritten anstatt grossen Würfen vorgeht, nicht wünschenswerter ist. Dies ist eine Wertfrage, die hier nicht behandelt werden kann, aber sicherlich lässt sich aufgrund obiger Ausführungen die Kleinheit eines Landes nicht als Voraussetzung für eine Intensivierung der direkten Demokratie vorgeben.
Weiter wird auch eine direktdemokratische Tradition als Voraussetzung eines Landes aufgefasst, damit es eine Intensivierung der direkten Demokratie vornehmen kann. Laut Klein hat sich in der Schweiz eine politische Kultur der Kontinuität und Verlässlichkeit mit erkennbar konservativem Grundtenor herausgebildet. Ohne diese Tradition könnte nun die politische Kontinuität und Berechenbarkeit der deutschen Politik gefährdet sein, falls politische Zentralfragen plebiszitär entschieden würden.[26] Nach Jesse sind die Erfahrungen der Schweiz nur begrenzt auf Deutschland übertragbar, da in Schweiz ein Regierungssystem des gütlichen Einvernehmens herrsche.[27]
Zwar ist es richtig, dass in der Schweiz eine besondere Kultur des politischen Diskurses besteht. Wenn dies jedoch als Voraussetzung für die Intensivierung der direkten Demo-kratie genommen wird, gilt es zu bedenken, dass sich eine besondere politische Kultur nur dann entwickeln kann, wenn die Bürger auch die Möglichkeit haben, über Sachfragen abzustimmen. Sie ist somit nicht nur Voraussetzung, sondern auch Folge der direkten Demokratie. Eine fehlende Tradition kann somit nur ein Argument dafür sein, die Intensivierung Schrittweise und beginnend mit den unteren staatlichen Ebenen vorzuneh-men.[28] Bütler zeigt anhand einer Anekdote, wie die direkte Demokratie Lernprozesse bei Bürgern auslösen kann, welche noch keine grosse Erfahrung im Umgang mit der direkten Demokratie aufweisen: In einer kleinen Schweizer Gemeinde waren an einer Gemeinde-versammlung der katholischen Kirche in den sechziger Jahren die damals zahlreich in der Schweiz tätigen Fremdarbeiter italienischer Herkunft in der Mehrzahl und stimmten, etwas übermütig, für einen Antrag, der vorsah, den Kirchensteuerfuss auf Null zu senken. Daraufhin mussten die Schweizer Kirchgemeindemitglieder den Italienern erklä-ren, dass es ohne Kirchgemeindesteuern keinen Pfarrer, keine Gottesdienste, Hochzeits-feiern etc. mehr geben könne. Einige Monate später stimmten auch die Italiener einem leicht reduzierten Steuersatz zu.[29] Durch eine schrittweise Einführung der direkten Demokratie kann somit eine direktdemokratische Kultur und Tradition aufgebaut[30] und politische Verantwortung gelernt werden.[31]
Eine Voraussetzung, die ein Staat hingegen mitbringen sollte, damit eine Intensivierung der direkte Demokratie erfolgreich verläuft ist eine funktionierende repräsentative Demokratie, denn die direkte Demokratie wird ja als Ergänzung der repräsentativen Demokratie verstanden.[32] In einer funktionierenden repräsentativen Demokratie sind schon viele Voraussetzungen eingeschlossen, die auch für das Funktionieren der direkten Demokratie unerlässlich sind, wie beispielsweise die Meinungsfreiheit, die ein offenes Argumentieren in Sachfragen zulässt. Zudem ist ein gewisses Bildungsniveau der Bevölkerung wohl eine Voraussetzung zur Einführung der direkten Demokratie, denn je höher die Bildung, desto besser werden Vorlagen und Abstimmungsfragen verstanden, stützt man sich auf mehr als nur eine Informationsquelle, besteht ein grösseres Fachwissen über den jeweiligen Vorschlag und herrscht auch nach subjektiver Selbst-einschätzung nur geringe Verwirrung bzw. Informationsmangel.[33] Diese Voraussetzungen bezüglich der direkten Demokratie und dem Bildungsgrad der Bevölkerung sind in den Staaten Nordamerikas und Westeuropas gegeben. Deshalb erfüllen die besagten Staaten, sofern eine Intensivierung der direkten Demokratie schrittweise und von unten erfolgt, alle Voraussetzungen, die zu einer Intensivierung der direkten Demokratie vonnöten sind. Der Grund für die schwache Verbreitung der direkten Demokratie kann somit nicht darin liegen, dass dafür die Voraussetzungen in den Staaten Westeuropas und Nordamerikas fehlen.
4. Zweiter Hinderungsgrund: Die direkte Demokratie ist der repräsentativen Demokratie unterlegen.
In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob die schwache Verbreitung der direkten De-mokratie auf eine gegenüber der repräsentativen Demokratie prinzipielle Unterlegenheit zurückzuführen ist. Eine ausführliche Gegenüberstellung repräsentativer und der direkter Demokratie würde den Rahmen dieser Arbeit angesichts der Fülle von Pro- und Contra-argumenten jedoch bei weitem sprengen, weshalb in einem knappen Rahmen die dies-bezüglich wichtigsten Argumente und Gedanken erläutert und bewertet werden sollen.
4.1 Argumente für die direkte Demokratie
Wie Frey schreibt, wird durch die direkte Demokratie am besten gesichert, dass die politischen Entscheidungen den Vorstellungen der Bürger entsprechen.[34] Das Volk wird durch Referenden in die Lage versetzt, den Einfluss der politischen Klasse zu begrenzen und potentiell zu korrigieren.[35] Durch Initiativen andererseits können Themen zur Diskussion gebracht werden, auch wenn sich die etablierten Parteien einem neuen Problem verschliessen.[36] Durch diese aktivere Rolle der Bürger werden die Politiker besser überwacht und kontrolliert, was dazu führt, dass die Entscheidungen der Politiker und Aktivitäten des Staates näher bei den Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung sind. Werden die Präferenzen der Bürger besser durchgesetzt, hat dies eine höhere Zufriedenheit mit den staatlichen Leistungen zur Folge, was ein Grund ist, warum eine stärker entwickelte direkte Demokratie laut Studien mit einem höheren allgemeinen Wohlbefinden der Bürger korreliert.[37]
Ein weiterer Vorteil der direkten Demokratie ist darin zu sehen, dass sie zur Auseinandersetzung der Bürger mit politischen Themen anregt. Die Bürger sind besser über die zur Diskussion stehenden Sachfragen informiert als in der repräsentativen Demokratie.[38] Im Falle von Sachabstimmungen haben die Politiker und andere involvierte Interessengruppen ein elementares Interesse daran, die Bevölkerung über eine anstehende Vorlage zu informieren und zu erklären, warum sie für oder gegen eine Gesetzes- oder Verfassungsänderung sind. Das Angebot von Informationen ist deshalb höher als in der repräsentativen Demokratie.[39] Wegen der direkten Betroffenheit der Bürger und aufgrund von sozialem Druck, nämlich wenn Mitbürger, mit denen man in Kontakt ist, eine guten Informationsstand erwarten, ist die Bereitschaft, Informationskosten auf sich zu nehmen, also auch die Informationsnachfrage, grösser als in der repräsentativen Demokratie.[40] So findet in einer direkten Demokratie in viel stärkerem Masse ein Diskurs mit der Bevölkerung und nicht nur innerhalb der politischen Elite statt.[41]
Ein Vorzug der direkten Demokratie wird zudem darin gesehen, dass der Frust der Bürger kanalisiert[42] und Protest artikuliert[43] werden kann. Ein Aufstau ungelöster Probleme sowie eine Marginalisierung und Radikalisierung von politischen und gesellschaftlichen Gruppen wird so verhindert.[44] Bei repräsentativen Demokratien, wo keine Möglichkeiten bestehen, die Politik durch Initiativen oder Referenden herauszufordern, wird sich Protest auf andere Art und Weise äussern, nämlich in Streiks, Demonstrationen, ja gar Krawallen.[45] Frei spricht denn in bezug auf Frankreich auch von einem Referendum der Strasse, bei dem sich die Bürger in Ermangelung eines echten Referendums ihre Rechte selber holen.[46] Durch direktdemokratische Institutionen werden die Bürger hingegen besser in die Politik einbezogen. Dies sei ein weiterer Grund für das höhere Wohlbefinden von Bürgern in einem System mit besser ausgebauter direkter Demokratie.[47]
Wie Scheyli zudem schreibt, wird die Legitimität einer getroffenen Entscheidung erhöht, falls die Möglichkeit zur direkten Beteiligung am politischen Prozess besteht und die Zustimmung zu einer Sachfrage durch eine explizite Mehrheit der abstimmenden Bürger erfolgen muss.[48] Direktdemokratische Entscheidungen haben einen demokratischen Mehrwert und erscheinen von besonderem politischem Gewicht.[49]
Umfangreiche Untersuchungen über die finanziellen Auswirkungen der direkten Demokratie auf die Gemeinden und Kantone der Schweiz kamen des weitern zum Ergebnis, dass die direkte Demokratie zu einer besseren wirtschaftlichen Performance führt: Kantone und/oder Gemeinden mit direkter Demokratie haben in Finanzfragen – jeweils ceteris paribus – geringere Staatsausgaben, eine geringere Staatsschuld, effizienter arbeitende öffentliche Betriebe sowie ein höheres Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Zudem hat die Bevölkerung ein grösseres Vertrauen in die öffentliche Verwaltung, was zu einem geringeren Ausmass an Steuerhinterziehung führt.[50]
4.2 Argumente gegen die direkte Demokratie
Das wohl traditionellste Argument gegen die direkte Demokratie, ja laut Majer letztlich die Grundlage der Repräsentationstheorie, war die Angst der Regierenden vor einem ungebildeten Volk, das weder lesen noch schreiben konnte und daher als unwissend und nicht als fähig betrachtet wurde, Sachentscheide zu fällen. Da die mangelnde Bildung in Nordamerika und Westeuropa seit langem kein Hinderungsgrund für die direkte Demokratie mehr sein kann, wandelte sich das Argument und das Parlament war nun nicht mehr eine Versammlung Fachkundiger, sondern etwas Besseres/Höheres als das Volk, ein veredelter Auszug des Volkes.[51] Dieses Argument ist auch in der heutigen Literatur zu finden. So schreibt Oberreuter, dass die Überantwortung der politischen Entscheidung an Repräsentanten den Auftrag und die Hoffnung einschliesst, den empirischen Volkswillen zu verbessern und veredeln.[52] Auch Patzelt meint, dass man in Deutschland auf Bundesebene nicht auf eine Veredelung des empirisch vorfindbaren Volkswillens verzichten sollte.[53] Parlamentarier haben ihr Mandat nicht zuletzt, um auch gegen den Volkswillen handeln zu können, falls sie dies mit Blick auf dessen langfristige Interessen für richtig erachten. Abgeordnete werden als Treuhänder und nicht als Sekretäre des Volkes gesehen.[54] In die gleiche Kerbe haut das Argument, dass es in der direkten Demokratie zu einer Entrationalisierung von Entscheiden kommt. Angesichts der Komplexität politischer Entscheidungen sei eine Überforderung der Stimmbürger zu befürchten, wobei der Stimmbürger sich dann von subjektiver Betroffenheit und mediengeprägten Stimmungen leiten lässt.[55] Den Stimmbürgern wird mit anderen Worten nicht zugetraut, dass sie vernünftige Entscheidungen fällen, sie seien mit Sachabstimmungen überfordert.
Als weiteres grundsätzliches Argument gegen die direkte Demokratie wird deren fehlende Kompromissfähigkeit beanstandet. Plebiszite verkürzten eine Entscheidung auf eine binäre Ja/Nein-Struktur, obwohl gerade die Entscheidungs- und Gesetzgebungsverfahren in pluralistischen Demokratien auf ein Höchstmass an Kompromisssuche und –findung angelegt sein müssen.[56] Plebiszite seien grobschlächtige Instrumente der Entscheidungs-findung, die eher spalten als zusammenführen.[57]
Eine weitere gehegte Befürchtung ist, dass Interessengruppen zu einem übermässigen Einfluss gelangen.[58] Plebiszite gäben aktiven Minderheiten und gut organisierten Vertretern von Partikularinteressen das Instrumentarium, um ihre Macht stärker durchzusetzen.[59] Laut Kleinewefers sind es denn auch die Interessengruppen, die das System ständig kontrollieren, ja die Volksrechte haben ein zweites Kartell von mächtigen Interessengruppen geschaffen, das zudem auch die Parteien, das Parlament und die Verwaltung in erheblichem Mass unter seine Kontrolle gebracht hat.[60]
Der wohl in Bezug auf die direktdemokratische Praxis in der Schweiz am häufigsten erhobene Vorwurf ist derjenige der Langsamkeit. Der Status-Quo werde bevorzugt und Neuerungen haben es schwer, akzeptiert zu werden.[61] Laut Germann hat die direkte Demokratie ein ausgeklügeltes Netz von Vetopositionen gewoben, das jeden Reform-anlauf zu ersticken vermag.[62] Laut Wittmann, einem der schärfsten Kritiker der direkten Demokratie in der Schweiz, ist eine Schweiz mit direkter Demokratie ausserstande, zentrale Zukunftsprobleme zu lösen und insbesondere marktwirtschaftliche Reformen zu realisieren.[63]
Für Jesse ist das stärkste Argument gegen die direkte Demokratie, dass sich Abgeordnete dem Volk verantworten müssen, die politischen Verantwortlichen können am Wahltag belangt werden, während sich das Volk nicht selber zur Verantwortung ziehen könne.[64]
Weiter werden auch historisch schlechte Erfahrungen mit der direkten Demokratie geltend gemacht. So schreibt Hornung, dass die Erfahrungen mit direktdemokratischen und plebiszitären Ideen und Programmen – angefangen von der Jakobiner-Diktatur (1793/94) über das Konzept der „wahren Demokratie“ bei Karl Marx bis hin zu den totalitären Konsequenzen des marxistisch-leninistischen Sowjetkommunismus und des „nationalsozialistischen Volksstaates“ als totalitäre Partei- bzw. Führer-Diktaturen -angesichts der Verheissungen direktdemokratischer Vorstellungen immer wieder der Vergegenwärtigung bedürfe.[65] In Deutschland wird auf schlechte Erfahrungen mit der direkten Demokratie in der Weimarer Republik verwiesen, wo Plebiszitbewegungen die politischen Gegensätze verschärft und Spannungen angeheizt haben.[66]
4.3 Bewertung
Wie ist nun mit den aufgeführten Argumenten pro und contra die direkte Demokratie umzugehen? Zum einen ist es sicherlich interessant zu sehen, was zu diesen Argumenten wiederum für Gegenargumente vorliegen.
In Bezug auf die Argumente, die für die direkte Demokratie sprechen, wird man diesbezüglich jedoch kaum fündig. Dass die Politik in der direkten Demokratie näher an den Präferenzen der Bürger ist, dass die Bürger besser über die Politik informiert sind, dass unzufriedenen Bürgern eine verbindliche, friedliche und integrierende Art der Protestäusserung gegeben wird und dass Volksentscheiden eine höhere Legitimation zukommt, wurde in all der verarbeiteten Literatur kaum bestritten respektive es wird nicht wirklich auf diese Argumente eingegangen. Hufschlag beispielsweise bespricht zwar zehn Argumente, die gegen die direkte Demokratie sprechen, aber kein einziges der aufgeführten Argumente, welche für die direkte Demokratie sprechen.[67] Rüther schreibt, dass die direkte Demokratie die Politikverdrossenheit nicht, wie von deren Befürwortern behauptet, reduziere, geht dabei aber auch nicht auf die Proargumente ein, sondern bemüht zur Begründung wieder die bekannten Argumente gegen die direkte Demokratie.[68] Einzig Rudzio versucht das Argument, dass die direkte Demokratie den Volkswillen besser zum Ausdruck bringt, dadurch zu relativieren, als laut einer Untersuchung 70 Prozent der parlamentarischen Handlungen mit der Bevölkerungs-mehrheit übereinstimmen.[69] Es spricht bei diesem Argument aber nichts dagegen, dass die Übereinstimmungsquote in der direkten Demokratie noch höher sein kann. Zudem ist die Erfassung von Volksmeinungen mittels Umfragen ein heikles Unterfangen, denn wie Rudzio selber schreibt, können die Güte der möglichen Fragestellungen, welche die Sachproblematik nicht erfassen und ungefestigten Antworten ohne vorangegangene Diskussion problematisch sein.[70]
Umstritten ist dagegen die St.Galler Studie von Kirchgässer/Feld/Savioz, nach der die direkte Demokratie zu einer besseren wirtschaftlichen Performance führt. Das komplexe ökonometrische Modell basiere auf „unechten“ Zahlen[71] und übertrage Erkenntnisse aus der Ebene der Gemeinden und Kantone unzulässigerweise auf den Bund[72]. Letzteres wird von den Autoren wiederum bestritten, da alle Argumente gegen die Übertragbarkeit von empirischen Ergebnissen auf die Bundesebene besagen, dass der positive Effekt geringer ist als auf den unteren Ebenen, jedoch gäbe es kein ernstzunehmendes Argument, weshalb sich dieser Effekt umdrehen sollte.[73] Ob die direkte Demokratie nun wirklich einen positiven Einfluss auf die Performance eines Landes aufweist, kann hier nicht abschliessend beantwortet werden. Was jedoch ein Indiz dafür ist, dass die direkte Demokratie zumindest keinen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes hat, ist die Tatsache, dass Wittmann zwar das Modell und die Schlussfolgerungen der St.Galler Ökonomen kritisiert, aber gleichzeitig keine eigenen Untersuchungen vorlegen kann, welche einen negativen Einfluss der direkten Demokratie auf die wirtschaftliche Performance nachweisen.
Bei den Argumenten der Anhänger einer repräsentativen Demokratie herrscht hingegen eine viel intensivere Diskussion.
In Bezug auf das Argument der fehlenden Fähigkeit der Stimmbürger, über eine Sachfrage vernünftig entscheiden zu können, stellen die Befürworter der direkten Demokratie die Frage, wie den Bürgern dann die Wahl von Personen anvertraut werden kann. Denn fehlt dem Volk die Fähigkeit, Sachfragen zu entscheiden, so wäre auch das allgemeine Wahlrecht kaum zu rechtfertigen.[74] Wahlentscheidungen zwischen zwei oder mehr Parteien sind mit Bezug auf die notwendigen Informationen sehr viel schwieriger als Sachabstimmungen.[75] Im Gegensatz zu den relativ leicht überschaubaren Sachent-scheidungen ist bei Wahlen über Lösungsansätze für das gesamte Spektrum von zukünftigen Sachfragen zu entscheiden und zusätzlich auch die Persönlichkeit, Fähigkeit und Glaubwürdigkeit der Kandidaten und deren bisheriger Leistungsausweis zu beurteilen.[76] Wie soll das Volk kluge und weise Volksvertreter erkennen und wählen, wenn es angeblich so leicht manipuliert und beeinflusst werden kann? Wird ein Volk, wie es von den Gegnern der direkten Demokratie charakterisiert wird, nicht einfach plumpe Populisten ins Parlament wählen?
Fraglich ist auch, ob die Parlamentarier wirklich immer über eine besseren Sachkunde verfügen. Auch Parlamentsdebatten leiden häufig an übertriebener Emotionalisierung, dem Schielen nach angeblich herrschenden Stimmungen und Polarisierungen.[77] Zudem existiert beispielsweise in Deutschland ein Fraktionszwang im Parlament, d.h. die Entscheidungen werden in Ausschüssen durch eine kleine Zahl Interessierter und Informierter getroffen und die Abgeordneten stimmen dann im Plenum entsprechend den Parolen ihrer Ausschussvertreter.[78] Zach spricht denn auch von vertraulichen Klagen von Abgeordneten über den Zwang, ergeben abnicken zu müssen, was Regierung, Fraktions- und Parteispitze in kleinem Kreis beschliessen. Welcher Parlamentarier kann so dann guten Gewissens behaupten, dass er alles versteht, was er beschliesst?[79] Die Spezialisten in den Parteien sind hingegen sehr gut über die jeweiligen Probleme informiert und tatsächlich in der Lage, überlegtere und informiertere Entscheidungen zu treffen als die Bevölkerung. Dieses Wissen geht in der direkten Demokratie jedoch nicht verloren und zudem zeigt die neue politische Ökonomie, dass solche Politiker Anreize haben, systematisch von den Interessen der Bevölkerung abzuweichen, um für sich respektive für ihre Klientel Sondervorteile herauszuholen. Es stellt sich daher die Frage, ob die wesentlich durch Spezialisten getroffenen informierteren Entscheidungen in rein repräsentativen Demokratie wirklich sachgemässer sind als Entscheidungen in direkten Demokratien, wo die Vorschläge der Spezialisten auch die Zustimmung der Bevölkerung finden müssen.[80]
Die Stimmenden sind zudem bei adäquater Ausgestaltung der direkten Demokratie gar nicht schlecht über Vorlagen informiert. Verwirrte oder uninteressierte Bürger stimmen sehr häufig gar nicht ab.[81] Umfragen, die den Stimmbürgern ein schlechtes Informations-niveau bescheinigen,[82] sind deshalb zu relativieren. Die tatsächlichen Abstimmenden sind denn auch tendenziell relativ sachkundig und empfinden die Vorlagen mehrheitlich nicht als übermässig kompliziert oder verwirrend,[83] haben sie durch den öffentlichen Diskussions- und Entscheidungsprozess doch die Möglichkeit, und auch Anreize[84], sich sachkundig zu machen.[85] Sekundäranalysen von Abstimmungen in der Schweiz zwischen 1977 und 1980 ergaben denn auch, dass ca. 80 Prozent der Stimmenden gute bis mittlere Kenntnisse des Vorlageinhalts aufwiesen.[86] Dabei sind auch Bürger mit geringerer eigener Sachkunde, die sich an Abstimmungen beteiligen, nicht völlig irrational, da sich diese bei komplizierten Abstimmungen ganz beträchtlich an bekannten Personen und Gruppen, die zum Abstimmungsinhalt Stellung bezogen haben, auszu-richten scheinen.[87] Sie lassen sich mit anderen Worten in ihren Entscheidungen durch Empfehlungen von Experten leiten,[88] wobei auch von Bedeutung ist, dass in einer direkten Demokratie die Bürger, die Spezialisten bezüglich der zur Diskussion stehenden Frage sind, aber nicht in den offiziellen politischen Diskurs eingebunden sind, sehr viel mehr Möglichkeiten haben, ihre Meinung in die Öffentlichkeit zu tragen und Einfluss auf die Entscheidung zu nehmen.[89] Zur Entschärfung des Problems der zum Teil geringen Sachkenntnis der Stimmenden trägt auch bei, dass die Stimmenden bei Verwirrung, Zweifeln und Informationsdefiziten ein Volksbegehren mehrheitlich ablehnen, es besteht somit ein von Skepsis und Vorsicht geprägtes Stimmverhalten.[90] Sodann spricht sogar für eine höhere Sachkompetenz bei Volksabstimmungen, dass bei günstigen Koordinations-prozessen das aggregierte Ergebnis individueller Entscheidungen Fehler kompensiert und ein bedeutend höheres Wissen repräsentiert, als irgendein einzelner Akteur besitzt.[91]
Mit dem Vorwurf der fehlenden Sachkompetenz und Rationalität schwingt zuweilen auch die aufklärerische Einstellung mit, dass es bei Abstimmungen nur darum geht, dem Volk die „richtige“ Meinung aufzuzeigen. Laut Schwarz ist Politik aber nicht in erster Linie Aufklärung, sondern Interessenpolitik. Es ist nicht von vornherein klar, was richtig ist und was falsch, denn sonst wäre das einzige Problem die Dummheit der Leute, welche die richtige Lösung nicht begreifen. Er erwähnt das Beispiel eines kleinen naiven Kindes, das bei der Wahl zwischen einer 20-Rappen- und einer 50-Rappen-Münze immer das 20-Rappen-Stück nimmt, weil es grösser ist. Da das Kind mit dem Geldstück nicht etwas kaufen will, sondern es als Spielzeug benutzt, ist die Wahl des Kindes rational. Politik ist Interessenwahrnehmung und nicht in erster Linie Information.[92]
In der Schweiz haben sich zudem die Argumente der Gegner nicht bestätigt. Wie Bütler meint, habe das Volk in diesem Land ein sehr realistisches Urteilsvermögen bewiesen, oft sogar ein besseres als die Politiker, die aus dem Wunsch, wiedergewählt zu werden, gerne Geschenke verteilten.[93] Auch Kleinewefers, welcher der direkten Demokratie gegenüber eigentlich eher skeptisch eingestellt ist, kommt zum Schluss, dass aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht rückblickend nur wenige Beispiele von eindeutigen Fehlentscheiden bei Volksabstimmungen zu finden sind.[94]
Bezüglich der Kompromissunfähigkeit und Grobschlächtigkeit, die der direkten Demo-kratie aufgrund der binären Entscheidungsstruktur vorgeworfen wird, kann auch der repräsentativen Demokratie der Vorwurf von binären Strukturen gemacht werden, denn auch die Entscheidung zwischen Regierung und Opposition kommt einem binären Code gleich.[95] Die Entscheidung zwischen zwei Parteien ist dabei grobschlächtiger als mehrere Entscheidungen zu Sachfragen. Zudem führt die Praxis in der Schweiz zu ganz anderen Schlüssen. Unter dem Druck eines möglichen Referendums werden möglichst breit abgestützte Lösungen gesucht, die in der Natur der Sache mehr oder weniger breite Kompromisse sein müssen. Ironischerweise wird denn gerade diese dauernde Suche nach Kompromissen der direkten Demokratie andererseits wieder vorgeworfen, da sie die Handlungsfähigkeit der Regierung einschränke.[96] Die binäre Ja/Nein-Struktur wird zudem bei Initiativen durch die Möglichkeit eines Gegenvorschlags des Parlamentes stark relativiert. Weiter entstehen bei einer Abstimmung Vorwirkungen und indirekte Effekte[97], das heisst, auch wenn nur Ja oder Nein abgestimmt werden kann, kann die Stärke der Zustimmung oder Ablehnung Effekte auslösen oder nur schon eine Diskussion kann Veränderungen bewirken.[98] Stimmbürgerbefragungen, wie in der Schweiz die Vox-Abstimmungsanalysen, können einen Volksentscheid weiter aufschlüsseln und relativieren die Ja/Nein-Struktur von Abstimmungen.
Ähnlich kann die Argumentationsstruktur auch beim Vorwurf des übermässigen Einflusses von Interessengruppen gehalten werden. Bei der repräsentativen Demokratie versuchen Interessengruppen genau gleich, ihre spezifischen Ziele zu erreichen, wobei das Lobbying jedoch viel weniger transparent ist. Dabei ist es eher schwieriger, die Mehrheit eines Volkes zu „kaufen“ als die Mehrheit eines Parlaments mit ein paar hundert Abgeordneten, insbesondere dann, wenn aufgrund eines Fraktionszwanges nur die Führungen der Regierungsfraktionen von einer Regelung überzeugt werden müssen.[99] Die Praxis zeigt zudem, dass Volksabstimmungen nicht gekauft werden können, so wurden in der Schweiz und Kalifornien mehrfach Abstimmungen gegen starke, mit grossen finanziellen Mitteln agierende Interessengruppen gewonnen[100]. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass ein wichtiger Grund für die Einführung der direkten Demokratie in der Schweiz und den US-Bundesstaaten war, dass die Interessenverbände der Wirtschaft einen übermässigen Einfluss auf die Politik hatten.[101] Zudem besteht die Möglichkeit, den Einfluss von finanzkräftigen Gruppierungen beispielsweise durch ein Verbot von Fernsehwerbung einzuschränken.
Der Vorwurfes der Langsamkeit der direkten Demokratie ist sodann sicherlich zum Teil zutreffend, jedoch in mancherlei Hinsicht zu relativieren. So kann ein Gesetz, dessen Inkrafttreten keinen Aufschub duldet, von der Mehrheit der Mitglieder jeden Rates für dringlich erklärt werden und sofort in Kraft gesetzt werden, wobei das (allfällige) Referendum nachträglich angesetzt wird.[102] Zudem ist die direkte Demokratie in Fragen schneller, der sich die etablierten Parteien verschliessen und die durch Initiativen aufs Tapet gebracht werden.[103] Weiter wird in der Langsamkeit, einem leichten Status-Quo-Bias, auch ein Vorteil der direkten Demokratie gesehen. Schwarz meint bezüglich des Status-Quo-Bias, dass dieser gar nicht unbedingt schlecht sein muss, denn etwas Neues ist nicht auch unbedingt etwas Gutes, der Status-Quo ist in vielen Fällen sogar besser.[104] Eine gewisse Langsamkeit bringt auch den Vorteil mit sich, dass es zu einer kontinuier-lichen Entwicklung eines Landes ohne radikale Ausschläge kommt, denn die Gesetzes-vorlagen müssen, um vor dem Volk bestehen zu können, ja relativ breit abgestützt sein.[105]
Ein Problem kann die Langsamkeit jedoch werden, falls sie zu einer völligen Reformunfähigkeit führt, wie dies von Wittmann suggeriert wird.[106] Entspricht dies den Tatsachen? Verschiedenste Abstimmungen der letzten Jahre, mit denen Reformen beschlossen wurden, sprechen dagegen. So wurde vom Volk eine Revision der Arbeitslo-senversicherung, des Arbeitsgesetzes, eine neue Bundesverfassung, ein Sparpaket zur Sanierung der Bundesfinanzen, die bilateralen Verträge usw. angenommen.[107] Wittmann stösst sich vor allem daran, dass in der Schweiz keine marktwirtschaftlichen Reformen durchgeführt, der Wohlfahrtsstaat ausgebaut die Steuerlast erhöht und der EWR vom Volk abgelehnt wurde.[108] Ein ganzes System zu kritisieren, nur weil einzelne Abstimmungsresultate nicht den eigenen politischen Präferenzen entsprechen, ist aber kein überzeugendes Vorgehen und spricht sicherlich nicht gegen die direkte Demokratie an und für sich. In repräsentativen Demokratien wird es auch immer Entscheidungen geben, die man persönlich für falsch hält, je nach Regierung mehr oder weniger.[109] Es ist denn im Falle Wittmanns auch sehr fraglich, ob in einer Schweiz mit repräsentativer Demokratie wirklich streng marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt worden wären und er mit den politischen Entscheidungen generell zufriedener wäre. Gerade in Bezug auf die Steuerquote ist z.B. die verhältnismässig niedrige Steuerbelastung in der Schweiz nicht zuletzt dem System ausgebauter direkter Demokratie zu verdanken.[110]
Auf den Vorwurf, dass sich das Volk im Gegensatz zu den Parlamentariern niemandem verantworten muss, kontert von Arnim, dass man sich ja nur verantworten muss, wenn man jemanden vertritt. Handelt man hingegen selber, muss man sich nur sich selber verantworten. In der direkten Demokratie handelt das Volk selber und ist von den Konsequenzen der gefällten Entscheide, z.B. einem offensichtlichen Fehlentscheid, selber betroffen, was die beste Gewähr für sinnvolles Verhalten ist.[111]
In Bezug auf historische Erfahrungen kommt nur der eingangs vorgenommenen Definition der konkreten Form der direkten Demokratie besondere Bedeutung zu, denn viele historische Erfahrungen beziehen sich, wie z.B. im Falle von französischen oder vor allem nationalsozialistischen Plebisziten, auf Formen der direkten Demokratie, die als Akklamationsabstimmungen einen völlig anderen Charakter aufweisen als diejenige Form, welche dieser Arbeit zu Grunde liegt. Aus diesem Grund werden solche Erfah-rungen hier nicht weiter besprochen.
In Weimar konnte das Volk hingegen von sich aus tätig werden, ein Zehntel der Stimmberechtigten konnte eine Gesetzes- oder eine Verfassungsinitiative einreichen.[112] Da die Bedingungen für eine Anwendung der Initiative aber sehr restriktiv waren[113], es wurde z.B. schon im Kapitel 2 auf das Zustimmungsquorum von 50% der Stimmberechtigten verwiesen, war eine erfolgreiche Initiative praktisch ausgeschlos-sen.[114] Die Volksgesetzgebung war somit ein Nebenschauplatz der Volksgesetzgebung, ein Verfahren zweiter Wahl mit unverkennbarem Protestcharakter.[115] So kamen lediglich drei Initiativen in das Stadium des Unterschriftensammelns und nur bei zweien kam es dann auch zu einer Abstimmung, wobei beide Begehren abgelehnt wurden.[116] Dabei gibt es keinen Beleg dafür, dass diese Versuche der Volksgesetzgebung die allgemeine Radikalisierung wesentlich begründet oder entscheidend vorangetrieben hätten.[117] Die Diskussionen im Vorfeld der Abstimmungen eröffneten zwar den extremen Parteien Agitationsmöglichkeiten, welche zur Polarisierung beitrugen, aber die Volksabstimmung-en waren nicht so sehr Ursache, sondern Ausdruck der Krise. Dies auch deshalb, weil bei den wenigen Volksbegehren jeweils ein echtes Versagen des parlamentarischen Repräsentativsystems vorlag. So bestritt die SPD 1928 mit dem Wahlkampfslogan „Kinderspeisung statt Panzerkreuzer“ einen erfolgreichen Reichstagswahlkampf, reduzierte jedoch nach der Wahl als Regierungspartei weder die Rüstungsausgaben noch verhinderte sie eine Streichung der Gelder für die Schülerspeisung.[118] Eine Initiative, welche die gebrochenen Wahlkampfversprechen nun auf dem Weg des Volksbegehrens durchsetzen wollte, war in diesem Kontext nur logisch. Zudem ergaben sich ähnliche, wenn nicht noch stärkere Agitationsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Wahlen. Das Ende der Weimarer Republik wurde dann durch das vom Reichstag verabschiedete Ermächtigungsgesetz endgültig besiegelt. Nicht das Volk hatte Hitler jemals die Mehrheit gegeben, sondern die Parlamentarier haben einen legalistischen Schein über Hitlers Gewaltherrschaft gebreitet.[119] Laut Jung war die Abschaffung der Volksgesetzgebung im Nachkriegsdeutschland denn auch eine schier handgreifliche Fehltherapie, da die Volksgesetzgebung, um in einer technischen Metapher zu sprechen, als ein „Sicherheitsventil“ betrachtet werden muss. Keinem Ingenieur würde es nun einfallen, das Ventil als schuldig zu bezeichnen und auszubauen. Nach der Logik der Abschaffung der Volksrechte hätte man, so wie die deutsche Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aussieht, noch eine Menge anderer Dinge abschaffen können, den hochgelobten Parlamentarismus eingeschlossen. So bliebe es denn auch zu begründen, warum nach 1945 in vielen Fällen versucht wurde, es besser zu machen, während der direkten Demokratie keine Chance mehr gegeben wurde.[120]
Für interessant halte ich das Gedankenspiel, dass bei einer besseren Ausgestaltung der direkten Demokratie die nach 1933 einsetzende Katastrophe hätte verhindert werden können.[121] Die Krise der Weimarer Republik war wesentlich durch das Versagen der Parteien begründet.[122] Nun ist es denkbar, dass dieses Versagen durch die Volksrechte zumindest teilweise korrigiert hätte werden können, indem die Möglichkeit bestanden hätte, durch Volksbegehren die Politik näher an die Präferenzen der Bevölkerung zu zwingen und Unzufriedene durch legale Möglichkeiten, die Regierung herauszufordern, besser in die staatlichen Institutionen einzubinden.
Der Umgang mit den historischen Erfahrungen scheint mir bezüglich der Argumentations-schemen gewisser Gegner einer Intensivierung der direkten Demokratie bezeichnend zu sein. Die Schweiz, die auch als Laboratorium der direkten Demokratie bezeichnet wird,[123] kommt der in dieser Arbeit vorgenommene Definition der direkten Demokratie am nächsten. Die Argumente für oder gegen die direkte Demokratie müssen sich somit vor allem an den Verhältnissen der Schweiz messen. Die Erfahrungen der Schweiz werden aber von den Anhängern der repräsentativen Demokratie oft völlig übergangen oder verzerrt dargestellt. Rüther spricht in der Einleitung eines Sammelbandes mit lauter Voten für die repräsentative Demokratie zwar von positiven Erfahrungen, welche die Schweiz mit der direkten Demokratie gemacht habe,[124] aber im ganzen folgenden Buch wird darauf praktische nicht mehr eingegangen, sondern es werden einzelne Elemente wie eine relativ tiefe Stimmbeteiligung in der Schweiz herausgepickt und negativ ausge-legt,[125] ohne dessen Hintergrund zu erklären. Dabei können viele Befürchtungen, die mit einer Intensivierung der direkten Demokratie einhergehen, anhand der praktischen Erfahrungen der Schweiz relativiert oder als gegenstandslos bezeichnet werden.
Bei der Besprechung der Argumente gegen die direkte Demokratie scheint sich zudem eine Aussage von Budge zu bewahrheiten, wonach es sehr schwierig zu verhindern ist, dass sich Argumente gegen die direkte Demokratie zu Argumenten gegen die Demokratie an und für sich entwickeln.[126] Die direkte Demokratie ist beileibe kein perfektes System, ein solches wird es wohl auch nie geben. Wie der Argumentationsaustausch aber zeigte, können Vorwürfe, die gegen die direkte Demokratie erhoben werden, oft genauso auf die repräsentative Demokratie angewandt werden, zum Teil sogar noch im stärkeren Mass. In diesem Zusammenhang wird auch die Bedeutung ersichtlich, dass bei einem Vergleich konkrete Institutionen miteinander verglichen werden und nicht irgendwelche Ideal- oder Zerrbilder. Es ist z.B. ein leichtes, die direkte Demokratie an einem Idealbild der repräsentativen Demokratie zerschellen zu lassen. Ein solcher utopischer Vergleich ist jedoch nicht aussagekräftig. Für einen Vergleich geeignet sind zum Beispiel die Schweiz, als Musterland der direkten Demokratie, und Deutschland, mit einem fast rein repräsen-tativen System.[127]
Die direkte Demokratie scheint der repräsentativen Demokratie somit nicht unterlegen zu sein, sondern es bestehen wohlbegründete Anhaltspunkte, dass die direkte Demokratie der repräsentativen Demokratie sogar überlegen ist. Das Argument einer grundsätzlichen Unterlegenheit der direkten Demokratie kann somit kein Hinderungsgrund für eine Intensivierung der direkten Demokratie sein.
5. Dritter Hinderungsgrund: Die direkte Demokratie ist gegen die Interessen der politischen Klasse
Da die Ablehnung einer Intensivierung der direkten Demokratie sachlich schwierig zu begründen ist, stellt sich nun die Frage, ob eine ablehnende Haltung gegenüber der Demokratie nicht dadurch verursacht wird, dass die damit einhergehenden Verände-rungen nicht im Interesse der Politiker sind. Mit anderen Worten drängt sich die Vermutung auf, dass die Politiker nicht an der besten Institution für das Volk, sondern an der besten Institution für sich selber interessiert sind.
Zach schreibt bezüglich der mit der direkten Demokratie einhergehenden Veränderungen, dass die etablierte Politik durch direktdemokratische Aktionen gezwungen wird, erstmals die Existenz gleichrangiger Politiksubjekte ausserhalb ihrer konkludenten Beziehungshierarchien anzuerkennen. Dieser für das Selbstverständnis von Parteipoliti-kern ungewohnte und bedrohlich erscheinende Systembruch wird zunächst gefürchtet und bekämpft.[128] In einer streng repräsentativen Demokratie gibt es oberhalb der Kommunalebene keinen real erfahrbaren, in grosser Zahl akkumulierter Bürgerwillen mehr. Als massgeblicher Faktor Indikator für den Bürgerwillen wird das mediale Meinungsspektrum aufgefasst, weil es als Machtfaktor anerkannt, als Informationsquelle unersetzlich und als Ansprechpartner jederzeit verfügbar ist. Die Medien zu überzeugen ersetzt deshalb den Diskurs mit den Bürgern. Dadurch hat sich die in einer repräsentativen Demokratie ohnehin angelegte Bürgerferne verfestigt, der adäquate politische Umgang mit dieser gesichtslosen Masse sind periodische Popularitätsabfragen in Wahlgängen von hohen Emotions- und geringem Informationsgehalt. Politisch handelnde und kompetent argumentierende Bürgerinitiativen durchbrechen nun diese Anonymisierung, was bei den angestammten Vertretungsorganen enorme Konkurrenz- und Existenzängste auslöst und insbesondere für alleinregierende Parteien eine bestürzende Erfahrung ist.[129] Ähnlich die Einschätzung von Frey, wonach die direkte Demokratie den politischen Interessen der Regierenden quer läuft und aus ihrer Sicht die Arbeit kompliziert. In der direkten Demokratie wird generell die Macht der Politiker begrenzt, weshalb sie zu deren stärksten Gegnern gehören.[130]
Die Politiker fürchten nach diesen Ausführungen somit eine Relativierung ihrer Machtpo-sition und eine Begrenzung ihrer Macht. Diese Befürchtungen sind denn auch begründet. Wie im bisherigen Verlauf der Arbeit hervorgegangen ist, ändert sich für Politiker in der direkten Demokratie, dass sie besser kontrolliert werden, sie mehr Erklärungsarbeit leisten müssen und für sie mehr politische Ungewissheit und Unberechenbarkeit herrscht. Durch die stärkere Kontrolle können Politiker weniger nach eigenem Gutdünken handeln, falls sie politische Veränderungen in ihrem Sinne wollen, müssen sie mehr Überzeu-gungsarbeit im Volk leisten und trotzdem besteht je nach Vorlage eine grössere oder kleinere Ungewissheit darüber, wie das Volk dann entscheiden wird, was die Politik schlechter planbar macht. So fällt nicht nur ihre Macht als letzte Entscheidungsinstanz weg, die Politik wird auch anstrengender, es muss mehr gerechtfertigt und erklärt werden. Der Politiker wird, um es etwas plakativ auszudrücken, vom Führer zum Diener degradiert. Es scheint einleuchtend zu sein, dass eine solche Änderung der eigenen Rolle den wenigsten Politikern attraktiv erscheint.
Neben den eben genannten Gründen gibt es laut von Arnim für die Politiker auch sehr handfeste materielle Gründe, eine Intensivierung der direkten Demokratie zu bekämpfen. Er nennt diese Gründe das sogenannte Versorgungsinteresse der Politiker. Dies sei das Interesse, das für die meisten Berufspolitiker im Vordergrund stehe, nämlich von der Politik möglichst gut und möglichst auf Dauer leben zu können. Das Versorgungsinteresse kann gleichzeitig von allen Politikern befriedigt werden, die Opposition wird regelmässig ebenfalls an den politischen Pfründen beteiligt, um zu verhindern, dass diese öffentlich und wählerwirksam dagegen opponiert. Deshalb verfolgen die Politiker ihr Versorgungs-interesse am wirkungsvollsten durch Kooperation und Kollusion, was zu Kartellierungs-tendenzen führt. Die Versorgungsinteressen werden dadurch zum Problem, dass die Inte-ressenten selbst an den Schalthebeln der staatlichen Macht sitzen und ihre Interessen deshalb direkt in Gesetze oder Haushaltstitel umsetzen können, was in Deutschland bisher vor allem bei Regeln deutlich geworden sei, die unmittelbar den Erwerb von Macht, Posten und Geld betreffen. Er erwähnt diesbezüglich vor allem die Finanzierung von Parteien, die zu mehr als 60 Prozent aus der Staatskasse subventioniert werden und die beinahe gänzlich staatliche Finanzierung von Fraktionen und Parteistiftungen.[131]
Die Politiker haben nun allen Grund, bei einer Intensivierung um diese Gelder zu fürch-ten. Wie Untersuchungen über die Politikfinanzierung in verschiedenen Ländern zeigen, hat die direkte Demokratie diesbezüglich einen mässigenden Einfluss. In der Schweiz hat das fakultative Gesetzesreferendum die Einführung einer staatlichen Parteienfinanzierung verhindert und dazu beigetragen, dass die Abgeordnetenentschädigung und Fraktionsfinanzierung sehr gering sind.[132] Im Gegensatz zu Österreich und der Schweiz wird Abgeordneten nach ihrem Ausscheiden aus dem Parlament auch kein Übergangsgeld und keine Altersvorsorge gewährt.[133] Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die Politiker bei einer Intensivierung der direkten Demokratie materiell eher schlechter gestellt werden. Unter diesen Umständen erhält auch der Vorschlag, dass finanzwirksame Politikbereiche von der Abstimmungskompetenz ausgenommen werden[134], einen schalen Beigeschmack. Es scheint, dass dem Druck nach direkter Demokratie nur unter der gleichzeitigen Absicherung von persönlichen materiellen Vorteilen nachgegeben werden soll.
Der wohl wichtigste Hinderungsgrund für die Intensivierung der direkten Demokratie scheinen somit die Eigeninteressen der politischen Klasse zu sein, welche durch die direkte Demokratie an Macht verliert, in eine undankbarere Rolle gezwungen wird und materiell tendenziell schlechter gestellt wird.
6. Voraussetzungen, die eine Intensivierung der direkten Demokratie begünstigen
Nach den bisherigen Ausführungen stellt sich nun die Frage, unter welchen Voraussetzungen die direkte Demokratie entgegen den Präferenzen der Politiker intensiviert werden kann. Wie bei der Einführung der direkten Demokratie in der Schweiz und den USA beobachtet werden kann, scheinen vor allem drei Elemente die Durchsetzungschancen der direkten Demokratie zu begünstigen.
Als wichtige Voraussetzung, um eine Intensivierung der direkten Demokratie durchzusetzen, wird das Versagen der repräsentativen Demokratie im Bezug auf das Lösen von drängenden Problemen gesehen.[135] Die Unzufriedenheit mit den repräsentativen Organen und den politischen Parteien lässt den Ruf nach direkter Demokratie jeweils lauter ertönen.[136] In den US-Staaten wurde die Volksgesetzgebung erstritten, weil der Staat den Anliegen breiter Bevölkerungskreise aufgrund einer korrupten politischen Elite nur sehr bedingt entgegenkam. Die Führer der Parteien waren eng mit der Lobby von Wirtschaftsunternehmen verfilzt und die Konzerne waren in der Lage, die von den korrupten Parteien aufgestellten Kandidaten mit verschiedensten Arten der Bestechung für sich zu gewinnen.[137] Ein extremes Beispiel war der Einfluss der „Southern Pacific Railroad“ in Kalifornien. Diese Eisenbahngesellschaft hielt den gesamten kalifornischen Staat im Griff und bestimmte über Mittelsmänner nicht nur die Kandidaten für Staatsämter, sondern diktierte auch Parteiprogramme.[138] Durch die Einführung eines Referendums sollten nun korrupte Gesetze blockiert und durch die Initiative auf korrupten Einflüssen basierendes Untätigbleiben überwunden werden.[139]
Zum Teil verblüffend ähnlich waren die Verhältnisse und Motive bei der Intensivierung der direkten Demokratie in der Schweiz. Wie Kölz schreibt, wandten sich die Demokraten beim Kampf für die direkte Demokratie im Kanton Zürich gegen eine als drückend empfundene Parlamentsherrschaft der Liberalen, welche es verstanden, eine bildungs- und besitzaristokratisch geprägte politische Hegemonie aufzurichten und in enger Verbindung mit dieser auch weite Teile des Wirtschaftslebens zu kontrollieren. So konnte die liberale Führungsschicht mit Hilfe von Alfred Escher das Eisenbahn- und Kreditwesen weitgehend zugunsten der Hauptstadt Zürich und der vermögenden Leute und zulasten der Landschaft, Winterthurs und der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerung steuern.[140]
Die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden scheint eine logische Voraussetzung zur Intensivierung der direkten Demokratie zu sein, denn Bestehendes überdacht und für neues gekämpft wird zumeist nur, falls eine gewisse Unzufriedenheit, ein gewisser Unmut herrscht. Die Politiker haben es somit ein Stückweit selber in der Hand, wie gross der Druck zur Intensivierung der direkten Demokratie ist.
Dann ist die Gefestigtheit des bestehenden politischen Systems eines Landes von Bedeutung. Die direkte Demokratie konnte sich in den USA vor allem in den westlichen Bundesstaaten durchsetzen, während es in den anderen Regionen wesentlich schwieriger oder gar nicht möglich war, Initiative und Referendum zu etablieren. Ein Grund hierfür war, dass sich die westlichen Staaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch in den frühen Phasen ihrer politischen Entwicklung befanden und deshalb für Neuerungen offener waren.[141] Da die politischen Systeme heutzutage in allen Ländern Europas und Nord-amerikas gefestigt sind und das Stadium einer frühen Phase der politischen Entwicklung eines Landes etwas einmaliges ist, kann dies heute in den besprochenen Staaten keine Voraussetzung mehr sein, welche eine Intensivierung der direkten Demokratie begünstigt.
Sodann schienen basisdemokratische Traditionen eine wichtige Rolle zu spielen. In der Schweiz fielen die direktdemokratischen Ideen laut Möckli auf fruchtbaren Boden, da sie wegen der vorfindbaren Tradition der Landsgemeinden nicht als etwas neues betrachtet wurden, sondern als etwas, das schon seit Jahrhunderten gelebt wurde.[142] Auch in den USA waren versammlungsdemokratische Traditionen vorhanden, welche die Durchsetz-ung von direktdemokratischen Elementen begünstigten. Die frühen Städte Neuenglands wurden durch informelle town-meetings regiert, an denen alle erwachsenen Männer teilnehmen und das Wort ergreifen konnten.[143] Im Osten der USA setzte sich die direkte Demokratie denn auch nur in Massachusetts und Maine durch, zwei Staaten mit besonders starker direktdemokratischer Tradition.[144] Direktdemokratische Traditionen und Kulturen bedeuten im Prinzip nichts anderes, als dass die direkte Demokratie schon bekannt und vertraut ist, dass man mit dieser Institution schon Erfahrungen gesammelt hat. Ein solches ist auch heutzutage noch möglich, eine Tradition und Kultur kann gerade durch die Praxis der direkten Demokratie auf unteren Staatsstufen geschaffen werden, wo der Einsatz der direkten Demokratie auch viel unumstrittener ist. Die Vertrautheit mit der direkten Demokratie kann so als zweite heute wichtige Voraussetzung bezeichnet werden, welche eine Intensivierung der direkten Demokratie begünstigt.
7. Ausblick
Um in die Zukunft zu schauen, sollte zuerst ein Blick in die Vergangenheit geworfen werden. Wie Budge ausführt wurde im Laufe der letzten zweihundert Jahre in den Demokratien mehr und mehr Bevölkerungsgruppen das Wahlrecht verliehen: Der Mittelklasse, ethischen und religiösen Minderheiten, Arbeitern und Frauen. Jede dieser Wahlrechtsverleihungen provozierte Widerstand und Niedergangsprophezeiungen. Die neuen Wähler wurden als ausserstande angesehen, gute Repräsentanten auszuwählen. Ihre Anführer wurden als Demagogen und ihre Parteien als subversiv vorverurteilt. Mittlerweile sind die meisten Erwachsenen in demokratischen Gesellschaften im Besitz des Wahlrechts. Eine Erweiterung der Demokratie dreht sich nun nicht mehr um die Frage, ob neuen Gruppen das Wahlrecht verliehen werden soll, sondern ob den existierenden Wählern erweiterte politische Mitgestaltungsmöglichkeiten gegeben werden sollen. In dieser Diskussion werden nun wieder die genau gleichen Befürchtungen über ein ignorantes Stimmvolk oder die Machtübernahme einer tyrannischen Mehrheit laut wie bei früheren Erweiterungen der Demokratie.[145]
Wie die Ausführungen Budges zeigen, bewegten sich die Demokratien in den letzten Jahrzehnten langsam, aber sicher in eine Richtung, welche der Bevölkerung mehr und mehr Mitsprache bescherte. Längerfristig wird sich meines Erachtens der Trend hin zu einer Form der direkten Demokratie, wie sie der Schweiz ähnlich ist, bewegen. Die Hürden, die einer Intensivierung der direkten Demokratie entgegenstehen, sind zwar wohl grösser als diejenigen bei einer Erweiterung des Wahlrechts, da letzterem keine Politikerinteressen entgegenstehen. Aber aufgrund der Tatsache, dass der Hinderungs-grund für eine Intensivierung der direkten Demokratie hauptsächlich in den Eigeninte-ressen der politischen Klasse liegt, wird sich eine rein repräsentative Demokratie argumentativ immer schwieriger verteidigen lassen. Durch den Gebrauch der direkten Demokratie auf unteren Staatsebenen wird der Keim zu einer direktdemokratischen Tradition gelegt. Zudem ist die Sympathie für die direkte Demokratie in der Bevölkerung gross[146]. Die Prognose sei deshalb gewagt, dass die direkte Demokratie in den Staaten Westeuropas und Nordamerikas in einigen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten eine viel wichtigere Rolle als heute spielen wird.
Literaturverzeichnis
Budge, Ian (1996). The new challenge of direct democracy. Cambridge: Polity Press.
Bracher, Karl Dietrich (1996). „Massendemokratie und plebiszitäre Gefährdung“. In:
Rüther, Günther (Hrsg.), Repräsentative und plebiszitäre Demokratie – eine
Alternative?. Baden-Baden: Nomos, S. 315-318.
Brunetti et al. (1997). „Diskussion“, In Borner, Silvio/Rentsch, Hans (Hrsg.), Wieviel direkte Demokratie verträgt die Schweiz?. Chur, Zürich: Rüegger, S. 205-213.
Bütler, Hugo (2000). „Direkte Demokratie – aus schweizerischer Sicht“. In: Von Arnim, Hans Herbert (Hrsg.), Direkte Demokratie. Berlin: Duncker & Humblot, S. 175-187.
Drysch, Thomas (1994). Finanzierung der Politik in Österreich, in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Speyer: Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.
Ergebnisse der Vorlagen an eidgenössischen Volksabstimmungen. Online im Internet:
URL:http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/index.html [Stand 25.2.2003].
Frei, Christoph (1995). Direkte Demokratie in Frankreich: Wegmarken einer schwierigen
Tradition. Vaduz: Liechtensteinische akademische Gesellschaft.
Frey, Bruno (1997). Neubelebung: direkte Demokratie und dynamischer Föderalismus.
In: Borner, Silvio/Rentsch, Hans (Hrsg.), Wieviel direkte Demokratie erträgt die
Schweiz?. Chur, Zürich: Rüegger, S. 183-205.
Frey, Bruno S./Stutzer, Alois (2000). „Happiness, Economy ans Institutions”. The
economic journal, 110, S. 918-938.
Gebhardt, Jürgen (2000). „Das Plebiszit in der repräsentativen Demokratie“. In: Von
Arnim, Hans Herbert (Hrsg.), Direkte Demokratie. Berlin: Duncker & Humblot, S. 13-27.
Germann, Raimund E. (1993) „Aufnahme plebiszitärer Elemente ins deutsche Grundgesetz: Was lehren die Schweizer Erfahrungen?“. In: Link, Werner/ Schütt-Wetschky, Eberhard/Schwan, Gesine (Hrsg.), Jahrbuch für Politik.
Baden-Baden: Nomos, S. 219-238.
Heussner, Hermann K. (1994). Volksgesetzgebung in den USA und in Deutschland. Köln:
Heymann.
Heussner, Hermann K. (2000). „Wurzeln und Durchsetzung direktdemokratischer
Verfahren in den USA“. In: Von Arnim, Hans Herbert (Hrsg.), Direkte Demokratie.
Berlin: Duncker & Humblot, S. 199–218.
Hornung, Klaus (1996). „Plebiszitäre Demokratie und totalitäre Diktatur. Historische
Erfahrungen mit direktdemokratischen Ideen und Programmen“. In: Rüther,
Günther (Hrsg.), Repräsentative oder plebiszitäre Demokratie – eine Alterntive?.
Baden-Baden: Nomos, S. 73-95.
Hufschlag, Hans-Peter (1999). Einfügung plebiszitärer Komponenten in das Grundgesetz?
Baden-Baden: Nomos.
Jesse, Eckhard (1996). „Mehr plebiszitäre Elemente in der Parteiendemokratie?“. In:
Rüther, Günther (Hrsg.), Repräsentative oder plebiszitäre Demokratie – eine Alternative?. Baden-Baden: Nomos, S. 170–183.
Kaase, Max (1995). „Demokratie im Spannungsfeld von politischer Kultur und politischer
Struktur“. In: Link, Werner/ Schütt-Wetschky, Eberhard/Schwan, Gesine (Hrsg.),
Jahrbuch für Politik. Baden-Baden: Nomos, S. 199-220.
Kaina, Viktoria (2002). „Direkte Demokratie als Ausweg? Repräsentativverfassung und
Reformforderungen im Meinungsbild von Politikeliten und Bevölkerung“. Zeitschrift für Politikwissenschaft, 12, S. 1045-1072.
Kirchgässner, Gebhard/Feld, Lars P./Savioz, Marcel R. (1999). Die direkte Demokratie.
Modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig. München: Franz Vahlen.
Klein, Josef (1996). „Plebiszite in der Mediendemokratie“. In: Rüther, Günther (Hrsg.),
Repräsentative oder plebiszitäre Demokratie – eine Alternative?. Baden-Baden:
Nomos, S. 244-261.
Kleinewefers, Henner (1997). „Die direkten Volksrechte in der Schweiz aus ökonomischer
Sicht“. In: Borner, Silvio/Rentsch, Hans (Hrsg.), Wieviel direkte Demokratie
verträgt die Schweiz?. Chur, Zürich: Rüegger.
Kölz, Alfred (1998). Der Weg der Schweiz zum modernen Bundesstaat. Historische
Abhandlungen. Chur: Rüegger.
Luthardt, Wolfgang (1994). Direkte Demokratie. Ein Vergleich in Westeuropa.
Baden-Baden: Nomos.
Majer, Diemut (2000). „Die Angst der Regierenden vor dem Volk. Verfassungs- und
geistesgeschichtliche Betrachtungen zu den Schwierigkeiten direktdemokratischer Bürgerbeteiligung seit 1789“. In: Von Arnim, Hans Herbert (Hrsg.), Direkte Demokratie. Berlin: Duncker & Humblot, S. 27-51.
Möckli, Silvano (1994). Direkte Demokratie. Ein internationaler Vergleich. Bern: Haupt.
Oberreuter, Heinrich (1996). „Repräsentative und plebiszitäre Elemente als sich
ergänzende politische Prinzipien“. In: Rüther, Günther (Hrsg.), Repräsentative und plebiszitäre Demokratie – eine Alternative?. Baden-Baden: Nomos, S. 261–277.
Patzelt, Werner J. (1996). „Imperatives Mandat und plebiszitäre Elemente: Nötige
Schranken der Abgeordnetenherrlichkeit?“. In: Rüther, Günther (Hrsg.),
Repräsentative und plebsizitäre Demokratie – eine Alternative?. Baden-Baden:
Nomos, S. 183-201.
Ritterbach, Manfred E. (1976). Repräsentative und direkte Demokratie. Bonn: Eichholz.
Rudzio, Wolfgang (1996). „Parteiendemokratie und Repräsentation“. In: Rüther, Günther
(Hrsg.), Repräsentative oder plebiszitäre Demokratie – eine Alternative?. Baden-Baden: Nomos, S. 136-149.
Rüther, Günther (1996). „Was verbirgt sich hinter der Forderung nach mehr direkter
Demokratie? Eine Einführende Betrachtung.“. In: Rüther, Günther (Hrsg.),
Repräsentative oder plebiszitäre Demokratie – eine Alternative?. Baden-Baden:
Nomos, S. 9-33.
Koller, Heinrich (1997). „Die Reform der Volksrechte: Differenzierende Weiterentwicklung
im Paket“. In: Borner, Silvio/Rentsch, Hans (Hrsg.), Wieviel direkte Demokratie
verträgt die Schweiz?. Chur, Zürich: Rüegger, S. 25-51.
Scheyli, Martin (2000). Politische Öffentlichkeit und deliberative Demokratie nach
Habermas. Bade-Baden: Nomos.
Schiffers, Reinhard (2000). „Schlechte Weimarer Erfahrungen?“. In: Von Arnim, Hans
Herbert (Hrsg.), Direkte Demokratie. Berlin: Dunker & Humblot, S. 51-67.
Von Arnim, Hans Herbert (2000). Vom schönen Schein der Demokratie. Politik ohne
Verantwortung – am Volk vorbei. München: Knaur.
Weidenfeld, Werner (2000). „Europäische Einigung im historischen Überblick“. In:
Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang (Hrsg.), Europa von A bis Z –
Taschenbuch der europäischen Integration. Bonn: Europa-Union. Online im
Internet: URL:http://www.cap.uni-muenchen.de/download/2000/einigung.pdf
[Stand 25.2.2003].
Wittmann, Walter (2001). Direkte Demokratie. Bremsklotz der Revitalisierung.
Frauenfeld: Huber.
Zach, Manfred (2000). „Kontrolle der politischen Klasse durch direkte Demokratie?“. In:
Von Arnim, Hans Herbert (Hrsg.), Direkte Demokratie. Berlin: Duncker & Humblot, S. 137–147.
[...]
[1] Kaase (1995), S. 199.
[2] Möckli (1994), S. 18.
[3] Von Arnim (2000), S. 182.
[4] Gebhardt (2000), S. 19.
[5] Frei (1995), S. 27.
[6] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 162.
[7] Gebhardt (2000), S. 16.
[8] Zach (2000), S. 141.
[9] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 183.
[10] Zur einfacheren Leserlichkeit wurde auf die Berücksichtigung der weiblichen Formen verzichtet.
Selbstverständlich sind weibliche Akteurinnen immer mitgemeint.
[11] Schiffers (2000), S. 60.
[12] Kirchgässer, Feld, Savioz (1999), S. 139.
[13] Ritterbach (1976), S. 12.
[14] Von Arnim (2000), S. 184.
[15] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 140.
[16] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 162.
[17] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 188.
[18] Hufschlag (1999), S. 292.
[19] Germann (1993), S. 221.
[20] Budge (1996), S. 1.
[21] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 33.
[22] Bütler (2000), S. 184.
[23] Bütler (2000), S. 185.
[24] Weidenfeld, Werner (2000), S. 5
[25] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 57.
[26] Klein (1996), S. 256.
[27] Jesse (1996), S. 179.
[28] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 34.
[29] Bütler (2000), S. 178.
[30] Bütler (2000), S. 185.
[31] Majer (2000), S. 46.
[32] Möckli (1994), S. 17.
[33] Heussner (1994), S. 414.
[34] Frey (1997), S. 184.
[35] Luthardt (1994), S. 159.
[36] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 22.
[37] Frey, Stutzer (2000), S. 921.
[38] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 59.
[39] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 57f.
[40] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 54f.
[41] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 199.
[42] Majer (2000), S. 46.
[43] Heussner (2000), S. 212.
[44] Scheyli (2000), S. 125.
[45] Budge (1996), S. 192.
[46] Frei (1995), S. 29.
[47] Frey, Stutzer (2000), S. 921.
[48] Scheyli (2000), S. 123.
[49] Von Arnim (2000), S. 191.
[50] Kirchgässner, Feld, Savioz, (1999), S. 105.
[51] Majer (2000), S. 34.
[52] Oberreuter (1996), S. 267.
[53] Patzelt (1996), S. 194.
[54] Patzelt (1996), S. 186.
[55] Hufschlag (1999), S. 284.
[56] Hufschlag (1999), S. 282f.
[57] Patzelt (1996), S. 186.
[58] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 24.
[59] Hufschlag (1999), S. 286.
[60] Kleinewefers (1997), S. 66.
[61] Jesse (1996), S. 179.
[62] Germann (1993), S. 222.
[63] Wittmann (2001), S. 16.
[64] Jesse (1996), S. 179.
[65] Hornung (1996), S. 73.
[66] Germann (1993), S. 221.
[67] Hufschlag (1999), S. 279ff.
[68] Rüther (1996), S. 14ff.
[69] Rudzio (1996), S. 139.
[70] Rudzio (1996), S. 141.
[71] Wittmann (2001), S. 41.
[72] Wittmann (2001), S. 31f.
[73] Kirchgässner, Feld, Savioz, S. 108.
[74] Heussner (1994), S. 420.
[75] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 194.
[76] Heussner (1994), S. 421f.
[77] Heussner (1994), S. 418.
[78] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 56.
[79] Zach (2000), S. 144.
[80] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 59f.
[81] Heussner (1994), S. 414.
[82] Möckli (1994), S. 186.
[83] Heussner (1994), S. 415.
[84] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 54.
[85] Kirchgässner, Feld,Savioz (1999), S. 108.
[86] Möckli (1994), S. 187.
[87] Heussner (1994), S, 415.
[88] Heussner (1994), S. 417.
[89] Kirchgässner, Feld, Savioz, S. 58f.
[90] Heussner (1994), S. 410f.
[91] Kleinewefers (1997), S. 69f.
[92] Brunetti et al. (1997), S. 209.
[93] Bütler (2000), S. 183.
[94] Kleinewefers (1997), S. 70.
[95] Kaase (1995), S. 208.
[96] Germann (1993), S. 232.
[97] Bütler, (2000), S. 178.
[98] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 23.
[99] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 31.
[100] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 27f.
[101] Heussner (1994), S. 44.
[102] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 21.
[103] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 21f.
[104] Brunetti et al. (1997), S. 209.
[105] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 24.
[106] Wittmann, (2001), S. 41.
[107] http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/index.html
[108] Wittmann (2001), S. 41f.
[109] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 5.
[110] Koller (1997), S.43.
[111] Von Arnim (2000), S. 186f.
[112] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 146f.
[113] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 146.
[114] Schiffers (2000), S. 62.
[115] Schiffers (2000), S. 53.
[116] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 149f.
[117] Schiffers (2000), S. 63
[118] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 151.
[119] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 154.
[120] Jung (1989), S. 149.
[121] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 162.
[122] Schiffers (2000), S. 63.
[123] Von Armin (2000), S. 275.
[124] Rüther (1996), S. 11.
[125] Bracher (1996), S. 315.
[126] Budge (1996), S. 2f.
[127] Kirchgässner, Feld, Savioz (1999), S. 16.
[128] Zach (2000), S. 142.
[129] Zach (2000), S. 143f.
[130] Brunetti et al. (1997), S. 205f.
[131] Von Arnim (2000), S.33ff.
[132] Drysch (1994), S. 102.
[133] Drysch (1994), S. 100.
[134] Hufschlag (1999), S. 292.
[135] Möckli (1994), S. 176f.
[136] Möckli (1994), S. 24.
[137] Heussner (1994), S. 47.
[138] Heussner (2000), S. 206.
[139] Heussner (1994), S. 47.
[140] Kölz (1998), S. 86.
[141] Heussner (2000), S. 208.
[142] Möckli (1994), S. 38.
[143] Möckli (1994), S. 65.
[144] Heussner (2000), S. 208.
[145] Budge (1996), S. 190f.
[146] Kaina (2002), S. 1045.
- Arbeit zitieren
- Matthias Dornbierer (Autor:in), 2003, Voraussetzungen und Hinderungsgründe einer Intensivierung direkter Demokratie in den Staaten Westeuropas und Nordamerikas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108796
Kostenlos Autor werden









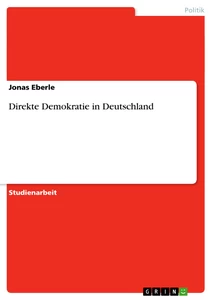












Kommentare