Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1. Kapitel: Heutiger Stand der Hirnforschung
2. Kapitel: Der Aufbau der Libet-Experimente
3. Kapitel: Die Methoden der Hirnforschung
4. Kapitel: Kritik an den Methoden und Aussagen der Hirnforschung
Fazit
Einführung
Die Neurowissenschaften genießen hinsichtlich der Diskussion über die Willensfreiheit besondere Beachtung. Da die Wissenschaft überhaupt einen hohen Stellenwert in unserer heutigen Gesellschaft hat, meint man oft, auch die Hirnforschung sei heute in der Lage, ein hochphilosophisches und bis heute auf der Ebene der Philosophie bislang ungelöstes Problem wie das der Willensfreiheit mittels ihrer Methoden lösen zu können. Die Hirnforschung, so scheint es, sei in der Lage, Fragen, mit denen sich die Menschheit seit Jahrhunderten beschäftigt und auf die sie nie eine eindeutige Antwort fand, zu beantworten. Viel zu selten wird dabei jedoch nach der Methode, die hinter der jeweiligen wissenschaftlichen Aussage steckt, gefragt, und danach, ob die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Neurowissenschaften gerechtfertigt sind. Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Frage zu untersuchen, ob die Neurowissenschaften zum heutigen Zeitpunkt das Problem des freien Willens beantworten können. Um es deutlicher zu formulieren: In welchem Verhältnis stehen die heutigen Erkenntnisse der Neurowissenschaften zu ihren Methoden? Denn die Hirnforschung hat natürlich schon längst Antworten auf die Frage, ob unser Wille frei ist. Aber worauf stützen sich diese Antworten? Rechtfertigen Versuchsergebnisse und Daten diese Antworten? Ich komme hierbei zu dem Schluss, dass die Hirnforschung heute noch keine Antwort auf die Freie-Wille-Problematik geben kann und dass die Erkenntnisse der Neurowissenschaften in keinem Verhältnis zu ihren heutigen Methoden steht; ja, dass diese Erkenntnisse sogar insgesamt falsch sind. Ich stütze mich bei dieser Behauptung vor allem auf den Artikel ‚What do brain data really show?’ von Valerie Hardcastle und Matthew Stewart in der Zeitschrift ‚Philosophy of Science’. Im Hintergrund dieser Untersuchung steht die Aussage, dass der freie Wille eine subjektive Erfahrung ist, die aus der objektiven bzw. der 3.- Person- Perspektive nicht beobachtbar oder erfahrbar ist. Searle weist in seinem Aufsatz ‚Free Will as a problem in neurobiology’ darauf hin, dass wir durchaus die Erfahrung eines freien Willens haben (‚experience of the gap’)[1], daher sollen auch wissenschaftstheoretische Überlegungen herangezogen werden. Denn wenn dem so ist, wenn der freie Wille tatsächlich nur subjektiv erfahrbar ist, dann müsste die Hirnforschung, wenn sie denn eine Antwort auf die Freie-Wille-Problematik hat, einen Weg bzw. eine Methode gefunden haben, diesen freien Willen dennoch objektiv ‚sichtbar’ zu machen. Im nächsten Kapitel wird sich zeigen, dass die heutige Antwort der Hirnforschung auf die Frage, ob wir einen freien Willen haben oder nicht, sich unter anderem auf den so genannten Libet-Experimenten beruht, die vom Hirnforscher Benjamin Libet 1979 und in den frühen 1980er Jahren durchgeführt wurden. In dieser Hausarbeit soll keine Diskussion über das ‚Für’ oder ‚Gegen’ den freien Willen geführt werden.
2. Kapitel: Heutiger Stand der Hirnforschung
Um es gleich vorweg zu nehmen: Hirnforscher sind sich heute größenteils darin einig, dass der freie Wille eine Illusion ist. Begründet wird diese Aussage zum einen mit den Ergebnissen einer Reihe von Experimenten in den frühen 1980er Jahren, welche vom amerikanischen Neurophysiologen Benjamin Libet durchgeführt wurden, und zum anderen auf den Ergebnissen anderer Methoden in der Hirnforschung, so z.B. der Untersuchung psychisch-kranker Menschen. Zu den Methoden der Hirnforschung will ich jedoch erst im nächsten Kapitel etwas sagen. Zunächst soll der heutige Stand der Hirnforschung bezüglich des freien Willens näher betrachtet werden.
Die Hirnforschung sieht heute überwiegend das Gehirn nach einem ‚Modularitäts – Prinzip’ aufgebaut[2]. Das bedeutet, dass für jedes menschliche Verhalten und Gefühl ein bestimmter Bereich im Gehirn zuständig ist. So ist z.B. der als ‚Primär-motorischer Cortex’ bezeichnete mittlere Teil des Gehirns zuständig für die Steuerung einzelner Muskeln bei Willkürbewegungen.[3] Diese Ansicht vom ‚Modularitäts-Prinzip’ geht im Wesentlichen zurück auf den Begründer der ‚Schädellehre’ (Phrenologie), dem deutschen Mediziner Franz Joseph Gall (1758-1828).[4] Durch verschiedene Methoden, die ich erst im nächsten Kapitel besprechen werde, wurden und werden jedem Hirnareal eine bestimmte Funktion zugeordnet. Den menschlichen Bewegungen der Arme und Beine ist ein Hirnareal zugeordnet, und ebenso dem menschlichen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Gerhard Roth, Hirnforscher an der Universität Bremen, verdeutlicht den Weg von unseren Überlegungen über den ‚freien Willen’ zur Ausführung der Handlung nun so, wobei er sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Libet-Experimente stützt: Führt der Mensch Handlungen aus, so wird in seinem Gehirn das motorische Areal aktiviert. Dieses unterteilt sich in den ‚Primären-Motorischen Cortex (MC)’, den ‚Prämotorischen Cortex (PMC)’, und den ‚Supplementär-Motorischen Cortex (SMA)’.[5] Jedes dieser „Unterbereiche“ des Motorischen Areals, ist für bestimmte Willkürbewegungen zuständig. So ist der ‚Primäre-Motorische Cortex’, wie vorhin schon einmal kurz erwähnt, zuständig für die Steuerung einzelner Muskeln, der ‚Prämotorische Cortex’ steuert komplexe Muskel- und Gelenkbewegungen, und der ‚Supplementär-Motorische Cortex’ kontrolliert und plant komplexe Bewegungsabläufe.[6] Nun, so Roth, sei es so, dass bei willentlichen Entscheidungen, eine bestimmte Handlung auszuführen, diese ‚Untergebiete’ des motorischen Areals in einer bestimmten Reihenfolge ‚aktiviert’ werden. Vor den Aktivitäten in diesen Hirn-Unterregionen werden noch der ‚Präfrontrale und der Parietale Cortex’ aktiviert. Diese Aktivitäten, die im Motorischen Areal und im ‚Präfrontalen und Parietalen Cortex’ vor einer Handlung auftreten, können als elektrische Veränderungen in diesem Hirnareal gemessen werden und werden in der Hirnforschung als ‚Bereitschaftspotential’ bezeichnet.[7] Darüber hinaus gehen diesem ‚Bereitschaftspotential’ aber noch Aktivitäten voraus. So konnten vor dem Bereitschaftspotential schon Aktivitäten im Kleinhirn festgestellt werden. Das Kleinhirn hängt mit dem limbischen System zusammen, in welchem vor allem Gefühle angesiedelt sind.[8] Roth erklärt nun weiter, dass das Bewusstsein des Menschen in der Großhirnrinde sitzt, wo auch das motorische Areal und der ‚freie Wille’ vorhanden sind. Das Kleinhirn jedoch fällt in das Gebiet des Unterbewusstseins. Bildlich lässt sich der Ablauf einer ‚willentlich’ entschiedenen Handlung grob vereinfacht in etwa so darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Bereitschaft, eine bestimmte Handlung auszuführen, steht demnach bereits schon vor der (bewussten) Entscheidung fest. Das Gehirn hat sozusagen bereits entschieden, bevor der Mensch selbst seine bewusste Entscheidung dazu fällt. Für Libet, auf dessen Experimente zur Erforschung des freien Willens sich auch Roth stützt, ist der freie Wille nichts anderes als ein ‚Veto’, dass der Mensch gegenüber der schon beschlossenen Handlung noch einsetzen kann.[9] Während jedoch Libet dem freien Willen eine eigenständige Existenz einräumt und offenlässt, woher denn nun der freie Wille kommt und ob dieser determiniert ist oder nicht[10], schließt Roth aus den Libet-Experimenten und den bisherigen Erkenntnissen der Hirnforschung radikal, dass der subjektive freie Wille eine Illusion ist, und lehnt die subjektive Willenserfahrung ab.[11] Libet selbst jedoch spricht seinen Experimenten keine Entscheidungsrolle zu in der Frage, ob wir einen freien Willen haben oder nicht. Im nächsten Kapitel soll kurz auf den Aufbau der Libet-Experimente eingegangen werden und im darauffolgenden Abschnitt auf die Methoden der Hirnforschung, um zu zeigen, wie die Neurowissenschaften zu ihren heutigen Erkenntnissen über den freien Willen gelangt(e).
3. Kapitel: Der Aufbau der Libet-Experimente
Da der freie Wille eine subjektive Erfahrung ist, musste Benjamin Libet versuchen, den freien Willen dennoch in irgendeiner Weise zu ‚objektivieren’. Dazu überlegt sich Libet Folgendes: In einem Experiment sollten die Versuchspersonen auf eine oszillierende Uhr schauen und in dem Moment, in dem sie zum ersten Mal den Wunsch verspürten, eine Handlung auszuführen, sich den Zeitpunkt merken. Der genannte Zeitpunkt auf der Uhr sollte demnach als objektives Messinstrument des freien Willens gelten. Zuerst definierte Libet, was er unter dem freien Willen versteht und wie er ihn definiert: „First, there should be no external control or cues to affect the occurrence or emergence of the voluntary act under study; that is, it should be endogenous. Second, the subject should feel that he or she wanted to do it, on her or his own initiative, and feel he or she could control what is being done, when to do it or not to do it.”[12]
Während des Experimentes wollte Libet das Bereitschaftspotential (‚readiness potential’) messen, um zu sehen, zu welchem Zeitpunkt dieses einsetzt. Das Experiment war nun so aufgebaut, dass die Versuchspersonen während eines bestimmten Zeitraumes, wenn sie den Wunsch verspürten, ihre Hand bewegen sollten und sich den Zeitpunkt, in dem sie sich ihres Wunsches bewusst wurden, merken sollten.[13] Während des Experimentes zeigte sich nun, dass das Bereitschaftspotential bereits 550 Millisekunden vor den ersten Muskelbewegungen auftrat, während die Angaben der Versuchspersonen, zu welchem Zeitpunkt sie denn zum ersten Mal den Wunsch verspürten, ihre Hand zu heben, erst 200 Millisekunden vor den ersten Muskelbewegungen stattfanden.[14] Wie waren diese Daten zu interpretieren? Wie schon im vorherigen Kapitel erwähnt, interpretierten Hirnforscher wie Gerhard Roth die Daten als Beweis dafür, dass wir keinen freien Willen haben. Libet äußerte sich skeptischer - und zwar nicht nur zu den Daten seines Experimentes, sondern auch zu so mancher Methode der Neurowissenschaften. Dazu aber erst im übernächsten Kapitel. Für Libet stand nach seinen Experimenten auf jeden Fall fest, dass das Bewusstsein ein Phänomen für sich sei.[15] Genau wie Searle weist auch Libet auf eine Lücke zwischen dem freien Willen als subjektives und als objektives Phänomen hin: „There is an unexplained gap between the category of physical phenomena and the category of subjective phenomena.“[16]
Zwar, so Libet, gehe dem ‚freien Willen’ das Bereitschaftspotential schon vor, aber dennoch will Libet dem freien Willen eine Art Kontrollfunktion zusprechen.[17] Libet macht letztenendes jedoch deutlich, dass weder die Annahme eines freien, noch eines unfreien Willens jemals experimentell bestätigt wurde.[18] Er selbst zweifelt somit auch die Aussagekraft seines eigenen Experimentes an. Nach meiner Auffassung tendiert Libet eher zum Indeterminismus, denn erstens macht er mehr als einmal darauf aufmerksam, dass die Annahme eines Determinismus des freien Willens bislang unbewiesen ist, zweitens spricht er – wie vorhin schon erwähnt – von einer Lücke zwischen subjektiver Willenserfahrung und der objektiven Sicht des freien Willens, und drittens nimmt er an, dass der Wille relativ autonom ist, da er ihm die Rolle einer Kontrollfunktion und eines Vetos zuspricht.
Nachdem die Libet-Experimente in diesem Kapitel kurz dargestellt wurden, soll im nächsten Kapitel auf die Methoden der Hirnforschung eingegangen werden. Denn es stellt sich ja die Frage, mit welchen Methoden die Hirnforschung überhaupt zu den Erkenntnissen kommt, dass z.B. ausgerechnet die Mitte des Gehirns für die motorischen Fähigkeiten des Menschen zuständig sein sollen.
4. Kapitel: Die Methoden der Hirnforschung
Nun kann ich natürlich nicht auf jede einzelne Methode der Hirnforschung eingehen. Denn das würde den Umfang dieser Hausarbeit übersteigen. Ich werde in diesem Kapitel nur auf vier Methoden eingehen, die für das Problem der Willensfreiheit wichtig sind. Ich werde diese Methoden einzeln darstellen und jede einzelne Methode kurz zusammenfassen und die Vorgehensweise erläutern. Das Ziel dieser vier Methoden ist im Grunde genommen dasselbe: die Lokalisierung von Zuständigkeitsbereichen im Gehirn. Die folgende Auflistung der für die Erforschung des freien Willens in den Neurowissenschaften relevanten Methoden ist zwar von mir selbst in dieser Form eingeteilt worden, dennoch wird es bei den Methoden untereinander Überschneidungen geben z.B. zwischen der ‚Läsions-‚Methode und dem Subtraktionsverfahren. Bei dieser Auflistung beziehe ich mich auf Kischka[19], Roth[20] und Hardcastle/Stewart[21]. Die folgenden vier Methoden sind:
A. Die Subtraktions-Methode
Beschreibung: Bei der Substraktions-Methode wird, wie der Name schon sagt, etwas subtrahiert, nämlich unterschiedliche Spannungen im Gehirn. Roth bezeichnet diese Methode als solche, „um spezifische von unspezifischen Stoffwechselerhöhungen infolge erhöhter Hirnaktivität unterscheiden zu können.[22]
Vorgehensweise: Um bestimmten Hirnregionen mittels dieser Methode eine bestimmte Funktion zuordnen zu können, werden Experimente mit Versuchspersonen durchgeführt, welche in diesem Experiment die Verhaltensweise, die man untersuchen will, durchführen sollen. Zur Messung der Hirnströme wird ein Elektroenzephalogramm (EEG) verwendet. Ebenso wird heute das Magnetenzephalogramm (MEG) verwendet. Dieses Messgerät ist besser als das EEG dazu in der Lage, Hirnströme zu registrieren und die Lokalisierung bestimmter funktioneller Hirnregionen zu erleichtern.[23] Nun werden der Versuchsperson Oberflächenelektroden angebracht, durch welche das EEG oder das MEG die Hirnströme registrieren soll. Das Experiment wird nun unter zwei verschiedenen Bedingungen durchgeführt, wie Roth schon sagte, danach werden die elektrischen Spannungen, die vom EEG/MEG während des Experimentes unter Bedingung 1 gemessen wurden, mit denen aus dem Experiment unter der Bedingung 2 subtrahiert. In dem Hirnbereich, in dem die größten elektrischen Spannungsdifferenzen auftauchen, dort vermutet man dann auch den Zuständigkeitsbereich des Gehirns für das im Experiment untersuchte Verhalten. Ein EEG wurde auch von Libet in seinen Experimenten verwendet, um das Bereitschaftspotential zu messen.
B. ‚Einzelzell’-Aufnahmen
Beschreibung: Diese Methode findet bei niederen Tieren (z.B. Blutegeln) Anwendung. Hierbei werden einzelne Neuronen des Tieres elektrisch stimuliert und dann die Verhaltensauswirkungen auf das Tier beobachtet. Lassen sich solche Verhaltensauswirkungen feststellen, so wird von dem Ergebnis des Experimentes an diesem Tier auf höhere Lebewesen geschlossen.
Vorgehensweise: Hierbei werden Elektroden an bestimmte einzelne Neuronen des Tieres angebracht und elektrisch stimuliert. Daraufhin wird beobachtet, welches Verhalten dieses Tier nach der Stimulation zeigt. Beobachtet man ein bestimmtes Verhalten dieses Tieres nach der elektrischen Stimulation durch die Elektroden, so nimmt man an, dass diese bestimmten Neuronen oder Hirnregionen für dieses jeweilige Verhalten zuständig sind. Dann schließt der Hirnforscher von den Ergebnissen des Experimentes an diesem Tier auf die Hirnfunktionen höherer Lebewesen, d.h. er geht davon aus, dass, würden bei einem höheren Lebewesen (auch bei einem Menschen) dieselben Neuronen elektrisch stimuliert, so träten dieselben Verhaltensweisen, die z.B. ein Blutegel aufweist, auch beim höheren Lebewesen auf. Das Verhältnis von Hirn-/Nervenregion zu den Verhaltensauswirkungen wird also analog auf höhere Tierarten übertragen.[24] Gerade dies ist ein wesentlicher Kritikpunkt an den Methoden der Hirnforschung, der übrigens nicht nur von Hardcastle/Matthew, sondern auch von Libet zumindest angesprochen wird.
C. Die ‚Läsions’-Methode
Beschreibung: Bei dieser Methode werden verletzte Hirnregionen (‚Läsionen’) im Verhältnis zu Funktionsstörungen in menschlichen oder tierischen Verhaltensweisen. Werden die Verletzungen bestimmter Hirnregionen nur bei solchen Menschen oder Tieren gefunden, die eine bestimmte Verhaltensstörung aufweisen, so vermutet man einen Zusammenhang zwischen der jeweiligen Hirnregion und der jeweiligen Verhaltensweise. Die Vorgehensweise bei Mensch und Tier ist dabei unterschiedlich.
Vorgehensweise beim Tier: Beim Tier wird in einem Experiment eine bestimmte Hirn- oder Zellregion bewusst zerstört, um zu beobachten, welche Verhaltensstörungen daraus resultieren. Hardcastle meint hierzu, Hirnforscher würden oft versuchen, diese Methode mit dem ‚single cell recording’ zu verbinden.[25] Dabei werden ebenso wie bei der Methode der ‚Einzelzell-‚Aufnahme meistens einfache und niedere Tierarten untersucht. Beim Versuchstier wird nun versucht, eine bestimmte Hirnregion zu zerstören, um zu beobachten, welche Verhaltensänderungen oder -störungen auftreten. Treten Verhaltensänderungen auf, so wird wie bei den ‚Einzelzellaufnahmen’ von den Gehirnen niederer Lebewesen auf die höherer geschlossen.[26]
Vorgehensweise beim Menschen: Aufgrund ethischer Bedenken lässt sich die Vorgehensweise der ‚Läsions’-Methode bei den Tieren natürlich nicht auf den Menschen anwenden. Hier beobachtet man stattdessen psychisch oder physisch eingeschränkte Menschen. Bei diesen Menschen untersucht sucht man nun nach beschädigten Hirnregionen. Hat man solche gefunden, so wird vermutet, dass die Verletzung dieser Hirnregion für die psychische oder physische Störung verantwortlich ist. So geht z.B. die Erkenntnis, dass die mittlere Hirnregion (d.h. der motorische Bereich) für die Bewegungsabläufe des Menschen zuständig ist, auf Patienten zurück, die an der Parkinson-Krankheit, dem Tourette-Syndrom oder dem ‚alien hand syndrome’ leiden. Bei all diesen Patienten, so Libet, könne man eine Schädigung des prämotorischen Bereiches nachweisen.[27] Auch dass die gesamte Verhaltenssteuerung auf vom frontalen Cortex aus gesteuert wird, geht laut Walter auf die Beobachtung von Patienten zurück, bei denen diese Region verletzt ist und die Patienten zugleich physische Störungen aufweisen (z.B. das eben angesprochene ‚alien hand sydrome’).[28]
D. Bildgebende Verfahren
Beschreibung: Hierbei bilderzeugende Techniken genutzt, die das Gehirn und sein Stoffwechsel bildlich projezieren sollen, um so Hirnregionen ausfindig zu machen, welche für bestimmte Verhaltensweisen des Menschen verantwortlich sein sollen.
Vorgehensweise: Die bei dieser Methode verwendete Technik „beruhen auf der … Tatsache, dass neuronale Erregungen von einer lokalen Erhöhung der Hirndurchblutung und des Hirnstoffwechsels (vornehmlich hinsichtlich des Sauerstoff- und Zuckerverbrauchs) begleitet sind.“[29]
Daher werden Messinstrumente verwendet, deren Funktion es ist, den Stoffwechsel im Gehirn zu messen und bildlich wiederzugeben. Als erstes werden der Versuchsperson Stoffe verabreicht, welche radioaktive Isotope enthalten (z.B. radioaktive Sauerstoff-Isotope). Diese Stoffe mit den radioaktiven Isotopen gelangen nun ins Gehirn und werden dort verbraucht. Währenddessen führt die Versuchsperson bestimmte Handlungen aus, von der man wissen will, welche Hirnregion dafür verantwortlich ist. Und da gerade in der Hirnregion der Stoffwechsel am größten sein müsste, die für die gerade vollzogene Handlung zuständig ist, so müsste auch in dieser Region die meisten radioaktiven Sauerstoff-Isotope vorhanden sein. Gemessen wird diese Radioaktivität, die ja beim Zerfall der Isotope entsteht, durch eine Positronen-Emissions-Tomographie (PET) oder eine Kernresonanzspektroskopie (MRI).[30] Ein PC wandelt nun die Daten des PET oder MRI in ein Bild vom Gehirn um, entweder in zwei- oder dreidimensionaler Ansicht. Auf diesem Bild wird dann der Stoffwechsel im Gehirn farblich dargestellt, so dass man erkennen kann, in welcher Region der Stoffwechsel besonders hoch ist. Demzufolge ist dann auch diese Hirnregion zuständig für die im Experiment ausgeführte Handlung.
Nachdem nun hier die Methoden der Hirnforschung, die sie anwendet, um bestimmten Hirnregionen bestimmte Funktionen zuzuordnen, vorgestellt wurden, geht es im nächsten Kapitel um die Kritik an eben diesen Methoden, der Vorgehensweise und den heutigen Erkenntnissen der Neurowissenschaften.
5. Kapitel: Kritik an den Methoden und Aussagen der Hirnforschung
Schon der ‚Versuchsleiter’ der Libet-Experimente, welche als repräsentativ für die Möglichkeit einer ‚neurowissenschaftlichen’ Antwort angesehen werden, äußert nicht nur Bedenken seinen eigenen Experimenten gegenüber, sondern auch über so manche Methode in der Hirnforschung: „It is common in scientific researches to be limited technically to studying a process in a simple system; and then to find that the fundamental behavior discovered with the simple system does indeed represent a phenomenon that appears or governs in other related and more complicated systems.“[31]
Auch Henrik Walter warnt vor einer linearen Betrachtung des Gehirns in der Hirnforschung.[32]
Am Radikalsten formulieren aber Hardcastle und Matthew das Problem an der bisherigen Hirnforschung: „We want to claim that neuroscientists’ assignments of function to brain regions or areas are not warranted by the data. They are not warranted because their simplifying assumptions of localization of function and functionally constancy are radically false.”[33]
Beide sehen also zum einen erhebliche Differenzen zwischen den Methoden der Hirnforschung und den Aussagen der Hirnforschung über das ganze Gehirn, zum anderen sind sämtliche heutige Erkenntnisse über die Funktionen des Gehirns nicht nur unbewiesene Annahmen, sondern darüber hinaus auch noch falsche Annahmen. Der Fehler beginnt für Hardcastle/Stewart schon in der Annahme der Hirnforscher, das Gehirn sei nach einem ‚Modularitäts’-Prinzip aufgebaut. Aber nicht etwa nur deshalb, weil es bislang keine experimentellen Daten gibt, welche dieses Prinzip verifiziert hätten[34], sondern weil diese Annahme schon die Methode vorgibt, wie Neurowissenschaftler das Gehirn erforschen sollen. Denn wenn angenommen wird, das Gehirn sei in einzelne Funktionsbereiche eingeteilt, von denen jeder für eine bestimmte menschliche Verhaltens- und Erkenntnisart zuständig sein soll, so wird ein Neurowissenschaftler seine Methoden auch so ausrichten, dass es ihm möglich ist, diese Annahme zu verifizieren. So kritisieren Hardcastle/Stewart die Analogieschlüsse, in denen bei der ‚Läsions’-Methode und der der ‚Einzelzellaufnahmen’ immer wieder von den experimentellen Ergebnissen der niederen Tiere auf die Gehirne höherer Lebewesen 1:1 geschlossen wird. Und das, obwohl es doch leicht einzusehen ist, dass das Gehirn eines Menschen wesentlich komplexer ist als das z.B. das Gehirn einer Fliege. Denn während es bei einer Fliege mit ein paar hundert Neuronen noch einfach ist, durch die Methode der ‚Einzelzell’-Aufnahmen Schlüsse über die Funktionen einzelner Neuronen zu ziehen, dürfte dieses Verfahren bei dem Gehirn eines höheren Säugetieres scheitern. Hinzu kommt noch, dass selbst bei den primitivsten Gehirnen die einzelnen Regionen keineswegs voneinander isoliert, sondern miteinander verbunden sind. Neurowissenschaftler beschäftigen sich jedoch immer nur mit einer bestimmten Region des Gehirns, weil sie ja das ‚Modularitäts’-Prinzip nachweisen wollen und dieses ihnen somit auch die Vorgehensweise vorgibt. Ein weiterer Kritikpunkt an dieser Methode ist der, dass nur an toten niederen Tieren experimentiert wird, was selbst Aussagen über lebende niedere Tiere erschweren dürfte.
Die Probleme der ‚Läsions’-Methode sind nach Hardcastle/Stewart sowohl technischer als auch theoretischer Natur. Technisch gesehen ist die ‚Läsions’-Methode deshalb irreführend, weil die Bandbreite der Auswirkungen der Schädigung einer bestimmten Hirnregion auf ein bestimmtes Verhalten viel zu groß ist, um daraus verwertbare Daten zu gewinnen. Egal, wie oft die Schädigung an bestimmten Hirnbereichen einer niederen Tierart wiederholt wird, die Ausmaße in den Verhaltensweisen der jeweiligen Tierart sind einfach nicht einheitlich. Das theoretische Problem der ‚Läsions’-Methode liegt darin, dass jedes Nervensystem, so primitiv es auch sein mag, durchaus in der Lage ist, Schäden zu kompensieren. Genauso, wie wenn bei einseitigem Nierenversagen die andere die Aufgabe der ‚ausgefallenen’ Niere übernehmen kann, so ist auch ein Gehirn in der Lage, Teilschäden auszugleichen - manchmal sogar vollständig, so dass sich mit dem Schadensausgleich auch die Anatomie des Gehirns umformen und der ‚neuen’ Situation anpassen kann. Beide Probleme sind den Neurowissenschaftlern bekannt, werden aber ignoriert.[35] Der nächste Kritikpunkt richtet sich gegen die Substraktionsmethode und die bildgebenden Verfahren. Hier weisen Hardcastle/Stewart zum einen darauf hin, dass es bislang keine Evidenz gibt, warum die größte Spannungsdifferenz ausgerechnet mit dem im Experiment ausgeführten Verhalten etwas zu tun haben sollte; zum anderen hänge der ‚Erfolg’ der Substraktionsmethode von der ‚Grobheit’ der Messgeräte ab. Mit zunehmender Verfeinerung der Messgeräte dürften auch mehr Unterschiede in den Hirnaktivitäten festzustellen sein, was dann auch zunehmend gegen das ‚Modularitäts’-Prinzip sprechen dürfte. Die Auflösung heutiger bildgebender Messgeräte wie dem PET oder MRI ist sehr gering und wird der Komplexität des Gehirns – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – nicht gerecht. Ein Problem, auf das auch Kischka hinweist: „SPECT und PET lassen wegen der geringen räumlichen Auflösung keine Aussagen im mikroskopischen Bereich einzelner Neuronenverbände oder gar einzelner Ganglienzellen zu.“[36] Schwierigkeiten bereiten auch die ‚chemischen Einschränkungen’ der bilderzeugenden Messgeräte. Denn das PET beispielsweise ist so programmiert, dass es nur den Stoffwechsel misst, der auch die betreffenden Isotope enthält. Hirnaktivitäten aber, die während des Experimentes nicht direkt diesen Stoffwechsel durchführen würde, aber dennoch für die jeweilige Handlung verantwortlich wäre, würden vom Messgerät gar nicht erfasst werden. Ebenso wäre es möglich, dass der zum Zeitpunkt des Experimentes gemessene Stoffwechsel ganz oder teilweise mit anderen oder noch weiteren Abläufen im oder am Körper der Versuchsperson zusammenhängt.
Als Letztes führen Hardcastle/Stewart noch ein wirtschaftliches Problem an: Es existieren unter den Neurowissenschaftlern keine internationalisierten Standards, die notwendig wären, um Forschungsergebnisse der Hirnforschung untereinander vergleichbar zu machen. Stattdessen setzt jeder Hirnforscher andere Bedingungen in seine Forschungen. Um diese unterschiedlichen Forschungsbedingungen der Hirnforscher untereinander vergleichen zu können, müsste jeder Neurowissenschaftler offenen Zugang zu allen Informationen des jeweiligen Experimentes, den Erkenntnissen und Forschungen seiner ‚Kollegen’ haben. Einen solchen ‚freien’ Informationsaustausch unter Neurowissenschaftlern gibt es aber nicht, da die meisten neurowissenschaftlichen Forschungen von untereinander konkurrierenden Unternehmen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass unter den Hirnforschern eben kein offener Informationsaustausch stattfindet, sondern in erster Linie ein Ringen um Forschungsgelder und Marktanteile.[37] Möglicherweise ist dieser marktwirtschaftliche Konkurrenzdruck auch ein Grund dafür, dass das ‚Modularitäts’-Prinzip überhaupt von der heutigen Hirnforschung vertreten wird. Denn wenn man bedenkt, dass heutzutage die Vergabe von Forschungsgeldern, seien sie nun staatlich oder unternehmerisch, im Wesentlichen vom Konkurrenzdruck auf dem globalen Markt und der betriebswirtschaftlichen Rentabilität der Forschungsprojekte abhängt, d.h. von dem Kapitaleinsatz-Gewinn-Verhältnis, so wäre es durchaus auch möglich, dass das ‚Modularitäts’-Prinzip deshalb vertreten wird, weil es wissenschaftliche ‚Erfolge’ bringt, für die sich eine weitere Finanzierung lohnt. Mit anderen Worten: Ein Hirnforscher, der darauf hinweisen würde, dass es derzeit, wenn nicht sogar überhaupt, unwahrscheinlich ist, auf Daten gestützte Erkenntnisse über das Gehirn zu erlangen, würde wohl kaum Forschungsgelder bekommen für ein Forschungsprojekt über das menschliche Gehirn, das Jahrzehnte dauern kann, und dessen ‚Forschungserfolg’ vage ist.
Einen letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, der aber bei Hardcastle/Stewart nicht explizit genannt wird, betrifft die Erforschung des freien Willens unter den Bedingungen eines Experimentes. Kischka weist auf einen Aspekt bei der Hirnforschung hin, den ich noch zusätzlich als problematisch hinsichtlich der Möglichkeit einer Beantwortung der Frage, ob unser Wille frei ist. Kischka macht deutlich, dass ein Experiment mit einem PET nicht nur störanfällig ist, sondern dass die Probanden mindestens 30 Minuten regungslos liegen bleiben müssen. Ferner sagt er: „Funktionelle Untersuchungen der Hirnaktivität und –aktivierung erfordern zudem die Vermeidung einer zusätzlich cerebralen Aktivierung, weswegen die Personen in abgedunkelten Räumen mit geschlossenen Augen und ohne akustische Reize untersucht werden sollten.“[38]
Die Bedingungen, die Kischka hier schildert, sind künstliche, aus denen aber allgemeingültige Erkenntnisse erlangt werden sollen. Nun stellt sich hier eben die Frage, inwiefern neurowissenschaftliche Erkenntnisse über den Willen des Menschen repräsentativ und allgemeingültig sein können, wenn sie unter solch künstlichen Bedingungen erlangt wurden. Denn unsere Entscheidungen treffen wir überwiegend eben nicht in abgedunkelten Räumen, mit geschlossenen Augen oder verschlossenen Ohren. Dieser Aspekt wirft wieder das Problem auf, worauf schon Searle und Libet hingewiesen haben, nämlich dass es einen Unterschied zwischen der Freiheitserfahrung jedes einzelnen von uns und der neurowissenschaftlichen Definition von Freiheit gibt. Auch die Libet-Experimente fanden ja unter künstlichen Bedingungen statt. Aber wenn die Erstellung künstlicher Bedingungen zur Erforschung des Gehirns notwendig ist, dann kann die Hirnforschung nur zu falschen Erkenntnissen gelangen, oder zumindest zu solchen, die nicht viel mit unserer Erfahrung des freien Willens zu tun haben. Ich denke, dass dies das größte Problem der Neurowissenschaften ist. Denn wenn die Hirnforschung nur über solche künstlichen Bedingungen, die nur selten in unserem Alltag anzutreffen sind, zu Erkenntnissen gelangt, dann dürfte ihr der ‚Zugang’ zum subjektiven freien Willen versperrt bleiben. Die erste Frage wäre dann, ob und wie es möglich ist, aus einer subjektiven Größe wie dem freien Willen eine objektive messbare Größe zu machen. Die Beantwortung dieser Frage fällt jedoch nicht mehr in diese Hausarbeit.
Fazit
Was lässt sich nun über die Hirnforschung und ihren heutigen Methoden und Antworten zur Problematik des freien Willens sagen? Dass sie zum heutigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse über den freien Willen liefern kann – zumindest keine Erkenntnisse, die durch experimentelle Daten gerechtfertigt sind - , habe ich versucht zu zeigen. Aber wie sieht es in der Zukunft aus. Wird es den Neurowissenschaften überhaupt jemals möglich sein, eine biologische Antwort auf die Frage, ob wir in unserem Willen frei sind, zu geben? Hardcastle/Stewart äußern sich pessimistisch: „As a result, neuroscientists cannot use the data they get to support their claims of function, for they are assuming local and specific functions prior to gathering appropriate data for that claim. But, gathering the appropriate data is simply beyond our kin at the moment, for we have no way to approach studying the brain except through a modularist lens. Basically, we are stuck theoretically and empirically in a counter-productive circle.”[39] Zwar setzen Hardcastle/Stewart auf die Weiterentwicklung der neurowissenschaftlichen Messgeräte, die dann von selbst das ‘Modularitäts’-Prinzip zurückdrängen sollen[40], aber es ist unklar, warum technische Weiterentwicklung die Frage nach dem freien Willen in einem Experiment entscheiden sollte. Diese Auffassung erinnert an den ‚Neuen Experimentalismus’[41], einer Auffassung innerhalb der neueren Wissenschaftstheorie, welche dem Experiment eine relativ theorieunabhängige Rolle zuschreibt, in welcher es von selbst eine Entscheidung zwischen konkurrierenden Theorien geben kann. Einer solchen Auffassung stehe ich skeptisch gegenüber. Denn die ‚Verfeinerung’ eines Messgerätes oder eines Experimentes geschieht ja nicht zufällig, sondern wird ebenso theorieleitend vollzogen. Wenn man nämlich bedenkt, dass das ‚Modularitäts’-Prinzip die Methoden in der Hirnforschung vorgibt (man denke hier z.B. an die Läsions-Methode, bei der bei Tieren ein bestimmter Hirnteil beschädigt wird, in der Absicht, diesem beschädigten Hirnteil eine spezifische Funktion zuschreiben zu können), so ist für mich unklar, warum Messgeräte eine Eigendynamik entwickeln sollten. Zudem werden auch in neurowissenschaftlichen Experimenten sogenannte Störfaktoren ausgeschlossen, welche einen vorgesehenen Ablauf des Experimentes behindern (siehe die künstlichen Bedingungen beim Experiment mit einem PET); was bedeutet, dass, selbst wenn ein neurowissenschaftliches Messinstrument andere Daten zeigen sollte, diese womöglich auf Störfaktoren zurückgeführt werden würde, anstatt dass die Theorie geändert würde. Letztenendes bringen die heutigen Messinstrumente (z.B. PET) auch keine autonome Entscheidung, zumindest die, welche Hardcastle/Stewart sich wünschen. Ich denke, die Frage, ob die Hirnforschung überhaupt jemals eine datengestützte biologische Antwort darauf geben kann, ob wir einen freien Willen haben, kann nur beantwortet werden, wenn klar ist, ob und wie es überhaupt möglich ist, eine subjektive Größe zu einer objektiven umzuformen. Dass dies Hirnforschung bislang nicht gelungen ist, habe ich ja versucht zu zeigen.
Literaturverzeichnis
Chalmers, Alan F.: Wege der Wissenschaft (4. Auflage), Heidelberg 2001
Hardcastle, Valerie Gray/Stewart, C. Matthew: What do brain data really show? – in: Philosophy of science, supplement to volume 69, New York 2002
Kischka, Udo; u.a. (Hg.): Methoden der Hirnforschung, Heidelberg 1997
Libet, Benjamin: Do we have a free will? – in: Kane, Robert (Hg.): The Oxford handbook of free will, Oxford 2002
Meyers Enzyklopädisches Lexikon
Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, FFM 1999
Searle, John R.: Free Will as a problem in neurobiology,- in: Philosophy 76 (2001)
Walter, Henrik: Neurophilosophy of free will, - in: Kane, Robert (Hg.): The Oxford handbook of free will, Oxford 2002
[...]
[1] Siehe: Searle, John R.: Free Will as a problem in neurobiology,- in: Philosophy 76 (2001), S.494
[2] Siehe: Hardcastle, Valerie Gray/Stewart, C. Matthew: What do brain data really show? – in: Philosophy of science, supplement to volume 69, New York 2002; S.72 f.
[3] Siehe: Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, FFM 1999; S. 304
[4] Stichwort: Gall. – in: Meyers Enzyklopädisches Lexikon, … , S.635
[5] Siehe: Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, FFM 1999; S. 304
[6] ebenda; S.304
[7] Siehe: ebenda; S.307
[8] Siehe: ebenda; S.306
[9] Siehe: Libet, Benjamin: Do we have a free will? – in: Kane, Robert (Hg.): The Oxford handbook of free will, Oxford 2002; S.557 f.
[10] Siehe: ebenda; S.558 ff.
[11] Siehe: Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, FFM 1999; S.310
[12] ebenda; S.552
[13] Siehe: ebenda; S.553
[14] Siehe: ebenda; S.555
[15] Siehe: ebenda; S.559
[16] ebenda; S.562
[17] Siehe: ebenda; S.558
[18] Siehe: ebenda; S.562
[19] Kischka, Udo: Methoden der Hirnforschung, Heidelberg 1997
[20] Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, FFM 1999
[21] Hardcastle, Valerie Gray/Stewart, C. Matthew: What do brain data really show? – in: Philosophy of science, supplement to volume 69, New York 2002
[22] Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, FFM 1999; S.226
[23] Siehe: Kischka, Udo: Methoden der Hirnforschung, Heidelberg 1997; S.183
[24] Siehe: Hardcastle, Valerie Gray/Stewart, C. Matthew: What do brain data really show? – in: Philosophy of science, supplement to volume 69, New York 2002; S.73 f.
[25] Siehe: Hardcastle, Valerie Gray/Stewart, C. Matthew: What do brain data really show? – in: Philosophy of science, supplement to volume 69, New York 2002; S.75 f.
[26] Siehe: ebenda: S.75 f.
[27] Siehe: Libet, Benjamin: Do we have a free will? – in: Kane, Robert (Hg.): The Oxford handbook of free will, Oxford 2002; S.552
[28] Siehe: Walter, Henrik: Neurophilosophy of free will, - in: Kane, Robert (Hg.): The Oxford handbook of free will, Oxford 2002; S.566, S.571
[29] Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, FFM 1999; S.223
[30] Siehe: ebenda; S.223; Siehe auch: Kischka, Udo: Methoden der Hirnforschung, Heidelberg 1997; S.302
[31] Libet, Benjamin: Do we have a free will? – in: Kane, Robert (Hg.): The Oxford handbook of free will, Oxford 2002; S.559 f.
[32] Walter, Henrik: Neurophilosophy of free will, - in: Kane, Robert (Hg.): The Oxford handbook of free will, Oxford 2002; S.568
[33] Hardcastle, Valerie Gray/Stewart, C. Matthew: What do brain data really show? – in: Philosophy of science, supplement to volume 69, New York 2002; S.77
[34] ebenda; S.73
[35] siehe: ebenda; S.76
[36] Kischka, Udo: Methoden der Hirnforschung, Heidelberg 1997; S.304
[37] Siehe: Hardcastle, Valerie Gray/Stewart, C. Matthew: What do brain data really show? – in: Philosophy of science, supplement to volume 69, New York 2002; S.75
[38] Kischka, Udo: Methoden der Hirnforschung, Heidelberg 1997; S.304
[39] Hardcastle, Valerie Gray/Stewart, C. Matthew: What do brain data really show? – in: Philosophy of science, supplement to volume 69, New York 2002; S.80
[40] siehe: ebenda; S.78
[41] siehe: Chalmers, Alan F.: Wege der Wissenschaft (4. Auflage), Heidelberg 2001
- Arbeit zitieren
- Christian Mielenz (Autor:in), 2004, Der Freie Wille und die Hirnforschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108679
Kostenlos Autor werden











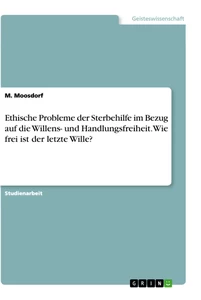



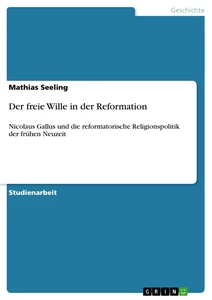
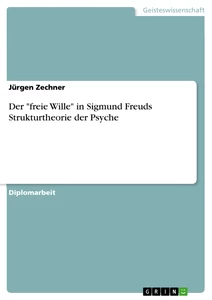



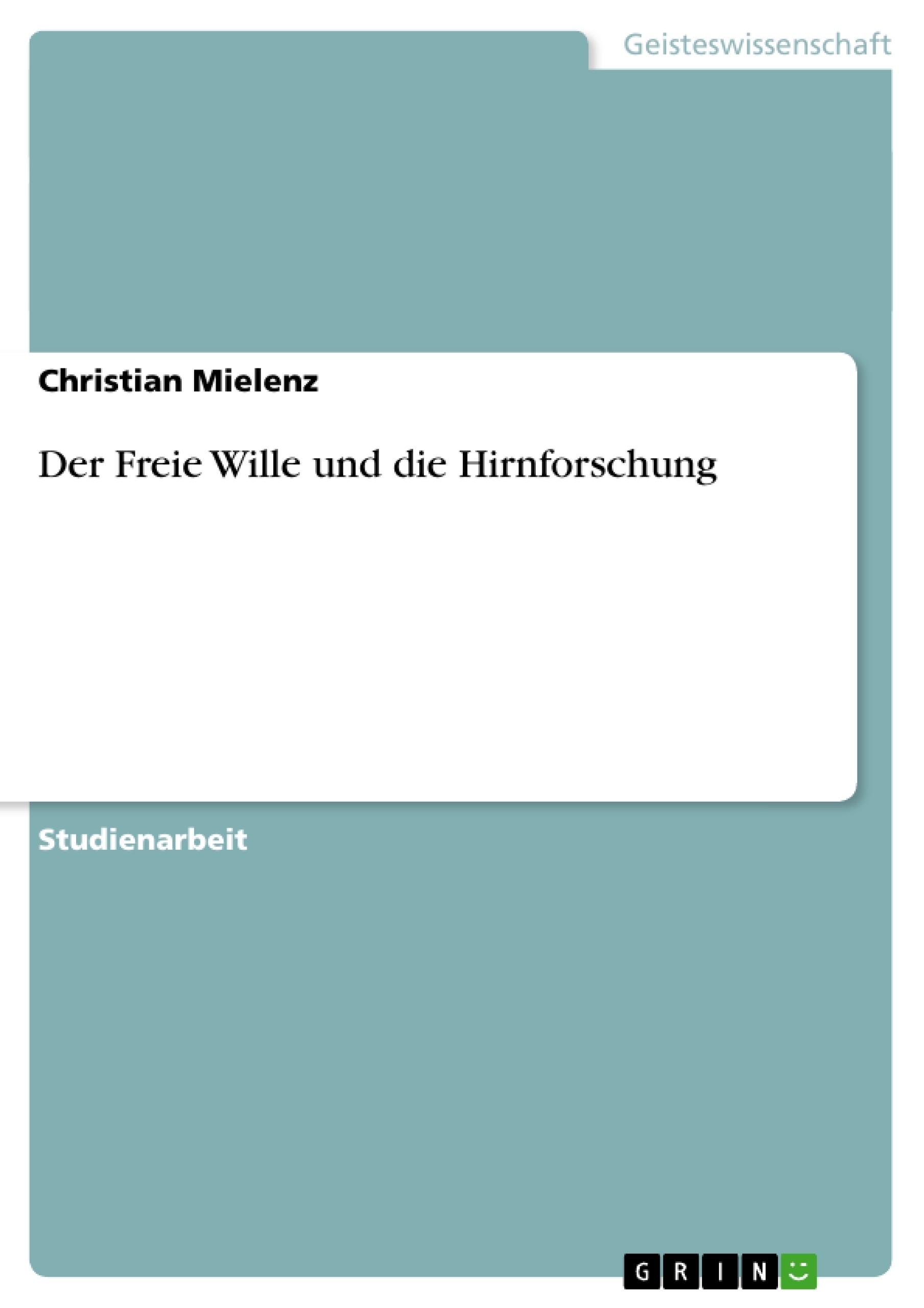

Kommentare
Anmerkungen zu Ihrem Text.
Grüezi Herr Mielenz
Ich habe ihren Beericht mit Interesse durchgelesen. Mein Kompliment, Ihnen ist es gelungen sachlich auf kritische Aspekte der Hirnforschung hinzuweisen aber doch ohne zu verurteilen. Ihr Breicht regt zum Nachdenken an.
Einen Inhaltlichen Hinweis zum Text möchte ich doch noch geben: Zu den bildgebenden Verfahren schreiben sie, dass der Zerfal der Isotope durch ein PET- oder MRI System gemessen werden kann. Das ist so nicht richtig. Ein MRI System basiert auf einer magnetischen Messung und ist kein ionisierendes Verfahren wie der PET-Scaner.
Grüsse aus der Schweiz
Hanspeter Zehnder