Leseprobe
Inhalt
Im Haus der Sprache sind viele Wohnungen!
1. Das Dialogische wird gekonnt – zum Dialogischen Prinzip Martin Bubers
2. Mensch-Sein ist leiblich: der Leib als Grundlage dialogischen Lebens
3. Sender + Nachricht + Empfänger = Kommunikation ?
4. Leben – Beziehung – Kommunikation: Gedanken zu einem erweiterten Kommunikationsbegriff
5. Kommunikation angesichts schwerer geistiger Behinderung
6. Verstehen
Im Haus der Sprache sind viele Wohnungen!
[1] [2] Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit Kommunikation und Verstehen. Ausgehend von der Kommunikation als grundlegendes Element menschlicher Existenz wird ein weites Verständnis von Kommunikation entwickelt. Die Essenz dieses erweiterten Kommunikationsbegriffs ist die uneingeschränkte Annerkennung kommunikativer Fähigkeiten jedes Menschen. In diesem Sinne ist die Überschrift, ein Zitat Bubers, zu verstehen als ein Bild für die Vielfalt menschlicher Kommunikation.
Im letzten Abschnitt dieses Kapitels (2.6.) setzte ich mich mit dem Begriff des Verstehens auseinander und erweitere das Nicht-Verstehen um eine bedeutungsvolle und konstruktive Dimension.
1 Das Dialogische wird gekonnt – zum Dialogischen Prinzip Martin Bubers
Der Mensch ist wesensmäßig ein Bezogener. Das meint, er lebt und entwickelt sich in und durch Beziehungen (vgl. Dederich 1998, 37). Dieses anthropologische Axiom spiegelt sich auch in folgendem Zitat des Philosophen Martin Buber: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“ (Buber 1994, 33). Diese Aussage ist die Essenz des dialogischen Prinzips, welches der menschlichen Existenz konstitutiv ist. Auf den folgenden Seiten werde ich die grundsätzliche Bezogenheit des Menschen auf seine Mitmenschen auf Grundlage von Bubers Philosophie intensiver ausbreiten. Denn in meinen Augen bildet das Verstehen des Menschen als dialogisches Lebewesen die Grundlage für ein angemessenes Verstehen des Menschen im allgemeinen und der menschlichen Kommunikation im Besonderen.
Bereits im ersten Satz von Bubers Ausführungen zum dialogischen Prinzip wird deutlich, dass der Mensch nicht losgelöst von seiner Umwelt existiert: „Die Welt ist dem Menschen zwiefältig nach seiner zwiefältigen Haltung“ (ders., 7). Die Welt gliedert sich für den Menschen wesensmäßig in zwei Bereiche, die eine Einheit bilden: dort gibt es den Menschen (Ich) und da sein Gegenüber (Du bzw. Er/Sie/Es). Und erst in der Konfrontation mit den Dingen und Personen in seiner Umgebung wird der Mensch Ich. Für dieses Werden und für sein tägliches Leben braucht er beides: die Begegnung mit den Dingen, in Bubers Worten mit der Eswelt, und die Beziehung zu dem anderen Menschen in der Duwelt.
Die Eswelt ist die Welt, in der das tägliche Leben stattfindet, die gegliederte und zuverlässige Welt der Erfahrungen und Tätigkeiten. Ich und Es[3] stehen sich hier gegenüber, das Ich kann am Es handeln. Aber trotz der gegenseitigen Orientierung zueinander bedeutet ‚Gegenüber‘ ‚Getrenntsein‘: für das Ich besteht in diesem Gegenüber keine Verbindung zur Welt - das Ich ist nicht in der Welt.
Angesichts Bubers Auffassung der grundlegenden menschlichen Kategorie der Beziehung („Im Anfang ist die Beziehung“, ders., 31), reicht die Begegnung mit dem Es dem Menschen zum Sein nicht aus. „Ohne Es kann der Mensch nicht leben. Aber wer mit ihm allein lebt, ist nicht der Mensch“ (ders., 38). Zum menschlichen Leben gehört die Duwelt. Wenn ein Mensch dem Ich als Du gegenübersteht, dann sind beide nicht länger Dinge unter Dingen und erst dann hat der Mensch Anteil an der Welt. Denn Ich und Du stehen sich nicht gegenüber, sondern sie sind in der Beziehung eine Ganzheit und zwischen ihnen ist die Welt – ihre Zusammenkunft ist eine dialogische.
Die Eswelt hat nur Gegenstände; Gegenstände bestehen im Gewesensein und im Gewordensein. Somit bedeutet die Begegnung mit dem Es Vergangenheit. Erst durch die Beziehung zwischen dem Ich und dem Du entsteht Gegenwart, denn „die Beziehung zum Du ist unmittelbar“ (ders., 15), ohne Voraussetzungen und ohne Vorwegnahme. Die beiden Teile Ich und Du werden zu einer Ganzheit in der Welt. Diese Du-Momente bereichern die Eswelt und sind „die Wiege des Wirklichen Lebens“ (ders. 13).
Wie aber wird das Gegenüber zweier Dinge zu einem dialogischen Ereignis? Die dialogische Begegnung geht über den Bereich hinaus, der umgangssprachlich als Dialog bezeichnet wird. Sie ist mehr als das Verbale, mehr als reiner Informationsaustausch. Den echten Dialog charakterisiert Buber als den, „wo jeder der Teilnehmer den oder die anderen in ihrem Dasein und Sosein wirklich meint und sich ihnen und der Intention zuwendet, daß lebendige Gegenseitigkeit sich zwischen ihm und ihnen stifte“ (ders., 166). Dem echten Dialog liegt die Hinwendung als elementare Grundbewegung[4] von Ich und Du zugrunde. Hinwendung bedeutet Hinwendung mit der Seele, indem die Aufmerksamkeit wirklich auf den anderen gerichtet wird – dies ist die Grundlage für ein dialogisches Erlebnis. „Die Hauptvoraussetzung zur Entstehung eines echten Gesprächs ist, daß jeder seinen Partner als diesen, als eben diesen Menschen meint“ (ders., 283). Bereitschaft für das Dialogische bedeutet, den anderen in seinem Sosein anzunehmen und seine Meinung trotz eventueller Abweichungen vom Eigenen verstehen zu wollen. Wenn ich mit dem anderen auf diese Weise elementar in Beziehung trete, bleibt er nicht länger das Objekt meiner Betrachtung, sondern ich beginne ihn in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Nur durch das wirkliche Sich-Zuwenden, durch die ‚personale Vergegenwärtigung‘ (vgl. ders., 282ff) wird die andere Person zur Gegenwart, nur dann hebt sie sich von der Welt der Dinge ab und wird zum Du.
Die dialogische Grundbewegung ist die Basis des dialogischen Daseins. Die Grundzüge eines dialogisch ausgerichteten Lebens verdeutlichen sich in folgenden Zitaten: „Dialogisches Leben ist nicht eins, in dem man viel mit Menschen zu tun hat, sondern eins, in dem man mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, wirklich zu tun hat“ (ders., 167). „Dialogisches Dasein empfängt auch in der äußersten Verlassenheit eine herbe und stärkende Ahnung der Reziprozität, monologisches wird auch in der zärtlichsten Gemeinschaft nicht über die Umrisse des Selbst hinaustasten“ (ders., 168).
Das Dialogische Prinzip und Bubers Axiom „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ (ders., 15) wird meiner Auffassung gerecht, dass die achtsame Hinwendung zum Anderen und das Erleben interessierter Zuwendung vom Anderen zwei Seiten eines existenziellen Bestandteils des menschlichen Lebens sind: dem oben beschriebenen echten Dialog.
Die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen, liebevollen Begegnung für den Menschen lässt sich nicht nur philosophisch begründen. Auch Ergebnisse der Deprivationsforschung bestätigen die wichtige Rolle, die Beziehungserfahrungen für die menschliche Entwicklung spielen. Ohne den Rahmen der Arbeit zu sprengen, möchte ich in diesem Zusammenhang auf einen Artikel verweisen, der im Online-Lehrbuch Medizinische Psychologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg erschienen ist. Hier wird hinsichtlich des Phänomens der Deprivation als Mangel an hinreichender emotionaler Zuwendung der Begriff ‚Hospitalismus’ folgendermaßen bestimmt: „Geht bei Säuglingen die längere Trennung von der Mutter (besser: von ihrer primären Bezugsperson) (...) mit einer mangelnden emotionalen Zuwendung einher (...), so tritt ein typisches Krankheitssyndrom auf, die anaklitische Depression: Das Kind nimmt von seiner Umgebung kaum noch Notiz, ist bewegungsarm, teilnahmslos und hinsichtlich Gestik und Mimik ausdrucksvermindert. Von hier aus entsteht häufig schon nach etwa drei bis fünf Monaten das Bild des psychischen Hospitalismus, der durch schwere Entwicklungsstörungen (...) gekennzeichnet ist und lebensbedrohlich werden kann. Diese Schäden sind zwar bei konstanter Zuwendung zum Teil reversibel, häufig stellen sich aber spätere Folgen in Form von Störungen der Kontaktfähigkeit (...) ein.“[5]
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen ist im Kontext der Kommunikation mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung ein weiterer von Buber ausgeführter Aspekt von Bedeutung: „Es (das Dialogische, Anm. d. Autorin) wird wirklich gekonnt. (...) (Es) ist kein Vorrecht der Geistigkeit (...) Es fängt nicht im oberen Stockwerk der Menschheit an, es fängt nicht höher an als wo sie anfängt“ (ders., 190)! Buber vertritt die Ansicht, dass dialogisches Leben von jedem Menschen qua seines Menschseins immer bereits gekonnt wird, denn „sie (die Zwiesprache, Anm. d. Autorin) ist eine Sache der Schöpfung“ (ders., 190), eine grundlegende menschliche Fähigkeit. Die Möglichkeit eines dialogischen Miteinanders ist somit an keine andere Voraussetzungen gebunden als an die, Mensch zu sein. Für den Bereich der Schwerstbehindertenpädagogik, die ich als Teilgebiet der Geistigbehindertenpädagogik verstehe, ist von herausragender Bedeutung, dass konsequenterweise das Dialogische nicht im Bereich des geistigen Luxus zu suchen ist. Vielmehr ist jeder Mensch, auch der Mensch mit schwerer geistiger Behinderung, in seiner Bedingtheit dialogfähig. „Ich suche nicht nach den Menschen, suche mir die Menschen nicht aus, ich nehme an die da sind, sie habe ich im Sinn, ihn, den Eingespannten, den Radtretenden, den Bedingten“ (ders., 190).
2 Mensch-Sein ist leiblich: Der Leib als Grundlage dialogischen Lebens
Die eben dargestellte Dialogfähigkeit jedes Menschen will ich im folgenden Abschnitt vertiefen: nach Buber wird das Dialogische von jedem Menschen aufgrund seines Mensch-Seins gekonnt. Was aber ist das bestimmende Moment unseres Mensch-Seins? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage bin ich im Laufe meines Studiums unter anderem auf die Vertreter der Leibphilosophie gestoßen. Durch die Auseinandersetzung mit der Idee der Leiblichkeit wurde meine Auffassung menschlichen Seins entscheidend geprägt. So stimme ich der Aussage Wilhelm Pfeffers zu: „Leib-sein ist die Weise des Zur-Welt-Seins des Menschen“ (Pfeffer 1988, 11).
Dem Begriff der Leiblichkeit liegen sehr komplexe philosophische und anthropologische Gedanken zugrunde, die ich im Rahmen dieser Arbeit nicht im Einzelnen erläutern werde. Einige Aspekte der phänomenologisch-leibphilosophischen Betrachtung sind allerdings sowohl in der aktuellen Schwerstbehindertenpädagogik als auch in meinen Reflexionen zur Begegnung mit Jan von besonderer Bedeutung. Die Relevanz der Leiblichkeit für die Schwerstbehindertenpädagogik begründete Dreher bereits 1979. Da schreibt er, dass sich „in der Begegnung mit schwer geistigbehinderten Menschen (...) diese ‚Leibhaftigkeit‘ mit besonderer Mächtigkeit in den Vordergrund“ (Dreher 1979, 13) drängt.
Doch was meint der Begriff ‚Leib‘? Im Alltagsverständnis gilt ‚Leib‘ als antiquiertes Synonym für ‚Körper‘. Im phänomenologischen Verständnis aber vereint der Leibbegriff verschiedene Gesichtspunkte menschlichen Daseins.
Buytendijk unterscheidet zwei Aspekte von Leib: die ‚pathische Leiblichkeit‘ und die ‚technische Leiblichkeit‘. Mit der technischen Leiblichkeit ist der Körper in seiner Funktionalität gemeint. Der Begriff richtet sich auf den Organismus, das Stoffliche, das Organische des Menschen, seine Substanz sowie die organischen Abläufe, die Physiologie. Der Körper kann erfasst und erforscht werden, er ist Objekt der Betrachtung. Als pathischen Leib hingegen bezeichnet Buytendijk das, womit Emotionen, Stimmungen und Neigungen erlebt werden. Dieser Zusammenhang beinhaltet, dass sich pathischer und technischer Leib gegenseitig beeinflussen und den Zugang des Menschen zur Welt prägen. Eine Teilung des Menschen in Körper und Geist ist dieser Vorstellung von Leiblichkeit nicht angemessen (vgl. Fornefeld 1998a, 65-67)[6]. Im Gegensatz zum Körper kann der Leib als Gesamtes somit nicht ausschließlich objektiv betrachtet werden. Ich bin mein Leib, ohne ihn wäre ich nicht. Und „da wir ja selber unser Leib sind, (können wir) uns diesem unseren Leib niemals als objektiven Gegenstand völlig gegenüber bringen“ (Dederich 1998, 34). Um das Gemeinte zu verdeutlichen, frage man sich beim Waschen: Wer wäscht wen? (vgl. Schärli 1998, 25). Der eigene Leib kann nicht objektiver Gegenstand der eigenen Beobachtung werden, denn er ist immer zugleich Objekt des Interesses als auch beobachtendes Subjekt. Er gehört somit sowohl zu mir als auch zu den Dingen. Durch ihn bin ich jetzt und hier – der Leib ist meine „Zentriertheit und Verankerung in der Welt“ (Dederich 1998, 34). Aber durch ihn bin ich nicht nur in der Welt, sondern durch ihn bin ich auch mit der Welt verbunden. Dreher spricht in diesem Zusammenhang[7] von der „Verschlungenheit von leiblicher Daseinsweise und umhüllender Lebenswelt“ (Dreher 1979, 8). Der Leib ist das Bindeglied zwischen meinem Ich auf der einen Seite und der Welt auf der anderen Seite. Die Grundlage des menschlichen Weltbezugs ist dementsprechend nicht kognitiv. Menschlicher Weltbezug ist ursprünglich ein leiblicher – und das präreflexiv, also vor jeder Reflexion. Der Leib ist somit das Medium des menschlichen Weltbezugs.
Für das Verständnis des Leibbegriffes ist jedoch noch ein weiterer Gesichtspunkt von Bedeutung: Leib gilt außerdem als eine Einheit von Leib, Seele und Geist. Dederich beschreibt viele Facetten menschlicher Leiblichkeit: „Berührung, Geruch, Geschmack, Hören, Sehen, das Gleichgewicht, die Orientierung im Raum, die Empfindung von Wärme und Kälte, Atmung, Gesten, Gebärden, der individuelle Bewegungsstil, Emotionen, Wohl- und Mißbefinden, Müdigkeit und Frische, Gesundheit und Krankheit, Sexualität uns vieles mehr sind leiblicher Natur“ (Dederich 1997, 172f). In der näheren Betrachtung dieser einzelnen Bereiche des Leiblichen erkennt man das dynamische Gefüge von Leib, Geist und Seele. Ich will versuchen, diese Einheit am Begriff ‚Krankheit‘ zu verdeutlichen: mit einer Krankheit geht im allgemeinen Verständnis eine vorübergehende körperliche Dysfunktion einher. Dabei ist aus medizinischer Perspektive lediglich der pathologische Befund handlungsweisend. Die Person, ihr „Befinden und sonstige individuelle Besonderheiten werden (...) ausgeklammert, (...) auf (...) persönlichen Eigenheiten (...) (wird) nicht eingegangen“ (Kittel 1981). Doch Krankheit, oder im Zusammenhang der Leiblichkeit besser ‚Kranksein‘, ist kein personunabhängiger Sachverhalt. Denn nicht nur meinem Körper geht es während dieser Zeit nicht gut, mir geht es schlecht. Einerseits habe ich beispielsweise Schmerzen an bestimmten Körperstellen, andererseits fühle ich mich aber zudem müde und kann unter anderem auch im Bereich des Kognitiven nicht die gewohnte Leistung erbringen, meine Stimmung ist gedrückt – ich bin krank und meine gesamte Leiblichkeit, mein Leib, meine Seele und mein Geist, ist davon betroffen.
Es wurde oben bereits betont, dass sich das Phänomen der Leiblichkeit aus zwei wesentlichen Elementen konstituiert: zum einen die Einheit von Mensch und Welt durch den Leib, zum anderen die Einheit Leib-Seele-Geist. Ich nenne diese beiden Bereiche ‚Elemente‘, angelehnt an Bodenheimers Definition des Begriffs ‚Element‘: jedes Ganze besteht aus einem „Gesamt von Elementen“ (Bodenheimer nach Fornefeld 1995, 185), wobei die einzelnen Elemente untereinander in einem interdependenten Spannungsverhältnis stehen und so das Ganze mehr ergibt als die Summe seiner Teile (vgl. dies., 185f). Ebenso verhält es sich mit den beiden genannten Elementen der Leiblichkeit: die Einheit Mensch-Welt und die Einheit Leib-Seele-Geist sind wechselseitig aufeinander bezogen und bilden gemeinsam die Einheit des Menschen in der Welt.
Der Mensch nimmt die Welt leiblich wahr. Dieser Satz hat unter der Berücksichtigung der Gesamtheit der beiden Elemente eine wichtige Bedeutung für die Begegnung des Ich mit dem Es und dem Du: Das Ich wendet sich der Welt immer in seiner aktuellen Befindlichkeit, in einer gewissen ‚Gestimmtheit‘ zu. Die Gestimmtheit prägt die Wahrnehmung entscheidend. Eine positive Gestimmtheit lässt mir die Blumen am Straßenrand in ihrer Pracht erscheinen, während sie mir in schlechter Verfassung nicht einmal ins Auge fallen würden. In Momenten des Missbefindens nehme ich vielmehr den wolkenbedeckten Himmel wahr, der mir in diesem Augenblick ‚bleiern‘ erscheint. Es wird deutlich, dass auf der Basis eines leiblich-sinnlichen Wahrnehmungsbewusstseins die Dinge der Umwelt durch den Leib mit Sinn erfüllt werden. „Da wir leiblich zur Welt sind, ist unsere Welt eine durch unsere Leiblichkeit interpretierte Welt “ (Merleau-Ponty nach Dederich 1998, 36, Hervorhebung im Original). Welt wird durch diesen Prozess der Sinngebung zu meiner Welt. Dederich bezeichnet den Leib daher „als ein Organ individueller, subjektiver Sinnstiftung“ (Dederich 1998, 36). Konsequent weitergeführt intendiert dieser Gedanke als „Rückseite der Medaille der Sinnstiftung (...), daß der Leib sein eigenes Verstehen hat“ (Dederich 1998, 36).
Die Verflochtenheit vom ‚Ich‘ (dem Subjekt) und Welt intendiert ein weiteres Begriffsfeld, nämlich das von Kommunikation und Dialog. Denn einfach gesagt versteht man unter Kommunikation und Dialog die Beziehungsdynamik zwischen dem Subjekt und der Welt.
Petzold spricht dem Leib drei wesentliche Eigenschaften zu, denen entsprechend er ihn als perzeptiven, memorativen und expressiven Leib bezeichnet. Er geht also davon aus, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der menschlichen Leiblichkeit und der Sinnlichkeit, dem Gedächtnis und dem Ausdruck. (vgl. Petzold nach Dederich 1998, 36). Die drei Eigenschaften prägen das Zur-Welt-Sein des Einzelnen in erheblicher Weise. Wie oben beschrieben können auch hier die drei Elemente nicht von einander getrennt werden. Sie stehen in einem engen wechselseitigen Verhältnis, und erst in ihrer Gesamtheit sind sie der ‚Leib‘. Der Leib speichert Erfahrungen, die er in gewissen Situationen gemacht hat (memoratives Moment). Eine aktuelle Situation nehme ich als Leib wahr (perzeptives Moment), leiblich bin ich offen für die Stimmungen und die Atmosphäre des Moments, und vor jeder kognitiven Reflexion der Sachlage gebärdet sich der Leib als Reaktion auf das Wahrgenommene (expressives Moment). In unsere Kultur spielt die Kognition, die geistige Erkenntnis eine herausragende Rolle, sodass der erwachsene Mensch die Fähigkeiten seines Leibes häufig nicht mehr zu nutzen weiß. Aber bei Kindern und bei den Menschen, die als (schwer) geistig behindert gelten besteht eine enge Interdependenz zwischen der leiblichen Wahrnehmung und dem leiblichen Ausdruck. „Diese untrennbare Verflochtenheit von Erleben und Ausdruck bedeutet, daß man analog zum präreflexiven Selbst- und Welterleben auch von einer präreflexiven und präverbalen Kommunikationsfähigkeit des Menschen sprechen kann. Indem sich der Leib gebärdet, drückt er sich aus, und indem er sich ausdrückt, ist er bereits kommunikativ“ (Dederich 1997, 177). Unter diesem Blickwinkel betrachtet ist der Leib der Ausgangspunkt menschlicher Kommunikation oder, wie es die Überschrift dieses Kapitels bereits sagt, die Grundlage dialogischen Lebens.
3. Sender + Nachricht + Empfänger = Kommunikation ?
In den beiden vorangegangenen Abschnitten fiel mehrfach das Wort ‚Kommunikation‘. So bezeichnete ich Kommunikation unter anderem als „die Beziehungsdynamik zwischen dem Subjekt und der Welt“ (s.o.). Im Zusammenhang der Arbeit mit Jan T. und der genaueren Untersuchung interaktiver und kommunikativer Momente zwischen Jan und mir halte ich es für angebracht, einige Gesichtspunkte des Phänomens ‚Kommunikation‘ zu vertiefen. Es handelt sich hierbei um ein sehr komplexes Thema, welchem man sich wissenschaftlich von verschiedenen Richtungen nähern kann: unter anderem beschäftigen sich die Linguistik, die Soziologie, die Philosophie und die Pädagogik mit diesem Gegenstand. Im Rahmen der vorliegenden Auseinandersetzung mit der Kommunikation mit einem Kind mit schwerer geistiger Behinderung werde ich dem Leser die in diesem Zusammenhang wichtigsten Aspekte des komplexen Bereichs der Kommunikation vorstellen.
Das linear-technologische Kommunikationsmodell
Schlägt man im Brockhaus nach, findet man dort unter Kommunikation die Synonyme „Austausch, Verständigung; Übermittlung und Vermittlung von Wissen“ (dtv Brockhaus 1989, Bd. 10, 56). Im weitesten Sinne werden hier unter Kommunikation „alle Prozesse der Übertragung von Nachrichten oder Informationen durch Zeichen aller Art unter Lebewesen (Menschen, Tiere, Pflanzen) und/oder techn. Einrichtungen (Maschinen) durch techn., biolog., psycholog., soziale u.a. Informationsvermittlungssysteme“ (ders., 56) gefasst. Es werden drei Elemente genannt, die als wesentlich für den Kommunikationsprozess gelten: der Sender, auch Kommunikator genannt, die Nachricht (Mitteilung, Aussage) und der Empfänger, welcher außerdem als Rezipient oder Adressat gilt. Hinter diesen drei Elementen steht das in der Linguistik entwickelte kybernetisch-technologische Kommunikationsmodell: „Eine Quelle liefert über einen Sender unter Ausnutzung eines Kanals eine Nachricht, die einen potentiellen Empfänger als Ziel erreichen soll. Der Empfänger seinerseits hat dabei (...) Möglichkeiten der Rückmeldung (feed back) an die Quelle, um Verständnis oder Missverständnis zu signalisieren“ (Krawitz 1999, 172, Hervorhebungen im Original). Dieses Grundmodell wird in der Literatur hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte erweitert. Des weiteren weißt er auf neuropsychologische und psychologische Faktoren und die Beachtung sozialer Prozesse hin, die einen Einfluss auf den Kommunikationsprozess haben können (vgl. Hettinger 1996, 169). In der Natur der Sache liegt es, dass die Linguisten ihr Arbeitsmodell so entwickeln, dass es die sprachlichen Kommunikation innerhalb der menschlichen Welt zu erklären vermag[8]. Das kybernetische Modell erfasst somit nur intentionale[9] kommunikative Akte sprachlicher Natur.
Für eine grundsätzliche Annäherung an den Komplex ‚Kommunikation‘ mag das beschriebene Modell ausreichen. Da der Mensch allerdings sowohl in seiner Persönlichkeit, als auch in seinem Ausdruck und als in einer vielseitigen Umwelt lebendes Lebewesen sehr facettenreich ist, halte ich ein lineares Modell als Verstehenszugang für nicht adäquat. Angesichts der Betrachtung des Menschen als grundsätzlich dialogisch ausgerichtetes Lebewesen, wie ich es in 2.1. im Sinne von Martin Buber dargestellt habe, sollte das lineare Kommunikationsmodell von einem dialogischen Kommunikationsmodell abgelöst werden. Dies sehe ich als einen Schritt dahin, einem besseren Verständnis der Kommunikation zwischen Menschen näher zu kommen.
Das dialogische Kommunikationsmodell
Das dialogische Modell folgt grundsätzlich anderen Annahmen als das lineare: es wird nicht lediglich die Botschaft betrachtet, losgelöst von allem Vorwissen, welches das Subjekt hat. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass der Mensch bereits eine Meinung, eine Theorie, also seine ‚Anschauung‘ zu einem Thema hat. Wenn sich nun zwei Subjekte über das Medium der Sprache miteinander austauschen, versucht jedes der beiden dem anderen seine jeweilige Anschauung zu vermitteln. In der Auseinandersetzung mit den Argumenten des anderen kommt es während eines Dialogs zu einer Bewusstseinsveränderung (vgl. Krawitz 1999, 172f). Zu dieser Vorstellung einer dialogischen Situation passt die Ansicht nicht, dass lediglich eine Information deckungsgleich von einem Bewusstsein in ein anderes transferiert wird. Vielmehr gilt: jedes Subjekt baut die Informationen in sein vorhandenes Meinungsgefüge ein und es entsteht etwas Neues, Drittes. So ist im Sinne Schallers (gelungene) Kommunikation, wenn „nicht ‚lediglich schon vorher Vorhandenes übermittelt‘ (wird, sondern wenn) (...) auch wesentlich ‚etwas hervorgebracht, gebildet (wird), das vorher noch nicht da war‘“ (Schaller nach Krawitz 1999, 171, Hervorhebung im Original).
In den bisherigen Ausführungen lag das Augenmerk maßgeblich auf den inhaltlichen Gesichtspunkten der Kommunikation. Wie bereits erwähnt, wendet sich der Mensch darüber hinaus aber seiner Duwelt wesensmäßig zu, er lebt erst durch die Beziehung zum Anderen und durch sie entwickelt er sich. Mit Pfeffers Worten gesagt: „Menschliches Leben ist Zuwendung zur Welt der Menschen und Dinge“ (Pfeffer 1988, 6, Hervorhebung im Original). Um diesem Moment gerecht zu werden, bedarf es der Erweiterung des dialogischen Modells um den Beziehungsaspekt. „(D)ie äußere Situation (wird) stets mitbestimmt durch das teils bewusste, teils unbewusste Bedürfnis der Partner, ihre Beziehung zueinander zu definieren. Je nachdem, wie die Beziehung der Kommunikationspartner gestaltet wird, erwachsen positive oder negative Konsequenzen für den argumentierenden Verständigungsprozess auf der Inhaltsebene“ (Krawitz 1999, 173).
Doch selbst durch diese Erweiterung um die Beziehungsebene ist für mich auch der beschriebene dialogische Ansatz nicht angemessen zur Beschreibung menschlicher Kommunikation in ihrer gesamten Vielfalt. Angesichts der genannten Ausrichtung des Menschen als dialogisches Wesen[10] und unter Berücksichtigung seiner Leiblichkeit[11], reicht weder das dargelegte dialogische noch, oder besser gesagt erst recht nicht das zuerst beschriebene lineare technologische Modell aus, um die menschliche Kommunikation zu erfassen. Auf dem Weg zu einem umfassenden Verständnis der Kommunikation weisen sie dem Interessierten die Richtung. Doch in beiden Modellen spielt die verbale Verständigung eine herausragende Rolle, und somit stoßen sie in der Begegnung mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung schnell an ihre Grenzen.
Bedingt durch die Vielfalt menschlichen Seins, gibt es eine ebenso große Vielfalt der menschlichen Kommunikation. Und somit muss ein universelles Kommunikationsmodell der Anforderung gerecht werden, neben dem verbalen Austausch auch die nicht-sprachlichen Formen der Kommunikation zu erfassen. Gemeint ist damit dementsprechend die Integration aller Kommunikationsformen, die vermittels eines Zeichensystems funktionieren, auf das sich die Beteiligten geeinigt haben. Doch meine Anforderungen an ein adäquates Modell gehen noch darüber hinaus. Denn angesichts sogenannter schwerer (geistiger) Mehrfachbehinderung ist es von großer Bedeutung, dass neben dem Austausch mittels bestimmter Symbole auch solche Kommunikationsformen berücksichtigt werden, die im Bereich des Prä-Verbalen (allgemeiner: des Prä-Symbolischen) und Prä-Reflexiven liegen. Basis eines solch umfassenden Modells kann nur eine erweiterte Definition von Kommunikation bieten, die hinausgeht über die Vorstellung von Kommunikation als „System zielgerichteter und motivierter Prozesse, die die Wechselwirkung der Menschen in der kollektiven Tätigkeit gewährleisten, die gesellschaftlichen und die individuell-psychischen Beziehungen realisieren und dazu spezifische Mittel, vor allem die Sprache, verwenden“ (Leontjew 1984 nach Hettinger 1996, 167).
Etymologisch gründet der Ausdruck ‚Kommunikation‘ in dem lateinischen Verb ‚communicare‘. Dieses Wort beinhaltet in der Übersetzung zwei Bedeutungen: 1) ‚etwas gemeinsam machen‘ und 2) ‚teilen, mitteilen, teilnehmenlassen‘. Demgemäss umfasst der Kommunikationsbegriff neben zielgerichteten Mitteilungen an einen Mitmenschen auch gemeinsame Handlungen zweier oder mehr Personen sowie den Informationsaustausch ohne expliziten Mitteilungscharakter (vgl. Hettinger 1996, 166). In diesem Sinne benennt Hettinger in Anlehnung an Gottman (1979) zwei Kriterien, die einen Vorgang als Kommunikation ausweisen: „es müssen mindestens zwei Personen (Organismen, ‚Systeme‘) beteiligt sein und es muß eine Information übermittelt werden“ (Hettinger 1996, 166)[12]. Dabei ist es unwichtig, ob der Informationsaustausch von einer Mitteilungsabsicht getragen wird oder nicht. Hettinger weißt in diesem Zusammenhang auf die informationstheoretische Darstellung bidirektionaler Kommunikation bei Ploog (1972) hin und stellt fest, „daß das Abgeben und Aufnehmen von Informationen als entscheidendem Charakteristikum kommunikativer Prozesse nicht von einer wie immer gearteten Mitteilungsabsicht abhängig ist“ (Hettinger 1996, 166, Fußnote). Ebenso ist die Art der Information unerheblich, also „ihre sinnlich wahrnehmbare Form und die Bewegungen, Haltungen, Zustände und Vorgänge, die zu ihrer Hervorbringung dienen“ (Hettinger 1996, 166f).
Die soeben versuchte Begriffsbestimmung unter Beachtung der etymologischen Wurzeln des Begriffs ‚Kommunikation‘ legitimiert folgende Aussage: „Kommunikation ist somit nicht an Sprache oder ein anderes Zeichensystem gebunden“ (Hettinger 1996, 167). Die Auflösung der engen Verbindung zwischen Kommunikation und Sprache nimmt in der Begegnung mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung einen hohen Stellenwert ein.
An dieser Stelle möchte ich dem Leser auf Basis des bisher Ausgeführten eine vorläufige Definition des Kommunikationsbegriffs bieten. Im Wissen darum, dass das Thema Kommunikation sehr komplex ist und im Rahmen diese Arbeit nur bruchstückhaft dargestellt werden kann, und im Wissen um die zwangsläufig daraus resultierende Unvollständigkeit meiner Ausführungen, soll folgende Definition von René Spitz im weiteren Verlauf als Arbeitsgrundlage dienen: Spitz bezeichnet als Kommunikation „jede erkennbare, bewußte oder unbewußte, gerichtete oder nicht-gerichtete Verhaltensänderung (...) mittels derer ein Mensch (oder mehrere Menschen) die Wahrnehmung, Gefühle, Affekte, Gedanken oder Handlungen anderer absichtlich oder unabsichtlich beeinflußt“ (Spitz nach Pfeffer 1989, 142). In diesem Sinne ist jedes Verhalten meines Gegenüber Kommunikation, sobald mich sein Verhalten erreicht. Sowie ich sein Verhalten wahrnehme, ebenfalls bewusst oder unbewusst, werde ich davon beeinflusst und es wird zur Kommunikation zwischen dem Anderen und mir.
4. Leben – Beziehung – Kommunikation: Gedanken zu einem erweiterten Kommunikationsbegriff
Es gibt keine größere Illusion als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation zwischen Menschen.
(Elias Canetti, dt. Schriftsteller)
Die Auflösung des Bedingungsverhältnisses ‚Kommunikation ist Sprache‘ bedeutet einen wichtigen Schritt hin zu einem umfassenden Kommunikationsbegriff. Umfassend bedeutet in diesem Zusammenhang zweierlei. Zum einen meine ich damit eine alle Menschen umfassende Vorstellung, unabhängig von ihrer eventuellen Verhaftung in einem vorwiegend oder ausschließlichen leiblich-präreflexiven Zur-Welt-Sein. Zum anderen meint der Begriff ‚umfassend‘ den Menschen in seiner Existenz. Das heißt, dass unter Kommunikation nicht nur einzelne Lebensäußerungen gefasst werden, sondern dass Leben an sich Kommunikation ist. Dem Kommunikationsbegriff wohnt eine existentielle Bedeutung inne, die dem Menschen als dialogisches Wesen implizit ist. Die Einheit von Leben, Beziehung und Kommunikation als Elemente eines Ganzen soll im Folgenden ausgeführt werden.
„Unsere Welt, in der wir leben, ist ursprünglich kommunikativ geordnet“ (Dreher 1994, 79) – die Prämisse lautet: Leben ist Erleben. Welt ist Mit-Welt und Mit-Dasein (vgl. ders. 1994, 79). Das, was in dieser Mit-Welt Leben hervorbringt, das den Menschen motivierende Interesse, nennt Dreher ‚Inter-esse‘ – ‚Zwischen-sein‘ (vgl. ders. 79) – die Begegnung von Ich und Du.
In der Auseinandersetzung sowohl mit Bubers Philosophie als auch mit den phänomenologischen Gedanken zum Leib wurde die Einheit von Menschen und Welt und in Zusammenhang damit die existentielle Bedeutung von Beziehung betont. „Bereits vor jeder bewußten Intention ist der Mensch in seinem Leibe zur Welt hin und auf die Welt hin gestimmt“ (Pfeffer 1988, 12). In diesem Sinne ist Leben Beziehung und Kommunikation - ebenso wie Beziehung Kommunikation und Leben - und Kommunikation Beziehung und Leben ist. Menschliches Sein betreffend haben die drei Begriffe eine annähernd synonyme Bedeutung.
Mit Fornefeld komme ich zu einer Feststellung bezüglich menschlichen Lebens, die ihre Gültigkeit unabhängig von Behinderung hat: „(D)a der Mensch ohne Beziehung zur Welt nicht existieren könnte, ist Beziehung nichts anderes als Zur-Welt-Sein des Menschen“ (Fornefeld 1995, 188, Hervorhebung im Original).
Was aber versteht man unter Beziehung? In der Soziologie gilt Beziehung als „der Grad der Verbundenheit oder Distanz zw(ischen) Individuen, die in einem sozialen Prozeß vereint sind“ (dtv Brockhaus 1989, Bd. 2, 248).
Angesichts der existentiellen Bedeutung von Beziehung als Leben trägt diese soziologische Definition nicht weit genug. Wenden wir uns also einer anderen Betrachtungsweise zu, die diese überaus wichtige Funktion von Beziehung berücksichtigt: dem existenzphilosophisch-psychoanalytischen Ansatz des Schweizer Psychiaters Aron R. Bodenheimer. Er interpretiert die zwischenmenschliche Beziehung hauptsächlich als Seins- und Selbstbestätigung des Menschen. Ausgangspunkt ist seine Auffassung, dass der Mensch das grundlegende Bedürfnis hat "immerwährend zu fragen, ob er ist" (Bodenheimer nach Fornefeld 2001, 133) und wer er ist. Eine Antwort auf diese Fragen, die Feststellung, dass er ist und das Erkennen, wer er ist, erlangt er nur in der Beziehung zum Anderen. Denn nur durch die Begegnung kann er sich vom Anderen abgrenzen und sich dadurch bestätigt fühlen (vgl. Fornefeld 2001, 133). Zur Verdeutlichung dieses Zusammenhangs von menschlichen Daseinbestätigung und Selbsterkennung durch Beziehung stellt Bodenheimer eine Analogie her zwischen der menschlichen Beziehung und dem akustischen Phänomen des Echos (vgl. dies., 133): Der Mensch macht einen Ausruf und hört den Wiederhall seiner Worte. In diesem Hören erkennt er sich selbst als Verursacher der Laute – dies bestätigt ihm sein Dasein. Das Echo lässt sich neben der Seinsbestätigung allerdings auch zur Erklärung der Selbstbestätigung heranziehen: der Ausruf wird durch das Echo nicht identisch zurückgegeben, er schallt in verkürzter Form zurück. Für den Menschen liegt hierin die Möglichkeit der Selbstbestätigung, denn durch die Abweichung der Antwort von seinem Anruf ist es ihm möglich, sich als vom Echo abgegrenzt zu erfahren.
Bezogen auf des menschliche Leben in Beziehung ist es von ausschlaggebender Bedeutung, dass der Ausrufende eine Antwort erhält, der er Sinn zusprechen kann. Ein Antwort erscheint sinn-voll, "(w)enn zwischen dem Ausgerufenen und dem Wiedergegebenen irgendein Zusammenhang hergestellt werden kann (...). Als unsinnig wird das empfunden, was nicht vorauserwartet ist, also das, was in keiner Beziehung zu dem Geäußerten steht" (dies., 133, Hervorhebung im Original). Eine solche sinn-lose Antwort sowie auch das Ausbleiben einer Antwort erzeugt beim Anrufenden "Verblüffung" (Bodenheimer nach Fornefeld 2001, 133) und Angst – er steht verblüfft da, denn er kann sich in einer ausbleibenden Antwort nicht selbst entdecken (vgl. Fornefeld 2001, 133). "Im Falle von Verblüffung bleibt die Selbstbestätigung aus" (dies., 133). Beziehung ist folglich immer auf Anruf und Antwort angewiesen, erst durch das 'Zurück' entsteht der Mensch und dadurch die Beziehung. Beziehung ist also immer Rück-Beziehung (vgl. dies. 133) .
Bei Bodenheimer liegt der Schwerpunkt auf der Antwort an sich. Ich möchte die Gedanken Bodenheimers um eine Facette erweitern und die Bedeutung des Anderen - des 'Du' - stärken. Eine zwischenmenschliche Beziehung generiert sich immer aus der Begegnung mindestens zweier Personen, dem Ich und dem Du. Angesichts dieses Umstandes möchte ich im Horizont der aufgeführten Ideen Bodenheimers noch einmal auf Buber verweisen: "Der Mensch wird am Du zum Ich" (Buber 1994, 33). Das Du steht vor dem Ich – erst in der Begegnung mit dem Du erkennt sich das Ich. Zur Seinsbestätigung wird der Eine im Ausruf zum Anrufenden. Indem der Andere den Anruf hört und darauf reagiert, wird er dem Einen zum Du. Er gibt den Anruf wieder und ermöglicht dem Einen somit die Bestätigung seines Daseins. Ist die Antwort zudem sinn-voll (s.o.), kommt es außerdem zu einer Selbstbestätigung des Einen, dieser wird zum Ich. In diesem Sinne bedeutet Beziehung Leben.
Und Leben und Beziehung sind Kommunikation. Obwohl die Bedeutungen der beiden Begriffe Beziehung und Kommunikation nicht deckungsgleich sind, stehen sie sich in ihrem Sinngehalt so nahe, dass die Gleichsetzung gerechtfertigt erscheint. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die etymologische Herkunft des Begriffs Kommunikation verweisen: Die Übersetzung des Verbs ‚communicare‘ (1. etwas gemeinsam machen, 2. teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, vgl.o.) verdeutlicht die große Nähe der Begrifflichkeiten ‚Kommunikation‘ und ‚Beziehung‘. In beiden Bedeutungen schwingt Beziehungsgeschehen mit: durch Interaktion, durch ‚gemeinsam machen‘ wenden sich zwei Menschen einander zu und ‚teilen‘ den Moment, zwischen ihnen entsteht Beziehung – und Kommunikation.
5. Kommunikation angesichts schwerer geistiger Behinderung
Rufen wir uns noch einmal die vorgelegte Arbeitsdefinition von Kommunikation ins Gedächtnis (s.o. Definition von René Spitz). Ich möchte das Augenmerk des Lesers auf einen bestimmten Aspekt lenken: auch unbewusste, nicht-gerichtete Verhaltensänderungen gelten als Kommunikation, wenn sie vom anderen wahrgenommen werden und er somit dadurch beeinflusst wird. Daraus folgt, dass eine Kommunikation mit dem Menschen mit schwerer geistiger Behinderung dadurch beginnen kann, dass mir sein Verhalten zum Anruf wird, auch wenn es von ihm nicht als Mitteilung intendiert ist, und ich darauf antworte. In diesem Sinn umfasst ‚Verhalten‘ auch jegliche Art der leiblichen Äußerung.
Die kommunikativen Möglichkeiten des Leibes wurden oben (Kapitel 2.2.) bereits kurz angesprochen. Um zu verstehen, wie der Austausch mit einem anderen Menschen auf der Ebene des Leibes, wie der ‚leibhafte Dialog‘ möglich ist, ist eine eingehendere Auseinandersetzung mit dem kommunikativen Potential des Leibes nötig.
Wahrnehmung
Die Basis aller Beziehung und Kommunikation des Mensch zur Mit-Welt ist seine Wahrnehmung – durch die Wahrnehmung nimmt er Bezug zu seiner Umwelt auf. Der Ort unserer Wahrnehmung ist der Leib: unser Leib ist ein wahrnehmender Leib, er vereint das System der wahrnehmenden Sinne und wird somit selbst zu einem Organ der Wahrnehmung. Der Weg der Wahrnehmung ist in dieser Vorstellung kein kausal-räumlicher. Ausgangspunkt ist nicht der Umweltreiz, der von den Sinnesorganen in Nervenimpulse umgewandelt wird und über die Nervenbahnen die cerebralen Zentren erreicht. Phänomenologisch gesehen ist Wahrnehmen Erleben. Begründet in der Einheit von Leib und Welt ist das Objekt meiner Wahrnehmung ein Korrelat meines Leibes. Dennoch erlebe ich es in seinem Sein als von mir getrennt (vgl. Pfeffer 1988, 37ff). Dieser Widerspruch erklärt sich durch die Beachtung der Leiblichkeit, „die jenen dialektischen Raum abgibt, in dem die Dinge gleichzeitig subjektiv wahrnehmend angeeignet werden und doch eben darin als sie selbst erfahrbar sind. (...) Weil der Leib gewissermaßen selbst ein Stück Welt ist, sind wir im Leib unmittelbar bei den Dingen, ohne daß sie dabei ihr eigenes Sein verlieren, erweist er sich doch immer auch als der von den Dingen angezeigte und unterschiedene, als ‚mein Leib‘ “ (Pfeffer 1988, 39, Hervorhebungen im Original). Wahrnehmung erfolgt also immer aus der Perspektive meiner Leiblichkeit. „Mein Leib ist mein Gesichtspunkt für die Welt“ (Merleau-Ponty nach Pfeffer 1988, 40). Das heißt mit anderen Worten, dass ich zwar das Ding selbst erfasse, allerdings perspektivisch. Somit ist das Ding mehr, als ich momentan wahrnehme, es reicht über seine aktuelle Erscheinung hinaus (vgl. Pfeffer 1988, 40)
Im phänomenologischen Denken wird dem Wahrnehmungsprozess Sinnstiftung zugeschrieben. Im Sinne Merleau-Pontys ist Wahrnehmung der „Dialog des Subjekts mit dem Objekt, in dem das Subjekt den im Objekt ausgebreiteten Sinn übernimmt und das Objekt die Intentionen des Subjekts" (Merleau-Ponty nach Pfeffer, 40). Die Dinge erlangen Bedeutung, Maßgabe hierfür ist die Leiblichkeit. Der Prozess der Sinnstiftung geschieht bereits vor einer reflektierenden Auseinandersetzung mit dem Ding: „Unser Leib stiftet schon einen qualitativen, geformten, bedeutungsvollen und sinnreichen Zusammenhang mit den räumlichen und zeitlichen Dimensionen, mit den Dingen und situationalen Strukturen, ohne daß wir persönlich etwas davon wissen“ (Buytendijk nach Pfeffer 1988, 12). Dadurch, dass mir etwas auffällt, mich erreicht, verweist mich mein Leib in sinnvoller Weise auf ein Objekt, dass für mich von Bedeutung ist.
Das beziehungsstiftende Potential der Wahrnehmung wird konkreter, wenn man die beziehende Dimension der Sinne betrachtet. Aron R. Bodenheimer entwickelte eine Theorie der Elemente der Beziehung. Es entspricht nicht der Natur der Wahrnehmung, die einzelnen Sinne als separierte Wahrnehmungsorgane zu untersuchen (vgl. Fornefeld 1995, 187). Bodenheimer gibt keine Antwort auf die Frage nach der Ursache der sinnlichen Einheit. Phänomenologisch gründet die Einheit der Sinne in der Leiblichkeit: „Der Singularität der Sinne geht die Ganzheit des intentionalen Leibes voraus“ (Pfeffer nach Fornefeld 1995, 193). In Bodenheimers Verständnis sind die Sinne die Vermittlungsorgane der Beziehung und in Verbindung mit dem, was wahrgenommen wird, als die Elemente[13] der Beziehung in ihrer Einheit zu betrachten (vgl. Fornefeld 1995, 187).
Bodenheimer nennt folgende fünf Elemente: das visuelle Element, das auditive Element, das osmatische Element, das haptisch-taktile Element und das gustatorische Element. Jedes Element setzt sich aus zwei ‚Radikalen‘ zusammen, die gleichwertig zueinander stehen: als erstes Radikal bezeichnet Bodenheimer „die Sinne als Vermittlungsorgan“ (Bodenheimer nach Fornefeld 1995, 188), das zweite Radikal ist „das, was sich den Sinnen mitteilt“ (Bodenheimer nach Fornefeld 1995, 188). Die Radikale sind aufeinander bezogen, mittels des ersten Radikals, der Sinneswahrnehmung wende ich mich der Welt im zweiten Radikal zu – dies erklärt die Auffassung von Wahrnehmung als beziehungsstiftend. Dieser Gedankengang lässt sich erneut ebenfalls phänomenologisch auslegen als begründet in der Einheit von Mensch und Welt, von dem Wahrnehmenden und dem Wahrgenommenen.
Ich möchte die einzelnen Elemente kurz vorstellen, um dem Leser einen Eindruck ihrer beziehungsstiftenden Dimension zu vermitteln:
1. „Das visuelle Element setzt sich aus den Radikalen ‚Sehen‘ und ‚Erscheinen‘, man könnte auch ‚Aus-Sehen‘ sagen, zusammen“ (Fornefeld 1995, 189, Hervorhebung im Original).
2. „Das auditive Element baut sich aus den Radikalen ‚hören‘ und ‚Tönen‘ bzw. ‚Sich-Anhören‘ auf“ (dies., 189, Hervorhebung im Original).
3. Die Radikale des osmatischen Elements klingen gleich: ‚Riechen‘ und ‚Riechen‘ (vgl. dies., 190).
4. „(D)as haptisch-taktile Element (...) setzt sich aus den Radikalen ‚Fühlen‘ und ‚Anfühlen‘ zusammen“ (dies., 191, Hervorhebung im Original)
5. Das letzte Element bezeichnet Bodenheimer als das Paradigma der medialen Beziehung. Die eindeutige Gliederung in Radikale erweist sich als schwierig - das direkte, einander schmeckende Beziehen wäre Kannibalismus (vgl. dies. 192). Die gustatorische Beziehung erfolgt über das Medium Essen: „Das gemeinsame Mahl verbindet. Die Partner beziehen sich sowohl auf die Speise als auch aufeinander über die Speise bzw. vermittels der Speise “ (Bodenheimer nach Fornefeld 1995, 192, Hervorhebungen im Original)
Die Definition von Wahrnehmung als sinn- und beziehungsstiftend ermöglicht ein Verständnis von Kommunikation zwischen dem Ich und der Welt auf einer Ebene, die keine Anforderungen an die intellektuellen Möglichkeiten eines Menschen stellt. Über den Leib nimmt er Beziehung zur Welt auf.
Auf dieser Ebene wird jedoch nicht deutlich, in welcher Weise es zu einem leiblich fundierten wechselseitigen Austausch subjektiver Sinnstiftungen kommt. Kommunikation meint den reziproken Bezug zweier Menschen aufeinander. Während die Wahrnehmung den Bereich der Aufnahme von Sinn umschließt, stellt sich nun die Frage nach den Möglichkeiten, Sinn auszudrücken.
Leib als Ausdruck
Die meisten Menschen mit schwerer geistiger Behinderung vermögen es nicht, sich über ihr Befinden, ihr Erleben und ihre Bedürfnisse verbal oder mittels einer vereinbarten Zeichensprache mitzuteilen. Begründet in ihrem präreflexiven und präsymbolischen Zugang zu Welt, drücken sie sich leiblich aus. Angesichts der Einheit von Leib, Geist und Seele ist die beobachtbare leibliche Verfasstheit eines Menschen Ausdruck seines geistigen und seelischen Geschehens. „Präreflexiv und präverbal drücken sie sich in und durch ihre leibliche Erscheinung aus, die es zu verstehen gilt.“ (Pfeffer 1988, 31). Für die Schwerstbehindertenpädagogik bietet die Betrachtung des Menschen als Leib eine Möglichkeit, der Kommunikation von Menschen mit einer schweren Behinderung eine angemessene Grundlegung zu geben.
Die Ausdrucksmöglichkeiten eines Menschen sind die Grundlage seiner Intersubjektivität. Auf die Frage des wechselseitigen Verstehens (Intersubjektivität) gehe ich im folgenden Kapitel 2.6. näher ein, die nun folgenden Ausführungen beschäftigen sich hingegen mit den Möglichkeiten des Ausdrucks qua Leib.
Der Leib ist immer das aktuelle Sein des Menschen. Er ‚verkörpert‘ das, was ich gerade bin, was ich fühle und wie es mir geht. Er ist nicht nur ein Zeichen dafür, was gerade in mir vorgeht, vielmehr ist er „Ausdruck der Modalitäten (meiner) Existenz überhaupt“ (Merleau-Ponty nach Pfeffer 1988, 31). Demnach sind „(d)ie Haltung, die Bewegung, die vegetativen Regulationen wie Kreislauf, Atmung, Temperatur, Weisen der Nahrungsaufnahme, die Entleerung (Aus-scheidungen), Krankheiten sowie die vielfältigen sogenannten Verhaltensstörungen (Apathie, Hyperaktivität, Aggressivität, Auto-aggressivität, Stereotypien ...) (...) als subjektiver Ausdruck der Existenz und des Bewußtseins im Leib zu betrachten und zu verstehen“ (Buytendijk nach Pfeffer 1988, 31).
Den Ausdruck des situativen Zur-Welt-Seins bezeichnet Pfeffer als ‚Emotioniertsein‘ (vgl. Pfeffer 1988, 32f). Es ist der eruptive, unwillkürliche Ausdruck aktuellen Seins. In der gegebenen Situation ist es die ‚spontan gelebte und erfahrbare Äußerung‘ (vgl. ders., 32f). Um zu Verdeutlichen, was mit Emotioniertsein gemeint ist, nennt Pfeffer in Anlehnung am Buytendijk beispielhaft folgende Weisen des Emotieniertseins: „Ergriffen-, Bestürzt-, Gerührt-, Bewegt-, Getroffen-, Erschreckt-, Überwältigt-Sein (...) und Schreck, Ekel, Notreaktionen (panische Angst und Wut) sowie Aggression“ (Buytendijk nach Pfeffer 1988, 32). Es kann nicht linear-kausal erklärt werden, die Ursache des Emotioniertseins sind nicht die autonomen Systeme des Menschen. Vielmehr ist es „das, worauf sich das Zur-Welt-Sein des Menschen situationsbezogen stützt, was sich unter anderem darin zeigt, daß er in der gleichen Situation je anders emotioniert sein kann, bzw. daß verschiedene Menschen in derselben Situation unterschiedlich emotioniert sind“ (Pfeffer 1988, 33, Hervorhebung im Original). Im Zusammenhang mit der Beschäftigung des leiblichen Ausdrucks ist es von Bedeutung zu erwähnen, dass die verschiedenen Weisen des Emotioniertseins von ausgeprägten vegetativen Erscheinungen begleitet werden: die Atmung verändert sich, der Mensch erblasst oder errötet, sein Kreislauf intensiviert sich usw. (vgl. ders., 32). Mittels der somatischen Erscheinungen des Leibes ist es uns möglich, mit dem Anderen in Beziehung zu treten. Diese Möglichkeit des Ausdruck ist jedem Menschen, unabhängig von einer Behinderung, eigen. Die somatischen Ausdrucksformen wie Gesten und Gebärden (Körperbewegungen), Speichelfluss, Atemfrequenz, Tränenflüssigkeit und vieles mehr, sind für den einzelnen auf der präreflexiven Ebene sinnvolle Reaktionen auf seine personelle und materielle Umwelt (vgl. Fornefeld 2001, 136).
Das Potential des intersubjektiven Austauschs über die somatischen Erscheinungen des Leibes gründet nun in dem ursprünglichen Verstehen der leiblichen Gesten des anderen. Der leibliche Ausdruck ist nicht als Zeichen für etwas dahinterstehendes Psychisches anzusehen. Und zu ihrem Verständnis ist somit keine Reflexion nötig, denn es gibt kein ‚Dahinter‘, welches durch Reflexion erschlossen werden muss. Vielmehr ist die Gebärde das, was sie ausdrücken will. „Um etwa eine zornige oder drohende Gebärde zu verstehen, muß ich mir nicht erst die Gefühle in die Erinnerung rufen, die ich selbst einmal hatte, als ich dieselben Gebärden machte. (...) und übrigens fasse ich Zorn oder Drohung nicht als hinter den Gesten verborgene psychische Fakten, ich sehe vielmehr den Zorn der Gebärde an: sie läßt nicht lediglich denken an Zorn, sie ist der Zorn“ (Merleau-Ponty nach Dederich1997, 177).
Auf Basis der Grundannahme grundsätzlicher Beziehungsfähigkeit jedes Menschen und der Beachtung somatischer Erscheinungen als sinnvolle Äußerungen können mir die somatischen Ausdrucksformen eines Menschen mit schwerer geistiger Behinderung zum Anruf werden, die ich leiblich verstehe und auf die ich leiblich antworten kann – unmittelbarer leibhafter Dialog kann entstehen. Der leibhafte Dialog ist charakterisiert durch eine Gleichberechtigung beider Partner, denn in Bezug auf den leiblichen Ausdruck besteht kein Kompetenzgefälle zwischen den Partnern. Innerhalb des leibhaften Dialogs werden der Andere und ich zur Welt füreinander und es kommt zu gegenseitigem Verstehen (vgl. Fornefeld 2001, 136).
Es stellt sich mir an dieser Stelle die Frage, was ‚gegenseitiges Verstehen‘ bedeutet. Ist die Kommunikation mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung nicht häufig geprägt von Unverständnis und Missverständnis? Woher kann man die Sicherheit nehmen, dass das, was man meint verstanden zu haben, wirklich dem Inhalt der Mitteilung entspricht? Und häufig bleibt die Ungewissheit, was von dem, was ich aussagen möchte, beim anderen angekommen ist.
Auch Pfeffer ist sich die Bedeutung dieses Aspekts bewusst, wenn er schreibt: „Vieler ihrer (der Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, Anm. d. Autorin) Verhaltensweisen bleiben unverständlich und erschweren die Kommunikation. Die großen Schwierigkeiten, Kinder und Jugendliche mit schwerer geistiger Behinderung zu verstehen, rütteln gleichzeitig am Selbstverstehen des Erziehers (des Dialogpartners, Anm. d. Autorin)“ (Pfeffer 1988, 55).
Angesichts dieser Problematik setzt sich das folgende Kapitel mit dem komplexen Phänomen ‚Verstehen‘ auseinander.
6. Verstehen
"Jan liegt in seinem Bällchenbecken. Er erscheint mir gut gelaunt und zufrieden. Allerdings ist er etwas ruhiger als sonst und reagiert auf meine Versuche, etwas mit ihm zu kuscheln oder zu spaßen nicht, sondern spielt weiter mit seinem Wasserball, der von der Decke hängt. Ich habe den Eindruck, er möchte lieber in Ruhe gelassen werden. Also verlasse ich das Zimmer wieder und begebe mich daran, in der Küche seinen Abendbrei herzurichten. Als ich nach einigen Minuten wieder in sein Zimmer gucke, liegt er da und schläft. Es ist sehr untypisch, über Tag schläft er eigentlich nie. Ich wundere mich, lasse ihn aber in Ruhe weiterschlafen und verlasse den Raum wieder. Plötzlich höre ich, dass Jan weint. Es sind nicht seine üblichen Unmutsäußerungen, die er macht, wenn er nicht mehr spielen will oder ähnliches. Vielmehr weint er sehr heftig und ich habe den Eindruck, er hat Schmerzen. Zuerst kontrolliere ich seine Kleidung, vielleicht ist irgendwo eine Druckstelle entstanden. Doch ich kann nichts finden. Sein Körpertemperatur erscheint mir normal. Ich streiche über seinen Bauch, doch er ist weich und bläht sich nicht auf, Jan zeigt keine besondere Reaktion, als ich den Bauch berühre. Ich nehme ihn auf den Arm, doch er windet sich heraus. Also lege ich ihn wieder hin und wechsele seine Windel. Danach biete ich ihm etwas zu trinken sowie etwas zu essen an, beides lehnt er ab. Wie sooft verstehe ich nicht, was Jan mir mitteilen möchte, was ihm fehlt und was ich für ihn tun kann. Da ich keinen Auslöser für sein Weinen feststellen kann, weiß ich mir keinen anderen Rat, als zum Kinderarzt zu fahren. Obwohl ich die Eltern nicht beunruhigen will, bitte ich den Vater, mit mir und Jan die Praxis aufzusuchen. Der Arzt untersucht Jan und diagnostiziert eine schmerzhafte Mittelohrentzündung." (Grundlage: 5.2.3. Beobachtungsprotokoll vom 21.03.03)
Die beschriebene Situation ist ein Extremfall davon, dass das Verstehen in der Kommunikation zwischen Jan, einem Kind mit schwerer geistiger Behinderung, und mir kaum gelingt. Alltägliche Situationen gestalten sich selten so dramatisch wie die beschriebene, dennoch stehe ich Jan häufig gegenüber und frage mich in Gedanken: "Was möchte er mir sagen?"
In der Begegnung mit Jan T. stellt sich mir immer wieder die Frage, was von dem, was ich tue, bei ihm ankommt. Und ebenso oft frage ich mich, was ich von dem, was er mir mitteilen möchte, richtig verstehe. Häufig kommt es zu Situationen, in denen ich Jans Verhalten in keinerlei Zusammenhang mit der von mir wahrgenommenen Situation bringen kann. Ganz plakativ hierfür stehen die Momente, in denen Jan plötzlich heftige emotionale Aktion zeigt, sei es bitterliches Weinen oder herzhaftes Lachen, ohne das ich den Auslöser hierfür bemerke – in meinem Sinnhorizont sowie in meinem Versuch, seinen Sinnhorizont zu erfassen, tritt sein Verhalten völlig zusammenhangslos auf. Wenn ich ein positives emotionales Befinden wahrnehme, gelingt es mir, mich ohne Kenntnis der Ursache hierfür darüber zu freuen, dass es Jan scheinbar gut geht. Habe ich jedoch den Eindruck, es geht ihm nicht gut oder er fühlt sich sogar sehr schlecht, dann belastet mich die Unkenntnis der Ursache sehr. Denn in dem Wissen, dass Jan seine Situation nicht ohne Unterstützung verändern kann, wird seine schlechte Verfassung für mich zu einem Bitten um Hilfe. Aber ich verstehe häufig nicht, in welcher Hinsicht er Hilfe braucht, stehe zunächst hilflos da und versuche dann Verschiedenes (wie zum Beispiel eine Lageveränderung, Anbieten von Nahrung oder einem Getränk, Anbieten von anderem Beschäftigungsmaterial), um schließlich an seiner Reaktion feststellen zu können, ob ich das Richtige gefunden habe.
Während der ersten Jahre meiner Zusammenarbeit mit Jan war es für mich das Wichtigste, eine Ebene zu finden, mit Jan in Kontakt zu kommen. Abgesehen davon, dass er sich weder verbal noch über ein Zeichensystem auszudrücken vermag, weicht Jan jedem Blickkontakt aus. In den fast vier Jahren, die wir uns kennen, erlebte ich es bisher nur höchstens fünf Mal, dass wir uns gegenseitig in die Augen schauten. Allein diese Tatsache vermittelt ein starkes Gefühl davon, für den anderen nicht wirklich da zusein. Ich hatte lange Zeit den Eindruck, Jan nicht zu erreichen. Mit der Zeit stellte ich fest, dass er es genießt, für eine Weile auf meinem Bauch oder in meinem Schoss zu liegen. Während er sonst ständig in Bewegung ist, mit seinen Armen rudert und mit den Beinen strampelt, wird er dann für einige Minuten ruhig, er atmet tief ein und aus. Ohne erklären zu können, worauf ich meine Vermutung stützte, spürte ich sein Wohlbefinden. Somit wurde das 'Kuscheln' für mich eine Möglichkeit, Jans Befinden für ein paar Augenblicke positiv zu beeinflussen – wir waren in Kontakt. Erst im Laufe meines Studiums, durch die Beschäftigung mit verschiedenen theoretischen Grundlegungen, wuchs in mir das Bewusstsein, dass wir auf diesem Wege miteinander in Kommunikation treten. Trotzdem wich mein Verständnis der Begriffe 'Kommunikation mit Jan' und 'Kommunikation mit sogenannten Nicht-Behinderten' stark voneinander ab. Während 'Kommunikation mit sogenannten Nicht-Behinderten' für mich in der wechselseitigen Verständigung mit meinen Mitmenschen bestand, hatte ich bei der 'Kommunikation mit Jan' lange das Gefühl, der Kommunikationsbegriff sei seltsam verkürzt – das 'Schönreden' einer Tatsache, die doch nicht vielmehr ist als das 'normale' Wohlbefinden im körperlichen Kontakt. Geplagt von Selbstzweifeln habe ich mich damit auseinadergesetzt, warum ich den Austausch mit Jan nicht als 'richtige' Kommunikation erleben konnte – und ich wurde mir meiner Auffassung bewusst, dass Kommunikation für mich in großem Ausmaß kognitives 'Verstehen' bedeutet: rational verstehen (vielleicht besser auch: erklären können), was der andere denkt, welche Wünsche er hat, was genau er gerade tun möchte, was er von einer Situation hält usw. Diesem sachlichen Verstehen, der Annäherung an die Auffassungen des Gegenübers, sind in der Begegnung mit Jan ganz enge Grenzen gesetzt. In dem Bewusstsein der Dominanz des kognitiven, reflektierten 'Verstehens' in meiner Konstruktion von 'Kommunikation', gewann dieser Themenkomplex für mich eine herausragende Bedeutung für meine vorliegenden Ausführungen zur "Kommunikation in einer Familie mit einem Kind mit Mehrfachbehinderung".
Die Suche nach einem weniger reflexiv als vielmehr umfassenden, auch die Leiblichkeit berücksichtigenden Verstehensbegriff, begann im Brockhaus: hier gilt verstehen als "Sinnerforschung eines Zeichens, Worts, Satzes; unmittelbares Begreifen eines ursächl(ichen) oder Sinnzusammenhangs, des Wesens einer Person oder ihrer Äußerung" (dtv Brockhaus Lexikon, Bd. 19, 163). Diese allgemeine Definition von 'Verstehen' greift so weit, dass unter Verstehen jeder Prozess gemeint ist, der dem Verstehenden einwenig Sinn von etwas oder jemand anderem vermittelt. Hier gibt es aber keinerlei Auskunft darüber, wie Verstehen abläuft und was es bedeutet, den Sinn von etwas oder jemandem 'erforscht' und 'begriffen' zu haben.
Der Konstruktivismus[14] benennt das Problem der Verstehens als die Frage danach, "ob der Kommunikationspartner in bezug auf die eigenen Bedeutungs-zuweisungen hinreichend ähnliche Bedeutungen konstruiert. (...) Verstehen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass der eine Kommunikationspartner einen Sachverhalt ebenso erfasst oder begreift wie der andere, sondern lediglich die Annahme, dass die individuellen Bedeutungszuweisungen kompatibel sind" (dies., 83). Ob die beiden Partner sich gegenseitig Verstehen wird nur an ihren jeweiligen Reaktionen deutlich. Reagiert mein Gegenüber auf meine Ansprache in einer für mich sinnvollen Weise, kann ich daran erkennen, dass seine Konstruktion meiner Mitteilung der meinen ähnelt. Dadurch kommen wir zu einem für uns beide sinnvollen Austausch. Reagiert mein Gegenüber jedoch in für mich völlig überraschend und zusammenhangslos, wird deutlich, dass unsere Sinnkonstruktionen sich nicht hinreichend ähneln ergo dass wir uns nicht verstanden haben.
Der Konstruktivismus versteht Wahrnehmung als den Prozess der Interpretation der Umwelt durch das Subjekt (vgl. dies., 31). Dahinter steht die Überzeugung, dass die Wirklichkeit immer durch die subjektiven Wahrnehmung des Einzelnen konstruiert ist. Ungeachtet des Disputs, ob eine objektive, subjektunabhängige Realität[15] existiert oder nicht, ist es jedenfalls unmöglich, Aussagen über eine von der Interpretation des Subjekts unabhängige Realität zu treffen, denn es kann keine Beobachtung ohne einen Beobachter geben (vgl. dies, 5ff).[16] "Wahrnehmen und Erkennen sind keine Abbildungen einer wahrnehmungs-unabhängigen Realität, sondern das Konstrukt eines aktiven Subjekts. Der Mensch ist kein Entdecker der Gegebenheiten, sondern ein Erfinder und Konstrukteur (seiner subjektiven Welt, Anm. d. Autorin)" (Lindemann et al 1999, 14). Die Kommunikation als Phänomen innerhalb der Wahrnehmung basiert somit auf meiner Wahrnehmung meines Partners, aber nicht auf seiner Person oder seiner Äußerungen direkt. Ich beziehe mich lediglich auf mein Bild, welches ich vom Anderen habe, auf meine Konstruktion meines Gegenübers. Der Logik des konstruktivistischen Denkens folgend, ist der andere für mich in der Begegnung niemals das mir gegenüberstehende Subjekt, sondern ich erlebe ihn lediglich als Objekt meiner Wirklichkeit auf Basis meiner Intentionen.
Demgegenüber steht die Auffassung der Phänomenologie. Sie geht davon aus, dass es eine Wirklichkeit gibt, die vor jeder subjektiven Erkenntnis liegt – 'die Sache selbst' (Husserl nach Fornefeld 1998a, 47). "'Die Sache selbst' sind die Phänomene, wie sie sich von sich selbst her einem unvoreingenommenen und unverstellten Blick auftun" (Waldenfels nach Fornefeld 1998a, 47, Hervorhebung im Original). Auch in der phänomenologischen Vorstellung stehen sich Mensch und Welt nicht polar und strikt voneinander abgegrenzt gegenüber. Doch während im Konstruktivismus ausschließlich das Subjekt in seinem Sinnhorizont Wirklichkeit konstruiert, vereinen sich hier Mensch und Welt in einem 'konstituierendem Geschehen' (vgl. Fornefeld 1998a, 48) – mit anderen Worten: sie stehen in einem interdependenten Verhältnis und beeinflussen sich wechselseitig.
Das phänomenologische Verständnis des Fremdverstehens
Während im Konstruktivismus Fremdverstehen als 'mein Erlebnis von dir' verstanden wird, zielt die Phänomenologie mit 'echtem Fremdverstehen' auf das Erfassen der Sinnzusammenhänge des Anderen, seiner Motive und seiner Selbstauslegung (vgl. ders., 64f).[17]
Schütz entwickelt eine Theorie des echten Fremdverstehens als reflexive Selbstauslegung des Wahrgenommenen (vgl. Pfeffer 1988, 63ff). In diesem Sinne bedeutet Verstehen, dass wir ein Verhalten des Anderen beobachten und dieses unter Berücksichtigung unserer Kenntnisse über den anderen nachfantasieren. "Wir entwerfen also das fremde Handlungsziel als Ziel unseres eigenen Handelns und phantasieren nun den Hergang unseres an diesem Entwurf orientierten Handelns" (Schütz nach Pfeffer 1988, 65). Neben dem Nachfantasieren ermöglicht auch ein von Schütz als Reproduktion bezeichneter Vorgang das Verstehen der beobachteten Handlung: indem ich mich an eine von mir selbst schon einmal vollzogene ähnliche Handlung und die damit zusammenhängenden Bewusstseinserlebnisse erinnere, wird mir ein Verstehen der Handlung des Anderen möglich (vgl. ders., 65).
Im Hinblick auf Menschen mit schwerer geistiger Behinderung stellt Schütz' Theorie keinen adäquaten Ansatz dar, denn Fremdverstehen auf Basis reflexiver Selbstauslegung berücksichtigt nicht das Verstehen auf prä-reflexiver Ebene. Trotzdem gibt es präreflexives Verstehen, Verstehen also, zu dem es ohne Reflexion des Verhaltens kommt. Zur Erinnerung verweise ich auf die bereits erwähnte Vorliebe Jans, in meinem Schoss zu liegen. Zu Beginn meiner Arbeit mit Jan verstand ich 'intuitiv', d.h. ohne bewusste Reflexion der Situation, dass es Jan gefällt, mit mir zu kuscheln. Ohne Kenntnis von basaler Kommunikation oder ähnlichen Ansätzen aus der Schwerstbehindertenpädagogik merkte ich einfach, dass er sich dann wohlfühlt. Damals erschien es mir zudem nicht wichtig, die Anlässe zu erforschen, auf denen sich meine Annahme gründete.
Wie lässt sich aber das präreflexive Verstehen erklären? Pfeffer begründet es mit dem Leib-sein des Menschen: denn in seiner Leiblichkeit ist er immer schon kommunikativ auf die Welt und den anderen gerichtet. Er ist grundsätzlich als Leib auf den Leib des Anderen hingeordnet und nimmt in diesem Sinne den Leib des anderen in Korrespondenz zu seinem eigenen Leib wahr (vgl. ders., 69). Denn trotz aller Abgegrenztheit zwischen Du und Ich erkennt mein Leib im Leib des anderen eine bekannte Weise des Umgangs mit der Welt[18] (vgl. ders., 70). "Der Leib des Anderen ist also in gewisser Weise eine 'Ansicht' vom eigenen Leib, so ist er dem Ich gegeben. Und ebenso ist das Ich mit seinem Leib dem Anderen als eine gewisse 'Ansicht' von ihm gegeben. Darin gründet der Dialog zwischen Ich und dem Anderen, der die Möglichkeit des Einverstehens und auch des Nichteinverstehens impliziert" (ders., 69). Das Verstehen des anderen gründet im gemeinsamen leiblichen Weltbezug von Du und Ich. In der intersubjektiven Situation ist die Umwelt des Dus ebenso die Umwelt des Ichs – es ist eine gemeinsame Umgebung, "die Eine uns gemeinsame intersubjektive Welt, die uns da vorgegeben ist" (Schütz nach Pfeffer 1988, 74). Der Grad der Andersheit des Anderen steht den Grad der Gemeinsamkeit im Weltbezug und somit auch den Grad der Möglichkeit, den anderen zu begreifen in einem umgekehrt proportionalem Verhältnis ("je mehr – desto weniger").
Angesichts der Frage nach dem gegenseitigen Verstehen begegnen wir einem Grundproblem der Phänomenologie: der Konstitution des Anderem im intentionalen Leben: "Wie ist es möglich, daß der Andere nicht vergegenständlicht als Objekt meines intentionalen Lebens erscheint (wie es im Verständnis des Konstruktivismus intendiert ist, Anm. d. Autorin), sondern für mich als Subjekt seines intentionalen Lebens" (Pfeffer 1988, 55)? Gerade in Bezug auf den Umgang mit Menschen, die gemessen an meinem Sein nicht 'normal', sondern vielmehr in einer überwältigenden Weise 'defizitär'[19] sind, beinhaltet die Verobjektivierung des Anderen eine Verfügung über sein Leben, die ihn in seinem subjektiven So-Sein übergeht. In diesem Sinne bedeutet Verobjektivierung Entmündigung.
Auf Grund der kommunikativen Ausrichtung des Menschen und der Welt konstituiere ich den Anderen nicht, sondern er ist mir immer schon gegeben. "Der Andere ist für mich und er ist für mich unverfügbar" (Pfeffer 1988, 71). Für Pfeffer ist dies im Sinnhorizont von Merleau-Ponty nicht verwunderlich, denn ebenso wie der Andere bin ich mir selbst unverfügbar gegeben: "Ich entgehe mir als Subjekt, wenn ich meinen Blick auf mich selbst richte und mich gleichsam 'vergegenständliche', bleibt doch immer die Frage, wer es denn sei, der hier seinen Blick auf mich selbst richtet" (ders., 71). Bereits vor jeder Wahrnehmung und vor jeder Reflexion bin ich bereits in der Welt situiert und dabei gerichtet auf Andere, die ich nicht konstituiere, sondern die mir, so wie ich mir gegeben bin, ebenfalls vor jeder Wahrnehmung und Reflexion gegeben sind (vgl. ders., 71). In diesem Umstandbegründen sich die Grenzen des Fremdverstehens. Und eben diese Grenzen sind der Grund dafür, dass er andere Subjekt bleibt, genauso wie darin meine Subjekthaftigkeit begründet ist. "Ohne diese Subjekthaftigkeit von Ego (Ich, Anm. d. Autorin) und alter ego (Du, Anm. d. Autorin) gäbe es für das Ego überhaupt kein alter ego, weil sonst die Welt des einen die des anderen einschließen würde und der eine sich zugunsten des anderen selbst entfremdet fühlte" (Pfeffer 1988, 72).
Die grundsätzliche Hinwendung des Menschen zum Anderen und der gerade beschriebenen Verbleib von Ich und Du in der Subjekthaftigkeit birgt eine Schwierigkeit für den Menschen: denn alle Versuche, die Grenze zwischen Eigenem und Anderem zu überwinden (motiviert von der grundsätzlichen Hinwendung) scheitern aufgrund der unüberwindbaren Subjekthaftigkeit des Anderen: "Ich bleibe ein anderer. Was sich von daher empfiehlt, ist ein Agieren und Denken auf der Grenze" (Meyer-Drawe/Waldenfels nach Fornefeld 1998a, 116).
"Du störst, ich störe, wir stören einander ..." (Aron R. Bodenheimer) – Zur Wesentlichkeit der Andersheit
Fornefeld setzt sich mit der Auffassung des Anderen als 'Fremder in der Nähe' auseinander: da sowohl alle Aneignungsversuche, durch die Ich und Du sich losgelöst voneinander polar gegenübergestellt werden, als auch alle Enteignungsversuche, die auf die Auflösung aller Grenzen zwischen Du und Ich zielen, aus den bekannten Gründen scheitern, beschäftigt sie sich mit der Begegnung des Anderen auf der Grenze. "Was das Bewegen auf der Grenze meint, wird deutlich, wenn man nach der Verflechtung von Eigenem und Fremden diesseits von Aneignung und Enteignung fragt" (Fornefeld 1998a, 116, Hervorhebung durch d. Autorin). Im Sinn Merleau-Pontys ist Verflechtung das Abheben in ein gemeinsames Feld. Dies gelingt uns durch gemeinsames Reden und Handeln. Waldenfels und Meyer-Drawe sprechen davon, dass im "tatsächlichen Umgang von Kindern und Erwachsenen (von Ich und Du, Anm. d. Autorin) sich Fremdes und Eigenes unaufhörlich kreuzt, ohne jedoch in Deckung zu geraten, was das Ende jeder Verständigung wäre" (Mayer-Drawe/Waldenfels nach Fornefeld 1998a, 120). Entscheidend ist zu erkennen, dass sich das Eigene und das Fremde im Umgang, in der Verflechtung gegenseitig bereichern können. Von Bedeutung ist es also, nicht nur die Andersheit zu erkennen, sondern ihr bereicherndes Potenzial anzuerkennen. Die Entscheidung, die Fremdheit des anderen in ihrer positiven Wirkung anzuerkennen, fällt angesichts schwerer Behinderung schwer, "weil hier die 'Unbestimmtheit' menschlichen Seins augenfälliger ist, nach Bemächtigung drängt und zur Überakzentuierung der Fremdheit führt" (dies., 124). Dennoch, oder besser gesagt gerade deswegen gibt der Aspekt der Bereicherung der Begegnung mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung in ihrer Fremdheit eine neue Qualität: "Behinderung ist also in diesem Sinne keine 'Unordnung', sondern eine andere, neue Ordnung, die bereichernd auf die normierte zurückzuwirken vermag" (dies., 118).
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf Aron R. Bodenheimer zurückkommen: Im Kapitel 2.4. haben wir uns bereits mit der menschlichen Seins- und Selbstbestätigung durch Kommunikation beschäftigt. Es wurde deutlich, dass das dauerhafte Streben nach Harmonie und Gleichheit in der zwischenmenschlichen Beziehung lediglich die Seinsbestätigung ermöglicht. Die Selbstbestätigung wird erst in der Abgrenzung zum Anderen – durch die Auseinandersetzung mit abweichenden Meinungen, Einstellungen und Zugangsweisen – möglich.
Bodenheimer nennt drei Grundformen zwischenmenschlicher Beziehungen: Begleiten – Erweitern – Stören (vgl. Bodenheimer 1986); und er stellt fest, dass sich jede Beziehung einer dieser drei Formen zuordnen lässt – in seinem Sinne sind mehr als drei 'Grund-Dynamismen' nicht vonnöten (vgl. ders., 96).
Die drei Formen will ich dem Leser in aller Kürze mit Bodenheimers Worten nahe bringen:
1. Begleiten:"So hat es das Begleiten an sich, daß es in völliger Konsequenz und größtmöglicher Kongruenz Gleiches mit Gleichem beantwortet" (ders., 97, Hervorhebung im Original). In diesem Sinne wird Beziehung verwirklicht, indem das Du die Äußerungen des ich ohne Abwandlung zurück gibt – dem Ich wird Seinsbestätigung ermöglicht.
2. Erweitern: "Dies ist nun mehr als Begleiten. Es ist ein Weiterführen, über das hinaus, was der (A)nredende (...) sagt oder auch nur andeutet. Es wird aus einer Sache zwar nicht eine andere Sache gemacht, aber es entwickelt sich die engere Sache zu einer weitern Sache" (ders., 100). Durch die Erweiterung des Ursprünglichen bringt das Du sich und sein So-Sein in die Beziehung ein. Wenn die Veränderung dem Ich als sinn-voll erscheint, kommt es zum Austausch zwischen Ich und Du.
3. Stören: "(D)iesmal (wird) weder (...) gleichsinnig begleitend (...), noch durch eine Erweiterung des Angebotenen (...) geantwortet; vielmehr wird etwas widersprechend anderes hinzu gegeben" (ders., 101). Durch die Begegnung mit dem Abweichenden kommt es für das Ich zur Selbstbestätigung. Dies verdeutlicht folgender Satz in seiner Radikalität: "Dadurch, daß etwas negiert (gestört) wird, findet es erst bezeugt, daß es besteht" (ders., 104).
Als Psychotherapeut interessieren Bodenheimer besonders die therapeutischen Möglichkeiten, die das Wissen über die Wirkungen der genannten Grundformen beim Patienten hervorrufen. Angesichts schwerer geistiger Behinderung ist die Theorie der Grundformen der Beziehung für mich von Interesse, weil neben der Bedeutung der Antwort auch die Wirkung der Antwort fokussiert wird. Und in diesem Zusammenhang legimitiert sich die Andersheit der Partner in einer Beziehung: das in der Andersheit begründete gegenseitige Stören erweist sich als ergiebig für die Entwicklung des Einzelnen: "Du störst, ich störe, wir stören einander: und spüren erst jetzt, wie wesentlich wir füreinander sind" (ders., 112).
Obwohl die Argumentation Bodenheimers einem anderen Sinnzusammenhang entspringt als die von Fornefeld, unterstreicht auch die Theorie der Grundelemente der Beziehung die wesentliche Funktion der Andersheit.
Wandel der Wertigkeiten
In der Auseinandersetzung mit der Idee des Verstehens wandelte sich meine Vorstellung von Verstehen auf verschiedenen Ebenen:
1) Dadurch, dass ich mich mit Pfeffers Theorie des präreflexiven Verstehens aufgrund der Leiblichkeit auseinandergesetzt habe, wuchs mein Vertrauen in meine Fähigkeit bzw. die Fähigkeit meines Leibes, Jan bzw. Jans leiblichen Ausdruck zu verstehen. Im alltäglichen Umgang mit ihm gestehe ich meinem 'Gefühl im Bauch' wieder eine größere Bedeutung zu.
2) Angesichts der Bedeutung der Andersheit gelingt es mir, meinen Anspruch an das 'absolute' Verstehen des Anderen abzubauen. Ich versuche, unsere Schwierigkeiten im gegenseitigen Verstehen als in der Natur der Sache liegend zu begreifen und somit dem Gefühl des Versagens weniger Bedeutung zuzuschreiben.
Obwohl sich keine grundsätzliche Wandlung vollzogen hat, reagiere ich auf Situationen misslingender Kommunikation weniger betroffen. Im Vergleich zu vorher erscheint es mir nun wichtig, dass ich Jan beispielweise verstehe, wenn er mir mitteilt, dass er Hunger oder Durst hat. Weniger wichtig ist dann, dass ich nicht verstehe, was er essen oder trinken möchte. Ebenso ist es mir wichtig zu erkennen, dass er sich wohl fühlt und weniger warum er sich wohlfühlt. Die Ebene des basalen Verstehens[20] entwickelt sich auf Grundlage der Erfahrung gemeinsamer Weltbezüge: im Laufe der Zeit habe ich gelernt, Jans unterschiedliche Formen des Weinens zu verstehen - da gibt es Weinen als Ausdruck von Langeweile, als Ausdruck von Unwohlsein (beides ist mehr ein 'Quengeln' als richtiges Weinen) und das bitterliche Weinen, welches ich seit der beschriebenen Situation zu Anfang des Kapitels als Weinen vor Schmerz zu verstehen weiß. Ebenso kann ich sein Husten differenzieren: manchmal hustet Jan, weil er krank ist; oder er hustet, weil er sich beim Essen oder Trinken verschluckt hat; oft jedoch hustet er beim Mittagessen. Anfangs dachte ich, das Essen wäre vielleicht nicht fein genug püriert und er verschlucke sich an den Reiskörnern oder ähnlichem. Irgendwann fiel mir auf, dass der Milchreis, den er manchmal am Abend oder zum Nachtisch isst, eine ähnliche Konsistenz hat, wie das Mittagessen - am Milchreis verschluckt er sich nie. Das Husten am Mittagstisch ist wohl vielmehr Ausdruck dafür, dass es ihm nicht sonderlich schmeckt und er lieber etwas Süßes essen möchte. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema 'Verstehen' gelingt es mir, in Situationen wie dem Erkennen seines Hustens beim Essen als 'Theater' neue Wertigkeiten zu setzen: während ich mich früher darüber ärgerte, dass Jan so ein 'Theater' macht, statt ordentlich zu essen, werte ich diese Situation nun als gelungene Kommunikation ergo als Verstehen. Denn Jan kann mir verständlich machen, dass er die angebotene Mahlzeit nicht mag. Und in Anerkennung seiner Fähigkeit, selbst zu entscheiden und auszudrücken, was er mag oder nicht, beende ich die Mahlzeit mittlerweile, wenn dieses Husten auftritt - auch dann, wenn ich meine, er sollte noch mehr essen[21].
Literatur:
Bodenheimer, Aron R. (1967): Versuch über die Elemente der Beziehung, Stuttgart
Bundschuh, Konrad / Ulrich Heimlich / Rudi Krawitz (Hrsg.) (1999): Wörterbuch Heilpädagogik, Bad Heilbrunn
Buytendijk, Frederik J.J. (1967): Prolegomena einer anthropologischen Physiologie, Salzburg
Dederich, Markus (1997): Leiblichketi, Erziehung und Identität – eine geistigbehindertenpädagogische Skizze, in: Dreher, Walter: Denkspuren: Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung – Basis einer integralen Pädagogik, 2. Aufl., Aachen
Dederich, Markus (1998): Leiblichkeit, Kommunikation und Musik – Die Bedeutung einer Philosophie der Leiblichkeit für Pädagogik und Therapie, in: Behinderte 3/1998, 33-46
Dreher, Walter (1979): Überlegungen im Vorfeld einer sonderpädagogischen Theoriebildung der Erziehung schwer geistigbehinderter Menschen, in: Dreher, Walter (1997): Denkspuren: Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung – Basis einer integralen Pädagogik, 2. Aufl., Aachen, 2-19
Dreher, Walter (1991): Anthropologische Fragen angesichts schwerster Behinderung, In: Fröhlich, Andreas (Hrsg.): Pädagogik bei schwerster Behinderung. Handbuch der Sonderpädagogik Bd. 12, Berlin, 60-69
Dreher, Walter (1994): Die ‚Innenwelt‘ von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung – Ein Problem in der Begegnung von Mensch zu Mensch, in: Dreher, Walter (1997): Denkspuren: Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung – Basis einer integralen Pädagogik, 2. Aufl., Aachen, 77-92
Dreher, Walter (1997): Denkspuren. Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung – Basis einer integralen Pädagogik, 2. Aufl., Aachen
Dreher, Walter (1998): Vom Menschen mit geistiger Behinderung zum Menschen mit besonderen Erziehungsbedürfnissen – Umdeutung einer „Unabänderlichen“ oder ein grundlegender Paradigmenwechsel in der (Sonder-)Pädagogik?, In: Dörr, Günter: Neue Perspektiven in der Sonderpädagogik, Düsseldorf, 57-75
Dtv Brockhaus Lexikon, München 1989
Eggert, Dietrich (1997): Von den Stärken ausgehen – Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lernförderdiagnostik; 2. Aufl., Dortmund
Feuser, Georg (1998): „Geistigbehinderte gibt es nicht!“ - Projektionen und Artefakte in der Geistigbehindertenpädagogik, In: Geistige Behinderung 35, 18-25
Fornefeld, Barbara (1998a): Das schwerstbehinderte Kind und seine Erziehung – Beiträge zu einer Theorie der Erziehung, 2. Aufl., Heidelberg
Fornefeld, Barbara (1998b): Menschen mit (schwersten) Behinderungen eine Herausforderung für die Pädagogik? – Ermutigung zur Reflexion pädagogischen Handelns, in: Dörr, Günter: Neue Perspektiven in der Sonderpädagogik, Düsseldorf, 77-93
Fornefeld, Barbara (2001): Elementare Beziehung – Leiborientierte Pädagogik – Phänomenologische Schwerstbehindertenpädagogik; in: Fröhlich, Andreas / Norbert Heinen / Wolfgang Lamers: Schwere Behinderung in Praxis und Theorie – ein Blick zurück nach vorn, Düsseldorf , 127 – 144
Fröhlich, Andreas (Hrsg.) (1991): Pädagogik bei schwerster Behinderung. Handbuch der Sonderpädagogik Bd. 12, Berlin,
Fröhlich, Andreas (1998a): Auf der Suche nach dem Menschen; in: Dörr, Günter: Neue Perspektiven in der Sonderpädagogik, Düsseldorf, 21-31
Fröhlich, Andreas (1998b): Basale Stimulation - Das Konzept, Düsseldorf
Fröhlich, Andreas (1998c): Die Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen unter restriktiven Bedingungen; in: Zeitschrift für Heilpädagogik 49, 96-99
Girtler, Roland (1988): Methoden der Qualitativen Sozialforschung – Anleitung zur Feldarbeit, Wien
Gottman, John M. (1979): Marital interaction, New York
Greving, Heinrich / Dieter Gröschke (Hrsg.)(2000): Ein praxologisches Fazit oder der Versuch einer Zwischenbilanz, in: Greving, Heinrich / Dieter Gröschke (Hrsg.): Geistige Behinderung – Reflexionen zu einem Phantom, Bad Heilbrunn, 201-210
Heinen, Norbert / Wolfgang Lamers (2001): Wanderung durch die schwerstbehindertenpädagogische Landschaft; in: Fröhlich, Andreas / Norbert Heinen / Wolfgang Lamers: Schwere Behinderung in Praxis und Theorie – ein Blick zurück nach vorn, Düsseldorf, 13-47
Hettinger, Jochen (1996): Selbstverletzendes Verhalten, Stereotypien und Kommunikation – Die Förderung der Kommunikation bei Menschen mit geistiger Behinderung oder Autismussyndrom, die selbstverletzendes Verhlaten zeigen, Heidelberg
Jantzen, Wolfgang (2000): Geistige Behinderung ist kein Phantom – Über die soziale Wirklichkeit einer naturalisierten Tatsache, in: Greving, Heinrich / Dieter Gröschke (Hrsg.): Geistige Behinderung – Reflexionen zu einem Phantom, Bad Heilbrunn, 166-178
Kittel, Ingo-Wolf (1981): Systematische Überlegungen zum Begriff „Krank“ in der Medizin im allgemeinen und in der Seelenheilkunde im besonderen, in: Degkwitz, R. / H. Siedow (Hrsg.): Standorte der Psychiatrie. Band 2: Zum umstrittenen psychiatirschen Krankheitsbegriff, München, URL: http://www.sgipt.org/medppp/krank/iwk1.htm (15.08.2003)
Kobi, Emil E.(1983): Vorstellungen und Modelle zur Wesenserfassung geistiger Behinderung und zum Umgang mit geistig Behinderten, in: Geistige Behinderung 22, 155-166
Krawitz, Rudi (1999): Kommunikation, in: Bundschuh, Konrad / Ulrich Heimlich / Rudi Krawitz (Hrsg.): Wörterbuch Heilpädagogik, Bad Heilbrunn, 169-173
Kron, Friedrich W. (1999): Wissenschaftstheorie für Pädagogen, Basel
Leontjew, Alexej A. (1984): Psychologie der Kommunikation, in: Leontjew, Alexej A. / Alexej N. Leontjew / E.G. Judin: Grundfragen einer Theorie der sprachlichen Tätigkeit, Berlin, 45-198
Lindemann, Holger / Nicole Vossler (1999): Die Behinderung liegt im Auge des Betrachters – Konstruktivistisches Denken für die pädagogische Praxis, Neuwied
Mayring, Philipp (1996): Einführung in die qualitative Sozialforschung – Eine Anleitung zu qualitativem Denken, 3., überarbeitete Auflage, München
Mühl, Heinz (1991): Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik, 2. Aufl., Stuttgart
Nagel, Thomas / Michael Gebauer (Hrsg.)(1991): Die Grenzen der Objektivität – Philosophische Vorlesungen, Stuttgart
Petzold, Hilarion (1993): Integrative Therapie. Modelle, Theorien und Methoden für eine schulenübergreifende Psychotherapie, 3 Bände, Paderborn
Pfeffer, Wilhelm (1984): Handlungstheoretisch orientierte Beschreibung geistiger Behinderung – Ein Versuch, in: Geistige Behinderung 23, 101-111
Pfeffer, Wilhelm (1988): Förderung schwer geistig Behinderter – Eine Grundlegung, Würzburg
Ploog, Detlev (1972): Kommunikation in Affengesellschaften und deren Bedeutung für die Verständigungsweisen des Menschen, in: Gadamer, Hans-Georg / Paul Vogler: Neue Anthropologie II, Stuttgart, 98-178
Plügge, Herbert (1967): Der Mensch und sein Leib, Tübingen
Schäfer, Ralph I. / Matthias Goos / Sebastian Goeppert: Online-Lehrbuch Medizinische Psychologie, URL: http://www.medpsych.uni-freiburg.de/OL (12.08.2003) s. Anhang
Schärli, Otto (1998): Durch die Sinne zum Sinn. Sinne – Schnittstelle zwischen innen und außen, in: Behinderte 3/98, 21-32
Schröder, Siegfried (1979): Beschreibungen und Definitions- Betreuungs- und Erziehungsansätze bei mehrfachgeschädigten Geistigbehinderten, in: Zeitschrift für Heilerziehung und Rehabilitationshilfen 2/1979, 7-25
Schumacher, Johannes (1985): Schwerstbehinderte Menschen verstehen lernen, in: Geistige Behinderung 1/1985 Innenteil
Speck, Otto (1990): Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Erziehung – Ein heilpädagogisches Lehrbuch, 6. Aufl., München
Speck, Otto (1996): System Heilpädagogik – Eine ökologisch reflexive Grundlegung, 3. Aufl., München
Spitz, René (1983): Vom Säugling zum Kleinkind – Naturgeschichte der Mutter-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr, 7. Auflage, Stuttgart
Stengel-Rutkowski, Sabine (2002): Vom Defekt zur Vielfalt, Zeitschrift für Heilpädagogik 2/2002, 46-55
Theunissen, Georg (2000): Wege aus der Hospitalisierung – Empowerment in der Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen, Bonn
Wagner, Michael (1999): Autonomie, in: Bundschuh, Konrad / Ulrich Heimlich / Rudi Krawitz (Hrsg.): Wörterbuch Heilpädagogik, Bad Heilbrunn, 26-28
Wiesinger, Hannelore: Qualitative Methoden nach Mayring, unveröffentlichtes Skript, Universität zu Köln, URL: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/fs-psych/serv_pro/mayring.html (04.09.2003), s. Anhang
Witt, Harald (2003): Welche Forschung ist normal oder wie normal ist qualitative Sozialforschung?, unveröffentlichtes Skript, Universität Hamburg, URL: http://rrz.uni-hamburg.de/psych-1/witt/Archiv/ringvorlesung%2096/rvtxt4.html (02.06.2003)
[...]
[1] Zitat: Buber 1994, 152
[2] Der Ausspruch ist ein Zitat Martin Bubers (Buber 1994, 152)
[3]. ‚Es‘ sind Gegenstände. Dazu gehören für Buber neben Dingen auch Menschen, die dem Ich momentan kein Du sind.
[4] Als Grundbewegung bezeichnet Buber die Basis einer Wesenshaltung einer Person (vgl. ders., 170), sie ist elementarer Bestandteil der Persönlichkeit.
[5] Die ungekürzten Artikel ‚Hospitalismus’ und ‚Deprivation’ aus dem Freiburger Online-Lehrbuch findet der interessierte Leser im Anhang.
[6] In der phänomenologischen Terminologie wird der beschriebene Doppelcharakter der menschlichen Leiblichkeit als ‚ambiguité‘ (beziehungsweise ‚Ambiguität‘) bezeichnet. Zur Begriffsklärung zieht Dreher Plügge heran, der Ambiguität in Anlehnung an den französischen Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty wie folgt präzisiert: „Als ‚Ambiguité‘ bezeichnen wir eine Verknüpfung von lediglich gelebter Leiblichkeit, die von der unlösbaren Verbindung mit allen je möglichen, die Grenzen der eigenen Person überschreitenden Beziehungen zur Welt, Umwelt und Situation bestimmt ist, mit der ständig anwesenden, oft kaum bemerkbaren, aber letzten Endes bestimmenden Körperlichkeit. Das heißt, alles Leibliche hat eine grundsätzliche ständige Beimischung von substantieller Dinglichkeit. Und alles Körperliche hat, soweit es sich nicht einfach um eine Leiche handelt, eine geistige Struktur“ (Plügge nach Dreher 1979, 7).
[7] In dem herangezogenen Aufsatz thematisiert Dreher das Phänomen der Ambiguität unter anderem im Horizont von Buytendijks Werk „Prolegomena einer anthropologischen Physiologie“.
[8] Linguistik: Wissenschaft der Sprache, Sprachwissenschaft (dtv Brockhaus 1989, Bd. 11, 65)
[9] ‚Intentional‘ meint hier, dass der kommunikativen Aktion eine Mitteilungsabsicht zugrunde liegt.
[10] vgl. hierzu Kapitel 2.1. (s.o.)
[11] vgl. hierzu Kapitel 2.2. (s.o.)
[12] Unter Informationsübermittlung verstehe ich, dass jemand eine Information abgibt, die ein anderer aufnimmt.
[13] Mit folgendem Zitat rufe ich dem Leser die in Kapitel 2.2 vorgestellte Auffassung des Begriffs ‚Element‘ ins Gedächtnis: „Es wäre nun falsch zu glauben, daß sich das Ganze aus der additiven Verbindung seiner Einzelteile ergäbe, sondern die Spannung, die zwischen den Elementen und dem Ganzen besteht, ‚macht den elementaren Charakter der Elemente aus‘ (Bodenheimer 1967, 27)“ (Fornefeld 1995, 186).
[14] Der Konstruktivismus sieht Kommunikation als einen Prozess, bei dem der eine Kommunikationspartner versucht, in seinem Gegenüber eine Bedeutungsstruktur auszulösen, die soweit ähnelt, dass eine gegenseitige Verständigung möglich wird (vgl. dies., 82). Dass Kommunikation bei Lindemann und Vossler als ein zielgerichteter Prozess verstanden und somit enger definiert wird als das oben von mir ausgeführte Verständnis von Kommunikation, beeinflusst nicht die Relevanz ihrer Auffassung von Verstehen.
[15] Siehe hierzu Lindemann und Vossler 1999 ab Seite 5.
[16] Die konstruktivistische Vorstellung soll hier nicht näher ausgeführt werden. Den interessierten Leser verweise ich auf das Buch von Holger Lindemann und Nicole Vossler, welches eine umfassende Einführung in den Konstruktivismus bietet.
[17] In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, darauf hinzuweisen, dass der Andere allerdings nie vollständig, sondern nur annäherungsweise erfasst werden kann. Der Grund hierfür sieht Schütz darin, "daß vom Erlebnisstrom des Du das Ich nur Bruchstücke, 'diskontinuierliche Segmente' erfaßt, während vom eigenen Erleben dessen ganze Dauer und Fülle der Selbstauslegung offen steht" (Schütz nach Pfeffer 1988, 64).
[18] vgl. Kapitel 2.5., wo ich bereits auf das ursprüngliche Verstehen der leiblichen Gesten des anderen eingegangen bin.
[19] Ich weise darauf hin, dass ich das Wort 'defizitär' in diesem Zusammenhang lediglich zur Verdeutlichung der Unterschiede gebrauche, gemessen an den 'Normen' meines Seins. Diese 'Normen' sind jedoch nicht Grundlage meiner Betrachtung von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung (Vermeidung der angesprochenen Objektivierung).
[20] 'Basal' möchte ich in diesem Zusammenhang nicht als 'rudimentär' sondern vielmehr als 'grundlegend' verstanden wissen. Mit 'basalem Verstehen' meine ich, dass ich Jans emotionales Befinden leiblich verstehe und dieses Verstehen auch als Verstehen begreife, indessen mir teilweise die Sinnzusammenhänge, aus denen heraus er emotioniert ist, reflexiv verschlossen bleiben.
[21] Es liegt nicht in meiner Befugnis, zu entscheiden, was Jan mag oder nicht. Ebenso-wenig kann ich darüber entscheiden, wie viel er zu essen hat. Die Problematik der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung werde ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Bei Interesse des Lesers verweise ich ihn an den Handbuchartikel „Autonomie“ von Michael Wagner. Dieser gibt besonders unter 4. eine kurze Einleitung sowie in den Literaturangaben weitere Querverweise.
- Arbeit zitieren
- Friederike Sturm (Autor:in), 2003, Im Haus der Sprachen sind viele Wohnungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108439
Kostenlos Autor werden














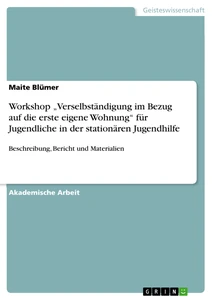

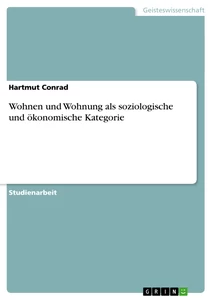



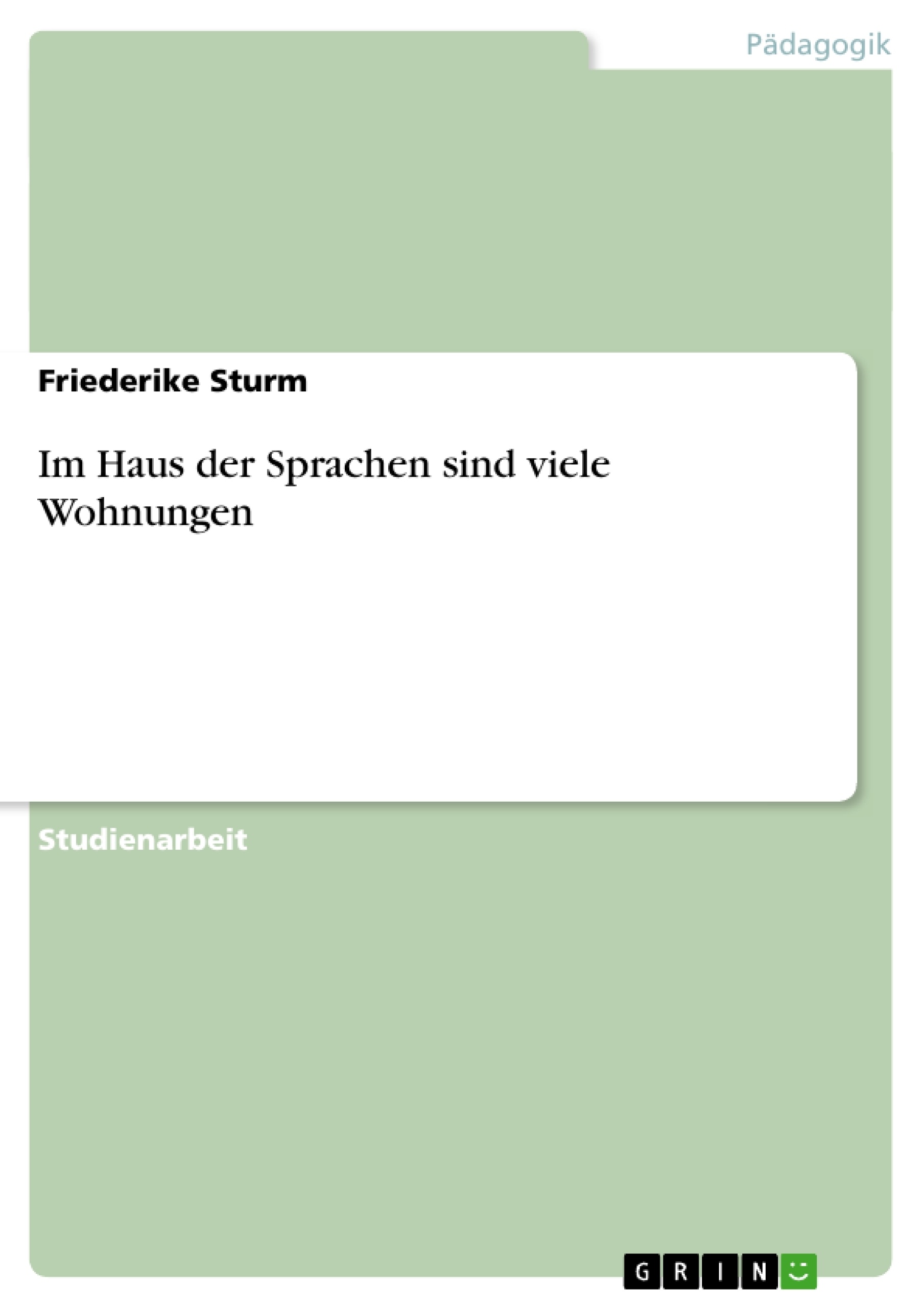

Kommentare