Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kunst, Therapie und Kunsttherapie
2.1 Wurzeln der Kunsttherapie
2.1.1 Kunst
2.1.1.1 Kunstverständnis im Wandel
2.1.1.2 Joseph Beuys
2.1.1.3 Kunst ist verrückt
2.1.2 Psychoanalyse
2.1.2.1 Die Symboltheorie von Sigmund Freud
2.1.2.2 Die Symboltheorie von Carl Gustav Jung
2.1.3 Pädagogik
2.2 Streit um den Begriff Kunsttherapie
2.2.1 Kunsttherapie als Überbegriff
2.2.2 Kunst als Therapie
2.2.3 Theapie mit kreativen Elementen
2.2.4 Kunstpsychotherapie
2.2.5 Anthroposophische Kunsttherapie
2.3 Kunsttherapeutische Möglichkeiten und Grenzen
3. Psychiatrie
3.1 Krankheitsansichten: Schizophrenie
3.2 Schizophrene Symptome
3.2.1 Verlust
3.2.2 Gewinn
3.2.3 Verschiebungen
3.2.4 Erhalt
3.3 Rolle der Diagnose Schizophrenie in der therapeutischen Praxis
3.3.1 Diagnose als Etikettierung
3.3.2 Diagnose als Therapieansatz
3.4 Rolle der KunsttherapeutInnen in der Arbeit mit Schizophrenen
4. Kunsttherapie mit Schizophrenen
4.1 Spezifische Ansätze und Techniken
4.1.1 Klinische Gruppentherapie
4.1.2 Tagesklinische Gruppentherapie
4.1.3 Einzeltherapie
4.2 Bildinhalte
4.2.1 Stilelemente
4.2.2 Symbole
4.2.3 Bildanalyse als Diagnoseverfahren
4.3 Relevanz der Kunsttherapie im Vergleich zu anderen bei schizophrenen angewandten Therapien
4.3.1 Pharmakotherapie
4.3.2 Psychotherapie
4.2.3 Beschäftigungstherapie
5. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Eidesstattliche Erklärung
1. Einleitung
„Bei mir ist das aber so, daß ich mir für viele Fragen unseres Lebens, für die Frage der Kunst und auch für die Frage der Wissenschaft den größten Erfolg versprochen habe, indem ich versuche, auf dem Papier eine Sprache zu entwickeln, die eine Anregung dazu gibt, Weitergehendes in die Diskussion zu bringen, mehr als nur das, was die gegenwärtige Zeitkultur an Wissenschaftlichkeit, an Kunstbegrifflichkeit und Sinnen darstellt.“ Joseph Beuys 1979
Kunst ist ein weites Feld, ebenso Therapie, selbst schon die Psychoanalyse, und Kunsttherapie erst recht. Genauso das Thema Schizophrenie. Um dem Thema „Kunsttherapie mit Schizophrenen“ gerecht zu werden, macht sich eine ausführliche Annäherung notwendig, die in der vorliegenden Arbeit den großen Raum der Kapitel zwei und drei einnimmt. Erst auf deren Grundlage ist es möglich, Konkretes und Verstehbares über die Kunsttherapeutische Arbeit mit Schizophrenen darzustellen. Beim Lesen wird die Vielgestaltigkeit der sich in wesentlichen Punkten unterscheidenden Ansätze deutlich werden, die alle unter dem Begriff Kunsttherapie subsumiert werden. In der vorliegenden Arbeit wird er - wenn nicht genauer beschrieben - auf die malerische, selten auch auf die plastisch gestaltende Kunsttherapie angewandt. Andere Kunstgattungen wie Musik, Theater, Dichtung, Tanz etc. konnten hier keine Berücksichtigung finden und werden in der Regel auch klassifiziert gebraucht (z.B. Musiktherapie), wenn auch der Streit um den Begriff Kunsttherapie längst nicht geklärt, sondern noch in vollem Gange ist.
Erörtert werden hier ausführlich die Rolle der Kunst und die der Therapie sowie deren spezifische Anteile am Zustandekommem der Kunsttherapie. Daraus lassen sich bereits Aspekte der Relevanz von Kunsttherapie ableiten, die später exemplarisch anhand eines Krankheitsbildes vertieft werden.
Der Terminus Schizophrenie wird hier verwendet, weil er gemein üblich ist. Im Text enthaltene Anfragen an das Krankheitsverständnis von Schizophrenie sowie die geäußerte Skepsis, ob schizophrene Symptomatik - soweit sie überhaupt als solche klassifizierter ist - überhaupt Krankheitswert besitzt und ob daher der Begriff der psychischen Störung oder der der Dünnhäutigkeit nicht passender wären, sollen der Verwendung des Terminus als Metapher nicht entgegenstehen und vor allem die Verständlichkeit und Lesbarkeit des vorliegend Verfaßten erleichtern. Das gleiche trifft für die Bezeichnung PatientIn zu. In der kunsttherapeutischen Praxis ist dies der den Betroffenen von außen zugewiesene Status. Wäre dem nicht so, fehlte der Kunsttherapie ihr derzeit größtes Einsatzfeld - das klinische.
In der Kunsttherapie wirken nach Ingrid Riedel vier Prozesse: Gestaltungs-, Symbolisierungs-, Besprechungs- und Beziehungsvorgang (vgl. RIEDEL 1992, S.25). Zur Darstellung dieser ist m.E. die wissenschaftliche Sprache allein nicht ausreichend geeignet. Dies macht die Einbeziehung der Alltagssprache notwendig, was ihrer Würdigung gleichkommt. Denn den Begriff des Normalen gilt es sowohl innerhalb der Kunst als auch im Umgang mit der Schizophrenie zu hinterfragen und auszudehnen. Für den Schreibstil gilt m.E. das gleiche. In vorliegender Arbeit wurden Alltagssprache und wissenschaftliche Sprache ebenbürtig behandelt. Um aber dem gegenwärtig geltenden Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit trotzdem Genüge zu tun, erhalten die als „Gespräche mit Herrn X.“ bezeichneten Einschübe den Status von Exkursen, sind daher streng abgetrennt und stören nicht den Lesefluß der nur wissenschaftliche Formulierweisen gewöhnten LeserInnen. Die „Gespräche“ sind fiktiv, entbehren aber nur selten real zugrundeliegenden Theorien, Personen und Begebenheiten. Auch sollen die „Gespräche“ hinsichtlich des Beziehungsvorgangs die Dynamik eines Prozesses beschreiben.
Die festgestellte Begrenztheit verbaler Ausdrucksfähigkeit ist ein Grund für die Herausbildung gestaltungsorientierter Therapien überhaupt; Therapien, bei denen das Wort nur eine nachgeordnete, mitunter auch gar keine Rolle spielt. Umfangreiches Bildmaterial illustriert den Text nicht nur, sondern - eher andersherum - der Text soll die Bilder erklären. Neben Reproduktionen von Werken psychotischer und/oder „verrückter“ KünstlerInnen stehen Dokumentationen aus kunsttherapeutischer Arbeit. Hauptkriterium der Auswahl war die Darstellung des Zerrissenen, Gespaltenen, Schizophrenen; gemäß der Diagnose Carl Gustav Jungs aus dem Jahre 1961: „Die Welt ist durch sie (monströse Geschehen vergangener Jahrzehnte - d.V.) auf den Kopf gestellt worden und befindet sich seither im Zustand der Schizophrenie“ (JUNG 1994, S.77).
Auch die moderne Kunst im Allgemeinen zeigt dies deutlich. Bereits die Greueltaten des 1. Weltkrieges führten zum „Die Kunst ist tot“-Dadaismus mit dem Versuch, das Kaputte, die zerrissene Welt künstlerisch-unästhetisch darzustellen und damit ihrem Zustand Rechnung zu tragen. Ohne diese und spätere Entwicklungen innerhalb der Kunst wäre die Herausbildung einer eigenständigen Disziplin Kunsttherapie undenkbar. Ausgehend von der offensichtlichen Notwendigkeit der „Heilung der Welt“ entstand in den vergangenen Dekaden mit zunehmender Häufigkeit der Versuch, die Welt, die Gesellschaft(en), den einzelnen Menschen zu therapeutisieren. Alles mögliche wurde dazu verwendet; besonders östliche und antike Verfahren wurden modifiziert und verbreitet (vgl. PETERSEN 1994, S.159 f). Der Markt ist heute kaum zu überblicken, auf dem die Hilfs- und Heilungsbedürftigkeit nicht selten bewußt - meist finanziell - ausgenutzt wird, wobei diese hinterher häufig größer und existentieller ist als vorher (vgl. THIES <Hrsg.> 1987, S.36 f; Original: BROCKHOFF 1986, S.18). Will die Kunsttherapie nicht in diese Rubrik abrutschen, macht sich eine seriöse und damit fundierte Theorie notwendig. An der wird gearbeitet, doch sind die bisherigen Erfolge eher ernüchternd. Näher wird darauf in Kapitel 2.3 (Kunsttherapeutische Möglichkeiten und Grenzen) eingegangen.
Kunsttherapie, so jung diese auch ist - in Deutschland wird sie erst seit zehn bis 15 Jahren angewandt, ein Beginn ist nicht exakt festlegbar - so unüberschaubar ist bereits die Fülle der Veröffentlichungen. Diese Arbeit unternimmt den Versuch, eine möglichst große Zahl kunsttherapeutischer VertreterInnen zu benennen, zu zitieren. Am konkreten Beispiel wird in die Tiefe gegangen werden - besonders in Kapitel 4 (Kunsttherapie mit Schizophrenen).
Da Überschneidungen existieren zwischen den einzelnen Kapiteln, ließen sich Wiederholungen und Vorgreifungen nicht vollständig vermeiden. Sie machen aufmerksam auf die fließenden Grenzen, den weiten Gesamtzusammenhang und das Themenübergreifende dieser Arbeit.
2. Kunst, Therapie und Kunsttherapie
„ ... daß wir das Rad nicht neu zu erfinden brauchen. Viel kann von denen gelernt und legitimerweise übernommen werden, die entweder das Wesen der Kunst oder die Psyche des Menschen ausführlich erforscht haben.“ Karin Dannecker 1992
Kunsttherapie als integrativer Ansatz aus Kunst und Therapie - so stellt Karin Dannecker es (sich) vor (vgl. DANNECKER 1994, S.19). Als eher gegensätzliche Pole betrachten Elisabeth Tomalin und Peter Schauwecker Kunst und Therapie und fragen: „Ist Kunsttherapie ein Widerspruch in sich?“ (TOMALIN/SCHAUWECKER 1993, S.20). Sowohl Kunst als auch Therapie geben Antworten auf Lebensfragen, jedoch die Kunst auf intuitive, die Therapie auf rationale Art. Dieser Ausgangspunkt läßt die Schwierigkeit erahnen, beides unter einen Hut zu bringen, was ihnen natürlich gelingt und an Hand von Theorie und Beispiel sehr eingänglich dargestellt wird.
Daß es auf das richtige Verhältnis ankommt, betont Doris Titze (vgl. TITZE 1993, S.98). So gelte es besonders für „künstlerische“ KunsttherapeutInnen, „ein Übergewicht des Kunst-Anspruches abzubauen und die Therapie zu ihrem Recht kommen zu lassen.“ (ebd.). Mehr als nur Kunst und Therapie findet Rainer Wick in der Kunsttherapie. Diese habe auch Animationsfunktion in Bezug auf soziale Prozesse und der Sensibilisierung für diese, ebenso diagnostische Aufgaben (auch gesellschaftlicher Art), sie müsse Kommunikation anregen, sozialwissenschaftliche Methoden - z.B. Befragungs- und Beobachtungsmethoden - anwenden, kultur- und kunstpolitische Beiträge leisten etc. (vgl. ROMAIN 1994, S.20; Original: WICK o.J.)
Wie konnte sich bei dieser Aufgabenfülle überhaupt eine Kunsttherapie entwickeln? Noch dazu, da „die Auseinandersetzung mit ästhetischen Materialien für die meisten Patienten angstbesetzt und schwierig ist“ (DOMMA 1990, S.20) und damit nicht nur kunsttherapeutische AnbieterInnen, sondern auch deren RezipientInnen von vornherein zu überfordern scheint?
Dieser Frage soll - verbunden mit historischen Exkursen - im folgenden Kapitel, das sich mit den Wurzeln der Kunsttherapie auseinandersetzt, nachgegangen werden und die Synthese aus Kunst und Therapie sowie Pädagogik durchschaubarer und nachvollziehbarer machen.
2.1 Wurzeln der Kunsttherapie
„Wenn Worte fehlen, sprechen Bilder.“ Gertraud Schottenloher 1994
Hauptwurzeln der Kunsttherapie sind unstrittig Kunst und Therapie. Der Pädagogik kam - bedingt durch den Wandel innerhalb der Kunst und die dadurch bewirkte Veränderung des Zeichenunterrichtes - eine Vorreiterrolle zu durch das Bekanntmachen der guten, durch freies Zeichnen erzielte Wirkung auf die SchülerInnen.
Daß die heutige Kunsttherapie darüberhinaus ein Aufgreifen sehr alter Traditionen ist, geht aus folgendem Zitat hervor: „Daß Kunst zum Zwecke der Heilung und der Bewältigung eingesetzt wird, ist mindestens so alt wie die Höhlenzeichnungen“ (RUBIN 1993, S. 13). Auch sei den Medizinmännern seit jeher das „`Wunder’der Furchtbewältigung“ bekannt gewesen: „Indem man dem gefürchteten Objekt eine Form gibt, bringt man es unter seine symbolische Kontrolle“ (ebd., S.12). So weit muß man gar nicht zurückgehen, um Traditionen zu bemühen. Denn diese sind erst im 18. Jahrhundert unterbrochen worden. Peter Petersen stellt fest, daß „die klassischen Künste - und die Kunst überhaupt - eineinhalb Jahrhunderte lang durch die naturwissenschaftliche Medizin aus der Therapie verdrängt waren“ (PETERSEN 1994, S.159). Gesellschaftliche Bedingungen für das Wiederaufleben der Kunsttherapie läßt er nicht unerwähnt: Die klassische Medizin wissenschaftlicher Prägung ist an einem Endpunkt. Rein somatische Orientierung führte zu einer technischen Apparatemedizin, die immer weniger bezahlbar ist. Auf der anderen Seite reicht aus seiner Erfahrung das psychiatrische Handwerkszeug - Begrifflichkeit und Systematik - bei weitem nicht aus, um der Mannigfaltigkeit der erkrankten Menschen gerecht zu werden. Letzteres brachte auch ihn dazu, nach neuen Therapiemöglichkeiten zu suchen (vgl. ebd., S.163).
Trotz der sich hier andeutenden Vielgestaltigkeit kunsttherapeutischer Wurzeln sind in den beiden Hauptbereichen Kunst und Therapie sowie - eher stichpunktartig dargestellt - dem Ansatz der Pädagogik die Ursprünge der Kunsttherapie weitestgehend zusammenfaßbar.
2.1.1 Kunst
„Der Motor, der den Künstler zu seiner Arbeit treibt, muß ihm Befriedigung und Freude oder die Erfüllung eines anderen Anliegens in Aussicht stellen, sonst würde er dieser Tätigkeit nicht nachgehen.“ Karin Dannecker 1994
Die Verwendung des Begiffes „Kunst“, so bewerten es Hilarion Petzold und Johanna Sieper, sei zu problematisch in Verbindung mit „-therapie“ (vgl. PETZOLD/SIEPER 1991, S.176) und fragen: Ist das, was Kunsttherapie produziert, wirklich Kunst? Noch härter formuliert es Michael Jung: „Der Kunsttherapie geht es nicht darum, Kunst zu produzieren. Aus in unterschiedlicher Hinsicht hilfsbedürftigen Menschen sollen ja keine Künstler gemacht werden, was ohnehin ein Ding der Unmöglichkeit wäre“ (JUNG 1990, S.140).
2.1.1.1 Kunstverständnis im Wandel
„Das `Ewige’ an Kunst wäre höchstens, daß es ständig eine andere ist.“
Stefan Mitzlaff 1995
Beide o.g. Behauptungen provozieren gleichermaßen die Frage: Was ist Kunst? Bzw.: Welchem Kunstverständnis entspringen solche Äußerungen? Fragen, die hier wegen ihres Umfanges und des Meinungscharakters nicht ausdiskutiert werden können; was auch eine Unmöglichkeit wäre. Jedwede weitere „neue“ Kunstdefinition würde sich nur einfügen in die endlos lange Reihe der bisher aufgestellten (vgl. Mäckler <Hrsg.> 1987). Wenn es schon nicht um die „Kunst an sich“ geht, so sollen hier dem Thema der Arbeit entsprechend andere, relevantere Fragen stehen. Was löst die Kunst aus; was in den BetrachterInnen, was in den ProduzentInnen?
Exkurs:
Herr X. und ich sitzen wie jede Woche im Atelier und arbeiten. Währenddessen hält er gerne Vorträge, besonders liebt er das Historische: „Der klassischen Ästhetik früherer Jahrhunderte entsprach die Abbildung des Schönen; die schöne Abbildung des Schönen. Die Künstler - allesamt Handwerker, in Zünften organisiert - standen fest in Lohn und Brot. Sie waren Auftragsarbeiter: Porträts von Königen, Feldherren, Päpsten, Heiligen - das lernte sich. War das Hauptanliegen erfüllt - die Treffsicherheit und Schönheit - konnte der Künstler zufrieden den Pinsel auswaschen und nach Hause gehen. Und Betrachter? Es gab nicht viele; nicht viele Könige. Die Heiligen waren immer schon tot, wenn sie heiliggesprochen wurden. Viel mehr Päpste gab es auch nicht; doch wurden die Bilder von denen wenigstens so platziert, daß viele sie sehen konnten. In Kirchen zum Beispiel; wo es düster ist und die Leute beim Beten die Augen sowieso zumachen.
Wenn der König sein Bild sah, dann war er stolz darüber, sich so etwas leisten zu können und er sah sich an und war stolz darüber, so schön zu sein. Und wenn seine Untertanen es sahen, flößte es Respekt ein. Besonders die Augen, die jeden angucken, wo er auch stehen mag; ob links, rechts, oder direkt davor, nah dran oder weit weg, ob er groß oder klein ist - egal. Die Augen des gemalten Königs guckten einen immer direkt an.“ Herr X. hatte sich warmgeredet und starrte ein Loch in die Staffelei; seine Augen glänzten, als er fortfuhr: „Das war noch Kunst! Und das hatte schon seinen Zweck so.“ Wie aus einem Traum erwacht nun zu mir weiter: „Wenn heute einer das gleiche Bild sieht, in einem Museum zum Beispiel oder in einem Schloß oder wo auch immer - manche sammeln das ja auch und hängen es sich ins Zimmer - dann wird kein Frauenherz mehr höher schlagen wegen der majestätischen Schönheit und kein Auge wird ehrfürchtig niederschlagen ob der Allsichtigkeit und Allwissenheit des Königs.“ Herr X. schließt mit den Worten: „Es hat sich eben alles geändert: der Geschmack, was einer unter „schön“ versteht und die Zeit.“ Kaum, daß er geendet hat, frage ich, wie das denn sei, wenn heute ein König - oder wie auch immer die Ministerpräsidenten und Kanzler zur Zeit genannt werden - Bilder von sich in den Straßen dem Volk zugänglich macht? Warum er nicht das gleiche damit erreicht wie dazumal seine Vorgänger; obwohl der Effekt mit den Augen noch immer angewendet wird und die Kleidermode zumindest zum Teil dem Zeitgeschmack angepaßt sei. Und ob das, was - wie Herr X. sagte - einmal Kunst war, heute immer noch Kunst ist? Und ob das, was heute an solchen Bildern in den Straßen rumhängt, seiner Meinung nach auch Kunst sei?
Jetzt hatte ich mich heißgeredet. Herr X. war sprachlos, blaß und setzte sich. An seinem Bild mochte er heute nicht mehr weitermalen.
Zurück zur Fragestellung, was Kunst auslöst: Bildnerisch Gestaltetes rührt an seelischen Stimmungen, weckt Assoziationen durch verwendete Formen, Themen, Inhalt, Symbole. Besonders archetypische Darstellungen regen Erinnerungen an, stimulieren vorbewußte Gedanken und bilden mitunter Brücken zum Unbewußten. Werke moderner KünstlerInnen regen durch ihre Vieldeutigkeit zur Kommunikation zwischen Werk und BetrachterIn und damit zur persönlichen Auseinandersetzung und Sinnfindung an. In der gesellschaftlichen Situation ins Vergessen geratene historische, gesellschaftliche, politische, persönliche und Gefühlsaspekte werden durch das künstlerische Aufgreifen in die Gesellschaft zurückgegeben und diese damit konfrontiert. Daß die Darstellung mitunter in einer Art und Weise geschieht, die die BetrachterInnen eher zum Ignorieren der Kunst als zum Auseinandersetzen damit animiert, sei hier nur am Rande erwähnt, hat aber seinen Ursprung im Pluralismus und trägt damit - bewußt oder unbewußt - auch zur Entwicklung, zur Veränderung bei. Abstrakteste Gebilde und Installationen - in der Öffentlichkeit ausgestellt - gelten nach einer „Gewöhnungszeit“ voller Aufregung und Kritik als normal im Sinne von üblich. Feste Normen, Grenzen, Stigmatisierungen werden ad absurdum geführt. Und - es findet Bewegung statt.
Da KünstlerInnen Entwicklungen vorwegnehmen bzw. voraussehen oder auch nur Gegenwärtiges kritisch darstellen, sind sie der Zeit voraus und damit im Abseits - aus der Sicht der Bevölkerungsmehrheit. Der KünstlerInnenstatus hat etwas Anrüchiges. Dies verbindet KünstlerInnen mit ProphetInnen, SchamanInnen und - mit psychisch Kran-ken. Das Folgen der inneren Stimme ist geradezu sprichwörtlich geworden.
Dies ist bereits ein Aspekt der Antwort, was Kunst bei den ProduzentInnen auslöst: Die Gewißheit, dem Drang zum bildnerischen Ausdruck der inneren Stimme gefolgt zu sein; vernachlässigte Aspekte in den Mittelpunkt gestellt zu haben; Anstöße gegeben zu haben: zur Bewegung, zum Ausgleich; Werte und Normen hinterfragt zu haben.
Soviel zu dem knappen Versuch, Verallgemeinerungsfähiges zu beschreiben neben dem hier vernachlässigten Individuellen. Fazit: Kunst steht in direkter Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Wenn diese sich ändert, ändert sich jene. Und umgekehrt - wenn auch mit jeweils zeitlicher Verschiebung.
2.1.1.2 Joseph Beuys
„Kunst IST ja Therapie!“ Joseph Beuys 1972
Exemplarisch soll auf einen Künstler eingegangen werden, der in starkem Maße die Kunst, den Kunstbegriff, anthropologisch-philosophische Diskussionen und gesellschaftliche Prozesse prägte: Joseph Beuys (1921-1986). Anhand der Beuys-Zitate soll an die vorangegangenen Thesen angeknüpft und diese konkret belegt weden.
Ausgehend von seinem anthropologisch erweiterten Kunstbegriff („Jeder Mensch ist ein Künstler.“) nennt Beuys als Voraussetzung zur Veränderung der Gesellschaft die Entwicklung des Menschen zum freien Individuum. „Aus dieser Position heraus kann er etwas erarbeiten für den Teil, wo er mit anderen Menschen in Abhängigkeit und Gebundenheit sich befindet“ (STACHELHAUS 1989, S.189; Original: KATALOG 1977). Angesichts der Nischenexistenz der modernen Kunst drängt es ihn, „aus dieser Nische heraus Durchbrüche anzulegen“, und fand dadurch zu seinem Kunstbegriff, der „sich auf den Menschen bezieht, auf alle Menschen selbstverständlich“ (ebd., S.197; Original: KURNITZKY <Hrsg.> 1980). Soviel zur Ausgangsgrundlage Beuys’. Ziel war es, „etwas für die Gegenwart und für die Zukunft (zu) tun, etwas Allgemeingültiges.“ Seine Werke sollen sein „ein Anklopfen an Wände, ein Anklopfen an das Gefangensein in unserem zivilisatorischen Kulturbewußtsein.“ Ihm ging es darum, „den Menschen als geistiges Wesen zu begreifen“ (ebd., S. 198; Original: MAGAZIN KUNST 1973) und folgt damit einer inneren Stimme: „Das ist meine Wahrnehmung: auf einmal erscheint irgendwo ein Geist, ich sage bewußt Geist, weil es mit Intuition zu tun hat, mit der inneren Stimme, mit der Inspiration. ... Das Gespräch ist möglich“ (ebd., S. 211; Original: KURNITZKY <Hrsg.> 1980). Das brachte ihm den Ruf ein, Schamane zu sein, was er akzeptierte mit dem Hinweis: „... durch den Schamanismus weise ich auf den Todescharakter unserer Gesellschaft hin. Ich weise aber zugleich darauf hin, daß der Todescharakter der Gegenwart in der Zukunft überwindbar ist. Also da ist die Zukunft für mich die Dimension des Ausgangspunktes“ (ebd., S. 212; Original: KATALOG 1979). Dies bleibt für die BetrachterInnen nicht ohne Wirkung: „... ich habe die Erfahrung gemacht, daß jeder einzelne auf jeweils andere Art berührt wird. ... Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktion durchaus therapeutischen Charakter“ (ebd., S. 223; Original: ZWEITE 1986). Einzige Einschränkung: Unverständnis. „Hilflos stehen die Leute davor (vor Beuys Produkten - d.V.), weil sie nicht die Geduld haben, sich die Sachen richtig anzusehen. Die Leute bleiben immer am Bild kleben: an der Margarine oder der Blutwurst. Das geht auch anderen Künstlern so. Nicht alle auch sind ratlos. Die Zahl der Menschen, die verstehen, wächst von Tag zu Tag. Van Gogh und Einstein hat man auch nicht sofort verstanden“ (ebd., S.227; Original: KATALOG 1970). In welchen Zusammenhängen Beuys dachte, in welchen Disziplinen er es ebenfalls zur Meisterschaft brachte, sei im folgenden letzten Zitat benannt: „Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, daß es keine einzige Möglichkeit gibt, etwas für den Menschen zu tun, als aus der Kunst heraus. Und dazu brauche ich eine pädagogische Konzeption, und ich brauche eine erkenntnistheoretische Konzeption, und ich muß handeln, also es sind gleich drei Dinge, die unter ein Dach gehören“ (ebd., S. 240; Original: ADRIANI u.a. 1973; vgl. zu diesem Kapitel auch BEUYS 1991, S.33 ff).
Beuys’ Schüler Peter W. Rech gründete die Kölner Schule für Kunsttherapie.
2.1.1.3 Kunst ist verrückt
„Der künstlerische Schöpfungsakt, der mit so extremer Anspannung einhergeht, und das hohe Fieber, das ihn begleitet, können sie überhaupt normal sein?“ Jean Dubuffet 1948
Seit dem Bruch mit dem traditionellen Kunstbegriff wurde - avanciert durch den Kunstmarkt - immer mehr das Neue, das „Noch-nicht-Dagewesene“ zum Renner des Absatzes und damit der Produktion. Schlagzeilen mußten und müssen KünstlerInnen machen, um bekannt zu werden. Dies fördert die radikale Suche nach nichtalltäglichen Ausdrucksformen.
Exkurs:
„Eigentlich -“, so begann Herr X. langgezogen auf dem gemeinsamen Nachhauseweg, „- eigentlich ist das dann schon alles Kunst, was an Bildern in der Weltgeschichte rumhängt. Eben verrückte Kunst.“ So könne er alle verstehen, die sich nicht von Picasso oder Andy Warhol haben konterfeien lassen. „Die Banane“ - und er lacht für sein Alter ungewohnt kindlich - „hat sich ja nicht dagegen wehren können!“ Ob Herr X. auch glaube, Marilyn Monroe habe sich ebenfalls nicht ...? Die Frage liegt mir auf der Zunge. Doch ist mir die Lust auf weitere Kunstdebatten vergangen. Außerdem wollte ich mir keine Blöße geben. Es hätte ja sein können, daß die Monroe schon tot war und sich wirklich nicht wehren konnte. Herr X. hat oft so verquere Ansichten. Trotzdem fühle ich mich irgendwie zu ihm hingezogen. Woran liegt das nur? Auf dem restlichen Weg schweigen wir und ich kann darüber nachdenken.
Somit entstanden viele erst einmal befremdlich erscheinende Werke, die als verrückt - oder gar entartet - bezeichnet wurden. Ist Kunst verrückt? Auf diese Frage ging der Künstler und Soziologe Stefan Mitzlaff in einem gleichnamigen Vortrag ein. „Der Begriff des Verrückten ist vorzüglich, weil er mit dem Ver-Rücken beide Standorte einführt: den des Werkes und den des Betrachters. Erst beide Standorte und das Verhältnis zueinander ergeben eine Antwort auf die Frage, ob etwas Kunst sei (und ob es anstrengt). Sind die Orte, die Sichtweisen, nicht deckungsgleich, dann kann es sich um Kunst handeln“ (MITZLAFF 1995, S.5). Weiter: „Ich finde also, daß Kunst verrückt ist, daß Verrücktheit zusammen mit Normalität - soweit sie frei lebbar sind - und die freie Auseinandersetzung damit lebensnotwendig sind, - daß Kunst und zumal die Bildende aber nur einen Teilaspekt des allgemeinen kulturellen Problems darstellt“ (ebd., S.10). Denn: „Daß Kunst verrückt ist, heißt nicht, daß alles, was Verrückte machen, Kunst ist, - auch, wenn sie sich Mühe geben“ (ebd., S.8).
Auch Elisabeth Tomalin und Peter Schauwecker beschreiben diese Verbindung als eine übliche: „Die Nähe von Kunst und Wahnsinn ist oft schon warnend oder romantisch verklärend beschrieben worden. Sie fasziniert die Menschen, seitdem Kunst von der Renaissance an zu einer Angelegenheit des tragischen Subjekts geworden ist, das in seiner Kunst nur mehr sich selbst und seiner inneren Welt verpflichtet ist. Die Verbindung Kunst und Wahnsinn ist keinem, der sich auch nur oberflächlich mit Kunst befaßt hat, irgend etwas Neues“ (TOMALIN/ SCHAUWECKER 1993, S.24).
Wenn auch nicht für Deckungsgleichheit, so sprechen die folgenden Beispiele von verrückten - in psychiatrischer Behandlung gewesenen - KünstlerInnen doch für fließende Grenzen zwischen Kunst und Verrücktheit: Edvard Munch (1863-1944) geriet 1908 in schwere Depression und wurde acht Monate lang in einer Nervenklinik behandelt. Danach nahm seine Schaffenskraft stark ab (vgl. SELZ 1993, S.65 ff). Bei Joseph Beuys (1921-1986) begann das öffentliche Wirken nach über zweijähriger Depression (1954-57) (vgl. STACHELHAUS, S.54 ff). Überliefert sind schizophrene Psychosen der Maler Carl Fredrik Hill und Ernst Josephson. Hill (1850-1911) verbrachte vier Jahre in der Klinik und die letzten 28 Jahre seines Lebens in privater Pflege. Josephson (1850-1903) wurde 1888 eingeliefert und befand sich bis zu seinem Tod in privater Pflege. Auch Vincent van Gogh (1853-1890) kam in eine Anstalt. Ebenso Adolf Wölfli (1865-1930), Maler, Dichter und Komponist, schizophren. Er schuf sein gesamtes Werk im Irrenhaus (vgl. ROTH 1994, S.V). Camille Claudel (1864-1943) war ihre letzten 30 Lebensjahre in einer Anstalt interniert, nachdem sie vorher bereits sieben Jahre psychotisch war und viele ihrer Arbeiten zerstört hatte. In der Anstalt gab man der Bildhauerin keine Möglichkeit, ihr Talent weiter auszuleben (vgl. DELBE`E 1985).
Hans Prinzhorns Bildsammlung schizophrener PatientInnen (PRINZHORN 1994) beeinflußte seit Erscheinen ganze KünstlerInnengenerationen, wurde zur „Bibel“ (Werner Spies) der Pariser Surrealisten. Jean Dubuffet wurde davon inspiriert, ART BRUT - eine Kunst, die sich nicht aus der Kultur entwickelt - als Kunstrichtung zu etablieren und Ausstellungen auch mit Werken psychisch Kranker einzurichten. Motto: „Wir sind der Ansicht, daß die Wirkung der Kunst auf uns in allen Fällen die gleiche ist, und daß es ebensowenig eine Kunst der Geisteskranken gibt, wie eine Kunst der Magenkranken oder der Kniekranken“ (ROTH 1994, S.VI) - und wischte damit jeden Einwand weg, es könne ein Unterschied oder zumindest eine Grenze zwischen Kunst und Verrücktheit geben. Prinzhorn hingegen benutzt bewußt den Begriff Bildnerei (vgl. PRINZHORN 1994, S.3) und betont, „daß bis heute das Grenzgebiet zwischen Schizophrenie und Kunst noch unter der Nachwirkung des Schlagwortes `Genie und Irrsinn’ steht“ (ebd., S.8). Die Abgrenzung schizophrener Bildwerke von der bildenden Kunst sei „nur auf Grund einer überlebten Dogmatik möglich. ... Sonst sind die Übergänge fließend“ (ebd., S.350). Leo Navratil vermeidet jedwedes pauschale Urteil und wertet konkret am Einzelfall (vgl. NAVRATIL 1965, S.9 f).
2.1.2 Psychoanalyse
„Jeder Patient, der zu einem Therapeuten kommt, bringt seine inneren Bilder mit, Bilder, aus denen er lebt, die ihn quälen oder einengen, denen er vergeblich nachjagt, mit denen er sich nicht im Einklang befindet, sonst käme er nicht.“ Elisabeth Wellendorf 1991
Obwohl sich KunsttherapeutInnen immer wieder auf die Psychoanalyse berufen, gibt es nur wenige konkrete theoretische Bezüge. Wesensverwandtschaft besteht wohl am ehesten im Hinblick auf das Menschenbild, speziell die abstrakte Kategorie des Unbewußten.
Exkurs:
Als wieder einmal das schweigende Malen zu langweilig wurde, fing ich an, von Kunsttherapie zu quatschen. Wie konnte ich ahnen, daß Herr X. auch auf diesem Gebiet firm ist?! Er haute mächtig auf den Putz, als er meinte, die Kunsttherapie benutze den vermeintlichen Bezug zur Psychoanalyse und dem Unbewußten nur, um ihr Nichtwissen zu legitimieren. „Die wollen doch nur im Trüben fischen!“ - so sein Kommentar. Ich versprach ihm, das nächste Mal bissel was zu Lesen darüber mitzubringen. „Dann werden sich ihre Zweifel schon aufklären“ - hoffte ich. „Ach“, winkte er ab, die zwei Stunden waren schon wieder um, „ich habe andere Sorgen. Im übrigen: ich kann mit meinen Zweifeln leben. Kann’s die Kunsttherapie auch?“ Ich verstand nicht recht: „Mit kunsttherapeutischen Zweifeln leben?“ „Nein. Mit meinen!“
Komischer Kautz! Wenn er doch nur zu begreifen wäre. Herr X. verabschiedete sich, da er noch etwas Dringendes zu erledigen hatte und in die andere Rich-tung mußte. Schade. Gerade heute wollte ich doch die Frage mit der Monroe stellen. Beim nachgucken hatte ich nämlich gemerkt, daß beides 1962 war: Marilyns Selbstmord und Warhols schreiend buntes Bild von ihr.
Psychoanalytische Techniken werden kunsttherapeutisch modifiziert. Beispielsweise das freie Assoziieren über Traumbilder und Bilder im allgemeinen. Während Träume schnell in Vergessenheit geraten, stellen gemalte Bilder eine bleibende Erinnerung dar. Auch kann damit das rein verbale Assoziieren über Träume ergänzt oder gar ersetzt werden (vgl. SCHUSTER 1993, S.36 f). Ebenso Gregg Furth stellt, sich auf Susan Bachs Forschung beziehend, fest, „daß unbewußte Inhalte in Bildern (nicht nur - d.V.) psychologisch entziffert werden können, sondern daß das Unbewußte durch die Bilder nachweislich zum Ausdruck bringen kann, was im Körper vor sich geht“ (FURTH 1992, S.27). Damit kann der bildnerische Ausdruck als dem verbalen mindestens gleichgestellt gelten.
Karin Eisler-Stehrenberger führt kunsttherapeutische Überlegungen auf Grundlage des Freud’schen Sublimationskonzeptes als einer Form der Verschiebung libidinöser Energie auf höhere geistige Operationen. So wird der kreativ-künstlerische Prozeß des Gestaltens, gründend im Konflikt, zur geglückten Triebabwehr bzw. -umleitung (vgl. EISLER-STEHRENBERGER 1991, S.123). Sie betrachtet diesen Mechanismus primär hinsichtlich des entstehenden künstlerischen Bildwerkes und damit einhergehenden Lustgewinns. Neben der hier kurz dargestellte Sublimierung werden von KunsttherapeutInnen die Progressions- und Regressionsprozesse sowie Symbolbedeutung ausführlich diskutiert. Letztere geht in den Interpretationen der Quellenväter Sigmund Freud (1856-1939) und Carl Gustav Jung (1875-1961) auseinander. Aus diesem Grunde werden die Thesen im Folgenden separat dargestellt. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang der Versuch Jaques Lacans (1901-1981), beide Schulen harmonisierend zu einer Theorie zusammenzubringen. Karl-Heinz Menzen, einer der fundiertesten deutschen Kunsttherapiehistoriker und -theoretiker, würdigt dessen Verdienste auf diesem Gebiet (vgl. MENZEN 1994, S.45; MENZEN 1994 <b>, S.62). Außerdem werden in den folgenden zwei Rubriken weitere Theorien und Ansätze aufgeführt, die sowohl für die Theoriebildung als auch Praxis der Kunsttherapie Relevanz besitzen. Daß es auch funktionale Abgrenzungen zur Psychoanalyse gibt, betont Karin Dannecker. Über-tragung - Gegenübertragung beispielsweise würden durch das Hinzutreten von Kunst nicht in der gehabten Weise wirksam (vgl. DANNECKER 1994, S.19). Krasser noch bringt es Gisela Schmeer zum Ausdruck: „Wie kann es bei diesem hohen Stellenwert des Wortes in der Psychoanalyse überhaupt eine `psychoanalytische Kunsttherapie’ geben?“ (SCHMEER 1993, S.113).
2.1.2.1 Die Symboltheorie von Sigmund Freud
„Eine solche konstante Beziehung zwischen einem Traumelement und seiner Übersetzung heißen wir eine symbolische, das Traumelement selbst ein Symbol des unbewußten Traumgedankens.“ Sigmund Freud 1900
Sigmund Freud fand durch seine Studien der Traumforschung zum Symbol als fixem Bildelement der Träume. Dabei bezog er sich auf Arbeiten des Philosophen K. A. Scherner (1861). In der Symbolik sieht Freud eine feststehende Übersetzung, unabhängig von der individuellen Person und Situation, die aber in deren Leben eine konkrete Rolle spielt. Symbolische Darstellung im Traum finden nur wenige Dinge. So die menschliche Person als Haus, die Eltern als Respektspersonen, Kinder und Geschwister als kleine Tiere und Ungeziefer, die Geburt durch das aus dem Wasser Holen einer Person, das Sterben durch Abreisen/Wegfahren, Nacktheit durch Kleider und Uniformen. Daneben beschreibt Freud einen großen Katalog von Symbolen, welche Sexualleben, Genitalien und Geschlechtsverkehr bedeuten. Alle phallusartigen Dinge symbolisieren demnach die männliche, alle einen Hohlraum umschließenden die weiblichen Genitalien. Das Deuten von Symbolen soll das freie Assoziieren keinesfalls ersetzen, sondern ist als dessen Ergänzung gedacht. Freud geht davon aus, daß sich das Unbewußte der TräumerInnen der Symbolik bedient, weil „... dem Träumer die symbolische Ausdrucksweis zu Gebote steht, die er im Wachen nicht kennt und nicht wiedererkennt“ (FREUD 1989, S. 174). Karin Dannecker findet noch eine frühere Einführung des Symbols bei Freud und zitiert: „Das `Symptom ist das Erinnerungssymbol gewisser wirksamer (traumatischer) Eindrücke und Erlebnisse’ “ (DANNECKER 1994, S.25, Original: FREUD 1906-09, S.196). Damit ist die Krankheitsäußerung eine symbolische, die auf die „... Kompromißleistung zwischen den libidinösen Phantasien und der Verdrängungsregung“ hinweist. „Wenn in der analytischen Deutung diese Beziehung aufgedeckt wird, wird die Symbolisierung überflüssig“ (ebd.).
Bei Freuds späterer Traumdeutung bekommt das Symbol etwas Objektiveres, Übergeordneteres, von Individuum und Kultur Unabhängiges. „Wir haben ja erfahren,“ - begründet Freud seine Theorie - „derselben Symbolik bedienen sich Mythen und Märchen, das Volk in seinen Sprüchen und Liedern, der gemeine Sprachgebrauch und die dichterische Phantasie“ (FREUD 1989, S.174). Auch seine analytische Arbeit mit Fremdsprachigen bestätigt ihn in der Gewißheit, daß diese Sinnbeziehungen keineswegs nur auf die deutsche Sprache gemünzt sind, was ja der These vom universalen Anspruch widerspräche. Daß die sexuelle Symbolik das Übergewicht hat, liegt nach Rank und Sachs u.a. an der „individuellen Tatsache, daß kein Trieb in dem Maße der kulturellen Unterdrückung unterworfen und der direkten Befriedigung entzogen ist, wie der aus den verschiedensten `perversen’ Komponenten zusammengesetzte Sexualtrieb, dessen psychischer Vorstellungskreis, das Erotische, daher in weitem Umfang der indirekten Darstellung fähig und bedürftig ist“ (DANNECKER 1994, S.27; Original: RANK/SACHS 1913, S.12). Kunsttherapeutische Relevanz bekommt Freuds Symboltheorie durch den Hinweis auf die Dichter als Vorläufer der wissenschaftlichen Psychologie (vgl. ebd., S.30). Vormals seien es nur die Poeten gewesen, welche Träume frei nachbildeten. „So kann der Dichter dem Psychiater, der Psychiater dem Dichter nicht ausweichen.“ (FREUD 1907, S.70). Freud weiter - und damit läßt er die Einschränkung der Kunst auf die nur dichterische fallen: „Es gibt ... einen Rückweg von der Phantasie zur Realität, und das ist die Kunst“ (FREUD 1917, S.390). Von daher scheint es inkonsequent, daß Freud die Kunst für seine analytische Arbeit nicht nutzte. Ist doch von ihm festgestellt worden, daß TräumerInnen ihre Träume oft eher zeichnen als beschreiben könnten (vgl. ebd., S. 86). Mit Freuds Interesse für und Unsicherheit gegenüber den KünstlerInnen sowie eventuellem Konkurrenzdenken beschäftigt sich ausführlich Dannecker (vgl. DANNECKER 1994, S.29 ff).
Erst Anna Freud führte Malen und gestalterische Medien in die Analyse ein - bei Kindern, da diese zur freien Assoziation noch nicht bereit seien (vgl. ebd., S.41). Die beiden ersten amerikanischen prakizierenden Kunsttherapeutinnen Margaret Naumburg und Edith Kramer waren freudianisch orientiert. „Für Margaret Naumburg war die Kunst eine Form der `symbolische Rede’, die wie die Träume dem Unbewußten entstammte“ (RUBIN 1993, S.14). „Kramer dagegen sah in der Kunst den `Königsweg’ zur Sublimierung, eine Möglichkeit, ... dem Ich mittels des kreativen Prozesses zu Kontrolle, Meisterung und Synthese zu verhelfen“ (ebd.).
Exkurs:
„Gut gelungen!“, meinte Herr X., mein Bild betrachtend. Er muß schon eine ganze Weile hinter mir gestanden haben. „Wer ist denn das?“ Gedankenverloren hatte ich irgend eine weibliche Person im Sitzen darstellen wollen. Hat sich da nicht das Gesicht meiner früheren Freundin hineingeschlichen, deren Bedeutung für mich ich längst vergessen zu haben wähnte?
Zurück zum Symbolverständnis. Nach Menzen ist dieses in Übereinstimmung mit dem Jung’schen dahingehend, „daß sich im Vorgang des Symbolisierens seelisch-konflikthafte Sachverhalte ästhetisch-bildnerisch dokumentieren können (MENZEN 1994, S.45). Gemeinsam auch die Vorstellung, daß sich ein konflikthafter Vorgang hinter der Symbolisierung verbirgt. Doch geht nur Freud davon aus, daß es sich dabei um konkrete kausale Bezüge zu individuellen Schicksalen handelt.
2.1.2.2 Die Symboltheorie von Carl Gustav Jung
„Ein Symbol heißen wir einen Begriff, ein Bild oder einen Namen, die uns als solche bekannt sein können, deren Begriffsinhalte oder Gebrauch und Anwendung jedoch spezifisch oder merkwürdig sind und auf einen verborgenen, unklaren oder unbekannten Sinn hindeuten.“ Carl Gustav Jung 1961
Carl Gustav Jung wirft Sigmund Freud eine zu stark reduzierte Symboldeutung auf die kindliche Triebgeschichte vor und macht damit seine eigene Meinung deutlich. Nach Jung entwirft das Unbewußte vielmehr im Symbol eine Entwicklungstendenz (vgl. RIEDEL 1992, S.14 f). Diese Meinungsverschiedenheit wird verständlicher durch die Beleuchtung von Jungs allgemeinem Symbolverständnis. Im Unterschied zu Freud sah er archaische Bilder als Symbole an, in allen kulturellen oder metaphysischen Zusammenhängen bekannte Darstellungen. Beispielsweise die Mandalazeichen sind meditatives Symbol der Einheit und bekommen bei ihm heilende und allgemein wirkende Kraft zugeschrieben (vgl. FURTH 1992, S.27). Archetypische Bilder und Symbole entspringen - auch das unterscheidet seine Meinung von der Freuds - dem kollektiven Unbewußten: eine Seinszustände beschreibende Kategorie, welche der Sexualität keinen großen Raum läßt, um so mehr aber dem Metaphysischen, der Spiritualität. Jungs therapeutisches Ziel ist die Individuation, die Integration abgespaltener, überpersonal-transzendenter Teile der Persönlichkeit (vgl. Jung 1994, S.171 ff). Er geht davon aus, im Gestalterischen, besonders im bildnerischen Gestalten von Symbolen, den Weg zur Individuation gefunden zu haben. Mit dem Gestalterischen verbindet er die aktive Imagination - ein bewußtes Weitersinnieren des unbewußten (Traum-) Bildes. Anlaß für diese Entdeckung war eine lange Sinnkrise (1912-1918) nach der Trennung von Freud; über das kollektive Unbewußte haben sich beide nicht einigen können. In diesem Zusammenhang machte er die heilsame Erfahrung mit symbolischem Gestalten, auch in Form von Traumdarstellungen (vgl. RIEDEL 1992, S.17). Jung: „Wann immer ich in meinem späteren Leben steckenblieb, malte ich ein Bild oder bearbeitete ich Steine, und immer war dies ein Rite d`Entree, ein Eingangsritus für nachfolgende Gedanken und Arbeiten“ (ebd., Original: JUNG 1971). Wichtig für die Individuation war ihm dabei der innere Dialog mit den Bildern und der äußere darüber. So praktizierte Jung bereits in den 20er Jahren etwas, was man Kunsttherapie nennen kann. Damit schuf er ein methodisches Potential, auf das heute noch wesentlich zurückgegriffen wird (vgl. RIEDEL 1992; FURTH 1992; SCHUSTER 1993; CZERNY 1989 u.a.). Nur Holgrid Gabriel sieht eine Schwierigkeit darin, lediglich Teile einer Therapie so zu betrachten und anzuwenden, als stellten diese Teile ein Ganzes dar (vgl. GABRIEL 1991, S.329 f). Denn die Technik des Malens war für Jung nie Selbstzweck gewesen, sondern lediglich Mittel zum Ausdruck ihn leidend machender Gedanken, Bilder, Symbole, Träume. „Und das Unbewußte, so C.G. Jung, entwerfe im Symbol eine Vorstellung dessen, was eigentlich gemeint und sinnvoll sei und was nach Bewußtwerdung, nach Gestaltung dränge“ (MENZEN 1994, S.45). Hauptkritikpunkte Karin Danneckers an dem Jung’schen psychoanalytischen Ansatz - den sie nur skizziert, „da eine ganze Anzahl von Kunsttherapeuten nach Jung arbeiten“ (DANNECKER 1994, S.46) - sind die „recht eingeschränkte Sichtweise“ auf PatientInnen und KünstlerInnen sowie die offensichtliche Vernachlässigung des spezifisch Individuellen (vgl. ebd., S.50). Auch käme aus ihrer Sicht die Rolle der Kunst bei der Gestaltung zu kurz (vgl. ebd., S.54 ff).
Exkurs:
Draußen scheint die Sonne und Herr X. zeichnet einen verschneiten Acker. „Wie kommen sie bloß bei diesem Wetter auf das Motiv?“ „Was weiß ich!“, begegnet er ungewohnt wirsch und beginnt zu weinen. Er habe mir nichts davon erzählen wollen, schluchzt er, doch jetzt müsse er es mir sagen: „Meine Mutter ist gestorben. Das bewegt mich so, daß mir erst gar kein Motiv in den Sinn gekommen ist. Da war ich froh, überhaupt eins zu haben.“ Er nimmt das angefangene Bild entgegen seiner sonstigen Art mit nach Hause, um es dort fertig zu malen. Als ich ihn zwei Tage später anrufe, erzählt Herr X. ziemlich erleichtert, daß auf seinem erst kahlen Feld jetzt ein Baum mit Knospen stehe. „Der ahnt schon den Frühling.“, meint er. Und natürlich freue er sich, daß ich anrufe.
Doch fällt es schwer, konkrete Belege für Danneckers Kritik in Jungs Theorie zu finden. In der Praxis mögen diese Vorwürfe der Realität entsprechen. Doch sprach Jung lediglich davon, daß die Deutung individueller künstlerischer Werke nicht leicht sei (vgl. JUNG 1994, S.12), schloß eine solche aber nie aus. Auch weist Jung auf das Individuelle konkreter Formen selbst bei archetypischen Traum- und Symbolbildern hin (vgl. ebd., S.58) bzw. darauf, daß sich archetypische Traum- und Symbolbilder auf konkrete Menschen und ihre individuelle Situation beziehen (vgl. ebd., S.60 ff, 76, 80).
2.1.3 Pädagogik
„Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst.“ Johann Wolfgang von Goethe (o.J.)
Die Erkenntnis, daß künstlerisches Gestalten bereits in der kindlichen Entwicklung der Menschen eine bedeutende Rolle spielt, geht bis auf den Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) und dessen Schüler Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852) zurück (vgl. MENZEN 1994, S.40). Von Kunstkräften des Kindes und kunstgemäßer Erregung im Prozeß der Erziehung war die Rede. Auch Johann Friedrich Herbart forderte 1804, die ästhetische Darstellung der Welt solle zum „Hauptgeschäft“ der Erziehung werden (vgl. ebd.). Ebenso Wilhelm Freiherr von Humboldt (1767-1835) maß dem ästhetischen Sinn und dessen weiterer Ausbildung große Bedeutung zu. Einfluß auf das Gewahrwerden des hohen Stellenwertes der Kunst in der Erziehung hatten auch Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) kunst-theoretische und Friedrich von Schillers (1759-1805) ästhetische Schriften („Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen“).
Kunstpädagogik, aufbauend auf humanistischem Gedankengut der deutschen Klassik, konnte erstmals zwischen 1835 und 1865 im schulischen Rahmen als „fakultativer Gegenstand Zeichnen“ in Bayern und Preußen Fuß fassen. Zu Beginn diesen Jahrhunderts forderten Reformer der Kunsterziehungsbewegung das freie Zeichnen und damit die Abschaffung der festen, repressiven Vorgaben und Methoden wie stupides Nachmalen von vorgezeichneten Formen. Hervorzuheben sind hierbei Alfred Lichtwark (1852-1914), Leiter der Hamburger Kunsthalle, und Georg Kerschensteiner (1854-1932) aus Bayern. Die von ihnen organisierten Kunsterziehungstage trugen wesentlich zur Auseinandersetzung mit dem Thema Kunstpädagogik in der Öffentlichkeit und damit in Folge zu einer Reihe ähnlichlautender Veröffentlichungen bei, unter anderem auch von Rudolf Steiner (1861-1925) (vgl. MENZEN 1995, S.103).
In Österreich wurde 1920 aufgrund der langjährigen Überzeugungsarbeit von Franz Cizek (1856-1946) das Freihandzeichnen eingeführt. Von da ab konnten - und sollten - die Kinder das malen und gestalten, was sie erlebten; so, wie sie es erlebten. Die positive Wirkung des Kreativen in der Erziehung ist, so Judith Aron Rubin, besonders bei Kindern mit Frustrationen und Schwierigkeiten ihrer Selbstdefinition zu beobachten (vgl. RUBIN 1993, S.14).
Das die Identitätsbildung fördernde freie Malen sowie die Auswertung der damit gemachten Erfahrungen bildet - neben den oben beschriebenen Bereichen Kunst und Therapie - die dritte Wurzel der Kunsttherapie. Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die von Wolfgang Domma hierzu vertretene These der therapeutischen Wirksamkeit des Ab- und Nachbildens von einfachen Linien und geometrischen Grundformen. „Ihre Wirksamkeit beruht einerseits auf der geforderten Konzentration, auf der bewußten Ablenkung vom inneren `Chaos’ und der gezielten Hinwendung zum `Erkennen’ und `Abbilden’ der äußeren Realität“ (DOMMA 1990, S.118). Diese Behauptung, aufgestellt im Zusammenhang von Kunsttherapie mit Schizophrenen, greift bereits Kapitel 4.1 (Spezifische Ansätze und Techniken) vor, macht sich aber hier notwendig zur Veranschaulichung der Bandbreite auch gegensätzlicher pädagogischer Theorien.
Begünstigt wurde das Entstehen pädagogischer Kunsttheorien durch die sich erst in Form- und Farbgebung, dann in ihrem gesamten Erscheinungsbild ändernde Kunst. Bereits von Pädagogen erarbeitete kunstpsychologische Theorien ließen sich durch die psychoanalytische Forschung noch präzisieren. Der Fülle kann hier nicht weiter nachgegangen werden. Hingewiesen sei auf die gegenwärtige Wiederentdeckung der Kreativität als Mittel, das „zu Selbst-Erfahrung, Selbst-Bewußtsein und Selbst-Aufklärung führt“ (PÄDAGOGIK 4/95, S.5).
Abschließend sei noch erwähnt, daß in den 40er Jahren die ersten amerikanischen KunsttherapeutInnen PädagogInnen waren, die mit Kindern arbeiteten: Edith Kramer in einer Sonderschule und Margaret Naumburg in einem Krankenhaus. In den 50ern entwickelte Viktor Lowenfeld die kunstpädagogische Therapie für behinderte Kinder - zeitgleich mit der Einführung der Kunsttherapie in amerikanischen Allgemeinkrankenhäusern und in psychiatrischen Behandlungszentren (vgl. RUBIN 1993, S.14).
2.2 Streit um den Begriff Kunsttherapie
„Viele Köche verderben den Brei.“ Sprichwort
Kunsttherapie - vor einem Jahrzehnt im deutschen Sprachraum noch ein Fremdwort - scheint heute „in aller Munde“ zu sein. Dies brachte eine Sprachverwirrung mit sich. Zu vielversprechend waren die Chancen und Einsatzgebiete; zu stark der Reiz des Neuen, den Kunsttherapie auf eine bunte Berufsgruppenpalette ausübte und -übt. Die Arbeitsmarktsituation ist als Erklärung für das rasant konkurrierende Erschließen neuer Arbeitsfelder nicht zu unterschätzen. So ist es nicht verwunderlich, daß jede Profession nach der Hauptdefinitionsmacht strebt, sich berufspolitisch für das neue Feld stark macht in der Hoffnung, den Hauptzuschlag - oder, um im Bild der Köche zu bleiben, die größte Portion - zu bekommen bei der Etablierung und Finanzierung des Neuen in der Praxis.
Dies liegt wie ein Schleier über der von helfenden Berufen seit Jahren vertretenen These der Notwendigkeit multiprofessioneller Zusammenarbeit, um der Komplexität menschlicher Problemlagen gerecht zu werden. Verschiedenste Kategorien zur Unterteilung und Spezifizierung des Begriffes wurden geschaffen, um der Kunsttherapie zur Klarheit und den Berufsgruppen zur nötigen Solidarisierung zu verhelfen. Realisierbar scheint dies erst, wenn KünstlerInnen, PädagogInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen, BeschäftigungstherapeutInnen etc. trotz differierender Ansprüche und Ziele gemeinsame Anliegen (an) der Kunsttherapie formulieren und so deren einheitlichen, integrativen Status postulieren - und sei dies nur, um die Anerkennung durch die Krankenkassen zu erreichen.
Das einzig Verbindende sieht Karin Dannecker derzeit im „Glauben an den Wert des künstlerischen Ausdrucks“ (vgl. DANNECKER 1994, S.9). In Amerika, dem Land mit 40jährigem Vorsprung gegenüber Deutschland in Sachen Kunsttherapiepraxis, ist es so, „daß trotz der verschiedenen theoretischen Hintergründe bei allen die Relevanz eines kunsttherapeutischen Konzeptes für die konkrete Praxis eine große Rolle spielt“ (ebd., S.8). Und die „Beschäftigung mit demselben Gegenstand: dem Ursprung und der Entwicklung von Kreativität ... bzw. den Auswirkungen bei pathologischen Entwicklungsverläufen“ (vgl. ebd., S.15 f). Daher plädiert sie für eine schlüssige Synthese von Ansätzen, die theoretische Relevanz haben und zur gemeinsamen Grundlage für einen eigenen „integrierten Verstehens- und Behandlungsansatz der Kunsttherapie“ werden können.
In den folgenden Kapiteln sollen die Hauptrichtungen innerhalb der Kunsttherapie als auch deren Begriffsbestimmung sowie spezifische Eigenarten erläutert werden. Daß dies in sehr verschiedenem Umfang geschieht, entspricht der aktuellen Diskussionslage. Unangefochtene Thesen brauchen nur erwähnt, strittige Thesen sollen ausführlich mit reichhaltigem Pro und Kontra dargestellt werden.
2.2.1 Kunsttherapie als Überbegriff
„Kunst darf dabei keinesfalls nur als bildnerisches Gestalten verstanden werden. Auch Musik, Theater, Tanz und Poesie sind Formen der Kunst.“ Hilarion Petzold / Johanna Sieper 1990
Nach Hilarion Petzold und Johanna Sieper ist Kunsttherapie als Oberbegriff für die Arbeit mit unterschiedlichen künstlerischen Methoden, Techniken und Medien im Rahmen psychotherapeutischen Handelns zu verwenden (vgl. PETZOLD/SIEPER 1991, S.176). Neben dieser Definition - Kunsttherapie als Überbegriff der verwendeten Medien und Materialien - steht die von Karl-Heinz Menzen: Kunsttherapie als Überbegriff aller Ansätze. Er unterscheidet:
- einen ästhetisch-theoretisch / ästhetisch-psychologischen
- einen kunstpädagogisch-didaktischen
- einen arbeits-/ ergo-/ beschäftigungstherapeutisch-heilpädagogischen
- einen kreativ-gestaltungstherapeutischen
- einen tiefenpsychologisch-psychotherapeutischen
- einen künstlerischen Ansatz (vgl. MENZEN 1995, S.120).
Immerhin hätten sich diese Ansätze zu nur vier Praxisbereichen „zusammengetan“, in die:
- präventiv -
- rehabilitativ -
- psychotherapeutisch - und
- psychiatrisch orientierte Kunsttherapie (vgl. ebd.).
(Bzw. zu den drei Bereichen der rehabilitativ -, psychosomatisch - und psychiatrisch orientierten Kunsttherapie; vgl. MENZEN 1994, S.47).
All dies stellen folgerichtige Gliederungen dar auf dem Hintergrund seiner Kunsttherapiedefinition, die lediglich besagt, daß „innere und äußere Lebensverhältnisse abgebildet“ würden, die dann bearbeitbar, zentrierbar seien (vgl. MENZEN 1994, S.119). Damit reiht sich die Kunsttherapie in die große Zahl psychotherapeutischer Verfahren ein. Um dies nicht zuzulassen, sondern sich konkret zu unterscheiden, setzen besonders die künstlerischen VertreterInnen den Schwerpunkt auf den ersten Teil des zusammengesetzten Begriffes: Kunst.
2.2.2 Kunst als Therapie
„Kunsttherapie ist die therapeutische Anwendung von Kunst.“ Karin Dannecker 1994
Eine der oben genannten künstlerischen VertreterInnen, Karin Dannecker, schreibt: „Die Erschaffung von Kunst verhilft auch dazu, viele Ich-Funktionen zu mobilisieren, indem die intellektuellen, imaginativen, integrativen und handwerklichen Fähigkeiten eines Menschen eingesetzt werden“ (DANNECKER 1994, S.12). Dies ist Hilfe zur psychischen Organisation und wirkt chaotischem Verhalten entgegen. Auch entwickeln die PatientInnen ein Gefühl für Identität, Autonomie und Selbstwert (vgl. ebd.).
Kunst ist Therapie. Oder, um es mit Martin Schusters Worten zu sagen: „Die zeitgenössische Kunst betont die therapeutische Funktion der Kunst immer wieder “ (SCHUSTER 1993, S.146). Dieser Ansatz beruft sich auf eine lange Tradition: „Fast zu allen Zeiten läßt sich in östlichen wie in westlichen Kulturen diese wortlose Heilwirkung der Kunst als Medikament zur Beeinflussung der Befindlichkeit von Leidenden nachweisen“ (OTT 1993, S.176). Doch weisen darauf ausschließlich jene KunsttherapeutInnen hin, die am eigenen Leibe die Wirkung von Kunst gespürt haben. Wem diese Erfahrung fehlt, kann schwerlich das der zum Mysterium hochstilisierten Kunst zugesprochene Gewicht verstehen. Desto stärker versuchen diese EmpirikerInnen, mit Praxisbeispielen zu überzeugen (vgl. DANNECKER 1994 / LANDGARTEN 1990 / RUBIN 1993 u.a.).
Andreas Mayer-Brennenstuhl setzt den Schwerpunkt ebenfalls auf die Kunst. „Kunsttherapeuten sind ... primär Künstler“ (MAYER-BRENNENSTUHL 1993, S.67). Er nähert sich der ihr innewohnenden Heilkraft anhand kunstphilosophischer Theorien: „Fruchtbare Reflektionen aus therapeutischer Sicht über die Funktionen des Bildnerischen in der Therapie sind geläufig. Reflektionen aus der Sicht der Kunst sind seltener zu finden“ (ebd.). Ausgehend von diesem Manko begibt er sich auf den schweren Weg der Auseinandersetzung mit kunstimmanenten Heilsutopien sowie KünstlerInnen, die jene praktizier(t)en. Zwei Hauptströmungen macht er aus:
Zum ersten die Utopie, deren Ziel sich mit „Sprung zurück zum Ursprung“ wohl am ehesten beschreiben läßt; einer Richtung auf der Suche nach dem spontanen Ausdruck - in der Natur, im einfachen Leben, im Primitivismus, im Kindhaften, im leiblich-sinnlich-dionysischen Erleben bis hin zur Regression des rauschhaften Vergessens (vgl. ebd., S.69). Hoffend, die kranke, kaputte Welt dadurch zum „verlorenen Paradies“ (vgl. ebd.) zurückzuführen. „Die Natur wird zum Urgrund der Heilung von den Schädigungen der Kultur proklamiert, und die Gesellschaft souverän ignoriert“ (MENZEN 1994 <b>, S.66). Beispiele sind neben den VertreterInnen der Romantik auch Paul Gauguin (1848-1903) mit seiner „Faszination der vermeintlich heilen `Wilden’“, weitere finden sich bei den Performance-Künstlern, etwa Hermann Nitsch. Zu dieser emotionalen Hauptrichtung gehört ebenso ART BRUT. Heilende Wirkung wird der ornamentalen, symbolischen Gestaltung beigemessen - bei ProduzentInnen genauso wie bei RezipientInnen.
Die zweite Strömung als Gegenentwurf dazu ist die Heilserwartung in geistig-aufklärerisch-vernünftigen Dimensionen. Die dahinterstehende Theorie der Entwicklung des Menschen durch den Verstand geht auf die rationalen Entwürfe der Aufklärung zurück und drückt sich in ästhetischen (im Sinne von klassisch Schönem) wie in rational-abstrakten Werken aus, z.B. denen der Künstler Piet Mondrians, Paul Klees (1879-1946), Wassily Kandinskys (1866-1944). Die beiden letztgenannten verweisen auf den von ihnen mitgeprägten Bauhausstil, der ebenfalls offensichtlicher Ausdruck der rationalen Kategorie ist.
Einen dritten, qualitativ anderen Weg beschreiben Johannes Itten (1888-1967) und Joseph Beuys (1921-1986). Itten, „einer der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Gründungsphase des Bauhauses“ (BADER 1993, S.28), steht für eine Grundidee, die da lautet: „Ja, ich will Ruhe in der Bewegung und innere Bewegung in der Ruhe, individuell Exstatisches und logisch Objektives in einem Werk. ... Der Widerspruch ist das Prinzip des Lebens überhaupt“ (MAYER-BRENNENSTUHL 1993, S. 77, Original: ITTEN 1988). Beuys steht für die Umsetzung dieser Theorie in die Praxis. Die von ihm begründete Plastische Theorie setzt auf die multidimensionale Bewegung zwischen den Polaritäten, z.B. von Geist und Emotion, Chaos und Form, Willen und Intellekt. Als allgemein-gültiges anthropologisches Prinzip lasse es sich auf alle Bereiche des Lebens anwenden. Wenn die Bewegung zwischen den Polaritäten aufhört, so Beuys, wenn der Mensch an einem Pol eine gewisse Schwelle überschreitet, „dann fällt er ganz aus dem System heraus“ (ebd., S. 79; Original: HARLAN u.a. 1976). „Drinbleiben“ ist das Ziel; das Mittel: Kunst. Dem theoretischen und praktischen Aneignen und Gestalten des Lebens als kreativ-schöpferischem Akt, dem Bewegung innewohnt - dieser „Kunst“ maß Beuys Heilwirkung zu (vgl. STACHELHAUS 1989, S.78 f).
Auf dieser Welle schwimmt die „Creativity Mobilisation Technique“ (CMT), auch Messpainting genannt (von no-thought-messpainting - ohne-Gedanken-durcheinander-malen). Wolfgang Luthe hat CMT als Kreativitätstraining entwickelt (LUTHE 1976). „Es ist die einzige Methode, die ich kenne, die konsequent den spontanen bildnerischen Prozeß in seiner heilenden und selbstregulierenden Wirkung zum Tragen kommen läßt, ohne Deutung und Interpretation der Bilder“ (SCHOTTENLOHER 1993, S.37). CMT stützt sich auf den Parallelprozeß von Progression und Regresssion beim spontanen Malen. Vierzehn Jahre Messpainting haben Gertraud Schottenlohers Gewißheit auf dessen Wirksamkeit ständig bestärkt. Nicht ergebnis- bzw. produkt-orientiert, sondern mit Schwerpunkt auf dem Prozeß werden exemplarisch Normen, Zwänge, Bildvorstellungen im wahrsten Sinne des Wortes übertüncht. Diese Grenzüberschreitung wird nach Schottenlohers Beobachtung als existentielle, physisch wie psychisch mitunter schmerzhafte Befreiung erlebt.
Zur Methode: Messpainting unterteilt sich in zwei Phasen. Die erste beinhaltet als Übung das fast vollständige Füllen des Papierbogens mit „formlosen Formen“ mittels Farbe und Pinsel innerhalb von zwei Minuten. Was theoretisch primitiv klingt, entpuppt sich in der Praxis als Problem. Innere Blockaden und Hemmungen verhindern den unreflektierten Ausdruck, die freie Bewegung. Erst wenn das Malen „spontan fließt“ (vgl. ebd., S.41), beginnt die zweite Phase; die des sich selbst entfaltenden Malens - von Schottenloher „spontane Komposition“ genannt. Bewußte Impulse von Farbwahl und Flächenaufteilung dürfen beim Gestalten der „formlosen Formen“ aufgegriffen werden.
Bei CMT stehen zwei Theorien im Hintergrund. Die auf bioorganischer Sicht basierende Haupthypothese ist die der unterschiedlichen Spezialisierung der beiden Gehirnhälften. Die Dominanz der analytisch-logisch-intellektuellen linken Hälfte hindert die Entfaltung der musisch-räumlich-ganzheitlich orientierten rechten Hälfte. Die Funktionen der rechten sollen - als Ausgleich zur in unserer Kultur überstark verbal-intellektuellen Erziehung - trainiert werden. Für Schottenloher scheint eine Nachentwicklung der rechten Hemisphäre belegt und erforderlich zur Stimulation von Selbstregulierungsprozessen. Die Prozesse sind für sie die Fähigkeit des Organismus, sich durch Spannungsentladung im Gleichgewicht zu halten (vgl. ebd., S.43).
These Zwei besagt, daß Messpainting kreativitätshemmende Faktoren neutralisiert. Zusätzlich unterstützt werden könne dies durch Gespräche (vgl. SCHOTTENLOHER 1994, S.58 ff). Sie führt für beide Thesen keine Quellen an.
These Eins wird bestätigt von Luc Ciompi (vgl. DOMMA 1990, S.118 f; Original: CIOMPI 1982, S. 144 ff, 171 ff). These Zwei klingt sinnvoll und ist Voraussetzung für künstlerisches Schaffen, hat aber nicht zwingend Relevanz für die Anwendung von Kunsttherapie in der Psychiatrie.
Den Gegenpol zu CMT visiert Wolfgang Domma an - das strenge Nach-zeichnen von Linien und geometrischen Figuren (vgl. DOMMA 1990, S.118; siehe auch Kapitel 2.1.3 Pädagogik). Ob dies noch - oder schon - Beschäftigungstherapie ist oder gar auf dem besten Weg, stupide Verhaltensweisen zu fördern, mag andernorts geklärt werden. Berechtigterweise kann auch Domma sich auf das Beuys’sche Modell des stets notwendigen Ausgleichs und der Bewegung zwischen den Polen berufen. So helfen Pauschalurteile nicht weiter, sondern müssen sich am konkreten Einzelfall messen lassen. Letzteres soll einen weiteren Beleg für die extreme Vielgestaltigkeit der therapeutisch verstandenen - also nicht die Therapie ergänzenden - Kunst darstellen. Das Besondere an diesem „Kunst ist Therapie“-Ansatz ist, daß die PatientInnen an der einmal gelernten künstlerischen Technik autonom weiterarbeiten können, unabhängig von ihnen helfenden bzw. helfen wollenden Personen.
2.2.3 Theapie mit kreativen Elementen
„Gestaltungstherapie solcher Art versteht sich als Ergänzung verbal orientierter Psychotherapie durch den bildnerischen Ausdruck.“ Karl-Heinz Menzen 1992
Therapie mit kreativen Elementen bzw. Gestaltungs- oder Kreativitätstherapie bedient sich des Malens / Plastizierens, legt den Schwerpunkt aber auf das Gespräch darüber. Da sich für Gefühle, Stimmungen, Erinnerungen leichter Bilder als Worte finden lassen, stellt die gestalterische Abbildung des inneren Bildes einen ersten Schritt des Zugangs zu den PatientInnen dar. Vereinzelt werden noch Kämpfe gegen den Begriff Kunsttherapie geführt; weitestgehend hat sich die Einsicht durchgesetzt, daß der Streit um Inhalte wichtiger ist als der um Begriffe (vgl. TOMALIN/SCHAUWECKER 1993, S.19). Das unter Kapitel 2.2.2 (Kunst als Therapie) Ausgeführte wird mit „Ja, aber ...“ ergänzend kommentiert oder abgewertet. Kunst, richtiger kreatives Gestalten, wird lediglich als Vehikel verstanden, bei welchem es therapeutische Methoden anzusetzen gilt. Besonders PsychologInnen und BeschäftigungstherapeutInnen ohne (künstlerische) Zusatzqualifikation vertreten diese Richtung. Die Grenzen zu Psychologie, Pädagogik und Beschäftigungstherapie sind fließend (vgl. MENZEN 1995, S.101 ff).
2.2.4 Kunstpsychotherapie
„Das Bild wird zum Helfer, zum Dritten, der auf bisher Übersehenes hinweist, Ressourcen und Lösungen anbietet.“ Gisela Schmeer 1993
Wie der Begriff Kunstpsychotherapie bzw. Psychoanalytische Kunst-therapie schon nahelegt, wird diese Richtung primär von PsychotherapeutInnen und TiefenpsychologInnen vertreten. Nach Israel Zwerling rekrutieren sich VertreterInnen aus neurobiologischen, verhaltensorientierten, psychodynamischen und familiensystemischen Ansätzen gemeinsam zu dieser Richtung (vgl. ZWERLING 1991, S.65 f). Doch gesteht er selbst ein, daß diese Aufzählung eher auf einem stillschweigend-unreflektierten Solidarisierungswunsch der TherapeutInnen basiert als auf realer Übereinstimmung.
Grundlage der Kunstpsychotherapie bilden die in Kapitel 2.1.2 (Psychoanalyse) ausführlich interpretierten Theorien. Somit hat dieser Ansatz im Vergleich zu den anderen kunsttherapeutischen Sparten - dank der immensen Forschungsleistung Freuds und Jungs - die stärkste theoretische Basis. Karin Dannecker, auf der Suche nach einem allgemeingültigen Kunsttherapiekonzept bei Zugrundelegung praxisrelevanter Theorien, findet sich in diesem Ansatz wieder, obgleich sie in der Praxis eher Vertreterin des „Kunst ist Therapie“-Konzeptes ist. Denn zwar betonen kunstpsychotherapeutische TheoretikerInnen häufig die formale Gleichwertigkeit - bspw. Elisabeth Wellenreiter: „In der psychoanalytischen Kunsttherapie kommen zwei Bereich zusammen, die Psychoanalyse und die Kunst“ (WELLENDORF 1991, S.301) - doch ist die Kunst doch der eher vernachlässigte Bereich.
2.2.5 Anthroposophische Kunsttherapie
„Das `Normale’ kann kein Maßstab für Krankheit sein, sondern Krankheit oder Behinderung in jeglicher Form hat ihren eigenen Maßstab, und der Mensch ist dann `gesund’, wenn er mit sich identisch ist.“ K.H. Türk 1993
Die Anthroposophische Kunsttherapie sei hier nur der Vollständigkeit wegen genannt. Hintergründe und Zusammenhänge zu beleuchten, muß hier bedauerlicherweise aus Platzgründen unterbleiben. Es ist ein spezieller Ansatz, der sich von allen anderen grundsätzlich unterscheidet; zu dem lediglich der Begriff Kunsttherapie eine Parallele bildet.
Therapeutische Grundaufgabe ist, „die Selbstheilungskräfte des Patienten anzuregen, ihn soviel wie nötig von außen zu stützen und ihn soweit zu begleiten, bis er die Krankheit im Wesentlichen selbst überwinden lernt“ (PÜTZ/GLÖCKNER 1993, S.164). Metaphysische Kräfte-konstellationen tragen bei zu Ungleichgewicht und Krankheit bzw. Gleichgewicht und Gesundheit (vgl. STEINER 1978). Diese wenigen Hinweise mögen hier genügen. Alles weitere würde eine hintergründig-detaillierte Darstellung des von Rudolf Steiner (1861-1925) begründeten anthroposophischen Menschenbildes, Farblehre etc. erfordern.
Dabei hat sich die Anthroposophie besondere Verdienste im Bereich der künstlerischen Therapien erworben (vgl. PETERSEN 1994, S.160). Seit über 60 Jahren werden deren spezifische Ansätze therapeutisch praktiziert. Nur dadurch konnte die Kunsttherapie nach der amerikanischen „Neuentdeckung“ so schnell in Deutschland Fuß fassen und breite Anerkennung und Anwendung finden.
Abschließend sei noch erwähnt, daß Joseph Beuys Anhänger der Anthroposophie war und viele derer Gedanken in dessen Arbeit und Werk einflossen.
2.3 Kunsttherapeutische Möglichkeiten und Grenzen
„Ein Mensch, der seine Angst gestalten und ihr ein Gesicht geben kann, ist schon nicht mehr in der Gefahr, von ihr überwältigt zu werden.“ Elisabeth Tomalin / Peter Schauwecker 1993
Es mag vermessen erscheinen, bereits nach einem Jahrzehnt kunst-therapeutischer Praxis zu behaupten, Möglichkeiten und Grenzen der Kunsttherapie aufzeigen zu können; zumal die Praxis, wie oben dargestellt, keineswegs eine einheitliche ist. Die Analyse ist eine situative und somit unvollständig.
Als Zusammenfassung des bisher Dargestellten hier einige Thesen zu den Möglichkeiten der Kunsttherapie (vgl. TRETTER 1994, S.182 ff; SCHOTTENLOHER <I> 1994, S.28 f).
Kunsttherapie:
- spricht Psyche und Physis gleichermaßen an
- bezieht zeitliche Dimensionen von Gegenwart (aktuelle Situation) und Vergangenheit (Erinnerung) ein und prägt somit das Zukünftige (Lebensgestaltung und -ziel)
- ermöglicht analog zum bildnerischen Gestalten fast spielerisch die Erfahrung, daß das Leben als ganzes ein kreativ-schöpferischer Prozeß ist und fördert damit die Selbstaktivierung
- vermindert die Abhängigkeit der PatientInnen gegenüber den KunsttherapeutInnen: Verbindung und Grenze zugleich ist das Medium Kunst - der gestalterische Prozeß und mitunter das Produkt
- kann - sind die Techniken gelernt - von den PatientInnen autonom weitergeführt werden
- macht Verkrampfungen und Blockierungen im körperlichen und seelischen Bereich bildhaft-konkret deutlich und deutbar bzw. löst diese im therapeutischen Prozeß
- ermöglicht den PatientInnen durch die dargestellten Bildinhalte einen konkret-persönlich-individuellen Zugang zur eigenen Psyche
- stärkt die unterentwickelte rechte Hemisphäre
- verringert durch den spielerischen Umgang mit unbekannten Materialien und Techniken generell die Angst vor Neuem / Fremdem / Unbekanntem und ermöglicht flexiblere Reaktionen im Alltag
- verhilft zur Individuation, zur Integration abgespaltener und verdrängter Teile des Selbst
- schafft durch künstlerischen Prozeß und Produkt eine „Pufferzone“ zwischen Innen- und Außenwelt, gleichfalls zu deren Bewußt-werdung, Bearbeitung und Einteilung
Möglichkeit und Grenze zugleich ist der nur nachrangige Gebrauch des verbalen Mediums. Weiterhin ergeben sich aus dem bisher Dargestellten folgende Grenzen. Kunsttherapie:
- ist keine „machbare“ Methode
- ist ein ganzheitlicher Prozeß, den die KunsttherapeutInnen durch ihre Erwartungen wesentlich beeinflussen und den sie als Voraussetzung an sich selbst erlebt haben müssen
- kann ihre Ergebnisse durch den prozessualen Charakter kaum quantifizierbar - statistisch - zahlenmäßig nachweisen; dazu bedarf es der spezifischen Betrachtung des jeweiligen Einzelfalles
Weiterer Beleg für eine Grenze des häufig mißtrauisch beäugten Novums Kunsttherapie ist ihre häufig verhinderte Praxis. Denn der kunsttherapeutische Vormarsch geht nicht ohne Hindernisse. So enthält das 1991er „Forschungsgutachten zu Fragen eines Psychotherapeutengesetzes“, in Auftrag gegeben vom Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, ein niederschmetterndes Resümee: Kunsttherapie sei ein „nicht bewährtes und wissenschaftlich fundiertes Therapieverfahren“ und somit von einer Anerkennung nach dem Gesetzentwurf ausgeschlossen (vgl. DANNECKER 1994, S.3). Daraus leiten sich zwei Fragen ab, die einzeln zu erörtern sind:
A: Ist diese Analyse zutreffend?
B: Welche Defizite sind zu kompensieren?
Zu A: Eine Vielzahl von Äußerungen Prominenter aus Politik und Fachwelt scheint dem zu widersprechen. Prof. Dr. Karl-Hans Laermann, Bundesminister für Bildung und Wissenschaft: „Der kunstthera-peutische Prozeß bewirkt auf Seiten des Patienten vornehmlich die Förderung der Selbstheiungskräfte“ (vgl. SCHOTTENLOHER <Bd.I> 1994, S.9). Weiter spricht er sich dafür aus, daß Kunsttherapie für psychiatrische und andere Kliniken zur Regel wird. Sein Kollege Prof. Dr. Helmut Engler, Baden-Würtembergischer Minister für Wissenschaft und Kunst, ist ähnlicher Meinung, wenn er äußert, Kunsttherapie hätte u.a. die Aufgabe, „einen ersten emotionalen Zugang zum Patienten zu eröffnen und damit die Grundlage für die Gesprächsfähigkeit und Gesprächsbereitschaft des Patienten zu schaffen“ (THIES <Hrsg.> 1987, S.35).
KunsttherapeutInnen sorgen weniger markant, dafür anschaulich begründend für ein gutes Image der Kunsttherapie. Doch je eingehender die Möglichkeiten analysiert werden, desto klarer tritt auch die Darstellung von Problemen und Grenzen hervor. Ohne die Frage A vorschnell bejahen zu wollen, scheint eine Reflexion des bisher Erreichten inclusive der eingeräumten Defizite unter Beantwortung der Frage B sinnvoll.
Zu B: Peter Petersen erstellt die erschütternde Analyse, daß die gegenwärtige Kunsttherapie „eher einem recht fragwürdigen Flickenteppich gleicht“ (PETERSEN 1994, S.160). Zur Abhilfe empfiehlt er sowohl die Ausarbeitung der Erfahrungen anthroposophischer Kunsttherapie als auch anthropologischer Ansätze. Neben dem Nachholebedarf an Theoriebildung besteht nach Petersen der der Untersuchung von Wirkungsweisen. „Am `Das’ der Wirkung ist kein Zweifel, aber das `Wie’ ist im Dunkel“ (ebd.). Petersen ist überzeugt davon, daß das Wirken immer nur als schöpferischer Akt zwischen TherapeutInnen und PatientInnen entsteht. Doch sei dies eine unsichtbare und nicht machbare Dimension, die man „nur sich einstellen lassen“ kann. Damit entfernt er sich jedoch weit von einer akzeptablen und brauchbaren Theorie der Kunsttherapie, statt ihr zu derselben zu verhelfen. Denn gerade diese und ähnliche nebulöse Thesen bringen die Kunsttherapie in der skeptischen Fachwelt in Verruf.
Theoriebedarf in einer weiteren Hinsicht sieht Karin Dannecker. Sie betont kritisch die unklare Verwendung des Begriffes Kunsttherapie, wodurch die dahinter stehenden inkohärenten Theorien und daraus resultierenden Praxen nur per logos verschmolzen werden, was eine mentale Annäherung als auch Auseinandersetzung verkompliziert. Miteinander harmonisierende Schulen werden durch gemeinsamen Gebrauch desselben zu Konkurrenten (vgl. DANNECKER 1994, S.3 ff). Dies wurde bereits in Kapitel 2.2 (Streit um den Begriff Kunst-therapie) ausführlich dargelegt.
Auch Wolfgang Domma beschreibt, in welche Ferne eine einheitliche Kunsttherapiedefinition durch das Gerangel der verschiedenen fachwissenschaftlichen Spezialgebiete gerückt ist (vgl. DOMMA 1990, S.9 ff). Er plädiert, um wenigstens ansatzweise die unterschiedlichen Sichtweisen zu bündeln, für die strikte begriffliche Trennung zwischen Kunsttherapie und Gestaltungstherapie.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, aus der Not eine Tugend zu machen. Diese Chance sieht Peter W. Rech und geht damit offensiv ins Rennen: „Heute habe ich die Erfahrung, daß die Beschreibung kunsttherapeutischer Praxis ihre Legitimation ist“ (RECH 1995). Es gebe keine bedeutende Theorie, und da sie auch niemand würde entwickeln können, verzichtet er freiwillig und gänzlich auf theoretische Fundierung und empirische Nachweise. Dessenungeachtet soll vorliegende Arbeit weiterhin dem Ziel dienen, Theoriebildendes in die Diskussion einzubringen.
Übervorsichtigkeit beinhaltet die Kritik Karl-Heinz Menzens. Er anerkennt Kunsttherapie als moderne Formulierweise des individuellen Bewußtseins, hegt jedoch Bedenken des Mißbrauchs im Hinblick auf die Instrumentalisierung als gesellschaftlich intendierten Steuerungsprozeß der Vernunft. Damit verbunden sei die Gefahr, daß die so manipulierend eingesetzte Kunsttherapie es ermögliche, „Widersprüche `ganzheitlich’ auszublenden“ (vgl. MENZEN 1995, S.118). Menzens Kritik trifft die psychotherapeutische Seite der Kunsttherapie im Allgemeinen; ist ein wiederaufgewärmter Seitenhieb gegen die Psychoanalyse, speziell deren Tendenz zur Subjektivierung auch gesellschaftlich-wirtschaftlich-sozialer Problemursachen und -auslöser. Doch ist das in doppelter Hinsicht ein alter Hut. Erstens bestehen diese Vorwürfe seit den 20er Jahren, detailliert dokumentiert aus marxistischer Perspektive (vgl. JURINETZ 1927; BERNFELD 1970), währenddessen zeitgleich psychoanalytisch-marxistische Theoretiker dies Manko bearbeiteten (vgl. REICH 1970; OSBORN 1970) und weit über die individuell-psychische Dimension hinaus wirtschaftliche, soziale, historische, später auch metaphysische bzw. pseudophysikalische Aspekte einbezogen, so daß von Ausblendung ganzheitlicher Widersprüche diesbezüglich keine Rede sein kann. Zweitens dürfte eine Verhinderung der Kunsttherapie wegen der Gefahr des Mißbrauchs in keinem Verhältnis zum damit verhinderten Nutzen stehen. Damit gliche Menzens Warnung dem Versuch der Neuerfindung der Volksweisheit, daß jede Medaille zwei Seiten hat. Also berührt seine Kritik weder relevante theoretische noch praktische Aspekte, hat daher nichts mit der zu Beginn des Kapitels genannten Problemlage zu tun und verdient nur in allgemeiner Weise als prinzipieller Gedanke Beachtung.
Nach dem Mißbrauch nun zum Mißverständnis. Elisabeth Tomalin und Peter Schauwecker bestätigen die allgemeine therapeutische Wirkung der Kunsttherapie, betonen aber das Problem des Individuell-Konkreten: „Nicht immer und ohne weiteres ist Malen und Gestalten von sich aus heilend, vor allem dann nicht, wenn wir nicht erkennen, was die Bilder uns sagen“ (TOMALIN/SCHAUWECKER 1993, S.21). Mitunter seien Bilder von PatientInnen ein letzter Aufschrei, eine letzte Warnung; unterstrichen durch das Beispiel des letzten Werkes Vincent van Goghs vor seinem Suizid: das düsterschwere „Weizenfeld mit Raben“. Ähnliche Erfahrungen erfuhren sie in ihrer eigenen Praxis: Bildmotive einer Patientin wurden zwar von der Kunsttherapeutin, nicht aber vom Arzt als akut todessehnsüchtige verstanden. Sicherheitsvorkehrungen veranlaßte dieser nicht und verhinderte somit auch den wirklich folgenden Suizid nicht (vgl. ebd., S.23 f). Folgendes Fazit läßt sich daraus ziehen: Neben hoher fachlicher, künstlerisch und therapeutisch ausgerichteter Qualifikation, die durch staatlich anerkannte Fakultäten - Tendenz qualitativ und quantitativ steigend - gesichert scheint, ist in gleichem Maße eine höhere Anerkennung des Status’ der KunsttherapeutInnen notwendig. Wie obiges Beispiel zeigt, ist praktizierte Kunsttherapie in der noch üblichen Berufsgruppenhierarchie - die ÄrztInnen entscheiden; auch darüber, welche Informationen ihrer MitarbeiterInnen sie ignorieren - nicht nur für die PatientInnen nicht hilfreich, sondern auch der noch um Anerkennung ringenden Kunsttherapie extrem abträglich. Letzten Endes steht in der Krankenakte: „Suizid trotz Kunsttherapie“, was als Negativbeleg in die Statistik eingeht.
Eine weitere Dimension der Skepsis erörtert Doris Titze, die sich kritisch mit der KünstlerInnenrolle auseinandersetzt, in die PatientInnen - häufig ohne es zu wollen - durch ihre Bildwerke gedrängt werden. Auch wenn
1. der KünstlerInnenstatus dem der PatientInnen übergeordnet scheint, stellt er doch nur eine weitere gesellschaftliche Randposition dar.
2. geraten die Ausstellenden schnell in das Gerangel des Kunsthandels, was eine weitere Belastung und häufig Überforderung darstellt. Außerdem wird maximal das Werk, nicht aber die Person gewertschätzt; wieder geschieht eine Fremddefinierung.
3. entwickeln manche PatientInnen ihre exzessiven kreativen Phasen nur in akuten Psychosen. Weiteres Kunstschaffen kann diese Krisen verlängern, manifestieren, chronifizieren, ständig neu auslösen (vgl. TITZE 1993, S.97).
Möglicherweise besteht in o.g. skeptischen Aspekten ein Zusammenhang zu folgenden Beispielen.
Abschließend seien zwei Projekte erwähnt, die Kunsttherapie ablehnen. Für Luc Ciompis Berner Soteria, die alternative Schizophrenie-Akutbehandlung im Rahmen einer Wohngemeinschaft, „Hoffnungs-träger“ (HANSEN 1993, S.7) der Sozialpsychiatrie, gilt die Kunst als eher künstlich und die -therapie als Theorie und damit als nicht lebenspraktisch. Elisabeth Aebi über Soteria: „Es gibt kein spezifisch therapeutisches Angebot, keine Gruppensitzungen. Wir wollen kein künstliches Milieu schaffen, sondern uns an lebenspraktische Tätigkeiten halten“ (AEBI 1993, S.37).
Das Bremer „Blaumeier Atelier, Projekt Kunst und Psychiatrie Blaumeier e.V.“, ist ein „Frei- und Spielraum“ für „junge und alte Menschen, mit und ohne Behinderungen, psychisch gekränkte und psychiatrisierte Menschen, Laien und professionelle KünstlerInnen“ (EISENBEISS/ RÖMER 1994, S.6). Konzeptionell verbunden fühlt es sich den Ideen der italienischen Demokratischen Psychiatrie und der englischen Antipsychiatrie (vgl. ebd., S.8). Das Blaumeier Atelier bietet Möglichkeiten für künstlerische Betätigung, distanziert sich aber ausdrücklich von jedweder Therapiefunktion. Einem „psychiatrisch diagnostischen Versorgungsauftrag“ wird eine „klare Absage“ erteilt. Dagegen „wichtig ist die Eigenständigkeit der im Atelier entstehenden Kunst und nicht eine mit künstlerischen Mitteln bekräftigte therapeutische Behandlung. ... Gerade dieses `Frei-sein von Therapie´ stellt eine Qualität dar, die der Kunst und damit auch dem Menschen eine Chance gibt“ (ebd., S.32). Auch Mitarbeiterin Marie Luise Thören drückt ihr Kunsttherapieverständnis drastisch aus: „Hier wird kein Ergebnis auf ablesbare psychische Defizite untersucht“ (ebd., S.7).
Diese beiden Projekte seien genannt als Beispiele für selbstgesetzte Grenzen bzw. Begrenzungen aufgrund spezifischer Interessen; ebenso dafür, welches Bild auch in der Fachöffentlichkeit über Kunsttherapie gemeinhin existiert. Als mögliche Erklärung sei ergänzend hinzugefügt, daß beide Projekte seit etwa zehn Jahren bestehen und somit kunsttherapeutische Konzeptionen - sollten sie sich nicht allein aufs ferne Amerika beziehen - rar waren; bedenklich stimmt jedoch die Resistenz der Aversion gegen Kunsttherapie. Dies als abschließenden Beleg für zu kompensierende Defizite. In Kapitel 2.2.2 (Kunst als Therapie) wurde bereits deutlich, daß die bei Blaumeier angebotene Form der künstlerischen Betätigung durchaus als Kunsttherapie bezeichnet werden kann - auch wenn sich die InitiatorInnen dagegen verwehren.
Exkurs:
Her X. beharrt darauf, daß Künstler Eigenbrötler seien und weder mit sich, noch mit der Welt klarkämen. Ihm sei völlig unklar, wie ich dem Künstlerleben irgend etwas Faszinierendes abgewinnen könne. „Warum malen sie?“, fragte ich, ohne meine Arbeit zu unterbrechen. „Och, ‘s ist halt mein Hobby.“ Ein paar Augenblicke später: „Ach was, ich bin selbst ein Eigenbrötler und ... Ach, lassen wir das.“ Also ließen wir das.
3. Psychiatrie
„Wer ist denn normal? Wo ist der normale Mensch? Zeigen sie ihn uns!“ Jean Dubuffet 1948
Johann C. Reil führte 1808 in Deutschland den Begriff „Psychiatrie“ ein und rief nach humanitären Reformen zugunsten der psychisch Kranken betreffs Unterbringung und Betreuung (vgl. SCHWAB 1995, S.408). Reichlich 150 Jahre später forderte die Sozialpsychiatrie, beeinflußt von der englischen Anti- und der italienischen Demokratischen Psychiatrie, das gleiche. Sie rückte die Psychiatrie wieder ins öffentliche Bewußtsein und prangerte Mißstände der Verwahranstaltspraxis in Großkliniken an, was unter anderem zur Einsetzung einer Psychiatrieenquete-Kommission durch den Bundestag und einer Veröffentlichung der Ergebnisse 1975 führte. Zeitgleich arbeiteten die VertreterInnen der Sozialpsychiatrie an der Konzeption nach Alternativen - einer gemeindenahen Psychiatrie, die nicht nur somatisch orientiert ist, sondern ganzheitliche therapeutische und rehabilitative Aspekte bewußt realisiert. Das Ziel ist, „psychische Störungen in ihrer engen Verflechtung mit der gesamten sozialen Umwelt - Familie, Wohn- und Arbeitsumgebung, ökonomische Situation, soziokulturelle Umwelt - sowohl zu verstehen wie auch zu behandeln“ (CIOMPI 1995, S.295). So einheitlich dieses Paradigma klingt - die daraus resultierende Praxis ist vielfältig. Von jenen, die in Sozialpsychiatrie nur ein frisches Etikett und lediglich ein paar neue Inhalts- oder Zusatzstoffe sehen, soll hier nicht die Rede sein. Vielmehr soll den Ansätzen derer nachgegangen werden, die radikal nach Alternativen suchten und suchen, die das bisher Bestehende ersetzenden. Genannt seien besonders die Einführung von neuen, das Absolute der Neuroleptika relativierenden bzw. ersetzenden anderen Therapien, deren Kunsttherapie eine ist, und der Aufbau sozialpsychiatrischer Strukturen außerhalb der Kliniken, innerhalb der Gemeinden. Für Klinikauflösungen gibt es in Deutschland bislang ein einziges modellartiges Projekt. „Nur das Bundesland Bremen machte keine Anstalten, sondern im Gegenteil, seine wieder auf: Seit zehn Jahren leben rund achthundert Geisteskranke und Behinderte mitten unter dem, was sich für normal hält. Das einzig Irrsinnige an dem Versuch scheint der Erfolg zu sein, den Fachleute aus aller Welt bewundern kommen“ (KÜPPERSBUSCH 1995, S.49).
Dem Thema der Arbeit entsprechend, wonach die Schizophrenie in vorliegendem Zusammenhang nur Beispielcharakter trägt, werden die Abhandlungen in diesem Hauptkapitel dementsprechend kürzer als die vorhergehenden. Doch ist die inhaltliche Annäherung an die „härteste Knacknuß der Psychiatrie“ (CIOMPI 1993, S.173), die Schizophrenie, notwendig, was in diesem Abschnitt 3 (Psychiatrie) geschieht.
Im Zusammenhang mit Psychiatrie gilt es, deren heutige Bedeutung als staatlichem Repressionsinstrument mitzubedenken, da Kunsttherapie überwiegend im klinischen Rahmen Anwendung findet. Es soll nicht bestritten werden, daß viele KunsttherapeutInnen mit dem hehren Ziel antreten, gerade diese repressiven Strukturen zu unterwandern und aufzulockern, den PatientInnen Freiräume ermöglichen wollen (vgl. PETZOLD/SIEPER 1991, S.172). Der Gedanke, ob dies möglich ist und inwieweit gerade diese Versuche benutzt, mißbraucht und in die Struktur assimiliert werden zur weiteren Rechtfertigung und Weiterführung derselben auf subtilere Art, kann hier nicht vertieft werden. Es sei erinnernd hingewiesen auf das Wiederaufleben der deutschen Kunsttherapie in den 70er Jahren als Teil der alternativen, gegen (Groß-) Kliniken kämpfenden und stattderer nach anderen Behandlungsformen und -orten suchenden Sozialpsychiatrie. Diese auch politisch geführte Standortbestimmung spielt in der gegenwärtigen Kunsttherapiediskussion kaum eine Rolle.
3.1 Krankheitsansichten: Schizophrenie
„Der jeweils vorherrschende Zeitgeist übt einen gewaltigen Einfluß auf die Häufigkeit und den Charakter der Geisteskrankheiten aus.“ Esquirol 1837
Die älteste Bezeichnung ist „Dementia praecox“ (vorzeitige Verblödung). Die das schizophrene Syndrom betreffende Kategorie bezeichnete erstmals Emil Kraepelin 1883. Eugen Bleuler führte 1908 den Pluralbegriff „Schizophrenien“ (Spaltungsirresein) ein (vgl. SCHARFETTER, S.XIII). Die davon abgeleiteten Singulartheorien, was Schizo-phrenie ist und was sie auslöst, gehen so weit auseinander, daß Charlotte Köttgen resümiert: „Wir wissen nicht, was Schizophrenie ist“ und jede andere Behauptung als Größenwahn abtut (KÖTTGEN 1995, S.1). Geläufig jedoch sind hauptsächlich zwei Erklärungsansätze. Der eine besagt, daß eine Spaltung existiert - eine Spaltung der Persönlichkeit, Abspaltung der Emotionen vom Ich, gespaltenes Verhältnis zur Umwelt etc. (vgl. DÖRNER/PLOG 1992, S.149 ff). Der andere besagt, daß eine Auflösung besteht - eine Auflösung der Ich-Grenzen, der Identität, des normalen Selbstschutzes, wodurch alle Umwelteinflüsse „ungefiltert“ auf das Ich einwirken und dieses mitunter völlig „besetzen“. Innen- und Außenwelt verschwimmen (vgl. JERVIS 1978, S.390 ff; WULFF 1994, S.2 ff). Eine organische Schädigung kann jeweils ausgeschlossen werden (vgl. HUTTERER-KRISCH <Hrsg.> 1994, S.808 f). Mitunter werden beide als unterschiedliche Stadien des Krankheitsverlaufs dargestellt (vgl. ADERHOLD 1994, S.1 ff) bzw. als gleichzeitiges Paradoxon (vgl. BENEDETTI/PECICCIA 1994, S.109 f). Ohne ins Detail abzugleiten: ob „besondere Entwicklung“ unter besonders „disharmonischen Bedingungen“ (vgl. BLEULER 1989), Hospitalismusfolge (vgl. CIOMPI 1980), Störung des Zusammenspiels zwischen Fühlen und Denken (vgl. CIOMPI in: AEBI/CIOMPI/HAGEN <Hrsg.> 1993), dem Zeitgeist entsprechende Gesellschaftskrankheit (vgl. DEVEREUX 1974), Vereerbung, Stoffwechselkrankheit, Regression in frühkindliche Zustände - die Aufzählung vermeintlich objektiver Erklärungsansätze ließe sich beliebig lange fortsetzen (vgl. KÖTTGEN 1994, S.1 ff). Es ist außerdem davon auszugehen, daß bei dem Verdacht auf Schizophrenie weitere bestehende Symptome subsumiert werden, statt sie einer separaten - z.B. bei bestimmten Schmerzen einer körperlichen - Diagnose zuzuordnen. Somit wird der Begriff der Schizophrenie auf ihr fremde Bereiche ausgeweitet. An der von Leo Navratil 1965 erfaßten Situation - „Es gibt heute kaum einen Psychiater, der nicht seine eigenen Ansichten über Ursache und Wesen der schizophrenen Geistesstörung hätte“ - (NAVRATIL 1965, S.13) hat sich bis heute nichts grundlegendes geändert.
Exkurs:
Herr X. kam heute eine Stunde zu spät. Außer Atem berichtet er vom Besuch bei seiner Arbeitskollegin, die völlig überraschend ins psychiatrische Krankenhaus eingeliefert worden war. „Etwas sonderbar war sie ja schon immer. Gerade das mochte ich an ihr.“ Kopfschüttelnd: „Die anderen haben sie nie ernstgenommen. Meinten,“ - tippt sich mit dem Finger an die Stirn - „sie wäre blem-blem. Sie hat sich total beschäftigt mit Ökologie und so und was man da alles machen kann. ´Machen muß` - wie sie immer betonte. Und welche Gifte überall drin sind, im Essen und in der Luft. Und überhaupt. Am Ende ist sie nackt durch den Wald gelaufen, hat sich eine Hütte gebaut und die Pilzsammler angeschrien, sie werde die einzige Überlebende beim nahen Super-GAU und der Vernichtung der Menschheit sein.“
Bei seinem Besuch habe sie ihn erkannt, sich aber weiter mit irgendwelchen Geistern unterhalten. „Und die geben ihr Tabletten en masse. Das hilft doch nix. Jetzt fühlt sie sich erst recht vergiftet. Hätten die das Geld, was die in die Behandlung stecken, für die Umwelt ausgegeben, wär’s nicht so weit mit ihr gekommen!“ Auf meine Frage, ob Herr X. auf ein Bier mit in die nächste Kneipe kommen wolle, schüttelt er den Kopf. Wie konnte ich auch nur sein Asthma vergessen?! Herr X. versteht: „Aber bei mir zu Hause können wir gern eins trinken.“ Was folgte, war ein Abend, der mir lange in Erinnerung bleiben wird. Ewig nicht mehr habe ich mir so sehr ´nen Kopf gemacht über die Umwelt und was man dafür tun kann - tun muß, wie ich jetzt manchmal sage.
An Schizophrenie erkranken durchschnittlich ein Prozent (JERVIS 1978, S.387) bzw. 1-2% (DÖRNER/PLOG 1992, S.172) der Bevölkerung, doch variiert die Häufigkeit der erstellten Diagnose von Land zu Land (vgl. JERVIS 1978, S.387); ebenso die Symptomatik (vgl. SCHMITZ 1994, S.1 ff; WULFF 1994, S.11 ff) - trotz nahezu einheitlichen Klassifikationskriterien (vgl. ICD-10, WHO 1993, S.101 ff; DSM-III-R 1989, S. 24 ff). „Der Ausbruch der spaltenden Krise liegt meist 3-4 Wochen nach einem kritischen Lebensereignis“ (DÖRNER/ PLOG 1992, S. 162). Schizophrenie steht mit 20-25% an zweiter Stelle der Erstaufnahmen in psychiatrischen Krankenhäusern (vgl. ebd. S.171). Mehr als die Hälfte der chronisch hospitalisierten PatientInnen erhielt ursprünglich diese Diagnose. Das Ersterkrankungsalter liegt zwischen 15. und 25. Lebensjahr; geschlechtsspezifische Unterschiede in der Häufigkeit bestehen nicht (vgl. ebd.).
Spezifisch genau zu untersuchen sind bei Schizophrenen erstens die kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Gewaltaspekte und deren Wertigkeit für die Betroffenen. Eine zweite Annäherung ist möglich durch das Vertrautmachen mit den in der Familie sowie im engeren Bekanntenkreis bestehenden Beziehungsstrukturen inclusive immanenter körperlicher und/oder subtil-psychischer Gewaltverhältnisse wie Abhängigkeit etc. (vgl. BARTL/MOSER 1994, S.239 ff). Nur in Kenntnis dieser Perspektiven kann ein Minimum an innewohnender Logik der schizophrenen Psychose verstehbar werden. Es liegt nahe, daß diesem Verständnis aus therapeutischer Sicht große Bedeutung zukommt. Daher auch bei Klaus Dörner und Ursula Plog die Bezeichnung Störung statt Krankheit, ebenso in ICD-10 und DSM-III-R.
Daraus leitet sich die Frage ab, ob denn das Krankenhaus überhaupt die passende Adresse sei. An dieser Veränderung, so notwendig sie auch scheint, hängen - konsequent weitergedacht - noch andere, offenkundig unerwünschte Begleiterscheinungen. Schizophrene würden den häufig passiven PatientInnenstatus aberkannt bekommen und zur stärkeren, auch mentalen Beteiligung genötigt. Damit aber dürften viele geistig überfordert sein (vgl. THOMAS 1986, S.251 ff), werden in psychiatrischen Krankenhäusern doch hauptsächlich Menschen aus der unteren Mittel- und Unterschicht behandelt, während Oberschichtangehörige i.d.R. private Pflege und Psychotherapie beanspruchen können. Beachtung verdient, auch bei etwaig geplanten Umstrukturierungen der Behandlung, daß die Freiräume der PatientInnen im Sinne von „seine/ihre Ruhe haben können“ nicht weniger, sondern mehr werden, dafür aber um so stärker gefüllt mit normaler i.S.v. menschlich-adäquater Kommunikation. Der Schutzaspekt, den Kliniken aus Unterschichtssicht bieten, ist nicht zu unterschätzen. „Psychiatrie als soziale und karitative Institution hat auch die Aufgabe, Raststätte, Herberge, Schutz- und Schonraum für die dessen wirklich Bedürftigen zu gewähren, Hospital zu sein“ (SCHARFETTER 1995, S.230 f; vgl. THOMAS 1986; vgl. WINDGASSEN 1989, S.135 f).
Um die babylonische Sprachverwirrung um den Begriff Schizophrenie andeutungsweise aufzuheben, macht sich neben den zwei oben erwähnten Annäherungsperspektiven an die Logik der Schizophrenie die Untersuchung der schizophrenen Symptomatik notwendig. Dabei kommt viel „Normalität“ zum Ausdruck, die einen Verständniszugang gewährt. Dies ist beabsichtigt, um eine Spaltung, nämlich die gesellschaftlich einteilende in krank-verrückt-schizophren und gesund-normal-angepaßt zu überbrücken. G.Huber zitiert in diesem Sinne: „Most of their lifes the schizophrenics are not schizophrenics“ (SURGULADSE 1994, S.1). Desweiteren soll klar dargestellt werden, daß nicht jede Handlung schizophrener PatientInnen als krank zu werten ist i.S.v. unentwegter Symptomsuche zur Bestätigung der unsicheren Diagnose, sondern daß gesunde i.S.v. übliche Verhaltensweisen, individuell leicht modifiziert, zur Auffälligkeit führen und nichts über einen Krankheitswert aussagen, jedoch viel über die Werte der Gesellschaft (vgl. KEUPP 1972, S.1 f).
3.2 Schizophrene Symptome
„Es gibt keinen Ausdruck und keine Haltung, die als typisch schizophren bezeichnet werden kann“ Klaus Dörner / Ursula Plog 1992
In diesem Kapitel werden einige typische schizophrene Symptome aufgeführt. Verknüpft wird diese Darstellung mit Äußerungen Psychoseerfahrener und ihrer reflektierten Sicht der Symptombedeutung. Ob die Aufzählung unvollständig oder überladen ist, hängt vom jeweiligen Krankheits- oder besser Störungs verständnis ab.
Um Überschneidungen zu vermeiden, bietet sich eine Viergliederung an, die nachstehend eingehalten wird: Was verliert die Person während ihrer akuten Störung? Was kommt neues dazu? Was ist metamorph verschoben? Was bleibt bestehen? Letztere, auf jeden Fall unvollständige, ist die wesentliche, wenn auch unauffällige Symptomatik, die Anknüpfungspunkte bietet zur - wenn notwendig - therapeutischen Intervention. An den gesunden Teilen kann angeknüpft werden, sie sind zu bestärken, zu fördern.
Allerdings steht die Behauptung im Raum, daß neben Umweltreaktionen auch Therapieversuche Krankheits- bzw. Störungsverläufe negativ verstärken können (vgl. JERVIS 1978, S.388). Dem kann hier nicht nachgegangen werden.
Problematisch bleibt bei der folgenden Einteilung immer noch der Maßstab des Normalen, hier abgeleitet vom Sein der Person vor der akuten Phase. Zur Rechtfertigung mag bedacht werden, daß dies ein jeweils individueller Maßstab ist, der wenig Raum für Fremddefinition und Zuschreibung läßt. Die Einteilung erfolgt ohne Bezug auf d.V. vorliegende Kategorisierungen und stellt eine übergeordnete Zusammenfassung der in unterschiedlicher Literatur einzeln beschriebenen Symptomatik dar. Die folgend benannte Vielzahl der Symptome tritt selten komplex auf. Verlust und Gewinn sind u.U. ambivalent.
3.2.1 Verlust
„Was gibt es Unterdrückerischeres, Entautonomisierenderes als die Irrenanstalt?“ Giovanni Jervis 1978
Verlust (Regression), Aufgabe und Nichterwerb (Infantilität) werden hier gleich behandelt und nicht ausdrücklich unterschieden. Es soll speziell auf das Erscheinungsbild, weniger auf den Verständnisprozeß eingegangen werden. Auch nicht darauf, ob ein Verlust auf einen mangelhaften Erwerb zurückzuführen ist. Die Kennzeichnung des Verlustes von Persönlichkeitsmerkmalen ist den Betroffenen nicht immer klar benennbar, mitunter überhaupt nicht als solche wahrnehmbar. Doch ist ein Zustand vorhanden, welcher dem/der Betroffenen und/oder anderen starkes Leid bereitet. Zu nennen sind Verluste von:
- Autonomie
- Schutzmechanismen zwischen Betroffenen und Umwelt
- zwischenmenschlichen Beziehungen / Vertrauen
- physischer und psychischer Reaktionsfähigkeit.
Während die ersten zwei Verlustkategorien mit Sicherheit und die dritte mit Wahrscheinlichkeit auf im weitesten Sinne äußeres ökologisches Fehlverhalten (Aktion) zurückführbar sind, beschreiben die Punkte 3 und 4 ein Verhalten zur erlebten Wirklichkeit (Reaktion).
Psychoseerfahrene betonen bezüglich des Verlustes der Reaktionsfähigkeit die aktive Abwehrabsicht als Selbstschutz bei gleichzeitiger innerer Anspannung und Aufnahmefähigkeit (vgl. BOCK u.a.1994, S.81 f).
3.2.2 Gewinn
„Meine fünf schizophrenen Schübe in den Jahren 1936, 1938, 43, 46 und der letzte 1959 gehören zu den eindrucksvollsten Erfahrungen meines Lebens.“ Dorothea Buck 1994
Unter Gewinn und Zuerwerb, auch ungewollt oder imaginär, werden Verhaltensweisen beschrieben, die auffällig weit über die bisherigen hinausgehen und die Betroffenen selbst verwirren, unsicher machen, durch Unverständnis der Umwelt isolieren. Dazu zählen:
- Angstbeimessung (auf verschiedene Subjekte oder Objekte projizierter Wahn)
- täuschende (?) Sinneswahrnehmung (akustische, selten optische Halluzinationen etc.)
- Selbstüberschätzung (Identifizierung mit Gott oder anderen meist toten Respektspersonen)
- unaussprechliche Gedankenfülle (Sprachstörung, Zerfahrenheit)
Exemplarisch sei auf die Punkte Selbstüberschätzung und Sinneswahrnehmung eingegangen. Aus Sicht von Psychoseerfahrenen wird betont: „Sich in eine berühmte Persönlichkeit zu versetzen, macht nicht nur mich größer, sondern auch die Berühmtheit kleiner. Das ist wichtig“ (BOCK u.a. 1994, S.79). Und: „Die eigenen Gedanken waren so laut, daß man sich in dem Moment selbst nicht vorstellen kann, sie kommen aus dem eigenen Kopf“ (ebd.).
3.2.3 Verschiebungen
„Psychotiker sagen uns, wie die Welt sein sollte. Sie sagen uns dies ohne Kompromisse: so etwas wie `ein bißchen gut’, `ein bißchen böse’ oder `gut genug’ gibt es nicht.“ Els van Dongen 1994
Hierzu gehört, was sich innerstrukturell bzw. in der Wahrnehmung verschiebt, verändert, was weder Verlust noch Gewinn, sondern eine andere Ebene darstellt, auf der bisheriges sich äußert und eine neue Qualität verkörpert. Verschiebungen finden statt innerhalb der:
- Ich-Identität, also
- Gefühle und
- Gedanken, sowie als Quintessenz davon
- Wertigkeiten.
Beispiel dafür sind „sich verselbständigende Wunschträume“ (BOCK u.a. 1994, S.78).
3.2.4 Erhalt
„Es ist wichtiger, die Fähigkeiten eines Patienten kennenzulernen als seine Unfähigkeiten!“ Klaus Dörner / Ursula Plog 1992
Neben den Veränderungen, den eigentlichen Symptomen, sei auf die Merkmale hingewiesen, die Bestand haben, normal i.S.v. üblich und üblich akzeptiert sind, im Klinikalltag jedoch häufig übersehen, quasi mit Nichtachtung gestraft werden. Wie sich dies auf die Symptomatik auswirkt, kann hier nicht näher untersucht werden.
Exkurs:
Herr X. hat, als er seine Kollegin in der Nervenklinik besuchte, auch viel mit den Krankenschwestern gesprochen. „Die armen Dinger, die können das ja gar nicht schaffen. Die sind so unterbesetzt, daß sie gar nicht dazu kommen, mit den Leuten mal richtig zu sprechen.“ Herr X. unterstellt, wie mir auffällt, allen Menschen, besonders Frauen, erst einmal grundsätzlich nur Gutes. Unterschätzt er im speziellen Fall nicht den verlockenden Reiz des Pausenraumes als Personalrückzugsort? Und weiß Herr X. nicht, wie gut man von sich selber ablenken kann, indem man auf andere und anderes schimpft? Und daß die Psychiatrie nicht nur für PatientInnen, sondern häufig auch für MitarbeiterInnen Abschiebeort ist? Kann ich ihm seine heile Welt zerstören? Nein, ich kann es nicht. Ich würde ihn damit zerstören.
Ausdrücklich erwähnt werden muß, daß die Intelligenz Schizophrener erhalten bleibt, damit verbunden i.d.R. auch die zeitliche und örtliche Orientierung (vgl. JERVIS 1978, S.388; NAVRATIL 1965, S.14). Die gedankliche Auseinandersetzung findet weiter statt, auch die mit den eingegebenen bzw. übertragenen Gedanken. Ebenso erhalten bleiben „ältere Regulationssysteme“ wie Kreativität und Kunst (vgl. NAVRATIL 1965, S.16; PRINZHORN 1994, S. 4 f; vgl. RIEDEL 1992, S.303 f ). Diese sind gleichsam Ausdruck des Selbstheilungswunsches und Selbsterhaltungstriebes, die den Betroffenen ein Mindestmaß an Kontakt, Betätigung, Bestätigung und Ausdruck ermöglichen.
Gleich welchen Sinn die Psychose letzten Endes im konkreten individuellen Zusammenhang macht: unter der Prämisse, daß sie Sinn macht, sind die auffälligen Symptome nicht „wegzubehandeln“, sondern als Äußerung von Schwachpunkten zur Kenntnis zu nehmen. Zugleich ist der Symptomatik entsprechend ein Zugang zu den PatientInnen zu suchen, der diesen deutlich erfahrbare, ehrliche Akzeptanz entgegenbringt und die Sensibilität der PatientInnen wertschätzt. Auffälligwerden und folgende Klinikeinweisung beruhen häufig auf Mißachtung dieser Empfindlichkeit bzw. Überforderung einzelner HelferInnen durch sie. Das Sicheinstellen auf die Sensibilität erleichtert Interaktion und damit Zugang sowie Förderung der erhaltenen Fähigkeiten.
Zusammenfassend: Ansatzpunkt jedweder Schizophrenietherapie, will sie sich nicht als Symptomgedokter verstehen im Sinne eines In-die-Flammen-statt-in-die-Glut-Spritzens, sind die gesunden, erhaltenen, im üblichen Maße strapazier- und förderbaren Anteile der PatientInnen; Ziel derselben ist die Stärkung des PatientInnen-Ich.
3.3 Rolle der Diagnose Schizophrenie in der therapeutischen Praxis
„Eine Diagnose erfaßt nie die Wirklichkeit eines Menschen; sie ist eine Leitidee und liefert ein Modell für die Beschreibung seiner psychisch-körperlich-sozialen Auffälligkeiten.“ Klaus Dörner / Ursula Plog 1992
Diagnose meint Erkennung und Bezeichnung einer Krankheit. Es wurde bereits festgestellt, daß die Zuordnung der Schizophrenie in die Kategorie Krankheit grundlegend nicht gesichert ist (vgl. Kapitel 3.1 Krankheitsansichten: Schizophrenie). Nach Dörner und Plog war die Bezeichnung Krankheit vor 100 Jahren ein Schutz für Menschen mit psychischen Problemen und sicherte ihnen eine bessere Behandlung und größere Freiräume (vgl. DÖRNER/PLOG 1992, S.34 u. S.469 ff). Die Naturwissenschaft Medizin zeigte Fortschritte, wurde dementsprechend gefördert, expandierte und okkupierte schließlich die Psychiatrie. Seitdem wurden die nunmehr PatientInnen von religiös-moralistisch-pädagogischen Torturen entlastet, die sie in der Anfangszeit durch geisteswissenschaftliche Philosophie zu erleiden hatten. Die Psychiatrie mußte sich, nun der Medizin zugeordnet, dementsprechend anpassen. Salopp gesagt: das Kind brauchte jetzt einen Namen. Die Diagnose wurde geboren: Dementia praecox, später umgetauft in Schizophrenie(n). Die medizinisch-organische, die psychiatrische Behandlung hat den offensichtlichen Nachteil der Vernachlässigung seelisch-geistiger Inhalte. Psychiatrische Diagnosen beschreiben aber keine organischen Defekte, sondern definieren Zustände als krank.
Die sozialen Folgen der Diagnose im allgemeinen und die Folgen der Diagnose Schizophrenie für die Therapie im speziellen werden nachfolgend vertieft.
3.3.1 Diagnose als Etikettierung
„Das Individuum übernimmt die ihm zugeschriebene Rolle. Dabei scheint es unwichtig zu sein, ob die Bewertung von Interaktionspartnern vorgenommen wird, die ihn bestrafen oder solchen, die ihn resozialisieren möchten.“ F. Tannenbaum 1938
Vorab einige allgemeine Bemerkungen zur Diagnose. Die Diagnose macht bei körperlichen Gebrechen grundsätzlich Sinn und vereinfacht sowohl Kommunikation als auch Behandlung. Eine Diagnose in diesem Rahmen wird keinen Einfluß haben auf die bestehende Person-Umwelt-Wechselbeziehung, da sie i.d.R. als vorübergehend verstanden wird. Das unterscheidet die Diagnose bei rein somatischen von der bei psychischen Störungen: Die Umwelt wird auf die Person mit einer geänderten Erwartungshaltung reagieren, ebenso daraufhin die Person auf ihre Umwelt. Selbst wenn die Person es schaffen sollte, weiterhin wie vor der Psychose zu leben, so wird dieses Verhalten von der Umwelt nun als krankhaftes gedeutet.
Exkurs:
Herr X. und ich sind uns, besonders seit dem letzten Abend bei ihm, richtig vertraut geworden. Herr X. erzählt von B., seiner Heimatstadt, und seinen früheren Kollegen. Die waren immer ganz baff, wenn er mit gebügeltem Hemd auf Arbeit kam - wo er doch allein seinen Haushalt schmiß. „Was dann kam, habe ich hier noch niemandem gesagt.“ Er zögerte, fixierte mich mit einem zugeworfenen Blick. Nach kurzem Zögern weiter: „Ich war dann in der Psychiatrie. Davon vielleicht später mehr.“ Schweres Atmen. „ Als ich wieder raus war, haben die mich wie den ersten Menschen angeguckt und auch so behandelt.“ Am schlimmsten waren für ihn das hämische Grinsen und die dummen Sprüche. `Wer seine Hemden selber bügelt, bei dem muß ja ´ne Schraube locker sein!’ Dies und ähnliches habe er häufig über sich ergehen lassen müssen. Lange hat er das nicht ausgehalten. „Kurzerhand habe ich meinen Krempel gepackt und bin hierher nach C. gezogen.“ Ihm Stillschweigen über eben Erfahrenes zu versprechen, war überflüssig. Unsere Blicke verstanden sich. (Dem Abdruck in anonymisierter Form stimmte Herr X. zu.) Jetzt wurde mir auch dessen Sympathie für seine Kollegin klar und warum er sie in der Klinik besucht hat.
Diagnosen im psychiatrischen Bereich werden zu Etikettierungen, die Kettenreaktionen auf beiden Seiten auslösen: die Umwelt setzt situativ abweichendes Verhalten mit der entsprechenden Person gleich, was deren als normal geltenden Handlungsspielraum einengt, in dem Falle durch die Interpretation allen Verhaltens als Anzeichen der Geisteskrankheit. Ausweg ist nur, der Etikettierung durch Anpassung völlig zu entsprechen in Wort, Tat und Selbstdefinition (vgl. LAMNEK 1993, S.216 ff; MAAßEN 1995, S.25). Nach Dörner hat die psychiatrische Diagnose ausschließlich „eine Ordnungsfunktion für die Gesellschaft und für das jeweilige konkrete soziale System eines Individuums“ (DÖRNER 1975, S.144). Die Ordnungsfunktion impliziert Einordnungspflicht. So kommt auch der Diagnose der Charakter einer „self-fulfilling prophecy“ zu, in deren Verlauf sich das Verhalten der Diagnostizierten solange ändert, beeinflußt durch das der Diagnostizierenden, bis es dem Erscheinungsbild der Diagnose entspricht (vgl. ebd., S.145; LAMNEK 1993, S.218).
3.3.2 Diagnose als Therapieansatz
„Fast immer wird die akute schizophrene Psychose lediglich als Zustand der Desintegration ohne innere Ordnung, ohne therapeutisches Potential und ohne Möglichkeiten für einen psychotherapeutischen Umgang verstanden.“ Volkmar Aderhold 1994
Der Beitrag, den die Diagnose zu oben genanntem Mißstand leistet, ist - auf diesbezüglich bestehende Unklarheiten wurde bereits mehrfach eingegangen - nicht zu unterschätzen. Die Fixierung auf eine ausschließlich krankheitsorientierte Sichtweise verstellt den Blick auf die gesunden i.S.v. ungestörten Anteile, bei denen es anzusetzen gilt. Welche Therapien angewandt werden und mit welchem Erfolg und worin das Spezifikum der Kunsttherapie besteht, das wird im folgenden ausführlich betrachtet.
Bei Miteinbeziehung der gesungen Anteile in die Zustandsbeschreibung der Störung kommen einige Therapien als sich sinnvoll anbietende in die engere Wahl. Dabei spielt für die anzuwendende Therapieart das konkrete Krankheits- bzw. Störungsverständnis eine Rolle. Wird Schizophrenie als Spaltung verstanden, ist eine Grenzaufhebung das Ziel; wird sie als verschwimmende Auflösung verstanden, ist auf eine Grenzziehung hinzuwirken. Zweifelsohne kann jeder Ansatz mit Erfolgsmeldungen aufwarten.
Exkurs:
Eine von Herrn X.’ Redewendungen ist: „Trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.“ Herr X. weiß, wovon er spricht. Er kommt aus der Werbebranche.
Zu vertiefen wäre die naheliegende Vermutung, daß es gar nicht darauf ankommt, welche spezifische (kunst-)therapeutische Methode angewandt wird, sondern daß der Schwerpunkt darin liegt, eine Methode klar und konsequent anzuwenden. Welche Bedeutung einer solchen Hintergrundidee wirklich zukommt, kann hier nicht ausführlich erläutert werden, da dies d.V. nicht vorliegende Untersuchungen voraussetzte.
Beschrieben wurden der Erhalt der Intelligenz sowie der kreativ-künstlerischer Fähig- und Fertigkeiten. Berücksichtigt werden muß die Kontaktarmut bzw. -sperre. Klares, eindeutiges Verhalten der TherapeutInnen den Betroffenen gegenüber beinhaltet die größte Chance, von diesen erwidert zu werden durch Beziehungsaufnahme (vgl. DÖRNER/PLOG 1992, S.161 f). Wenn die TherapeutInnen sich dann noch einstellen können auf die Symptomatik als symbolische Bedeutung, „so wird die schizophrene Symptomatik von vornherein in ein interaktionell, gesellschaftlich und kulturell vorgeprägtes Kommunikations- und Tätigkeitsfeld gerückt, in welchem sie eine Botschaft darstellt und auch einen potentiellen Adressaten hat“ (WULFF 1994, S.2).
Davon ausgehend, daß Symptome nonverbale Formulierungen sind (vgl. SCHARFETTER 1995, S.231 f), liegt es nahe, auch nonverbale Therapien anzuwenden; mit z.B. kreativen - den Körper oder künstlerische Gestaltung betreffenden - Therapien den Zugang zu den Patien-tInnen anzustreben (vgl. WULFF 1994, S.10). Und noch einmal der wahrlich nicht kunsttherapeutisch fixierte Jervis: „Der Wahn als Interpretation der Welt entsteht in dem Moment, wo die betreffende Person Botschaften, Symbole, einen Schlüssel sucht, womit sie sich selbst und die Welt erklären kann“ (JERVIS 1978, S.268). Bei so verstandener Schizophrenie - Jervis verwendet Wahn und Schizophrenie nahezu deckungsgleich - wird die Diagnose bzw. deren Inhalt zur gemeinsam zu entschlüsselnden Botschaft, die es aufzuschließen gilt. Der kunsttherapeutische Versuch als einer der daraus resultierend möglichen wird in den Kapiteln 4 (Kunsttherapie mit Schizophrenen) umfangreich beschrieben.
Ausdrücklich betont werden muß, daß solcherart Herangehens- und Verstehensweise der Diagnose die Ausnahme, nicht die Regel ist. In der üblichen psychiatrischen Praxis sagt die Diagnose kaum etwas über die anzuwendenden Therapien aus. Dörner schreibt, sich auf eine Untersuchung von Bannister u.a. an 1.000 PatientInnen beziehend, „daß je nach der Zahl der diagnostischen Kategorien die Diagnosen nur in 18-33% der Fälle richtige Voraussagen für die Wahl der geeigneten Therapie erlaubten“ (DÖRNER 1975, S.141). Mit anderen Worten: Daß ein „Symptom Bedeutung für andere hat, bleibt meist dunkel, geht in die wahrnehmungs- und verhaltensbestimmende Diagnose nicht mit ein“ (ebd., S.146). Das psychiatrische Diagnostizieren, soweit es dem medizinischen Konzept folgt, ist „nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch unpraktisch, antipraktisch, antitherapeutisch“ (ebd., S.147).
Dörners Hoffnung, die psychiatrisch Tätigen mögen ohne den Schutz des medizinischen Diagnostizierens mit den PatientInnen zusammenarbeiten, hat sich in den vergangenen 20 Jahren nicht erfüllt. Das widerum ist kein Beleg für die Unrealisierbarkeit der Hoffnung, vielmehr ein Anlaß zu verstärkter Suche nach Ansätzen - beispielsweise in der Kunsttherapie. Die pragmatische Variante dazu ist die Suche nach einem neuen Umgang mit der Diagnose. Daran gekoppelt ist die Reflexion der therapeutischen Arbeit und die daraus resultierende Erkenntnis: „Die Haltung der Therapeuten zum Menschen, zum Lebendigen überhaupt, seine Krankheits- Gesundheits- und Normenvorstellungen bestimmen seine Arbeit mit den Kranken“ (SCHARFETTER 1995, S.229). Die subjektiven Anteile der TherapeutInnen bilden das Pendant zu den objektiv wirkenden Labeling-Prozessen, stellen aber keine Entweder-oder-Kategorien dar, sondern verdienen umfassende dialektische Betrachtung.
3.4 Rolle der KunsttherapeutInnen in der Arbeit mit Schizophrenen
„Der Therapeut beeinflußt mit seinen inneren Bildern und Erwartungen unbewußt den bildnerischen Prozeß des Patienten und dessen Ergebnisse.“ Gertraud Schottenloher 1990
Prinzipiell ist klarzustellen, daß es die Rolle der KunsttherapeutInnen nicht gibt, eher nehmen sie eine komplexe „Rollenkonfusionsrolle“ ein. KunsttherapeutInnen haben Drahtseilakt, Spagat und Kopfstand gleichzeitig auszuführen. Sie:
· suchen Auswege aus der totalen Institution Psychiatrie, sind aber ÄrztInnen unterstellt
· sind, besonders wenn sie „aus der Kunst“ kommen, materiell angewiesen auf finanzielle Zuwendungen der Klinik
- wollen die therapeutische Landschaft bereichern, verdrängen aber u.U. andere therapeutische MitarbeiterInnen, da der Klinikhaushalt nicht alles gleichzeitig zuläßt und eine Kassenan-erkennung aussteht
- wollen PatientInnen i.d.R. nichttherapeutisch begegnen und dadurch eine normale Beziehung schaffen, müssen aber, um im Team anerkannt zu werden, medizinisches Wissen und daraus abgeleitete praktische Ansätze vorweisen und anwenden
- sind aus Selbsterfahrung überzeugt von ihrer Therapie (Praxeologie: Kunst ist Therapie), haben aber keine überzeugende Theorie dazu
- wollen sich ganz den PatientInnen widmen, müssen aber zugleich die MitarbeiterInnen mit kreativen Ideen zu infizieren versuchen, soll die Kunsttherapie nicht eine Insel bleiben im weißgrau-sterilen Klinikalltag und von diesem immer wieder überflutet werden
- haben als Neulinge ihre Existenzberechtigung gegenüber KritikerInnen zu behaupten, was weder per Statistik, noch per Emotion überzeugend gelingen dürfte.
Vom allgemeinen zum speziellen: Klarer läßt sich die Rolle der KunsttherapeutInnen in der konkreten Arbeit mit Schizophrenen festmachen. Weder die PatientInnen-Bild-Beziehung, noch die TherapeutInnen-Bild-Beziehung sind - wie bedeutend auch immer - das wichtigste. Hauptbeziehung ist und bleibt die zwischen PatientInnen und KunsttherapeutInnen (vgl. MAHLSTAEDT-HECKE/ FREYWALD 1994, S.3). Und bestimmt wird die Beziehung entscheidend von den KunsttherapeutInnen. Wäre dem nicht so, bedürfte es ihrer nicht. Für die Beziehung bedeutsame Kriterien werden nachfolgend aufgeführt.
Wenn die These stimmt, daß sich Schizophrenie „mit einer gewissen Souveränität dem Morbusmodell und damit dem ... therapeutischen Beherrschtwerden“ (SCHARFETTER 1995, S.XVII) entzieht, dann haben KunsttherapeutInnen durch das Medium Kunst eher als andere TherapeutInnen die Chance, sich dem zu beugen. Denn einerseits sind die Ausdrucksformen des Unbewußten im kunsttherapeutischen Prozeß unbeherrschbar (vgl. SCHOTTENLOHER 1990, S.33 ff), andererseits ist Kunst generell eine nicht eingrenzbare und damit unbeherrschbare Dimension. KunsttherapeutInnen kommt also nicht die Funktion zu, etwas anzuwenden (Therapie), sondern hauptsächlich haben sie etwas anzubieten:
- Material (Farben, Kreiden, Tusche, Papier, Pinsel u.v.a.m.), mit dem die PatientInnen tun können, was sie wollen
- kreative, künstlerische Techniken, die die PatientInnen wählen können, wenn sie wollen
- primär künstlerische Perspektiven, welche es den PatientInnen ermöglichen, sich zu äußern, wie sie wollen
- Raum, in dem die PatientInnen den Platz finden, den sie wollen.
All dies sind Voraussetzungen, welche die PatientInnen bzw. im folgenden Zitat den Patienten bestärken und fördern im „Ringen um sein Selbstsein, um sein Ich“, was als Kernpunkt, gleichsam als Spiegel der Schizophrenie beschrieben wird (vgl. SCHARFETTER 1995, S.XIX). Nur die Rolle der KunsttherapeutInnen als AnbieterInnen wird der Situation gerecht, denn „schizophrene Menschen haben keine größere schöpferische Begabung als nicht-schizophrene“ (ebd., S.107). Diese Tatsache anzuerkennen, bewahrt KunsttherapeutInnen vor übersteigerten Universalerwartungen, die sich auf die PatientInnen übertragen und Blockaden auslösen würden. Auch der Anspruch, es müsse wirkliche i.S.v. handwerklich-klassische Kunst entstehen, verkehrt die Chancen der KunsttherapeutInnen und hätte seitens der PatientInnen nicht Freiraum, sondern Druck; nicht Lust, sondern Frust; nicht Eigenmotivation, sondern rückzugsimmanente Fremdbestimmung zur Folge. Daß sich auch unbewußte Vorgaben und Beschränkungen im künstlerisch-kreativen Prozeß übertragen, schildert Gertraud Schottenloher beispielhaft nachdrücklich (vgl. SCHOTTENLOHER 1990, S.33 ff) und fordert kontinuierliche Supervision, um derartige Übertragungen auf ein Minimum zu reduzieren.
Da den KunsttherapeutInnen eine so große Verantwortung zukommt, erweitern sich die oben aufgeführten Angebote um ein weiteres: die Person der KunsttherapeutInnen selbst und damit gleichbedeutend die Person-Person-Beziehung zwischen KunsttherapeutInnen und PatientInnen.
So werden aus den KunsttherapeutInnen - um deren Rolle zusammenfassend zu beschreiben - Personen, die sich anbieten und die etwas zu bieten haben.
Wie in Kapitel 3.2.4 (Erhalt) beschrieben, sind bei Schizophrenen Intelligenz und Orientierung sowie kreativ-künstlerische Ausdrucksfähigkeit nicht gemindert. Die Voraussetzungen der PatientInnen und die Angebote der KunsttherapeutInnen gehen folglich konform.
Abschließend seien noch Aspekte genannt, welche die o.g. Rolle der KunsttherapeutInnen gefährden (vgl. SCHARFETTER 1995, S.231). Vermeiden sollten die KunsttherapeutInnen:
- narzißtische Tendenzen der Aufblähung zu GesundmacherInnen
- Verwirrung der PatientInnen durch metapsychologische Theorien
- Mißbrauch der kreativen Äußerungen der PatientInnen für ihre eigene künstlerische Arbeit (Ideenklau)
- das Bestärken der PatientInnen in ihrer Opferperspektive
- eine abstrakte Objekt-Sicht auf die PatientInnen
- die Übernahme und Anwendung patriarchaler und anderer rigider Strukturen in den therapeutischen Prozeß
- das Gesunde bzw. das Zerbrechliche am Schizophrenen zu vergessen
4. Kunsttherapie mit Schizophrenen
„Schizophrene Patienten sind durch ihren erhöhten Gestaltungsdrang dagegen (im Gegensatz zu depressiven PatientInnen - d.V.) leichter für eine Kunsttherapie zu gewinnen.“ Martin Schuster 1993
Einleitend muß klargestellt werden, daß bedeutende Kunsttherapie-TheoretikerInnen trotz umfangreicher Eigenpublikationen und herausgeberischer Vielfalt konkrete Ansätze bezüglich des Einsatzes bei speziellen Störungen aussparen und damit an praktischer Relevanz ihrer Theorien in starkem Maße missen lassen. Werden praktische Durchführhinweise gegeben, fehlen oft spezielle Anwendungsgebiete. Immer wieder tauchen in einschlägiger Literatur Fallbeispiele der kunsttherapeutischen Praxis auf. Doch läßt auch ein Vergleich dieser Einzelstudien kein induktives Vorgehen zu; verschiedene Ansätze (vgl. Kapitel 2.2 Streit um den Begriff Kunsttherapie) machen dies unmöglich. Zusammenfassen läßt sich die Problematik mit dem Zitat: „Viele Therapieversuche (Kunsttherapieversuche - d.V.) sind gar nicht auf ein spezielles Symptom gerichtet, so daß eine nachfolgende Bewertung des Therapieerfolges subjektiv und willkürlich sein muß“ (SCHUSTER 1993, S.162). Um bei dieser Einschätzung nicht stehenzubleiben - und da sich der Grund der Klage, daß es keine symptomspezifischen Studien gibt, nicht ändert, wenn man nur klagt - werden in den folgenden Kapiteln spezifische Techniken kunsttherapeutischer Schizophreniebehandlung dargestellt. Die Auswahl bleibt zugegebenermaßen dürftig. Scheinbare Widersprüchlichkeit ergibt sich aus den verschiedenen kunsttherapeutischen Ansätzen, die jeweils genannt werden. Weiterhin werden Bildwerke Schizophrener nach ausgewählten Kriterien untersucht und die Besonderheit der Kunsttherapie im Vergleich zu anderen bei Schizophrenen angewandten Therapien erläutert. Diese Untersuchungen ermöglichen es, relevante Aspekte der Kunsttherapie zu benennen.
4.1 Spezifische Ansätze und Techniken
„GRUNDSÄTZLICH BESTIMMT DER PATIENT (natürlich nicht willentlich und rational, sondern) DURCH SEIN ERLEBEN UND VERHALTEN, WAS FÜR IHN THERAPIE IST, WAS ER THERAPEUTISCH AM DRINGLICHSTEN BRAUCHT.“ Christian Scharfetter 1995
Dem einleitenden Zitat folgend liegt es nahe, auf eine allgemeine Aufzählung der bei Schizophrenen einzusetzenden bzw. anzubietenden Techniken zu verzichten. Doch ist diese Feststellung nicht absolut zu sehen, sondern ebenso verstehbar als Herausforderung für KunsttherapeutInnen, eine breite Palette fester Angebote zur Auswahl zu haben und anzubieten. Die Wahlmöglichkeit erlaubt einerseits den PatientInnen eine Entscheidung, insofern sie psychisch in der Lage sind zu wählen, andererseits können die KunsttherapeutInnen die aus ihrer Sicht geeignetste Technik den PatientInnen anbieten. Zum Erstellen dieser Palette werden in loser Folge Ansätze und Techniken erläutert, die speziell bei Schizophrenen angewandt wurden und positive therapeutische Ergebnisse brachten. Daß die von KunsttherapeutInnen beschriebenen „Fallberichte kein Beweis für die Wirksamkeit des therapeutischen Handelns sein“ können (SCHUSTER 1993, S.162) und „eine Besserung der Symptomatik von einem völligen Verschwinden des Symptoms grundsätzlich unterschieden werden“ muß, hat als Parameter für die weitere wissenschaftliche Forschung zu gelten und kennzeichnet die nachfolgend dargestellten Ansätze als vage. Denn: „Nur bei einem Verschwinden des Symptoms kann ein Zugriff auf die Ursachen des Symptoms vermutet werden“ (ebd., S.161 f). Diese klare Positition gleicht der Nadel im Heuhaufen - die übergroße Zahl der KunsttherapeutInnen scheint es mit der Philosophie des „Kleine-Brötchen-backens“ zu halten und sich über Erfölgchen zu freuen. Mehr vermag diese Arbeit nicht zu leisten, als das bisher zum Thema „Kunsttherapie-Schizophrenie“ Publizierte zusammenzufassen.
Ehe unterschieden wird in die kunsttherapeutischen Varianten klinischer und tagesklinischer Gruppentherapie sowie der Einzeltherapie (vgl. LANDGARTEN 1990, S.275 ff), seien zugrundeliegende gemeinsame Thesen genannt, die auf Ingrid Riedels „Stichworten für die Praxis“ basieren (vgl. RIEDEL 1992, S.301 ff): Schizophrene bedürfen einer besonders behutsamen Heranführung an das Malen. Der Chance, abgespaltene Teile darzustellen und auf das Blatt zu bannen, steht die angstabwehrende Notwendigkeit gegenüber, bestimmte Teile abzuspalten. Dem inkohärenten Ich schizophrener PatientInnen wird in bildnerischem Tun Gestaltung, Strukturierung und Kohärenz ermöglicht, was durch Gespräche zwischen PatientIn und Gruppe und/oder TherapeutIn noch verstärkt werden kann.
Obige Unterteilung nach Landgarten wurde gewählt, weil sie die grundlegenden Bereiche psychiatrischer Kunsttherapie - Klinik und Tagesklinik - beinhaltet sowie auf Besonderheiten von Gruppen- und Einzeltherapie hinweist. „Das Wesen der Kunsttherapie legt eine Gruppenarbeit von vorneherein nahe. Viele Gruppen sind jedoch aus Patienten zusammengesetzt, deren krasse Funktionsstörungen ihre Interaktionsfähigkeit behindern“ (LANDGARTEN 1990, S.277). Dieser Umstand läßt eine Individualtherapie innerhalb der Gruppe oder eine Einzeltherapie ergebnisreicher erscheinen.
Natürlich lassen sich mitunter auch Techniken der klinischen Gruppentherapie in der tagesklinischen anwenden, und umgekehrt.
4.1.1 Klinische Gruppentherapie
„Zunächst zählen dazu alle Maßnahmen, die, mittels eines gemeinsamen bildnerischen oder plastischen Gestaltungsprozesses, Patienten in die Lage versetzen sollen, sich in sozialen Zusammenhängen zu erleben und entsprechende Fähigkeiten zur befriedigenden Kommunikation und Interaktion in der Gruppe zu erwerben. Auf diese Weise kann u.a. auch der Chronifizierung schizophrener Erkrankungen und einem damit einhergehenden sozialen Rückzug begegnet werden.“ Wolfgang Domma 1990
Aufgrund großer Differenzen bezüglich der Dauer des Klinikaufenthaltes entstehen keine festen Gruppen. Die PatientInnen sind häufiger akut psychotisch. Beidem gilt es, in der klinischen Gruppentherapie Rechnung zu tragen. Die Gruppenform bietet zusätzliche therapeutische Interaktionspotentiale, besonders bei Gruppen mit sehr verschiedenen Diagnosen (vgl. LANDGARTEN 1990, S.281). Bei ähnlichen Symptomen sollen Themen und Techniken die spezielle Störung betreffen (vgl. ebd.) Domma fordert generell die jeweilige Abklärung folgender Fragen am Einzelfall: Welche Materialien? Welche Gruppenform? Welche Arbeitsform? Wie lange? Wie oft? (vgl. DOMMA 1990, S.159). Im Therapieverlauf sei ein ständiger Ist-Soll-Vergleich angezeigt (vgl. ebd., S. 160 ff).
Als Einstiegsübung empfiehlt die Kunstpsychotherapeutin (vgl. Kapitel 2.2.4) Helen B. Landgarten (vgl. LANDGARTEN 1990, S.282 ff) die Collagetechnik und wendet sie selbst folgendermaßen an: Die PatientInnen erhalten Fotos aus Zeitschriften mit dem Hinweis, drei Bilder, die gefallen, auszusuchen, diese auszuschneiden, auf Papier zu kleben und ein paar Worte unter jedes Bild zu schreiben. Beendet wird die Übung, indem sich die PatientInnen ihre Collagen zeigen und - nach Wunsch - kommentieren. Zeitschriftenbilder werden - da sie etwas „Nicht-Eigenes“ sind - als abstandschaffend beschrieben; Ausschneiden und Aufkleben als haltgebend, als langsamen Zugang zum schöpferischen Prozeß. Eine andere Möglichkeit, besonders für PatientInnen mit besonders minimierter Ich-Stärke und großem Widerstand gegenüber kreativem Gestalten, ist es, auf das Zeichenpapier z.B. eine Hand zu fotokopieren, die als Ausgangsfigur zeichnerisch ergänzt oder verändert werden kann (vgl. ebd., S.294). Als weiterführende Technik beschreibt Landgarten das den Realitätssinn schärfende thematische Zeichnen, z.B. unter der Aufgabenstellung, die PatientInnen mögen sich im Krankenhaus malen. Der Gruppendynamik wegen hält sie es für angezeigt, feste Themen vorzugeben, die je nach individueller Stimmung sachlich-konkret oder metaphorisch-abstrakt umgesetzt werden können. Die Gruppe sollte aus maximal sieben bis acht TeilnehmerInnen bestehen, besser aus vier bis fünf (vgl. SCHRODE 1995, S.42). Als kontraindiziert bezeichnet Landgarten die Scribble-Technik (Kritzel-) besonders zu Beginn einer neuen Kunsttherapiegruppe, da das Scribble keinen Halt biete und gleichzeitig die Phantasie noch mehr beflügele.
Als ungeeignete Techniken bezeichnen alle interviewten Kunsttherapeutinnen (s. Anhang) das Naß-in-Naß-Zeichnen bzw. Aquarellmalerei. Entweder sind die Erfahrungen damit negativ, oder das bestehende Schizophrenieverständnis läßt diese Verfahren bereits als kontraindiziert erscheinen. Gebräuchlich sind dagegen Techniken, die feste klare Formen ermöglichen. Somit verbietet sich auch das von Schottenloher als allgemein wirksam beschriebene Messpainting (vgl. Kapitel 2.2.2 Kunst als Therapie).
Wolfgang Domma, Vertreter der Therapie mit kreativen Elementen (vgl. Kapitel 2.2.3) setzt auf das schon beschriebene Nachzeichnen fester Formen als Möglichkeiten der Konzentration, Besinnung und Realitätsbewältigung (vgl. DOMMA 1990, S.118; Kapitel 2.1.3 Pädagogik und 2.2.2 Kunst als Therapie).
Einen besonderen Platz nehmen Kunstprojekte in der Psychiatrie ein. Innerhalb eines überschaubaren zeitlichen Rahmens findet ein den klinischen Ablauf ersetzender bzw. diesen auflockernder künstlerischer Prozeß statt, der meist mit einem Ergebnis, einer Ausstellung endet. Letzteres hat sekundäre Bedeutung. „Zusätzlich zur Bereitschaft, sich mit den eigenen Bildern zu konfrontieren, fordert und fördert dieses zielgerichtete Arbeiten auch ein bestimmtes Durchhaltevermögen, größere Belastbarkeit und eine mehr oder weniger überlegte Durchführung der schließlich entschiedenen Idee. Dazu kommt der Kontakt mit oft völlig ungewohntem Material und das Aushalten der Freiheit, selbst die eigene Phantasie zu leiten, also die eigenen Maßstäbe der Gestaltung zu entwickeln. Die kunsttherapeutische Intervention dabei besteht in bloßer unterstützender Begleitung“ (TITZE 1993, S.82). Bei der Durchführung können tagesklinische PatientInnen hinzukommen, was dem Projekt Begegnungs- und Verbindungsakzente zwischen „drinnen“ und „draußen“ verleiht.
4.1.2 Tagesklinische Gruppentherapie
„Schließlich ermöglicht die Gruppensituation die GEMEINSAME ARBEIT am gleichen Stück oder selben Thema, sei es IN SUBGRUPPEN ODER IN DER GESAMTGRUPPE.“ Erich Franzke 1983
Tagesklinik, Tagesstätte und ähnliche Institutionen werden in diesem Kapitel zusammengefaßt behandelt. Tagesklinische Gruppen sind dauerhafter als klinische. Hauptziele sind hier eher Alltagsbewältigung und Resozialisierung. „In der ambulanten Therapie ist ja immer zu berücksichtigen, daß die Schonfunktion der Klinik oder Abteilung wegfällt. Der Gestalter muß also zwischen den Treffen oder Stunden imstande bleiben, seine aktuellen Lebensaufgaben in ausreichender Weise zu bewältigen“ (FRANZKE 1983, S.184 f). Um die Kommunikation zu üben, bietet sich eine Aufteilung der Gruppe und gemeinsames Gestalten zu zweit, später zu dritt und zu viert an (vgl. LANDGARTEN 1990, S.301 f). Die PatientInnen haben größere Ich-Stärke, sie sind seltener akut (vgl. ebd, S.278). Gute Erfahrungen machte Petra Schulze (vgl. Anhang) mit projektartigen Angeboten. Sechs bis acht Sitzungen finden pro angebotenem Thema bzw. pro angebotener Technik statt. Die PatientInnen schreiben sich selbständig ein. Freiwilligkeit regt Motivation und Selbstdisziplin an.
Der dem „Kunst als Therapie“-Ansatz (vgl. Kapitel 2.2.2) nahestehende Paul Schwer betont die Bedeutung des gemeinsamen künstlerischen Arbeitens von PatientInnen und TherapeutInnen. Seiner Erfahrung nach können PatientInnen, die ihr Blatt einfarbig anmalen, zur Formgebung angeregt werden, indem die TherapeutInnen gleichfalls ein Blatt monochrom einstreichen. Diese Spiegelung duch die TherapeutInnen signalisiert den PatientInnen Anerkennung ihres bisherigen Ausdrucks sowie eine bildlich-symbolische Identifizierung zwischen TherapeutIn und PatientIn. Dieses Verfahren ist nonverbal und hauptsächlich künstlerisch-gestalterisch orientiert. Die PatientInnen gestalten völlig frei. Gruppeninteraktionen werden nicht bewußt angeregt, sondern entstehen von selbst. Hauptziel ist der „Anstoß schöpferischer Prozesse“ (SCHWER 1994, S.1). Menzen beschreibt eine Form des gemeinsamen Malens, bei dem KünstlerInnen mit PatientInnen „deren Nach-hause-Weg, den Grundriß ihrer Häuser, ihre alltäglichen Wegstrecken“ male. Denn dabei „werden Lebensverhältnisse in der Beuys’schen Art abgebildet, reflektiert - und wieder verfügbar gemacht“ (MENZEN 1994, S.49). Landgarten setzt besonders auf einfache Collagetechniken und Gestaltung von Objekten, z.B. großen festen Kartons. Zum Abreagieren starker Aggressionen steht Ton bereit.
Die Kunstpsychotherapeutin (vgl. Kapitel 2.2.4) Helena Schrode setzt bei größerer Belastbarkeit der PatientInnen auf Gruppenbilder. Entweder gestalten die PatientInnen jeweils einen fest bezeichneten Teil des Bildes, oder sie malen miteinander und durcheinander. Bei ersterem steht das Eigene im Vordergrund, bei letzterem das Gemeinsame (vgl. SCHRODE 1995, S.180 f).
Exkurs:
U. X. und ich sind schon lange per „Du“ und richtige Kumpels geworden. Aus verläßlicher Quelle ist U. X. zu Ohren gekommen, daß ein schizophrener Kunststudent durch die Aufgabenstellung, ein Selbstportrait anzufertigen, derart unter Druck geriet, daß er sich strangulierte. „Ich weiß nun nicht, ob daß an der Hochschule oder in der Klinik passiert ist.“ Aber daß es passiert sei, dafür lege er seine Hand ins Feuer. Ich bat ihn, sich noch mal genau zu erkundigen. Denn wenn es in der Klinik passiert ist, gehörte dann nicht die Kunsttherapie ein für allemal abgeschafft? U. X. weiß aus eigener Erfahrung, wie viele Pfuscher am Werk sind. Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht.
Bei derartigen Gesprächen entstand unser erstes gemeinsam gemaltes Bild „Bunter Abend“. Es hat natürlich viele Mängel, gestalterisch und so. Um so einiger sind wir uns, den Versuch zu wiederholen.
Wird in einem separaten Atelier gemalt und primär auf das Therapeutikum Kunst gesetzt, wie z.B. im Blaumeier Atelier (vgl. EISENBEISS/RÖMER 1994), Maske Blauhaus in Tinaia (vgl. STANGE 1994) oder UNART (vgl. SCHWER 1994), so erübrigt sich nachfolgende Einteilung der Einzeltherapie durch das entsprechend „andere“ Milieu. Mit dem Hinweis auf das Atelier ist zugleich die Bedeutung des Raumes angesprochen, der - je nachdem, ob er beklemmend oder befreiend wirkt - auf den Verlauf des künstlerischen und kunsttherapeutischen Prozesses wesentlichen Einfluß nimmt (vgl. FRANZKE 1983, S.249).
4.1.3 Einzeltherapie
„Eine weitere Möglichkeit besteht im Angebot,GLEICHZEITIG MIT DEM PATIENTEN ODER auch MIT IHM ZUSAMMEN GESTALTERISCH ZU ARBEITEN. Die gleichzeitige Beschäftigung bringt den Patienten weniger ausgeprägt in die Situation, beobachtet zu werden, läßt auch keinen Zweifel darüber, daß der Therapeut diese Art des Vorgehens wirklich ernst nimmt.“ Erich Franzke 1983
Landgarten hält speziell zu Beginn der Behandlung Schizophrener „eine Einzeltherapie (für) zweckmäßig“ (LANDGARTEN 1990, S.298). Das deckt sich mit der Ansicht Dommas, der von einer „stufenweisen Steigerung von Einzel- zur Gruppenarbeit“ spricht (DOMMA 1990, S.49, S.178 ff).
Prinzipiell steht bei der Einzeltherapie die Therapie im Vordergrund. Die Gestaltungen der PatientInnen werden meist ergänzt durch Gestaltungen der TherapeutInnen.
Gaetano Benedetti und Maurizio Peciccia, Psychiater und Kunstpsychotherapeuten (vgl. Kapitel 2.2.4), verfolgen die Idee des „progressiven therapeutischen Bildes“ bzw. Spiegelbildes (BENEDETTI/PECICCIA 1991, S.317ff; vgl. PECICCIA/BENEDETTI 1994, S.91ff; BENEDETTI/PECICCIA 1994, S.107 ff; SCHOTTENLOHER <II>1994, S.95 ff; DOMMA 1990, S.157 f). Bei dieser Technik zeichnet der/die TherapeutIn das PatientInnenbild mittels Transparentpapier nach und verändert es gegebenenfalls. Einfaches Nachzeichnen des Bildes bestätigt den/die PatientIn und regt an zum Weiterzeichnen, wozu wiederum das TherapeutInnenbild kopiert und verändert wird. Verändert der/die TherapeutIn das Bild, so muß ein Zweck dahinterstehen, z.B. eine Überbrückung dargestellter Gegensätze, Schluchten, Risse, Gräben etc. Durch das Nachzeichnen bzw.
Durchpausen entsteht eine lange Bilderfolge, die den Prozeß dokumentiert. Peciccia und Benedetti beobachteten zwei Ergebnisse. „Erstens haben alle sechs schizophrenen Patienten die Fähigkeit wiedererlernt, zunächst verbal mit dem Therapeuten und daraufhin auch mit dem sozialen Umfeld zu kommunizieren, und zweitens: Die Patienten bevorzugen anstelle der Bilder Worte, haben sie einmal die Sprache wiedergefunden. Die verbale Kommunikation mit dem Therapeuten stellte sich nach drei bis sechs Monaten ein und überwog dann in den ersten zwölf bis 18 Monaten der Therapie“ (PECICCIA/BENEDETTI 1994, S.91 f).
Die Kunstpsychotherapeutin (vgl. Kapitel 2.2.4) Helena Schrode vertritt die Technik des gleichzeitigen Malens auf jeweils dem eigenen Blatt. Dabei versucht sie, sich intuitiv „einzufühlen“ und gestaltet ihr Bild als Gegen- bzw. Ergänzungsentwurf zum Bild des/der PatientIn (vgl. SCHRODE 1995, S.143 ff). Die Gestaltung des/der Therapierenden soll den/die PatientIn nicht ablenken - ein Verfahren, das schon sehr viel Vertrauen in die eigene intuitive Einfühlungsfähigkeit voraussetzt.
Ingrid Riedel (Kunstpsychotherapeutin, vgl. Kapitel 2.2.4) beschreibt als Technik bei sich ankündigenden psychotischen Schüben das Aufeinander-zu-Malen. In der bildnerischen Begegnung verringere sich die Angst merklich (vgl. RIEDEL 1992, S.304).
Gertraud Schottenloher, dem „Kunst-als-Therapie“-Ansatz verpflichtet (vgl. Kapitel 2.2.2) erwähnt ein Beispiel erfolgreicher Krisenintervention bei einer Patientin in psychosenahem Zustand. Die Patientin malte frei ihre Bilder bei bloßer Anwesenheit der Kunsttherapeutin. Nach einem „Wutbild“, das Bühne und/oder Sarg darstellte, ging es der Patientin „wieder besser“. Auch der Malstil veränderte sich. „Anschließend verloren ihre Bilder den eigenwillig faszinierenden Stil; sie wurden weich und leicht kitschig, mit fast banalen Motiven, eine Beobachtung, die man oft machen kann, wenn jemand einen Schub hinter sich hat“ (SCHOTTENLOHER 1990, S.38).
Worin dieser „eigenwillig faszinierende Stil“ besteht, dem wird in den folgenden Kapiteln nachgegangen.
4.2 Bildinhalte
„Die Phantastik, Unsinnigkeit, Inkohärenz, Stereotypie, Iteration usf. in ihren Bildwerken zwingt immer wieder dazu, gerade in den schizophrenen Produktionen eine noch unbenutzte Quelle psychiatrischer Erkenntnis zu sehen.“ Hans Prinzhorn 1922
Dieses Kapitel geht der Frage nach, was denn das Besondere an den Bildern Schizophrener ist; ob es das Besondere überhaupt gibt und - wenn ja - wie es sich beschreiben läßt. Nach Wolfgang Domma ist es „gerade der `Stil’ bildhafter Äußerungen, an dem sich Merkmale schizophrener Erkrankungen nachweisen lassen, an dem die Beschaffenheit und die Intensität der Verrückung affektlogischer Bezugssysteme u.U. abgelesen und erste therapeutische und prognostische Rückschlüsse gezogen werden können“ (DOMMA 1990, S.96). Doch beläßt es Domma bei der bloßen Feststellung, wobei er weder auf den Stil, noch auf die Rückschlüsse konkret eingeht. Verdient gemacht hat sich Hans Prinzhorn (1886-1933) durch Sammlung und systematischen Vergleich von über 5.000 Bildern „Geisteskranker“, meist Schizophrener, wobei er zehn Künstler und ihre Bildwerke detailliert beschreibt (vgl. PRINZHORN 1994). Prinzhorn unterscheidet sechs Ausdrucksformen bzw. „Gestaltungstendenzen“, die, verschieden gewichtig, in schizophrener Bildnerei deutlich werden (vgl. ebd., S.15 ff):
- Spieltrieb (Betätigungsdrang) (= objektfrei)
- Schmucktrieb (Umweltbereicherung) (//)
- Abbildetendenz (Nachahmungstrieb) (= objekthaft)
- Ordnungstendenz (Rhythmus und Regel) (//)
- Mitteilungsbedürfnis (//)
- Symbolbedürfnis (Bedeutsamkeit) (//).
Verallgemeinernd stellt er fest: „Jede Zwecksetzung ist dem Wesen der Gestaltung fremd ... Vielmehr suchen wir den Sinn alles Gestalteten eben in der Gestaltung selbst“ (vgl. ebd., S.15). Doch kann er nicht umhin, dem Symbol eine Ausnahme zuzugestehen: „Wo symbolische Bedeutung herrscht, wird das Werk Träger dieser Bedeutung und verliert seinen Selbstzweck“ (ebd., S.39). Auf Symbole wird in Kapitel 4.2.2 ( Symbole) näher eingegangen.
Ebenfalls Leo Navratil (geb. 1921) hat in starkem Maße Pionierarbeit geleistet im Bereich Kunsttherapie und Schizophrenie. Der Psychiater der Landes - Heil- und Pflegeanstalt Gugging (Niederösterreich) betreut seit Jahrzehnten schizophrene Künstler. Er arbeitete besonders „das eigentlich Schöpferische, die Gestaltungskraft“ (NAVRATIL 1966, S.137) Schizophrener heraus. „Die schöpferische Leistung dieser Kranken ist ein Krankheitssymptom und der zugrundeliegende Gestaltungsvorgang ein Krankheitsvorgang, genauer gesagt, ein Restitutionsversuch innerhalb des Krankheitsgeschehens“ (ebd. S.135). Der schizophrene Stil ist in nahezu allen Einzelheiten durch extreme Gegensätze gekennzeichnet“ (ebd., S.93).
Exemplarisch werden im folgenden Stilelemente und Symbole schizophrener Bilder beleuchtet. Außerdem wird der Frage nachgegangen, ob und inwieweit die Bilder diagnostische Relevanz besitzen. Auf eine Farbuntersuchung der Bilder Schizophrener wird hier verzichtet. Der Gründe dafür sind mehrere. Bei Bleistiftzeichnungen, die sehr häufig sind, entfällt diese Untersuchung sowieso. Weiterhin ist Rot nicht gleich Rot - um Nuancen wird gestritten. Es existieren verschiedene Farbkreise und, damit zusammenhängend, verschiedene Farblehren, z.B. von Goethe, Runge, Delacroix, Van Gogh, Chevreul, Seurat, Delaunay, Betzold, Itten, Klee, Renner und Miescher (vgl. PAWLIK 1990).
Farbanalytische Publikationen mißachten diese Farblehren ebenso gröblich wie den Einfluß von Modeströmungen etc.. Interpretationen werden eher hergezerrt als hergeleitet und sehr beliebig nebeneinandergestellt (vgl. RIEDEL 1990 <a>). Seriöse Ausarbeitungen zu Farbuntersuchungen der Bilder Schizophrener liegen d.V. nicht vor. Riedels Hinweis, Schizophrene würden Gelb bevorzugen (vgl. ebd., S.77), kann hier getrost übergangen werden, da sich diese These lediglich auf die Untersuchung der Bilder zweier Künstler gründet und weitere Belege dafür fehlen.
4.2.1 Stilelemente
„Manierismen können unter Gesunden `Mode’ werden. Bei unseren Kranken sind Verschrobenheit und Manieriertheit jedoch niemals oberflächlich angenommene Gewohnheiten, sondern Symptome ihrer tiefgreifenden seelischen Erkrankung.“ Leo Navratil 1965
Grundlage der Aufzählung schizophrener Stilelemente in diesem Kapitel bildet Navratils Klassifikation (vgl. NAVRATIL 1966, S.55 ff). Als selbstverständlich wird davon ausgegangen, daß diese Elemente auch in den Bildern anderer Künstler zu beobachten sind, ja sogar eine eigene Kunstgattung bestimmen: den Manierismus (vgl. ebd., S.16 ff; vgl. HAUSER 1988, S.208 ff; vgl. HOCKE 1957). Nach Navratil herrschen bei Schizophrenen diese Stilelemente i.d.R. nur in akut psychotischen Stadien vor und verflüchtigen sich mit dem Abklingen der Symptome. Die Eigentümlichkeiten der Bilder Schizophrener werden im folgenden kurz dar-, und anschließend in Frage gestellt.
- Grenze und Kontur (vgl. NAVRATIL 1966, S.55 ff)
Konturen werden sowohl vernachlässigt als auch - besonders in der Restitutionsphase - überbetont, z. B. durch Mehrfachkonturen. Wenn Konturen vernachlässigt werden oder ganz fehlen, „ergießen“ sich die Details über das ganze Blatt. Andererseits gibt es Beispiele, bei denen (Körper-) Konturen vorherrschen ohne Details (z.B. Gesicht oder Kleidung etc.). Ebenfalls hierzu gehört die „Schließungstendenz“ real offener Formen.
- Gemischtes Profil (vgl. ebd., S.60 ff)
Häufig verschmelzen Vorder- und Seitenansicht des menschlichen Kopfes. Die Augenzahl variiert dann zwischen eins (Zentralauge) und vier. Nase, Mund, Kinn, Ohren können verdoppelt vorkommen oder fehlen. Auch besteht die Tendenz, Dinge zu physiognomisieren - Häuser, Bäume, Wolken u.ä. erhalten ein Gesicht.
- Geometrisierung (vgl. ebd., S.69 ff)
Für Schizophrene typisch ist die vereinfachte Abbildung belebter und unbelebter Dinge mittels einfacher geometrischer Formen. Drei-, Vier- und Vielecke, Kreise etc. werden dabei so aneinandergesetzt, daß eine abstrahierte vergleichbare Gestalt entsteht, eine Formvereinfachung. Beobachtet wurde dieses Phänomen häufig nach Elektrokrampfbehandlungen. Navratil wertet es als Restitutionsversuch. Die Geometrisierung kann als Bezugsnorm, als Ordnungsqualität verstanden werden, die häufig Übergangscharakter trägt hin zum lebendig-realen Abbilden. Die Darstellung geometrischer Formen kann den Versuch beinhalten, das äußere und/oder das innere Chaos zu bändigen, zu bannen.
- Deformation (vgl. ebd., S.80 ff)
Bei schizophrener Bildnerei liegen strenger Formalismus und Zerstörung der Form nahe beieinander. Besonders im akuten Zustand schlagen sich starke Deformationen in den Zeichnungen nieder. Die Disproportionalisierung wird auch als Affekt-Perspektive bezeichnet: Unter affektivem Einfluß wird der Wahrnehmungsinhalt umgeformt, was nicht selten zu beträchtlicher Entstellung führt, z.B. bei den Größenverhältnissen, bei der Abbildung von Extremitäten am nicht dazugehörigen Körperteil, durch Verdrehen von Körperteilen, deren Verstümmelung oder Zerstückelung.
- Rand, Bildraum und formale Fülle (vgl. ebd., S.87 ff)
Charakteristisch ist auch hier das Gegensätzlich von teils vermehrter, teils verminderter Beachtung des Bildrandes. Starke Randbetonung kommt einer selbstauferlegten Begrenzung gleich. Ein Auf-die-Unterlage-Weiterzeichnen beobachtet Navratil nach Elektrokrampfbehandlung. Mitunter wird nur ein Rand oder eine Ecke bekritzelt.
- Bewegung (vgl. NAVRATIL 1966, S.91 ff)
Ausgeprägt polarisiert zeigen sich übertriebene Bewegung und bewegungslose Starre der gemalten Figuren. Dabei kann eine äußerlich bewegungslos dargestellte Person durch den Gesichtsausdruck enorme innere Spannung und Bewegung ausdrücken. Manche stark bewegt dargestellte Haltung wirkt marionettenhaft. Oft fehlt dabei der Untergrund, der Bezug zum Boden, die Figuren „schweben“. Navratil sieht dieses Schweben als Sinnbild des Welt- und Lebensgefühls Schizophrener, als ein In-Gefahr-Schweben.
- Transparenz (vgl. ebd., S.94 f)
Kleidung wird mitunter sehr durchsichtig dargestellt. Innere Organe können sichtbar sein, oder Gegenstände werden gegenüber dem Hintergrund schemenhaft transparent.
- Symbolismus (vgl. ebd., S. 95 ff)
Symbolismus gehört neben Formalismus und Deformation zu den Hauptmerkmalen schizophrenen Gestaltens. Mehr dazu im folgenden Kapitel (4.2.2 Symbole).
- Änigma (vgl. ebd., S.98 f)
Neben den rätselhaften Symbolen entstehen ganze Bilrätsel. Rätselhaftigkeit und Ratlosigkeit verwendet Navratil nahezu synonym und stellt fest, daß sich der Mensch, den das Änigmatische fesselt, in einem Übergangsstadium befindet zwischen ursprünglich-mythischer und rationaler Ordnung.
- Zahl (vgl. ebd., S.99 f)
Schizophrene neigen zu starker Verwendung von Ziffern in ihren Bildern, mitunter ohne den Zahlenwert richtig benennen zu können. Zahlen haben dann etwas änigmatisches, können magisch-symbolische Bedeutung haben oder Abbild des rational-nummernhaften Alltags- oder Anstaltslebens sein.
- Spirale und Labyrinth (vgl. ebd., S. 100 ff)
Spirale und Labyrinth werden häufig gekritzelt. Ihre Bedeutung fällt mit in den Bereich des Symbolischen und reicht von Unheimlich-Ausweglosem über Bildrätseldarstellung bis hin zum geordneten Abbild des bisherigen ungeordneten Lebensweges. Briefe werden häufig spiralförmig geschrieben.
- Auge (vgl. ebd., S. 103 ff)
Die Augen werden von Schizophrenen entweder besonders genau gezeichnet oder gröblich vernachlässigt. Besonders für Paranoiker haben Augen etwas Bedrohliches. Typisch ist nach Navratil das frontal zugewandte einzelne, „isoliert“ Auge. Es beobachtet, warnt und droht - vergleichbar dem Auge im Dreieck als göttliches Sinnbild.
- Anatomie (vgl ebd., S.105 f)
Darstellung von Schädeln, Knochen und inneren Organen drücken Angst vor dem Tod oder Überwindung dieser Angst aus.
- Maske (vgl. NAVRATIL 1966., S.106 f)
Masken setzen sich meist aus geometrisierten und deformierten Elementen zusammen, auch dann, wenn sie gezeichnet sind. Sie sind nicht nur Abbild, sondern Eigenschöpfung. Masken sind schützende Hilfsmittel, sind unveränderbar und dauerhaft, ermöglichen, sich zu verstecken und eine andere Person zu sein.
Diese Aufzählung ist, wie deutlich wurde, von extremer Gegensätzlichkeit, beinahe beliebigkeit bestimmt. Demnach ließen sich nahezu alle Bilder - außer vielleicht die des Realismus’ - in die Kategorie „Schizophrenie“ einordnen. So verständlich der Wunsch ist, feste anhaltspunkte, feste Kriterien anlegen zu können, so kritisch sind diese Maßstäbe zu hinterfragen. Prinzhorn wehrt sich gegen eine Auflistung bestimmter Stilelemente. Überhaupt hielt er einer vorschnellen Deutung als „schizophren“ eine Reihe relativierender Fakten gegenüber.
Zusammenfassend beschreibt er das „typisch Schizophrene“ so: „Von dieser völligen autistischen Vereinzelung, dem über alle Schattierungen psychopathischer Weltentfremdung hinausgehenden grauenhaften Solipsismus spüren wir in den typischen Bildwerken den Abglanz, und hiermit glauben wir die Eigenart schizophrener Gestaltung im Kern getroffen zu haben“ (PRINZHORN 1994, S.339). Die unbeschreibbare Vielseitigkeit legt für ihn einen Umkehrschluß nahe betreffs psychiatrischer Diagnosen: „Die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Bildwerke erlaubt nicht die Aufstellung einiger charakteristischer Merkmale und spricht dafür, daß in dem weiten Begriff der Schizophrenie recht verschiedenartige Zustände lose zusammengefaßt sind“ (ebd., S. 349).
4.2.2 Symbole
„Anstatt den Menschen als animal rationale zu verstehen, sollten wir ihn als animal symbolicum definieren.“ Ernst Cassierer 1960
Auf die Differenz zwischen Freud und Jung betreffs des symbolverständnisses wurde bereits hingewiesen (vgl. Kapitel 2.1.2.1 f). Diese Meinungsverschiedenheit über das wohl reizvollste Stilelement schizophrener Bildnerei (vgl. NAVRATIL 1966; S.95) setzte sich bis zu den gegenwärtigen Verfechtern psychoanalytisch orientierter Deuterei kunsttherapeutischer Werke konsequent fort. Neben einer Aufzählung sich unterscheidender Symbolverständnisse gilt es im folgenden der Frage nachzugehen, welche Zugangsmöglichkeiten Symbole zum Verständnis der Schizophrenie mittels künstlerischer Bilder zu eröffnen vermögen.
Navratil übernimmt Kretschmers Symbolverständnis: „Symbole sind bilhafte Vorstadien der Begriffe, gefühlsstarke Bildverschmelzungen“ (NAVRATIL 1966, S.95; original: KRETSCHMER 1956). Nachfolgend zitiert er folgende Definitionen (vgl. ebd.; Original: SIEBENTHAL 1953):
„Die Symbolbildung spielt sich an der Grenze zwischen Unbewußtem und bewußtem ab.“ (Häberlin)
„Das Symbol ist die Vorwegnahme eines im Entstehen begriffenen Bewußtseins.“ (C.G.Jung)
„Symbole treiben die allmähliche Bewußtwerdung gleichsam voran.“ (Siebenthal)
Erinnert sei noch einmal an Freud und Jung:
„Eine solche konstante Beziehung zwischen einem Traumelement und seiner Übersetzung heißen wir eine symbolische, das Traumelement selbst ein Symbol des unbewußten Traumgedankens“ (FREUD 1989, S.160).
„Ein Symbol heißen wir einen Begriff, ein bild oder einen Namen, die uns als solche bekannt sein können, deren Begriffsinhalte oder Gebrauch und Anwendung jedoch spezifisch oder merkwürdig sind und auf einen verborgenen unklaren oder unbekannten Sinn hindeuten. ... Ein Begriff oder ein Bild sind symbolisch, wenn sie mehr bedeuten, als sie bezeichnen oder aussagen“ (JUNG 1990, S.7).
Letzterer Aussage verwandt ist Riedels Einschätzung:
„Symbol ist ein Bild insofern, als es bei weitem mehr beinhaltet als das, was es jeweils abbildet“ (RIEDEL 1991, S.14)
Diesen recht allgemeinen, sich teils auf Träume, teils auf Bildanalyse beziehenden Aussagen setzt Karin Dannecker eine speziell kunstthera-peutische Untersuchung entgegen:
„Ich bin der Meinung, daß dieses Thema ´Symbol und Symbolisierungsprozesse` das Zentrum einer Kunsttherapie ist, die ihren theoretischen Rahmen abstecken will“ (DANNECKER 1994, S.21). „Das Ziel der Kunsttherapie könnte man umschreiben mit der Wieder- oder Neugewinnung der Symbolisierungsfähigkeit mit den Mitteln der Kunst“ (ebd., S.175).
Auch wenn Dannecker nichts mit allgemeinen Symboldeutungsregeln im Sinn hat, so unterstellt sie doch vorschnell jeder aus ihrer Sicht symbolischen Darstellung einen Integrationscharakter (vgl. ebd., S.181). Danneckers Meinung mag man sich anschließen oder nicht; ihre Ausführungen sind künstlerisch, psychoanalytisch und empirisch fundiert. Schwachstelle ist der nicht klar herausgearbeitete Unterschied zwischen Symbol, Zeichen und allgemeiner Darstellung. Auch provoziert die Ansiedlung der Symbolbildung an der Grenze des Unbewußten KunsttherapeutInnen zur Hineininterpretation einer symbolischen Bedeutung in auch allgemeine, spielerische Darstellungen.
Abschließend zum Thema Symbole soll auf Hans Prinzhorn eingegangen werden. In seinem Werk nimmt die auseinandersetzung mit Symbolen einen großen Raum ein. Seine 75 Jahre alte Definition scheint - vergleicht man sie mit heutzutage aufgestellten - nur leicht abgewandelt:
„Hier genügt die Erklärung, daß wir von Symbolik im weiteren Sinne sprechen, wenn wir in einem sinnlich Gegebenen ein Abstraktes, Geistiges, Übersinnliches finden, wenn uns das Bild zum Sinnbild wird“ (PRINZHORN 1994, S.110).
Unterschieden wird zwischen konventionellen Symbolen (Allegorien) und neu geprägten Symbolen (vgl. ebd.). Symbole sind - im allgemeinen - Repräsentanten einer unabhängig von den Bildwerken für sich bestehenden Macht, häufig auch mit magischer Bedeutung (vgl. ebd., S.38). Bei Bildern Schizophrener sei es hingegen anders. Während sich üblicherweise eine Sinnbeziehung zwischen Symbol und Gemeintem „erahnen oder erfühlen“ lasse, gelingt dies bei Schizophrenen Bildern nicht. „Absurde Diskrepanz zwischen dem anschaulich Gegebenen und dem damit Gemeinten weist am ersten auf schizophrene Störung hin“ (ebd., S.335 f). Er findet bei Schizophrenen eine „kindlich spielerische Freude daran, einfallsmäßige Beziehungen zu stiften“ (vgl. ebd., S.336), die in „einer Bevorzugung des Vieldeutigen, Geheimnisvollen, Unheimlichen“ (vgl. ebd., S.337) liegen. Bei Schizophrenen besteht also der Gestaltungsvorgang „aus ungesiebten Zufällen und unbedachter Willkür (,) ... indem sich Einfälle hemmungslos aneinanderreihen“ (vgl. ebd., S.338). Diese Aussagen kennzeichnen schizophrene Bilder als Folge eines schöpferischen Gestaltungsdranges, nicht einer Abbildeabsicht. Somit sind entstehende Bilder als Indiz für den Gestaltungsdrang zu deuten, der Bildinhalt aber aber kein Freiwild für SymboljägerInnen.
Wer deuten will, wird immer etwas Symbolisches oder zumindest Symbolähnliches finden. Doch sagt diese Deutung dann mehr über die DeuterInnen als über die GestalterInnen aus. Das einzige, was stichhaltig zutage treten dürfte, sind Darstellungen „solipsistischen Abglanzes“ (vgl.ebd., S.339).Da beißt sich die Katze in den Schwanz: Daß, wenn sich Schizophrene bildnerisch ausdrücken, der bildnerische Ausdruck Schizophrener dabei herauskommt, dürfte von vorneherein selbst Laien einleuchtend sein - dies als Übergang zu einer kurzen Abhandlung über die Bildanalyse zu diagnostischen Zwecken.
4.2.3 Bildanalyse als Diagnoseverfahren
„Es gibt keinen allgemein gültigen Schlüssel, um die Bilder zu lesen. Richtlinien wie Symbol- oder Farbdeutungen, Analyse der Bildraumaufteilung, graphische Merkmale usw. können zwar Hinweise geben, sind letztlich aber ohne genaue Kenntnis des Einzelfalles nicht anzuwenden ...“ Gertraud Schottenloher 1990
Mahlstaedt-Heckel und Freywald fassen treffend „das fast zwanghaft zu nennende Bedürfnis mancher Therapeuten“ zusammen, „alles und jedes im Bild als ´Symbol`deklarieren zu wollen, damit es nur ja interpretiert wird“ (MAHLSTAEDT-HECKE/FREYWALD 1994, S.3), weisen hin auf die in die Gestaltung eingeflossenen Anteile der KunsttherapeutInnen und „plädieren für die Unerschrockenheit der Therapeuten, sich auf die unterschiedlichsten Gestaltungen der Patienten als Widerhall ihres psychischen Erlebens deutungsfreier einzulassen“ (ebd., S.4). Dieser Ansatz wird der Problematik eher gerecht als Riedels Versuch, der in der Intention besteht, „einige Schlüssel oder besser einen Schlüsselbund zu bildern anzubieten, die wir an ihnen ausprobieren können“ (RIEDEL 1991, S.14; vgl. RIEDEL 1990<a> und 1990<b>).
Zu den Deutungswilligen gehört auch Furth, der zwar einräumt - wodurch er sich stark von Riedel unterscheidet - „Man muß den Bildern Zeit widmen, sie studieren, messen, sogar ihren Linien folgen und das Bild nachzeichnen und dabei festhalten, wieviel Zeit und Energie die einzelnen Teile der Zeichnung beanspruchen“ (FURTH 1992, S.28), doch lassen die von ihm beschriebenen Fallbeispiele aus seiner Praxis diese intensive Beschäftigung missen.
Exkurs:
U. X. läuft immer noch die Galle über, wenn er an den Psychologen in der Klinik denkt. „Der hat an allem rumgedeutelt! Auch auf ´nem weißen Blatt Papier hätte der einen Neger oder zumindest einen Schneemann oder was weiß ich gesehen. Da ist mir die Lust zum Malen völlig vergangenm.“ Erst vor ein paar Monaten hat er wieder angefangen damit, als die Annonce mit dem Atelier in der Zeitung stand. Nun gehts ihm wieder richtig gut damit, mit der Kunst, meine ich. Auch ich bin froh, jede Woche diesen festen Punkt zu haben. Früher mußte ich mich zum Malen immer aufraffen. Bin da total schwerfällig in der Beziehung. Inzwischen ist´s Gewohnheit. Total O.K. so. Und mit U.X. machts nochmal so viel Spaß. Wie das Leben doch so spielt ...
Prinzhorn empfindet es zwar als zwingend, „in den schizophrenen Produktionen eine noch unbenutzt Quelle psychiatrischer Erkenntnis zu sehen“ (PRINZHORN 1994, S.5), doch ist dies nicht im Sinne einer Bilddeutung zu verstehen, sondern, wie er meint, in der Untersuchung des „Gestaltungsvorgang(es) ohne jede Wertung“ (ebd. S.343). Das ist etwas völlig anderes.
Domma stellt darüber hinaus fest, daß nachfolgend beschriebene prospektive Testverfahren, die man bei Bildern Schizophrener „zu Rate ziehen“ könnte, „für diese Klientel (Schizophrene - d.V.) allerdings nicht geeicht sind“ (DOMMA 1990, S.152). Somit wäre nur eine allgemeine Überprüfung möglich, „ob der Patient auf ein altersgemäßes Formenrepertoire ... zurückgreifen kann oder ob (krankheitsbedingte) Beeinträchtigungen des zeichnerischen Ausdrucksniveaus vorliegen, die dann gfs. Anlaß zu weiteren diagnostischen Überprüfungen (der Intelligenz, hirnorganischer Funktionen etc.) geben könnten“ (ebd.). Mittels Bildern ließen sich in vielen Fällen Erkenntnisse gewinnen, die eine hilfreiche Ergänzung (sprach-)diagnostischer und anamnestischer Erhebungen bieten können“ (ebd., S.152 f). Dommas Thesen stützen also keine Theorie der Bilddeutung zu diagnostischen Zwecken, sondern weisen allenfalls auf die Möglichkeit hin, bei akut psychotischen Schizophrenen - deren Ansprechbarkeit oft stark gemindert ist - mittels der Bilder Ansatzpunkte für die Intensität der Störung festzustellen, die dann durch klassische Diagnoseverfahren konkreter herausgearbeitet werden können. Das von Domma aufgestellte „mögliche Spektrum erster diagnostischer Abklärungen“ (ebd., S.153) bezieht sich gleichsam exemplarisch auf den bildnerischen Prozeß. Das Spektrum beinhaltet allgemein anamnestisch-diagnostisch wichtige Aspekte wie: Fragestellungen nach Beziehungsfähigkeit, Einhaltung von Absprachen, Ma-terialumgang, Ängst, Hemmungen, Unlust, Verweigerung, Überaktivität, Realitätskontrolle u.a., die im künstlerischen Prozeß deutlich bzw. deutbar werden können, aber nicht zwingend kunsttherapieimmanent sind. Damit stellt Domma die Kunsttherapie der Psychiatrie zur freien Verfügung, was ausgehend von seinen psychiatriekritischen Erörterungen (vgl. DOMMA 1990, S.145 ff) nicht in dessen Sinne sein kann.
Was also von der „Bildanalyse als Diagnoseverfahren“ bleibt, ist nicht viel. Wenn sich einst stichhaltige Parameter als Diagnosekriterien erarbeiten lassen, kann über dieses Thema erneut nachgedacht werden. Bis dahin bleibt lediglich die individuelle, künstlerisch und therapeutisch fundiert belegbare Einschätzung der den Prozeß begleitenden KunsttherapeutInnen relevant. Um dabei Übertragungsprozesse aufzudecken und zu minimieren, ist Supervision unverzichtbar.
4.3 Relevanz der Kunsttherapie im Vergleich zu anderen bei schizophrenen angewandten Therapien
„Einen Prozeß kann man dann therapeutisch nennen, wenn er wünschenswerte Veränderungen in der Persönlichkeit oder im Lebensstil ermöglicht oder unterstützt, die die Sitzungen überdauern. Voraussetzungen dafür sind, sich selbst kennenzulernen, die Umwelt real sehen zu lernen, sich zur Umwelt in Beziehung setzen zu können.“ Gertraud Schottenloher 1992
Über die Effizienz von Therapien läßt sich prinzipiell streiten (vgl. SCHUSTER 1993, S.160 ff). Studien über Vergleiche zwischen therapeutisierten und nichttherapeutisierten PatientInnen - speziell Schizophrene - , sind selten (vgl. HUTTERER-KRISCH 1994, S.95). Vorhandenen Studien sind stark anzufragen:
- bezüglich hinter der Studie stehenden Interessen und InteressentInnen, die Ergebnisse in übertrieben positivem Licht erstrahlen lassen
- bezüglich real bestehender Übereinstimmung der Vergleichsgruppen in Symptomatik, sozialem Status etc.
- bezüglich des Einflusses weiterer zeitgleich angewandter Therapien.
Solch detailliert hintergründige Untersuchung und Auswertung vermag diese Arbeit nicht zu leisten. Der Kunsttherapie mangelt es schon an o.g. allgemeinen empirischen Studien (vgl. TÜPKER 1990, S. 71 ff), um so mehr an solchen zu spezieller Symptomatik. Daher bleibt, um Spezifika herauszuarbeiten, nur der allgemeine theoretische, z.T. hypothetische Weg offen, der im folgenden kurz beschritten wird. Vorab noch Grundsätzliches: Es kann nicht Absicht des Kapitels sein darzustellen, daß Kunsttherapie das Nonplusultra der Schizophrenietherapie sei. Um ein Bild ins Spiel zu bringen: Wie in einem Kreisverkehr drehen sich (bzw. sollen sich drehen) alle Therapien um die PatientInnen und bilden lediglich verschiedene, sich phasenhaft wie inhaltlich ergänzende Zugangsweisen (vgl. DOMMA 1990, S. 151 f). Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, und „in der Kunsttherapie können die nicht enden wollenden Fallberichte kein Beweis für die Wirksamkeit des therapeutischen Handelns sein“ (SCHUSTER 1993, S. 162).
Da die therapeutische Wirksamkeit angewandter Verfahren durch die betreffenden TherapeutInnen leicht überschätzt und zudem die Wahrnehmung Betroffener nicht selten ignoriert wird, werden im folgenden die spärlichen, da schwierig zu erstellenden Untersuchungen (vgl. WINDGASSEN 1989, S.13) speziell aus der Innenansicht Schizophrener mit zum Vergleich der Therapien herangezogen (vgl. ebd. S. 34 ff; die Untersuchung zur Schizophreniebehandlung aus der Sicht der PatientInnen fand in einer Klinik statt, in der keine Kunsttherapie angeboten wurde). Zum Vergleich herangezogen werden Pharmakotherapie, Psychotherapie sowie Beschäftigungstherapien.
4.3.1 Pharmakotherapie
„Die Pflege des kreativen Beitrags der geisteskranken Maler ist auch deshalb wichtig, weil die heute übliche Behandlung mit hohen Dosen von Psychopharmaka sowohl die Psychose als auch die kreative Leistung zurückdrängt.“ Martin Schuster 1993
Nach Navratil verringern Neuropharmaka kreative und künstlerische Möglichkeiten der PatientInnen, ohne sie jedoch völlig auszuschließen. „Die kunsttherapeutische Betreuung hat sogar den Vorteil, eine zu hoch dosierte oder unnötig lange medikamentöse Behandlung leicht erkennbar zu machen, so daß sie rasch korrigiert werden kann“ (THIES <Hrsg.> 1987, S.40; Original: NAVRATIL 1983, S.46 f). Die Beeinträchtigung wird von Werner Janzarik bestätigt und legitimiert: „Angesichts des therapeutischen Fortschritts, den die Psychopharmaka brachten, muß man es hinnehmen, daß sie dem spontanen kreativen Ausdruck seelischen Krankseins weitgehend den Boden entzogen haben“ (ebd., S.41; Original: JANZARIK 1980). Praktizierende Kunsttherapeutinnen fühlen ihre Handlungsmöglichkeiten durch pharmakologische Behandlung der PatientInnen häufig stark eingeschränkt (vgl. Anhang). Scharfetter weist darauf hin, daß häufig durch Neuropharmakabehandlung PatientInnen überhaupt erst wieder anderen Therapieformen zugänglich werden (vgl. SCHARFETTER 1995, S.247).
Nach dieser die Praxis betreffenden Bemerkungen soll auf Einsatzgrund und Wirkung von Neuropharmaka eingeganen werden. Für Dörner und Plog ist die Frage nach Nutzen und Schaden der Neuropharmaka noch offen (vgl. DÖRNER/PLOG 1992, S.527). Diese Medikamente unterdrücken, „entaktualisieren“ Symptome schizophrenen Handelns (vgl. ebd., S.528), ohne wirklich zu heilen. Indiziert sind Neuroleptika, wenn sich die PatientInnen quälen und Medikamente wünschen, oder - als Sozialisierungs- und Erziehungsmittel - wenn PatientInnen andere quälen, Angehörige, behandelndes Team etc. Der Ehrlichkeit halber ist dann darauf hinzuweisen: „´ Wir brauchen es, daß Du Nl (Neuroleptika - d.V.) nimmst, wir können sonst nicht mit Dir sprechen, wir können Dich sonst nicht aushalten`. Insofern geben wir Neuropharmaka den Patienten immer auch zu unserer eigenen Selbstbehandlung“ (ebd., S.530). Neuropharmaka können also andere Therapien ebenso ermöglichen wie - speziell Kunsttherapie - nahezu verunmöglichen. Eine „Güterabwägung“ ist vorzunehmen (vgl. SCHUSTER 1993, S.99).
Auf die Nebenwirkungen von Neuroleptika kann hier im Detail nicht eingegangen werden. Erwiesen ist, daß trotz der Nebenwirkungen viele PatientInnen eine Pharmakotherapie begrüßen. Nach Windgassens Studie stimmten 50% der PatientInnen mit oder ohne Vorbehalte der Pharmakotherapie zu (vgl. WINDGASSEN 1989, S.120 ff), trotz häufig daraus folgender Einfalls- und Ideenarmut (vgl. ebd., S.96 ff). Knapp 30% der PatientInnen hoben die Pharmakotherapie als „besonders hilfreich“ hervor (vgl. ebd., S.134 ff). Ciompi geht davon aus, „daß die Diagnose Schizophrenie an sich noch keine Anzeige für eine medikamentöse Behandlung ist“ (HUTTERER-KRISCH <Hrsg.> 1994, S.98; vgl. CIOMPI u.a. 1993, S.440 ff). Studien über die Relevanz von Kunsttherapie in akuten Stadien stehen noch aus.
Zusammenfassend betrachtet sind Neuropharmaka und Kunst zwei sehr verschiedene Kämpfer: Während Medikamente besonders in akuten Stadien und kurzzeitig sinnvoll einsetzbar sind durch ihre reizabschirmende und symptomunterdrückende Funktion, setzt Kunsttherapie auf den heilenden und begleitenden Prozeß.
4.3.2 Psychotherapie
„Folglich kann die Behandlung akuter (schizophrener - d.V.) Psychosen mittels ausgewählter ästhetischer Arbeitsweisen zumindest (!) sinnvoll ergänzt werden und ist in dieser Krankheitsphase den, auf Einsicht und Reflexion abzielenden, sprachlichen Therapieangeboten überlegen.“ Wolfgang Domma 1990
Das einleitende Zitat betrifft die Psychotherapie im allgemeinen, also Psychoanalyse, Gesprächspsychotherapie, Verhaltenstherapie u.a. gleichermaßen. Psychotherapie setzt „auf Patientenseite ein Maß an Klarheit, Bewußtheit und Reflexionsfähigkeit voraus, das bei psychotisch Erkrankungen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht“ (DOMMA 1990, S.122). Kunsttherapie dagegen hat schon eher Zugang zu den PatientInnen, da „die Ausbildung bildnerischer Vorstellungen eine Leistung des Bewußtseins darstellt, die schon bevor die Psyche in der Lage ist, Sprache und sprachgebundene Operationen zu entwickeln, die Möglichkeit zur Informationsverarbeitung mittels ´ mentaler Bilder ` eröffnet“ (ebd., S.119). In diesen inneren Bildern werden „weitläufige Diachrone Abläufe erstmals zu ´Synchronien` zusammengefaßt“ (ebd., Original: CIOMPI 1982, S.147). Im Unterschied zur Psychotherapie können diese Bilder und Abläufe in der Kunsttherapie bereits frühzeitig - auch in akuten Stadien - projiziert und integriert werden.
Ein Gegeneinander von Kunst- und Psychotherapie kann schon deswegen nicht postuliert werden, weil Kunsttherapie unter anderem in der Psychotherapie wurzelt und deren Elemente ebenso übernommen hat wie die Psychotherapie in der Praxis häufiger kreative Elemente aufnimmt. So ist das freie Malen eine noch wirkungsvollere Art der freien Assoziation, da das verbale Medium unter starker Bewustseinskontrolle steht, während sich malerisch-gestalterischer Ausdruck dieser Kontrolle zu entziehen vermag (vgl. Kapitel 2.1.2 Psychoanalyse). Trotzdem wird noch behauptet, der Kunsttherapie „wird aus psychotherapeutischer Sicht kein all zu hoher Stellenwert eingeräumt“, weil sie die Konflikte der PatientInnen nichtbearbeiten könne (SCHUSTER 1993, S.95). Die kreative Beschäftigung unterstütze lediglich andere therapeutische Maßnahmen.
Im Rahmen dieser Arbeit detailliert auf Unterschiede zwischen den einzelnen Psychotherapien einzugehen und jeweils der Kunsttherapie gegenüberzustellen, würde zu weit führen. Als Begründung sind folgende Zitate zu verstehen: „In der Praxis besteht zwischen Psychoanalyse und verschiedenen anderen Formen der Psychotherapie keine klare Trennung mehr“ (JERVIS 1978, S.342). Dörner und Plog bestätigen diese Einschätzung und konkretisieren sie dahingehend, daß mit zunehmender Erfahrung der PsychotherapeutInnen der Einfluß der unterschiedlichen Schulen abnimmt und sich die Arbeitsweisen dadurch ähnlicher werden (vgl. DÖRNER/PLOG 1992, S.561).
Psychotherapeutische Gespräche mit den ÄrztInnen werden auf der PatientInnenseite überwiegend positiv eingeschätzt, besonders diejenigen dialogischer Art (vgl. WINDGASSEN 1989, S.126 ff). Mit psychoanalytisch orientierter Psychotherapie bei Schizophrenen beschäftigte sich Benedetti (vgl. HUTTERER:KRISCH 1994, S.72 ff; Original: vgl. BENEDETTI 1975). Die untersucht Gruppe war mit 30 PatientInnen relativ klein. Als nach Benedettis Kriterien geheilt konnten - nach drei bis sechs Jahren - immerhin 17 PatientInnen gelten. Daß er dabei außerdem herausfand, daß bei 40% der PatientInnen „die Entwicklung der Kreativität ein - bisher nicht berücksichtigtes - Besserungs- und Heilungsmerkmal ist“ (ebd., S.73), zeugt von der Annäherung bzw. Nähe zwischen Kunst- und Psychotherapie (vgl. SCHOTTENLOHER <I> 1994, S.28).
Hutterer-Krisch verweist auf eine Untersuchung von Luborsky mit „dem Phänomen, daß die verschiedenen Psychotherapiemethoden im Durchschnitt gleich erfolgreich sind“ (ebd., S.78; Original: LUBORSKY 1975, S. 995 ff; vgl. HAUßMANN/SCHIEFER 1993, S.223). Ähnlich betonen Cross u.a., „daß weniger die theoretisch-therapeutische Ausrichtung für die Veränderung der Patienten wichtig war als die Art der zwischenmenschlichen Beziehung“ (ebd., S.94; Original: CROSS/ SHEELAN/KHAN 1980, S.615 ff; vgl. SCHARFETTER 1995, S.244). Mit dieser These ließe sich auch die Feststellung bezüglich der Verhaltenstherapie erklären: „In all zu kurzfristigen therapeutischen Interventionen scheinen die Probleme schizophrener Patienten nicht angemessen und nur unzureichend angegangen zu werden“ (ebd., S.76).
Bei allen beschriebenen Ähnlichkeiten zwischen Psycho- und Kunsttherapie bleibt der wesentliche Unterschied: Psychotherapie bezieht sich primär auf Sprache und Kommunikation, womit viele Schizophrene überfordert sind. Kunsttherapie bietet ungleich vielfältigere Varianten an Ausdrucksmöglichkeiten. Weiterhin steht Psychotherapie nicht allen PatientInnen gleichermaßen offen: „Es besteht immer noch die Neigung, Psychotherapie sozial ungerecht anzubieten. Psychotherapeuten siedeln am liebsten in Mittelschicht-Gegenden und arbeiten mit Ihresgleichen. ... Und es ist eine Binsenweisheit, daß in den Einrichtungen, die Patienten nicht weiterschieben können, a. mehr arme Menschen sind und b. Psychotherapie so gut wie nicht vorkommt“ (DÖRNER/PLOG 1992, S.564; vgl. JERVIS 1978, S.342; vgl. FROMM in: DÖRNER/PLOG 1992, S.563).
4.2.3 Beschäftigungstherapie
„Wenn es also einerseis klar ist, daß Arbeits-, Beschäftigungs- und Gestaltungstherapeuten vielfach ´dasselbe` tun bzw. ihre Patienten zu sehr ähnlichen Tätigkeiten anleiten, so sind doch der weitere Weg und die Zielsetzungen, somit auch die Indikationen, verschieden.“ Erich Franzke 1983
Trotz der zwischen Beschäftigungs-, Arbeits- und Ergotherapie bestehenden Unterschiede werden diese Therapien, da allesamt praktische Betätigungen sind, hier zusammengefaßt. Erwähnt wurden bereits in den Kapiteln 2.2 (Streit um den Begriff Kunsttherapie) und 2.2.3 (Therapie mit kreativen Elementen) die entwicklungsbedingten Übergänge zwischen Kunsttherapie und Beschäftigungstherapie. Hier werden nun die Unterschiede dargestellt und konkretisiert am Beispiel der Schizophrenie.
Nach Franzke hat „Beschäftigungstherapie wohl eher die Funktion, von Konflikten abzulenken“; bei der Arbeitstherapie stehen „die Verwendbarkeit der Produkte, ihre Nützlichkeit, ihr Gebrauchswert im Vordergrund“ (FRANZKE 1983, S.11 f). Gleichzeitig weist er darauf hin, , daß diese Tätigkeiten häufig als sinnlos erlebt werden (vgl. ebd.). Windgassen stellt zwar eine positive Einschätzung der PatientInnen gegenüber der Beschäftigung fest (vgl. WINDGASSEN 1989, S.136 f), doch die abgedruckten PatientInnenzitate bestätigen eindeutig Franzkes Vorbehalte bezüglich Ablenkung und Produktprimat (vgl. DOMMA 1990, S.53 ff). Looden wertet letzteres nicht ab, sondern sehr positiv. Sie stellt fest, daß „die Tatsache, daß der Patient die Beschäftigungstherapie als schön und in irgend einer Hinsicht hilfreich erlebt und daß er eine positive affektive Einstellung zu ihr hat, ist allein schon ein Therapeuticum, das in einer objektiv feststellbaren Besserung des Patienten zum Ausdruck kommt“ (WINDGASSEN 1989, S.137; Original: LOODEN 1971, S.116 ff). Die benannten Ziele Ablenkung und Produkt stehen konträr denen der Kunsttherapie gegnüber, die auf Auseinandersetzung im therapeutischen Prozeß hinwirkt, wobei das Produkt nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Wenn - um das Bildwort wieder aufzugreifen - sich alle Therapie wie Straßen auf den Kreisverkehr hinbewegen und sich um die PatientInnen drehen, so gilt dies Prinzip auch für Kunsttherapie und Beschäftigungs-/Arbeits-/Ergotherapie: der den Interessen der PatientInnen entsprechende Weg wäre demnach der sinnvollste. Dabei besteht die Gefahr einer Vereinseitigung. Schizophrene, die vor Auftreten ihrer Störung stark leistungs- und ergebnisorientiert eingestellt waren, werden sich, davon ist auszugehen - konkrete Untersuchungen liegen nicht vor - bei freier Wahl für eine leistungs- und ergebnisorientierte Therapie entscheiden, da diese ja ihrem Alltag entspricht. Zu überlegen ist, wie ein Pendant dazu gefunden werden kann, um einer Vereinseitigung, die möglicherweise das Auftreten der Störung wesentlich bedingte, nicht weiter Vorschub zu leisten. Durch die entgegengesetzte Zielrichtung böte sich die Kunsttherapie hervorragend an. Im kunsttherapeutischen Prozeß könnte eine starre Produkt-/Objekt-/Leistungsfixierung angefragt und gelockert, im günstigsten Fall relativiert werden. Ob arbeitstherapeutische Produktorientierung das Gefühl der Weltfremdheit Schizophrener vermindert oder noch bestärkt, ist theoretisch noch zu begründen und bis dahin am Einzelfall zu messen (vgl. CIOMPI 1982, S.356). Auf gelungene Art und Weise verbinden lassen sich Kunst und Arbeit beim Herstellen von Plastiken (vgl. DOMMA 1990; S.182 ff).
5. Zusammenfassung
“Was lange währt, wird endlich gut.“ Sprichwort
Die Wirksamkeit kunsttherapeutischer Schizophreniebehandlung gilt als unumstritten (vgl. RIEDEL 1992, S.23, 301 ff; TOMALIN/SCHAUWECKER 1993, S.25 f; RUBIN 1993, S.330 ff; SCHWER 1994; S.5 ff; PECICCIA/BENEDETTI 1994, S.91 ff; DOMMA 1990, S.177 ff; SCHUSTER 1993, S.146 ff; PETERSEN 1994, S.161; PETZOLD/ORTH 1991, S. 13 u.v.a.m.). Das Lob schmeichelt der noch in den Kinderschuhen steckenden Kunsttherapie. Doch das Praxislob kann die Theorie nicht ersetzen, sondern muß sie geradezu herausfordern.
Die Thematisierung der Relevanz des therapeutischen Beziehungsprozesses zwischen TherapeutIn und PatientIn, und gegebenenfalls der Gruppe, ist nahezu Neuland. Weiterhin werden bei speziellen Themen, z.B. welche kunsttherapeutische Techniken bei Schizophrenen einzusetzen sind, auch die wenigen vorhandenen Zipfel Theorie sehr vage. Trotzdem konnte gezeigt werden, daß Kunsttherapie im Vergleich zu anderen angewandten Therapien Schizophrenen sehr günstige Zugangsmöglichkeiten bietet. Die nonverbale Ausdrucksmöglichkeit innerer Bilder hat die Kunsttherapie allen anderen Therapien voraus. Ob bereits in schizophrenen Akutstadien dieses Angebot sinnvoll und hilfreich ist, gilt als umstritten und wird abhängig gemacht von der Intensität der TherapeutIn-PatientIn-Beziehung. Solange KunsttherapeutInnen von ÄrztInnen die Forschungsmöglichkeit vorenthalten wird, direkt im Akutstadium mit PatientInnen zu gestalten, solange wird es keine aufschlußreichen Ergebnisse dazu geben. Dafür benötigen KunsttherapeutInnen - besonders im klinischen Rahmen - einen höheren Status und eine gleichberechtigte Möglichkeit der Mitarbeit im therapeutischen Team. Und dafür widerum braucht es eine fundierte Theorie der Kunsttherapie.
In der Kunst gibt es keine Einteilung in normal und unnormal, es gibt nur Einmaligkeit. In der Kunst tut sich Schizophrenen eine Welt jenseits von Stigmatisierungen auf, in denen gestörte Persönlichkeitsanteile unreglementiert ausgelebt und gesunde gefördert werden können.
- Das Malen bietet Schizophrenen die Möglichkeit, sich von den zu Papier gebrachten Ängsten und Wahninhalten zu distanzieren.
- Die Beziehungsaufnahme zwischen TherapeutIn und PatientIn wird durch kreative Medien wesentlich erleichtert.
- Eine Deutung der Bilder Schizophrener für diagnostische Zwecke steht unter starkem Verdacht subjektiver Beliebigkeit und kommt einem Mißbrauch gleich. Kunst ist Selbstzweck!
- Schizophrene entwickeln - besonders in der Restitutionsphase - ein ausgesprochen reichhaltiges Kreativitätspotential. Dies wird einem Selbstheilungsversuch zugeschrieben, der durch bildnerisch-kreative Gestaltung noch unterstützt wird.
- Kunsttherapie mobilisiert Ich-Kräfte. Abgespaltenes kann integriert, Zerfließendes eingegrenzt werden.
Diese Arbeit unternahm den Versuch, die Vielgestaltigkeit der Theorien zur Kunsttherapie anzureißen und auf ihre Relevanz hin zu untersuchen. Es konnte gezeigt werden, daß sich trotz unterschiedlicher Ansätze gute therapeutische Ergebnisse erzielen lassen. Dabei wurde ein Nachholebedarf an Theoriebildung innerhalb der Kunsttherapie deutlich; darüberhinaus sind Studien über Effizienz (Qualitätssicherung) sowie der meßbare Vergleich mit anderen Therapien notwendig, um künftig mit gesicherteren Daten die Relevanz der Kunsttherapie - auch mit Schizophrenen - belegen zu können.
Exkurs:
Naja, meinte U.X., nachdem er das Manuskript gelesen hatte, „hast ja ganz schön losgelegt!“ Das Wort „losgelegt“ ist für U.X. die höchste Wertschätzung. Er meint es halt gut mit allen ;Menschen, nicht nur mit Frauen. Monatelang hat er die Schatten um meine Augen beobachtet und mich oft verwundert gefragt, ob ich nichts anderes mehr im Kopf hätte und nicht auch mal bissel an mich denken würde. Wenn ich durchhing und den ganzen Packen beschriebener Zettel in den Ofen stecken wollte, hat er mich echt ermutigt. Und daß das etwas Normales, etwas Vorübergehendes sei, was jeder mal durchmache. „Kann ja sein, daß meine Nase mich diesmal täuscht. Ich versteh´ ja von dem ganzen Kram nix. Aber ich kauf schon mal ´ne Pulle Sekt - die trinken wir so oder so.“ Jaja, der U. X.! So ist er. So schätze ich ihn.
Literaturverzeichnis
(Q) = vollständige Quellenangaben der von AutorInnen verwendeten fremden Zitaten; dem Verfasser nicht vorliegende Literatur
(Z) = Zeitung / Zeitschrift
(K) = Konzepte der auf dem Weltkongreß für Sozialpsychiatrie gehaltenen Vorträge; erschienen 1994, Hamburg: Art & Text
Aebi,Elisabeth (1993): Zum Konzept der therapeutischen Begleitung durch die Psychose. Wie wird begleitet? in: Aebi/Ciompi/Hansen (Hrsg.) 1993
Aebi,Elisabeth/ Ciompi,Luc/ Hansen,Hartwig (Hrsg.) (1993): Soteria im Gespräch. Über eine alternative Schizophreniebehandlung. Bonn: Psychiatrie
Aderhold,Volkmar (1994): Die akute Schizophrenie als Prozeß - Archetypisch und Autopoietisch. (K)
Adriani,Götz/ Konnertz,Winfried/ Thomas,Karin (1973): Joseph Beuys. Köln: Dumont Schauberg (Q)
Bader,Roswitha (1993): Gestaltungslehren der Bauhauszeit. in: Baukus/Thies (Hrsg.) 1993
Bartl,Reinhold M./ Moser,Christian (1994): Systemische Familientherapie bei psychotischem Verhalten. in: Hutterer-Krisch (Hrsg.) 1994
Baukus,Peter/ Thies,Jürgen (Hrsg.) (1993): Aktuelle Tendenzen in der Kunsttherapie. Stuttgart/Jena/New York: Fischer
Benedetti,Gaetano (1975): Ausgewählte Aufsätze zur Schizophrenielehre. Med.Psychol. Göttingen (Q) (Z)
Benedetti,Gaetano/ Peciccia,Maurizio (1991): Die Funktion des Bildes in der gestaltenden Psychotherapie bei Psychosepatienten. in: Petzold/ Orth (Hrsg.) 1991
Benedetti,Gaetano/ Peciccia,Maurizio (1994): Symbol und Schizophrenie. in: Schottenloher (Hrsg.) Bd.II 1994
Bernfeld,Siegfried u.a. (Hrsg.) (1970): Psychoanalyse und Marxismus. Frankfurt a.M.: Fischer
Beuys,Joseph (1991): ´Kunst ist ja Therapie` und ´Jeder Mensch ist ein Künstler`. in: Petzold/Orth (Hrsg.) 1991
Bock,Thomas/ Buck,Dorothea/ Gross,Jan/ Maß,Ernst/ Sorel,Eliot/ Wolpert,Eugen (Hrsg.) (1995): Abschied von Babylon. Verständigung über Grenzen in der Psychiatrie. Bonn: Psychiatrie
Bock,Thomas u.a. (1994): „Es wird Zeit, daß bald mal wieder ein Erzengel vorbeikommt.“ Übersetzungen der Symptome für Schizophrenie in Alltagssprache. in: Bock/Deanders/Esterer (Hrsg.) 1994
Bock,T./ Deranders,J.E./ Esterer,I. (Hrsg.): Stimmenreich. 4.Auflage; Bonn: Psychiatrie
Brechtloff,D. (Hrsg.) (o.J.): Kunstforum International. Die aktuelle Zeitschrift für alle Bereiche der bildenden Kunst. Bd.27; Ruppichterroth o.J. (Q) (Z)
Brockhoff,Victoria (1986): Malen am Krankenbett. in: Türk/Thies (Hrsg.) 1986 (Q)
Cassierer,Ernst (1960): Was ist der Mensch. Stuttgart (Q)
Ciompi,Luc (1982): Affektlogik: über die Struktur der Psyche und ihre Entwicklung. Stuttgart (Q)
Ciompi,Luc (1993): Auf dem Weg zu einer menschlicheren Schizophreniebehandlung. in: Aebi/Ciompi/Hansen (Hrsg.) 1993
Ciompi,Luc (1995): Die Phiosophie der Sozialpsychiatrie im Rahmen eines psycho-sozio-biologischen Verstehensmodells der Psyche. in: Bock u.a. (Hrsg.) 1995
Ciompi,L./ Krupper,Z./ Aebi,E./ Dauwalder,H.P./ Hubschmid,T./ Trüsch,K./ Rutishauser,C. (1993): Das Pilotprojekt „Soteria Bern“ zur Behandlung akut Schizophrener. II. Ergebnisse einer vergleichenden prospektiven Verlaufsstudie über 2 Jahre. Nervenarzt 64 (Z) (Q)
Cross,D.G./ Sheelan,P.W./ Khan,J.A. (1980): Alternative advice and counsel in psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology 48 (Z) (Q)
Czerny,Michael (1989): Einführung in die Bildbetrachtung. Ein psychologisches Essay über die sich in den bildhaften Gestaltungen ausdrückenden Kräfte des Unbewußten. Stuttgart: Deutscher Arbeitskreis Gestaltungstherapie
Dannecker,Karin (1994): Kunst, Symbol und Seele. Thesen zur Kunsttherapie. Frankfurt a.M., Berlin/Bern/New York/Paris/Wien: Peter Lang
Delbée,Anne (1985): Der Kuss. Kunst und Leben der Camille Claudel. München: Knaus
Domma,Wolfgang (1990): Kunsttherapie und Beschäftigungstherapie. Grundlegung und Praxisbeispiele klinischer Therapie bei schizophrenen Psychosen. Köln: Maternus
Dörner, Klaus (1975): Diagnosen in der Psychiatrie. Frankfurt a.M., New York: Campus
Dörner, Klaus/ Plog, Ursula (1992): Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie/Psychotherapie. 7. überarb. Auflage. Bonn: Psychiatrie
DSM-III-R (1989): Diagnostische Kriterien und Differentialdiagnosen des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen. Weinheim, Basel: Beltz
Eisenbeiss, Micha/ Römer, Alfons (1994): Zwei verschiedene Socken - Das Blaumeier Projekt. Bremen: Geffkens
Eisler-Stehrenberger, Karin (1991): Kreativer Prozeß - Therapeutischer Prozeß. in: Petzold/Orth (Hrsg.) 1991
Franzke, Erich (1983): Der Mensch und sein Gestaltungserleben. Psychotherapeutische Nutzung kreativer Arbeitsweisen. 2.Aufl. Bern, Stuttgart, Wien: Hubler
Freud, Sigmund (1907): Der Wahn und die Träume. Gradiva. GW Bd.VII o.O. (Q)
Freud, Sigmund (1906-1909): Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualität. GW Bd.VII, o.O. (Q)
Freud, Sigmund (1917): Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Die Wege der Symptombildung. GW Bd.XI, o.O. (Q)
Freud, Sigmund (1989): Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Und neue Folge. Frankfurt a.M.: Fischer
Furth, Gregg M. (1992): Heilen durch Malen. Die geheimnisvolle Welt der Bilder. 2.Auflage; Olten: Walter
Gabriel, Holgrid (1991): Die Behandlung früher Störungen mit kunsttherapeutischen Mitteln aus der Sicht von C.G. Jung. in: Petzold/Orth (Hrsg.) 1991
Goffmann, Erving (1973): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
Hansen,Hartwig (1993): Vorwort. in: Aebi/Ciompi/Hansen (Hrsg.) 1993
Harlan/ Rappmann/ Schata (1976): Soziale Plastik. Achberg (Q)
Hauser, Arnold (1988): Kunst und Gesellschaft. München: dtv
Haußmann,A./ Schiefer,H.J. (1993): Lerntheoretische Prinzipien in der Kunsttherapie. in: Baukus/Thies (Hrsg.) 1993
Hocke,G.R. (1957): Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der europäischen Kunst. Hamburg (Q)
Hutterer-Krisch, Renate (1994): Einige Ergebnisse der Wirksamkeitsforschung zur psychotherapeutischen Behandlung von Psychosen. in: Hutterer-Krisch (Hrsg.) 1994
Hutterer-Krisch,R.(Hrsg.) (1994): Psychotherapie mit psychotischen Menschen. Wien, New York: Springer
Itten, Johannes (1988): Tagebücher. Wien (Q)
Janzarik, Werner: Der bildnerische Ausdruck seelischen Krankseins als projektiver Stimulus. in: Die Prinzhornsammlung 1980, Königstein i.T. (Q)
Jervis, Giovanni (1978) Kritisches Handbuch der Psychiatrie. Frankfurt a.M.: Syndikat
Jones, Ernest (1970). Die Theorie der Symbolik. (Q) in: Psyche 24/1970 (Z)
Jung, Michael (1990): Studienführer Kunst & Design. München: Lexika
Jung, Carl Gustav (1971): Erinnerungen - Träume - Gedanken. in: Jaffe´ (Hrsg.) 1971 Olten (Q)
Jung, Carl Gustav (1994): Traum und Traumdeutung. 4.Auflage, München: dtv
Jurinetz,W. (1927): Psychoanalyse und Maxismus. in: Unter dem Banner des Marxismus 1927 o.O.
Kandinsky, Wassily (1952): Über das Geistige in der Kunst. Bern (Q)
Katalog (1970): Joseph Beuys - Werke aus der Sammlung Karl Ströher. Basel (Q)
Katalog (1979): Joseph Beuys. Zeichnungen. Nationalgalerie, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz; Berlin (Q)
Keupp, Heinrich (Hrsg.) (1972): Der Krankheitsmythos in der Psychopathologie. München, Wien, Berlin: Urban & Schwarzenberg (Q)
Keupp, Heinrich (1972): Sind psychische Störungen Krankheiten? Einführung in eine Kontroverse. in: Keupp (Hrsg.) 1972
Köttgen, Charlotte (1994): Wir wissen nicht, was Schizophrenie ist. Wider den theoretischen Größenwahn. (K)
Kretschmer,E. (1956): Medizinische Psychologie. 11.Auflage. Stuttgart (Q)
Kruckenberg, Peter (1995): Die Entwicklung der kommunalen Psychiatrie in einer Großstadt - ein vieldimensionaler dynamischer Prozeß. in: Bock u.a. (Hrsg.) 1995
Küppersbusch, Friedrich (1995): „Bis hierhin vielen Dank.“ Moderationen aus ZAK. Hamburg: Konkret
Kurnitzky,H. (Hrsg.) (1980): Notizbuch 3. Kunst und Gesellschaft. Berlin (W): Medusa (Q)
Lamnek, Siegfried (1993): Theorien abweichenden Verhaltens. 5.Auflage; München: Fink
Landgarten, Helen B. (1990): Klinische Kunsttherapie. Karlsruhe: Gerardi
Looden,I.(1971): Beschäftigungstherapie aus der Sicht des Patienten. Z. klin. Psychol. Psychother. 19 (Z) (Q)
Luborsky,L. (1975): Comparative studies of psychotherapies. Archives of General Psychiatry 32 (Z) (Q)
Luthe, Wolfgang (1976): Creativity Mobilisation Technique. New York (Q)
Maaßen, Heinz-Günther (1995): Ich bin schizophren. Erfahrungsbericht. in: Soziale Psychiatrie 3/95 (Z)
Mahlstaedt-Hecke, Lillemor/ Freywald, Dieter (1994): Bildsprache psychischer Erkrankungen. - oder die Hypothese einer (kunst-) therapeutischen Triade. (K)
Mäckler, Andreas (Hrsg.) (1989): Was ist Kunst..? 1.080 Zitate geben 1.080 Antworten. 2.Auflage. Köln: Dumont
Mayer-Brennenstuhl, Andreas (1993): Das Heil der Kunst. Zur Relevanz künstlerischer Handlungsstrukturen für die Kunsttherapie. in: Baukus/Thies (Hrsg.) 1993
Menzen, Karl-Heinz (1994): Einführung in die Kunsttherapie. in: Schottenloher (Hrsg.) Bd.II 1994
Menzen, Karl-Heinz (1994 <b>): Heilpädagogische Kunsttherapie. Methoden und Praxis. Freiburg i.Br.: Lambertus
Menzen, Karl-Heinz (1995): Was tut die Kunst in der Kunsttherapie? in: Musik-, Tanz- und Kunsttherapie 1995 (Z)
Mitzlaff, Stefan (1995): Ist Kunst verrückt? Vortrag, gehalten: Moritzbastei Leipzig, 25.5.1995, Manuskript unveröffentlicht
Musik-, Tanz- und Kunsttherapie (1995), Verlag für Angewandte Psychologie; Göttingen: Hogrefe (Z)
Navratil, Leo (1966): Kunst und Schizophrenie - ein Beitrag zur Psychologie des Gestaltens. München: dtv
Navratil, Leo (1983): Die Künstler aus Gugging. Wien, Berlin (Q)
Osborn, Reuben (1970): Marxismus und Psychoanalyse. Frankfurt a.M.
Ott, Gerhard Heinrich (1993): Bildende Kunst in der Medizin. Wortlose Hermeneutik zwischen Arzt und Patient. in: Baukus/Thies (Hrsg.) 1993
Pawlik, Johannes (1990): Theorie der Farbe. Eine Einführung in begriffliche Gebiete der ästhetischen Farbenlehre. 9.Aufl. Köln: Dumont
Pädagogik (1995): Kreativität. mit Beiträgen von Liebau,E./ Duncker,L/ Kagerer,H./ Vater,B. u.a.; Hamburg: Pädagogische Beiträge (Z)
Peciccia, Maurizio/ Benedetti, Gaetano (1994): Das progressive therapeutische Spiegelbild. in: Schottenloher (Hrsg.) Bd.II 1994
Petersen, Peter (Hrsg.) (1990): Ansätze kunsttherapeutischer Forschung. Berlin, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona: Springer
Petersen, Peter (1994): Der Therapeut als Künstler. Ein integrales Konzept von Psychotherapie und Kunsttherapie. 3.Auflage Paderborn: Jungfermann
Petzold, Hilarin/ Orth, Ilse (1991): Die neuen Kreativitätstherapien. Handbuch der Kunsttherapie Bd.I. 2.Auflage; Paderborn: Jungfermann
Petzold, Hilarion/ Sieper, Johanna (1991): Kunst und Therapie, Kunsttherapie, Therapie und Kunst - Überlegungen zu Begriffen, Tätigkeiten und Berufsbildern. in: Petzold/Orth (Hrsg.) 1991
Prinzhorn, Hans (1994): Bildnerei der Geisteskranken. 4.Auflage; Wien, New York: Springer
Pütz, Hildegard/ Glöckner, Michael (1993): Grundlegendes über die künstlerischen Therapien der Anthropsophischen Medizin und Darstellung ihrer Zeitgestalt am Beispiel einer Maltherapie. in: Baukus/Thies (Hrsg.) 1993
Rank/ Sachs (1913): o.T. (Q) Zitiert nach Jones 1970 in: Psyche 24/1970 o.O. (Z)
Rech, Peter W. (1995): Meine Praxis, oder: Die unerschöpfliche Generierung der Kunsttherapie. in: Musik-, Tanz- und Kunsttherapie 1995 (Z)
Reich, Wilhelm (1970): Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. in: Bernfeld (Hrsg.) 1970
Riedel, Ingrid (1991): Bilder in Therapie, Kunst und Religion. Wege zur Interpretation. 2.Auflage Stuttgart: Kreuz
Riedel, Ingrid (1990 a): Farben in Religion, Gesellschaft und Psychotherapie. 8.Auflage Stuttgart: Kreuz
Riedel, Ingrid (1990 b): Formen. Kreis, Kreuz, Dreieck, Quadrat, Spirale. 4.Auflage Stuttgart: Kreuz
Riedel, Ingrid (1992): Maltherapie: eine Einführung auf der Basis der Analytischen Psychologie von C.G. Jung. Stuttgart: Kreuz
Romain, Lothar (1994): Kunst als sozialer Prozeß. Ein Rückblick mit Zukunft. in: Schottenloher (Hrsg.) Bd.II 1994
Roth, Gerhard (1994): Geleitwort. in: Prinzhorn 1994
Scharfetter, Christian (1995): Schizophrene Menschen. 4.Auflage. Weinheim: Psychologie
Schmeer, Gisela (1993): Psychoanalytische Kunsttherapie. in: Baukus/Thies (Hrsg.) 1993
Schmitz, Susanne (1994): Symptome schizophrener Patienten in Nigeria und Deutschland. (K)
Schottenloher,Gertraud (Bd.II)(1994): Alle zwei Minuten ein Bild. „Messpainting“. Ein fast japanisches Experiment. in: Schottenloher (Hrsg.) Bd.II 1994
Schottenloher, Gertraud (1990): Das Unbewußte des Therapeuten als Mitgestalter der kunsttherapeutischen Beziehung. in: Petersen (Hrsg.) 1990
Schottenloher, Gertraud (Bd.II) (1994): Metamorphosen. Ein Beispiel aus dem Unterricht. in: Schottenloher (Hrsg.) 1994
Schottenloher, Gertraud (Bd.I 1994): Weg als Ziel: Bildnerisches Gestalten als Therapie? in: Schottenloher (Hrsg.) Bd.I 1994
Schottenloher, Gertraud (Hrsg.) (Bd.I/II)(1994): Wenn Worte fehlen, sprechen Bilder. Bildnerisches Gestalten und Therapie. München: Kösel
Schrode, Helena (1995): Klinische Kunst- und Gestaltungstherapie. Regression und Progression im Verlauf einer tiefenpsychologisch fundierten Therapie. Stuttgart: Klett-Cotta
Schuster, Martin (1993): Kunsttherapie. Die heilende Kraft des Gestaltens. 4.Auflage; Köln: Dumont
Schwab, John J. (1995): Neubewertung der Sozialpsychiatrie. in: Bock u.a. (Hrsg.) 1995
Schwer, Paul (1994): Die therapeutische Bedeutung gemeinsamen künstlerischen Handelns von Patienten und Künstlern. (K)
Selz, Jean (1993): Edvard Munch. Bindlach: Gondrom
Siebenthal,W.v. (1953): Die Wissenschaft vom Traum. Berlin, Göttingen, Heidelberg (Q)
Soziale Psychiatrie. Rundbrief der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V.; 19.Jahrgang, Heft 3 1995 o.O. (Z)
Stachelhaus, Heiner (1989): Joseph Beuys. Leipzig: Reclam
Stachelhaus, Heiner (1973): Phänomen Beuys. in: Magazin Kunst. 2.Quartal o.O. (Q)
Stange, Sabine (1994): Maske Blauhaus in Tinaia. Ein Atelier für Menschen, die sich Raum und Zeit nehmen wollen, um sich zu entwickeln. (K)
Steiner, Rudolf (1978): Theosophie. Dornbach (Q)
Surguladze, Simon A. (1994): Values, attitudes and schizophrenia. (K)
Thomas, Günther J. (1986): Unterschicht, Psychosomatik und Psychotherapie. Eine kritische Sichtung von Forschung und Praxis. Paderborn: Jungfermann
Titze, Doris (1993): Es ist der eigene Weg, der allen gemeinsam. Ein Kunst(-Therapie)projekt in der Psychiatrie. in: Baukus/Thies (Hrsg.) 1993
Tomalin, Elisabeth / Schauwecker, Peter (1993): Interaktionelle Kunst- und Gestaltungstherapie in der Gruppe. Köln: Claus Richter
Tretter, Felix (1994): KunstTherapie in einem Bezirkskrankenhaus aus ärztlicher Sicht. in: Schottenloher (Hrsg.) Bd.1 1994
Tüpker, Rosemarie (1990): Auf der Suche nach angemessenen Formen wissenschaftlichen Vorgehens in kunsttherapeutischer Forschung. in: Petersen (Hrsg.) 1990
Türk,K.H. (1993): Aspekte der Form- und Raumtherapie - ein Plädoyer für das Haptische. in: Baukus/Thies (Hrsg.) 1993
Türk,K.H./ Thies,J. (Hrsg.) (1987): Bilder von Behinderten. Aus der Welt psychisch Kranker und geistig Behinderter. Nürtingen: Freie Kunstschule
Türk;K.H./ Thies,J. (Hrsg) (1986): Therapie durch künstlerisches Gestalten - wider die Handlungsverarmung in unserer Zeit. Stuttgart (Q)
Wellendorf, Elisabeth (1991): Psychoanalytische Kunsttherapie. in: Petzold/Orth (Hrsg.) 1991
WHO (Hrsg.) (1993): Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD - 10. Dilling,H.; Mombour,W.; Schmidt,T.H.; 2.Auflage. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Huber
Wick, Rainer (1988): Bauhauspädagogik. Köln (Q)
Wick, Rainer (o.J.): Kunst als sozialer Prozeß. in: Brechtloff (Hrsg.) (o.J.)
Windgassen, Klaus (1989): Schizophreniebehandlung aus Sicht des Patienten. Untersuchungen des Behandlungsverlaufs und der neuroleptischen Therapie unter pathischem Aspekt. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong: Springer
Wulff, Erich (1994): Diagnostische und therapeutische Antworten auf kulturspezifische Symptomformulierungen bei Schizophrenen. (K)
Zweite,A. (1986): Beuys zu Ehren. München (Q)
Zwerling, Israel (1991): Die Therapien der „kreativen Künste“ als Form der Psychotherapie. in: Petzold/Orth (Hrsg.) Bd.I 1991
Bildnachweis
Deckblatt: „Mandala“ A.S. Kunsttherapie (Kt)
Seite
1 „Buntes Ensemble“ 1938 W. Kandinsky
2 „Gespalten“ 1980 R. Andiel
3 „Wunderhirte“ Fall 18 in: Prinzhorn 1994 (P)
4 „Shot Red Marilyn“ 1964 A. Warhol
5 „Der große Paranoiker“ 1936 S. Dali
6 „Frauen und Vögel in der Nacht“ 1945 J. Miro „Der Sturz des Zauberers Hermogenes“ P. Breugel d.Ä. (um 1525-1569)
7 „Selbstbildnis mit Gasmaske“ 1930 B. Gilles „Selbstbildnis mit sieben Fingern“ 1912/13 M. Chagall
8 „Collage“ 1996 H. Klemm
9 „o.T.“ R. Block „Kunstwerk“ D Becher
10 „Skt. Adolf Bank“ A. Wölfli
11 „Madonna“ E. Munch
12 „Bildnis Sigmund Freud“ 1937 S. Dali
13 „Fischreiter über der Stadt“ Detail aus: „Die Versuchung des Hl. Antonius“ H. Bosch „Der Rufer“ C. Hofer (1878-1955)
14 „Collage“ H.Klemm 1996
15 „Vereinigung des Unvereinbaren“ indische Darstellung „Turmbau zu Babel“ 1563 P. Breugel d.Ä.
16 „Turmbau zu Babel“ 1595 M. I. v. Valckenbosch „Babel - Verwirrung“ 1983 J. Feige
17 „Doppelkopf“ J. Schrott (Kt)
18 „Maul halten und weiter dienen“ 1927 G. Grosz „Russische Frauenliebe“ Fall 174 (P)
19 „Composition“ 1921 P. Mondrian (1872-1944) Mondrians Atelier in New York
20 „Palau-Insulaner“ M. Pechstein (1881-1955) „Tasse de thè V (utopique)“ 1966 J. Dubuffet
21 „Dekorativer Entwurf“ Fall 244 (P)
22 „Hexe mit Adler“ Fall 18 (P) „Reptilien“ 1943 M. C. Escher
23 Beispiel für die Gestaltung einer Janusform (Doppelaspekt) (Kt)
24 „Der Künstler“ W. Kandinsky „Hahn“ N.N. (Kt)
25 „Wurmlöcher usw.“ Fall 36 (P) „Dekorative Zeichnung mit Vögeln“ Fall 90 (P)
26 „Site avec trois personnages“ 1982 J. Dubuffet „Bauernhof“ Fall 90 (P)
27 „Lufterscheinung“ Fall 57 (P) „Konflikt“ 1980 R. Andiel
28 „Der Greis im Laufstuhl“ Detail aus: „Die Versuchung des Hl. Antonius“ H. Bosch
29 „Frau mit Blume“ 1932 P. Picasso
30 „Die großen Fische fressen die kleinen“ 1557 P. Breugel „Republikanische Automaten“ 1920 G. Grosz
31 „Zwischen Ost und West“ 1946/47 A. P. Weber ohne Quelle
32 „Der Kampf zwischen Karneval und Fasten“ (Detail) 1559 P. Breugel
33 „Empfang und Abgrenzung“J. Schrott (Kt)
34 „Der Baummensch in der Landschaft“ H. Bosch
35 „Verbum“ 1942 M. C. Escher
36 Pergamentblatt mit einem koptischen Zaubertext, Ägypten 12. Jh.
37 „Die Vewrsuchung des Hl. Antonius“ (Detail) 1512/15 M. Grünewald (um 1480-1528) ohne Quelle
38 „Keller, Wirtshaus, Salon, Stall in Einem“ 1915 Fall 36 (P)
39 „Sitzender Mann“ Terrakotta Alt-Nigeria
40 „Sechs Gesichter“ Fall 36 (P) „Ecce Homo“ Fall 91 (P)
41 „Adam und Eva“ um 1930 M. Chagall Keramikgefäß, Hohokam-Kultur, !. Jh. v.u.Z.
42 „Maria mit dem Kinde, auf Drache und Löwe stehend“ um 1230 N.N.
43 o.T., J. Schrott (Kt)
44 „Der Kuß“ 1895 E. Munch „Begegnung im All“ 1899 E. Munch
45 „Der Traum“ M. Beckmann (1884-1950)
46 „Aus der Dunkelheit“ (Detail) J. Jentges „Soldat und Armee“ Fall 2 (P)
47 „Viatorium spagyricum“ 1625 Jamsthaler „Kreuzigung“ Anf. 11. Jh.
48 Zeichnung einer schizophrenen Patientin und Antwort- zeichnung des Therapeuten N.N. (Kt) Aufeinanderzu-Malen N.N. (Kt) Handkopie als Vorlage und Fortführung N.N. (Kt)
49 „Sonntag“ 1953/54 M. Chagall „Höllenhund und Paradiesvogel“ 1911 W. Kandinsky
50 Zeichnungen eines Schizophrenen auf dem Höhepunkt der Psychose (a), während des Behandlungsverlaufes (b-e) und nach Herstellung (f) (Kt) in: Navratil 1966 (N) Zeichnungen eines Schizophrenen im akuten Stadium der Psychose (a), während des Behandlungsverlaufes (b-e) und nach der Behandlung (f) (Kt) (N)
51 Gemischtes Porträt Fall 193 (P) Erzeugnisse eines Schizophrenen nach Aufforderung, einen Menschen zu zeichnen; (a) unbehandelt; (b) nach Behandlung (Kt) (N) Zeichnungen des schizophrenen Hans (Kt) (N)
52 Drei Holzschnitte aus Lycosthenes 1557 „Dreifaltigkeit“ N.N. Drei Kopffüßer nach Breugel „Das Gerücht“ 1943/53 A.P. Weber
53 „Lamm Gottes“ Fall 90 (P) Zauberer beim Kulttanz, Jungpaläolithikum
54 „Das hl. Schweißwunder in der Einlegesohle“ Fall 15 (P) Der Kriegsgott Ku, prähistorisch „Halb Mensch, halb Tier“ 1980 R. Andiel Johannessymbol, 8. Jh.
55 „Scala lapidis“ 17. Jh. N.N. „Wald mit Vögelchen, Drachen und Blut“ Fall 82 (P)
56 „Hindenburg“ Fall 17 (P) „David und Goliath“ Anf. 10. Jh. „Unterweisungen in der Sexualität I, Blatt 2“ 1974 H. Bellmer
57 Zeichnungen eines Kr. während akutem Schub (a), nach Ende der Behandlung (b), drei Tage später (c) und nach Abklingen des schizophrenen Schubes (d) (Kt) (N) „Begegnung“ 1944 M. C. Escher
58 „Zuchthaus-Chikane“ Fall 180 (P) „Die Zeit hat keine Ufer“ 1930/39 M. Chagall
59 Zeichnung eines 16jährigen während seines zweiten schizo- phrenen Schubes (a-c) und nach abklingen der Psychose (d) (N)
60 „Melancholie“ 1970 A. P. Weber o.T. E. Munch
61 „Das bescheidene Tier“ Fall 17 (P) „Stierkopf“ Herr U.
62 „Der Rabe“ Carl Spitzweg
63 „Frauen am Strand“ 1898 E. Munch
64 Verlauf der Kunsttherapie mit einer Frau (a-c) N.N. (Kt)
Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.
Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.
Vorliegende Arbeit kann in der Bibliothek der Hochschulöffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
- Arbeit zitieren
- Holger Klemm (Autor:in), 1996, Die Relevanz der Kunsttherapie. Dargestellt am Beispiel der Arbeit mit Schizophrenen., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108212
Kostenlos Autor werden









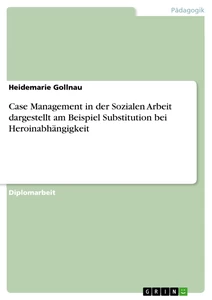
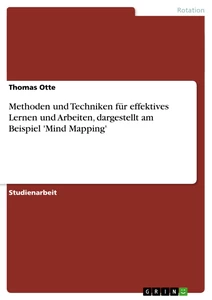









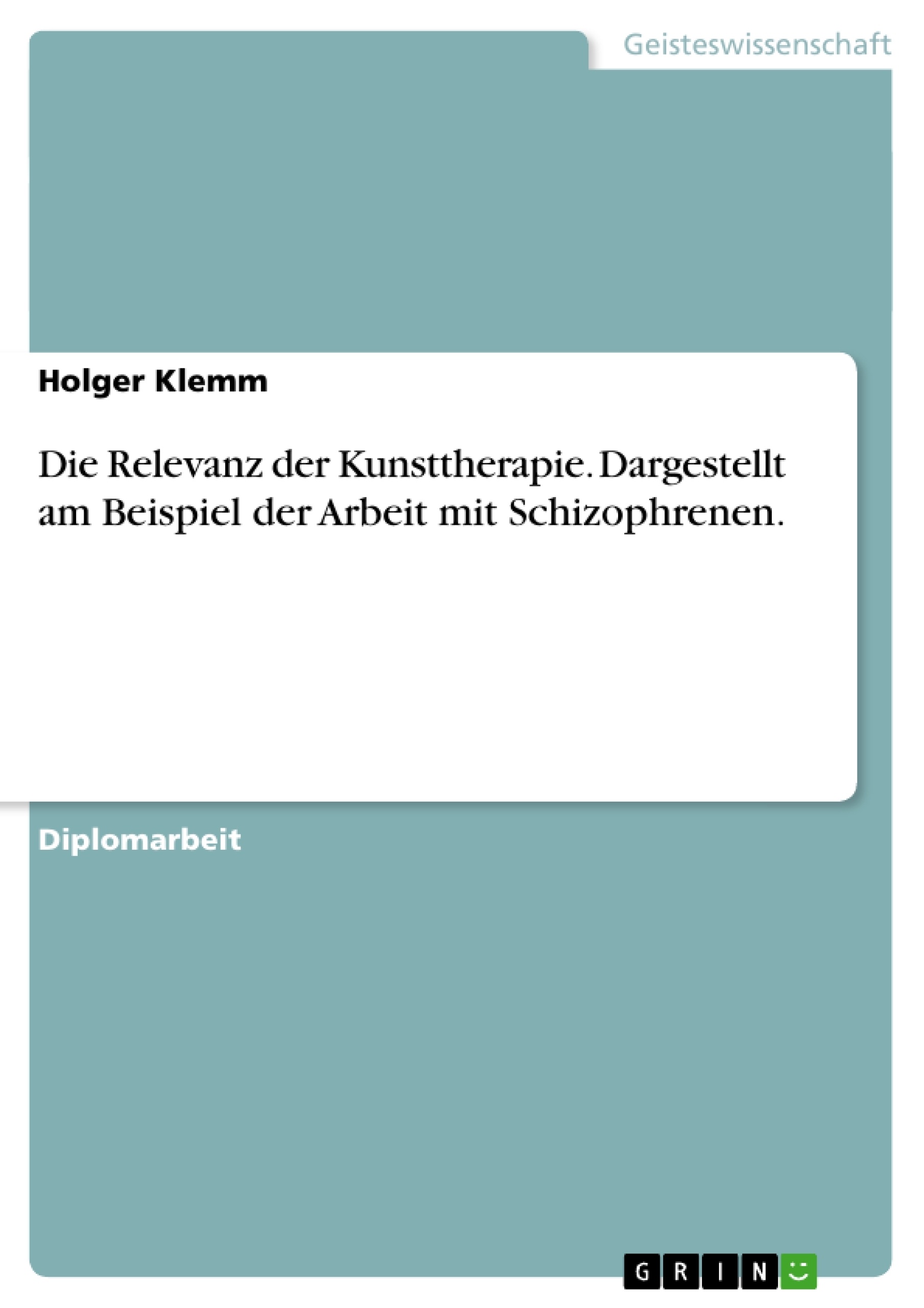

Kommentare