Leseprobe
Inhalt
Einleitung
1.1 Die Entwicklung des MfS und sein Verhältnis zur Literatur
1.2 Das Verhältnis der Schriftsteller zum MfS
1.3 Christa Wolf - (K)eine Biographie
2.1 Was bleibt inhaltlich?
2.2 Inhalt
2.3 Analyse
3.1 Der Literaturstreit
4. Schlussbetrachtungen
Literaturangaben
Einleitung
Bei der Lektüre der Sekundärliteratur, Aufsätze und Stellungnahmen zu Christa Wolfs 1990 veröffentlichter Erzählung „Was Bleibt“ fällt schnell auf, dass sich die Rezensenten in zwei Lager aufspalten. In anbetracht des durch das Erscheinen des Buches in der Umbruchphase zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung ausgelösten gesamtdeutschen Literaturstreites ist dies kaum verwunderlich, zeigte sich doch schon in der Frühphase des Streits, dass sich zwei unversöhnliche Parteien gegenüberstehen.
Die Frontlinie, an der entlang sich die Gemüter erhitzten, war dabei keineswegs mit parteipolitischen oder gar der (noch bestehenden) innerdeutschen Grenze zu verwechseln. Doch nur gesellschaftspolitische Zusammenhänge können im Ansatz das Phänomen des ersten gemeinsam-gesamtdeutschen Literaturstreits erhellen.
Um die Hintergründe der Erzählung „Was bleibt“ zu veranschaulichen, schien es mir sinnvoll, zunächst die Entstehung und Entwicklung des Ministeriums für Staatssicherheit und dessen Beziehung zur Literatur zu recherchieren. Aus entgegengesetzter Sicht wird daraufhin das Verhältnis von Schriftstellern zum Staatssicherheitsdienst unter spezieller Berücksichtigung Christa Wolfs eigener Tätigkeit für das Ministerium betrachtet. Kontrastiert werden diese Erkenntnisse durch biographische Aspekte Christa Wolfs.
Nach dieser differenzierenden Vorarbeit steht die Erzählung „Was bleibt“ im Zentrum dieser Arbeit. Neben einer inhaltlichen Analyse soll es vor allem um die Darstellung der Protagonistin gehen, welche als zentrales Argument in dem dadurch ausgelösten Literaturstreit fungierte.
Eine Verlaufsrekonstruktion des Literaturstreites versucht schließlich den Absichten der Streitenden auf den Grund zu gehen und deren Argumentation gegenüberstellend nachzuvollziehen.
1.1 Die Entwicklung des MfS und sein Verhältnis zur Literatur
Es macht vor dem Hintergrund der Erzählung „Was bleibt“, aber auch im Zusammenhang der Vorwürfe gegen Christa Wolf im Literaturstreit und der darauffolgenden öffentlichen Debatte um das Bekannt werden ihrer Tätigkeit als IM „Margarete“ gegen Ende der Fünfziger Jahre Sinn, sich der Entwicklungsgeschichte des Ministeriums für Staatssicherheit anzunehmen, weil sich dadurch die bewussten Leerstellen in der Erzählung mit Fakten auffüllen lassen und die Motivation einer jungen Schriftstellerin, die ihrem ebenfalls jungen sozialistischen Staat dienen will, darin eher verstehen lässt, als in dem Zustand der Deutschen Demokratischen Republik im Prozess ihrer Auflösung des Sommers 1990.
Das Ministerium für Staatssicherheit war am 08. Februar 1950 unter Wilhelm Zaisser und seinem Stellvertreter Erich Mielke gegründet worden. In den Nachkriegsjahren hatten Sowjetische Sicherheitsorgane, seit 1946 die Deutsche Verwaltung des Inneren und 1949 ein Sicherheitsausschuss im Ministerium des Inneren das Gebiet der Sowjetisch Besetzten Zone und das Staatsgebiet der neu gegründeten Deutschen Demokratischen Republik überwacht. Die Aufgabe der Behörde bestand darin, auf geheimdienstlichem Wege die staatliche Sicherheit und Integrität zu gewährleisten.
Der Aufbau der Institution fand unter fachlicher Anleitung und Hilfestellung von Mitarbeitern des sowjetischen NKWD (Narodny kommissariat wnutrennich del – Volkskommissariat für innere Angelegenheiten; später KGB) statt und förderte so die Herausbildung einer Organisation nach sowjetischem Vorbild. Mit der 1951 im MfS gegründeten Hauptverwaltung Aufklärung (intern HV A) unter der Leitung von Markus Wolf setzte sich die Einsicht in die Notwendigkeit der Auslandsaufklärung während des kalten Krieges, der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung im kapitalistischen Ausland, vornehmlich auf dem Staatsgebiet der ebenfalls jungen Bundesrepublik Deutschland, durch.
Die im selben Jahr eingerichtete Hauptabteilung V (intern HA V) dagegen hatte sich mit der geheimpolizeilichen Tätigkeit im Inneren der Republik zu befassen. Während deren Hauptaufgaben in den frühen Fünfziger Jahren vor allem im Kampf gegen die Republikflucht und im Vorantreiben der Kollektivierung der Landwirtschaft bestand, zeigten sich erste Ergebnisse der Arbeit im Bereich der Kulturpolitik nach dem Ungarn-Aufstand 1956. Intellektuellen und Schriftstellern wie Walter Janka, Wolfgang Harich und Erich Loest konnte, nach kritischen Stellungnahmen zu den Vorgängen in Budapest, auf grund der gesammelten Informationen der Prozess gemacht werden. Auch Institutionen wie dem Schriftstellerverband, dem Literaturinstitut Johannes-R.-Becher und dem Aufbau Verlag Berlin widmete sich das MfS in Form operativer Vorgänge (OV). Der Mauerbau 1961 brachte einen Zuwachs an Operativen Vorgängen, wobei die Betätigungsfelder ausgeweitet wurden und die Mitarbeiterzahlen stiegen.
Nach der Umbenennung der HA V in HA XX, mit 1300 festen Mitarbeitern, entstehen, im Zusammenhang mit den Ereignissen in Prag 1968 und den dazu geäußerten Meinungen verschiedener Schriftsteller, die Operativen Vorgänge „Diversant“ gegen Stefan Heym und „Lyriker“ gegen Wolf Biermann. Die 1969 gegründete HA XX/7, zuständig für den Kulturbetrieb, wähnt ihren Hauptaufgabenbereich zunächst bei Presse, Rundfunk und Medien; die Literatur gerät erst nach und nach in den Blickwinkel der Betrachtung. Das ebenfalls 1969 verfasste Statut des Ministeriums für Staatssicherheit stellt die von ihm erwartete Arbeit in folgender Reihenfolge zuerst auf die Grundlagen des Programms der Partei, danach auf die Grundlagen der Beschlüsse des Zentralkomitees und des Politbüros der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und zu guter letzt auf die Grundlagen der Verfassung der DDR.
Der 1973 geschlossene Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR mit erweiterten Transit- und Reisemöglichkeiten führt zu einem Ausbau des Netzes Informeller Mitarbeiter (IM), wodurch eine flächendeckende Überwachung, speziell der Transitstrecken einsetzt. Mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 räumt die politische Führung den DDR-Bürgern politische Grundrechte ein, die sogleich im Ministerium für Staatssicherheit zur Planung einer vorbeugenden Überwachung führen. Die Umwelt-, Friedens- und Menschenrechtsgruppen, zumeist unter dem Dach der Kirche entstanden, werden systematisch unterwandert und überwacht.
In den Folgen der Biermann-Ausbürgerung 1976 erkennt man im MfS die Notwendigkeit, die sich bildende breite Protestbewegung zu zerschlagen. Während die HA XX/7 1974 insgesamt acht Operative Vorgänge verzeichnete, sind es 1976/77 schon Einunddreißig.
Die aktivste und operativ erfolgreichste Periode für das MfS stellen die Achtziger Jahre dar, die allerdings auch in der Auflösung desselben gipfelten. Neben der in den Neunziger Jahren öffentlich diskutierten Unterwanderung der unpolitischen Literatur-Szene am Prenzlauer Berg durch deren Zentralgestalt Sascha Anderson wurden IM vor allem in kirchlichen Umwelt- und Friedensgruppen installiert um diese zu steuern und kontrollieren.
Im Dezember 1989 wird das MfS vom Ministerpräsidenten Hans Modrow in Amt für Nationale Sicherheit (AfNS) umbenannt. Nach der Besetzung der Zentrale in der Berliner Normannenstrasse im Januar 1990 kommt es im Februar zur Einsetzung eines Staatlichen Komitees zur Auflösung des MfS/AfNS. Nach den Volkskammerwahlen im März 1990 kommt es zu einer Überprüfung der Abgeordneten, was aber keine Folgen hatte, da die Ergebnisse nicht veröffentlicht wurden. Durch die Wiedervereinigung am 3. Oktober übernimmt die Treuhandanstalt das Vermögen des Staatssicherheitsdienstes und die neu geschaffene Gauck-Behörde die Aktenbestände.
Das Ministerium für Staatssicherheit verfügte zwischen 1950 und 1990 über eigene Untersuchungsgefängnisse, die von keiner anderen staatlichen Stelle kontrolliert wurden. Entwickelt und gepflegt wurde ein eigener, militärisch geprägter Sprachschatz, in dem „feindlich-negative Kräfte“ zu beobachten oder „auszuschalten“ waren, „personelle Schwerpunkte“ zu „zersetzen“ waren, wo die betreffenden „Elemente“ „destabilisiert“ und „neutralisiert“ wurden und Maßnahmepläne erarbeitet. Im Jahre 1989 arbeiteten für das MfS 85500 Hauptamtliche und 174200 Inoffizielle Mitarbeiter, wodurch rechnerisch auf 65 Einwohner ein Mitarbeiter der Staatssicherheit entfiel. In der internen Dienstanweisung 3/69, dem Jahr der Bildung der HA XX/7 wird der kulturpolitische Auftrag des MfS folgendermaßen definiert: „Das strategische Ziel der sozialistischen Kulturpolitik besteht in der Herausbildung der sozialistischen Menschengemeinschaft und in der Schaffung der gebildeten sozialistischen Nation, die zugleich als Vorbild auf Westdeutschland und andere kapitalistische Länder ausstrahlt.“[1]
1.2 Das Verhältnis der Schriftsteller zum MfS
Schon in den Fünfziger und Sechziger Jahren gab es eine Reihe von Schriftstellern und Intellektuellen, die vom MfS angeworben wurden und sich, schriftlich oder mündlich, dazu verpflichteten, dem Ministerium Informationen zu liefern. Die Ermittler erhofften sich dadurch, Einfluss in Gremien und Institutionen, verwertbare Informationen über andere Schriftsteller und damit zunehmende Kontrolle im kulturellen Bereich zu erlangen. So wurden beispielsweise Christa Wolf zwischen 1959 und 1962 unter dem Decknamen „Margarete“, Erwin Strittmatter von 1959 bis 1961 als Geheimer Informant (GI) „Dollgow“ und Franz Fühmann 1954 bis 1959 als GI „Salomon“ geführt. Die Bedeutungslosigkeit des weitergegebenen Wissens machte in diesen Fällen eine Zusammenarbeit auf längere Sicht für das MfS nutzlos, was zu einer Beendigung der Treffen führte. Erstaunlich ist dabei das spätere Auftauchen derselben ehemaligen Informanten in eigens für sie angelegten Operativen Vorgängen: Christa Wolf ab 1969 im OV „Doppelzüngler“, Franz Fühmann im OV „Filou“ und Ulrich Plenzdorf (von 1971 bis 1973 IM „Ewald Richards“) im OV „Dramatiker“.
Was den Einzelnen bewogen haben mag, dem System auf diese Art und Weise zu dienen, ist kaum herauszufinden. Individuelle Illusionen über die Evidenz eines solchen Schrittes mögen vielleicht in den bisher genannten Fällen in Betracht kommen, gänzlich erhellen können sie das Verhalten nicht.
Ein weitaus folgenreicheres und verwirrenderes Beispiel lieferte mit seiner Rolle zwischen dem MfS und der unabhängigen, halböffentlichen Literaturszene am Prenzlauer Berg Sascha Anderson, alias IM “David Menzer“. Angeworben im Januar 1975 in Dresden stößt er Anfang der Achtziger Jahre in die alternative Kunstszene Berlins, wo er durch sein Organisationstalent, sichere Westverbindungen und ausreichende finanzielle Mittel schnell zum kreativen Kopf der jüngeren Autoren und Maler wird. Neben dem Observieren und Sabotieren, Kontrollieren und Denunzieren versuchte er vor allem die verschiedenen Strömungen zu zentralisieren und auf seine Person zu konzentrieren. Selbst nach seiner Übersiedlung 1986 nach Westberlin war er dem Ministerium eng verbunden und überwachte die dorthin ausgereisten Oppositionellen und Künstler. Der Spagat zwischen Selbstverleugnung und künstlerischer Ambition und das Verschmelzen verschiedener Identitäten in einer Person erzeugte in seinem Fall das Gesamtkunstwerk[2] Sascha „Arschloch“[3] Anderson.
1.3 Christa Wolf - (K)eine Biographie
Von ganz anderer Qualität erscheint im Kontrast zur Aktivität Sascha Andersons die von Hermann Vinke veröffentlichte Personalakte des Ministeriums für Staatssicherheit über Christa Wolf als GI (Geheimer Informant) „Margarete“.[4]
Der Anwerbungsbericht ihres Führungsoffiziers vom 25.03.1959 hält fest, dass sie „ohne großes Zögern“ ihre Zustimmung zur Unterstützung des MfS gegeben habe und zu den ihr gestellten Fragen „alles genau und ausführlich berichtete.“ „Lediglich bei der Frage der Konspiration und das Verbot, gegenüber dritten Personen (Anm. ihrem Ehemann Gerhard Wolf) zu sprechen, versetzte sie in eine leichte unruhige Stimmung, die jedoch durch ein Entgegenkommen unsererseits bereinigt wurde.“[5]
Im Perspektivplan für den GI „Margarete“ vom November des selben Jahres werden die bei den „wenigen Treffs“ von ihr abgegebenen Berichte als von „nur informatorische(m) Charakter“[6] eingeschätzt, die jedoch „zur Einschätzung von Personen verwandt werden“ konnten. Darüber hinaus sieht man für „den GI eine reichhaltige Perspektive unter den Literaturschaffenden.“ Allerdings werden auch Schwächen des GI bemerkt: „Auffallend an der Zusammenarbeit war eine größere Zurückhaltung und überbetonte Vorsicht, die aus einer gewissen intellektuellen Ängstlichkeit herrührt.“[7] Durch das Arbeitspensum, „die vielen Dienstreisen“ und den Wohnortwechsel der Wolfs nach Halle kommt es dort nur zu wenigen Gesprächen mit einem Mitarbeiter der Stasi. Der IM-Vorgang „Margarete“ wird nach dem Umzug der Wolfs von Halle nach Potsdam von der dortigen Bezirksverwaltung nicht übernommen und am 29.11.1969 eingestellt.[8]
Ein 1965 in Berlin von der Hauptabteilung XX/1 des MfS angefertigter Auskunftsbericht über Christa Wolf definiert sie als freischaffende Schriftstellerin und Kandidatin des ZK der SED.[9]
Der Bericht listet dann nach der sozialen Herkunft den beruflichen Werdegang auf: vom Schulbesuch 1935 in Landsberg und dem Abitur 1949 in Bad Frankenhausen am Kyffhäuser über das Studium der Germanistik in Jena/Leipzig 1949-53 bis zu den verschiedenen wissenschaftlichen Tätigkeiten im Deutschen Schriftstellerverband, im Verlag „Neues Leben“, bei der Zeitschrift „Neue Deutsche Literatur“ und im Mitteldeutschen Verlag Halle.
Im Anschluss wird die politische Entwicklung anhand der Mitgliedschaften in politischen Organisationen zusammengefasst (1935-45 BDM, 1948 FDJ, 1949 SED und DSF, 1953 FDGB, GST und Vorstand des DSV). Auch Auszeichnungen (1961 Kunstpreis der Stadt Halle für die „Moskauer Novelle“ und 1963 Heinrich-Mann-Preis für „Der Geteilte Himmel“) bleiben nicht unerwähnt.
Die Familienverhältnisse werden durch die Tätigkeit und Parteizugehörigkeit des Ehemannes Gerhard Wolf und die Geburtsdaten der beiden Töchter (1952/56) für die Hauptabteilung XX/1 ausreichend beleuchtet.
Von größerer Wichtigkeit erscheinen vier Jahre nach dem Mauerbau die Auslandsreisen nach Frankfurt am Main und nach Jugoslawien. Die darauf folgende ausführliche Einschätzung der Genossin Wolf attestiert ihr zwar zeitweilig politische Schwankungen, schätzt sie aber in ihrer politischen Entwicklung als zuverlässige und gute Genossin ein.
Der Bericht schließt mit dem Operativen Hinweis auf die konspirative Zusammenarbeit mit der Genossin Wolf. Operative Maßnahmen sind zu diesem Zeitpunkt „infolge der positiven politischen Einstellung der Familie Wolf nicht eingeleitet“ worden.
Noch nicht, wie sich vier Jahre später herausstellen wird.
2.1 Was bleibt inhaltlich?
Die Erzählung „Was Bleibt“ präsentiert laut Klappentext des Luchterhand-Verlages die „Aufzeichnungen über einen Tag aus dem Leben einer von Staatssicherheitsbeamten observierten Frau“. Diese Reduzierung bietet vor dem Hintergrund der autobiographischen Analogien der erzählenden Figur mit Christa Wolf reichlich Spielraum zu Unterstellungen.
Auch der Titel der Erzählung ist mehrdeutig. Es könnte sich dabei um eine Frage handeln: Was bleibt? Dass an verschiedenen Stellen im Text das Fragezeichen fehlt[10], bemerkt auch die Schreibende: „Fragezeichen. Die Zeichensetzung in Zukunft gefälligst ernster nehmen, sagte ich mir.“[11] Einfacher betrachtet würde der Text davon handeln, was bleibt. Beide Varianten geben allerdings keine nähere Auskunft darüber, wovon.
Die am Ende der Erzählung vermerkten Daten, Juni/Juli 1979 und November 1989[12], meinen den Entstehens- bzw. Überarbeitungszeitraum. Diese führten insofern zu Kritik, als dass nicht deutlich wird, welche Textelemente wann geschrieben wurden, ob nur geringfügige Änderungen vorgenommen wurden, oder weite Teile hinzugefügt, verändert oder entfernt. Ob dies für eine literaturwissenschaftliche Untersuchung ausschlaggebend ist, bleibt fraglich.
Dass der Text als „Erzählung“ bezeichnet wird, legt eine zeitliche Distanz zwischen dem Erlebten und dessen Niederschrift nahe. Die zugespitzte Handlung gegen Ende des Textes nähert sich dagegen in der Art ihrer Beschreibung der „unerhörten Begebenheit“ einer Novelle.
2.2 Inhalt
Um der verwirrenden Vielschichtigkeit der Erzählung auch in der Analyse folgen zu können, soll hier die Handlung noch einmal vereinfacht dargestellt werden:
Nach dem morgendlichen Aufstehen vergewissert sich die Ich-Erzählerin der Anwesenheit ihrer Beobachter, frühstückt und führt ein Telefonat mit einem Bekannten. Um der schnell einsetzenden Lethargie ihrer Gedanken zu entfliehen, beschließt sie einkaufen zu gehen. Unterwegs betritt sie ein Spirituosengeschäft, wo ihr die Verkäuferin von der Verfolgung einer jüdischen Freundin im Dritten Reich erzählt. Während des Anstehens in einer Kaufhalle, die sie danach aufsucht, um für ihren im Krankenhaus liegenden Mann einzukaufen, beobachtet sie die Umstehenden.
Auf dem Postamt, wo sie Geld holt, sieht sie einen früheren Bekannten, der es vermeidet, sie zu grüßen. Gedankenversunken begibt sie sich nach hause. Dort angekommen liest sie die tägliche Post und wird von der Veranstalterin des Kulturhauses angerufen, in dem sie am Abend eine Lesung hat. Von dieser wird sie gebeten, früher zu der Veranstaltung zu kommen, da mit Andrang gerechnet wird. Nach dem Mittagessen telefoniert sie mit ihrer jüngeren Tochter, um sich dann zum Mittagsschlaf hinzulegen.
Sie kocht sich, nachdem sie wieder aufgestanden ist, Kaffe und erhält Besuch von einer jungen Frau, die ihr ein Manuskript zu lesen gibt, welches die gesellschaftlich-politischen Zustände beim Namen nennt. Sie unterhält sich mit der jungen Frau über deren Lebensumstände und fährt, nachdem diese wieder gegangen ist, mit dem Auto ins Krankenhaus zu ihrem Mann, der am Vortag operiert worden ist.
Direkt vom Krankenhaus fährt sie zu dem Kulturhaus, wobei sie unterwegs auf grund eines verkehrswidrigen Wendemanövers von einem Polizisten verwarnt wird. Im Kulturhaus angekommen wird sie von der Kollegin K., die sie am Mittag angerufen hatte, in deren Büro geführt, wo sich ein Gespräch über die Eintritt begehrende Menge und die geladenen Teilnehmer entspinnt.
Daraufhin hält sie die Lesung und in der darauf folgenden Diskussion dauert es nicht lange, bis die Fragen nach einer lebenswerten Zukunft, denen sie eigentlich ausweichen wollte, um keine Zuspitzung der Situation durch die im Publikum vertretenen Abgesandten des Ministeriums für Staatssicherheit zu provozieren, in unterschiedlicher Variation gestellt werden; jedoch der erwartete Eklat bleibt aus.
Ein älterer Mann – ein Pfarrer, wie sich später herausstellt – überreicht ihr eine Schachtel Pralinen, womit die Veranstaltung beendet wird. Sie kommt ins Gespräch mit zwei jungen Menschen, von denen, wie sich herausstellt, einer ein Dichter ist, der ihr in unregelmäßigen Abständen Gedichte zukommen lässt. Die beiden schildern ihr die Ereignisse vor dem Gebäude. Dabei mischt sich der Leiter des Kulturhauses ein, der den Polizeieinsatz zur Zerstreuung der Wartenden mit dem Hausfriedensbruch der überwiegend Jugendlichen rechtfertigt.
Die Erzählerin fährt nach hause, wo sie zuerst von ihrer älteren Tochter, die bereits über Bekannte von dem Vorfall gehört hat, und dann von einem entfernten Bekannten angerufen wird, der ihr seine Telefonnummer gibt mit der Aufforderung, ihn bei Belieben zu jeglicher Tages- oder Nachtzeit anzurufen. Sie schaltet alle Lichter aus, bis auf die Schreibtischlampe und nimmt sich vor, den Tag aufzuschreiben.
2.3 Analyse
Der beschriebene Tag – „es war ein Morgen im März, kühl, grau, auch nicht mehr allzu früh“[13] – fällt in „ein sonnenarmes Frühjahr“.[14] Die Schriftstellerin möchte sich „jetzt an einen dieser dem Untergang geweihten Tage klammern und ihn festhalten, egal, was ich zu fassen kriegen würde, ob er banal sein würde oder schwerwiegend, und ob er sich schnell ergab oder sich sträuben würde bis zuletzt.“[15] In diesem Sinne umfasst die erzählte Zeit einen Tag vom morgendlichen Aufstehen bis zum späten Abend. Der zeitliche Rahmen wird dabei durch die Reflexionen der Erzählerin und ihre Hoffnungen auf die Zukunft gebrochen. Die verwendeten Zeitformen variieren dementsprechend zwischen erzählendem Präsens, erzählendem Präteritum, verschiedenen Konjunktiven und dem Futur. Dadurch entsteht eine zeitliche Schwebe, die stellenweise im unklaren lässt, ob an dem beschriebenen Tag gesprochen wird oder im späteren Schreibprozess. Ergänzt wird diese zeitliche Schwebe durch die häufigen Verweise auf die „neue Sprache“[16]. Ob der Text bereits in der „neuen Sprache“ verfasst ist, auf dem Weg zu dieser, oder in ungebrochener Hoffnung darauf bleibt offen. Die „neue Sprache“, die sie sucht, müsse die „Wörter aus dem äußeren Kreis“ ersetzen, denn diese „trafen nicht, sie griffen Tatsachen auf, um das Tatsächliche zu vertuschen“.[17]
Die Protagonistin wird als von der Observation eingeschüchterte und ängstliche Schriftstellerin dargestellt. Ihr literarisches Schaffen hat sie bekannt und erfolgreich gemacht, ihr gesellschaftlichen Einfluss und Privilegien eingebracht. Dieser privilegierte Status in Form von Telefon, Auto, Fernsehen und dem Wunsch, zur Ablenkung einkaufen zu gehen, gerät in Bedrohung durch die Observation. Diese Observation durch die „jungen Herren“ von der Geheimpolizei gewinnt an Macht über die Schriftstellerin, wenn sie sich ihr, allein zuhause, nicht entziehen oder ablenken kann.
Die lähmenden Folgen des Dauerzustandes Überwachung sind das kontinuierliche Schwinden von Lebenskraft und –mut, die zunehmende Entwirklichung der sozialen Beziehungen, der Verlust spontaner Lebensäußerungen, welche der Selbstzensur zum Opfer fallen und starke Selbstzweifel, die zur Aufspaltung der Persönlichkeitsstruktur führen. Es entwickelt sich ein Dialog, den die Protagonistin mit sich selbst als „du“ und „ich“ führt. Bis eine Trennung von „jenem Dritten“, dem „Begleiter“, der „unwillkommenen Stimme“ eintritt, entfaltet sich ein Stimmenchaos, ein „multiples Wesen“, aus dem sich das krisengeschüttelte Bewusstsein zusammensetzt, denn: „Aus Erfahrung wusste ich: Innerer Dialog ist dem inneren Dauermonolog vorzuziehen.“[18]
Das Selbstgespräch durchdringt sowohl die Handlungs-, als auch die Reflexionsebenen. In regelmäßigen Abständen ermutigt sich die Sprechinstanz- „Nur keine Angst“ / „Nur keine Hektik“ -, beschwichtigt den inneren Zensor. Die wiederholten Fragen nach der Anwesenheit der „jungen Herren mit ihren Umhängetaschen“ strukturieren den Text – „Standen sie noch da? Sie standen da“ –und halten das Bewusstsein des „Beobachtetwerdens“ wach: „...die jungen Herren da draußen waren mir nicht zugänglich. Sie waren nicht meinesgleichen. Sie waren Abgesandte des anderen.“ Der andere ist der totale Staat, der menschliche Beziehungen zugunsten seines Fortbestandes auflöst: „der rücksichtslose Augenblicksvorteil“[19]. Mit dem Begriff „die anderen“ werden die Machthaber, besonders der Staatssicherheitsdienst bezeichnet. Allerdings wird die Staatssicherheit an keiner Stelle beim Namen genannt.
Der Apparat wird von der Erzählerin auch noch mit einem anderen Bild beschrieben: ein „Meister“[20] oder ein „Herr“, der „meine Stadt“ beherrscht. Zur „Stadt“ selbst, der Masse der Bevölkerung hat sie aufgrund der Methoden des „Herrn“ ein gestörtes Verhältnis. Schon die Möglichkeit, dass einer ihrer nächsten Freunde über sie berichtet und dass dann „kein Verlass auf irgendeinen Menschen“[21] sei, deutet darauf hin. Besonders aber die „tausende(n) von ahnungslosen Landsleuten, die Stunde um Stunde zwischen mir und dem weißen Auto da drüben vorübergingen“[22] zeigen den Bruch, die Entfremdung zwischen ihr und der Masse.
Der Herr der Stadt beschäftigt das Heer „junger Herren“, die überall herumlungern und viel Zeit zu haben scheinen für ihren „kostspieligen Müßiggang“: „Mit beiden Händen, lustvoll geradezu, warfen sie ihre Zeit zum Fenster hinaus; oder nannten sie das womöglich Arbeit, was sie taten?“[23] Einer von diesen, der Karriere gemacht hat, der an seinen Ansprüchen gescheiterte Philosoph Jürgen M., bestimmt den ersten Teils der Erzählung. Die Konfrontation mit ihm wird durch einen Blickkontakt in der Kaufhalle eröffnet, den der ehemalige Freund verweigert: „Für den Bruchteil einer Sekunde hatten unsere Blicke sich gepackt, aber Jürgen M. wollte mich nicht kennen (...).“[24] Der nicht erwiderte Blick, ein Zeichen äußerster Ablehnung, trüb und unergründlich, verbindet unausgesprochen M. mit den „gläsernen Blicken“, dem Kennzeichen der „jungen Herren“.
M. bildet in der Figurenkonstellation der Erzählung als leitender Angestellter der Spitzelbehörde den Gegenpol zu dem jungen Mädchen, das die Schriftstellerin am Nachmittag aufsucht, um ihr seine Manuskripte zu zeigen. Diese sind von so augenscheinlicher Brisanz, dass sie die junge Frau ins Gefängnis bringen würden, kämen sie in falsche Hände. Die etablierte Schriftstellerin rät dem jungen Talent, sich zu schonen, da es, „da sie nicht zu den Erpressbaren gehörte“[25], schon im Gefängnis gesessen hatte.
Die beiden Figuren bilden zur Protagonistin die beiden Extreme auf einer Skala, welche das Verhältnis zum Staat widerspiegelt und in deren Mitte sie selbst steht. Dem Konflikt mit dem Staat stellt sie sich nicht und erscheint damit als passive Figur. In Sorge über ihre persönliche Zukunft, in der Angst um die ihr zugebilligten Privilegien und ihre Rolle als populäre Schriftstellerin, vermeidet sie jegliches persönliche Engagement; im Gegensatz zu den Wartenden vor dem Kulturhaus, die durch die Polizei auseinander getrieben werden. Auch die junge Frau, die in der auf die Lesung folgenden Diskussion danach fragt, „ auf welche Weise aus dieser Gegenwart für uns und unsere Kinder eine lebbare Zukunft herauswachsen solle“[26], riskiert dadurch mehr, als der Schriftstellerin lieb ist.
Auffallend ist die Zäsur, die der Text zur Mitte des Tages erfährt. Während der Vormittag von der durch die Überwachung ausgelösten Lethargie und Trostlosigkeit geprägt ist, wird die Handlung an Nachmittag und Abend verdichtet. Durch das Verschwinden, die „Kündigung“ des inneren Zensors bricht der innere Dialog ab: „So hatte ich noch nicht gedacht, aber die Zeit schien gekommen, so und noch ganz anders zu denken.“[27] Die Selbstzweifel und Ängste weichen einem stärkeren Selbstbewusstsein: „Mein bisschen Angst? Damit müssen wir leben. Wem das nicht passt, der kann ja gehen.“[28]
Das unerwartete Auftauchen des „Mädchens“ mit seinem Manuskript, das „Fieber“ in der Diskussion nach der Lesung und das Aufbegehren der Jugendlichen vor dem Kulturhaus kontrastieren mit der Bedrohlichkeit der Observation im ersten Teil. So, wie am Vormittag die Alltäglichkeit im Vordergrund steht, so zentral erscheinen die außergewöhnlichen Vorgänge um die Lesung am Abend. Die in der Diskussion nach der Lesung frei werdende Energie – „Aber das Wunder geschah, keiner griff an“[29] - ist in anbetracht der im Publikum vertretenen Staatsmacht auch für die Erzählerin erstaunlich.
Die Erzählung ist nach zusammenfassender Einschätzung als eindringliche Beschreibung der Auswirkungen von Überwachung durch die Staatssicherheit und gleichzeitig als psychologisch verschachtelte Selbstkritik der Ich-Erzählerin zu lesen.
3.1 Der Literaturstreit
Noch vor dem Erscheinen von „Was bleibt“ im Juli 1990 im Frankfurter Luchterhand Verlag und im August beim Aufbau Verlag in Berlin, brachten die Wochenzeitschrift „Die Zeit“ am 1. Juni mit einer Gegenüberstellung zweier Textrezensionen und am darauffolgenden Tag die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Diskussion um den Text in Gang. Die eine der beiden Rezensionen in der „Zeit“ analysierte den Text aufgeschlossen und unvoreingenommen, die andere sah in der Veröffentlichung opportunistisches Kalkül der Autorin Wolf, die sich als honorierte Staatsdichterin der DDR den Nimbus der Verfolgten anhängen wolle. Interessanterweise kommt der Text von Volker Hage, der tolerantere der beiden und im Verlauf des Literaturstreites untergegangene, nicht umhin, Christa Wolf in Schutz nehmen zu müssen, vor den bereits im Vorfeld aufgeworfenen Beschuldigungen. Die tatsächliche Rezension des Textes nimmt bei ihm gerade mal ein Fünftel des gesamten Artikels in Anspruch. Somit ist für ihn, neben allem Widerlegen von Vorwürfen, die Erzählung „wunderbare, kunstvolle Prosa“.
Bei Ulrich Greiner, dem Pendant in der „Zeit“, reduziert sich die tatsächliche Textanalyse auf wenige zynische Kommentare. Er setzt die Autorin mit der Ich-Erzählerin gleich, was ihm Raum für persönliche Angriffe gibt. Die Überwachung Christa Wolfs durch die Staatssicherheit stellt er relativierend infrage: „Was will die Dichterin uns damit sagen? Will sie sagen: Die Stasi war so blöde, dass sie sogar eine Staatsdichterin bespitzelt hat?“[30] Eine literarische Wertung, wie Hage sie ansatzweise versucht, versteckt sich bei Greiner hinter Polemik. Er erkennt bei Christa Wolf lediglich eine: „Unschärfe-Relation zwischen der wirklichen Welt, die als ferne Ahnung herüberschimmert, und der poetischen Welt ihrer Texte.“[31]
Statt dessen erklärt er den Text für peinlich, da er nach dem 9. November 1989 herausgegeben worden sei und nicht davor, wo es „eine Sensation gewesen (wäre), die sicherlich das Ende der Staatsdichterin Christa Wolf und vermutlich ihre Emigration zur Folge gehabt hätte.“[32] Er wirft ihr mangelnde Sensibilität gegenüber den Opfern der SED-Diktatur vor, mit denen sie sich auf eine Stufe stelle, denn „sie hätte ja (im Gegensatz zu diesen) leicht Unterkunft im Westen finden können.“[33]
Einen Tag später veröffentlichte die F.A.Z. von Frank Schirrmacher den Artikel: „Dem Druck des härteren, strengeren Lebens standhalten“[34] – Auch eine Studie über den autoritären Charakter: Christa Wolfs Aufsätze, Reden und ihre jüngste Erzählung „Was bleibt“. Wie schon die Überschrift deutlich macht, ging es auch Schirrmacher nur am Rande um die Rezension des Textes. Er konstatiert, dass Christa Wolfs schriftstellerischer Rang überschätzt werde und untersucht ihre „beunruhigende und exemplarische Biographie“.[35] Ihren „autoritären Charakter“ erläutert er an familiären Deutungsmustern: „Nichts ist davon bekannt, dass sie das Spitzel- und Terrorisierungssystem der Staatssicherheit, den Schießbefehl, die jahrzehntelange Einmauerung des Landes kritisiert hätte. Sie hat den Kampf zwischen Zensur und Selbstzensur mit den Worten wie „Gerangel“ belegt, geradeso, als gelte es auch hier den Familienfrieden zu bewahren.“[36] Die Erzählung „Was bleibt“ ist für ihn literarisch apokryph, , sentimental und „unglaubwürdig bis an die Grenzen des Kitsches.“[37] Er begeht den gleichen literaturwissenschaftlichen Fauxpas und setzt die Erzählerin im Textes mit Christa Wolf gleich. Dadurch ist „Was bleibt“ für ihn ein Buch des schlechten Gewissens. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie Schirrmacher sowohl die Selbstkritik der Ich-Erzählerin, als auch von Christa Wolf selbst geäußerte Selbstkritik (in der Dankrede zur Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises im November 1987) zur eigenen Argumentation macht.
Die Texte von Greiner und Schirrmacher wurden im Folgenden heftig kritisiert - von Günter Grass z.B. als „professionelle Strickedreher (...), allzeit schreibfertige Enddreißiger bis Mittvierziger, denen ideologische Verführung ernsthaft nie widerfahren ist“[38] - und die Autoren einer „großen Treibjagd“ bezichtigt. Da sich viele westdeutsche Intellektuelle dazu berufen sahen, Christa Wolf beizuspringen und die meisten ihrer ostdeutschen Kollegen sich existentiell infrage gestellt sahen, eskalierte die Diskussion auf einem von der Bertelsmann-Stiftung veranstaltetem Kolloquium zum Thema „Kulturnation Deutschland“, auf dem Christa Wolf äußerte, sie fühle sich einer „Hetzkampagne“ ausgesetzt. Ulrich Greiner selbst wurde auf dem Kolloquium klar, „dass es gerade noch die deutsche Grammatik ist, die prominente Intellektuelle der DDR mit der Kultur der Bundesrepublik verbindet.“[39]
Die von Marcel Reich-Ranicki bereits 1987 im Aufsatz „Macht Verfolgung kreativ“ – „Mut und Charakterfestigkeit gehören nicht zu den hervorstechenden Tugenden der geschätzten Autorin Christa Wolf“[40] – und 1989 im „Literarischen Quartett“[41] vorgetragenen moralischen Beurteilungen wurden mehrfach wieder aufgegriffen und variiert.
In den weiteren Beiträgen zum Thema verschwand zusehends die literarische Wertung des Textes „Was bleibt“ und das Gesamtwerk Christa Wolfs und der restlichen ostdeutschen Schriftsteller (im Gegensatz zu den „Ausgereisten“) stand zur Debatte. Den im Vergleich zum westdeutschen Lebensstandard lächerlichen, zum ostdeutschen Durchschnitt jedoch „gewaltigen Privilegien“ (Schirrmacher) wurde eine maßgebliche Rolle zugemessen, die Genossen Schriftsteller willfährig zu machen. Eine Mitschuld an dem Weiterbestehen der Diktatur durch das Verschweigen der wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse wird in den Feuilletonseiten von „F.A.Z.“, „Zeit“, „Spiegel“ und „Welt“ erörtert.
Einzig Wolf Biermann kann dem Streit noch verschiedene humoristische Seiten abgewinnen indem er beide Seiten vorführt: „Die Kritiker werfen Christa Wolf vor, dass sie die Anti-Stasi-Story von vor über zehn Jahren erst jetzt aus der Schublade holt, wo es nichts mehr kostet. Stimmt! Aber auch umgekehrt: Bis grad eben noch war diese Autorin eine Heilige Kuh. Warum berennen diese Ritter des Geistes die umschmeichelte Autorin erst jetzt, wo es ebenfalls nichts mehr kostet?“[42]
Im Zuge der Reaktionen auf Greiner und Schirrmacher kommt es zu kritischen Äußerungen über die Literaturkritik Westdeutschlands, die den DDR-Autoren einen „Ost-Bonus“ eingeräumt habe und sie vor allem politisch und nicht literarisch bewertet habe.
Eine neue Dimension eröffnete Karl Heinz Bohrer der Debatte mit seinen Artikeln „Kulturschutzgebiet DDR?“ und „Die Ästhetik am Ausgang ihrer Unmündigkeit“ im „Merkur“, in denen er bezweifelt, „dass die verlorenen Leben und Karrieren der DDR-Intellektuellen zu mehr ausreichen als einer schmerzvollen und notwendigen psychologischen Einzel- oder Gruppentherapie“[43] und mit ästhetischen Begründungen für einen vermeintlich notwendigen literarischen Paradigmenwechsel plädiert.
Diese Argumentation verleitete Schirrmacher zu einem ausführlichen „Abschied von der Literatur der Bundesrepublik“, denn „ wie jener in der DDR steht auch ihr das Ende bevor...“[44], wobei er der westdeutschen Nachkriegsliteratur vorwirft, Vergangenheitsbewältigung de facto verhindert zu haben. Ulrich Greiner argumentiert in ähnlicher Richtung, bleibt aber näher am Thema des Streites in seinem Artikel „Deutsche Gesinnungsästhetik“. Die Gesamtheit der deutschen Intellektuellen, ausdrücklich Christa Wolf, war seiner Erkenntnis nach allzu sehr „mit außerliterarischen Themen beauftragt, mit dem Kampf gegen Restauration, Faschismus, Klerikalismus, Stalinismus etcetera“[45] um sich dem eigentlichen der Literatur, nämlich der Ästhetik anzunehmen: „In der Gesinnungsästhetik, und ihr hervorragendes Beispiel bleibt Christa Wolf, sind Werk und Person und Moral untrennbar.“[46]
Katharina von Ankum hält dem wiederum entgegen: „Dass Greiner allerdings darauf verzichtet, diesen rein ästhetischen Charakter der Literatur genauer zu umreißen, legt die Vermutung nahe, dass er bei seiner Analyse Gesinnungsästhetik, also eine auf eine außerliterarische message angelegte Literatur mit Gesinnungskritik, also einer Kritik, die einen literarischen Text aufgrund der politischen Einstellung des Autors beurteilt, verwechselt.“[47]
Christa Wolf ist als Objekt der Debatte um eine Abrechnung mit der politisch-gesellschaftlichen Funktion von DDR-Schriftstellern nicht zufällig gewählt worden. Keiner ihrer Kollegen wäre auch in Westdeutschland so energisch verteidigt worden. Dass sich der Streit schnell von der Literaturkritik an “Was bleibt” entfernte und zu grundsätzlichen Abrechnungen mit der deutschen Nachkriegsliteratur im Allgemeinen führte belegt, dass es den Initiatoren weder um Christa Wolf, noch um ihre herausragende Rolle im geteilten Nachkriegsdeutschland ging.
4. Schlussbetrachtungen
Die durch Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“ vor allem im westdeutschen Feuilleton ausgelöste Debatte hatte nur als Ausgangspunkt und auch dort nur marginal den eigentlichen Text zum Thema und wurde dessen literarischem Gehalt in keiner Form gerecht. Die Demontage der bis dahin gesamtdeutschen Schriftstellerin Christa Wolf und ihre politische Reduzierung auf eine „Staatsdichterin“ ignorierten die Ambivalenz ihres literarischen Werkes. Das neben ihrer Person und ihrem Werk auch die gesamte DDR-Literatur des Schutzes nicht wert sei, wurde zwar im Literaturstreit energisch umstritten, kann aber nur rückblickend grundsätzlich verneint werden.
Das öffentliche Eingeständnis Christa Wolfs bezüglich ihrer „Täterakte“ der Staatssicherheit im Jahr 1993 ist für sie vor den Hintergrund des Literaturstreits besonders prekär, da sie ihren Verteidigern das Vertrauen nimmt und ihren Gegnern zusätzliche Argumente liefert. Inwiefern das Ausmaß ihrer Zusammenarbeit mit dem MfS moralisch zu bewerten ist, muss in Anbetracht der historischen Distanz den Betroffenen überlassen werden. Dass die Rolle der Staatssicherheit in den fünfziger Jahren noch eine andere gewesen ist, als beispielsweise in den achtziger Jahren müsste dabei bedacht werden.
Literaturangaben:
Wolf, Christa: Was bleibt. In: Werke 10, München: Luchterhand Verlag, 2001
Vinke, Hermann (Hrsg.): Akteneinsicht Christa Wolf, Hamburg: Luchterhand Verlag, 1993
Walther, Joachim: Sicherungsbereich Literatur, Berlin: Links, 1996
Anz, Thomas (Hrsg.): „Es geht nicht um Christa Wolf“, München: Spangenberg, 1991
Emmerich, Wolfgang: Kleine Literaturgeschichte der DDR, Leipzig: Kiepenheuer, 1996
Herbert Lehnert: Fiktionalität und autobiographische Motive In: Weimarer Beiträge 37.Jahrgang, Berlin/Weimar: Aufbau Verlag, 1991
Meyer-Gosau, Frauke: In bester Absicht, In: Rüther, Günther (Hrsg.): Literatur in der Diktatur, Paderborn: Schöningh, 1997
von Ankum, Katharina: Die Rezeption von Christa Wolf in Ost und West, Amsterdam: Rodopi Verlag, 1992
Arker, Dieter: Anmerkungen zu Christa Wolfs Erzählung „Was bleibt“ , In: Arnold, Heinz Ludwig(Hrsg.):Text+Kritik XI/94, Heft 46, 4.Auflage: Neufassung, München: text+kritk, 1994
Böthig/Michael (Hrsg.): Machtspiele, Leipzig: Reclam, 1993
Papenfuß, Monika: Die Literaturkritik zu Christa Wolfs Werk im Feuilleton, Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 1998
Wittek, Bernd: Der Literaturstreit im sich vereinigenden Deutschland, Marburg, Tectum Verlag, 1997
[...]
[1] BstU, ZA, DSt 101073, S.9 zit. nach: Walther Joachim: „Sicherungsbereich Literatur“, S.30
[2] Frank-Wolf Matthies: Einer, der tatsächlich was getan hat, In: Machtspiele, S. 350
[3] Wolf Biermann: Der Lichtblick im grässlichen Fatalismus der Geschichte, In Machtspiele, S. 300
[4] Vinke: „Akteneinsicht Christa Wolf“, S. 90
[5] In: Vinke: „Akteneinsicht Christa Wolf“, S. 90
[6] Ebd. S.94
[7] In: Vinke: „Akteneinsicht Christa Wolf“, S. 94
[8] Vgl. Ebd. S. 101
[9] Vgl. Ebd. S. 20 - 24
[10] Was bleibt. S. 226, 227, 230, 231, 234, 235, etc.
[11] Ebd. S. 226
[12] Ebd. S. 289
[13] Was bleibt. S. 223
[14] Ebd. S. 224
[15] Ebd. S. 225
[16] Ebd. S. 225
[17] Ebd. S.229
[18] Ebd. S.252
[19] Was bleibt. S. 241
[20] Ebd. S. 253
[21] Ebd. S: 256
[22] Ebd. S. 266
[23] Ebd. S. 233/234
[24] Ebd. S. 244
[25] Was bleibt. S. 268
[26] Ebd. S. 281
[27] Ebd. S. 266
[28] Ebd. S. 265
[29] Ebd. S. 282
[30] Greiner, In: Anz: „Es geht nicht um Christa Wolf“, S. 56
[31] Ebd. S.59
[32] Ebd. S.60
[33] Ebd. S.60
[34] In: Deiritz/Krauss: „Der deutsch-deutsche Literaturstreit“, S. 127
[35] Ebd. S. 127
[36] Ebd. S. 132
[37] Ebd. S. 135
[38] vgl. Anz: „Es geht nicht um Christa Wolf“, S. 92
[39] vgl. Anz: „Es geht nicht um Christa Wolf“, S. 93
[40] Reich-Ranicki In Anz: S. 254
[41] vgl. Anz: „Es geht nicht um Christa Wolf“, S. 46-51
[42] Biermann: „Nur wer sich ändert bleibt sich treu“ In Anz: S. 140
[43] zit. nach Anz: „Es geht nicht um Christa Wolf“, S. 100
[44] zit. nach Wittek: Der Literaturstreit im sich vereinigenden Deutschland, S. 50
[45] In: Anz: „Es geht nicht um Christa Wolf“, S.213/214
[46] Ebd. S. 216
[47] von Ankum: Die Rezeption von Christa Wolf in Ost und West, S. 2
- Arbeit zitieren
- Martin Enderlein (Autor:in), 2002, Das MfS und Christa Wolf - Die Erzählung "Was bleibt" und der gesamtdeutsche Literaturstreit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108197
Kostenlos Autor werden







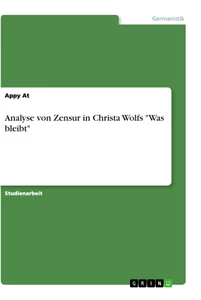








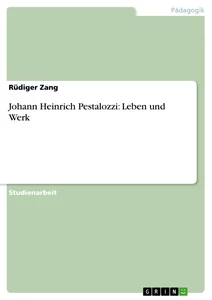





Kommentare