Leseprobe
Inhalt
0. Einleitung
1. Törless’ Masochismus
1.1. Das masochistische Ideal
1.2. Rückzug in eine andere Wirklichkeit
1.3. Entschleierung der Wirklichkeit
1.4. Umwege
2. Parthnogenese
3. Das masochistische Phantasma
3.1. Aufgeschobener Anfang
3.2. Fingierter Erzähler
3.3. Verneinung
4. Auflösung
4.1. Einsame Gewissheit
4.2. Rückkehr im Vertragsverhältnis
4.3. Entzauberung des Phantasmas
4.4. Abschluss
0. Einleitung
In seinem Aufsatz Sacher-Masoch und der Masochismus hinterfragt Gilles Deleuze die vermeintliche Einheit der beiden Perversionen Masochismus und Sadismus. Anhand der Werke Sades und Masochs, denen sie ihre Namen verdanken, versucht er aufzuzeigen, dass ihnen eine je eigene, mit der anderen jeweils unvereinbare Struktur eignet. Die bei beiden zu beobachtenden Symptome der Gewalttätigkeit und Grausamkeit ihrer Sexualität und die über ihre jeweilige Ätiologie hergestellte Verbindung und daraus abgeleiteten Möglichkeit einer Transformation erweisen sich ihm zufolge als zu oberflächliche Argumente, um die These einer sado-masochistischen Einheit aufrecht zu erhalten.
Ausgangspunkt seiner Analysen ist, wie bereits bei der Namensgebung der ‚Perversionen’ durch Krafft-Ebing, die Literatur – für Deleuze sind es vor allem die Schriften Masochs. Sie liefern ihm die Elemente, die er zu seinem Modell des Masochismus verbindet. Diese Vorgehensweise birgt, gerade weil sie sich als ausgesprochen fruchtbar erweist, die Gefahr, dass sich die in ihr angelegte Pathologisierung auf ihr Ausgangmaterial zurückschlägt – die Literatur kann so allzu leicht das Stigma der Perversion erhalten. Da sich der folgende Aufsatz auf das von Deleuze gezeichnete Modell stützt, wenn er die Struktur von Robert Musils Erzählung Die Verwirrungen des Zöglings Törless zu beschreiben unternimmt, ist es deshalb wichtig, diesem unheilvollen Effekt vorzubeugen. Obwohl die hier verwendeten Termini aus dem Kontext der Psychopathologie stammen, muss diese in ihnen mittransportierte Bedeutung ausgeschlossen werden. Sie sollen lediglich dazu dienen, eine gewisse Struktur der betrachteten Erzählung mit Hilfe des Modells nach Deleuze sichtbar zu machen.
Zu diesem Zweck bietet sich das Modell deshalb an, weil sich ihm zufolge der Masochismus vor allem durch eine bestimme Technik auszeichnet. Wenn im Folgenden versucht wird, eben diese masochistische Technik in der Erzählung nachzuweisen, so kann es deshalb gerade nicht darum gehen, Die Verwirrungen des Zöglings Törless als perverse Literatur zu pathologisieren. Vielmehr soll auf diese Weise eine textuelle Technik nachgezeichnet werden, welche sich möglicherweise auch in anderen Schriften wiederfindet, in dieser untersuchten Erzählung aber besonders deutlich hervortritt, weil sie auf allen Ebenen von der ständigen Auseinandersetzung mit diesem ihrem Vorgehen lebt. Unvermeidbar scheint dabei, dass sich die daraus hervorgehenden Verwirrungen auch in diesem Aufsatz niederschlagen müssen. Bleibt zu hoffen, dass er der Pathologisierung entgeht, indem aus diesem Prozess ein über sie hinausgehender Mehrwert resultiert.
1. Törless’ Masochismus
Die Verwirrungen des Zöglings Törless beginnen, etwas verzögert durch eine Rückblende, welche das Warten auf einen verspäteten Zug ausfüllt, mit der Rückkehr einer Gruppe junger Zöglinge in ihr Institut. Zwei der Zöglinge, Törless und Beineberg, trennen sich von den anderen, da ihnen eine verlängertes Ausbleiben erlaubt worden ist. Sie nutzen diese Zeit zu einem Besuch bei der Prostituierten Bozena. Vom Schein einer einsamen Laterne angezogen, verlassen sie die Strasse, die zum Institut führt, und folgen einem schmalen, überwucherten Weg zu einem verrufenen Wirtshaus, wo sie Bozena, in ihrem Zimmer auf dem Bett liegend, finden.
Es ist nicht das erste Mal, dass Törless Bozena begegnet. Die Besuche erfolgen regelmässig und bilden die jeweils sehnsüchtig erwartete Abwechslung nach den immer gleichen, ereignislosen Wochen. Die Gefühle, die sie in Törless hervorrufen, lassen seine masochistische Neigung erkennen:
Aus den Erinnerungen an seine Besuche bildete sich eine eigenartige Verführung heraus. Bozena erschien ihm als ein Geschöpf von ungeheuerlicher Niedrigkeit und sein Verhältnis zu ihr, die Empfindungen, die er dabei zu durchlaufen hatte, als ein grausamer Kultus der Selbstaufopferung. Es reizte ihn, alles zurücklassen zu müssen, worin er sonst eingeschlossen war, seine bevorzugte Stellung, die Gedanken und Gefühle, die man ihm einimpfte, all das, was ihm nichts gab und ihn erdrückte. Es reizte ihn, nackt, von allem entblösst, in rasendem Laufe zu diesem Weibe zu flüchten.[1]
Die lustvolle Phantasie der Selbsterniedrigung, welche sich an der Gemeinheit und Verderbtheit Bozenas nährt, ist aber nicht das einzige, was die Prostituierte in Törless hervorruft. Ihre Erzählungen über Beinebergs Mutter, die sie durch eine frühere Anstellung bei dessen Tante zu kennen behauptet, lösen in Törless Erinnerungen an seine eigene Mutter aus. Während Bozena sich über Beineberg und dessen Familie lustig macht, tauchen in Törless „mit visionärer Eindringlichkeit“ (32) Bilder seiner kühlen, unnahbaren Mutter auf. Diese Erinnerungen verbinden sich mit der in diesem Moment alles Verachtenswerte in sich vereinigenden Prostituierten. Dass auf diese Weise Erleben und Erinnerung die beiden von Törless so weit voneinander entfernt positionierten Frauen in einen Zusammenhang treten lassen, verwirrt ihn zutiefst. Das wirklich Ungeheuerliche dieser Verbindung liegt aber in einer Ahnung, die Törless nur nachträglich in umschreibende Fragen kleiden kann: „Was ist es, dass diese Bozena ihre niedrige Existenz an die meiner Mutter heranrücken kann? Dass sie sich in der Enge desselben Gedankens an jene herandrängt? (33)“ Was Törless hier scheinbar fühlt aber für sich nicht in Worten greifbar machen kann, ist die vom Erzähler nachgelieferte Wahrheit, dass vorbewusst, plötzlich, instinktiv ein seelischer Zusammenhang gegeben war, der sie [die Fragen] vor ihrem Entstehen schon in bösem Sinne beantwortet hatte. Törless sättigte sich mit den Augen an Bozena und konnte dabei seiner Mutter nicht vergessen; durch ihn hindurch verkettete die beiden ein Zusammenhang: Alles andere war nur ein sich Winden unter dieser Ideenverschlingung. Diese war die einzige Tatsache. (33)
Ohne dieser Tatsache wirklich habhaft werden zu können, erfährt sich Törless hier plötzlich eingebunden zwischen zwei Frauen, die nur durch ihn als Bindeglied in einen Zusammenhang gebracht werden. Der Besuch bei Bozena wird damit zum Auslöser verschiedener Verwirrungen, die Törless sogartig immer tiefer in ihre Wirbel hineinziehen und die ihn erst am Schluss der Erzählung aus ihrem Bann entlassen werden.
1.1. Das masochistische Ideal
Nicht zufällig treffen in dieser ersten, initiierenden Szene der Erzählung masochistische Phantasien auf Mutter- bzw. Frauenbilder. Gilles Deleuze bestimmt in seiner Analyse der Texte Leopold von Sacher-Masochs drei Frauentypen, die für sein System des Masochismus von entscheidender Bedeutung sind. Die durch sie zum Ausdruck kommenden Systeme bestimmen den jeweiligen Sinnzusammenhang einer Szene innerhalb der masochistischen Dramaturgie. Den Anfang macht dabei ein Frauentyp, der Eigenschaften aufweist, welche bereits bei Bozena gefunden worden sind:
Der erste Typ ist die heidnische Frau, die Griechin, Hetäre oder Aphrodite, Stifterin von Unordnung. Sie lebt, wie sie sagt, um der Liebe und Schönheit willen, dem Augenblick. Sie ist sinnlich, liebt den, der ihr gefällt, und gibt sich dem den sie liebt.[2]
Ihr Element ist das Chaos des ursprünglichen Sumpfes, das sich jeder Ordnung widersetzt und in dem das weibliche Prinzip herrscht. Es ist die Kloake, in der patriarchalische Institutionen wie Moral, Ehe, Staat und Kirche keinen Ort haben und in der es keinen Vater gibt. Von diesem vorgeschichtlichen Stadium setzt sich die masochistische Geschichte ab als die Suche des Masochisten nach seinem weiblichen Ideal. Sie führt ihn über einen möglichst langen Umweg an einen dem ursprünglichen Sumpf der Hermaphroditen entgegengesetzten Ort, wo er auf einen anderen Frauentyp trifft, die Sadistin. Diese liebt es, den Mann zu quälen. In ihr siegt das apollinische Element, angestachelt von einem männlichen Komplizen, auf dessen Geheiss die Sadistin ihr Opfer peinigt. Unter ihr zerfällt die masochistische Geschichte, wird die Suche aufgegeben.[3]
Weder der eine noch der andere Typ entsprechen dem masochistischen Ideal, dem weiblichen Henker. Dieses entspringt vielmehr einem Dazwischen, wo sich ein weiterer Frauentyp findet. Wenn Hermaphrodit und Sadistin ihre je abgeschlossenen Räume haben, in denen die ihnen eignenden Prinzipien herrschen, so lässt sich derjenige des mittleren Typs nicht abschliessend bestimmen. Der Bereich, wo sich das für den Masochisten Wesentliche abspielt, ist nach beiden Seiten durchlässig für ein Nicht-mehr und ein Noch-nicht. Sein Ideal oszilliert gleichsam in einer unsicheren Zone, stets bedroht von den Manifestationen der zwei anderen Frauentypen:
Wenn nun jene beiden Themen das masochistische Ideal selbst nicht ausdrücken, so doch die Grenzen, zwischen denen dieses Ideal schwingt und stockt wie die Bewegung eines Pendels. Sie markieren die Stelle, wo der Masochismus sein Spiel noch nicht begonnen hat, und die entgegengesetzte, wo er seine Daseinsberechtigung verliert.[4]
So wie Hermaphrodit und Sadistin zwei Urbildern der Mutter entsprechen – der uterinen Mutter die eine, der ödipalen Mutter die andere – lässt sich auch dem Dazwischen ein solches Urbild zuordnen: die orale Mutter. Sie ist weder reine Gebärerin und absoluter Ursprung, noch steht sie als Opfer oder Komplizin in Verbindung mit einem Vater. Als Ideal des Masochisten weist sie drei wesentliche Züge auf: Kalt-Mütterlich-Streng:
Durch sie unterscheidet sich der weibliche Henker von ihren „Doppeln“, der Hetäre und der Sadistin. Statt Sinnlichkeit jene übersinnliche Empfindsamkeit, statt Wärme und Feuer Kälte und Eis, statt der Unordnung eine strenge Ordnung.[5]
In der Gefrorenheit dieses Zwischenbereichs darf der Masochist auf die Verneinung der Sinnlichkeit zugunsten einer des Geschlechtlichen enthobenen Empfindsamkeit hoffen.
1.2. Rückzug in eine andere Wirklichkeit
Törless ist weit entfernt von diesem Ideal. Die derbe Erscheinung der Hetäre Bozena übt eine Wirkung auf ihn aus, der er nichts entgegenzusetzen hat und die er nicht aufnehmen kann. Ihr „Hemd, das von der einen Schulter geglitten war, das gemeine, wüste Rot ihres Unterrockes, ihr breites, schwatzendes Lachen“ überwältigen ihn und er lässt seine Blicke aus der Kammer in die Nacht fliehen (33). Erst dort, wo ihn seine Erinnerungen in eine eigene Welt führen, kündigt sich etwas an in der Vision seiner lachenden Mutter, unheimlich und lockend zugleich, „als ob sie mit ruhigem Schritte ginge, alle Türen zu schliessen ----“ (35). Es braucht den Rückzug in eine eigene Welt, in der sich seinen Gedanken der unbegrenzte Raum der Einbildungskraft eröffnet:
Die Welt schien ihm danach wie ein leeres, finsteres Haus, und in seiner Brust war ein Schauer, als sollte er nun von Zimmer zu Zimmer suchen, – dunkle Zimmer, von denen man nicht wusste, was ihre Ecken bargen, – tastend über die Schwellen schreiten, die keines Menschen Fuss ausser dem seinen betreten sollte, bis – in einem Zimmer sich die Türen plötzlich vor und hinter ihm schlössen und er der Herrin selbst der schwarzen Scharen gegenüberstünde. Und in diesem Augenblick würden auch die Schlösser aller anderen Türen zufallen, durch die er gekommen, und nur weit vor den Mauern würden die Schatten der Dunkelheit wie schwarze Eunuchen auf Wache stehen und die Nähe der Menschen fernhalten. (24f.)
Diese Phantasie des Suchenden, der in ein ihm unbekanntes, von der Welt entrücktes, dunkles Reich eintaucht, wo er einer unberechenbaren Macht ausgeliefert ist, wird sich im Folgenden wiederholen. Denn bald schon wird Törless eingebunden in die Geschichte, die sich aus dem Fehltritt Basinis entwickelt. Mit Reiting und Beineberg steigt er hinauf in die vergessene Kammer des Instituts, „ein mehrere Meter hoher verlorener Raum“, wo man sich „unendlich vorsichtig“ zu einem weiteren Raum vortastet, welcher der Gruppe als geheimes Versteck, „wie tief in dem Innern eines Berges“, dient (37f.). Allerdings bleibt ihm der Zugang zu einem weiteren Raum, demjenigen seines Phantasmas, noch verschlossen, weiss er noch nicht, wie die Tür dorthin zu öffnen ist: „Ein spöttisches Lächeln, dass er gerne auf seinen Lippen festgehalten hätte, und ein Schauer, der ihm über den Rücken fuhr, kreuzten sich. Ein Flimmern der Gedanken entstand ...“ (41f.). Zögernd auf dieser Schwelle fühlt er zwei Ordnungen gleichzeitig ihr Recht geltend machen, die eine als vermeintlich sichere Wirklichkeit ihm schon seit langem bekannt, die andere verwirrend und dunkel. Aber zunehmend gewinnt das Unbekannte, Bedrohliche an Macht, denn etwas ist „wie ein Stein in die unbestimmte Einsamkeit seiner Träumereien gefallen; es war da; da liess sich nichts machen; es war Wirklichkeit“ (46). Dieser Stein ist Basini, dessen Fall langsam Kreise um sich zieht, die Törless immer mehr den Boden unter den Füssen wegtragen und der dem Scheinhaften plötzlich eine eigene Wahrheit und Wirklichkeit verleiht.
1.3. Entschleierung der Wirklichkeit
Nicht nur Törless wird in diese Geschichte eingebunden. Sie zieht auch seinen Kameraden Beineberg in ihren Bann. Allerdings unterscheiden sich die beiden wesentlich. Auf Beineberg übt Basini eine ganz anders geartete Faszination aus als auf Törless. Dadurch, dass ihm der Zufall Basini in die Hände gespielt hat, erhofft dieser sich Zugang zu „innersten Erkenntnissen“ (59). Seine Suche gilt einem anderen Verborgenen. Hinter Äusserlichkeiten, Hüllen und Verkleidungen glaubt er ein Inneres, einen Kern, den es zu entdecken gilt. Er will sich nicht mit Scheinhaftem abfinden, sondern vordringen zum nackten Sein. Während für Törless die „äffende Ähnlichkeit“ ihre überwältigende Wirkung vor allem durch Äusserlichkeit, ihre Schein- und Ungreifbarkeit hat, will Beineberg die „äusserliche Ähnlichkeit“ durchdringen und ihr so alles Äffende nehmen (60).
Die Verschiedenartigkeit ihrer Suche nach einem Eingang oder Zugriff zur Welt zeigt sich auch an ihren je unterschiedlichen Bezugsfiguren. Bei Törless steht, wie oben beschrieben, bereits zu Beginn die Mutter im Vordergrund. Anders verhält es sich mit Beineberg, bei dem das Bild des Vaters zu einem derart dominanten Ideal geworden ist, dass er sich anscheinend völlig mit ihm identifiziert:
In ihm lebte das Bild seines wunderlichen Vaters in einer Art verzerrender Vergrösserung weiter. Jeder Zug war zwar bewahrt; aber das, was bei jenem ursprünglich vielleicht nur eine Laune gewesen war, die ihrer Exklusivität halber konserviert und gesteigert wurde, hatte sich in ihm zu einer phantastischen Hoffnung ausgewachsen. (20)
Einer dieser Züge, die Beineberg von seinem Vater übernimmt, ist dessen eigentümliche Art, Bücher zu lesen. In ihrem Kern glaubt er „Offenbarungen, Wirkliches“ zu finden, sobald er nur über den passenden Schlüssel zur Überwindung ihrer widerspenstigen Oberfläche verfügt (19). Es ist ein Verständnis von der Sprache als ein System, das in unmittelbarer Weise mit der Welt und ihren Dingen verbunden ist, in dem diese sich gleichzeitig manifestiert und verbirgt. In den gleichen Zusammenhang muss auch seine Besessenheit gestellt werden, mit Hilfe Basinis die ihm verhasste Äusserlichkeit überwinden zu können und „direkt in ein höheres Reich der Seelen“ einzugehen: „Denn wem es ganz gelingt, seine Seele zu schauen, für den löst sich sein körperliches Leben, das nur ein zufälliges ist“ (60). Diese Idee einer allen Erscheinungen zugrundeliegenden Natur, die in nichts über sie Hinausgehendes gründet, hat so grossen Einfluss auf sein Wesen, dass sie sich seiner Erscheinung bemächtigt und seine Augen ruhig und hart werden lässt, denn „die Gewohnheit, in Büchern zu lesen, in denen kein Wort von seinem Platze gerückt werden durfte, ohne den geheimen Sinn zu stören, [...] hatte ihren Ausdruck geformt“ (19).
Die Idee der totalen Überwindung des Körperlichen, Äusseren, die Beineberg in wahnhafter Weise verfolgt, kann mit Deleuze beschrieben werden als diejenige der reinen Negation. Als solche ist diese nie gegeben, denn, gefangen im persönlichen Element, der zweiten Natur, kann das angestrebte Negative immer nur als Kehrseite eines Positiven erfahren werden, muss man immer wieder an eine unüberwindbare Grenze stossen:
Die Welt der Erfahrung ist ganz und gar aus dem Stoff der zweiten Natur, und die Negation ist erfahrbar nur vermöge der Teilprozesse des Negativen. Daher ist die Urnatur notwendig Gegenstand einer Idee und die reine Negation ein Wahn, doch ein Wahn der Vernunft als solcher.[6]
Wenn Beineberg danach strebt, die Welt der sinnlichen Erfahrung auf ein Absolutes hin zu überschreiten, so widersetzt sich ebendiese zweite Natur wieder und wieder seinen verbissenen Anstrengungen. Da sich die reine Negation immer nur über unvollständige Teilnegationen innerhalb der erfahrbaren Welt ankündigt, jedoch nie in ihrer Totalität da sein kann, zwingt sie zur unendlichen Wiederholung dieser Teilprozesse: Eine Teilnegation muss zur nächsten führen, sich wiederholen als die wiederholte Gleiche – und in Monotonie und Apathie, der Negation des eigenen Ichs münden. In anderen Worten formuliert Beineberg dieses Ideal gegenüber Törless:
Die wahren Menschen sind nur die, welche in sich selbst eindringen können, kosmische Menschen, welche imstande sind, sich bis zu ihrem Zusammenhange mit dem grossen Weltprozesse zu versenken. Diese verrichten Wunder mit geschlossenen Augen, weil sie die gesamte Kraft der Welt zu gebrauchen verstehen, die in ihnen gerade so ist wie ausser ihnen. Aber alle Menschen, die bis dahin dem zweiten Faden folgten, mussten den ersten vorher zerreissen. Ich habe von schauerlichen Bussopfern erleuchteter Mönche gelesen, und die Mittel der indischen Heiligen sind ja auch dir nicht ganz unbekannt. Alle grausamen Dinge, die dabei geschehen, haben nur den Zweck, die elenden nach aussen gerichteten Begierden abzutöten, welche, ob sie nun Eitelkeit oder Hunger, Freude oder Mitleid seien, nur von dem Feuer abziehen, das jeder in sich zu erwecken vermag. (59)
Indem sich Beinebergs Wut gegen die „elenden nach aussen gerichteten Begierden“ richtet, richtet sie sich gleichzeitig gegen die Mutter. Denn einziges Ziel der beschriebenen Grausamkeiten ist immer die Zerstörung oder Negation der Mutter. Sie wird in diesem System der zweiten Natur gleichgesetzt, „die, bestehend aus ‚weichen’ Molekülen, den Gesetzen der Zeugung, Erhaltung und Reproduktion unterworfen ist“ und darum ihrem Wesen nach eine ständige Bedrohung des Vaters darstellt, der ihr gegenüber aus „dem Stoff der ersten Natur, Materie wütender und sprengender Moleküle“ gemacht ist.[7] In der ganzen Erzählung gibt es deshalb konsequenterweise auch keinen Hinweis auf die Existenz einer solchen Mutter. Sie scheint keinen Platz zu haben neben dem übergrossen Ideal des Vaters. Beinebergs Identifikation mit der Vaterfunktion löscht im Gegenzug die Mutterfunktion gänzlich aus.
1.4. Umwege
Aus diesen ersten Beobachtungen ergibt sich eine Sammlung verschiedener Züge, welche die beiden Figuren strukturell aufeinander bezogen erscheinen lässt. Beschreibungen, Gedankengänge und Verhaltensweisen, die zu Beginn der Erzählung die Konturen der Figur Törless zeichnen, stehen jeweils den ihnen entsprechenden Textstellen auf Seiten Beinebergs in auffällig gegensätzlicher Weise gegenüber. Törless sieht sich deshalb genötigt, gegenüber der sie verbindenden Gemeinsamkeit – der Suche nach einem Zugang zur Wirklichkeit – das ihn von Beineberg wesentlich Unterscheidende ausfindig zu machen und zu akzentuieren. Er braucht Beineberg, um ihm gegenüber seinen eigenen Weg zu finden. Deshalb wird er auch immer wieder versuchen, dem Gegenspieler seine Erfahrungen zu vermitteln und so sich über sich selbst Gewissheit zu verschaffen, ohne das ihm dies je gelingen könnte. Denn, gelänge ihm dies, oder gäbe er sein Bemühen auf, sich dem anderen mitzuteilen, dann wäre die Erzählung in ihrer Entwicklung gefährdet. Ihrer strukturellen Bedeutung gemäss sollen deshalb die wesentlichen Züge der beiden Figuren zusammengefasst werden.
Beinebergs Ideal ist also die reine Negation. In Verbindung mit seiner Überhöhung des Vaters und der Vernichtung der Mutter ergibt sich – in bisher noch rudimentärer Form – die Struktur der sadistischen Perversion, wie sie von Deleuze beschrieben wird. Ihr Ziel und damit ihr Sinn liegt in der Überwindung der zweiten Natur oder dem persönlichen Element zur Erreichung einer höheren, jener übergeordneten, ersten Natur, in der eine „unpersönliche Gewalt mit der Idee der Reinen Vernunft, mit der furchtbaren Logik des Beweises“ identifiziert wird.[8] Um diese Entpersonalisierung zu erreichen, ist der Sadist gezwungen, die Singularität der einzelnen Gewaltakte über eine wütende Kaskade von Wiederholungen und Akkumulierungen in einer indifferenten Monotonie aufzulösen, in der er letztlich auch sich selbst, sein eigenes Ich, auslöscht. In diesem „kosmischen Menschen“, wie Beineberg ihn nennt, muss alles zu einem zusammenschmelzen: der Sadist, die Gewaltakte und die Beschreibungen dieser Gewaltakte – „es geht um den Nachweis, dass die Ausübung von Gewalt und die logische Beweisführung identisch sind“.[9]
Bei Törless wurde dessen masochistische Phantasien hervorgehoben, und der Masochismus dieser Figur deckt sich ebenfalls weitgehend mit der von Deleuze herausgearbeiteten Strukturen dieser Perversion. Offensichtlich ist die zentrale Bedeutung der Mutter einerseits und die Marginalisierung des Vaters andererseits. Während die Gedanken, Phantasien und Träume von Törless stets Assoziationen des Weiblichen aufweisen, verschwindet die Figur des Vaters zunehmend. Nach einem kurzen Auftritt am Bahnhof wird diese nur noch durch einzelne Körperteile vertreten (wenn sich zum Beispiel die Mutter „fester an den Arm ihres Mannes“ drückt (34)), oder taucht gemeinsam mit der Mutter als „Eltern“ in einem Traum auf (84f.) und fehlt schliesslich am Ende der Erzählung völlig. Die Auslöschung des Vaters hat nach Deleuze die Übertragung sämtlicher seiner Funktionen auf die Mutter zur Folge, welche ihrerseits eine Verdreifachung in einen uterinen, einen ödipalen und einen oralen Muttertyp erfährt.[10]
2. Parthenogenese
Der Modus des ‚Noch-nicht’ ist eines der wichtigsten Merkmale des Masochismus und grenzt sich dadurch wesentlich von dem oben beschriebenen Verdichtungsprozess im Sadismus ab.
Die Form des Masochismus ist das Warten. Der Masochist erlebt das Warten im Reinzustand. Das reine Warten teilt sich in zwei gleichzeitige Ströme: der eine stellt dar, worauf man wartet, was aber wesentlich auf sich warten lässt, immer verzögert, immer aufgeschoben ist; der andere das, was man erwartet, das, was allein die Ankunft dessen, worauf gewartet wird, beschleunigen könnte.[11]
Die Bewegung des Aufschiebens bewirkt die Entfernung eines angekündigten Ereignisses und ermöglicht dessen Fiktionalisierung. Die Wirklichkeit soll also nicht negiert werden wie im Sadismus, sondern wird durch Verneinung in ein masochistischen Phantasma gehüllt. Dadurch erlangt das Ich in diesem System eine zentrale Bedeutung, denn es ist es, dass wartet und das sich in diesem Warten seiner selbst versichert.
Der Fall Basinis hat die Ereignisse ausgelöst, um die sich die Erzählung aufbauen wird. Die drei Zöglinge haben Besitz von ihm ergriffen und werden ihn zu ihren – je eigenen – Geschichten machen. Vorerst fällt noch „keine Entscheidung“ und Törless, „zum ersten Male voll auf sich selbst konzentriert“, liegt im Park und hängt seinen Gedanken nach (61).
Und plötzlich bemerkte er, – und es war ihm, als geschähe dies zum ersten Male, – wie hoch eigentlich der Himmel sei.
Es war wie ein Erschrecken. Gerade über ihm leuchtete ein kleines, blaues, unsagbar tiefes Loch zwischen den Wolken.
Ihm war, als müsste man da mit einer langen, langen Leiter hineinsteigen können. Aber je weiter er hineindrang und sich mit den Augen hob, desto tiefer zog sich der blaue, leuchtende Grund zurück. Und es war doch, als müsste man ihn einmal erreichen und mit den Blicken ihn aufhalten können. Dieser Wunsch wurde quälend heftig. (62)
Die Betrachtung des sich ihm immer weiter entziehenden Himmels lässt Törless eine unüberwindbare Einsamkeit erfahren. Gleichzeitig fühlt er sich von einem riesigen, nicht greifbaren Blick erfasst und in ein alles umspannendes Netz verwoben, dessen Zentrum er selbst ist. „Zwischen Wachen und Träumen“ legen sich einander ähnelnde Eindrücke aus der Erinnerung wie Schleier und Nebel übereinander und er fühlt sich „in ihre Beziehungen eingesponnen“ (63). Was sich immer wieder in Erinnerungen, Träumen und Phantasien angekündigt, wogegen er sich bisher aber immer instinktiv zu wehren versucht hatte, bricht nun jäh über ihn herein. Er erfährt seine Wahrnehmung als eine, die nicht zwischen unmittelbarer Wirklichkeit und täuschendem Schein, zwischen Kern und Oberfläche unterscheidet. Alles entzieht sich ihr in immer neuen Geweben und Beziehungen und es gelingt ihm immer nur, „eine ganz äussere Hülle fortzureissen, ohne das Innere blosszulegen“ (64). Aber nun erschreckt Törless weder seine Einsamkeit noch der schweigende Blick über ihm. Im Gegenteil. Diese Erfahrung, die alles in einen unheimlichen Schwebezustand versetzt, lässt selbst den hellen Tag zu einem „unergründlichen Versteck“ werden wo ihn das „lebendige Schweigen“ von allen Seiten umsteht (66). Bald wird die dadurch erzeugte, ins Unendliche sich dehnende Spannung, ihm Lust bereiten.
Wie es in der Kammer erstmals zu einem ungezügelten Ausbruch der Gewalt kommt, stürzt sich Törless nicht mit den anderen auf Basini, sondern bleibt gelähmt zurück und betrachtet eine umgestürzte Laterne. In seinem Zustand der körperlichen Verkrampfung ergreift ihn ein ähnliches Gefühl wie vor kurzem noch im Park. Während Beineberg und Reiting Basini quälen, verliert er sich im Anblick des über den Kammerboden ausströmenden Lichts. Wie im Park der Himmel über ihm, wird hier die Laterne zu einem Auge, von dem er sich erblickt fühlt, und durch den Verlust des körperlichen Empfindens scheint er sich von sich selbst zu entfernen.
Dabei beobachtete er sich selbst. Aber so, als ob er eigentlich ins Leere sähe und sich selbst nur wie in einem undeutlichen Schimmer von der Seite her erfasste. Nun rückte aus diesem Unklaren – von der Seite her – langsam, aber immer sichtlicher ein Verlangen ins deutliche Bewusstsein. (70)
Dadurch, dass er die „viehische Lust“, mit der die anderen beiden über ihr Opfer herfallen, verneint, erlebt er in der ihn so überkommenden Starre Tod und Wiedergeburt (69). Der Aufschub der Lust ermöglicht es ihm, dieses Ideal herbeizuführen und im Phantasma zu suspendieren. Bei Bozena überwältigte ihn noch deren Sinnlichkeit und es gelang ihm deshalb nicht, Abstand zu nehmen und sich „von der Seite her“ einzubilden. Erst im Suspense dieser Szene kann er hinter sich selbst zurücktreten und dadurch etwas ihn ihm absterben lassen, was ihn zuvor dem Phantasma gegenüber unempfänglich gemacht hatte. Er eröffnet einen Bereich, in dem die Sinnlichkeit sich nicht mehr völlig ungebändigt entfalten kann, in dem sie aber auch noch nicht von einem Ich auf ein Objekt gelenkt ist.
Zwischen der Urmutter und der Geliebten steht die orale Mutter als Imago des Todes und weist dem Ich den kalten Spiegel seines doppelten Abfalls. Aber der Tod kann imaginiert werden nur als zweite Geburt oder Parthenogenese, aus der ein vom Über-Ich und Sexualität befreites Ich hervorgeht. Die Selbstreflexion des Ich im Tode stiftet das ideale Ich in der spezifisch masochistischen Unabhängigkeit und Autonomie.[12]
Das so durch den Prozess der Verneinung befreite ideale Ich beobachtet in scheinbarer Schwerelosigkeit diese Wiedergeburt und lässt „Törless darüber lächeln“ (70). Gleichzeitig zieht es ihn nieder auf die staubigen Dielen, um dort „auf allen vieren, ganz nah in die staubigen Winkel zu kriechen“ (71). In der Erniedrigung vor dem schweigenden Auge ist dem resexualisierten Ich die bisher aufgeschobene Lustempfindung ermöglicht.
3. Das masochistische Phantasma
Obwohl schon wiederholt angekündigt, hat Törless in dieser Szene zum ersten Mal das masochistische Phantasma durchlebt. Zwar hat ihn diese Erfahrung nicht durch das verzweifelt gesuchte ‚Tor’ hindurchgeführt, und sie bleibt deshalb für Beineberg unverständlich, aber dies würde auch in keiner Weise der masochistischen Verneinung entsprechen.
Es geht also nicht darum, die Welt zu negieren oder zu zerstören, und ebenso wenig, sie zu idealisieren; es geht darum, sie zu verneinen, sie im Akt der Verneinung in einen Zustand des Schwebens zu versetzen und sich selbst einem Ideal zu öffnen, das seinerseits im Schwebezustand des Phantasmas verharrt.[13]
Es scheint, als ob alles auf dieses Phantasma hingearbeitet hätte. Es wurden immer wieder verschiedene Anläufe genommen, Andeutungen angesammelt, Zwischenspiele eingeschoben. Dieses Ankündigen und Hinausschieben hat ein mit immer grösserer Anspannung verbundenes Warten erzeugt und so das Milieu dieser speziellen Szene vorbereitet. Es gibt also eine Parallele zwischen dem Erzählten als einer Geschichte von Verzögerungen und der Struktur dieser Erzählung. Bevor wir Törless’ Phantasma weiterverfolgen – denn die Spannung ist noch nicht gelöst worden – gehen wir deshalb zurück an den Anfang der Erzählung.
3.1. Aufgeschobener Anfang
Bereits mit dem ersten Satz, mit dem die Erzählung vorgibt anzuheben – als Erzählung der Verwirrungen des Zöglings Törless – schiebt sie durch absolute Bewegungslosigkeit ihren eigenen Anfang hinaus: „Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Russland führt“ (7). Dieser Suspense, hervorgerufen durch ein gefrorenes Bild wo Handlung sich lösen sollte, setzt sich fort. Statt dass etwas geschieht, wiederholt sich die Starrheit, der Nicht-Anfang, in einer Reihe von Zeichen der Verzögerung: ein eingebrannter Strich im gelben Kies, ins Endlose führende Eisenstränge, zertretener Boden und das in gleichen Intervallen mechanisch ausgeführte Ausschauen des Bahnhofvorstandes kündigen etwas an, was durch grosse Verspätung auf sich warten lässt. Einzige ‚Bewegung’ ist vorerst die Beschreibung der Szene in Form von Ein- oder Verkleidungen durch Metaphern: „wie ein Schmutziger Schatten“ erscheint der Strich neben den Eisensträngen, Gegenstände und Menschen haben „etwas Gleichgültiges, Lebloses, Mechanisches an sich, als seien sie aus der Szene eines Puppentheaters genommen“, sie tauchen auf und verschwinden, „so wie die Figuren kommen und gehen, die aus alten Turmuhren treten, wenn die Stunde voll ist“ (7). Auf solche Weise entfalten sich die Metaphern wie Stoffe und geben der Szene etwas unwirkliches. Sie verstärken den Eindruck des Aufschubs und halten die Erzählung in der Schwebe.
Wird so die eigentliche Handlung, die erzählte Geschichte, als masochistische Technik des Phantasmas vorweggenommen, noch bevor sie sich anschickt, erzählt zu werden? Tatsächlich würde sich in dieser Struktur der Fiktion mit dem Namen Die Verwirrungen des Zöglings Törless zeigen, was Deleuze als den Kern des Masochismus bezeichnet: „Es gibt nicht so sehr masochistische Phantasmen als eine masochistische Technik des Phantasmas“.[14]
3.2. Fingierter Erzähler
Wir haben bisher eine wichtige Instanz, die aus dem Hintergrund die Erzählung ordnet, ausser Acht gelassen. Es gibt einen Erzähler, dessen Funktion sich nicht auf das reine Erzählen beschränkt. Im Gegenteil. Der scheinbar allwissende Erzähler, der in der eingefrorenen Stationsszene über eine Rückblende aus der Erzählung hinausführt, nachliefernd eine Vorgeschichte jenseits der Erzählung, ursprünglicher als ein Anfang, schiebt sich auch innerhalb der Erzählung vor als eine Instanz, die eingreift. So zum Beispiel wenn der Figur Törless die Mittel fehlen, um ein eigentümliches Gefühl der Erinnerung zu beschreiben:
Er hielt es für Heimweh, für Verlangen nach seinen Eltern. In Wirklichkeit war es aber etwas viel Unbestimmteres und Zusammengesetzteres. Denn der „Gegenstand dieser Sehnsucht“, das Bild seiner Eltern, war darin eigentlich gar nicht mehr enthalten. Ich meine diese gewisse plastische, nicht bloss gedächtnismässige, sondern körperliche Erinnerung an eine geliebte Person, die zu allen Sinnen spricht und in allen Sinnen bewahrt wird, so dass man nichts tun kann, ohne schweigend und unsichtbar den anderen zur Seite zu fühlen. (9)
Dieses ‚ich’ ist keine einfache Figur. Indem sie zwischen dem Erzählten – hier den unbestimmten Gefühlen von Törless – und den eigenen Erfahrungen eine Verbindung herstellt, macht sie die Erzählung zu ihrer eigenen und verliert dadurch die neutrale Perspektive des Aussenstehenden. Wenn sie über Törless’ „nicht bloss gedächtnismässige, sondern körperliche Erinnerung“ spricht, kann sie dies nicht tun, ohne selbst „schweigend und unsichtbar den anderen zur Seite zu fühlen“. Das ‚Sprechen über’ macht sich gleichzeitig als ‚Gesprochen werden über’ fühlbar. Unfassbar, und gerade deshalb um so zwingender, entzieht sich eine erzählende Instanz an der Seite des ‚ich’ dem sich so verdoppelnden Erzähler. Nur scheinbar beherrscht hier der Erzähler – als ‚ich’ – die Szene, wenn er dazwischenschiebt, was Törless zu überspringen droht, denn er selbst ist ein Vorgeschobener. Durch Die Verwirrungen des Zöglings Törless wird er inszeniert als ein Erzähler, der vorgibt, die Verwirrungen des Zöglings Törless zu erzählen. Nach Jaques Derrida zeigt sich – in anderem Zusammenhang – eine Struktur von Vierung:
Der Narrator (er selbst verdoppelt in narrierenden Narrator und narrierter Narrator, sich nicht begnügend, die beiden Dialoge zuzutragen) ist evidentermassen weder der Autor selbst (nennen wir das Poe) noch, was weniger evident ist, der Schreiber eines Textes, der uns erzählt oder vielmehr der sprechen macht einen Narrator, der selbst, in allen Sorten von Sinn, sprechen macht viele Leute. Der Schreiber und die Schreibung sind originale Funktionen, die sich vermischen weder mit dem Autor und seinen Handlungen noch mit dem Narrator und seiner Narration, noch weniger mit diesem besonderen Objekt, diesem narrierten Inhalt [...]. Dass die Schreibung in ihrer Gesamtheit – die Fiktion namens Der entwendete Brief – gedeckt sei, auf ihrer ganzen Oberfläche, durch eine Narration, deren Narrator „ich“ sagt, das erlaubt nicht, die Fiktion mit einer Narration zu vermischen.[15]
Der Erzähler der Verwirrungen des Zöglings Törless ist also eingeschlossen in „etwas viel Unbestimmteres und Zusammengesetzteres“, worin er sich und seine Erzählung bereits vorweggenommen fühlt und das noch weiter zurückgeht als der vermeintliche Anfang (9). Die Vierung von Schreibung/Fiktion, Schreiber/Fiktor und erzählende Erzählung, Erzähler (verdoppelt in erzählender Erzähler und erzählter Erzähler) begrenzt ihn, indem sie ihm die Möglichkeit nimmt, als allwissende Instanz die Verwirrungen zu überschauen und zu beurteilen.[16] Seine Fähigkeit, die unbeholfenen Versuche des „kleine[n] Törless“ (13), sein Gefühlsleben in Bilder zu fassen, ihn in „seiner eigenen Unselbständigkeit“ (12) zu unterstützen und bisweilen zu korrigieren, erweisen sich als Täuschung. Hinter ihm, an seiner Seite, gibt es einen weiteren Erzähler, der auf eine ganz andere Weise eingreift.
Der Narrator löscht sich als „allgemeiner Narrator“ nicht aus, oder vielmehr, indem er sich selbst auslöscht in der homogenen Allgemeinheit, bringt er sich vor als eine sehr singuläre Person in der narrierten Narration, in dem Gevierten.[17]
Was sich auslöscht indem es durch sein Schweigen spricht, enthebt den erzählten Erzähler seiner vermeintlich enthüllenden Tätigkeit. Sein Anspruch, aus den verirrten Fragen des verwirrten Törless, die „mit verschlossenen Lippen, von einem dumpfen, unbestimmten Gefühl... einer Schwäche, einer Angst verhüllt“ sind, das Wirkliche, ihren Grund oder Ursprung zu schälen, wird sabotiert durch diese singuläre Person (47). Sie lässt sich nicht ausschliessen, um einer Wahrheitsforderung zu genügen. Es gelingt nicht,
[...] beiseite zu setzten das, was sich immer beinahe (fingiert) von selbst (sich) beiseitesetzen lässt, abseits, als das Vierte. Man muss Rechnung tragen dem Rest, dem, was sich fallen lässt, nicht allein im narrierten Inhalt der Schrift (der Signifikant, das Geschriebene, der Brief), sondern in der Schriftoperation.[18]
Rechnung tragend diesem Rest, in Die Verwirrungen des Zöglings Törless und ihrer textuellen Technik, muss man noch einmal zurückkehren an den Anfang des Geschriebenen, und darüber hinaus.
3.3. Verneinung
Weiter oben hat der Vergleich der Schriftoperation der Fiktion unter dem Namen Die Verwirrungen des Zöglings Törless mit der masochistischen Technik des Phantasmas zurückgehen lassen. Die Suche nach diesem Anfang verlor sich in einem Geflecht von Metaphern, welches statt Handlung Suspense bewirkt. In der Starrheit des dadurch evozierten photographischen Bildes fand sich ein Erzähler, der sich anschickt die Verwirrungen des Zöglings Törless zu erzählen, sich gleichsam selbst in das Netz seiner Erzählung verstrickend. Und die Geschichte, soweit sie bisher ihre Kreise gezogen hat, handelt – indem sie verzögert – von den Verirrungen des Zöglings Törless durch die Einhüllung seiner Wahrnehmung in immer dichtere Schleier und Nebel.
Alle diese Operationen gehorchen einem Gesetz, das schon da gewesen sein wird, wenn der Anfang der Geschichte sich als Nicht-Anfang zeigt. Es ist das Motto von Maeterlinck, das ihr als von woandersher Kommendes vorangestellt ist:
Sobald wir etwas aussprechen, entwerten wir es seltsam. Wir glauben in die Tiefe der Abgründe hinabgetaucht zu sein, und wenn wir wieder and die Oberfläche kommen, gleicht der Wassertropfen an unseren bleichen Fingerspitzen nicht mehr dem Meere, dem er entstammt. Wir wähnen eine Schatzgrube wunderbarer Schätze entdeckt zu haben, und wenn wir wieder ans Tageslicht kommen, haben wir nur falsche Steine und Glasscherben mitgebracht; und trotzdem schimmert der Schatz im Finstern unverändert. (7)
Was hier an solch prominenter Position auftaucht, scheint zunächst die Vorstellung der Wahrheit als etwas Blosszulegendes, als etwas hinter den täuschenden äusserlichen Erscheinungen liegendes zu sein. Als solches entspräche es demjenigen Wirklichen, welches Beineberg durch seine Anstrengungen unter den zufälligen Formen des sinnlich Wahrnehmbaren zu finden hofft. Allerdings kann es laut dem ersten Satz des Mottos nicht gelingen, dieses Wirkliche in Sprache zu fassen und auszusprechen, da in diesem Zugriff gerade der Reiz verschwindet, den es als noch Unausgesprochenes auszuüben vermag. Im Folgenden kommt diese Unzulänglichkeit der Sprache in den beiden Metaphern vom Wassertropfen und vom Schatz zum Ausdruck. Ebenso wie jener als abgespaltener Teil das Meer nicht länger umfangen kann, ist diesem der Wert, den er aus der Dunkelheit verspricht, entzogen, sobald er geborgen ist. Dabei stehen aber die beiden Bilder in keinem einfachen Verhältnis zum vorhergehenden Satz, dem sie scheinbar zur Veranschaulichung dienen. Sie sind nicht bloss Metaphern für das in ihm bereits ausgedrückte, sondern fügen etwas eigenes hinzu. Sie fügen sich selbst, als Metaphern, als ihr In-sprachliche-Bilder-fassen hinzu und verneinen dadurch auf seltsame Weise gerade dasjenige, wofür sie in ihrer Funktion als Metaphern stehen. Seltsam vor allem deshalb, weil sie gemäss der masochistischen Technik verneinen, aber nicht negieren, und so die sonderbare Atmosphäre der Unentschiedenheit erzeugen, woraus sich die Verwirrungen des Zöglings Törless als masochistisches Phantasma entwickeln können:
Vielleicht muss die Verneinung als der Ausgangspunkt eines Vorganges verstanden werden, der nicht darin besteht, zu negieren oder zu zerstören, sondern vielmehr den Rechtsgrund dessen, was ist, anzufechten und diesen gleichsam in einen Zustand der Schwebe oder der Neutralisation zu versetzen, in dem jenseits des Gegebenen neue Horizonte des nicht Gegebenen aufscheinen.[19]
Die Metapher leugnet hier also die für die Sprache unheilvollen Konsequenzen, die sich aus der Erkenntnis des ersten Satzes des Mottos ergäben. Da aber die vollständige Aufhebung dieser Erkenntnis nicht möglich ist, ohne dass damit auch die Aufhebung ihrer selbst einherginge – die Metapher ist die Leugnung dieses Wissens – muss eine weitere Metapher folgen und so den Schwebezustand aufrechterhalten. Gerade aufgrund des Wissens um das Verborgenbleiben des Schatzes – und damit dem Scheitern eines jeglichen Versuchs, ihn zu heben – müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um die drohende Gefahr der Wiederkehr des ersten Satzes abzuwehren.
Das Übereinanderlegen von Metaphern im Motto bildet also den Ausgangspunkt einer Folge von Schleiern, die dazu dienen, das Wiederhereinbrechen des Verneinten hinauszuschieben. Die Verwirrungen des Zöglings Törless entsprechen dadurch dem konstant angewandten komplexen Verfahren, das der Masochist aufbieten muss, „um seine phantastische und symbolische Welt zu schützen und die halluzinatorischen Zugriffe der Wirklichkeit abzuwehren“.[20] Sie sind Umschreibungen auf Irrwegen, die immer dasjenige verfehlen und entwerten, was sie zu sein vorgeben: eine Entschleierung des Wirklichen. Um diesen Effekt zu erreichen, wird ein Erzähler vorgeschoben, der als scheinbar allwissende Instanz in einer von ihm losgelösten Erzählung Ideal und Wirklichkeit sich vereinigen lässt und ihr auf diese Weise die Form des masochistischen Phantasmas gibt. Diese Autonomie des Erzählers muss jedoch wiederum ständig bedroht sein, um die dem masochistischen Phantasma wesentliche Spannung zu erzeugen und die Erzählung in der Schwebe zu halten. Nur die Gefahr von der Seite her, der schweigende Blick der Fiktionalität, dem er sich unterwirft, wenn er ihn nicht negiert, sondern verneint, lässt ihn die Irrwege weitertreiben. Es braucht also das ‚trotzdem’ des Mottos, das den Schatz im Finstern unverändert schimmern und das Phantasma in seiner Entfernung von der Wirklichkeit wahr werden lässt. Nur wenn der Erzähler sich als fingiert zeigt, kann Die Verwirrungen des Zöglings Törless durch ein Sein von Fiktion wahrhaftig täuschen.[21]
4. Auflösung
An dieser Stelle kehren wir zurück zu Törless. Wir haben ihn in der Szene verlassen, in der die sadistischen Quälereien Beinebergs und Reitings und das ‚Auge’ der umgekippten Laterne die formalen Bedingungen für den Wendepunkt seiner masochistischen Geschichte schafften. Über die Verneinung der genitalen Sexualität und die damit verbundene gesteigerte Empfindsamkeit konnte in der gleichzeitigen Wiedergeburt des resexualisierten Ich das masochistische Ideal hervorgehen.
4.1. Einsame Gewissheit
Sowie Törless versucht, das soeben Erfahrene mitzuteilen, stösst er auf Unverständnis. Die Unfähigkeit Beinebergs, die Empfindung nachzuvollziehen wird deutlich, wenn er sich bückt und die Lampe wieder auf ihren Platz stellt (71). Sie bleibt dem Ich vorbehalten, welches die Wirklichkeit in seinem Phantasma zu verneinen vermag und erfüllt Törless sowohl mit einem Gefühl der Überlegenheit als auch der Einsamkeit. Nicht nur, dass seinen Gefährten der ihm allein gegebene Sinn für diese fremde Welt fehlt, ihre Gegenwart verunmöglicht auch die Entstehung des masochistischen Ideals. Törless’ Versuch, es in die mit den anderen geteilte Welt zu übertragen, indem er Basini zwingt, sich vor allen dreien zu erniedrigen, muss scheitern, da unmittelbar in dieser Wirklichkeit kein Prozess der Verneinung stattfinden kann.
Folgerichtig bricht denn auch an dieser Stelle die Szene ab und eine Episode wird eingeschoben. Es handelt sich dabei um Törless’ Besuch bei seinem Mathematikprofessor (75ff.). Analog zum Scheitern jenes ersten Versuchs, das masochistische Ideal ohne die vermittelnde Wirkung eines Phantasmas zu realisieren, entpuppt sich auch hier der dazu vermeintlich taugliche Schlüssel in Form eines Renommierbands Kant als Enttäuschung. In der Hoffnung, nun, mit Hilfe dieses Schlüssels, endlich alle Schleier durchstossen und direkt zum Schatz, zur nackten Wirklichkeit gelangen zu können, verbrennt Törless seine Umwege und Verwirrungen, welche er als poetische Versuche festgehalten hatte, um „alle Aufmerksamkeit auf die Schritte zu richten, die nach vorwärts zu tun seien“ (79).
Endlich stand er auf und trat unter die anderen. Er fühlte sich frei von allen ängstlichen Seitenblicken. Was er getan hatte, war eigentlich nur ganz instinktiv geschehen; nichts bot ihm eine Sicherheit, dass er wirklich von nun an ein Neuer werde sein können, als das blosse Dasein jenes Impulses. „Morgen,“ sagte er sich, „morgen werde ich alles sorgfältig revidieren, und ich werde schon Klarheit gewinnen.“ (79)
Diese Klarheit bleibt Törless wiederum versagt. Aber die Enttäuschung stärkt ihn – wie in der vorhergehenden Szene – in seiner Einsamkeit. Im anschliessenden Gespräch mit seinem Gegenspieler Beineberg kommt diese Gewissheit in der von Törless erkannten Unvermittelbarkeit ihrer Positionen zum Ausdruck. Beinebergs „Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen ...“ setzt er sein „in mir suche ich etwas; in mir!“ entgegen (83).
Beide Szenen münden also in den Versuch, aus der Einsamkeit des masochistischen Phantasmas auszubrechen und ihm eine intersubjektive Wirklichkeit zu verleihen. Und beide Male schlagen die Versuche fehl. Sie reihen sich damit in eine Abfolge von ähnlichen Mitteilungsversuchen ein, welche die ganze Erzählung seit Törless’ ersten verwirrenden Empfindungen beim Besuch Bozenas durchziehen. Immer stärker ist dabei aber die ängstliche Hoffnung auf Verständnis und damit Verifikation der Umschreibungen dieser Empfindungen zunehmend dem Bewusstsein ihrer Einzigartigkeit und Unvermittelbarkeit gewichen.
Er kam sich unendlich gesichert gegen diese gescheiten Menschen vor, und zum ersten Mal fühlte er, dass er in seiner Sinnlichkeit – denn dass es diese sei, wusste er nun schon lange – etwas hatte, das ihm keiner zu nehmen vermochte, das auch keiner nachzumachen vermochte, etwas, das ihn wie eine höchste, versteckteste Mauer gegen alle fremde Klugheit schützte. (87)
Noch schliessen sich Fragen und Zweifel an diese Gedanken an, aber sie verlieren zunehmend an Gewicht, bis Törless sie endlich gänzlich überwindet und die Entwicklung in seinem Austritt aus dem Institut – aus den Verwirrungen und aus der Fiktion – ihren logischen Abschluss findet.
4.2. Rückkehr im Vertragsverhältnis
Noch haben sich Die Verwirrungen des Zöglings Törless nicht vollständig aufgelöst, noch bewegt sich das Phantasma in jenem Zwischenbereich, den wir eingangs beschrieben hatten. Aber mit der zunehmenden Gewissheit, mit der Törless seinen Empfindungen gegenübersteht, engt sich auch der Schwingungskreis des masochistischen Ideals ein, der nach Deleuze an seinen Symbolrändern durch die beiden Mutterfiguren abgegrenzt wird. Ermöglicht durch die Erlösung aus der Herrschaft der Hetäre, konnte dieser Zwischenraum als der Ort des Phantasmas, unter der Bedingung der ständigen Bedrohung durch die ödipale Mutter und der patriarchalischen Ordnung in der Schwebe gehalten werden. Das Abwehren ihrer Herrschaft machte auch den Erzähler als fingierten Erzähler nötig und die Verwirrungen als seine Erzählung möglich. Solange dieser Erzähler in seinen permanenten Anstrengungen die Gültigkeit der reinen Form des durch das Motto eingeführten Gesetzes aufrecht erhalten kann – wenn er es vollzieht und damit seinen Inhalt verneint – bleibt die Erzählung in der für sie wesentlichen Schwebe. Dadurch wird die absolute Befolgung des Gesetzes gleichzeitig zu seiner radikalen Infragestellung.
Wer wüsste nicht, wie man das Gesetz gerade durch übermässigen Eifer verdrehen kann? Man will dann durch übergenaues Befolgen des Gesetzes die Absurdität des Gesetzes erweisen und eben die Unordnung heraufbeschwören, die es verbieten und bannen sollte.[22]
Dies setzt allerdings voraus, dass Erzähler und Erzählung weiterhin unbedingte Objekte im Vollzug des Gesetzes bleiben. Was weiter oben implizite Motivation eben dieses Vollzugs war, kann nun im Verhältnis des Masochisten zum Gesetz und dem ihm vorausgehenden Vertrag explizit dargestellt werden. Das Gesetz, dessen Vollzug die Fiktion mit dem Namen Die Verwirrungen des Zöglings Törless ist, geht aus einem Vertrag hervor, der des freiwilligen Einverständnisses der Vertragspartner bedarf und zeitlich begrenzt ist. Der Vertrag ist deshalb seinem Wesen nach mit dem Masochismus unverträglich.
Man muss wohl ganz allgemein sagen, dass im Masochismus der Vertrag Gegenstand einer Karikatur wird, in welcher die ganze schicksalhafte Zweideutigkeit des Vertrags angeklagt ist. Das Vertragsverhältnis nämlich verkörpert vollkommen den Typus eines künstlichen, apollinischen, männlichen Kulturzusammenhangs und widersetzt sich damit den chthonischen Naturverhältnissen, welche Wiedervereinigung mit der Mutter und Frau bedeuten.[23]
Daraus folgt, dass die masochistische Struktur der Fiktion verlangt, dass wir den Vertrag durch bedingungsloses und übereifriges Befolgen des in ihm begründeten Gesetzes – durch das unaufhörliche Übereinanderlegen von Metaphern, das Weitertreiben der Erzählung – vergessen machen.
Wenn nun aber Törless, statt dem Diktat des Gesetzes zu gehorchen und seine Suche fortzusetzen, sich aus dessen Herrschaft löst und in seiner Einsamkeit eine Position ausserhalb des Phantasmas einnimmt, dann tritt auch der Vertrag als Abgrenzung zwischen Phantasma und Wirklichkeit wieder hervor. Das Phantasma wird dadurch in seiner Scheinhaftigkeit entwertet. Gleichzeitig verliert auch der Erzähler seine Funktion. Als demselben Gesetz folgend müsste er sowohl vorgeschobener Erzähler der Fiktion Die Verwirrungen des Zöglings Törless als auch Erzähler der Verwirrungen des Zöglings Törless sein. Wird seine Figur autonom, fühlt sie sich nicht länger von der Seite her erblickt, gibt auch er diese Doppelfunktion zugunsten einer eindeutigen, gesicherten Position auf.
4.3. Entzauberung des Phantasmas
Der Auflösung geht eine Episode mechanischer Wiederholungen des Phantasmas voran. Immer sicherer beherrscht Törless nun die Technik, die ihm seine Empfindungen ermöglicht.
Daher beschloss er, so oft als möglich, immer und immer wieder die Situation zu suchen, welche jenen für ihn so eigentümlichen Gehalt in sich trugen; und besonders häufig ruhte sein Blick auf Basini, wenn dieser, sich unbeobachtet glaubend, harmlos unter den andern sich bewegte. (93)
Unermüdlich versucht Törless derartige Situationen herbeizubeschwören. Aber ihr Eintreten lässt sich nicht kontrollieren. Immer überrumpeln sie Törless und ergreifen ihn mit einer Gewalt, die sich aus seiner Ohnmächtigkeit ihnen gegenüber nährt.
In dem Masse aber, als dieser Abscheu wuchs, wurde auch der Antrieb stärker, zu Basini hinüberzugehen. Schliesslich war Törless ganz von der Unsinnigkeit eines solchen Unterfanges durchdrungen, aber ein förmlich physischer Zwang schien ihn wie an einem Seile aus dem Bette zu ziehen. (97)
Allmählich gewinnen die Zusammenkünfte eine immer grössere Regelmässigkeit und Törless zieht sich mehr und mehr von den übrigen Zöglingen zurück. Für ihn ist die Suche zu Ende.
Da suchte Törless kein Wort mehr. Die Sinnlichkeit, die sich nach und nach aus den einzelnen Augenblicken der Verzweiflung in ihn gestohlen hatte, war jetzt zu ihrer vollen Grösse erwacht. Sie lag nackt neben ihm und deckte ihn mit ihrem weichen schwarzen Mantel das Haupt zu. Und sie raunte ihm süsse Worte der Resignation ins Ohr und schob mit ihren warmen Fingern alle Fragen und Aufgaben als vergebens weg. Und sie flüsterte: in der Einsamkeit ist alles erlaubt. (108)
An dieser Stelle tritt der von seiner Figur und Erzählung sich lösende autoritäre Erzähler hervor (111ff.). Ähnlich wie am Anfang der Erzählung, wo er während des Wartens auf den Zug eine Vorgeschichte nachträgt, greift er auch hier, kurz vor ihrem Ende, wieder über sie hinaus und stellt Zukünftiges an ihre Seite. Mit ihm tritt ein anderer Törless auf, welcher gleichsam von ausserhalb über den Törless der Verwirrungen reflektiert. Abgegrenzt von einer anderen Ordnung wird so dem masochistischen Phantasma die Fähigkeit genommen, als Fiktion wahrhaftig zu täuschen. Es gibt nicht länger einen schweigenden Blick von der Seite her. Mit seinem Sprechen kann er nicht mehr als zu Verneinendes das Phantasma zu unermüdlichen Verschleierungen antreiben, sondern zeigt sich plötzlich als Blick aus der Ordnung des Wirklichen. Und im Sprechen verbindet er sich auch mit dem Erzähler, welcher dadurch ebenfalls in diese Ordnung versetzt ist. Er wird somit zu einem Erzähler, für den jenseits des Phantasmas die masochistische Struktur des Vertragsverhältnisses keine Wirkung mehr hat und für den deshalb das im Motto formulierte Gesetz auf eine ganz andere Weise Gültigkeit hat. Der Vertrag erfährt keine Sinnverkehrung mehr und fällt in seine ursprüngliche Ordnung zurück, da seine patriarchalische Struktur nicht länger im Innern des Phantasmas verneint ist. Statt dass das Gesetz den Vollzug des in ihm Genannten gebietet, wirkt es nun als Verbot: der Schatz darf nicht gehoben werden, da er dadurch entwertet würde. Die Fiktion tritt in den Dienst einer Wirklichkeit, wird ihr unterworfen. Aus der Ferne betrachtet verliert sie für den Törless, der sich über denjenigen des Instituts setzt, alles Mächtige und Bedrohliche.
Ich leugne ganz gewiss nicht, dass es sich hier um eine Erniedrigung handelte. Warum auch nicht? Sie verging. Aber etwas von ihr blieb für immer zurück: jene kleine Menge Giftes, die nötig ist, um der Seele die allzu sichere und beruhigte Gesundheit zu nehmen und ihr dafür eine feinere, zugeschärfte, verstehende zu geben. (112)
Durch die Verortung des Erzählers ausserhalb der Erzählung gelangt auch seine Figur Törless zu absoluter Autonomie. An seiner Seite gibt es daher auch kein lebendiges Schweigen mehr, welches ihn sich selbst in die Geschehnisse verwickelt fühlen machte, und er kann diesen als teilnahmsloser Beobachter gegenüberstehen.
Törless war während des ganzen vorangegangenen Auftrittes ruhig geblieben. Er hatte im stillen gehofft, dass sich vielleicht doch etwas ereignen werde, das ihn wieder mitten in seinen verlorenen Empfindungskreis versetzten würde. Es war eine törichte Hoffnung, dessen blieb er sich stets bewusst, aber sie hatte ihn doch festgehalten. Nun schien ihm jedoch, dass alles vorbei sei. Die Szene widerte ihn an. Ganz gedankenlos; stummer, toter Widerwille. (122)
Da sowohl Törless als auch der Erzähler sich in ihrer Einsamkeit und Autonomie von der Geschichte um Basini gelöst haben, hat auch Beineberg keine Bedeutung mehr. Der einstige Kontrahent, von dessen Charakteristika sich der Masochismus Törless’ abheben konnte, wird der Lächerlichkeit preisgegeben und das Scheitern seines Versuchs, seine Theorie mittels seines Opfers Basini zu beweisen, wird zur endgültigen Markierung des Abschlusses von Törless’ Suche.
4.4. Abschluss
Nachdem die Geschichte um Basini beendet worden ist, bleiben nur noch, gleichsam als Rest, Törless und der Erzähler. Im abschliessenden Verhör durch die Dozenten des Internats hat Törless bereits soviel Abstand zu den vergangenen Ereignissen, dass er imstande ist, ihnen gegenüber als souveräner Erzähler aufzutreten. Dass es den Zuhörenden nicht möglich ist, seinen Beschreibungen zu folgen, scheint dabei kein Hindernis zu sein. Die Geschichte ist die Seine geworden. Über sie hinausgekommen, hat er sie sich angeeignet, und es geht ihm nur noch darum, ihre unwiderrufliche Abgeschlossenheit zu demonstrieren: „Es reizte ihn förmlich, von sich zu sprechen und seine Gedanken an diesen Köpfen zu versuchen.“ (133). Das Gefühl, dass über oder neben ihm eine Instanz sein könnte, welche ihn in seinem Tun beobachtet und ihn sich immer in einer unsicheren Abhängigkeit fühlen lässt, ist einem Bewusstsein von Freiheit und Überlegenheit gewichen. In diesem Bewusstsein stellt er sich auf dieselbe Ebene wie der Erzähler. Er ist nicht länger ein Erzählter und Gesehener, sondern ein Seher.
Er hatte sich aufgerichtet, so stolz, als sei er hier Richter, seine Augen gingen geradeaus an den Menschen vorbei; er mochte diese lächerlichen Figuren nicht ansehen.
Draussen vor dem Fenster sass eine Krähe auf einem Ast, sonst war nichts als die weisse, riesige Fläche. (136)
Durch das Fenster hindurch verbindet er sich jetzt mit dem Erzähler, welcher sich seinerseits mit seiner Figur identifiziert. Wenn dieser im Folgenden von toten und lebendigen Gedanken spricht, dann sondert auch er das von ihm Erzählte als vergangenes, ihn nicht länger in seiner Autorität bedrohendes Phantasma (136f.). Auch er setzt sich über die Verwirrungen, welche ihn zuvor noch in seinen Anstrengungen, sie zu lösen, immer tiefer eingebunden und so in ihrer Lebendigkeit seine eigene Unabhängigkeit bedroht hatten. In ihrer jeweiligen Autonomie ausserhalb einer nun kontrollierbaren Erzählung verschmelzen beide in ihrer gemeinsamen Position und der Erzähler lässt Törless seine Gedanken nahtlos weiterführen.
Ohne sich um die betroffenen Gesichter ringsum zu kümmern, gleichsam nur für sich, knüpfte er hieran an und sprach, ohne abzusetzten, die Augen geradeaus gerichtet bis zu Ende:
„... Ich habe vielleicht noch zu wenig gelernt, um mich richtig auszudrücken, aber ich will es beschreiben. Eben war es wieder in mir. [...]“ (137)
Dieses ‚es’ in ihm, der Erzähler, dessen Lebendigkeit Törless zuvor noch schutzlos ausgeliefert war, ist nun durch sein Sprechen als toter Gedanke domestiziert.
Wir sind damit in jenem Herrschaftsbereich angelangt, in dessen Abwehr die Wahrheit und Wirklichkeit des masochistischen Phantasmas gegründet war. Damit ist auch ist auch die Spannung gelöst, welche zuvor zu fortgesetzten Verwirrungen getrieben hatte. Es wird keine Bedrohung mehr wahrgenommen und die Szene ist bereit für die ödipale Mutter, welche hier auftritt, um zum Abschluss die Hauptfigur abzuholen.
Literatur
- Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törless. Rowohlt: Hamburg 1978
- Gilles Deleuze: Sacher-Masoch und der Masochismus. In: Leopold von Sacher-Masoch: Venus im Pelz, Insel: Frankfurt a.M. 1997
- Jaques Derrida: Die Postkarte, 2. Lieferung. Brinkman & Bose: Berlin 1982
[...]
[1] Musil (1978), S. 30 [Nachfolgend werden Zitate durch die Seitenzahlen in runden Klammern nachgewiesen.]
[2] Deleuze (1997), S. 200
[3] vgl. ebda.
[4] a.a.O., S. 202
[5] a.a.O., S. 203f.
[6] a.a.O., S. 182
[7] a.a.O., S. 211
[8] a.a.O., S. 176
[9] a.a.O., S. 175
[10] a.a.O., S. 200ff.
[11] a.a.O., S. 222
[12] a.a.O., S. 275
[13] a.a.O., S. 187
[14] a.a.O., S. 223
[15] Derrida (1982), S. 206
Derrida dekonstruiert Jaques Lacans Analyse von Edgar Allen Poes Der entwendete Brief in Ecrits. Dabei gehen seine Interessen über die Struktur dieser Fiktion hinaus, d.h. sie stehen in einem anderen (weiteren) Zusammenhang als in dieser Arbeit. Bezüge wie ‚Poe’ und ‚Der entwendete Brief bleiben unverändert, sofern sie sich mit analogen Funktionen in dieser Arbeit decken.
[16] vgl. a.a.O., S. 207
[17] a.a.O., S. 208
[18] a.a.O., S. 211
[19] Deleuze (1997), S. 185
[20] a.a.O., S. 217
[21] vgl. Derrida (1982), S. 247
[22] Deleuze (1997), S. 238
[23] a.a.O., S. 241
- Arbeit zitieren
- Appel, David (Autor:in), 2002, Sich im Schauspiel nötig machen. Masochistische Techniken in den Verwirrungen eines Zöglings, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108141
Kostenlos Autor werden

















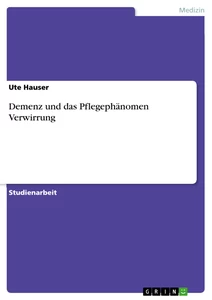
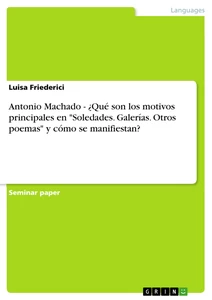



Kommentare