Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung
1.1 Das Problem der Anerkennung (individuelle Sphäre)
1.2 Die Politik der gleichheitlichen Anerkennung (öffentliche Sphäre)
1.3 Die Politik der universellen Menschenwürde
1.4 Liberalismus, kulturelle Neutralität und der Wert der Kulturen
2. Jürgen Habermas: Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat
2.1 Grundzüge moderner Verfassungsstaaten
2.2 Taylors Politik der Anerkennung
2.3 Kämpfe um Anerkennung – die Phänomene und die Ebenen ihrer Analyse
2.4 Die ethische Imprägnierung des Rechtsstaats
2.5 Gleichberechtigte Koexistenz versus Artenschutz
2.6 Immigration, Staatsbürgerschaft und nationale Identität
3. Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt
3.1 Politik der Neutralität
3.2 Politik der eigenen Identität
3.3 Politik des Minderheitenschutzes
3.4 Politik der Anerkennung
3.5 Politik der Multikulturalität
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Vorbemerkung
Ein Bewusstsein
über
gesellschaftliche Zusammenhänge,
über
politische Konzepte und Realitäten,
über
Verfassungsgrundlagen und Rechtssysteme,
über
philosophische Fragestellungen,
ist,
finde ich,
für SozialabeiterInnen
und im Speziellen
für mich
sehr
wichtig!
Einleitung
Die Kontroverse in Deutschland im Herbst 2000 um die Frage, ob es eine Leitkultur für eine multikulturelle Gesellschaft braucht, hat mich hellhörig gemacht auf die Frage, wie das Zusammenleben verschiedener ethnischer und kultureller Gruppen in einem demokratischen Rechtsstaat geregelt werden kann. Ich meine die gegenseitige Anerkennung verschiedener Lebensformen, die je eine eigene Vorstellung von gutem Leben haben.
In Zeiten von grossen Wanderungsströmen und einer zunehmenden Globalisierung wird in den Bevölkerungen westlicher europäischer Staaten eine zunehmende Verunsicherung spürbar. Westliche Gesellschaften sind mit einer immer stärkeren Einwanderung konfrontiert. Sie müssen die Einwanderung nicht nur akzeptieren, sondern auch noch fördern, um den starken Geburtenrückgang und die zunehmende Überalterung der Gesellschaft zu kompensieren. Nicht nur der schmerzliche Bewusstseinswandel, sich von einer Nicht- Einwanderungsgesellschaft zu einer Einwanderungsgesellschaft zu entwickeln, sondern auch die Zunahme sozialer- und wirtschaftlicher Probleme führen zu Spannungen. Einerseits ist das Auftreten rassistisch motivierter Taten und ein Rechtsrutsch in der Politik (Tendenz zur Abschottung) zu beobachten und andererseits gibt es Gruppen, welche die Zuwanderung begrüssen und darin eine kulturelle Bereicherung sehen. Die Frage der gegenseitigen Anerkennung ist ein wichtiger Bestandteil einer friedlichen Koexistenz aller Bürger eines Staates.
Auf philosophischer Ebene gibt es verschiedene Kontroversen darum, welches politische System den Anerkennungskämpfen in einem liberalen Rechtsstaat westlich moderner Prägung gerecht wird.
In meiner Arbeit werde ich nun die Frage der Anerkennung anhand zweier Philosophen darstellen, die je eine eigene Lesart von Liberalismus verfolgen. Im ersten Teil zeige ich auf, wie der Philosoph und Kommunitarist Charles Taylor seine Interpretation eines Liberalismus darlegt, welcher nötig ist, will man die Anerkennung individueller und kollektiver Identitäten gewährleisten. Nach Charles Taylor gilt es, dem „differenzblinden“ Liberalismus (1) ein Modell gegenüber zu stellen in der Form eines Liberalismus (2), der bereit ist, den kulturellen Fortbestand einer Gemeinschaft zu gewährleisten.
Im zweiten Teil werde ich darlegen, wie der deutsche Philosoph Jürgen Habermas auf die Darstellungen von Charles Taylor reagiert und aus seiner Sicht den Liberalismus interpretiert. Er zeigt auf, dass innerhalb des Liberalismus (1), das System der Rechte im Sinne eines demokratischen Verständnisses der Grundrechtsverwirklichung keineswegs blind ist gegenüber kultureller Differenzen. In seiner konsequenten Verwirklichung beinhaltet der Liberalismus (1) die Anerkennung individueller und kollektiver Identitäten und es ist somit nicht nötig, systemfremde kollektive Rechte (gemäss Liberalismus (2) einzuführen.
Im dritten Teil stelle ich fünf Grundrechtspolitiken vor, die Walter Kälin, Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Bern, in seinem Buch „Grundrechte im Kulturkonflikt“ beschreibt. Nach Walter Kälin werden die verfassungsmässigen Grundrechte in den westlichen Ländern aufgrund unterschiedlicher, grundrechtspolitischer Konzepte anders interpretiert, was sich auf den Umgang mit der Frage der Anerkennung auswirkt. Meine Ausführungen sollen einen groben Überblick über diese fünf, in der heutigen Zeit angewandten, Politikkonzepte geben.
Im letzten Teil werde ich noch meine eigene Meinung, die ich mir während der Bearbeitung dieses Themas gebildet habe, darstellen.
1. Charles Taylor: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung
1.1 Das Problem der Anerkennung (individuelle Sphäre)
Die Politik hat heutzutage in verschiedener Form mit dem Bedürfnis, aber auch der Forderung nach Anerkennung zu tun. Wichtige Beispiele sind eingewanderte Minderheiten, der Feminismus und die Vertreter einer Politik des Multikulturalismus. Unter den zuletzt genannten zwei Gruppen wird die Forderung nach Anerkennung besonders ausdrücklich erhoben. Auch Taylor nimmt an, dass es zwischen Anerkennung und Identität einen Zusammenhang gibt. Deshalb formuliert er die These: „ Unsere Identität wird teilweise von der Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, oft auch von der Verkennung durch die anderen geprägt, so dass ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen wirklich Schaden nehmen, eine wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild ihrer selbst zurückspiegelt, Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden verursachen, kann eine Form von Unterdrückung sein, kann den anderen in ein falsches, deformiertes Dasein einschliessen“. (Taylor 1997, 13/14)
Gegenseitige Anerkennung ist also nicht nur Ausdruck von Höflichkeit, sondern ein menschliches Grundbedürfnis und zentral für die Ausbildung der Identität.
Nach Taylor sind es, geschichtlich gesehen, zwei tiefgreifende gesellschaftliche und politische Wandlungen, die das Interesse an Identität und Anerkennung in den Vordergrund stellen.
Der erste Wandel ist der Übergang vom Prinzip Ehre zur Würde. Ehre im alten, gesellschaftlich hierarchischen System ist mit Ungleichheit verknüpft. Nach Montesquieu beruht Ehre auf Bevorzugung und Besserstellung. „ Wenn einigen Menschen in diesem Sinne Ehre zukommen soll, dann kann sie nicht jeder besitzen“. (Taylor 1997, 15) Mit dem Zusammenbruch der gesellschaftlichen Hierarchien, wird der Begriff der Würde wichtig. Die Würde ist etwas, was allen Bürgern in gleichem Masse zukommt und zielt auf die Angleichung und den Ausgleich von Rechten und Ansprüchen. Das macht die gleichberechtigte Anerkennung zu einem wichtigen Bestandteil der neuen, demokratischen Kultur.
Der zweite Wandel erfolgt mit der Ende des 18. Jahrhunderts sich entwickelnden neuen Auffassung von individueller Identität. Er hat die Wichtigkeit der Anerkennung als Strukturelement neuzeitlicher Identität noch verstärkt. Für den Zusammenhang von Identität und Anerkennung ist wichtig, dass der Mensch seine Identität im Dialog, also im Austausch mit andern, entwickelt und zugleich gefordert ist, seine persönliche Eigenart zu entdecken. In Gesellschaften früherer Zeiten war die Anerkennung in der Regel kein Problem. Die Identität wurde von der gesellschaftlichen Position abgeleitet und die allgemeine Anerkennung beruhte, im Gegensatz zu heute, auf Kategorien, die meist nicht in Frage gestellt wurden. „ Die im inneren gegründete unverwechselbare persönliche Identität hat diese selbstverständliche Anerkennung nicht. Sie muss Anerkennung erst im Austausch gewinnen und dabei kann sie scheitern“. (Taylor 1997, 24)
In der persönlichen Sphäre, ist die menschliche Identität also stark auf die Anerkennung anderer angewiesen.
1.2 Die Politik der gleichheitlichen Anerkennung (öffentliche Sphäre)
Die Politik der gleichheitlichen Anerkennung bezeichnet zwei unterschiedliche Ansätze.
Aus dem ersten tiefgreifenden Wandel, von der Ehre zur Würde, ist eine Politik der universellen Menschenwürde mit dem Prinzip der Gleichberechtigung aller Bürger hervorgegangen. Sie will eine Zweiklassengesellschaft vermeiden. Es gibt aber Unterschiede in der Ausgestaltung der Grundsätze. Die Gleichberechtigung kann sich nur auf die Bürgerrechte und das Wahlrecht beziehen, oder die sozioökonomische Sphäre noch einbeziehen.
Aus dem zweiten tiefgreifenden Wandel, basierend auf der Entwicklung einer neuen Identitätsvorstellung, ist eine Politik der Differenz hervorgegangen. Die universalistische Basis dieser Auffassung ist, dass jeder infolge seiner unverwechselbaren Identität anerkannt wird. Hier handelt es sich aber nicht wie bei der Politik der allgemeinen Menschenwürde um etwas, das für alle gleich ist, sondern um die Anerkennung der Besonderheit gegenüber allen anderen. Auch die Politik der Differenz kritisiert jegliche Diskriminierung und lehnt eine Zweiklassengesellschaft ab. Sie ist jedoch mit der Politik der universellen Menschenwürde unvereinbar, denn sie verlangt Anerkennung für etwas, das nicht universell ist und an dem nicht jeder teilhat. Die Politik der Differenz folgt aber aus der Vorstellung der universellen Menschenwürde, Taylor formuliert es so: „ Wir können das, was universell vorhanden ist- jeder Mensch hat eine Identität- nur anerkennen, indem wir auch dem, was jedem Einzelnen eigentümlich ist, unsere Anerkennung zuteil werden lassen. Die aufs allgemeine gerichtete Forderung wird zur Triebkraft der Anerkennung des Besonderen“. (Taylor 1997, 29)
Weil nun die eine Politik, die Anerkennung bestimmter universeller Rechte fordert, sich auf das konzentriert, was bei allen gleich ist, und die andere Politik Anerkennung und die Förderung einer besonderen Identität verlangt, treten diese beiden Ansätze weit auseinander. Der Grund für diese Unvereinbarkeit liegt in den sie leitenden Wertvorstellungen. Die Politik der universellen Menschenwürde basiert auf der schon von Kant formulierten Fähigkeit des Menschen, vernünftig zu handeln und das Leben nach Grundsätzen leiten zu lassen. Es ist die Achtung vor dem universellen menschlichen Potential, nicht aber vor dem, was jeder daraus gemacht hat. Genau dies aber fordert die Politik der Differenz und stützt sich auf die ihrem Konzept zugrundeliegende neue Vorstellung von Identität. Weiter behauptet die Politik der Differenz, dass die angeblich neutrale Politik der universellen Menschenwürde in Wirklichkeit die Spiegelung einer ganz bestimmten, hegemonialen Kultur sei, also ein Partikularismus unter der Maske des Universellen.
1.3 Die Politik der universellen Menschenwürde
Nach Taylor bildete sich die Politik der allgemeinen Menschenwürde anhand zweier Denkmodelle aus. Sie sind verbunden mit Rousseau und Kant, ihren zwei frühen Verfechtern. Taylor untersucht anhand dieser beiden Modelle, ob der Vorwurf, sie hätten einer falschen Homogenität Vorschub geleistet, zu Recht erhoben wird.
Rousseau zum Beispiel sieht die allgemeine Gleichachtung als unentbehrlich und setzt ein Leben in Freiheit einem Dasein entgegen, das durch Hierarchie und Abhängigkeit geprägt ist. Abhängigkeit ergibt sich aus dem Wunsch nach Wertschätzung und diese erwächst gemäss der traditionellen Auffassung von Ehre aus der Besserstellung. In Rousseaus Schilderung einer guten Gesellschaft nimmt die Wertschätzung immer noch eine zentrale Stelle ein. Diese wird aber nicht durch eine Besserstellung innerhalb der alten sozialen Ordnung erreicht, sondern durch einen Übergang in ein neues gesellschaftliches System, das sich durch Gleichheit, Gegenseitigkeit (keine Rollendifferenzierung) und Einmütigkeit im Wollen auszeichnet. Diese gleichheitliche Wertschätzung setzt also, so Charles Taylor, eine eng umgrenzte gemeinsame Zielsetzung voraus und ist somit mit jeder Form von Differenz unvereinbar. Gegen einen Liberalismus auf dieser Basis wird nach Taylor der Vorwurf der Homogenisierung zu Recht erhoben.
Die mit Kant in Verbindung gebrachten Modelle beinhalten nur die Gleichheit der Rechte aller Bürger ohne die von Rousseau geforderte Gegenseitigkeit und Einmütigkeit im Wollen. Radikale Verfechter der Politik der Differenz werfen aber diesen, sich an Kant orientierenden Formen des Liberalismus vor, dass sie nicht imstande seien, Besonderheit anzuerkennen. Taylor meint, dass es bestimmte Formen des Liberalismus gibt, welche die Besonderheit kultureller Identitäten nur sehr eingeschränkt anerkennen. Es scheint ihnen unannehmbar, dass man einen Katalog von Grundrechten in unterschiedlichen kulturellen Kontexten verschieden anwendet und dass seine Anwendung sogar kollektive Ziele beinhalten könnte. Wäre diese restriktive Interpretation von Liberalismus die einzig mögliche, müsste man den Vorwurf der Homogenisierung gelten lassen. Taylor ist jedoch der Ansicht, dass es auch eine andere Lesart von Liberalismus gibt. Er erläutert dies am Beispiel Kanadas, wo dieser andere Liberalismus angesichts des drohenden Auseinanderbrechens des Landes, eine wichtige Rolle gespielt hat.
Vor einigen Jahren ging es in Kanada darum, die kanadischen Verfassung an das amerikanische System der Rechte anzugleichen. Formuliert wurde ein Katalog der Rechte, als juristische Basis für die verfassungsgerichtliche Überprüfung der Gesetze[leh1]. Bei der Formulierung dieses Kataloges stiess man auf Probleme. Es stellte sich die Frage , ob die kulturelle Eigenart, also das kulturelle Überleben der Provinz Quebec und verschiedener Ureinwohner in den Katalog aufgenommen und ein Recht auf Besonderheit anerkannt werden sollte. Das francophone Quebec verlangte nun eine bestimmte Form von Autonomie und die Möglichkeit, einzelne für das kulturelle Überleben als notwendig gehaltene Gesetze zu erlassen. Zum Beispiel erliess Quebec verschiedene Sprachgesetze. Ein Gesetz regelt, dass Francophone und Immigranten ihre Kinder nicht an englischsprachige Schulen schicken dürfen und ein anderes bestimmt, dass in Firmen mit mehr als 50 ArbeitnehmerInnen die Geschäftssprache französisch sein muss. Diese und andere Beschränkungen berufen sich auf das kollektive Ziel des Überlebens der francophonen Kultur in Quebec. Quebec wollte nun als Gesellschaft mit besonderem Charakter anerkannt werden, als eine der Grundlagen für die Interpretation der kanadischen Verfassung. Dies wurde aber abgelehnt.
Die kanadischen Verfassung hat zwei Gruppen von Bestimmungen zur Grundlage. Zum einen eine Reihe von Individualrechten und zum anderen die Gleichbehandlung in Form eines Schutzes vor Diskriminierung. Die Verfolgung von kollektiven Zielen in der Form der oben genannten Sprachgesetze, wäre ein Verstoss gegen diese zwei Grundbestimmungen. Sie würden die Handlungsfreiheit und die Gleichbehandlung Einzelner beschränken (Auswahl der Schule) und wären diskriminierend (anglophone Kanadier dürfen). Aus der liberalen Perspektive haben Individualrechte und Bestimmungen gegen die Nicht-Diskriminierung immer Vorrang gegenüber kollektiven Zielen. Dworkin schreibt: „Wir alle hegen bestimmte Ansichten von den Zielen und Zwecken des Lebens, davon, wie das gute Leben beschaffen ist, nach dem wir und andere streben sollten. Aber wir kennen unabhängig davon, wie wir unsere Ziele und Zwecke bestimmen, auch ein Engagement für einen fairen und gleichberechtigten Umgang miteinander. Dieses Engagement könnte man „prozedural“ nennen, während das Engagement für bestimmte Lebensziele „substantiell“ ist. Liberal ist nun eine Gesellschaft, die sich als Gesellschaft nicht auf bestimmte, substantielle Bestimmungen der Ziele des Lebens festlegte. Zusammengehalten wird diese Gesellschaft vielmehr durch ein starkes prozedurales Engagement, das gebietet, allen Menschen mit gleichem Respekt zu begegnen“.(Taylor 1997, 49/50)
Ein Staat darf somit nicht eine Anschauung verordnen, die eine Mehrheit vom „guten Leben“ hat, weil er so die Anschauung derer, die nicht mit dieser übereinstimmen, als weniger Wert definiert und ihnen auf diese Weise die Anerkennung versagt. Der Staat muss also alle gleich behandeln und gewährleisten, dass die Bürger, unabhängig ihrer Anschauung, fair miteinander umgehen. Die moderne Vorstellung vom selbstbestimmten Subjekt, macht dieses prozedurale Liberalismusmodell populär und präferiert so die gerichtliche Überprüfung auf der Basis von Verfassungstexten gegenüber dem gewöhnlichen politischen Prozess der Mehrheitsbildung.
Die Gesellschaft von Quebec mit dem kollektiven Ziel, Angehörige der francophonen Gruppe zu erzeugen, verstösst gegen dieses Modell. Nach den Quebeçiens kann aber eine Gesellschaft durchaus eine Konzeption des „guten Lebens“ verfolgen und nach ihrer Vorstellung zeichnet sich eine liberale Gesellschaft dadurch aus, wie sie mit Minderheiten umgeht und welche Rechte sie allen ihren Angehörigen zugesteht. Gemeint sind elementaren Grundrechte wie: das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf Redefreiheit, auf freie Religionsausübung und andere Freiheiten, die nicht eingeschränkt werden dürfen. Diese sind nun von Vor- und Sonderrechten zu unterscheiden, welche eine Gesellschaft zur Erhaltung ihrer Kultur verordnet und die aus politischen Gründen wiederrufen werden können. Die Fähigkeit einer Gesellschaft, die Vielfalt zu respektieren, vor allem im Umgang mit denen, die diesen Zielen nicht folgen mögen, und das Garantieren der elementaren Grundrechte, sind eine Voraussetzung dieses Liberalismus- Modells. „Es wird ohne Zweifel zu Spannungen und Schwierigkeiten kommen, wenn verschiedene Ziele nebeneinander verfolgt werden, aber es ist dies nicht unmöglich, und die Probleme sind im Prinzip nicht grösser als die, vor denen jede liberale Gesellschaft steht, die zum Beispiel Freiheit und Gleichheit oder Wohlstand und Gerechtigkeit miteinander verbinden muss“. (Taylor 1997, 54)
Dies sind nun zwei nicht vereinbare Modelle von Liberalismus, innerhalb der Politik der Gleichachtung. Die eine Form von Rechte- Liberalismus (Lib. 1) verlangt die gleichheitliche Anwendung der Rechte ohne Ausnahme und ist misstrauisch gegenüber kollektiven Zielen. Zwar will dieser Liberalismus kulturelle Unterschiede nicht beseitigen, aber was Gesellschaften mit besonderem Charakter anstreben, den Fortbestand der Kultur, kann er nicht gewährleisten und ist somit nach Taylor gegenüber der Differenz unaufgeschlossen. Die anderen liberalen Modelle (Lib. 2), garantieren zwar die Einhaltung der Grundrechte, unterscheiden diese aber von Vor- und Sonderrechten und sind bereit, „ die Wichtigkeit bestimmter Formen der Gleichbehandlung abzuwägen gegen die Wichtigkeit des Überlebens einer Kultur, und sie entscheiden dabei bisweilen zugunsten der letzteren“. (Taylor 1997, 56).
Diese von Taylor favorisierten Liberalismusmodelle, gründen auf Konzeptionen des „guten Lebens“, in denen der Integrität der Kulturen ein hoher Stellenwert zukommt. Sie wären, nach Taylor, in heutigen multikulturellen Gesellschaften angemessener als der prozedurale Liberalismus. Auch vom Vorwurf der Homogenisierung könnte diese, gegenüber der Differenz aufgeschlossene Variante des Liberalismus, freigesprochen werden.
1.4 Liberalismus, kulturelle Neutralität und der Wert der Kulturen
Ein anderer, von Vertretern einer Politik der Differenz vorgebrachter Vorwurf lautet, dass der Liberalismus der politische Ausdruck einer bestimmten Kultur ist und deshalb nicht mit anderen Kulturen zu vereinbaren ist. Dieser Vorwurf wurde durch den Neutralitätsanspruch des differenzblinden Liberalismus provoziert. Nach Taylor sollte dieser Vorwurf auch nicht zurückgewiesen werden, denn der Liberalismus kann und sollte kulturelle Neutralität nicht beanspruchen. Auch der Liberalismus ist eine kämpferische Weltdeutung. Beide Formen, der differenzblinde wie der von Taylor favorisierte Liberalismus, müssen Grenzen ziehen. Der Aufruf zum Mord beispielsweise hat auch im Spielraum, der durch die unterschiedliche Anwendung des Grundrechtskatalogs entsteht, keinen Platz. Solche substantiellen Unterschiede akzeptiert nach Taylor zumindest der nicht-prozedurale Liberalismus. Da alle Gesellschaften multikultureller werden und Angehörige anderer Kulturen unsere philosophischen Grenzziehungen in Frage stellen, gilt es, uns mit dem Gefühl Andersdenkender auseinanderzusetzen, ohne unsere Grundprinzipien zu vernachlässigen. In bezug auf die Anerkennung ist die Ablehnung einer anderen kulturellen Verhaltensweise insofern problematisch, als daraus die historische, aus dem Kolonialismus herrührende, angebliche Überlegenheit westlicher Staaten als Verachtung aufgefasst werden kann.
Taylor prüft nun die weitergehende Forderung, die besagt, dass wir alle Kulturen als gleichwertig anerkennen und ihnen den gleichen Respekt entgegenbringen sollen. Diese Forderung nach Anerkennung wird heute ausdrücklich formuliert, was mit der neuen, oben beschriebenen Auffassung zusammenhängt, dass wir durch Anerkennung geformt werden und die Nichtanerkennung in den Rang eines Schadens erhoben wird. Nach Taylor hat Frantz Fanon entscheidend zu diesem Wandel beigetragen. Seine These lautet, dass es eine der mächtigsten Waffen der Kolonisatoren sei, den Unterworfenen ihr eigenes Bild des Kolonisierten aufzuprägen. Der Weg zur Befreiung aus diesem erniedrigenden Selbstbild sei die Gewalt. Die Vorstellung eines Kampfes, einerseits im Beherrschten und andererseits gegen den Herrscher, hat unter anderem im Feminismus wie auch in den Debatten um den Multikulturalismus Anklang gefunden.
Ein wichtiger Schauplatz dieser Auseinandersetzung ist der Bereich der Bildung, der Erziehung und der Universitäten. Es wird die Forderung erhoben dass nicht nur die weissen, „toten“ Autoren das Curricula bestimmen sollten, sondern, dass auch die Vertreter anderer Kulturen oder Minderheiten einbezogen werden. Begründet wird diese Forderung damit, dass den zuwenig beachteten Frauen und Angehörigen anderer Kulturen, direkt oder durch Unterlassung, ein abwertendes Bild ihrer selbst vermittelt wird. Dem liegt wiederum die Annahme zugrunde, dass alle Kulturen von gleichem Wert seien. Taylor sieht in dieser Annahme einen gültigen Kern, der anfechtbar ist und einen Glaubensakt zur Bedingung hat. Er sieht diese Annahme als Ausgangshypothese für das Studium anderer Kulturen. Da eine andere, uns fremde Kultur, nicht nur auf Grund unserer Kriterien untersucht werden kann, braucht es eine „Horizontverschmelzung“, die nur in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen erreicht werden kann. Es braucht ein neues Vergleichsvokabular, dass neben unserem gewohnten als eines unter mehreren möglichen besteht und so die Grundlage für eine inhaltliche Bestätigung der vorangegangenen Annahme bietet. Die Verweigerung dieser Annahme kann von den Multikulturalisten als Böswilligkeit und Vorurteil ausgelegt werden und als Arroganz, die Überlegenheit gegenüber unterworfenen Völkern zu bekräftigen.
Die Forderungen der Multikulturalisten stützen sich auf die Prinzipien der Politik der Gleichachtung und so wäre die Leugnung der Gleichwertigkeit der Kultur auch die Leugnung der Gleichwertigkeit der Individuen. „ So wie alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse und ihrer Kultur, gleiche Bürgerrechte und gleiches Wahlrecht haben sollen, so sollen sie auch in den Genuss der Annahme kommen, dass ihre traditionelle Kultur wertvoll sei“.(Taylor 1997, 65) Hier wird aber nun ein entscheidendes Merkmal der Politik der allgemeinen Menschenwürde, die „Differenzblindheit“, in Frage gestellt. Taylor ist sich nicht sicher, ob diese Gleichwertigkeit als Recht einzufordern wäre und er lässt es offen, weil die Forderung noch viel weiter geht. Der so verstandene Respekt der Gleichheit verlangt mehr als die Annahme, dass man mit der Beschäftigung der fremden Kultur, ihren „Wert“ erkennen kann. Sie verlangt, dass allen Hervorbringungen anderer Kulturen tatsächlich ein gleich grosser Wert beigemessen werden muss.
Nach Taylor ist daran etwas grundfalsch. Jede Kultur hat einen Rechtsanspruch darauf, dass die Beschäftigung mit ihr auf der Annahme beruht, dass sie einen gleichen Wert besitzt. Sie hat aber keinen Rechtsanspruch darauf, dass man am Ende der Beschäftigung mit ihr zum Urteil gelangt, dass sie wirklich wertvoll ist, oder den gleichen Wert besitzt, wie irgend eine andere Kultur. Man wird also etwas finden, das wertvoll ist, oder nicht, dieses zu fordern wäre aber unsinnig.
Taylor ist in diesen Fragen das Problem der Objektivität bewusst, er geht aber nicht weiter darauf ein, da es in diesem Kontext nur zur Konfusion führen würde.
Es geht hier gegen Urteile, die, scheinbar ungerechtfertigt, nicht-hegemoniale Kulturen als weniger Wert bezeichnen. Wären solche Urteile eine menschliche Willensentscheidung, so ginge es nicht um richtig oder falsch, sondern nur um Gefallen oder Missfallen. Es ginge also darum, ob man sich einer Kultur verbunden fühlt oder nicht. Die Anklage würde sich gegen die Verweigerung dieser Verbundenheit richten und nicht gegen das Urteil von Wert oder Unwert einer Kultur. „ Zuletzt lässt sich die Aussage, die Hervorbringungen einer anderen Kultur seien wertvoll, nicht mehr von der Aussage unterscheiden, man selbst stehe auf der Seite der anderen Kultur, auch wenn die Hervorbringungen durchaus nicht beeindruckend sind“. (Taylor 1997, 67) Die erste Aussage wird meist als Respektbezeugung verstanden und die zweite als Herablassung. Die Menschen anderer Kulturen wollen aber Respekt und nicht Herablassung und Theorien die diese Unterscheidung missachten verzerren die Realität, die sie untersuchen. Ein auf Verlangen abgegebenes positives Urteil wäre eine vorgespiegelte Achtungsbezeugung, eine Geringschätzung der Intelligenz und erniedrigend für Menschen anderer Kulturen. Eine Parteinahme und Solidaritätsbezeugung ohne gründliche Kenntnis anderer Kulturen wäre in diesem Sinne keine gute Lösung und würde die wirkliche Forderung, die nach Anerkennung und Respekt, verfehlen. Positive Urteile die auf eurozentrischen Kriterien basieren, ohne Horizontverschmelzung und ohne eine Auseinandersetzung mit der anderen Kultur, würden diese auch nur dafür rühmen, dass sie gleich sind wie wir. Die zwingende Forderung der Politik der Differenz nach positiven Werturteilen wäre sogar homogenisierend. „ Indem sie stillschweigend alle Zivilisationen und alle Kulturen an unseren eigenen Kriterien misst, kann die Politik der Differenz darin münden, dass sie alle gleichmacht“. (Taylor 1997, 69)
Der Ethnozentrismus ist in westlichen Gesellschaften tief verankert und führt zu krassen Aussagen. Saul Bellow schreibt beispielsweise, dass die Zulus zuerst einen Tolstoi hervorbringen müssen (...). Das meint einerseits, dass sie gleich sein müssen wie wir und dass sie andererseits, ihren Beitrag erst noch leisten müssen. Ein anderes Beispiel ist die Aussage von Roger Kimball, dass man nur zwischen Kultur und Barbarei wählen kann und nicht zwischen einer repressiven, westlichen Kultur und einem multikulturellen Paradies, wie es die Multikulturalisten fordern.
Allgemein ist festzustellen, dass weder eine rein kulturrelativistische, noch eine rein ethnozentrische Sicht, eine Lösung für das Zusammenleben verschiedener Kulturen bringt. Das ist weltweit, wie auch innerhalb einzelner Gesellschaften unmöglich.
Ausgehend von der Annahme der Gleichwertigkeit, als Grundhaltung für das Studium anderer Kulturen und der Frage, ob diese als ein Recht einzufordern wäre, fragt Taylor nun, ob wir uns den andern in dieser Haltung überhaupt nähern sollen oder nicht. Ein Grund dafür könnte religiöser Art sein, wie zum Beispiel die Vorstellung von Herder, dass die Vielfalt der Kulturen zu grösserer Harmonie führen soll und nicht als Zufall zu betrachten sei. Auch in einem elementaren Sinne gilt, dass jeweilige Kulturen mit ihrer eigenen Vorstellung von dem, was gut und gerecht ist, immer etwas beinhalten, was unseren Respekt verdient, auch wenn wir vieles ablehnen müssen. Dies auszuschliessen wäre ein Zeichen höchster Arroganz, wenn man dazu noch bedenkt, wie kurz unsere Rolle innerhalb der Geschichte der Menschheit ist. Diese Sicht verlangt keine gültigen Urteile über den gleichen Wert der Kulturen sondern die Offenheit, in vergleichenden Kulturstudien unseren Horizont zu erweitern und zu verändern. „ Vor allem verlangt sie von uns das Eingeständnis, dass wir von jenem letzten Horizont sehr weit entfernt sind, vor dem sich der relative Wert unterschiedlicher Kulturen deutlich erweisen würde“.(Taylor 1997, 71)
2. Jürgen Habermas: Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat
2.1 Grundzüge moderner Verfassungsstaaten
In der Einführung befasst sich Jürgen Habermas zuerst mit den Grundzügen moderner Verfassungen. Diese gründen auf einem freien Entschluss der Bürger, die sich gegenseitig Freiheit und gleiche Rechte zugestehen. Geschützt wird das einzelne Rechtssubjekt, die Integrität des Individuums hängt aber von einer intakten Struktur gegenseitiger Anerkennung ab. Die politische Macht teilt sich auf in institutionalisierte Problembearbeitung einerseits und andererseits in die verfahrensmässig geregelte Vermittlung der einzelnen Interessen. Zusammen bilden sie das System der Rechte. Auf politischer Ebene stehen sich kollektive Aktoren gegenüber, die um kollektive Ziele und Güter streiten und nur vor Gericht geht es um einklagbare, individuelle Rechte. Hinsichtlich des Kampfes um legitime Rechte kollektiver Aktoren stellt Habermas die Frage, ob diese mit einer individualistisch angelegten Theorie der Rechte in Einklang zu bringen sind. Er legt eine Bejahung nahe, weil sich der Kampf gegen ungleiche soziale Lebenschancen von Gesellschaftsschichten in einem Kampf um die sozialstaatliche Universalisierung von Bürgerrechten vollzogen hat. Der Status abhängiger Erwerbsarbeit, soll um soziale Teilhabe und politische Teilnahmerechte ergänzt werden. Die ungleichen Lebenschancen in der kapitalistischen Gesellschaft sollen durch eine gerechtere Verteilung kollektiver Güter kompensiert werden. Das wäre im Sinne von Rawls mit der individualistisch ausgelegten Theorie der Rechte vereinbar, da Grundgüter individuell verteilt und Infrastrukturen individuell genutzt werden können. Anders verhält es sich, wenn es um die Anerkennung kollektiver Identitäten und um die Gleichberechtigung kultureller Lebensformen und Traditionen geht. Diese Anerkennung wird zum Beispiel von Feministinnen und Minderheiten innerhalb von Gesellschaften, aber auch von ganzen Völkern, die nach nationaler Unabhängigkeit streben, gefordert. Habermas stellt nun die Frage, ob diese kollektiven Forderungen unseren auf subjektive Rechte zugeschnittenen, liberal demokratischen Rechtsstaat sprengen würden. Taylors Gedanken zu dieser Frage seien originell und brächten die Diskussion weiter, stellten aber den individualistischen Kern unseres modernen Freiheitsverständnisses in Frage.
2.2 Taylors Politik der Anerkennung
Habermas untersucht nun, ob die 1. Forderung, Achtung einer unverwechselbaren Identität jedes Einzelnen, mit der 2. Forderung, Achtung der jeweiligen spezifischen Handlungsformen kollidiert oder ob sich die 2. Forderung aus der 1. ergibt. Taylor geht davon aus, dass man sich für den Vorrang einer der zwei Positionen entscheiden muss. Nach Habermas spricht dafür folgende Überlegung: „ Weil (2) die Berücksichtigung eben der Besonderheiten fordert, von denen (1) zu abstrahieren scheint, muss sich der Gleichbehandlungsgrundsatz in gegenläufigen Politiken zur Geltung bringen – in einer Politik der Beachtung kultureller Differenzen auf der einen, in einer Politik der Verallgemeinerung subjektiver Rechte auf der anderen Seite. Die eine Politik soll den Preis ausgleichen, den die andere in Gestalt eines gleichmachenden Universalismus fordert“.(Habermas 1997, 151) Liberale wie Rawls und Dworkin fordern eine ethisch neutrale Rechtsordnung, innerhalb derer jeder die gleiche Chance hat, nach seiner eigenen Vorstellung zu leben. Taylor bestreitet aber die ethische Neutralität des Staates, welcher demzufolge auch aktiv eine bestimmte Konzeption des „guten Lebens“ fördern kann und bezieht sich dabei auf das Beispiel Quebec.
Der differenzblinde Liberalismus gewährt nach Taylor, basierend auf den Grundrechten, allen Subjekten die gleichen Rechte, die sie gerichtlich einfordern können. Das Prinzip der gegenseitigen Achtung bedeutet hier nur eine rechtlich geschützte Autonomie, in der jeder seinen persönlichen Lebensentwurf verwirklichen kann. Nach Habermas wird so die Autonomie des Individuums halbiert, weil die Bürger eines demokratischen Staates die Gesetze, nach denen sie sich richten, auch selber definieren müssen. Die Wahrnehmung der staatsbürgerlichen Autonomie beinhaltet gemeinsame Diskussionen über die verschiedenen berechtigten Interessen und Werte. Im Zusammenspielen von Rechtsstaat und Demokratie, im Sinne einer gemeinsamen Konsensfindung aller Beteiligten, ist das System der Rechte weder gegenüber sozialen- noch gegenüber kulturellen Differenzen blind. Die Tatsache, dass Menschen im Austausch mit anderen individuiert werden, verlangt, dass die Einzelnen in ihren identitätsbildenden Lebenszusammenhängen geschützt und anerkannt werden. Dazu braucht es nur die konsequente Verwirklichung des Systems der Rechte und kein Gegenmodell, wie Taylor es vorschlägt. Das geht aber nicht ohne soziale Bewegungen und politische Kämpfe.
Ein gutes Beispiel ist der Kampf der Frauen um rechtliche Gleichstellung, in dem es wie in der allgemeinen Rechtsentwicklung um die Dialektik zwischen rechtlicher und faktischer Gleichheit geht. Gleiche Rechte eröffnen allen Beteiligten individuelle Handlungsfreiheiten, fördern aber nicht unbedingt die faktische Chancengleichheit. Die erfolgte formale Gleichstellung der Frauen und die Loslösung der Rechte von der Geschlechtsidentität, zeigen um so mehr die tatsächlichen Benachteiligungen der Frauen. Die noch an traditionellen Mustern orientierte sozialstaatliche Politik, hat darauf mit speziellen Regelungen reagiert, welche die autonome Lebensgestaltung der Frauen wieder einschränken. Die Frauen werden weiter einer speziellen Klasse zugeordnet und die stereotypen Geschlechtsidentitäten so weiter gefestigt. Die selbstverständliche, traditionelle Einteilung der Geschlechterrollen wird heute durch den radikalen Feminismus erst richtig bewusst gemacht. Die Gleichmachung der Frauen in einer diskriminierenden Rolle soll einer chancengleichen individuellen Handlungsfreiheit Platz machen. Es geht nicht mehr darum, ob die Autonomie der Menschen durch subjektive Freiheiten oder durch objektive Leistungsansprüche gewährt wird, sondern um einen Wandel zu einer prozeduralen Rechtsauffassung. „ Die subjektiven Rechte, die Frauen eine privatautonome Lebensgestaltung gewährleisten sollen, können gar nicht angemessen formuliert werden, wenn nicht zuvor die Betroffenen selbst in öffentlichen Diskussionen die jeweils relevanten Hinsichten für die Gleich- und Ungleichbehandlung typischer Fälle artikulieren und begründen. Die private Autonomie gleichberechtigter Bürger kann nur im Gleichschritt mit der Aktivierung ihrer staatsbürgerlichen Autonomie gesichert werden“.(Habermas 1997, 157). Die Bürger eines demokratischen Staates müssen die Gleichbehandlung der verschiedenen, zusammenlebenden Gruppen sicherstellen, um diesen Dialog zu ermöglichen. Um das zu erreichen, braucht es nach Habermas wiederum nur die konsequente Verwirklichung eines demokratischen Verständnisses der Grundrechtsverwirklichung und keine systemfremden kollektiven Rechte.
2.3 Kämpfe um Anerkennung – die Phänomene und die Ebene ihrer Analyse
Es gibt verschiedene Gruppen, die um Anerkennung kämpfen und die man unterscheiden muss. Alle haben gemeinsam, dass sie gegen Missachtung und Unterdrückung kämpfen, innerhalb von Gesellschaften wie auch innerhalb der Weltgemeinschaft. Obwohl es in erster Linie um kulturell definierte, politische Ziele geht, sind auch soziale- und ökonomische Ungleichheiten wichtig. Habermas nennt vier Phänomene:
a) Feminismus
b) Multikulturalismus
c) Nationalismus
d) der Kampf gegen das eurozentrische Erbe des Kolonialismus
a) Der Feminismus unterscheidet sich von den anderen Phänomenen, weil er nicht eine Minderheit betrifft und weil er sich gegen die asymmetrische Interpretation der Geschlechterverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft richtet. Veränderungen in den Interessen und im Selbstverständnis der Frauen betreffen das ganze Werteregister der Gesellschaft. Die Folgen dieser Veränderungen greifen bis in die privaten Kernbereiche und stellen das Selbstverständnis der vorherrschenden Männer in Frage.
b) b) Die um die Anerkennung ihrer Identität kämpfenden, ethnischen und kulturellen Minderheiten wehren sich gegen Benachteiligungen und Ausgrenzung. Auch sie verändern das Selbstverständnis einer Gesellschaft, aber nicht in dem Masse wie der Feminismus. Diese Emanzipationsbewegungen können von kulturellen Minderheiten innerhalb eines Staates oder von Immigranten ausgehen und bilden kein einheitliches Phänomen. Grosse ethnische, rassische oder religiöse Unterschiede, wie auch der Fundamentalismus, können die Probleme verschärfen.
c) Im Nationalismus geht es um ethnisch und sprachlich homogene Gruppen, die einen eigenen Staat bilden wollen. Auch hier gibt es verschiedene Formen. Zum Beispiel im Kontext der Entkolonialisierung, oder nach dem Zusammenbruch grosser Imperien, wie dem Osmanischen Reich und Österreich-Ungarn. Eine andere Gruppe bilden die nationalen Minderheiten, wie Basken, Kurden oder Nordiren, die durch neue Grenzziehungen bei Nationalstaatsbildungen entstanden sind.
d) Beim Eurozentrismus geht es um die auf internationaler Ebene ausgetragenen Anerkennungskämpfe. Im Golfkrieg beispielsweise ist die Vorherrschaft der westlichen Kultur, von den religiösen Massen wie von säkularisierten Intellektuellen, als Missachtung ihrer Identität aufgefasst worden. Dasselbe gilt für das Verhältnis der Ersten zur Dritten Welt.
Laut Habermas geht es im Fall von Quebec um eine Mischung von (b) und (c). Durch den Wunsch der Quebeciens nach kultureller Vorherrschaft in ihrem Territorium würden aber nur neue Minderheiten entstehen.
Habermas führt noch drei Ebenen der Analyse an, welche die Überlegungen von Taylor berühren.
- Zum einen geht es um die amerikanischen Intellektuellen und um den Streit, ob die Curricula weiterhin von den alten Klassikern bestimmt werden sollen, oder ob auch neuere Werke aus verschiedenen kulturellen Kontexten aufgenommen
- werden sollten. Nach Habermas trägt diese Debatte weder zur Analyse der Anerkennungskämpfe noch zu politischen Lösungen etwas bei.
- Die Frage, ob wir mit unseren eurozentrischen Kriterien den Wert einer anderen Kultur erkennen oder gar bewerten können, betrifft den im engeren Sinne philosophischen Diskurs in Taylors Analyse.
- Eine dritte Ebene ist die von Recht und Politik.
Nach Habermas liegt Taylors Vorschlag auf der Bezugsebene von Recht und Politik. Es geht um die Frage, welche Rechte Minderheiten in komplexen Gesellschaften zustehen.
Das moderne Recht hat eine künstliche Struktur und beruht auf normativen Vorentscheidungen. Habermas beschreibt es so: „ Das moderne Recht ist formal, weil es auf der Prämisse beruht, dass alles, was nicht explizit verboten ist, erlaubt ist. Es ist individualistisch, weil es die einzelne Person zum Träger von subjektiven Rechten macht. Es ist zwingendes Recht, weil es staatlich sanktioniert und sich nur auf legales oder regelkonformes Verhalten erstreckt- z.B. die Religionsausübung freistellen, aber keine Gesinnung vorschreiben kann. Es ist positives Recht, weil es auf die - änderbaren - Beschlüsse eines politischen Gesetzgebers zurückgeht, und es ist schliesslich prozedural gesatztes Recht, weil es durch ein demokratisches Verfahren legitimiert wird.“ (Habermas 1997, 163) Eine Rechtsordnung muss nicht nur legales Verhalten fordern, sondern sie muss auch legitim sein, wenn sie die gleichmässige Autonomie aller Bürger sichern soll. Da es rechtlich gesehen ohne Demokratie keinen Rechtsstaat gibt, müssen die in der öffentlichen Diskussion erarbeiteten Entscheide von allen getragen werden. Das Prinzip der Volkssouveränität braucht, will es legitimes Recht gewährleisten, Grundrechte für die rechtliche Institutionalisierung des demokratischen Prozesses.
2.4 Die ethische Imprägnierung des Rechtsstaats
Wenn es um das Zusammenleben von verschiedenen kulturellen Lebensformen geht, also um unterschiedliche Vorstellungen von gutem Leben, stellt sich immer die Frage nach der ethischen Orientierung des politischen Systems. Konkret wird diese Frage in Bezug auf das Rechtssystem, wenn es zu Konflikten kommt. Ethische Grundeinstellungen basieren stark auf Wertvorstellungen und dem Selbstverständnis der jeweiligen Gruppen. „ Ethischen Fragen ist die Referenz der ersten Person und damit der Bezug zur Identität (eines Einzelnen oder) einer Gruppe grammatisch eingeschrieben.“ (Taylor 1997, 165) Die liberale Forderung nach ethischer Neutralität des Rechts untersucht Habermas nun am ethisch – politischen Selbstverständnis einer Nation von Staatsbürgern. Nach dem „differenzblinden“ Liberalismus soll der Staat nur die Grundrechte garantieren. Im Liberalismus nach Taylor soll er daneben auch kollektive Ziele verfolgen dürfen, wie zum Beispiel das Überleben einer kulturellen oder religiösen Teilgruppe.
Die Tatsache, dass in der Rechtstheorie das Individuum einen absoluten Vorrang vor kollektiven Zielen hat, rechtfertigt nicht die kommunitaristische Auffassung von Taylor, dass das Rechtssystem gegenüber kulturellen Ansprüchen blind ist. Jedes Rechtssystem beinhaltet neben politischen Zielsetzungen auch kollektive Ziele. Innerhalb eines abgegrenzten Staatsgebietes werden Rechtsnormen aufgestellt, mit denen ein Volk auf sich selbst einwirkt. Hier drückt sich das Selbstverständnis eines Kollektives aus, dessen Willens- und Meinungsbildung auf Grund kultureller Unterschiede ein weites Spektrum aufweist. „ Neben moralischen Erwägungen, pragmatischen Überlegungen und den Ergebnissen kfairer Verhandlungen gehen eben auch ethische Gründe in die Beratungen und Rechtfertigungen legislativer Entscheidungen ein.“ (Habermas 1997, 167) In der Diskussion über Werte, über weiterzuführende oder abzubrechende Traditionen oder über das Selbstverständnis einer Gemeinschaft, können sich Kulturkonflikte entzünden, in denen sich Minderheiten gegen eine Mehrheitskultur zur Wehr setzen. Der Grund für solche Konflikte ist nicht die ethische Neutralität der staatlichen Rechtsordnung, sondern die Tatsache, das jede Rechtsgemeinschaft und jeder demokratische Prozess ethisch eingefärbt ist. Habermas nennt die Verfassung als den Bezugsrahmen pluralistischer Gesellschaften. Zugleich verkörpern die darin lebenden Individuen ihre identitätsbildenden Lebensformen. Dies bildet den Horizont für die Interpretation der Verfassung und für die Entscheidungsfassung. Wenn sich die Zusammensetzung der Gesellschaft verändert, ändert sich der Interpretationshorizont und das führt zu anderen Ergebnissen. Auf diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass Minderheiten wie zum Beispiel die Bürger von Quebec kulturelle Autonomie fordern, um die Grundgesamtheit der am demokratischen Prozess beteiligten Bürger zu verändern. Dies würde aber nur neue Minderheiten bilden. Eine auf Konsens beruhende Konzeption des Guten zu verfolgen, ist mit der Theorie der Rechte zu vereinbaren, sie darf aber nicht eine Lebensform auf Kosten einer anderen privilegieren.
2.5 Gleichberechtigte Koexistenz versus Artenschutz
Westliche Einwanderungsländer werden durch die zunehmende Zahl von Immigranten in ihrer gesellschaftlichen Zusammensetzung verändert. Quebec, das sich dagegen wappnen will, indem es kulturelle Autonomie anstrebt, würde aber nur eine englische gegen eine französische Mehrheitskultur eintauschen. Eine multikulturelle Gesellschaft mit einer liberalen Kultur, in der es möglich ist, frei über verschiedene Vorstellungen und Lebensformen zu diskutieren, ermöglicht auch das Anstreben gleichberechtigter Koexistenz unterschiedlicher kultureller Gruppen. „ Denn die Integrität der einzelnen Rechtsperson kann, normativ betrachtet, nicht ohne den Schutz jener intersubjektiv geteilten Erfahrungs- und Lebenszusammenhänge garantiert werden, in denen sie sozialisiert worden ist und ihre Identität ausgebildet hat“. (Habermas 1997, 172) Das Individuum hat nach W. Kymlicka ein Recht auf kulturelle Mitgliedschaft, woraus sich unter anderem auch das Recht nach kultureller Selbstbestimmung ableitet. Dieser rechtliche Anspruch und nicht die von Taylor formulierte „Annahme des gleichen Wertes“, ist die Basis für die gegenseitige Anerkennung der Individuen. Das System der Rechte, welches den Schutz des Individuums garantiert, braucht nach dieser Auslegung keine systemfremden kollektiven Rechte für die gleichberechtigte Koexistenz verschiedener ethnischen Gruppen. Kulturelle Lebensformen müssen ihre Mitglieder überzeugen, denn sie können keinen Artenschutz verordnen. Die Entscheidung, eine Tradition fortzuführen, sie zu transformieren oder ihr den Rücken zuzuwenden, um neue Wege zu gehen, muss ihren Mitglieder überlassen werden. Der Staat kann nur die individuelle Lebensgestaltung ermöglichen. Die schnelle Veränderung einer modernen Gesellschaft erlaubt keine gleichbleibenden Lebensformen.
Eine mögliche Reaktion auf diese schnelle Veränderung ist der Fundamentalismus , der versucht, mit der Rückbesinnung auf und dem Einfrieren von Traditionen Ultrastabilität zu bewahren. Er lässt aber keinen Spielraum für die Auseinandersetzung, von verschiedene Weltbildern innerhalb von Gesellschaften. Habermas schreibt: „ In multikulturellen Gesellschaften kann die rechtsstaatliche Verfassung nur Lebensformen tolerieren, die sich im Medium solcher nichtfundamentalistischer Überlieferungen artikulieren, weil die gleichberechtigte Koexistenz dieser Lebensformen die gegenseitige Anerkennung der verschiedenen kulturellen Mitgliedschaften verlangt: Jede Person muss auch als Mitglied von Gemeinschaften anerkannt werden, die um jeweils andere Konzeptionen des Guten integriert sind“.(Habermas 1997, 177)
Habermas beschreibt zwei Formen von Integration, die getrennt werden müssen: Die politische Integration, welche alle Staatsbürger gleichmässig erfasst und die ethische Integration von unterschiedlichen kollektiven Identitäten. Die politische Integration verlangt die Loyalität aller gegenüber der politischen Kultur, welche auf der Interpretation der Verfassung beruht. Hier wird, in sich verändernden Gesellschaftszusammensetzungen, um die jeweils beste Interpretation der Grundrechte und Prinzipien gestritten. Diese bilden den festen Bezugspunkt eines jeden Verfassungspatriotismus. Das macht die politische Kultur einer Gemeinschaft aus, welche aber ethisch nicht neutral sein kann. Dieser ethische Gehalt eines Verfassungspatriotismus darf aber die neutrale Rechtsordnung nicht beeinträchtigen, sondern er sollte den Sinn für die Verschiedenheiten einer multikulturellen Gesellschaft schärfen. Dazu ist die Trennung der beiden Integrationsebenen wichtig. Dadurch, dass in heutigen komplexen Gesellschaften kein einheitlicher Wertekonsens mehr zu erreichen ist, ist auch die Neutralität des Rechts eher gewährleistet, zumindest aber gefordert.
2.6 Immigration, Staatsbürgerschaft und nationale Identität
Auf dem vorher beschriebenen Hintergrund stellt Habermas noch die Frage, ob ein Gemeinwesen nicht das Recht hat, die Immigration zu begrenzen, um seine politisch – kulturelle Lebensform intakt zu halten. Dabei ist wichtig, wieviel Assimilation eine demokratische Gemeinschaft von Einwandern verlangen kann. Er nennt zwei Stufen von Assimilation. Einerseits die Zustimmung zur ethisch – politisch gefärbten Interpretation der Verfassung, also die Assimilation an das öffentliche Verständnis von Autonomie und Vernunft. Andererseits die Akkulturation, also die Bereitschaft zur Einübung der am Ort praktizierten Lebensweise. Die politische Integration hat im Verhältnis zur Akkulturation, weniger Auswirkungen auf die Identität der Immigranten wie auch des ansässigen Gemeinwesens. Dennoch werden beide Gruppen auf die Dauer nicht vor Veränderung bewahrt. Dies wiederum verändert mit der Zeit den Horizont, mit dem ein Staatsvolk, seine Verfassung interpretierend, neue Regeln formuliert, mit denen sie auf sich selber einwirkt.
Habermas untersucht noch die Frage, wer überhaupt ein Recht auf Einwanderung hat. Unbestritten gibt es ein Recht auf Asyl für Menschen, deren Leben oder Freiheit infolge politischer, religiöser, rassischer oder sozialen Gründen bedroht ist. Die meisten Menschen flüchten aber wegen Armut und Arbeitsmangel in die wirtschaftlich erfolgreichen, westlichen Länder. Gerade gegen diese Menschen, welche auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben sind, wollen sich diese Länder verschliessen. Gegen diese Abschottung und für eine liberale Einwanderungspolitik lassen sich moralisch gesehen einige Gründe anführen. In der Zeit der Kolonisation, die hauptsächlich von den Europäern ausging, wurden viele Kulturen entwurzelt und durch willkürliche Grenzziehungen resultierten ethnische Spannungen, die bis heute anhalten. Dazu profitieren die kapitalistischen Staaten, früher wie auch heute, von wirtschaftlichen Beziehungen, unter anderem durch die Stützung totalitärer Regime, die viele Länder in der Armut halten. Geschichtlich gesehen waren die Europäer zwischen 1800 und 1960 stark an interkontinentalen Wanderungsbewegungen beteiligt und haben in doppelter Hinsicht profitiert. Einerseits konnten die Ausgewanderten durch die Inbesitznahme von Land ihren Wohlstand mehren und andererseits wurden so die Lebensbedingungen der Daheimgebliebenen verbessert. Im Wiederaufbau nach dem Krieg und im darauf folgenden wirtschaftlichen Aufschwung profitierte Europa dann von der Einwanderung. So gesehen hat Europa immer wieder von diesen Wanderungsströmen profitiert. Heutzutage sind die europäischen Staaten, infolge Überalterung und aus wirtschaftlichen Gründen auf Einwanderung angewiesen.
Das Bewusstsein der oben genannten Sachverhalte, ist für Europäer wichtig, um die Akzeptanz und Toleranz zu entwickeln, welche für eine gegenseitige Anerkennung unabdingbar ist.
3. Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt
Nach Kälin bewegt sich die Grundrechtsdogmatik in westlichen, liberal demokratischen Staaten in einem Spektrum zwischen Assimilation und Multikulturalismus. Beide Positionen werden kaum mehr in absoluter Weise vertreten und die Beurteilungen der Grundrechtspraxis höchster Gerichte zeigen, dass sie sich mehr beim einen oder anderen Pol ansiedeln. In diesem dritten Teil möchte ich nur die fünf von Kälin im ersten Kapitel seines Buches beschriebenen grundrechtspolitischen Konzepte vorstellen. Diese zeigen, auf welche verschiedene Arten westliche Verfassungsstaaten die Grundrechte interpretieren und anwenden. Kälin stellt die Frage: „ Welche Ansätze für den Umgang mit kulturell begründeten Grundrechtsansprüchen haben Grundrechtspraxis und –Theorie entwickelt, und was sind ihre spezifischen Stärken und Schwächen?“ (Kälin 2000, 19) Unterschiede entstehen einerseits durch verschiedene Verfassungsordnungen, andererseits durch den Spielraum, der durch die Universalisierung der Grund- und Menschenrechte entstanden ist. Dieser lässt Raum für die grundrechtspolitischen Konzepte, welche auch den Umgang mit der Frage individueller oder kollektiver Rechte beeinflussen.
Die fünf grundrechtspolitischen Konzepte sind: Die Politik der Neutralität, die Politik des Schutzes der eigenen Identität, die Politik des Minderheitenschutzes, die Politik der Anerkennung und die Politik des Multikulturalismus.
3.1 Die Politik der Neutralität
Nach diesem Prinzip verhält sich der Staat gegenüber weltanschaulichen Belangen neutral. Diesem Ansatz zum Umgang mit kulturell begründeten Grundrechtsansprüchen kommt in der Schweiz und in Deutschland grosse Bedeutung zu. Wichtig ist die Nichtidentifikation des Staates, das heisst, er soll nichts Besonderes zu seinem Eigenen machen und somit zum Allgemeinen. Dennoch gibt es in der Schweiz Sonderrechte, beispielsweise für die Landeskirchen, die das Recht haben Steuern zu erheben.
Nach Kälin dient die Politik der Neutralität „der gesellschaftlichen Friedenssicherung, schützt individuelle Freiheit und erleichtert die Identifikation der Privaten mit dem Staat; insofern erfüllt die weltanschauliche Neutralität des Staates unverzichtbare Funktionen auch im Umgang mit „neuen“ kulturellen und religiösen Minderheiten“.(Kälin, 2000, 51)
Das Neutralitätsprinzip ist sehr offen und kann eher als eine Richtlinie oder allenfalls als oberstes Leitprinzip dienen. Der Schutz für das Individuum resultiert aus den Grundrechten und nicht aus dem Neutralitätsprinzip. Allerdings kann das Neutralitätsprinzip Grundrechtskonkretisierungen in eine bestimmte Richtung leiten. Man unterscheidet zwischen einem negativen „laisser faire“ Neutralitätsverständnis (blosse Toleranz) und der positiven Neutralität, welche alle Gruppierungen und Weltanschauungen gleich berücksichtigt. Einer positiven Neutralität mit der Pflicht zur Förderung und Anerkennung der Pluralität ist der Vorzug zu geben. Es gilt also zu wählen zwischen dem Negativen, Keiner von beiden, und dem Positiven, Jeder von beiden.
Wichtig ist die Frage nach den Grenzen der Neutralität und der Toleranz gegenüber Unterdrückung und Gruppierungen, die selber intolerant sind. Jürgen Habermas schlägt vor, dass multikulturelle Gesellschaften nur Lebensformen tolerieren können, welche die gegenseitige Anerkennung verschiedener Lebensformen akzeptieren.
Als Grenzen der Neutralität gegenüber Unterdrückung innerhalb von Gruppen schlägt Kälin vor, dass einzugreifen ist, wenn unterdrückte Mitglieder ihre Gruppe nicht verlassen können, wenn sie sich der Beschneidung ihrer Rechte nicht freiwillig unterziehen und wenn eine kulturelle Tradition grundlegende Werte der Verfassungsordnung grundsätzlich in Frage stellt.
3.2 Die Politik der eigenen Identität
In diesem Konzept wird die kulturelle Identität der Mehrheit in den Vordergrund gestellt. Sobald diese gefährdet ist, besteht die Gefahr, dass die Rechte von Minderheiten begrenzt werden. Dieses Konzept ist im deutschsprachigen Raum sehr populär und zeigt sich in nationalistischen und den damit zusammenhängenden ausländerfeindlichen Tendenzen. Zugrunde liegt diesem Konzept der Bezug auf die christlich geprägte Zivilisation und die damit zusammenhängende, im Volk wirksame Sittlichkeit. Diese ist in die profane Kultur eingegangen und bildet die Wertgrundlage europäischer Staaten. Gemeint ist der Gesamtbestand ethischer Grundeinsichten welche einen staatstragenden ethischen Grundkonsens ermöglichen.
Für die Rechtsprechung stellt die diesem Konzept zugrundeliegende Doktrin drei Entscheidungsgrundlagen in den Vordergrund:
- die lebensweltlichen- und kulturellen Voraussetzungen des Verfassungsstaates
- die sittlichen Grundlagen des Gemeinwesens
- das rechtliche „ordre public“ im Privat- und Verfassungsrecht
Dieses Konzept verkennt ein zentrales Anliegen der Grundrechtsidee. Auch in der Demokratie sind dem Mehrheitsentscheid durch die Grundrechte Grenzen gesetzt. Das ist wichtig, um die Personenwürde oder eine kulturelle Minderheit zu schützen. Die Unterdrückung einer Minderheit mit Bezugnahme auf die sittliche oder kulturelle Identität einer Mehrheit würde die Grundrechtsidee in ihr Gegenteil verkehren und könnte zu einer Tyrannei der Mehrheit führen.
Eine solche Ethnisierungstendenz suggeriert eine falsche Homogenität und wäre eine romantisierende, nicht mehr der Realität entsprechende Vorstellung. Die Vorstellung, dass ein Kollektiv rassisch, kulturell oder religiös homogen ist, entspricht einer vormodernen Sichtweise, die keine Individualrechte kannte.
Die westlichen Verfassungsstaaten sind ein Produkt der Moderne. In ihnen gilt, dass Menschen als Individuen mit Individualrechten anerkannt sind. Es zählt das „Subjektivitätsprinzip“ als kulturelle Identität und nicht die Identität der Mehrheit.
Die Politik der eigenen Identität kann zu einer Verfestigung aktueller Identitäten führen und das zentrale Merkmal moderner Verfassungsstaaten, die grundsätzliche Offenheit und Wandelbarkeit behindern.
3.3 Die Politik des Minderheitenschutzes
Die Politik des Minderheitenschutzes ist sozusagen das Gegenstück der Politik der eigenen Identität. Sie zeigt sich in der Schweiz im Schutz von lokalen Sprachen wie beispielsweise dem Rätoromanischen, aber auch in den schon erwähnten Sonderrechten der Landeskirchen. Oft betrifft der Minderheitenschutz nur traditionelle Minderheiten mit Bürgerrecht und nicht neu eingewanderte Gruppen. Artikel 27 des UN Paktes über bürgerliche und politische Rechte enthält aber keine Beschränkung auf Staatsangehörige. Das Recht auf gemeinsame Pflege der Kultur, Sprache und Religion gilt für alle Personen in einem Land, die über einen festen Wohnsitz verfügen. Es handelt sich um individuelle und nicht um kollektive Rechte. Die kollektive Dimension wird aber ernst genommen, weil die spezielle Identität oft nur im Kollektiv gelebt werden kann. Ausserdem ist das Ausüben eines Assimilationsdruckes gegenüber MigrantInnen verboten.
Kritiker wenden ein, dass der Schutz von kollektiven Minderheiten gegen die individualistische, bürgerschaftliche Integration moderner Verfassungsstaaten verstösst. Individuen sollen sich aufgrund von Freiheitsrechten gemäss ihrer kulturellen Prägung entfalten können. Die Ethnizität einer Gruppe darf nicht als Differenzierungsmerkmal für Kollektive gelten und es sollen keine ethnischen Eigenarten durch einen Gruppenschutz konserviert werden.
3.4 Die Politik der Anerkennung
Charles Taylor, der den Begriff der Politik der Anerkennung geprägt hat, ist es wichtig, dass kulturelle Differenzen nicht nur anerkannt werden, sondern dass sie auch ernst genommen und geschützt werden. Kulturell andersartige Gruppen sollen durch die Pflege ihrer kulturellen Identität ihren Fortbestand sichern können. Nach Taylor wäre es zulässig, Individualrechte zugunsten eines Kollektives zu beschränken. Liberale halten dagegen, dass individuelle Freiheiten von Minderheiten innerhalb einer Gruppe wie auch von Dritten nicht beschränkt werden dürfen, auch wenn eine kulturelle Gruppe in ihrem Bestand gefährdet ist. Individuelle Rechte gehen immer vor kollektiv Rechte.
Die Politik der Anerkennung ist wichtig, um das Bewusstsein für die gleichberechtigte Koexistenz von Lebensformen zu schärfen. Sie kann für jeden Bürger die gesicherte Chance bieten, ungekränkt in einer kulturellen Herkunftswelt aufzuwachsen, um dann selbst gewählt eine Tradition weiterzuführen oder abzulehnen.
Der Schutz von Kollektiven birgt aber eine Gefahr für dissidente oder schwächere Gemeinschaftsmitglieder sowie für die Wandlungsfähigkeit demokratischer Gesellschaften.
3.5 Politik des Multikulturalismus
Multikulturalismus als Politikkonzept existiert in typischen Einwanderungsländern wie Kanada und Australien. Diese Politik des Multikulturalismus enthält folgende Elemente:
- Unterstützung der verschiedenen Gruppen zum Erhalt der kulturellen Identität
- Förderung des interkulturellen Austausches
- Anspruch auf Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung aller Einwohner
- Respekt und Anerkennung gegenüber der Verfassung und der Grundrechte
- Das Recht, die eigene kulturelle Identität zu leben verlangt, das gleiche Recht allen anderen zuzugestehen
Die Politik des Multikulturalismus hat zum Ziel, alle Mitglieder von Minderheiten in die gelebte Staatsbürgerschaft einzubeziehen.
Dieses Konzept gibt allen Einwanderungsgruppen und internen Minderheiten das Recht und die Sicherheit, dass sie ihre eigene Identität behalten können und dennoch gleichberechtigt am neuen Gemeinwesen teilnehmen können. Dazu braucht es spezielle Anstrengungen, um den Austausch der Gruppen zu gewährleisten und um ein beziehungsloses Nebeneinander der Kulturen zu verhindern.
Als Kritik wird angeführt, dass dieses Konzept die Gleichheit nur vorspiegelt und dass sich ethnische Minderheiten aufgrund ihres tiefen sozialen Status weit weg von einer realen Chancengleicheit befinden.
Für die europäischen Länder lassen sich aus diesem multikulturellen Konzept dennoch drei Lehren ziehen:
- Die Rücksichtsname auf die kulturelle Pluralität
- Wenn die gleichberechtigte kulturelle Pluralität auf eine gleichberechtigte Teilhabe ausgerichtet ist, muss sie den nationalen Zusammenhalt nicht gefährden, sondern kann umgekehrt integrativ wirken
- Toleranz allein reicht nicht, die kulturelle Vielfalt zu erhalten, sondern es braucht gesetzgeberische, finanzielle und institutionelle Fördermassnahmen
Alle diese oben beschriebenen grundrechtspolitischen Konzepte existieren, wie schon beschrieben, nicht in einer Reinform und könnten für sich auch nicht voll überzeugen. Sie weisen aber alle auf berechtigte und wichtige Gesichtspunkte hin und beeinflussen in den verschiedenen Ländern die Anwendung der Grundrechte.
Schlussbetrachtung
Ausgehend von der Frage der gegenseitigen Anerkennung von Menschen in demokratisch liberalen Staaten im Allgemeinen stiess ich während meiner Arbeit auf die Auseinandersetzung „Individuelle oder kollektive Rechte“ im Speziellen. Wie ich später merkte, ist dieser Punkt ebenfalls in meiner Fragestellung enthalten und zeigt sich mir als zentrale Auseinandersetzung in der Anerkennungsfrage.
Die Frage, ob der Staat nur Individualrechte oder auch kulturelle Gruppen als Kollektiv schützen soll, wird heutzutage im Rahmen der politischen Philosophie intensiv und kontrovers diskutiert. Das moderne liberale Verständnis westlicher Verfassungsstaaten, welches das Individuum schützt, wirft immer wieder die Frage nach dem Stellenwert des kulturellen Kontextes auf. Einerseits wird die Wichtigkeit der kulturellen Lebenswelt betont, in der das Individuum seine Identität ausbildet und andererseits können durch den Schutz von ganzen Kollektiven die Individualrechte eingeschränkt und in Frage gestellt werden.
Ich bin mit Taylors These über die Anerkennung einverstanden, aber nicht mit seinem politischen Lösungsvorschlag. Taylor stellt die Freiheit des Individuums und die Idee des Liberalismus an sich in Frage, wenn er Gruppenrechte zum Erhalt einer Kultur vor die individuellen Rechte stellt. Er garantiert zwar die grundlegenden Freiheitsrechte, zeigt aber nicht auf, wo die Grenze zwischen universellen Grundrechten und Sonderrechten verläuft.
Dieses Liberalismus- Modell, welches Taylor in heutigen, kulturell pluralistischen Gesellschaften als angemessen sieht, finde ich sehr problematisch. Weil Gesellschaften kulturell nicht homogen sind, würden bei Sonderrechten zu Handen einer kulturellen Gruppe neue Minderheiten entstehen. So wie die Quebeciens im Verhältnis zu ganz Kanada eine Minderheit stellen, würden danach die Englischsprachigen in Quebec als Minderheit gelten. Die Vorstellung einer kulturell und/oder ethnisch definierten Gesellschaft entspricht nicht mehr der Realität moderner Einwanderungsstaaten. Die Gefahr, dass eine nationalistische Politik entstehen würde und dass individuelle Rechte hinter Mehrheitsentscheiden zurückstehen müssten, wäre gross.
Habermas hingegen betont die politische und private Autonomie des Individuums. Auch er anerkennt, dass Menschen im Austausch, innerhalb ihres kulturellen Kontextes, ihre Identität ausbilden. Das Individuum soll aber selbst entscheiden können, ob es eine Tradition fortführen will oder nicht. Es wird also nicht ein Kollektiv als Ganzes geschützt, sondern das Individuum hat ein Recht auf kulturelle Mitglied- schaft. Der Verfassungspatriotismus von Habermas und die dazugehörige politische Integration (Assimilation) ohne Akkulturation von Migranten passt in dieses Konzept.
Diesem Konzept von Habermas stehen aber reale Umstände erschwerend im Wege. Es fehlt die politische Partizipation der ausländischen Wohnbevölkerung. Solange das politische Teilnahmerecht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist, sind Ausländer mittels Verweigerung der Einbürgerung von den politischen Diskussionen ausgeschlossen. Hier stellt sich die Frage, wie lange es sich ein Gemeinwesen wie z.B. die Schweiz noch leisten kann, grosse Teile der Bevölkerung (ca. 20%) vom Prozess der Meinungsbildung auszuschliessen. Eine Ausnahme und ein Grund zur Hoffnung bilden die Kantone Neuenburg und Jura, in denen das Stimmrecht auf kantonaler Ebene auch für die ausländische Wohnbevölkerung zählt. Auch Bern geht mit seinem Integrationsleitbild neue Wege, und sieht die Partizipation von MigrantInnen in einer Fachkommission und in einem Forum vor.
Es ist leider eine Tatsache, dass sich viele SchweizerInnen nicht mehr politisch engagieren und somit die lebendige, einer Demokratie angemessene Diskussionsbereitschaft weitgehend fehlt. Sehr wohl können sich bei öffentlichen Diskussionen über Werte und Vorstellungen vom „guten Leben“ Konflikte entzünden, die man zum Teil nicht wird lösen können. Die Probleme wären aber öffentlich benannt, diskutiert und würden weniger im Versteckten schwelen. Nach meiner Auseinandersetzung mit diesem Thema glaube ich nicht mehr, dass es verfassungsrechtliche Garantien geben kann, mit denen alle zufrieden wären und dass Gemeinschaften ohne Auseinandersetzungen und Kämpfe organisiert werden können.
Der Idee einer offenen Gesellschaft einiger politischer PhilosophInnen (Habermas, Tibi, Benhabib) stehen heutzutage starke nationalistische Bestrebungen entgegen in der Form einer Politik der eigenen Identität.
Ich denke, dass die momentanen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen grosse Teile der Bevölkerung verunsichern. Die auch daraus folgende Verunsicherung in der eigenen Kultur könnte die Akzeptanz für Menschen anderer Kulturen erschweren und so die Abgrenzungsformel „Wir/Sie“ stärken.
Eine ähnliche Entwicklung ist in der gesamten EU zu beobachten, wo sich viele Mitgliederländer auf ihre nationalen Werte besinnen und somit die gesamteuropäische Integration ins Stocken bringen. Dennoch sind im Moment Bestrebungen im Gange, eine europäische Verfassung zu formulieren. Ich denke, das wird grosse Diskussionen auslösen und es wird spannend sein, diesen Prozess zu beobachten.
Das Buch von Seyla Benhabib, „Kulturelle Vielfalt und demokratische Freiheit“ hat mir geholfen, mich in der Diskussion über individuelle oder kollektive Rechte nach Anerkennung zurechtzufinden. Sie selber vertritt einen diskurstheoretischen Ansatz, der dem von Habermas sehr nahe ist und der mir als sehr geeignet für heutige Gesellschaften scheint.
Wichtige Punkte in Seyla Benhabibs Konzept:
- Aufgrund der Prämisse der Diskursethik sind nur diese Normen gültig, denen alle in einem Diskurs zwangsfrei zustimmen können.
- Diese Metanorm setzt eine universale moralische Achtung und eine egalitäre Reziprozität voraus. Gemäss der universellen Achtung sollten wir einander als Menschen betrachten,
- die alle das Recht auf einen eigenen Standpunkt haben. Egalitäre Reziprozität meint, dass wir, um das diskursive Ideal zu verwirklichen, soziale Verhaltensweisen kultivieren sollten, welche uns erlauben, einander zu fördern, den eigenen Standpunkt zu artikulieren.
- Trotz der Annahme, dass Kultur identitätsstiftend ist, muss allen die grösstmögliche Chance an kultureller Interpretation, Erneuerung und Neuschöpfung eingeräumt werden. Es ist den Individuuen die Wahlmöglichkeit zu lassen und braucht keine Gruppenrechte auf Verfassungsstufe.
- Im Unterschied zu Habermas lehnt Benhabib die strikte Trennung von Gerechtigkeit und „gutem Leben“ in der Ethik ab, stellt aber diese Trennung für Staat und Gesetzgeber nicht in Frage. Die Misshandlung oder Unterdrückung von Frauen beispielsweise darf nicht länger als Privatangelegenheit der Familie angesehen werden. Solche Themen gehören in der Öffentlichkeit diskutiert, im Sinne eines moralischen Lernprozesses, ohne aber dem Staat eine Bevormundung der Bürgers zu erlauben. Vorrangig ist die Demokratisierung der Sittlichkeit vor der Erhaltung tradierter Lebensformen.
- Seyla Benhabib ist wichtig, dass die moralische Autonomie nicht der ästhetischen Pluralität untergeordnet wird. Das heisst, dass sie gegen den staatlichen Schutz derjenigen kulturellen Lebensformen ist, welche ihrerseits die Würde ihrer Angehörigen und im Speziellen wieder der Frauen missachten. Der Staat muss aber allen Bürgern, inklusive allen ethnischen, kulturellen und sprachlichen Minderheiten, Schutz gewähren. Dies muss mittels Diskurs und nicht mit Zwang erreicht werden. Seyla Benhabib schreibt:“Diese Gewährleistung kann jedoch nicht durch gewaltsame Zwangsmassnahmen erfolgen; sie kann auch nicht durch bevormundende Sozialarbeit geschehen (...). Der liberaldemokratische Staat kann die Verwirklichung universeller staatsbürgerlicher Rechte fördern, indem er in der Zivilgesellschaft und der Öffentlichkeit die Bedingungen schafft, mit deren Hilfe diese Gruppen Teilnehmer eines öffentlichen Dialoges werden und alle Beteiligten bzw. Betroffenen ihre eigenen Erzählungen von Identität und Differenz selbst präsentieren können. (Benhabib 2000, 69)
- Sie räumt aber ein, dass solche Diskurse auch riskant sein können. Es ist nicht sicher, ob sie zu einer Verständigung oder Polarisierung führen; ob sie traditionelle Lebensformen auflösen oder zu einer Wiederauflebung führen. Es ist nicht zwingend, dass moralische Autonomie zu Konflikten führt, aber wenn es geschieht, sagt Seyla Benhabib, ist es wichtig zu wissen, wo wir als kritische Intellektuelle stehen.
Ich denke, die grosse Herausforderung in der Zukunft wird sein, die gesamte Bevölkerung in die politischen Prozesse einzubeziehen. Die ausländische wie die einheimische Bevölkerung sollte sich im Sinne der Diskursethik an öffentlichen Diskussionen über Werte und Bedürfnisse beteiligen, um dann gemeinsam darüber zu entscheiden. Das setzt aber eine Bejahung der kulturellen Pluralität und ein neues Bewusstsein im Umgang mit „Fremden“ oder „Fremdem“ voraus. Etwas, das nicht sein darf, kann auch nicht bewusst diskutiert und organisiert, geschweige denn anerkannt werden.
Literaturverzeichnis
- Taylor, Charles u.a.: Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Mit einem Beitrag von Jürgen Habermas. Frankfurt am Main, 1997, S. 13-78, Fischer
- Habermas Jürgen: In Charles Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Frankfurt am Main, 1997, S. 147-196, Fischer
- Kälin, Walter: Grundrechte im Kulturkonflikt. Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Zürich, 2000, NZZ Verlag
- Benhabib, Seyla: Kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit. Politische Partizipation im Zeitalter der Globalisierung, 2. Auflage 2000, Frankfurt am Main, Fischer, „Horkheimer Vorlesungen“
[...]
[leh1] das ist eine schwer überladene Einleitung des satzes. In Kanada ging es vor einigen jahren darum, die kanadische Verfassung an das amerikanische Rechtssystem anzugleichen. Dabei ging es insbesondere um einen Katalog von (Grund?)rechten, der als juristische Basis für die verfassungsgerichtliche Überprüfung wovon? etwa Gesetzesbeschlüssen dienen sollte. Das müssten Sie etwas genauer sagen. Etwa so. Bei der Formulierung dieses kataloges stiess man auf das Problem, ob nicht die kulturelle Eigenart und überhaupt das kulturelle Überleben der provin z Quebec und verschiedener Ureinwohner in diesen katalog aufgenommen und d.h. ein Recht auf Besonderheit anerkannt werden sollte. etc
- Arbeit zitieren
- Stefan Wetzel-Siegenthaler (Autor:in), 2002, Wie verhält es sich mit der Anerkennung individueller und kollektiver Identitäten im modernen liberal- demokratischen Rechtsstaat?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107752
Kostenlos Autor werden








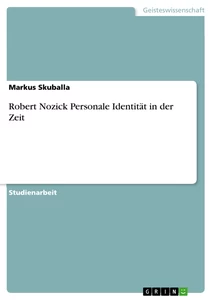









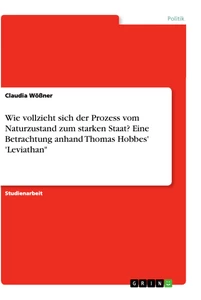

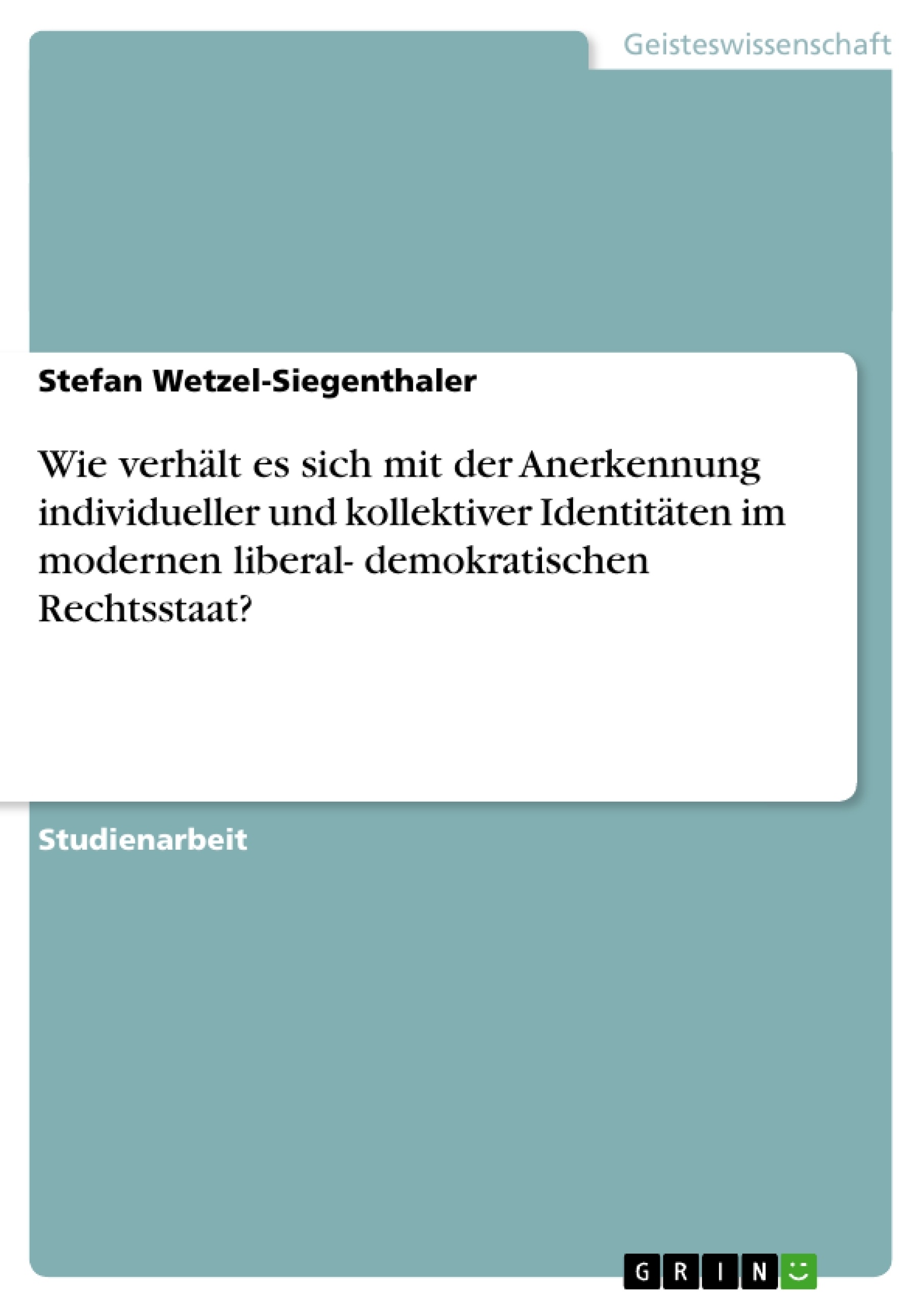

Kommentare