Leseprobe
Gliederung
I. Einleitung .
1. Einführung
2. Soziale Arbeit vor der Industrialisierung
II. Hauptteil
1. Einzelhilfe in der Industrialisierung und der Weimarer Republik
1.1 Das Eberfelder System
1.2 Bismarcksche Sozialgesetzgebung
1.3 Charity-Organisation-Societies und Mary Richmond
1.4 Die „Settlement-Houses“-Bewegung und Jane Addams
1.5 Das Werk von Alice Salomon .
2. Einzelhilfe nach dem 2. Weltkrieg
2.1 Die Nachkriegszeit 1945–1950
2.2 Rezeptionsphase 1951–
2.3 Konsolidierung und Aufruhr 1960–1970 .
2.4 Methodenkritik und „Machtwechsel“
III. Schlussteil
1. Zusammenfassung
2. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
1. Einführung
„Die Bezeichnung >Einzelhilfe< sagt aus, dass die Hilfe im dyadischen System, also im Gegenüber von Sozialpädagogen/Sozialpädagogin bzw. Sozialarbeiter/Sozial-arbeiterin auf der einen, Klient/Klientin auf der anderen Seite geleistet wird“ (ERLER 2000, S. 84, zit. nach: ROBERTS / NEE 1974).
Einzelhilfe (auch Einzelfallhilfe oder case-work genannt) ist eine Arbeitsform der sozialen Arbeit, die sich bestimmter Mittel (àMethoden) bedient. Weitere Arbeitsformen in der sozialen Arbeit sind gruppenbezogene und sozialraumbezogene Methoden.
In meiner Studienarbeit beschreibe ich die historische Entwicklung der Einzelhilfe, v.a. nach der Industrialisierung. Dabei soll der Schwerpunkt auf den wesentlichen Veränderungen und Umbrüchen liegen.
2. Soziale Arbeit vor der Industrialisierung
Ursprünglich war soziale Arbeit in vorindustrieller Zeit Armenfürsorge.
Dies wurde bis etwa zu Beginn des 15. Jahrhunderts von der Kirche und von den Klöstern übernommen. Kirchen verteilten Almosen, klösterliche Gemeinden versorgten Arme. Hier stand jedoch nicht die reine Nächstenliebe im Vordergrund, sondern vielmehr das Erlangen des Seelenheils der Gebenden. Soziale Hilfeleistung war somit nur eine Art „Nebenprodukt“ großzügiger Spenden (vgl. ERLER 2000, S. 51 ff).
Es entwickelte sich allmählich ein Bettelhandwerk und erste Bettelordnungen (z. B. die Freiburger Bettelordnung (1517) oder die Armenordnung von Nürnberg (1522)) und das Bettelamt entstanden. Das Betteln wurde somit bürokratisiert.
Gegen Ende des Mittelalters, im 17. Jahrhundert, stand die Erziehung immer mehr im Vordergrund. Pestalozzi (1746–1827) gründete zahlreiche Waisenhäuser und Kinder-heime, in denen er seine Idee, Zwang, Disziplin und Arbeit durch menschliche Nähe, Überzeugung und soziale Bildung zu ersetzen, umsetzte (vgl. ERLER 2000, S. 70). „Aus diesem Denkmuster heraus bereitete sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die private Wohltätigkeit aus.“ (ERLER 2000, S. 70)
II. Hauptteil
1. Einzelhilfe in der Industrialisierung und der Weimarer Republik
1.1 Das Elberfelder System
1853 wurde in der Stadt Elberfeld ein System der Armenversorgung entwickelt. Dieses kennzeichnete die Unterscheidung von arbeitsfähigen und –unfähigen Armen. Das Elber-felder System war von vier Grundsätzen geleitet:
1. Ehrenamtlichkeit der Arbeit (d.h. Armenpfleger waren unbezahlt tätig)
2. Individualisierung der Wohlfahrtspflege (d.h. max. vier Familien pro Pfleger)
3. Dezentralisierung der kommunalen Wohlfahrtspflege (d.h. die Stadt war in Bezirke mit je einem ehrenamtlichen Vorsteher, die Bezirke wiederum in Quartiere mit je einem Armenpfleger aufgeteilt)
4. Vermeidung von Dauerleistungen (d.h. Unterstützung max. für 14 Tage)
Das Elberfelder System war nach dem Individualprinzip ausgerechnet. 1905 wurde es durch das Straßburger System abgelöst. Die ehrenamtliche Arbeit wurde abgeschafft, es gab nun einen Innen- und Außendienst (vgl. ERLER 2000, S. 67 f).
1.2 Bismarcksche Sozialgesetzgebung
Die von Bismarck verfasste „Kaiserliche Botschaft“ vom 17.11.1881 ist als Geburtsurkunde einer staatlichen, auf den Ausgleich wirtschaftlicher Ungleichheit und von Belastungen unter den gesellschaftlichen Schichten gerichtete Sozialpolitik anzusehen.
Seine Sozialgesetzgebung umfasste sowohl die Sozialistengesetze als auch Krankenversicherung, Unfallversicherung und Invaliden- und Altersversicherung. Die Sicherung des Arbeitsplatzes bei Krankheit, Unfall oder Invalidität war somit gewährleistet und die meisten Jugendlichen waren somit frei von unmittelbarer Existenzbedrohung in Notfällen.
Durch diese ersten Sozialgesetze konnten zahlreiche pflegerische, schützende, betreuende, allgemein- und berufsbildende Aufgaben der Sozialpädagogik erst beginnen oder wirksam werden.
1.3 Charity-Organisation-Societies und Mary Richmond
Die Wurzeln des „Case Work” liegen in den USA. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die Forderung nach einheitlicher und wissenschaftlich fundierter Hilfe aufgrund des zunehmenden sozialen Elends und der uneinheitlichen Praxis der Armenhilfe. Die Charity-Organisation-Societies (COS), die sich ab 1877 in Amerika etablierten, fühlten sich durch dieses Problem angesprochen und gefordert und wollten, ohne Almosen zu geben, Hilfe organisieren: Ehrenamtliche, aber ausgebildete, Helferinnen („friendly visitors“) sollten über protokollierte Hausbesuche (à Kontrollfunktion) und ihre Vorbildrolle Veränderungen bewirken, wobei die Unterstützung und die Selbsthilfe im Vordergrund stehen sollten; die Organisation sollte die Zusammenarbeit der Wohlfahrtsorganisationen in einer Kommune fördern und Listen über die Hilfebedürftigen führen (vgl. NEUFFER 1990, S. 24).
„Die Charity Organisation Societies setzten auf die Rekonstruktion individueller Lebens-, Erziehungs- und Arbeitsfähigkeit ihrer Problemfamilien durch die analytischen und pädagogischen Qualitäten der sie besuchenden ehrenamtlichen Helferinnen. Soziale Reformen (...) waren durch sie nicht beeinflussbar“ (MÜLLER 1988, S. 120).
Trotz ihrer fehlenden Ausbildung in Sozialarbeit und Sozialwissenschaften wurde Mary E. Richmond (1861-1928) zu einer der bedeutendsten Gestalten in den COS. Sie arbeitete zunächst im Büro im Altamont Hotel in New York als Schatzmeisterin, wo sie sich mit der Wohlfahrtspflege vertraut machte, übernahm aber bald darauf die Aufgabe eines friendly visitors und wurde Gruppenleiterin in einem Club für junge Arbeiterinnen. 1891 wurde Mary Richmond als Nachfolgerin von Zilpha Smith zur Geschäftsführerin des Wohlfahrtsverbandes ernannt (vgl. MÜLLER 1988, S. 99-100).
Bereits 1899 formulierte Mary Richmond in ihrer Veröffentlichung „Friendly Visotors among the Poor“ erste Prinzipien einer methodischen sozialen Arbeit und ihr umfangreiches Werk „Social Diagnosis“ (1911), das auf der Praxis der Hilfen für Arme basiert, wurde zu einem Standardwerk der sozialen Arbeit. Darin stellt sie die Arbeitsweise der COS systematisch dar und fasst bisherige Arbeitsvollzüge und Leitgedanken zusammen, indem sie sich vor allem auf die Ermittlung von Fakten, ihre Interpretationen und die dazugehörenden Ermittlungstechniken konzentriert; der Behandlung eines Falles weist sie noch keine Bedeutung zu (vgl. NEUFFER 1990, S. 24-25).
Mary Richmond war der Überzeugung, dass Armut und Hilfebedürftigkeit „aus der individuellen Lebensgeschichte und dem gegenwärtigen Netzwerk sozialer Beziehungen stammten, in das der Hilfesuchende und seine Familie eingebunden seien“ (MÜLLER 1988, S. 119). Diese Hilfebedürftigkeit wollte sie durch Prozesse sozialen Lernens beseitigen, nicht durch punktuelle, materielle Gaben (vgl. MÜLLER 1988, S. 119).
1.4 Die „Settlement-Houses“-Bewegung und Jane Addams
Neben den COS entstand in den USA zeitgleich die Settlement-Houses-Bewegung, die sich im wesentlichen dadurch kennzeichnete, dass sich die Settlements strukturellen Problemen zuwandten und gleichzeitig sozialreformerische Änderungen durchzusetzen versuchten. Die Settlement-Houses-Bewegung war die Grundlage für die spätere Gemeinwesenarbeit und Soziale Gruppenarbeit (vgl. NEUFFER 1990, S. 26).
„Die Settlements bauten auf eine Doppelstrategie zwischen Verbesserungen der Infrastruktur im Wohnquartier und Beschneidung unternehmerischer Willkür im Arbeitsleben durch gewerkschaftliche Organisation und staatliche Arbeitsgesetzgebung“ (MÜLLER 1988, S. 120).
Die erste Settlement-Einrichtung entstand 1884 durch Samuel Barnett (1844–1913). Er nannte sie „Toynbee-Hall“, zu Ehren des verstorbenen Vorarbeiters Arnold Toynbee. Mit dieser Gründung begann die Settlement-Houses-Bewegung, das Gegenstück zur organisierten Einzelfallhilfe der COS (vgl. WENDT 1995, S. 153).
Die Wohl berühmteste Vertreterin der Settlement-Bewegung war Jane Addams (1860–1935). Sie ließ sich 1889 zusammen mit ihrer Freundin Ellen Starr in Chicago nieder und gemeinsam planten sie, in einem Arbeitsbezirk ein Haus zu etablieren, in das kranke und untätige junge Frauen gehen und den Armen helfen konnten. Wenig später entstand „Hull House“ und die Gründerinnen formulierten ihre Ziele: „(es ist die Aufgabe von Hull House), ein Zentrum für ein höheres öffentliches und soziales Leben zu sein; Einrichtungen der Bildung und der Philanthropie zu gründen und zu unterhalten, und die Lebensbedingungen in den industriellen Bezirken von Chicago zu untersuchen und zu verbessern“ (LINN, ADDAMS 1935, S. 110, zit. nach: MÜLLER 1988, S. 73).
Jane Addams und ihre Mitarbeiterinnen bezeichneten ihre Gründung als „social settlement“, wobei „social“ gesellschaftlich, gesellig und sozial im Sinne von „auf Mitmenschen bezogen“ bedeutete.
Die Gründerinnen von Hull House richteten in ihrem Gebäude zunächst einen Kindergarten ein, dann gründeten sie einen Jungenclub und einen Club italienischer Mädchen. Als Zielgruppe definierte Jane Addams jedoch nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen. Ihre Maßnahmen sollten dazu dienen, berufstätigen Frauen das Leben zu erleichtern.
Sowohl die Aktivitäten als auch die Räumlichkeiten von Hull House wurden ausgeweitet, was meist von privaten Spenderinnen finanziert wurde (vgl. MÜLLER 1988, S. 60–77).
Zusammenfassend kann man sagen, Jane Addams und die Settlement-Houses-Bewegung strebten nach einer „Lösung der sozialen und industriellen Probleme (...), die durch die Lebensbedingungen einer modernen Großstadt geschaffen werden“ (WENDT 1995, S. 157).
Dabei reichten die Initiativen von Hull House vom Eintreten für Verbesserungen im Schulwesen, Aufklärung der Bevölkerung über demokratische Rechte bis hin zu Beteiligungen an Arbeitskämpfen. Hull House wuchs so zu einem Zentrum soziokultureller Aktivitäten heran, und viele Besucher nahmen sich Anregungen für ähnliche Gründungen.
1900 gab es in den USA bereits etwa 100 Settlements und auch in anderen Ländern fasste das Konzept längst Wurzeln (vgl. WENDT 1995, S. 157 – 160).
1.5 Das Werk von Alice Salomon
Nach der Reichsgründung 1871 nahm im deutschen Kaiserreich die Industrialisierung und Urbanisierung rasch zu, was zur Folge hatte, dass bisherige soziale Zusammenhänge zerstört wurden. Die staatliche Wohlfahrtspolitik reagierte darauf mit sozialen Reformen, darunter die Schaffung der sozialen Versicherung und die Gründung kommunaler sozialer Dienste. Bedroht von sozialistischen Arbeiterbewegungen reagierte das Bürgertum mit Reformbewegungen, wobei vor allem die bürgerliche Frauenbewegung bedeutsam ist. Es ging darum, die Schwachen durch soziale Hilfen wieder in die Gesellschaft zu integrieren (vgl. NEUFFER 1990, S. 27).
Diese Entwicklung wurde maßgeblich von Alice Salomon (1872 – 1948) geprägt, die 1908 in Berlin die erste akademische Sozialpädagogikschule („Soziale Frauenschule“) gründete und mit dem Prinzip der „geistigen Mütterlichkeit“ („Mütterlichkeit als Beruf“) Frauen geeigneter für sozialpädagogische Tätigkeiten hielt als Männer. Der Beruf der Wohlfahrtspflege war bis dahin ein ausschließlich von Männern ausgeübter Beruf (vgl. ERLER 2000, S. 73).
Angeregt durch die Settlement–Bewegung gründete sie 1898 mit anderen Frauen das erste Arbeiterinnen–Heim in Berlin. Ab 1899 organisierte Alice Salomon Jahreskurse in der Wohlfahrtspflege, woraus sich 1908 die Soziale Frauenschule im Pestalozzi–Fröbel–Haus entwickelte, welche eine zweijährige Ausbildung anbot. Diese Schule leitete sie bis 1925.
„Die Qualifizierung ehrenamtlicher sozialer Arbeit durch Ausbildung und die stärkere Nachfrage nach ausgebildeten Kräften in der Jugend- und Gesundheitsfürsorge leiteten die Professionalisierung der sozialen Arbeit um die Jahrhundertwende ein“ (NEUFFER 1990, S. 29).
In Anlehnung an Mary Richmonds Lehrbuch „Social Diagnosis“ brachte Alice Salomon 1926 ihr Buch „Soziale Diagnose“ heraus, in welchem sie die soziale Diagnose als ein Instrument beschreibt, das die Ganzheitlichkeit der sozialen Arbeit erfassen soll, die sich auf den ganzen Menschen einstellt, alle Seiten des menschlichen Lebens zu einem Gesamtbild vereinigt und somit den Ausgangspunkt für Hilfeleistungen und schließlich das Ziel bestimmt. Dabei stützt sie sich vor allem auf die Ermittlung von Tatbeständen (Sammeln, Registrieren und Interpretieren von Daten). In ihrem Lehrbuch erarbeitet Salomon Grundlinien für eine Theorie des Helfens, darunter die Individualisierung, Berücksichtigung der Umweltfaktoren und die Hilfe zur Selbsthilfe.
1917 gründete sie die „Konferenz Sozialer Frauenschulen Deutschlands“, die sie bis 1933 leitete. Dadurch konnten durchgängige Standards der Ausbildung für soziale Berufe entwickelt werden. Die Ausbildung gliederte sich somit in die drei Hauptfächer Gesundheitsfürsorge, Jugendwohlfahrtspflege/Jugendfürsorge und allgemeine und wirtschaftliche Wohlfahrtspflege. Das Unterrichtsfach Methodenlehre war im Lehrplan von zentraler Bedeutung. Methodische Fragen wurden noch nicht behandelt, jedoch waren erste methodische Ansätze ersichtlich (vgl. NEUFFER, 1990, S. 28-37).
2. Einzelhilfe nach dem 2. Weltkrieg
2.1 Die Nachkriegszeit 1945–1950
Nach dem zweiten Weltkrieg war die soziale Arbeit in Deutschland vor eine große Aufgabe gestellt. Zahllose Kriegstote und –gefangene und die Vertreibung rissen Familien auseinander und der Mangel an Nahrung, Kleidung und Heizmaterial raubten der Bevölkerung die Kräfte. Krankheiten und Kriegsverletzungen stellten das Gesundheitswesen vor fast unlösbare Aufgaben und in der Bevölkerung fand ein Wertewandel statt. „Die Sozialpolitik erhielt (...) den Charakter einer reaktiven und korrigierenden Instanz in Form von leistungsbezogenen Versicherungen und nicht den einer umfassenden Sozialversorgung“ (NEUFFER 1990, S. 61).
Nach Kriegsende wurden alle aktiven Nationalsozialisten aus den Sozialverwaltungen entlassen (Entnazifizierung), was zu einem Fachkräftemangel führte.
Im Mai 1946 fand in Frankfurt die erste Fürsorgetagung nach dem Krieg statt. Während dieser Tagung verwies Wilhelm Polligkeit auf die Hauptaufgaben der Fürsorge, welche vor allem die Stärkung der Familien als „Keimzellen der Gesellschaft“ und als Erziehungsträger waren. Dies sei am besten durch den Grundsatz der Industrialisierung, den Ausbau der Methoden der Fürsorge und durch die Förderung der freien Wohlfahrtspflege zu erreichen. Gleichzeitig beklagte Elisabeth Bamberger, Leiterin des Münchner Jugendamtes, dass die Jugend zunehmend verwahrlose und kriminalisiert werde; es sollte Schutz für heimatlose Jugendliche gewährt werden, verwahrloste Frauen und Mädchen sollten untergebracht und männlichen Jugendlichen Arbeitserziehung angeordnet werden. Es wurde eine einheitliche Familienfürsorge gefordert; die meistgenannte Lösung war die Zuordnung der Familienfürsorge zu den Jugendämtern.
Bedingt durch die Kriegsfolgen und die Entnazifizierungsverfahren fiel ein großer Teil früherer beruflicher Fachkräfte aus, was die Ausbildung an Sozialen Schulen erschwerte. Erste Maßnahmen nach Kriegsende waren Kurse und Kurzzeitlehrgänge, um Ersatzkräfte einstellen zu können.
Im November 1950 gab es bereits 33 Wohlfahrtsschulen. Auffallend war ein starker Zustrom von Männern in den sozialen Ausbildungssektor.
Im Juli 1947 trat in Stuttgart zum ersten Mal die Konferenz der Wohlfahrtsschulen zusammen. Die Dreiteilung in die Schwerpunkte Wirtschafts-, Jugend- und Gesundheits-fürsorge, die den Rahmenrichtlinien von 1933 entsprach, wurde nach 1945 wieder Grundlage der Ausbildung.
Nach Kriegsende traf Kultur aus Amerika in Deutschland mit amerikanischen Methoden der sozialen Arbeit zusammen. Insbesondere, was das Casework betraf, fiel der deutschen sozialen Arbeit der Umgang mit den methodischen Konzepten aus den USA schwer.
Bereits 1946 wurde ein erstes Austauschprogramm für Sozialarbeiter entwickelt („Area Division for Occupied Areas“), das ab 1947 auch verwirklicht wurde, mit dem Zweck des Methodentransfers. Zwischen 1948 und 1956 nahmen insgesamt 16.228 Personen aus vorwiegend sozialen und pädagogischen Berufen an diesem Austauschprogramm teil, in dem die Teilnehmer vor allem in entsprechenden Einrichtungen in Amerika bei Kollegen hospitieren und das dortige berufliche Handeln kennenlernen sollten.
Martha Krause-Lang, die bereits 1948 in Amerika u.a. die Schools of Social Work in Chicago und Washington kennenlernte, wagte als eine der ersten den Einstieg in die Vermittlung methodischer Elemente an der Münchner Sozialen Frauenschule, an der sie als Dozentin beschäftigt war. Später erschien das Fach „Methodik der Einzelhilfe“ im Ausbildungsplan (vgl. NEUFFER 1990, S.56–95).
„Die erste Phase des Methodentransfers aus den USA war hauptsächlich auf die Wirkung von Persönlichkeiten abgestellt, die natürlich nur an wenigen Stellen Eindruck hinterlassen konnten (...). Der Versuch unterblieb, die breitere Fachöffentlichkeit über den bis dahin erreichten Stand der Methoden in den USA (...) zu informieren, ebenso der Frühzeitige und breite Aufbau von methodischen Fortbildungsangeboten“ (NEUFFER 1990, S 89).
2.2 Rezeptionsphase 1951–1959
Nach 1951 war der Alltag der Familien durch Konsum bestimmt und durch die um sich greifende Individualisierung gekennzeichnet. Diejenigen Menschen, die dem konsum- und leistungsorientierten Trend nicht nachkommen konnten, sammelten sich in Randgruppen; Flüchtlingslager wurden zu Obdachlosensiedlungen.
„Die Notstände, zu deren Milderung oder Behebung die Sozialarbeit um Hilfe angegangen wird, verlagern sich immer mehr von außen, vom Materiellen, nach innen, auf Schwierigkeiten des Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt“ (PFAFFENBERGER 1959, S. 69, zit. nach: NEUFFER 1990, S. 99). Durch diesen Perspektivenwandel verstärkte sich die Suche nach adäquaten Methoden sozialer Arbeit.
1951 wurde das Jugendschutzgesetz geändert, 1953 das Jugendgerichtsgesetz und das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Die Aufgaben der Jugendfürsorge wurden um „freiwillige Erziehungshilfe“, Erziehungsberatungsstellen und „Pflegenester“ (Vorstufe von Kleinstheimen) erweitert.
Dennoch war das Bemühen in dieser Zeit sehr stark, mit neuen Inhalten und methodischen Konzepten die Professionalisierung der Sozialen Arbeit voranzutreiben. 1958 setzte die „Düsseldorfer Konferenz“ eine Ausbildungsreform in Gang. Wesentliche Änderungen waren u.a. die Einführung einer dreijährige Ausbildung, die Aufhebung der Dreiteilung in Hauptfächer und die Einführung von Vertiefungsgebieten. Weiterhin zielte die neue Ordnung auf eine engere Verknüpfung von Theorie und Praxis ab und legte das Berufspraktikum in die Verantwortung der Schulen.
Ab Mitte der 60er Jahre lag wieder eine einheitliche Ausbildung vor und der Unterricht war nicht mehr durch das enge Verhältnis zwischen Schülern und Dozenten geprägt, sondern stofforientiert.
Nach anfänglicher Zurückhaltung schlossen sich die Sozialen Schulen der Arbeit der IASSW (International Association Schools of Socialwork) an und Deutschland erreichte allmählich den Anschluss an die internationale Diskussion. Bereits 1956 fand in München die turnusmäßige Tagung der IASSW statt. Darüber hinaus nahmen mehrere internationale Seminare Einfluss auf die deutsche soziale Arbeit.
1952 fand in Genf ein Studienkreis zur Einführung in die Methoden des Casework statt, den das Europäische Amt der Vereinten Nationen veranstaltete.
Diese Beispiele sollen aufzeigen, dass die Methodendiskussion nicht nur von dem direkten Austausch mit den USA lebte.
In dieser Zeit war Marie Kamphuis eine Wegbereiterin; sie entwickelte die ersten eigenständigen, aus der europäischen Situation begründeten Gedanken für ein Casework-Konzept.
1951 hielt Marie Kamphuis einen Vortrag über „Social Casework“, bei dem sie darauf hinwies, dass ein Grundelement europäischer Methodenkonzepte darin bestand, historische Gegebenheiten in Verbindung mit der Methodenlehre zu bringen.
1963 wurde ihr bereits 1950 in den Niederlanden erschienenes Lehrbuch „Wat is Social Casework“ übersetzt und in Deutschland herausgegeben. Es wurde zu einem Standartwerk vor allem an den Höheren Fachschulen für Sozialarbeit.
Neben den Sozialen Schulen forcierten besonders die sich neu konstituierenden Berufs-verbände den Anspruch an methodische Fortbildung. Zwei Säulen der Fortbildungsarbeit bauten sich auf: Fortbildungsseminare und örtliche wie regionale Arbeitsgemeinschaften.
An den Sozialen Schulen begann parallel zu den Fortbildungen in der Praxis das Ringen um die Einführung des Faches „Methoden- und Praxislehre“; im Jahr 1955 hatten von etwa 35 Sozialen Schulen bereits 21 das Fach Methodenlehre in den Lehrplan eingeführt oder würden es in Kürze aufnehmen; in anderen Schulen wurden Methoden der sozialen Arbeit in den Fächern Pädagogik, Psychologie oder Wohlfahrtspflege eingebaut.
Wenn auch nur als eines unter vielen und nicht als das zentrale Fach der Ausbildung setzte sich das Fach Methodenlehre letztendlich als eigenständiges Element im Lehrplan durch.
Zur Zeit der Rezeption von Casework gab es sehr unterschiedliche Ansichten über die eigentliche Bedeutung und die Aufgabe von Sozialer Einzelfallhilfe. Die Autorität des Helfers (des „Caseworkers“) war eine Kernproblematik, die sich in Deutschland aufgrund der hierarchischen und bürokratischen Tradition besonders stellte. Ein weiterer Streitpunkt war das Aufnehmen von schwierigen Klienten und das Zulassen von Aggression; dieser Ansatz wurde in den USA unter dem Stichwort „Aggressive Casework“ diskutiert. Das Arbeitsmittel „Gesprächsführung wurde immer mehr beachtet. Für Annette Garrett bildeten psychologische Erklärungen, Betonung des subjektiven Ansatzes, die nichtrichtende Haltung, die helfende Beziehung und Akzeptanz den Rahmen ihres Gesprächsführungskonzeptes.
Kennzeichnend für die Rezeption des Casework waren u.a. vielfältige Widerstände gegen diesen Aneignungsprozess, geprägt durch die beiden Reizworte „Freud“ und „Technik“. Unter dem Stichwort „Freud“ setzte sich die katholische Kirche mit der Psychoanalyse auseinander. Sie bemängelte, dass der religiöse Hintergrund bei der Einzelfallhilfe ausgeklammert würde. Unter dem Begriff „Technik“ sah man die Gefahr, dass im Casework sozialarbeiterisches Handeln entpersönlicht und mechanisiert werden könne. Am inhaltlichen Konzept wurde kritisiert, dass die Konzentration auf den Einzelfall die Sicht auf größere und grundsätzlichere Zusammenhänge verstellen könne.
Im Allgemeinen kann man einen starken Wandel der sozialen Arbeit und des Casework nach 1950 feststellen, sowohl in den USA als auch in Europa.
Vor allem die Stellung des Sozialarbeiters und des Berufsstandes sind hier zu beachten.
Nach 1950 erwarb der Sozialarbeiter aufgrund seiner akademischen Ausbildung eine gleichberechtigte Stellung gegenüber Ärzten und Psychologen. Über die Professionalisierung des Berufsstandes gab die Berufsstruktur Aufschluss: von 12.000 voll ausgebildeten Sozialarbeitern (alle Mitglied in der Berufsorganisation American Association of Social Work (AASW)) ordneten sich 81% dem Casework zu, 12% dem Groupwork, der Rest setzte sich aus Verwaltungs- und Organisationsfachleuten zusammen.
Das Casework-Konzept differenzierte sich nun immer mehr. In den Grundprinzipien wandelte sich das Verständnis in Bezug auf die Beteiligung der Klienten als nun mehr aktiv Mitwirkende, jedoch verhinderte die Konzentration auf den intrapersonalen Aspekt und die Übertragungsproblematik die Sicht auf soziokulturelle Einflüsse.
Ein neuer Denkansatz bestand darin, die Familie des Klienten in die Diagnose und Behandlung mit einzubeziehen; die Behandlung richtete sich allerdings nach wie vor an den einzelnen oder jeweils getrennt an mehreren Familienmitgliedern aus.
Dieser Behandlungsansatz wandelte sich: Robert Gomberg demonstrierte, wie mehrere Familienmitglieder oder gar die ganze Familie in die Behandlung einbezogen werden konnten.
Unter dem Stichwort „Aggressive Casework“ (s.o.) sollten nun nicht mehr nur schwierige Klienten, sondern ab sofort auch Klienten, die der Hilfe negativ gegenüber standen, geholfen werden. Dieser neue Methodenansatz wurde in den 50er Jahren durch den Anstieg von sozialen Problemen, wie z.B. Jugendkriminalität, erforderlich.
In den USA begann in den 50er Jahren in bezug auf das Casework eine Hinwendung zu den Sozialwissenschaften, woraus sich eine Reihe von einzelnen Lehrmeinungen und Schulen mit einer unübersichtlichen Vielzahl von Einzelforschungen entwickelte (vgl. NEUFFER 1990. S.96-147).
2.3 Konsolidierung und Aufruhr 1960-1970
Zu Beginn der 60er Jahre verabschiedete der Bundestag Reformen zum Jugendwohlfahrts- und Bundessozialhilfegesetz. Darin wurde die Individualisierung der sozialen Hilfe und ein Rechtsanspruch des Sozialhilfeempfängers (jetzt Hilfesuchender statt Hilfebedürftiger genannt) festgeschrieben; ebenso wurde die persönliche Hilfe gesetzlich geregelt. Das neue Gesetz ließ jedoch Spielraum für Initiativen und Interpretationen, und auch die Anforderungen an die Ausführenden der persönlichen Hilfe blieben vage und interpretierbar. Somit ist deutlich, dass die Sozialpolitik der 60er Jahre keinen entscheidenden Fortschritt für die soziale Arbeit brachte.
Wolfgang Bäuerle (1925-1982), Leiter des Sozialpädagogischen Instituts Hamburg, verwies auf die Problemstellungen der sozialen Arbeit in dieser Zeit; u.a. nennt er die Spannung zwischen dem staatlichen Auftrag und dem Anspruch auf eigene berufliche Identität und die Spannung zwischen modernen methodischen Konzepten und dem erfahrungsorientierten praktischen Handeln.
Die Wohlfahrtsschulen, gewandelt in Höhere Fachschulen für Sozialarbeit mit dreijähriger Ausbildung und Berufsanerkennungsjahr, strebten nun nach innerer Qualifizierung, nach einer Integration von Theorie und Praxis als Grundlage der Ausbildung und nach einer Mit- und Selbstverwaltung der Studierenden. Anfang der 60er Jahre überwogen noch die hauptamtlichen Dozentinnen, doch schon 1962 erhielten Fachakademiker mit beruflicher Erfahrung (aber ohne eigene Sozialarbeiterausbildung) mehr Gewicht.
In einer erneuten Ausbildungsreform in der zweiten Hälfte der 60er Jahre sollten Ingenieure und Betriebswirte im Ausbildungsniveau zwischen Höheren Fachschulen und Universitäten angesiedelt werden. Es entstand ein neuer Ausbildungsbereich, der der Fachhochschulen, von dem die Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und -pädagogik ausgeklammert waren. Durch Streiks, Demonstrationen und Sit ins wehrten sich die Studierenden gegen diesen Ausschluss.
Die Stellung der Methodendozenten, sowie die des Faches Methodenlehre, erlangte zunehmend an Bedeutung. Nach und nach begannen die Fachlehrer Höherer Fachschulen, das Konzept der Sozialen Einzelhilfe in der Ausbildung in all seinen Facetten auszubreiten; dabei lagen die Schwerpunkte auf der Anamnese, Sozialen Diagnose, Gesprächsführung und dem Behandlungsprozess.
Viele Dozenten richteten sich bei ihrer Unterrichtsgestaltung nach dem Lehrbuch von Marie Kamphuis. Der Seminarbetrieb gestaltete sich mehr und mehr aus Dialogen, Beteiligung der Studierenden, Kleingruppenarbeit und sogar Supervision; in den Methodenunterricht wurden Rollenspiele eingebaut.
Durch Lehrfallkommissionen sollten die Dozenten im Fach Methodenlehre fortgebildet werden. Arbeitsaufträge dieser Kommissionen waren die "Herausgabe von (...) deutschen Lehrfällen, Gestaltung von Fortbildungen, Literaturempfehlungen und Erfahrungsaustausch (...) und es wurden den Schulen und Dozenten Vorschläge über geeignete Unterrichtsthemen unterbreitet" (NEUFFER 1990, S. 163).
"Die Lehrfallkommissionen waren wichtigstes Organ für die Entwicklung des Casework-Unterrichts an den Schulen" (HARDER 1988, Interviewmanuskript L1, zit. nach NEUFFER 1990, S. 164).
Eine Veränderung im Konzept der Sozialen Einzelhilfe stellte 1970 ein Lehrgang mit dem Thema "Familienbehandlung" dar.
Parallel zu den Neuerungen in der Ausbildung versuchte man, die Fortbildung für Praktiker voranzutreiben. Kennzeichnend für den Aufbau langfristiger Lehrgänge waren eine Einführung in die Grundlagen wie Tiefenpsychologie, Soziologie und das Methodenkonzept; wesentlicher Bestandteil war die Supervision. Es wurden weiterhin kurzfristige Lehrgänge angeboten, bei denen jedoch keine Supervision stattfand und bei denen der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt stand.
In den 60er Jahren fand in den USA wieder ein Umbruch statt; die Fürsorgeleistungen stiegen aufgrund von gesellschaftlichen Unruhen explosionsartig an. Die Modernisierung vertrieb die schwarze Bevölkerung in die Städte; Folgen waren eine große Arbeitslosigkeit, Binnenwanderung und gesellschaftliche Unruhen, wodurch die Fürsorgeleistungen explosionsartig anstiegen.
Swithun Bowers und Marie Kamphuis formulierten den Gegenstand der Sozialen Einzelhilfe so, dass jeder Mensch Klient werden könne, sofern er Schwierigkeiten hat und die Hilfe eines Caseworkers in Anspruch nehme. Die Grenzen des Casework-Ansatzes wurden sehr uneinheitlich gezogen und auch bei Abgrenzungen in der Art der Hilfe zeigten sich Widersprüche.
Die Grundprinzipien der Sozialen Einzelhilfe waren: "Die Integrität und Würde des Individuums wahren, die Problemlage individualisieren, den Klienten akzeptieren und tolerieren, eine nicht-richtende partnerschaftliche Haltung praktizieren, Hilfe zur Selbsthilfe geben, dem Klienten Selbstbestimmung einräumen, Verschwiegenheit gewährleisten, Selbstkontrolle des Sozialarbeiters ausüben" (NEUFFER 1990, S. 182-183).
Im Hinblick auf die Theorie und Ziele der Sozialen Einzelhilfe legte man ihr die Zielsetzung zugrunde, durch Einbeziehung der Umwelt in den Hilfeprozess dem Klienten zu helfen, sich zu ändern, bzw. anders zu verhalten. Im Laufe der Zeit nahmen die Methode Groupwork, die Kleingruppenforschung und die Familiensoziologie Einfluss auf das Casework und man kam von der Vorstellung vom "autonomen einzelnen Menschen" ab.
Helen Perlman nahm erstmals 1957 Bezug auf Status und Rolle; Henry S. Maas und Werner Böhm forderten Ende der 50er Jahre, die Rollentheorie in Ausbildung und Praxis einzubauen. Ende der 60er Jahre kam die Diskussion auf, inwieweit die Systemtheorie einen grundlegenden Rahmen für Theorie und Praxis des Casework bieten könne.
Die Theorie der sozialen Arbeit richtet sich im Wesentlichen nach der Trennung in drei Methoden: Einzelhilfe, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit. Man strebte nach einer Sozialarbeitswissenschaft, war sich jedoch noch uneinig über Ziel, Standort, Gegenstand und Methoden.
Was methodische Handlungsschritte anbelangte, blieb in den neueren Konzepten der methodische Dreischritt (Fallstudie - Diagnose - Behandlung) weitgehend erhalten.
In der Schweiz wurde Anfang der 60er Jahre vorgeschlagen, die Soziale Einzelhilfe in Beratung (à psychologisch), Betreuung (à pädagogisch) und Behandlung (à kleine Psychotherapie) aufzuteilen; letztere sollte speziell Ausgebildeten überlassen werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt beschränkte sich die Diskussion auf die jeweilige einzelne Methode (Einzelhilfe, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit). Es war der Verdienst von Hans Pfaffenberger, die Diskussion auf einen Versuch, einen Austausch unter den drei Methoden zu verwirklichen bis hin zur Methodenkombination, zu lenken.
In den USA wurde zu dieser Zeit bereits der integrierte Methodikunterricht erprobt; im Vordergrund stand jetzt das zu lösende Problem des Klienten, nicht die Methodenspezialisierung.
Ein weiterer Versuch war kennzeichnend für diese Zeitphase: man wollte das Konzept der Sozialen Einzelhilfe speziellen Arbeitsfeldern, wie z.B. Strafvollzug, Heimerziehung, Psychiatrie, Arbeit mit gefährdeten Jugendlichen und Behinderten, zugänglich machen.
Ein neuer Ansatzpunkt für die Soziale Einzelhilfe war das familienorientierte Casework (1969), bei dem man jedoch immer noch davon ausging, dass der Einzelne und Untergruppen der Familie in dem Behandlungsprozess im Mittelpunkt stehen würden und nicht die ganze Familie. Erst Arbeiten von Erikson und Hartmann zur Ego-Psychologie und von Jackson zur Familieninteraktion stellten das Potential der Einzelnen und der Familie als System in den Vordergrund
Nach Abschluss der schulischen Ausbildung nahmen die Schulen auf den Übergang in die Praxis nur noch geringen Einfluss. Somit stellte sich der Weg in die Praxis meist als sehr problematisch dar. Abhilfe erhoffte man sich von der Supervision. Nach der Einführung der Methodik in die soziale Arbeit nahmen in den USA Supervisoren in Anlehnung an die Casework-Prinzipien eine helfende Position ein; vorher waren sie Vorgesetzte in der Administration.
Der Transfer der Supervision nach Deutschland kann mit dem der Methoden gleichgesetzt werden; er geschah durch Studienreisen in die USA und mittels Berichten und Demonstrationen von Experten aus den USA in Deutschland. Bald war man der Ansicht, dass Einzelhilfe nur noch unter Supervision möglich sein, doch die deutsche soziale Arbeit war dieser Anforderung noch nicht gewachsen.
1964 bot der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge unter der Leitung von Dora von Caemmerer den ersten Supervisionslehrgang an. Weitere Fortbildungslehrgänge wurden vor allem von den Sozialen Schulen organisiert und angeboten. Die Fachöffentlichkeit konnte sich nur langsam ein Bild von der Supervision machen.
Bang beschreibt 1959 das Aufgabengebiet der Supervision: "1. Ergänzung des theoretischen Schulunterrichts. 2. Förderung der Entwicklung des Studierenden zu einer beruflich reiferen Persönlichkeit. 3. Verbindung von theoretischen Kenntnissen mit der praktischen Arbeit" (BANG 1959, S. 177, zit. nach NEUFFER 1990, S. 200).
Zunächst fand Supervision nur im Zweierverhältnis statt, doch bald wurde ebenso die Gruppensupervision angeboten. Wegen der zögernden Aufnahme in Deutschland und einiger massiver Widerstände wurden jedoch nur wenige Supervisoren als leitende Angestellte in sozialen Einrichtungen eingesetzt (vgl. NEUFFER 1990, S. 148-201).
2.4 Methodenkritik und „Machtwechsel“
Ende der 60er Jahre kam es zu starker Kritik an der sozialen Arbeit und ihren Methodenkonzepten.
Helge Peters greift sich in seinen Ausführungen in einer soziologischen Analyse „Moderne Fürsorge und ihre Legitimation“ Marie Kamphuis als stellvertretende Kontrahentin für die Methodiker heraus. Die Ausgangsthese seiner Kritik lautet: „Nicht die Probleme der Klienten, sondern die Probleme der Fürsorgeorganisationen, die sich aus ihrer sozialen Situation ergeben, bilden die letzte Ursache fürsorgerischen Handelns“ (PETERS 1968, S.6, zit. nach NEUFFER 1990, S. 202). Diese These ist bestimmend für seine Kritikpunkte am fürsorgerischen Handeln.
Durch die zunehmende gesetzlich geregelte materielle Versorgung benachteiligter Personen sei die Fürsorge ersetzbar; es müsse gelingen, „die Vorstellungen über fürsorgerische Leistungen zu modifizieren und damit die Existenz der Fürsorge in ihrem alten organisatorischen Bestand oder gar dessen Expansion plausibel zu machen“ (PETERS 1968, S. 40, zit. nach NEUFFER 1990, S. 203).
Ebenso wie die Fürsorge seiner Meinung nach ersetzbar ist, wird die persönliche Hilfe durch mehr Wissenschaftlichkeit überflüssig, da sie routinierte Verfahren und generalisierende Lösungen schafft. „Die Fortschritte der Wissenschaften scheinen für den Abbau der Diskriminierung des fürsorgerischen Handlungsadressaten (...) keine große Rolle zu spielen (...). Es scheint, als seien >Wissenschaftlichkeit< und >Methodik< Vehikel der Professionalisierungsinteressen der Sozialarbeiter" (PETERS 1968, S. 81, zit. nach NEUFFER 1990, S. 205).
Einen weiteren Kritikpunkt sieht er in dem Eigeninteresse der Berufstätigen an der Professionalisierung, durch das neue Methoden und Techniken geschaffen wurden, welche wiederum strukturelle Veränderungen im Beruf notwendig machten.
In einem weitern Vorwurf warnt Peters vor einer möglichen Legitimierung von Eingriffen in die Freiheit des Adressaten, da Klienten als Kranke definiert wurden.
Am Ende seiner Kritik gibt Peters einige wenige Empfehlungen. Er rät zu einer radikalen Einkommensverteilung, dem Abbau von Verhaltenskontrollmöglichkeiten durch den Sozialarbeiter und zur Herstellung größerer Verhaltensautonomie in allen Schichten. Damit würden die Sozialarbeiter jedoch ihren eigentlichen Aufgabenbereich verlassen und ihre Existenz gefährden. Eine Lösung dieses Problems sieht Peters in einer freipraktizierenden Tätigkeit der Sozialarbeiter. So könnten sie die Bedürfnisse und Wünsche der Klienten, ohne Ausübung von Kontrolle, berücksichtigen.
Marie Kamphuis antwortet in einem Schreiben auf die massiven Vorwürfe von Helge Peters. Zum Vorwurf der Nichtwissenschaftlichkeit erwidert sie, niemals behauptet zu haben, dass Casework eine Wissenschaft sei; die Methode mache lediglich Gebrauch von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gegebenheiten und versuche dies in die Praxis des Helfens zu integrieren; das Ergebnis könnten wissenschaftlich verantwortete Methoden sein.
Kontrolle liege in jeder Handlung im Sozial-, Schul- und Gesundheitswesen, der Sozialarbeiter müsse nur wissen, wie er damit umzugehen habe; sie sei nicht auszuschließen.
Marie Kamphuis „rechtfertigt“ Peters Kritik mit seiner Unerfahrenheit in der praktischen Arbeit; sie hingegen habe sich mit der Theorieentwicklung in engem Zusammenhang mit der Praxis beschäftigt. Auf den Vorwurf, die Begriffe Wissenschaftlichkeit und Methodik dienten nur den Professionalisierungsinteressen der Sozialarbeiter, antwortet Kamphuis, dass man die Wissenschaft einbezog, um besser helfen zu können, und dass die Professionalisierung nur eine „Nebenwirkung“ war.
Obwohl Peters Kritik auch bei anderen erfahrenen Methodikern den Eindruck von praxisferner Arroganz hervorrief, trug sie auch dazu bei, gründlicher über Grenzen und Möglichkeiten sozialer Arbeit nachzudenken.
Peters Ausgangsthese erweckt den Eindruck, Fürsorgeorganisationen hätten die Definitionsmacht über soziale Probleme. Dies ist jedoch anzuzweifeln, da die öffentliche und private Wohlfahrt immer die Gesellschafts- und Sozialpolitik widerspiegelte und nur sehr begrenzt eigene Interessen und Aufgaben definieren konnte. Einen prinzipiellen Handlungsspielraum des Sozialarbeiters markiert das „Doppelmandat“ (Widerspruch zwischen Interessen der Klienten und der Institution), in dem er sich seit Beginn der Professionalisierung befindet.
Die 68er-Bewegung förderte einerseits die Reformbestrebungen in der Ausbildung und bei Praxiskonzepten, andererseits sah man die eingeleitete Methodisierung der sozialen Arbeit in Gefahr. Ilse Tägert beschreibt die Bewegung; „Die Hinwendung zu denen, die am meisten unter den gesellschaftlichen Verhältnissen litten, verstärkte den politischen Aspekt“ (TÄGERT 1988, Interviewmanuskript L8, zit. nach NEUFFER 1990, S. 212).
Das Konzept der Sozialen Einzelhilfe war Mittelpunkt der Methodenkritik, und diese übertrug sich somit auf die Berufsgruppe der lehrenden Sozialarbeiter. Diese waren nicht in der Lage, ihre Konzepte offensiv zu vertreten, da die Methodendozenten selbst nur mangelhaft in der Methodik ausgebildet waren und im Unterricht hauptsächlich auf die Auswertung eigener Erfahrungen und Kontakte zur Praxis angewiesen waren. Es standen nur wenige theoretische Konzepte zur Verfügung.
Ilse Tägert hielt die Einteilung der drei bekannten Methoden für veraltet, außerdem würde sie die Weiterentwicklung brauchbarer Handlungsstrategien hemmen.
Doris Zeller, eine der bekanntesten Methodikerinnen, hatte einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung der Methode der Sozialen Einzelhilfe geleistet. Sie war der Meinung, der Versuch der Übernahme des Behandlungsmodells der Psychoanalyse hätte zu einer Polarisierung in innere und äußere Hilfen geführt; dies konnte jedoch durch die Ich-Psychologie wieder aufgehoben werden. Sie appellierte, Klient und soziale Umwelt als Interaktionsfeld zu betrachten und widerspricht der These, das Konzept der Sozialen Einzelhilfe sei grundsätzlich mittelschichtorientiert. „Es war also nicht die Methode als solche nicht wirksam, sondern die einseitig am psychoanalytischen Behandlungsmodell orientierte Praxis dieser Sozialarbeiter“ (ZELLER in „Der Sozialarbeiter“ 1/1971, S. 3, zit. nach NEUFFER 1990, S. 215). Auch sie geht, nach einer Darstellung neuer Interventionsmodelle wie Kurzbehandlung, Familienbehandlung, klientenzentrierter Methode und Verhaltenstherapie, auf den Vorwurf der Nichtwissenschaftlichkeit ein und bekräftigt mit ihrer Aussage die Position von Marie Kamphuis. Soziale Arbeit sei „keine Wissenschaft, sondern ein Anwendungsbereich, ein berufliches Handeln, das auf einer Wissensgrundlage beruht“ (ZELLER in „Der Sozialarbeiter“ 1/1971, S. 9, zit. nach NEUFFER 1990, S. 215-216). Abschließend fordert sie die Zusammenarbeit von Praktikern und Forschung.
Die Geschichte der sozialen Arbeit (v.a. die der Fürsorge und einzelfallbezogenen Arbeit) ist eine Frauengeschichte; sie haben die Theorie und Praxis entwickelt. In den 60er Jahren fand jedoch ein „Machtwechsel“ statt und die Männer bemächtigten sich zunächst des Theorie- und Ausbildungsbereichs der sozialen Arbeit. Den Frauen blieb die Praxis und in der Ausbildung die Methodenlehre übrig. Auch alle Lehrveranstaltungen zum Thema „Gesprächsführung“ wurden etwa ab 1968 von den Männern geleitet; den Frauen blieben noch Ausbildungsteile wie Supervision, Studienberatung und Praktikumvermittlung übrig.
Staub-Bernasconi sieht diese „Verdrängung“ der Frauen darin begründet, dass diese sich nicht über ein akademisches Diplom weiterqualifizieren konnten.
Die klare Trennung in höher bewertete Theorie der Männer und abgedrängte Praxisorientierung der Frauen war vollzogen.
Nach und nach wurden die Frauen nicht mehr nur im Ausbildungsgeschehen, sondern auch im Vorstellen und Veröffentlichen von Theoriekonzepten von den Männern abgelöst.
Für Johanna Aab liegt die Ursache für die widerstandslose Aufgabe eigenständig erarbeiteter Felder darin, dass keine Frauenemanzipation stattfand und die Frauen sich den Männern unterordneten. Aus diesem Rollenverhalten, der das Bild der sozialen Berufe nachhaltig geprägt hat, sind die Frauen deshalb nicht herausgekommen, weil sie sich nicht von ihrer Herkunft aus der bürgerlichen, meist wohlhabenden Schicht lösen konnten (vgl. NEUFFER 1990, S.216-222).
„Auch wenn Johanna Aab bemängelt, die Frauen hätten sich auf den sozialfürsorgerischen und sozialpädagogischen Bereich abdrängen lassen, bleibt die Frage, ob das die Leistungen dieser Frauen schmälert, wie sie (...) dargestellt wurden“ (NEUFFER 1990, S.222).
III. Schlussteil
1. Zusammenfassung
Seit dem Mittelalter bis heute gab es zahlreiche Veränderungen in der sozialen Arbeit.
Im Mittelalter bedeutete soziale Arbeit im wesentlichen Armenfürsorge, die hauptsächlich durch Kirchen und Klöster geleistet wurde. In dieser Zeit wurde das Betteln legitimiert und bürokratisiert und die Erziehung wurde zunehmend wichtiger.
Die Wurzeln der Sozialen Einzelhilfe liegen in den USA und dort vor allem in den Charity-Organisation-Societies und den Settlement-Houses. Das Ideal der COS („no alms but a friend“) ist der Gegenpol zu dem der Settlements („neither alms nor a friend“).
In einer Rezeptionsphase wurde die Methode nach Europa gebracht. In Deutschland war Alice Salomon mit der Gründung der „Sozialen Frauenschule“ und ihrem Prinzip der „geistigen Mütterlichkeit“ eine bedeutende Wegbereiterin.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde soziale Arbeit in Deutschland wichtiger und v.a. notwendiger.
Die Ausbildung in sozialen Berufen (sowohl die Theorie als auch die Praxis) wurde reformiert und die damit einhergehende Professionalisierung der sozialen Arbeit nicht nur in Fachkreisen heftig diskutiert und kritisiert.
Durch einen „Machtwechsel“ wurden nicht mehr nur Frauen in sozialen Berufen ausgebildet, sondern zunehmend auch Männer. Doch es hat eine Angleichung stattgefunden und heute orientiert man sich bei der Ausbildung nicht mehr nach dem Geschlecht.
2. Literaturverzeichnis
- ERLER, M. (2000): Soziale Arbeit: ein Lehr- und Arbeitsbuch zu Geschichte, Aufgaben und Theorie. Weinheim, München: Juventa Verlag
- MÜLLER, C. W. (1988): Wie Helfen zum Beruf wurde: Band 1: Eine Methodengeschichte der Sozialarbeit 1883-1945. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- NEUFFER, M. (1990): Die Kunst des Helfens: Geschichte der sozialen Einzelhilfe in Deutschland. Weinheim, Basel: Beltz Verlag
- WENDT, W. R. (1995): Geschichte der Sozialen Arbeit. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag
- Arbeit zitieren
- Eva-Maria Dengel (Autor:in), 2002, Geschichte der Einzelhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107642
Kostenlos Autor werden






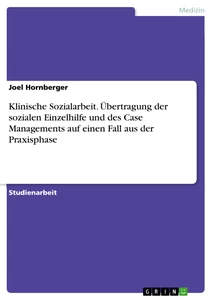




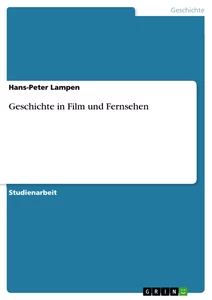







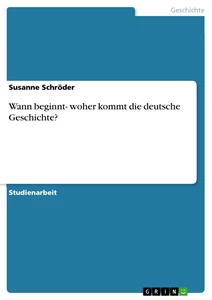


Kommentare
Johanna Aab für Einzelfallhilfe gesucht.
Johanna Aab hat nicht nur in einem Einzelfall einem Studenten aus Afghanistan sehr geholfen. Über einen speziellen Einzelfall brauche ich dringend ihre Auskunft. Darum bitte ich um ihre e-mailadresse und / oder die Weiterleitung dieser Suchmaildung an sie. Mit freundlichen Grüßen
Hartmut Barth-Engelbart
Lücke in der Geschichte?.
Mich würde nur interessieren, warum die NS-Zeit überhaupt nicht erwähnt ist und einfach ausgelassen wird?