Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung1
1.1. Fragestellung und Eingrenzung..
1.2. Literaturlage und Forschungsstand
2. Lebens- und Arbeitswelt städtischer Dienstboten
2.1. Verwendung der Begriffe „Gesinde“ und „Dienstboten“
2.2. Der Arbeitsmarkt der Dienstboten
2.2.1. Die Herkunft des städtischen Gesindes
2.2.2. Arbeits- und Tätigkeitsfelder der Dienstboten
2.3. Einkommens und Vermögensverhältnisse
2.3.1. Verdienstmöglichkeiten städtischer Dienstboten
2.3.2. Möglichkeiten der Subsistenzsicherung und der Altersvorsorge
2.4. In welchem sozialen Umfeld lebte das städtische Gesinde?
2.4.1. Das Prinzip des „ganzen Hauses“
2.4.2. Soziale Unsicherheiten
2.4.3. Zukunftsperspektiven des Gesindes
2.5. Zusammenfassung des Kapitels
3. Das soziale Ansehen der Dienstboten
3.1. Rechte frühneuzeitlicher Dienstboten in der Stadt
3.2. Das Prestige der Dienstboten in der „Hausväterliteratur“
3.3. „Gesind-Teuffel“. Dienstbotenberufe als Negativstereotype
3.4. Weibliche Dienstboten
3.4.1. Das Ansehen weiblicher Dienstboten in der frühneuzeitlichen Stadt
3.4.2. Weibliche Unzucht
3.5. Zusammenfassung des Kapitels
4. Resümee und Bewertung der Ergebnisse
5. Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Fragestellung und Eingrenzung
In der allgemeinen Vorstellung und in populärer Literatur stellt sich die Lebens- und Arbeitswelt von Dienstboten zumeist sehr positiv dar. Vor allem geprägt durch die Vorstellung einer „heilen Welt“ und der „guten alten Zeit“ stellen sich viele Menschen den Gesindedienst als einen angenehmen, vielleicht sogar gemütlichen Beruf vor.
Dass dies sowohl vor, als auch nach der industriellen Revolution nur sehr begrenzt der Fall war, darüber ist sich die historische Forschung weitgehend einig. Wenn aber die Verhältnisse, in denen städtische Dienstboten der Frühen Neuzeit lebten und arbeiteten, untersucht werden, so kommt sie häufig zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Qualität dieser Lebensumstände. Zum einen werden die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Bestreitung des Lebensunterhaltes städtischen Gesindes als positiv dargestellt, andererseits wird das Leben der Dienstboten als harte, durch zahlreiche Faktoren - allen voran die Dienstherrschaft - erschwerte und durch Vorurteile und Stereotype vordefinierte Existenz gesehen.
Diese Arbeit soll versuchen, in kleinerem Rahmen versteht sich, beide Betrachtungsweisen, sowohl wirtschaftliche als auch soziale, im Bereich städtischen Dienstbotendaseins in der Frühen Neuzeit, d.h. in diesem Fall zwischen der Mitte des 16. und dem Ende des 18. Jahrhunderts, zu beleuchten und dabei die Verbindung aufzuzeigen, die zwischen der Möglichkeit zur Subsistenzsicherung des Gesindes einerseits und dem Einfluss ihres sozialen Prestiges darauf andererseits bestand.
1.2. Literaturlage und Forschungsstand
Die Literaturlage bezüglich des Gesindes im allgemeinen kann als gut bezeichnet werden. Auch wenn in den meisten Fällen das ländliche Gesinde Gegenstand der Betrachtung war, so sind doch auch Überblickswerke in einiger Zahl vorhanden. Allerdings drängt sich der Eindruck auf, dass vor allem in den letzten Jahren die Zahl der Werke, die das Gesinde als Schwerpunkt der Untersuchung haben, etwas abnimmt. So wurde beispielsweise auf ein Werk von 1995 des öfteren eingegangen, herausgegeben von Gotthardt Frühsorge, Rainer Gruenter und Beatrix Freifrau Wolff Metternich, das sich mit dem Gesinde aus interdisziplinärem Blickwinkel beschäftigt. In diesem Werk waren vor allem die Aufsätze von Rainer Schröder zum Gesinderecht,[1]Paul Münch zum sozialen Ansehen der Dienstboten,[2]Ludwig Hüttl zum Bild der Dienstboten in der katholischen Frömmigkeitsgeschichte[3]und Gotthardt Frühsorge zu den Pflichten des Gesindes im „ganzen Haus“ interessant für diese Arbeit.[4] Wie sich zeigt, ist dies ein sehr umfangreiches Werk, das das Gesinde, vor allem des 18. Jahrhunderts, in allen Facetten darstellt.
An Literatur, die auf einzelne Aspekte des Gesindes eingeht, ist im Bereich der wirtschaftlichen Lage der Dienstboten, besonders in Bezug auf Arbeitsmarkt, Einkommens- und Vermögensverhältnisse das Werk Rolf Engelsings aus den siebziger Jahren zu erwähnen.[5]Herkunft und Alter der Dienstboten ist auch Gegenstand eines Aufsatzes von Michael Mitterauer aus dem Jahr 1985.[6]Als Überblickswerk, das in begrenztem Maße auf die prägnanten Merkmale des Gesindes eingeht, ist ein Werk von Wolfgang von Hippel zu erwähnen.[7]Zu Gesinderecht und sozialem Ansehen der Dienstboten hat Rainer Schröder 1992 ein sehr umfangreiches Werk veröffentlicht. Auch Renate Dürr beschäftigt sich unter anderem mit diesem Aspekt anhand des Beispiels der Mägde in Schwäbisch Hall.[8]Für die Lebenswelt städtischer Dienstboten und deren sozialem Umfeld wurden im Rahmen dieser Arbeit die Werke Otto Brunners und Richard van Dülmens aus den Jahren 1968, bzw. 1990 herangezogen.[9]
Für die Betrachtung des sozialen Ansehens der Dienstboten wurde auf die Werke Dagmar Müller-Staats, Maria Suutalas, Elfriede Moser-Raths und Paul Münchs zurückgegriffen.[10]
2. Lebens- und Arbeitswelt städtischer Dienstboten
2.1. Verwendung der Begriffe „Gesinde“ und „Dienstboten“
Im allgemeinen Verständnis fällt es schwer, den Begriffen „Gesinde“ und „Dienstboten“ eine unterschiedliche Bedeutung zuzumessen. Als Zugehörigkeitsmerkmal dieses Berufs wird meistens Erfüllung dem jeweiligen Dienstherren dienender Tätigkeit, sowohl auf dem Land, als auch in der Stadt verstanden.
Der Begriff „Gesinde“ wurde bereits früher gebraucht, als der des „Dienstboten“. Er wurde schon im Mittelalter verwendet, um diesen Berufsstand zu bezeichnen, wurde aber später dahingehend differenziert, dass ländliches und städtisches Gesinde unterschieden wurden.[11]Ab dem 16. Jahrhundert wurde häufiger der Begriff „Dienstbote“ als Bezeichnung für Gesinde verwendet, da diese auch eigenständig Nachrichten und Botschaften übermitteln musste und nicht nur im Haushalt für den Dienstherren beschäftigt war. Ab dem 19. Jahrhundert wurden beide Begriffe nebeneinander benutzt, wobei das Gesinde eher dem ländlichen Bereich, die Dienstboten eher der Stadt zugeordnet wurden.[12]
Innerhalb der Schwerpunktsetzung dieser Arbeit sind die Begriffe „Gesinde“ und „Dienstboten“ im folgenden als gleichwertig zu betrachten. Sie sind jedoch hauptsächlich auf Gesinde/Dienstboten im städtischen Bereich bezogen.
2.2. Der Arbeitsmarkt der Dienstboten
Im Verlauf dieses Kapitels soll erreicht werden zu klären, welcher Personenkreis dem städtischen Gesinde zuzurechnen war, welcher sozialen Herkunft dieses war und welche Arbeiten es zu verrichten hatte.
2.2.1. Die Herkunft des städtischen Gesindes
Grundlegend kann zur Schichtung der Personengruppen, die dem Gesinde zuzurechnen sind, gesagt werden, dass diese größtenteils den sozialen Unterschichten entstammten. Von diesen konnte man etwa ein fünftel bis ein viertel der zugehörigen Menschen zum Gesinde rechnen, was etwa 10% der städtischen Bevölkerung ausmachte.[13]Zwar war das Gesinde sowohl im städtischen, als auch im ländlichen Bereich sozial betrachtet noch über den ehrlosen Berufsgruppen angesiedelt, aber doch noch von mittelständischen, bürgerlichen Berufen getrennt.[14]Allerdings gab es auch kleinbürgerliche Familien, die ihre Kinder, zumeist ihre Töchter, als Dienstmädchen in andere Haushalte schickten,[15]doch bildete dies meistens die Ausnahme. Die Mehrzahl der Dienstboten hatten Handwerker oder ebenfalls Dienstboten als Eltern,[16]die ihrerseits versuchten, ihren Nachwuchs bei sozial höhergestellten Familien und Haushalten eine Anstellung als Dienstboten zu verschaffen.[17]
Der Beginn der Dienstbotenzeit fiel vor allem in die frühe Jugendphase und dauerte meist bis zur eigenen Hochzeit an. Diese Zeit umschloss damit auch die Phase der Pubertät und bedeutete eine Trennung von der Familie bereits vor dem Erwachsenenalter.[18]
Zur geographischen Herkunft lässt sich anmerken, dass der Bedarf an städtischen Dienstboten in größeren Städten, vor allem im 18. Jahrhundert, dadurch gedeckt wurde, dass Menschen von außerhalb der Stadt angeworben wurden, da diese zum einen geringere Bindungen zu anderen Menschen in der Stadt aufwiesen und damit möglicherweise in einer größeren Abhängigkeit vom Dienstherren standen, zum anderen, da ihnen durch diese mangelnden Bindungen eine größere Sittsamkeit und Tugendhaftigkeit nachgesagt wurde.[19]Dies galt besonders für Dienstmägde und -mädchen, die auch den größten Anteil am städtischen Gesinde ausmachten.[20]
2.2.2. Arbeits- und Tätigkeitsfelder der Dienstboten
Im Rahmen dieser Arbeit alle erdenklichen Tätigkeitsfelder des städtischen Gesindes anzuführen, würde mit Sicherheit zu weit führen, doch soll an dieser Stelle dennoch kurz auf die von Dienstboten zu verrichtenden Arbeiten eingegangen werden.
Die Fülle der Aufgaben, die durch das Gesinde zu verrichten waren, machte es notwendig, eine offizielle und für weite Bereiche geltende Definition dieser Aufgaben und Berufsbezeichnungen zu schaffen. Dies wurde durch die Gesindeordnungen erreicht, die neben ihrem weiteren Zweck, nämlich die Arbeitsverhältnisse und Einkommen der Dienstboten zu regeln, auch gesetzliche Bestimmungen über die Einsatzbereiche städtischer Dienstboten aufstellten. So heißt es beispielsweise in der Preußischen Gesindeordnung von 1746, dass zum Gesinde all jene Bediensteten zählten, die„[...]sowohl bei vornehmen oder sonst distinguirten Herrschaften [...] zum standesgemäßen Wohlstand, Bequemlichkeit und andern in der Wirtschaft vorkommenden Arbeit gebrauchet, gehalten werden müssen [...].“[21]
Sowohl in diesen Gesindeordnungen, als auch in den Werken zeitgenössischer Autoren zu diesem Thema finden sich detaillierte Definitionen der diversen Arten häuslichen Gesindes, die natürlich bereits vor der Veröffentlichung der jeweiligen Werke seit langem existierten. So zählten zu häuslichen Dienstboten unter anderem: Sekretäre, Küchenbedienstete, Zimmermädchen, Kammerdiener, Portiers, Lakaien, Stallburschen, Kutscher, Verwalter, Wäscherinnen, Haushälterinnen, Kindererzieherinnen, Kammer- und Stubenmägde, Kindsmägde, Viehmägde, Hausmägde und Untermägde. Allein der Beruf der Magd wurde in die unterschiedlichsten Gruppen unterteilt.[22]Aus diesen Aufzählungen wird auch ersichtlich, dass für haushälterische Tätigkeiten vor allem Frauen, für handwerkliche, gewerbliche und repräsentative überwiegend Männer eingestellt wurden.[23]
Die verschiedenen Aufgaben, bzw. deren Diversifikation, nahm je nach Größe des Haushaltes und der Anzahl der beschäftigten Dienstboten zu. So wurden in einem mittelständischen, bürgerlichen Haushalt oftmals alle anfallenden Aufgaben von einem oder zwei Bediensteten erledigt. Andererseits konnte es auch vorkommen, dass ein wohlhabender Haushalt des Großbürgertums oder ein herrschaftlicher bis zu 30 Dienstboten beschäftigen.[24]
Die neu einzustellenden Kräfte waren, egal ob Mann oder Frau, in den meisten Fällen junge, ungelernte Menschen, die sich die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten erst im Laufe der Zeit aneignen mussten, ohne dass man von einer speziellen Ausbildung zum Dienstboten sprechen konnte. Sie wurden anfangs für niedere Dienste im Haushalt eingesetzt und konnten sich je nach Befähigung „hocharbeiten“. Es gab allerdings auch Dienstboten, die auf Grund einer intellektuellen Vorbildung eingestellt wurden und dementsprechend höher gestellt waren. Dazu zählten vor allem Schreiber, Hofmeister, Kammerdiener und solche Diener, die durch Fremdsprachenkenntnisse als Reisebegleiter eingesetzt werden konnten.[25]
2.3. Einkommens- und Vermögensverhältnisse
Wenn im Rahmen des zweiten Kapitels die Frage nach der Subsistenzsicherung des städtischen Gesindes im Mittelpunkt der Betrachtung stehen soll, so erscheint es sinnvoll, im Besonderen auf deren Verdienstmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Altersvorsorge einzugehen. Die folgenden beiden Abschnitte sollen diesen Teilaspekt näher beleuchten.
2.3.1. Verdienstmöglichkeiten städtischer Dienstboten
Eine allgemeingültige Aussage über die Einkommensverhältnisse des Gesindes in der Stadt zu treffen, erscheint nahezu unmöglich. Denn obwohl in zahlreichen Gesindeordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts entsprechende Höchstlöhne festgesetzt waren,[26]war den Dienstherren nicht vorgeschrieben, einen Mindestlohn zu zahlen, so dass aus diesem Grund die Schwankungen innerhalb der Lohnzahlungen sehr groß sein konnten. Auch wurden die von der Obrigkeit festgelegten Löhne des Gesindes häufig durch die Dienstherren umgangen, so dass oftmals individuelle Löhne ausgemacht wurden.[27]Zudem hing die Höhe des Lohnes noch von zahlreichen anderen Faktoren ab, wie beispielsweise der verrichteten Arbeit oder auch der Größe und Lage der Stadt, wobei es auch hier sehr schwierig ist, eine einheitliche Lohnzahlung festzustellen, allein schon aus dem Grund der verschiedenen Währungsgebiete innerhalb des Reiches.
So konnte beispielsweise im 16. Jahrhundert eine Köchin in einem bürgerlichen Haushalt einen Jahreslohn von sechs Gulden erhalten, am Hofe in Königsberg aber durchaus zwanzig Gulden jährlich erwarten.[28]
Im 17. Jahrhundert zahlte ein Danziger Brauer seinem Knecht ein Jahresgehalt von 20-25 Gulden, ein Frankfurter Kaufmann seinem Diener aber z.B. den gleichen Lohn.[29]
Sollen die Einkommensmöglichkeiten städtischer Dienstboten betrachtet werden, so kann gesagt werden, dass das Gesinde sein Einkommen nur zu einem gewissen Teil aus den zuvor festgelegten Kontraktlöhnen bezog. Nur durch diesen Lohn allein wäre eine Subsistenzsicherung kaum möglich gewesen, doch gab es zusätzlich dazu noch zahlreiche andere Zuwendungen, die der Dienstherr seinem Dienstboten zukommen ließ. So konnten diese mit einiger Sicherheit solche Zuwendungen erwarten, wie z.B. ein Einstandsgeld bei der Anstellung, Geschenke an besonderen Festtagen oder zu Messen – hierbei konnte es sich sowohl um Sach-, als auch Geldgeschenke handeln – oder auch Trinkgelder für Botengänge, Begleitungen oder ähnliches.[30]Doch auch zu festlichen und repräsentativen Anlässen des Dienstherren erhielten die Dienstboten Geschenke, wie z.B. neue, dem Anlass entsprechende Kleidung. Außerdem kam es vor, dass zu Hochzeiten oder Taufen innerhalb des Gesindes der Dienstherr ebenfalls Geschenke machte.[31]Obwohl diese Art von Bezahlung der Dienstboten vom 16. bis zum 18. Jahrhundert durchaus üblich war – ein Rückgang lässt sich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts feststellen[32]- bestand auf diese Zuwendungen kein Rechtsanspruch.[33]Die Dienstboten waren demnach in starkem Maße auf eigene Vorsorge angewiesen. Mit den Möglichkeiten, über die das Gesinde dazu verfügte, beschäftigt sich das nächste Kapitel.
2.3.2. Möglichkeiten der Subsistenzsicherung und der Altersvorsorge
Im 16. und 17. Jahrhundert wurde als Möglichkeit zur Vorsorge für die Zeit, in der das Gesinde in keinem Beschäftigungsverhältnis mehr stand, vor allem die vorhergegangene treuhändlerische Verwaltung des angesparten Vermögens durch den Dienstherren angewandt. Diese legten das ihnen von ihren Dienstboten überantwortete Vermögen meist in der gleichen Weise und zu angemessenen Zinsen wie ihr eigenes an, um es anschließend entweder an die Dienstboten oder deren Verwandte auszuzahlen.[34]Auf diese Weise wurde es vor allem den Dienstboten in höhergestellten bürgerlichen Haushalten ermöglicht, später einmal selber durch ein entsprechendes Finanzpolster in den Stand des Bürgertums emporzusteigen, auch wenn diese soziale Mobilität nicht allen Dienstboten zukam.[35]
Diese althergebrachte Spartradition reichte auch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zumeist aus, um die Vorsorge der Dienstboten zu regeln. Im Laufe der beginnenden Zeit der Aufklärung machten allerdings neue soziale Ansichten eine Umstellung der Vermögensvorsorge notwendig.[36]War bis zu diesem Zeitpunkt das allgemeine Verständnis des Dienstherren als patriarchalischer „Fürsorger“ im Rahmen des „ganzen Hauses“ (s. Kapitel 2.4.1.), also auch als Verantwortlicher für die soziale Sicherung des Gesindes im Rahmen des Haushaltes vorherrschend, so setzte sich im Laufe der Aufklärung die Ansicht durch, dass die Dienstboten im Zuge ihrer Selbstbestimmung auch für sich selber sorgen müssten.[37]Diese Selbstfürsorge, die auch mit dem Streben der Dienstboten nach einem bürgerlichen Leben einherging,[38]förderte eine zunehmende Entfremdung zwischen Dienstboten und Dienstherr, auch da die soziale Bindung zwischen beiden immer mehr abnahm. Auf Grund dessen war auch das Vertrauen vom Dienstboten zu seinem Dienstherren in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens nicht mehr gegeben.[39]
Als neue Möglichkeiten der Selbstvorsorge wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts vermehrt die aufkommenden Sparkassen genutzt. Allerdings wurde das Vermögen des Gesindes hier zu ungünstigeren Konditionen angelegt. Auch gaben viele Dienstboten ihr Einkommen bereits vor dem Erreichen des Alters für die bereits angemerkte Anstrebung des bürgerlichen Standes aus, so zumeist für den Kauf entsprechender Statussymbole, wie z.B. Kleidung. Auch wurden sie durch ihre Dienstherren nicht mehr, wie dies in den Jahrhunderten zuvor der Fall war, zur Sparsamkeit angehalten.[40]
Eine weitere Beihilfe zur Altersvorsorge, die das Gesinde in der städtischen Gesellschaft erhalten konnte, war die Unterstützung von Seiten der Dienstherren bei der Gründung eigener Haushalte und dem Bestreben nach Sesshaftigkeit, sowie der Entsprechung des Wunsches vieler Dienstboten nach einem bürgerlichen Leben. Dieses Bestreben sollte auch nach Ansicht der Hausväterliteratur, auf die in Kapitel 3.2. noch näher einzugehen ist, gefördert werden, allerdings nur als eine Art Belohnung, die der Dienstherr dem Gesinde erfüllen sollte, das ihm immer treu gedient habe, sozusagen als eine Art „Treueprämie“.[41]
Zu guter Letzt gab es auch noch eine eher unsichere Art der Vorsorge, nämlich die Erwähnung des Dienstboten im Testament des Hausherren. Eine Möglichkeit, auf die sich das Gesinde allerdings nicht unbedingt verlassen konnte.[42]
2.4. In welchem sozialen Umfeld lebte das städtische Gesinde?
Entscheidend für die Lebensumstände und die Qualität dieser ist auch das soziale Umfeld, in dem das Gesinde seiner Arbeit nachging und in dem es lebte. Vor allem die frühneuzeitliche Hausgemeinschaft soll deshalb an dieser Stelle näher dargestellt werden, sowie die Zukunftsaussichten, die das Gesinde durch seine Lebenswelt hatte.
2.4.1. Das Prinzip des „ganzen Hauses“
Der Begriff des „ganzen Hauses“ wurde in der neueren Geschichtsforschung vor allem durch Otto Brunner untersucht und seitdem immer wieder kontrovers diskutiert. Das „ganze Haus“ war in Mittelalter und Früher Neuzeit die kleinste wirtschaftliche und gesellschaftliche Einheit. In ihm lebten die Bewohner, die vor allem den Hausvorstand, den Hausvater und dessen Familie im heutigen Sinne umschloss, sowie auch das im Haus beschäftigte Gesinde.[43]Zwar ist umstritten, ob dieses „ganze Haus“ wirklich die autarke Einheit war, als die es Otto Brunner darstellte, doch hatte es unzweifelhaft einen großen Einfluss auf das Leben städtischer Dienstboten.
Das „ganze Haus“ war hierarchisch strukturiert, mit dem Hausherren oder Hausvater als patriarchalisches Oberhaupt.[44]Dieser hatte auch die Befehlsgewalt im Haushalt inne, haftete für die Bewohner und repräsentierte den Haushalt. Auch verfügte er über umfangreiche Rechte zur individuellen Züchtigung der Hausbewohner bei Vergehen, die im Vergleich zum Hausvater auch über eingeschränkte Sachrechte verfügten.[45]Die sittliche Führung des Hauses unterlag ebenfalls dem Hausvater, er sollte ein sittlich-moralisches Beispiel für die Bewohner geben. Auf Grund dieser Aufgaben und Rechte erreichte der Hausherr eine Autorität, die von den Mitbewohnern, seien es Frau, Kinder oder Gesinde, nicht in Frage gestellt werden konnte und der diese sich fügen mussten.[46]
Demnach ist der Hausvater nicht nach den idyllisierenden Familien- und Vatervorstellungen zu verstehen, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts aufkamen, sondern vielmehr als eine auf religiöse Ansätze, im besonderen die „Oeconomia Christiana“, die christliche Ökonomie, fußende Rechtsstellung zu sehen,[47]die den Hausvater vergleichend als „Landesvater“ auf häuslicher Ebene betrachtete und ihn damit ins ordnungspolitische System der Frühen Neuzeit einordnete. Dies bedeutete bis zum Aufkommen der Aufklärung, dass der Hausvater als Repräsentant einer göttlichen Ordnung gesehen wurde, dem die Mitglieder des „ganzen Hauses“ zu Gehorsam verpflichtet waren.[48]
Das „ganze Haus“ war eine der häufigsten Formen sozialen Zusammenlebens bis zum 19. Jahrhundert, wobei es sich dabei nicht um Großfamilien handelte, sondern vielmehr die Miteinbeziehung des Gesindes das Gefüge des „ganzen Hauses“ bestimmte.[49]
2.4.2. Soziale Unsicherheiten
Die Arbeit der städtischen Dienstboten im Hause des Dienstherren war durchweg geprägt von diversen sozialen und rechtlichen Unsicherheiten, so dass ein rechtssicherer Status und damit verbunden eine Zukunftsplanung für das Gesinde nur sehr schwer zu erreichen war. Unter anderem waren durch die Gesindeordnungen zahlreiche Sanktionierungsmöglichkeiten von Seiten des Hausvaters geregelt, wie z.B. dass es diesem möglich war den Dienstboten, sollte dieser für eine längere Zeit krank werden, vorzeitig zu entlassen.[50]Auch eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wie sie in unserer Gesellschaft die Norm ist, wurde erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts in der Hausväterliteratur und in den Gesindeordnungen erwähnt, allerdings nur bedingt auch angewandt.[51]Doch auch das Recht auf körperliche Züchtigung der Dienstboten wurde dem Hausvater zugesprochen. So konnte Arbeitsverweigerung oder Protest durch diesen ohne weiteres mit Prügel bestraft werden.[52]
Doch auch der Rechtsanspruch auf den vereinbarten Lohn war für den Dienstboten nicht unbedingt gegeben. Wollte dieser seinen Lohn z.B. einklagen und stellte sich heraus, dass dieser über dem laut der Gesindeordnung zulässigen Höchstlohn lag, so wurde der Lohn auf dieses Niveau herabgestuft, bzw. musste sogar eventuell bereits zuviel bezahlter Lohn durch den Dienstboten unter Androhung von Gefängnisstrafe zurückerstattet werden.[53]
Sollte das Gesinde die Bedingungen des Arbeitsvertrages, dessen Auslegung meist durch den Hausvater erfolgte, nicht erfüllen, so drohte Nachdienen, Lohnabzug, Verwirken des Lohnes oder sogar die Entlassung.[54]
2.4.3. Zukunftsperspektiven des Gesindes
Wie bereits in Kapitel 2.2.1. angesprochen, war der Gesindedienst in den meisten Fällen kein lebenslanger Beruf, sondern überschnitt sich mit dem Lebensabschnitt bis zum dreißigsten Lebensjahr.[55]Welche Optionen hatten also städtische Dienstboten demnach, wenn sie aus dem Gesindedienst ausschieden?
Die Abhängigkeit vom Hausvater blieb für das Dienstpersonal zumeist bis zur eigenen Heirat bestehen, die jedoch durch den Gesindedienst bereits nach hinten verschoben wurde. Volle Mündigkeit und voller Erwachsenenstatus wurden oft erst mit der Heirat und damit dem Ende des Gesindedienstes erreicht.[56]Dafür hatten die Dienstboten eine größere Unabhängigkeit bei der Partnerwahl durch den fehlenden Einfluss des eigenen Elternhauses und somit auch eine stärkere Eigenverantwortlichkeit bei der Gründung eines eigenen Hausstandes.[57]Dieses Ziel zu erreichen, diente der Gesindedienst für viele Dienstboten als Vorbereitung und Ermöglichung. Denn vor allem für diejenigen, die von ihren Eltern kein Erbe zu erwarten hatten, blieb als einzige Alternative häufig nur der Gesindedienst.[58]Dies galt in erster Linie für Dienstmädchen, denn für die Einheiratung in eine andere Familie, möglichst eine Familie höheren gesellschaftlichen Standes, war eine entsprechende Mitgift die Voraussetzung.[59]Die Ausübung eines anderen Berufes nach der Dienstbotenzeit blieb für Dienstmädchen meist die Ausnahme, da die Obrigkeit der frühneuzeitlichen Stadt häufig versuchte, solche Selbständigkeit zu unterbinden.[60]
Für männliche Dienstboten war die Lage diesbezüglich etwas günstiger. Ehemalige Diener konnten sich, sofern dies durch die Zünfte erlaubt wurde, als kleine Handwerker niederlassen oder versuchten, im niederen Beamtentum tätig zu werden. Dies fand vor allem im 18. Jahrhundert statt. Für beide Geschlechter galt aber gleichermaßen, dass sie sich überwiegend wieder im städtischen Raum ansiedelten und nicht zurück aufs Land gingen, sofern sie von dort stammten.[61]
2.5. Zusammenfassung des Kapitels
Die Lebens- und Arbeitswelt städtischer Dienstboten der Frühen Neuzeit stellt sich nach den Betrachtungen dieses Kapitels als schwierig für diese dar, war aber durch sie zu meistern. Vor allem die finanzielle Situation auf dem Arbeitsmarkt des Gesindes erscheint im 16. und 17. Jahrhundert dahingehend gestaltet gewesen zu sein, dass das Gesinde durchaus die Möglichkeit zu einer eigenen Subsistenzsicherung hatte, vorausgesetzt es zeigte auch die dazu notwendige Eigeninitiative. Sparten die Dienstboten einen Teil ihres Lohnes, sowie die Sonderzuwendungen, die sie ab und zu erhielten, wie ihnen auch nahegelegt wurde, so konnten sie durchaus auch ein Kapital für die Zeit nach ihrem Gesindedienst aufweisen. Auch die Gründung eines eigenen Hausstandes erscheint möglich gewesen zu sein. Demnach muss es auch noch andere Einflüsse auf diese Berufsgruppe gegeben haben, sollen die oft angeführten, negativen Lebensumstände erklärt werden. Auf das Sozialprestige über das das Gesinde verfügte und welche Auswirkungen dieses Ansehen auf ihre Lebenswelt hatte, geht im folgenden der zweite Teil dieser Arbeit ein.
3. Das soziale Ansehen der Dienstboten
3.1. Rechte frühneuzeitlicher Dienstboten in der Stadt
Als Übergang zwischen der wirtschaftlichen und der sozialen Lage der Dienstboten, soll an dieser Stelle noch ein kurzer Überblick darüber gegeben werden, in welchem Rechtsrahmen sich die Arbeitsverhältnisse und die Lebenswelt der Dienstboten befand.
Bereits im 14. Jahrhundert wurde in diversen Polizeiordnungen der rechtliche Umgang mit dem Gesinde geregelt. Seit dem 16. und 17. Jahrhundert wurden nach und nach spezielle Gesindeordnungen für ganze Territorien erlassen, die versuchten, sämtliche Lebensbereiche des Gesindes zu regulieren und zu beeinflussen.[62]Zweck dieser Gesindeordnungen war es auch, das Verhältnis zwischen Dienstherr und Dienstbote zu regeln. Dies erfolgte nicht nur auf der Ebene des Arbeitsverhältnisses, sondern auch in Bezug darauf, wie das Zusammenleben von beiden in einem Haushalt geregelt werden konnte.[63]Dem Gesinde sollte durch diese Gesindeordnungen nicht nur verbindlich vorgeschrieben werden, welche Arbeiten zu erledigen waren, sondern auch wie es sich zu verhalten hatte und zu bestimmen, welche Stellung es in der Gesellschaft innehaben sollte.[64]Dabei durfte dieses Recht, das im übrigen in erster Linie dazu diente, den Arbeitsmarkt der Dienstboten zugunsten der Dienstherren zu beeinflussen, auch mit körperlicher Gewalt seitens der Dienstherren durchgesetzt werden.[65]Aufgrund der geringen Möglichkeit des Zurückgreifens auf Rechtsmittel seitens der Dienstboten und der starken Ausrichtung der Gesindeordnungen auf die Interessen der Dienstherren, kamen während der gesamten frühen Neuzeit immer wieder Klagen der Dienstboten auf, die wiederum durch das Erlassen neuer Gesindeordnungen zu beseitigen versucht wurden.[66]Dennoch behielten die Dienstboten stets ihr schlechtes Image bei, das ihnen von Seiten dieser Ordnungen, aber auch durch zeitgenössische Gelehrte „angehängt“ wurde. Und das im Verlaufe der nächsten Kapitel Gegenstand der Betrachtung sein wird.
3.2. Das Prestige der Dienstboten in der „Hausväterliteratur“
Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts existierte die sogenannte „Hausväterliteratur“, die darauf ausgelegt war, dem Hausvater Ratschläge zum Umgang mit den Mitgliedern des „ganzen Hauses“, also auch dem Gesinde, zu geben und ihn zur richtigen Haushaltsführung anzuleiten. Vor allem die sittliche Erziehung der Haushaltsmitglieder stand hierbei im Vordergrund.[67]Dafür gab es laut den diversen Autoren dieser „Hausväterliteratur“ auch zahlreichen Anlass, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen sollen.
Bereits 1529 lehrte beispielsweise Justus Menius, dass das Gesinde, sollte es nicht in ausreichendem Maße beschäftigt sein, zum Müßiggang tendiere. Daher müsse man diesem viel Arbeit zuweisen,„[...] denn der müssiggang leret viel bosheit [...].[68]Und auch Georgius Viuiennus wusste 1565 zu berichten, dass„[...] die Menschliche natur [...] von jhrer ankunfft zum bösen geneigt [...]“sei.„Darumb soll man das Hausgesinde also regieren auff das der fleis/ nüchterkeit/ sparsamkeit vnd messigkeit/ [...] / den Hausuetern vnd Müttern/ zeugnis gebe jhrer frömmigkeit vnd guten regimentes.“[69]
Doch auch 140 Jahre später wird dem Gesinde die Eigenverantwortlichkeit abgesprochen, wenn Franz Philipp Florinus 1705 schreibt, dass es an der Sorgepflicht des Hausherren sei, die„[...] treulosen/ rohen/ waschhafftigen/ zänckischen/ leichtfertigen [...]“Dienstboten zu erziehen.[70]Auch war das Gesinde im „ganzen Haus“ nie als gleichwertig anerkannt, sondern es wurde ihm während der ganzen Beschäftigungsphase eine Art dauerhafter Kinderstatus zugesprochen.[71]
Die Klagen über das Gesinde durch die Hausväter nahm vor allem im 18. Jahrhundert zu. Möglicherweise lag die oft attestierte Frechheit des Gesindes an der großen Nachfrage nach diesem, so dass es sich Forderungen erlauben konnte, vielleicht aber auch an den schlechten Arbeitsbedingungen, über die es sich zum Unwillen des Dienstherren beschwerte.[72]
Letztendlich war das schlechte Ansehen der Dienstboten jedoch im ganzen Reichsgebiet und konfessionsübergreifend in gleichem Maße vorhanden. So schrieb beispielsweise auch ein katholischer Autor, der sich selbst Abraham a Sancta Clara nannte, Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts sehr bildhaft über manchen Diener, er benehme sich,„[...] als hätt er die Händ von Wachs bossiert; er bewegt sich wie ein Hopfensack in Böhmen, scilicet: er sitzt ein ganze Zeit wie ein Bruthenn im Nest, er gaumezt wie ein Melampus nach der Tafel, er rennt als wollt er mit den Schnecken wettlaufen, er schlaft, als wäre er Stadt-Richter zu Ratzenburg, er ist so frisch, wie die Esel auf dem Stroh [...]“[73]
Auch war das Gesinde durchweg als lasterhafter Stand angesehen, wenn man als Beispiel dafür die Angaben von Christian Friedrich Germershausen aus dem Jahr 1781 betrachtet, nach denen das Gesinde seinen Lohn vor allem für feine Kleidung, die nicht ihrem Stande entspräche, für Gelage und für Glücksspiel ausgab. Diesem Treiben sollte durch die Herrschaft ein Ende bereitet werden.[74]
Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass das Ansehen der Dienstboten in der Hausväterliteratur vom 15. bis zum 18. Jahrhundert dahingehend geprägt war, dass diese als faule, unehrliche und lasterhafte Menschen angesehen wurden, die aus eigener Kraft oder eigenem Antrieb sich niemals zum Guten bessern könnten und diese Aufgabe dem Hausvater alleine auferlegt sei.
Doch nicht nur in der Hausväterliteratur wurde das negative Prestige der Dienstboten geprägt. Auch wurde dem Gesinde durch manchen frühneuzeitlichen Autor gänzlich menschliche Züge aberkannt, worauf im folgenden näher eingegangen wird.
3.3. „Gesind-Teuffel“. Dienstbotenberufe als Negativstereotype
Das Spannungsverhältnis zwischen Hausherr und Gesinde, das durch die etablierte Herrschaftsordnung zwischen beiden entstand, sorgte für das Aufkommen diverser negativer Stereotypisierungen des Gesindes durch die Dienstherren.[75]
So wurde durch das geringe Maß an gesellschaftlicher Ehre, das dem Gesinde im Vergleich zu höheren Schichten im Ständesystem zugesprochen wurde häufig abgeleitet - wie bereits angesprochen - dass die Dienstboten grundsätzlich nicht zuverlässig seien. Auch wurde angeraten, diesen nicht zu trauen und ihnen die moralische Festigung abzuerkennen.[76]
Überhaupt wurde das Gesinde weniger mit dem Menschen gleichgestzt, sondern vielmehr wiederholt mit Tieren verglichen. Diese Vergleiche mögen in Ansätzen zwar vielleicht noch aus der Antike übernommen worden sein, in der Tiere wie Sklaven dem Sachrecht zugeordnet waren,[77]doch gründete die Hervorhebung dieser angeblichen Animalität des Gesindes zumeist auf zahlreichen zeitgenössischen Ängsten und war viel bedeutender, als es zuerst erscheint.
In der Vorstellung der damaligen Zeit konnte auf alles tierische oder in Ansätzen tierhafte durch den Menschen nur in begrenztem Maße Einfluss ausgeübt werden. Es konnte durchaus der Fall sein, so die Ansicht, dass der Teufel Besitz von diesem tierischen Wesen ergriff oder bereits ergriffen hatte. Der Teufel konnte nur über ein Tier herrschen, nicht jedoch über einen vom heiligen Geist erfüllten Menschen.[78] Somit meint der Tiervergleich, bzw. die Gleichsetzung des Menschen mit dem Tier, die Hervorhebung des Bösen im Menschen, das vom Teufel beeinflusst wird.[79]Auch in der Lehre Martin Luthers wird gesagt, dass im Körper des Menschen sowohl Tier als auch Mensch enthalten sind. Sie sieht allerdings das Böse nicht grundsätzlich durch das Tier verkörpert, sondern durch die menschliche Sünde, von der dieser erlöst werden müsse.[80]Auch laut Erasmus von Rotterdam müsse der Mensch erzogen werden, da er sonst zum Tier ausarte. Durch gutes Beispiel müsse dem zu erziehenden Menschen das richtige, gottesfürchtige Leben gezeigt werden, da er durch das Laster erst zum Tier werde.[81]
Diese Ausartung des Menschen zum Tierhaften und damit zum Bösen, bedingt durch ein lasterhaftes Leben, ist eines der Hauptthemen mit dem sich die sogenannte „Teufelsliteratur“ des 16. und 17. Jahrhunderts beschäftigte. So existierten laut der damaligen Auffassung z.B. diverse „Sauf- und Kleiderteufel“, die die Menschen verführten. So mache der Saufteufel die Menschen durch den Alkohol zu Tieren und damit besonders anfällig für das Böse. Und auch der Kleiderteufel brächte nur die animalische Seite des Menschen zu Tage, indem er diesen durch das Tragen von Pelzen dem Tier gleichstelle und ihn seiner Menschlichkeit beraube.[82]
Doch auch ein ganz spezifischer „Gesind-Teuffel“ existierte laut dem protestantischen Theologen Peter Glaser. Demnach habe der Teufel großen Einfluss auf die Dienstboten, die zu schwach seien, dessen Verlockungen zu wiederstehen und somit eine Gefahr für alle darstellten.[83]Durch diesen satanischen Einfluss käme es dazu, dass das Gesinde seine Dienstherren so gut es nur ginge zu schädigen und zu hintergehen versuchte.[84]Diese Verteufelung des Gesindes hielt mitunter weit bis in das aufgeklärte 18. Jahrhundert an und machte einen Großteil des negativen Ansehens der dienenden Schichten aus. Zwar wurde immer weniger direkt auf den Teufel als Grund für das schlechte Gesinde verwiesen, dennoch war das Verhältnis Dienstherr - Dienstbote nach wie vor von Spannungen geprägt.[85]
3.4. Weibliche Dienstboten
Besonders unter der negativen Stereotypisierung zu leiden hatte das weibliche Dienstpersonal, das in den Städten den Großteil des Gesindes ausmachte. Vor allem mussten diese weiblichen Dienstboten unter einem doppelt negativen Ansehen ihren Dienst verrichten. Wurde schon die Menschlichkeit und Ehre des Gesindes im allgemeinen angezweifelt, so wurde teilweise bis in das 18. Jahrhundert hinein immer wieder die Frage aufgeworfen, ob die Frauen überhaupt Menschen seien.[86]Dass das Leben von Dienstmägden und anderem weiblichen Gesinde der frühneuzeitlichen Stadt besonderen Widrigkeiten ausgesetzt war, soll das folgende Kapitel zeigen.
3.4.1. Das Ansehen weiblicher Dienstboten in der frühneuzeitlichen Stadt
Waren die Klagen über Dienstboten in der Hausväter- und Teufelsliteratur auf das Gesinde im allgemeinen bezogen, so wurden die Mägde im besonderen zur Zielscheibe von Schmähschriften, der sogenannten „Mägdeschelte“, die die Stereotypisierung dieses Berufs über lange Zeit widerspiegelt.[87]
Mägde galten nach diesen Schriften durchweg als faule Müßiggängerinnen, die ständig ihre Arbeit vernachlässigten, widerspenstig waren und die Kinder des Hauses zu Unzucht ermutigten. Außerdem warfen sie ihr ganzes Geld zum Fenster hinaus für Schmuck und anderen Zierrat, um einen Mann für sich zu finden. Weil ihnen das aber nicht gelang, verführten sie oftmals ihren Hausherren, um sich nach dem Tode der Hausmutter ins gemachte Nest setzen zu können. Wurden sie dabei schwanger und wollte der Hausherr sie nicht heiraten, so würden viele von ihnen ihr eigenes Kind töten und letztlich als Kindsmörderinnen hingerichtet.[88]
Aus diesem Kontext entstammt auch der häufig angewandte Vergleich der Dienstmagd mit einer Hure. Diese Verunglimpfungen weiblichen Hauspersonals können als Beispiele für den tiefen Konflikt zwischen diesen und ihren Herrschaften herangezogen werden. Zwar gab es im Gegenzug zur „Mägdeschelte“ auch „Mägdelob“, dessen Zweck es war, die weiblichen Dienstboten zu verteidigen, doch konnten die negativen Traktate jederzeit leicht wieder durch die Dienstherrschaft als Beleg für die Unzuverlässigkeit der Dienstmädchen herangezogen werden.[89]
3.4.2. Weibliche Unzucht
Dem weiblichen Gesinde wurde wiederholt der Vorwurf der Leichtfertigkeit gemacht in Bezug auf aufgenommene sexuelle Beziehungen zu Männern vor der Heirat, ohne für mögliche Kinder als Folge dieses Treibens aufkommen zu können.[90]Dies wurde ihnen insofern besonders negativ angelastet, da sie als Mitbewohner des „ganzen Hauses“, wie die Töchter des Hausvaters auch, keusch zu leben und die Ehre des Hauses zu bewahren hatten. Dementsprechend trafen ihre angeblichen oder tatsächlichen Unzuchtsvergehen auch und vor allem den Hausvater, der für alle Mitglieder zu sorgen und diese zu einem sittlichen Leben anzuhalten hatte.[91]
Auch drohte nicht nur der durch religiöse und kulturelle Normen vorgesehene Ehrverlust allein. So waren Unzuchtsvergehen oft noch zusätzlich durch die Obrigkeit unter Strafe gestellt. Und dies nicht nur für die Beteiligten, sondern häufig auch für Hausvater und Hausmutter, wenn diese„[...] ihre erwachßene[n] kinder, söhn und töchter, knecht und mägd zusammen in eine kamer gelegt und damit zu dergleichen unzucht nicht wenig gelegenheit gemacht [hatten].“[92]
Besonders hart traf die strafrechtliche Verfolgung jedoch in den meisten Fällen die Magd selbst. So wurden auch kleinere Unzuchtsvergehen vor Gericht verhandelt und teilweise empfindlich bestraft. So zeigt Renate Dürr am Beispiel Schwäbisch Halls, dass Geschlechtsverkehr unter Ledigen mit 10 Tagen Haft zu bestrafen war.[93]Schlimmer waren für Dienstmädchen jedoch Strafen, die mit einem Verlust an Ehre verbunden waren, wie z.B. Pranger oder auch Ausweisung. Gerade innerhalb der städtischen Unterschichten war die Ehre, so gering diese grundsätzlich sein mochte, von großer Bedeutung, da sie sozusagen deren wichtigstes Kapital darstellte.[94]Bei der Anwendung dieser Strafen wurde besonders der Landesverweis, vermutlich seiner abschreckenden Wirkung wegen, sehr häufig bei Unzuchtsprozessen ausgesprochen, in denen Dienstmädchen angeklagt waren.[95]
Die Folgen des Ehrverlustes waren für weibliche Dienstboten meist gleichbedeutend mit dem Verlust an Zukunftschancen. So konnte sich beispielsweise ein schwangeres Dienstmädchen, das wegen dieses Vergehens auch noch verurteilt war, kaum noch Hoffnungen darauf machen, auf dem Heiratsmarkt zu bestehen.[96]
Wegen dieser negativen Zukunftsaussicht kam es immer wieder zu Abtreibungen von unehelichen Kindern oder der Verheimlichung von Geburten oft einhergehend mit Kindstötungen.[97]Als berühmtestes Beispiel in der Literatur ist dafür sicherlich das Gretchendrama in Goethes „Faust“ anzusehen. Diese Dienstmädchen erwartete in den meisten Fällen die Todesstrafe, auch wenn im 18. Jahrhundert nach und nach dazu übergegangen wurde, diese zu begnadigen. Den Verlust ihrer Ehre bedeutete es jedoch auch in dem Fall, in dem das Kind behalten wurde.[98]
3.5. Zusammenfassung des Kapitels
Stand im ersten Teil dieser Arbeit die wirtschaftliche Situation des städtischen Gesindes im Vordergrund, so wurde anhand des zweiten Teils gezeigt, dass auch dessen soziales Ansehen einen wichtigen Einfluss auf die Lebensqualität hatte. Vor allem zeigt sich, dass dem Gesinde alle nur erdenklichen negativen Eigenschaften zugesprochen wurden, so dass es kaum verwundert, dass die berufliche Motivation innerhalb dieses Berufsstandes selten besonders groß war. Dies hatte dann allerdings wieder zur Folge, dass das entsprechende Verhalten als Böswilligkeit ausgelegt und durch noch restriktivere Maßnahmen zu regulieren versucht wurde.
Die Lebenswelt der Dienstboten in der Stadt der Frühen Neuzeit wurde also nicht unerheblich durch deren schlechtes Sozialprestige beeinflusst und hatte dementsprechend wohl auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation, wie sich am Beispiel der „unzüchtigen“ Mägde gezeigt hat.
4. Resümee und Bewertung der Ergebnisse
Es wäre möglicherweise zu weit gegriffen zu sagen, dass das Dienstbotendasein in der frühneuzeitlichen Stadt durchweg nur von den zwei Faktoren Wirtschaft und sozialem Ansehen geprägt gewesen ist. So zeigte sich gerade in der Zeit der Aufklärung, dass auch kulturelle und möglicherweise auch religiöse Veränderungen hin zu einer liberaleren Gesellschaft und allmähliches Loslösen von einem ständischen System die Situation der Dienstboten nach und nach verbesserte. So trat beispielsweise das Zuerkennen von gesellschaftlichen Rechten für diese immer mehr in den Vordergrund.
Doch kann gleichfalls gesagt werden, dass dieser beginnenden Emanzipation des Gesindes eine Zeit vorausging, die noch in starkem Maße von den sozialen Ansichten des Mittelalters geprägt war und dem Gesinde eben nicht die Rechte zugestehen wollte, nach denen diese später immer häufiger verlangten. Dieses Einengen des Gesindestandes in sozialer Abhängigkeit und Unmündigkeit, die Bevormundung durch die höheren Schichten und die Fremdbestimmung der Lebensverhältnisse der Dienstboten durch Dienstherren, die sich moralisch gerechtfertigt sahen, machte die eigentliche Misere der dienenden Schichten aus. Nicht so sehr die wirtschaftliche Armut war prägend für diesen Teil der Unterschichten, sondern vielmehr die soziale Armut in der sie leben mussten.
5. Literatur- und Quellenverzeichnis
Brunner, Otto: Das „Ganze Haus“ und die alteuropäische Ökonomik, in: Ders.: Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2., vermehrte Auflage, Göttingen 1968.
Dülmen, Richard van: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit, Bd. 1: Das Haus und seine Menschen, 16.-18. Jahrhundert, München 1990.
Dürr, Renate: Mägde in der Stadt. Das Beispiel Schwäbisch Hall in der Frühen Neuzeit, Frankfurt a.M./New York 1995 (Geschichte und Geschlechter 13).
Dürr, Renate: Die Ehre der Mägde zwischen Selbstdefinition und Fremdbestimmung, in: Backmann, Sibylle; Hans-Jörg Künast; Sabine Ullmann und B. Ann Tlusty (Hgg.): Ehrkonzepte in der Frühen Neuzeit, Berlin 1998 (Colloquia Augustana 8), S.170-184.
Engelsing, Rolf: Der Arbeitsmarkt der Dienstboten im 17., 18. und 19. Jahrhundert, in: Kellenbenz, Hermann (Hg.): Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt. Bericht über die 4. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Wien am 14. und 15. April 1971, München 1974, S. 159-237.
Engelsing, Rolf: Das Vermögen der Dienstboten in Deutschland zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte 3 (1974), S. 227-256.
Engelsing, Rolf: Einkommen der Dienstboten in Deutschland zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte 2 (1973), S. 11-65.
Frühsorge, Gotthardt: Einübung zum christlichen Gehorsam: Gesinde im „ganzen Haus“, in: Frühsorge, Gotthardt; Rainer Gruenter und Beatrix Freifrau Wolff Metternich (Hgg.): Gesinde im 18. Jahrhundert, Hamburg 1995 (Studien zum achtzehnten Jahrhundert 12), S. 109-120.
Habermas, Rebekka und Tanja Hommen (Hgg.): Das Frankfurter Gretchen. Der Prozeß gegen die Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt, München 1999.
Hippel, Wolfgang von: Armut, Unterschichten, Randgruppen in der frühen Neuzeit, München 1995 (Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 34).
Hüttl, Ludwig: Das Erscheinungsbild der Dienstboten in der katholischen Frömmigkeitsgeschichte des 18. Jahrhunderts, in: Frühsorge, Gotthardt; Rainer Gruenter und Beatrix Freifrau Wolff Metternich (Hgg.): Gesinde im 18. Jahrhundert, Hamburg 1995 (Studien zum achtzehnten Jahrhundert 12), S. 121-160.
Mitterauer, Michael: Gesindedienst und Jugendphase im europäischen Vergleich, in: Geschichte und Gesellschaft (GG) 11 (1985), S. 177-204.
Moser-Rath, Elfriede: »Lustige Gesellschaft«. Schwank und Witz des 17. und 18. Jahrhunderts in kultur- und sozialgeschichtlichem Kontext, Stuttgart 1984.
Müller-Staats, Dagmar: Klagen über Dienstboten. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Herrschaften und Dienstboten mit besonderer Berücksichtigung Hamburgs im 19. Jahrhundert, Hamburg 1983.
Münch, Paul (Hg.): Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit. Texte und Dokumente zur Entstehung der »bürgerlichen Tugenden«, München 1984.
Münch, Paul: Tiere, Teufel oder Menschen? Zur gesellschaftlichen Einschätzung der „dienenden Klassen“ während der Frühen Neuzeit, in: Frühsorge, Gotthardt; Rainer Gruenter und Beatrix Freifrau Wolff Metternich (Hgg.): Gesinde im 18. Jahrhundert, Hamburg 1995 (Studien zum achtzehnten Jahrhundert 12), S. 83-108.
Schröder, Rainer: Das Gesinde war immer frech und unverschämt. Gesinde und Gesinderecht vornehmlich im 18. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1992.
Schröder, Rainer: Gesinderecht im 18. Jahrhundert, in: Frühsorge, Gotthardt; Rainer Gruenter und Beatrix Freifrau Wolff Metternich (Hgg.): Gesinde im 18. Jahrhundert, Hamburg 1995 (Studien zum achtzehnten Jahrhundert 12), S. 13-40.
Suutala, Maria: Tier und Mensch im Denken der Deutschen Renaissance, Helsinki 1990 (Studia Historica 36).
[...]
[1]Schröder, Rainer: Gesinderecht im 18. Jahrhundert, in: Frühsorge, Gotthardt; Rainer Gruenter und Beatrix Freifrau Wolff Metternich (Hgg.): Gesinde im 18. Jahrhundert, Hamburg 1995 (Studien zum achtzehnten Jahrhundert 12), S. 13-40.
[2]Münch, Paul: Tiere, Teufel oder Menschen? Zur gesellschaftlichen Einschätzung der „dienenden Klassen“ während der Frühen Neuzeit, in: Frühsorge, Gruenter, Wolff Metternich (Hgg.): Gesinde im 18. Jahrhundert, S. 83-108.
[3]Hüttl, Ludwig: Das Erscheinungsbild der Dienstboten in der katholischen Frömmigkeitsgeschichte des 18. Jahrhunderts, in: Frühsorge, Gruenter, Wolff Metternich (Hgg.): Gesinde im 18. Jahrhundert, 121-160.
[4]Frühsorge, Gotthardt: Einübung zum christlichen Gehorsam: Gesinde im „ganzen Haus“, in: Frühsorge, Gruenter, Wolff Metternich (Hgg.): Gesinde im 18. Jahrhundert, S. 109-120.
[5]Engelsing, Rolf: Der Arbeitsmarkt der Dienstboten im 17., 18. und 19. Jahrhundert, in: Kellenbenz, Hermann (Hg.): Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarkt. Bericht über die 4. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Wien am 14. und 15. April 1971, München 1974, S. 159-237. Engelsing, Rolf: Einkommen der Dienstboten in Deutschland zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte 2 (1973), S. 11-65. Engelsing, Rolf: Das Vermögen der Dienstboten in Deutschland zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert, in: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte 3 (1974), S. 227-256.
[6]Mitterauer, Michael: Gesindedienst und Jugendphase im europäischen Vergleich, in: Geschichte und Gesellschaft (GG) 11 (1985), S. 177-204.
[7]Hippel, Wolfgang von: Armut, Unterschichten, Randgruppen in der frühen Neuzeit, München 1995 (Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 34).
[8]Schröder, Rainer: Das Gesinde war immer frech und unverschämt. Gesinde und Gesinderecht vornehmlich im 18. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1992.
Dürr, Renate: Mägde in der Stadt. Das Beispiel Schwäbisch Hall in der Frühen Neuzeit, Frankfurt a.M./New York 1995 (Geschichte und Geschlechter 13).
[9]Brunner, Otto: Das „Ganze Haus“ und die alteuropäische Ökonomik, in: Ders.: Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2., vermehrte Auflage, Göttingen 1968.
Dülmen, Richard van: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit, Bd. 1: Das Haus und seine Menschen, 16.-18. Jahrhundert, München 1990.
[10]Müller-Staats, Dagmar: Klagen über Dienstboten. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Herrschaften und Dienstboten mit besonderer Berücksichtigung Hamburgs im 19. Jahrhundert, Hamburg 1983. Suutala, Maria: Tier und Mensch im Denken der Deutschen Renaissance, Helsinki 1990 (Studia Historica 36). Moser-Rath, Elfriede: »Lustige Gesellschaft«. Schwank und Witz des 17. und 18. Jahrhunderts in kultur- und sozialgeschichtlichem Kontext, Stuttgart 1984. Münch, Paul (Hg.): Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit. Texte und Dokumente zur Entstehung der »bürgerlichen Tugenden«, München 1984.
[11]Müller-Staats: Klagen, S. 27.
[12]Ebenda, S. 28.
[13]Hippel: Armut, S. 23.
[14]Schröder: Gesinde, S. 60.
[15]Engelsing: Arbeitsmarkt, S. 211.
[16]Ebenda, S. 212.
[17]Mitterauer: Gesindedienst, S. 201.
[18]Ebenda, S. 180-183.
[19]Engelsing: Arbeitsmarkt, S. 204-205.
[20]Hippel: Armut, S. 23.
[21]Zitiert nach: Schröder: Gesinde, S. 49.
[22]Engelsing: Arbeitsmarkt, S. 176-177.
[23]Ebenda, S. 185.
[24]Ebenda, S. 177-178.
[25]Ebenda, S. 187-188.
[26]Engelsing: Einkommen, S. 20.
[27]Ebenda.
[28]Ebenda, S. 22.
[29]Ebenda, S. 23-24.
[30]Ebenda, S. 14-16.
[31]Ebenda, S. 17-18.
[32]Ebenda, S. 19.
[33]Ebenda, S. 16.
[34]Engelsing: Vermögen, S. 229-230.
[35]Ebenda, S. 229.
[36]Ebenda, S. 233.
[37]Ebenda, S. 249.
[38]Ebenda, S. 236-237.
[39]Ebenda, S. 234-235.
[40]Ebenda, S. 237-239
[41]Ebenda, S. 247-248.
[42]Ebenda, S. 250.
[43]Brunner: „Ganze Haus“, S. 109.
[44]Dülmen: Kultur, S. 38.
[45]Brunner: „Ganze Haus“, S. 108.
[46]Dülmen: Kultur und Alltag, S. 41-42.
[47]Brunner: „Ganze Haus“, S. 112-113.
[48]Dürr: Mägde, S. 17.
[49]Ebenda, S.18-19.
[50]Schröder: Gesinde, S. 103.
[51]Ebenda, S. 101-102.
[52]Schröder: Gesinderecht, S. 15.
[53]Ebenda, S. 22.
[54]Ebenda, S. 24.
[55]Siehe Anmerkung 8.
[56]Mitterauer: Gesindedienst, S. 198-199.
[57]Ebenda, S. 200.
[58]Ebenda, S. 203.
[59]Hippel: Armut, S. 25.
[60]Engelsing, Arbeitsmarkt, S. 222.
[61]Ebenda, S. 217.
[62]Schröder: Gesinde, S. 21.
[63]Ebenda, S. 32.
[64]Schröder: Gesinderecht, S. 15.
[65]Ebenda.
[66]Ebenda, S. 27.
[67]Müller-Staats: Klagen, S. 110-111.
[68]Menius, Justus: An die hochgeborne Furstin/ fraw Sibilla Hertzogin zu Sachsen/ Oeconomia Christinana/ das ist/ von Christlicher haushaltung. Mit einer schönen Vorrede D. Martini Luther. 1529., in: Münch: Ordnung, S. 47.
[69]Viuiennus, Georgius: Weiberspiegel darinnen sich zuersehen: Wes sich ein Gottsfürchtig/ Christlich from/ Ehrlich Weib in jhrem Ehestande/ vnd Haushaltung/ gegen Gott/ jrem Eheman/ auch vor ihre person in zier vnd tracht/ gegen jhren Kindern/ in aufferziehen vnd ausstattung/ gegen jhrem Gesinde/ vnd sonsten menniglichen: Oder auch eine Witfraw in jhrem Witwenstande oder ander heirat/ zu jeder zeit vnd orth verhalten soll/ geteilet in vier Bücher. Mit viel schönen vnd lustigen Historien/ zu trewlicher vnterweisung der Hausmütter vnd Weiblichen geschlechtes. 1565., in: Münch: Ordnung, S. 71.
[70]Frühsorge: Einübung, S. 113.
[71]Ebenda, S. 114.
[72]Schröder: Gesinde, S. 129.
[73]Zitiert nach: Hüttl: Erscheinungsbild, S. 125.
[74]Müller-Staats: Klagen, S. 113-114.
[75]Münch: Tiere, S. 87.
[76]Ebenda, S. 88.
[77]Ebenda, S. 92.
[78]Suutala, Maria: Tier und Mensch im Denken der Deutschen Renaissance, Helsinki 1990 (Studia Historica 36), S. 136.
[79]Ebenda, S. 131.
[80]Ebenda, S. 150-151.
[81]Ebenda, S. 155-156.
[82]Ebenda, S. 158-159.
[83]Münch: Tiere, S. 96-97.
[84]Ebenda, S. 98.
[85]Ebenda, S. 101-102.
[86]Moser-Rath: »Lustige Gesellschaft«, S. 101.
[87]Dürr: Mägde, S. 96.
[88]Ebenda, S. 97.
[89]Ebenda, S. 100-103.
[90]Ebenda, S. 221.
[91]Dürr, Renate: Die Ehre der Mägde zwischen Selbstdefinition und Fremdbestimmung, in: Backmann, Sibylle; Hans-Jörg Künast; Sabine Ullmann und B. Ann Tlusty (Hgg.): Ehrkonzepte in der Frühen Neuzeit, Berlin 1998 (Colloquia Augustana 8), S. 172.
[92]Moser-Rath: »Lustige Gesellschaft«, S. 87-88.
[93]Dürr: Mägde, S. 224.
[94]Ebenda, S. 239.
[95]Ebenda, S. 243.
[96]Ebenda, S. 252-254.
[97]Habermas, Rebekka und Tanja Hommen (Hgg.): Das Frankfurter Gretchen. Der Prozeß gegen die Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt, München 1999, S. 18-20.
[98]Ebenda, S. 38-42.
- Arbeit zitieren
- Christoph Merkel (Autor:in), 2002, Gesinde und Dienstboten in der Stadt der Frühen Neuzeit. Subsistenzsicherung und Sozialreputation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107571
Kostenlos Autor werden
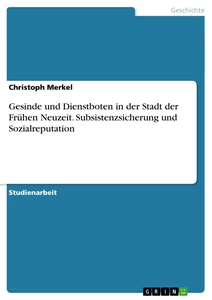
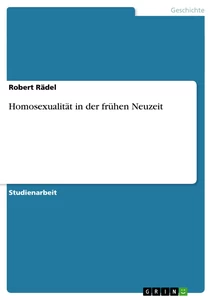

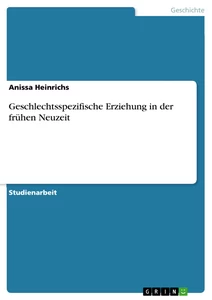
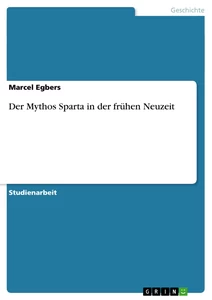










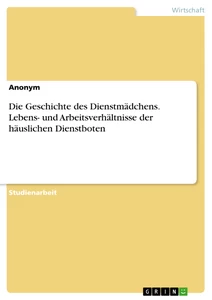

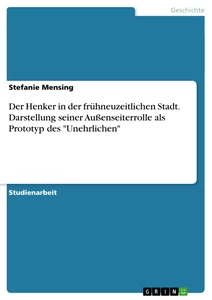

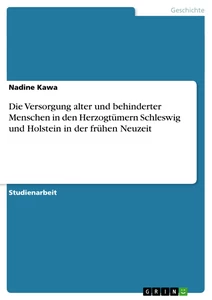
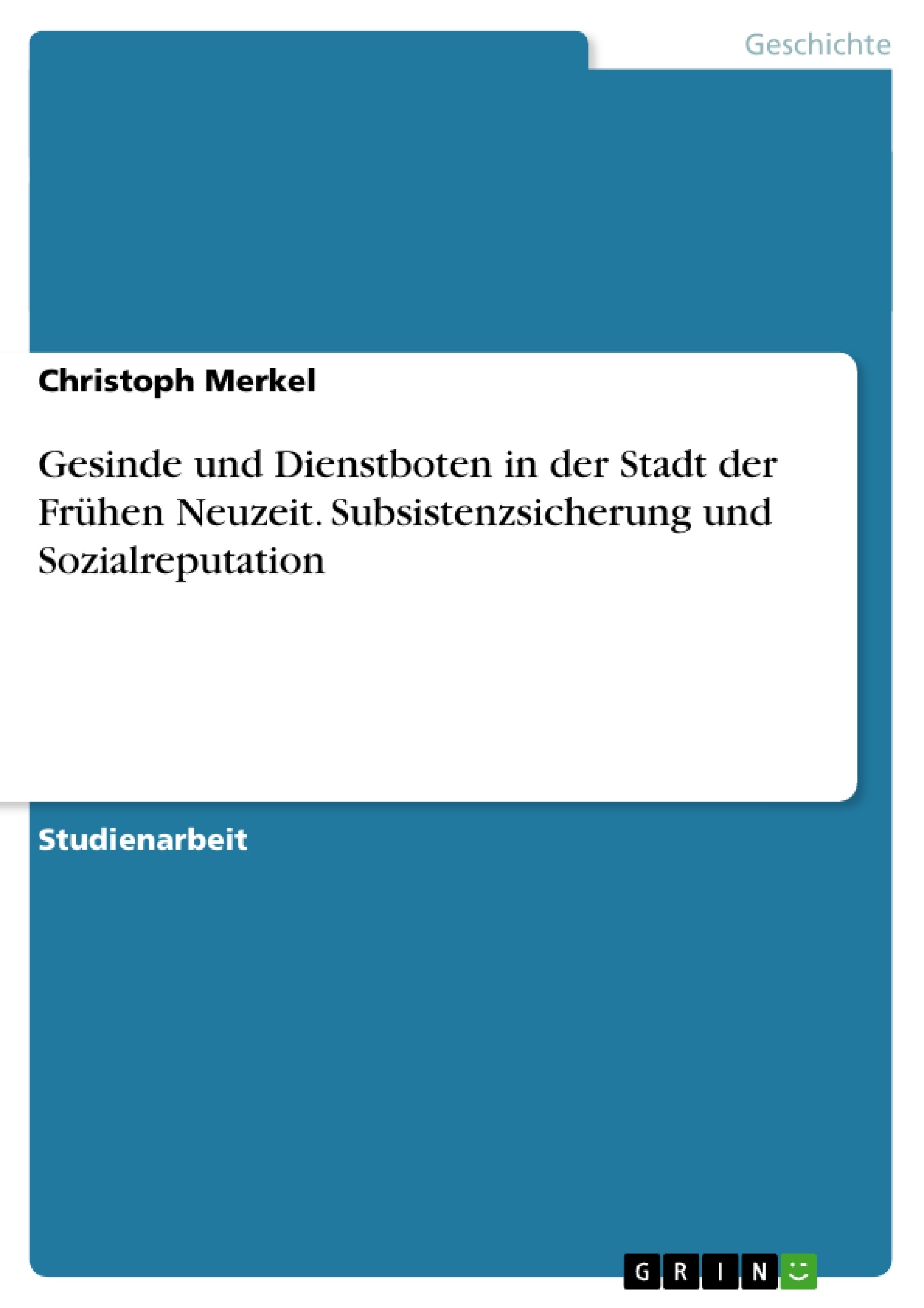

Kommentare