Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Die Diskussion um außerirdische Welten: Von der Antike bis zur Neuzeit
1.1 Erläuternde Begriffsbestimmungen
1.2 Alles begann mit den Griechen: Die Antike
1.3 Die Horizonte öffnen sich: Vom Mittelalter bis zur Aufklärung
1.4 Fantasie kennt keine Grenzen: Die Neuzeit
2. Was ist Leben ?
2.1 Definitionen von Leben
2.2 Was ist intelligentes Leben ?
2.3 Woraus besteht Leben ?
2.4 Wie könnte extraterrestrisches Leben beschaffen sein ?
3. Sind wir allein im Universum ?
3.1 Die Diskussion um extraterrestrisches Leben in der Gegenwart
3.1.1 Grundlegende Postulate und Prinzipien im Universum
3.1.2 Die Drake-Gleichung
3.1.2.1 Planeten als Wiege des Lebens
3.1.2.2 Das Lebensparadox
3.1.2.3 Die Ungewissheit bleibt
3.1.3 Von der Unwahrscheinlichkeit der menschlichen Existenz
3.1.3.1 Das Anthropische Prinzip
3.2 Folgerungen und Konsequenzen
4. Literaturverzeichnis
1. Die Diskussion um außerirdische Welten - von der Antike bis zur Neuzeit
1.1 Erläuternde Begriffsbestimmungen
Bevor ein philosophischer Abriss der Diskussion um außerirdische Welten gegeben werden soll, zunächst ein paar erläuternde Begriffsbestimmungen: In der griechischen Denkvorstellung gab es zunächst nur eine Welt (griech.: kosmos). Nach Epikur bestand sie aus einem abgegrenzten Teil des Himmels (ouranus), der die Erde als Zentrum, die Sonne und alle sonst bekannten himmlischen Körper und Phänomene beinhaltete. Diese Welt, die außen rund, dreieckig oder sonst wie geformt war, war ein Ausschnitt des Unendlichen (apeiron), also des gesamten Universums. Die Frage, welche die Griechen in diesem Zusammenhang bewegte, war: Gibt es nur diese eine beobachtbare Welt oder darüber hinaus „unzählig viele Welten“ (aperoi kosmos) mit eigenen Planeten und Sternen, die aber für unserer Wahrnehmung unzugänglich sind? Diese ursprüngliche Frage griechischer Philosophen wurde später in der westlichen Welt unter lateinisch sprechenden Gelehrten bekannt als die Frage nach „vielen Welten“ (plures mondi), wobei die griechische Vorstellung von einer Welt zunächst erhalten blieb. Erst nach Kepler im 17.Jahrhundert setzte sich die Einsicht durch, die Fixsterne am Himmel seien Sonnen wie die unsere und könnten von Planeten, auch bewohnten Planeten, umkreist sein. Damit wandelte sich seit der Renaissance die Frage nach vielen Welten im Sinne griechischer kosmoi zu der historischen Frage nach einer „Vielzahl von Welten“ in dem Sinne, ob diese Planeten selbst bewohnte Welten darstellen.
Es ist müßig zu spekulieren, ob abseits abendländischen Denkens die ersten Hochkulturen der Babylonier, Ägypter, Chinesen oder Mayas sich ein Bild vom Leben jenseits der eigenen Welt gemacht haben. Wahrscheinlich nicht. Denn ihr Weltbild war bestimmt von Mystizismus und einer irrationalen Götterwelt, in der die Erde eine Scheibe war, vom Ozean umflossen, und vom Himmelsgewölbe überdacht, in dem all das Funkeln der uns heute bekannte Sterne nur irgendein schmückendes Beiwerk war. In einem dieser fein ziselierten
Weltbilder wurde der Ozean mit den eingeschlossenen Landmassen von einer Schildkröte getragen, die in einem Meer aus Milch schwamm, das wiederum von einem anderen Tier getragen wurde und so weiter, bis als unterstes Tier der Elefant die Bürde aller tragen musste, der mit seinen unendlich langen Beinen keine Standfläche benötigte - womit die unangenehme Frage, worauf die Erde schließlich stehe, spitzfindig umgangen wurde. In diesen phantastischen Weltbildern gab es keine Frage nach dem Mittelpunkt des Weltalls, weil alles was existierte, die Erdscheibe selbst war. Und daher schloss sich auch eine Frage nach anderen Welten von vornherein aus.
1.2 Alles begann mit den Griechen: Die Antike
Es ist das große Verdienst der Griechen, in ihrer Blütezeit vom 6. vorchristlichen bis zum 2. nachchristlichen Jahrhundert das Weltbild auf eine rationale Basis zu stellen versucht zu haben; eine Naturphilosophie zu begründen, unbeeinflusst von der Willkür irgendwelcher Götter. Der erste, der ein geschlossenes mechanisches Weltmodell aufstellte, dass, wenn auch weitgehend falsch, so doch wenigstens in sich einigermaßen wiederspruchsfrei war, war Anaxagoras im 5. Jahrhundert vor Christus aus der ionischen Denkschule. Gemäß seiner Vorstellung entstand die Welt durch die Rotation eines Urstoffes, den die „Vernunft“ eingeleitet hatte. Die Rotation teilte den Urstoffe in die beiden Stoffe Äther, einer dünnen, flüchtigen, leichten, hellen Substanz, und Luft, einer dunklen, kalten, massiv schweren Substanz, wobei die Luft zur Mitte gedrängt wurde. Dort wurde Wasser aus ihr ausgeschieden und der daraus ausfällende Schlamm verwandelte sich unter der Einwirkung der Kälte zu Gestein. Damit war die Erde geschaffen.
Von den Pythagoräern, einer mehr mathematisch orientierten hellenistischen Denkschule, übernahm Anaxagoras die Vorstellung einer kugelförmigen Erde, die frei im Raum schwebt. Die Kugelgestalt der Erde, die später von allen griechischen Denkschulen übernommen wurde, entsprang jedoch weniger einer genauen Beobachtungsgabe, sondern der festen Überzeugung das in dies so seinmüsse,weildieErdevollkommenunddiegeometrisch
vollkommenste Form eben gerade eine Kugel sei. Mit seinem erstmals richtigen astronomischen Verständnis war Anaxagoras aber seiner Zeit weit voraus. Man darf ihn darüber hinaus auch getrost als ersten Kosmopoliten des Abendlandes bezeichnen, denn nach seinem Vaterland gefragt, soll er mit erhobenen Armen auf den Himmel gedeutet und so den Kosmos als das wahre Vaterland des Menschen bezeichnet haben.
Die Entstehung der Welt aus einer Rotation eines Urstoffes, wie Anaxagoras sie beschrieben hatte, entsprach in etwa auch der Vorstellung der Atomisten, mit Demokrit (460-370 v.Chr.) als deren Begründer. In ihrem Weltbild bestand alles aus kleinsten Teilchen, den Atomen, was „nicht schneidbar“ bedeutet, und aus Leere - und sonst nichts. Es existierten, so die Atomisten weiter, unendlich viele Atome, die sich in der zwischen ihnen befindlichen Leere konstant bewegten und sich auf diese ursächliche Weise zusammenfinden und die verschiedensten Stoffe formen konnten. Weil dies aber alles mehr oder weniger zufällig geschah, konnte diese Genesis zu im Prinzip unzählig vielen Welten führen, weswegen nach ihrer Vorstellung unzählig viele Welten in verschiedenen Größen koexistierten. Demokrit machte sich auch genauere Vorstellungen über andere Welten:
„In manchen Welten gibt es keine Sonne und keinen Mond. In anderen Welten sind diese größer als in unserer Welt und in wieder anderen sogar zahlreicher. In einigen Gegenden gibt es mehr Welten, in anderen weniger, einige nehmen an Größe zu, andere haben ihre maximale Ausdehnung erreicht und andere werden wieder kleiner. In einigen Gegenden entstehen Welten, in anderen vergehen sie. Sie werden zerstört durch Kollisionen miteinander.“
Obwohl die Frage nach außerirdischem Leben nicht der Zentrale Punkt ihrer Diskussion über mögliche andere Welten war, kam er schließlich zu dem Thema, welches Tausende von Jahren später die Essenz dieser Diskussion werden sollte:
„Es gibt einige Welten auch ohne lebende Wesen oder Pflanzen oder jegliche Feuchtigkeit.“
Diesen Punkt machten seine geistigen Nachfolger Epikur und Lukretius noch etwas deutlicher:
„Darüber hinaus müssen wir annehmen, dass in anderen Welten Lebewesen und Pflanzen und all die anderen Dinge unserer Welt existieren.“
Im völligen Gegensatz zu den Atomisten existierte in der Weltanschauung des Aristoteles (384-322 v.Chr.), dargestellt in seinem Werk De Caelo („Über die Himmel“), nur die eine Welt und somit indirekt auch kein Leben in anderen Welten. Selbst die Existenz einer einzigen anderen Welt schloss er aus. Diese Ansicht basierte auf den von ihm postulierten Grundelementen des Seins: Erde, Luft, Feuer und Wasser. Die natürliche Position des schweren Elementes Erde war der Mittelpunkt der Welt. Jedes Teil das Element des Elementes Erde bewegte sich auf die Erde zu. Einzig Feuer als das leichteste Element bewegte sich von der Erde nach außen weg. Luft und Wasser mit mittlerem Gewicht nahmen Positionen dazwischen ein. Aristoteles führte an, dass unsere Welt aus aller existenten Materie bestände. Es könne also keine anderen Welten geben, weil es dort keine weitere Materie gäbe. Der Grund für die Ansammlung von Materie in nur einer Welt lag für ihn in der zwingenden räumlichen Ordnung seiner vier Elemente bezüglich nur eines möglichen Mittelpunkt, weshalb dieses zweite Argument eigentlich vollkommen auf sein erstes Argument zurückführbar ist.
Philolaos von Kroton (530-428 v.Chr.) war der erste Grieche, bei dem die Erde nicht mehr im Mittelpunkt des Universums stand, sondern sich zusammen mit einer Gegen-Erde, Antichton, um ein gemeinsames
„Zentralfeuer“ bewegte. Obwohl er hiermit nicht die Sonne meinte, sind in dieser Denkweise Ansätze eines heliozentrischen Weltbildes zu entdecken., das die bis dahin Jahrhundert alte, starre Vorstellung von einer Erde als Weltmittelpunkt durchbrach. Diese Auffassung stand jedoch im Widerspruch zu nahezu allen bis dahin wirkenden philosophischen Schulen, nach denen die Erde einzigartig war und der
Mittelpunkt eines Universums, in dem die Sterne ätherische Eigenschaften besitzen.
Ebenso vermutete Heraklit (580-480 v.Chr.), dass die Erde nicht ausschließlicher zentraler Punkt aller Bewegungen in unserer Welt sei, sondern wie Merkur und Venus um die Sonne kreiste. Aber es war erst Aristarch von Samos (310-320 v.Chr.), der das Denken seiner Zeit radikal änderte und die Sonne, um die alle anderen Planeten, einschließlich der Erde kreisten, in das Zentrum des Weltalls stellte.
Der große Mathematiker und Philosoph Archimedes (287-212 v.Chr.) stand dem Weltbild des Aristarch ablehnend gegenüber, weil, so sein Gegenargument, dann die Positionen näherer Fixsterne vor dem Hintergrund weiter entfernter Sterne schwanken würden. Dies ist zwar richtig, aber ein immens großes Universum, bei dem die riesigen Abstände der Sterne diese Schwankungen so herabsetzen, dass sie unbeobachtbar klein würden, überstieg die Vorstellungskraft selbst eines Archimedes.
Hipparch (190-125 v.Chr.) bestimmte im folgenden durch eigene astronomische Beobachtungen die mittlere Entfernung der Erde zum Mond ziemlich zutreffend auf 400 000 km (exakt 384 400 km), hingegen unterschätzte er den Abstand zur Sonne um das 18fache.
Die Abstände zu den äußeren Planeten werden von Cicero (106-43 v.Chr.) als „unendlich und immens“ angegeben, und Seneca (4 v.Chr.- 65 n.Chr.) spricht von der „gewaltigen, obgleich endlichen Ausdehnung“ der Sphäre, in seiner Vorstellung kein tiefer Raum, sondern in der Tradition platonischer Schule eine Art dünne Grenzschale, in der die Fixsterne befestigt sind.
Die Vorstellungen über außerirdisches Leben konzentrierten sich hauptsächlich auf den Mond. Dass der Mond erdähnlich sein müsse, erwähnten vor Anaxagoras bereits Orpheus und Thales im 6. Jahrhundert v.Chr. Die Pythagoräer wie Xenophanes vertraten darüber hinaus die Meinung, der Mond sei wie die Erde bewohnt.
Eine späte griechische Quelle, bekannt als Pseudo-Plutarch, bezieht sich auf die pythagoräische Annahme, dass
„...der Mond terraner Natur ist, bewohnt ist wie unsere Erde und größere Tiere und Pflanzen mit seltenerer Schönheit beheimatet als unsere Erde es sich leisten kann. Die Tiere in ihrer Art und
Stärke sind uns um 15 Grade überlegen, geben keine Exkremente von sich, und die Tage sind fünfzehn mal länger.“
In nachchristlichen Zeiten wuchs das Interesse der Griechen am Mond noch weiter und damit ihre Spekulationen über außerirdische Lebewesen auf diesem Erdbegleiter. In seinem Buch De face in orbe lunae mutmaßt der griechische Priester Plutarch (46-120 n.Chr.), ob ein Leben auf dem Mond überhaupt möglich sei. Er kommt zu der Überzeugung, dass dies so sein müsste, weil sonst der Mond ohne Sinn und Zweck geschaffen worden sei, wenn er nicht Früchte wie ein irdisches Leben hervorbringt.
Dieses Buch von Plutarch scheint offensichtlich Auslöser für den ersten Raumfahrtroman Vera historia des griechischen Satirikers Lukian von Samosate (120-180 n.Chr.) in der Geschichte der Menschheit zu sein. Lukian erzählt in seinem Buch die fantastische Geschichte von einer Schiffsreise zum Mond, wohin er zusammen mit vielen weiteren Helden gelangt, als sein Schiff am Ende der Welt von einem mächtigen Orkan ergriffen wird. Dieser hebt das Schiff 3000 Stadien empor und das Schiff beginnt, in den Weltraum hinauszusegeln.
1.3 Die Horizonte öffnen sich: Vom Mittelalter bis zur Aufklärung
Mit dem 2. Jahrhundert erlosch der Glanz des griechischen Reiches und mit ihm die Fülle philosophischen Denkens. Vom aufkommenden Christentum wurde alles, was aus vorchristlicher Zeit kam, abgelehnt und als Ketzerei angesehen. Was sich als astronomische Erkenntnis der Griechen in die Spätantike und in das Mittelalter hinüberrettete, war einzig das geozentrische Weltbild des Apollonius von Perge (3.Jahrhundert v.Chr.) mit seiner Epizyklen-Theorie, die später von Claudius Ptolemäus (etwa 100-160 n.Chr.) in seinem mathematischen Werk Synthaxis mathematike durch seine Exzenter-Theorie erweitert wurde. Diesem geschlossenen Weltbild gab man dann auch dessen Namen, Ptolemäisches Weltbild.
Derweil gingen im aufkeimenden Christentum die revolutionierenden Ideen eines heliozentrischen Weltbildes verloren.
Der Vorstellung einer Vielzahl bewohnter Welten stand das ältere Christentum zunächst jedoch nicht ganz ablehnend gegenüber. Hier ist in erster Linie der Kirchenvater Origines (185-284 n.Chr.) zu nennen. Nach seiner Vorstellung sind nicht nur gleichzeitig viele Welten vorhanden, sondern auch vor und nach unserem Dasein gab und wird es eine unermessliche Zahl aufeinaderfolgender Weltensysteme geben:
„Wenn das Weltall einen Anfang hatte, was tat dann wohl Gott, ehe es entstand? Es ist ein ebenso gottloser wie törichter Gedanke, Gott sei träge oder untätig gewesen, oder es hätte eine Zeit gegeben, in der seine Güte keine Wesen gefunden hätte, an denen sie sich betätigen konnte, oder dass seine Allmacht sich hätte offenbaren können.“
Ihm folgend hebt der Heilige Athanasius (293-373) hervor, dass die Einheit Gottes keineswegs die Einheit der Welt beweise:
„Der, der Ursprung aller Dinge ist, sollte doch wohl auch andere Welten erschaffen können als die, die wir bewohnen.“
Doch das Ptolemäische Weltbild basierend auf den Aristotelischen Prinzipien wurde von der Kirche zur wahren Lehre erhoben und tatsächlich wurde die Wechselwirkung der Aristotelischen Gedanken mit denen der Theologie ein Eckpfeiler der Scholastik und der Philosophie des Mittelalters.
Doch etwas störte die Harmonie zwischen dem Aristotelischen Weltkonzept und kirchlicher Vorstellung eines allmächtigen Gottes. Wenn es in Gottes Macht stand, alles zu schaffen, was ihm notwendig erschien, wäre es dann angesichts der Allmacht Gottes angemessener, dass er viele Welten und nicht nur eine einzige geschaffen hätte? Diese Frage blieb tatsächlich über die folgenden Jahrhunderte ein Stachel im Fleisch des ansonsten perfekten Weltbildes der Kirche. Thomas von Aquin erkannte erstmals die Bedeutung dieser Frage. Analog zu Plato, sah Aquin jedoch die Perfektion der Schöpfung verwirklicht in der Einzigartigkeit unserer Welt. Die Größe des Schöpfungswerkes Gottes könne nur in einer Welt gewürdigt werden.
Die Antworten von Aquin waren allerdings den Hardlinern unter den Theologen, die die Größe Gottes mit vielen Welten gleichsetzten, ein Dorn im Auge. Im Jahre 1277, drei Jahre nach Aquins Tod, kam es zu einer kirchlichen Entscheidung, als sie 219 an Universitäten verbreitete Vorstellungen als häretisch verdammte, unter ihnen auch die von Aquin, „dass Gott nicht viele Welten schaffen konnte.“
Diese Verdammung hatte im nachhinein gesehen einen entscheidenden Einfluss auf das Denken und das Weltbild der folgenden Jahrhunderte. Sie änderte das Denkmilieu sowohl abrupt als auch nachhaltig. Sie wird heute von vielen Historikern als der Wendepunkt zum Übergang zur wissenschaftlichen Aufklärung betrachtet. Nachweislich fand danach eine kritische Beurteilung des aristotelischen Gedankengebäudes statt und im Zuge dessen eine Neubewertung alternativer griechischer Philosophen, wie der der Atomisten, und mit ihr eine zunehmende Akzeptanz vieler Welten.
Diese Zugeständnisse öffneten auch vom physikalischen Verständnis her die Tür zu einem ganz anderen Weltbild. Diese Gedanken hinterließen ihre Spuren im Denken der Gelehrten der folgenden Jahrhunderte.
Wie etwa bei dem deutschen Philosophen Nikolaus von Cues (1401- 1464). Getragen von seinen höchsten kirchlichen Würden, die er als katholischer Kardinal inne hatte, durfte er unangefochten Ansichten aussprechen, die im Gegensatz zum noch vorherrschenden kirchlichen Zeitgeist waren. Cues schloss, dass es nicht nur unendlich viele Welten geben müsse, sondern weil das Universum grenzenlos sei, es auch kein absolutes Zentrum besäße:
„Sein Zentrum ist überall und seine Grenzen nirgendwo.“
Bei dieser Vielzahl von Sonnen und Planeten hielt er allerdings die Erde für den nobelsten und perfektesten Himmelskörper.
Weil er allerdings zu seinem mittelpunktslosen Universum kein alternatives Weltbild anbieten konnte, blieb seine Idee ohne Resonanz. Zu radikal war seine Vorstellung. Der fällige Wandel musste sich in kleineren Schritten vollziehen. Es war Nikolaus Kopernikus (1473- 1543), dessen heliozentrisches Weltbild mit exakt kreisförmigen Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne nach fast 1800 Jahren mit
seinem Buch De revolutionibus orbium coelestium einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wurde. Da es nicht in die Weltanschauung der Kirche passte, wurde es von Rom 1616 auf die Liste der verbotenen Bücher gesetzt, wo es erst 1835 wieder bedingungslos verschwand.
Der Durchbruch des heliozentrischen Systems zum allgemein akzeptierten Weltbild vollzog sich erst durch die beiden Zeitgenossen Johannes Kepler (1571-1630) und Galileo Galilei (1564-1642). Kepler gelang es die geringen Abweichungen zwischen den kreisförmigen Planetenbewegungen des Kopernikanischen Weltbildes und den astronomischen Beobachtungen durch leicht elliptische Planetenbahnen zu erklären. Die Ergebnisse dieser neuen Himmelsmechanik in Form von drei Bahngesetzen (Keplersche Gesetze) veröffentlichte er in seinen Büchern Astronomia novea im Jahre 1609 und Harmonice mundi (1619).
Bis dahin basierten die Argumente für ein Universum, in dem die Erde nicht im Zentrum stand, nur auf mathematischer Einsicht; dies reichte nicht aus, um eine Mehrheit zu überzeugen. Das schaffte erst Galilei, der mit dem damals neu erfundenen Fernrohr die ersten Monde des Jupiter entdeckte. Diese Monde werden heute auch noch die Galileischen Monde genannt (Io, Europa, Callisto und Ganymed). Wenn es dort draußen also irgendwo Gestirne gab, die nicht um die Erde kreisten, dann lag es nahe, dass all die anderen Gestirne auch nicht zwingend die Erde umkreisten. Diese Öffnung des geistigen Horizonts durch die Jupitermonde zusammen mit den nachweislich elliptischen Bahnen der Planeten im heliozentrischen Weltsystem brachte schließlich dessen endgültige Anerkennung.
Angeregt durch die Mondflecken und Plutarchs Mutmaßungen über Leben auf dem Mond glaubte auch Kepler an Leben auf dem Mond:
„Ich nehme an, dass der Körper des Mondes von der Art der Erde ist, ein Globus, der Wasser und Land umfasst. Daher gibt es auf dem Mond Lebewesen mit sicherlich viel größeren Körpern und einer größeren Duldsamkeit als der unsrigen.“
Angestoßen durch die Entdeckung der Monde des Jupiters durch Galilei machte Kepler sich Gedanken über den Sinn deren Existenz:
„Wenn vier Monde des Jupiter in ungleichen Abständen und Umlaufzeiten umkreisen, dann muss man sich fragen, wem das wohl nützen mag, wenn es keine Wesen auf dem Jupiterballe gibt, die diesen wundersamen Wechsel mit ihren Augen schauen können.“
Also vermutete er genauso wie Galilei, dass der Jupiter bewohnt ist:
„Der Schluss ist offensichtlich. Unser Mond existiert für uns auf der Erde, nicht für die anderen Planeten. Jene vier kleinen Monde existieren für den Jupiter, nicht für uns. Und so hat jeder Planet mit seinen Bewohnern seine eigenen Monde. Aus dieser Begründung heraus schließen wir mit größter Sicherheit, dass der Jupiter bewohnt ist.“
Die Ursache, warum sich die Planeten genau nach den von ihm gefundenen Gesetzen bewegten, blieb ihm unklar, obwohl er sich durchaus Gedanken darüber machte. Erst der Engländer Isaac Newton fand 1687 mit dem Gravitationsgesetz in seinem Buch Philosophiae naturalis principia mathematica („Mathematische Grundlagen der Naturphilosophie“) die richtige Antwort darauf.
Das Kopernikanische Weltbild war aber selbst mit Keplers Präzisierung also noch nicht perfekt. Es war an dem dominikanischen Mönch Giordano Bruno (1548-1600), die fehlenden Mosaikstückchen zu ergänzen. So erkannte er ganz richtig, dass die Fixsterne leuchtende Sonnen gleich unserer Sonne seien, und lehnte das rotierende Himmelsgewölbe ab und verstand statt dessen die Drehung des Firmaments als eine Vorspiegelung, hervorgerufen durch Drehung der Erde um ihre eigene Achse. Für Bruno war das Universum unendlich groß. Er wiederholte im Sinne Nikolaus von Cues auch den denkwürdigen geistigen Schritt zu dem noch heute gültigen Weltbild, in dem die Sonne nicht im Zentrum des Universums stehe, weil das unendliche Universum eben keine Grenzen und somit auch kein Zentrum besäße:
„Haben nicht alle Planeten gleichen Rang innerhalb des mächtigen Sonnenbereichs? Sind sie nicht gleichartige Welten von einerlei Bestimmung? Und welchen Unterschied will man zwischen der Sonne und den übrigen Sternen machen? Das ganze Universum ist nur ein einziges ungeheures organisches Wesen, die verschiedenen Welten sind seine Glieder, und sein Lebensprinzip ist Gott.“
Mit der Unendlichkeit des Weltalls ging bei ihm ganz selbstverständlich die Vorstellung einher, die Sterne seien wie der Mond und die Planeten erdähnlich beschaffen, und sie trügen eine Vielzahl bewohnter Welten:
„Gott hat viele Sonnensysteme mit Planeten erschaffen, die alle Leben mit Seele tragen können. Daher gibt es nicht nur eine Welt, eine Erde, eine Sonne, sondern so viele Welten, wie wir Sternenlichter sehen!“
Diese Interpretation fand jedoch nicht die Zustimmung einer katholischen Kirche. Als Zeichen eines wieder zunehmenden kirchlichen Dogmatismus musste sich Bruno wegen seiner angeblich häretischen Äußerungen vor der römischen Inquisition verantworten, die ihn schließlich zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilte.
Der französische Priester Pierre Gassendi versuchte das Leben auf anderen Planeten unter strengeren wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu verstehen. In seinem Werk Sind die Sterne bewohnbar? schrieb er, dass die Bewohner anderer Planeten sich in ihrer Natur sehr stark von uns Menschen abweichen können:
„Die Sonne muss wohl als Wohnplatz der Erde und den anderen Planeten ebenso überlegen sein, wie sie sie an Größe und Erhabenheit übertrifft.“
Die Bewohner der Sonne müssen, so Gassendi,
„Wesen sein, die für jenes glühende und leuchtende Reich geschaffen sind. Für diese Verhältnisse ausgestattet, würden sie
vor Kälte vergehen, wenn man sie auf der Erde oder die anderen Planeten brächte.“
Gassendi wies also erstmals ausdrücklich auf die eventuell völlig andersartigen Formen von Leben hin, die in anderen Welten auftreten könnten. So ebnete Gassendi also die Wege des Denkens, weg vom Menschen als Krone der Schöpfung, hin zu anderen möglichen höheren Wesen in Gottes Schöpfung.
Ausgelöst durch die neuen Vorstellungen von Kopernikus, Kepler, Bruno, Galilei und Newton und zusammen mit der Erkenntnis Kopernikus, dass mit einem heliozentrischen Weltbild riesige Entfernungen zu den Planeten verbunden sind, fand eine Kehrtwendung im Denken des 17.Jahrhunderts über die Möglichkeiten entfernter bewohnter Welten und mögliche Reisen zu ihnen statt; und zusammen mit dem Beginn der exakten Wissenschaften öffnete sie den Fantasien neue Welten, die zum Erscheinen neuer Raumfahrtromane über entfernte bewohnte Welten führten.
1.4 Fantasie kennt keine Grenzen: Die Neuzeit
Den Auftakt bildete ein Buch aus dem Jahre 1634 mit dem Titel Somnium seu astronomia Lunaris, das von keinem geringeren als Kepler selbst stammte und an dem er bis zu seinem Tode arbeitet. Kepler versuchte in seinem Roman erstmals bekannte Tatbestände und sachliche Hypothesen einzubringen und nicht nur fantastische Geschichten zu erzählen. Die Fantasie eines bewohnten Mondes in Lukian Vera historia beflügelte aber auch weitere Schriftsteller. 1638 erschien das Buch The Man in The Moon: or a Discourne of a Voyage Thither des englischen Bischofs Francis Godwin. Ähnlich wie Kepler schildert er eine Flugreise zum Mond, wobei er sich aber über die Keplersche Erkenntnis, zwischen Erde und Mond befände sich keine Luft, freizügig hinwegsetzt und als Gefährt ein von Vöglein gezogenes Gerüst annimmt.
Der Wahrheit näher kam der französische Schriftsteller Cyrano de Bergerac in zwei Romanen aus den Jahren 1649 und 1652 (Histoire des Etats et Empires du Soleil).
- Arbeit zitieren
- Ansgar Almus (Autor:in), 2001, Lesesozialisation bei Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107109
Kostenlos Autor werden






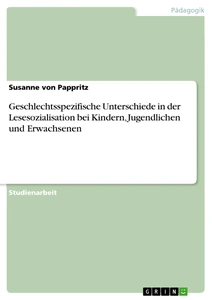





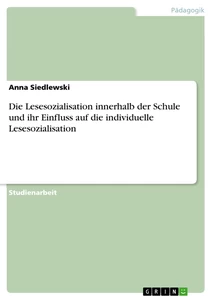









Kommentare