Leseprobe
STEPHAN PLATT
(Bei Verwendung des Textes - auch in Teilen - bitte ich um einen entsprechenden Hinweis in der Quellenangabe. Danke.)
Jean Piaget: Lernen als Entfaltung angeborener Möglichkeiten UdK Berlin, 2002
Die Lerntheorie, die Jean Piaget in die Diskussion brachte, befaßt sich in erster Linie mit der Entfaltung der Intelligenz1 [1 ]. Piaget fokussiert folglich auf die frühen und frühesten Jahre des Menschen, um dort Aspekte aufzuzeigen, die letztendlich auch das Denken des Erwachsenen verständlicher machen: Motivmuster oder Verhaltensformen, die bei Kindern beobachtbar sind, gälten auch für Erwachsene; Funktionen des Erkennens, die bei den Kleinen auftreten, fänden sich auch bei uns Großen wieder; aber trotz und gerade wegen alledem sei das Kind kein kleiner Erwachsener, sondern habe eben ganz eigene Bedürfnisse2 [2 ].
Piaget unterscheidet dabei die für jeden Menschen und jedes Alter konstante Funktion des Denkens von den entwicklungsspezifischen, variablen Strukturen. Motor dieser Entwicklung ist das Streben nach einem Gleichgewicht, das zu erreichen und zu sichern die ganze Aktivität des Menschen kennzeichnet; der Mechanismus dahinter ist die Anpassung mit ihren beiden Komponenten Assimilation und Akkomodation3 [3 ]. Deutlich wird der individuelle Entwicklungstand des Gleichgewichts am Grad der Reversibilität gleichgewichtssichernder Operationen und an deren zunehmender Organisiertheit4 [4 ].
Die Entwicklung des Denkens und ihrer intellektuellen Potentiale erfolgt in Schritten, die jeweils die innerpsychische Struktur des Individuums verändern. Piaget ordnet diese Entwicklungsschritte vier aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen zu, deren Übergänge fließend sind5 [5 ]:
In der ersten, Phase (Säugling und Kleinstkind bis zu zwei Jahren) koordinieren sich
- Reflexe, angeborene Reaktionen und damit verbunden Aktivitäten zu
- Wahrnehmungen und Gewohnheiten und führen schließlich zu der sogenannten
- sensomotorischen oder praktischen Intelligenz.
In der zweiten Phase (Kleinkind von zwei bis sieben Jahren) entwickelt sich die praktische Intelligenz durch die zunehmende Verinnerlichung der Wahrnehmungen weiter zu der präoperationalen6 [6 ] oder
- intuitiven Intelligenz.
In der dritten Phase (Kind zwischen sieben und etwa zwölf Jahren) werden konkrete intellektuelle und insbesondere logische Operationen möglich, die allerdings noch stark objektbezogen sind; Piaget bezeichnet diese Phase der Entwicklung sprachlicher Begriffe als Phase der konkretoperationalen oder
- begrifflichen Intelligenz.
Die vierte Phase schließlich (Adoleszenz) ist die Phase des formalen Denkens, das sich durch das sich vollständig mögliche Lösen vom Konkreten auszeichnet; der erreichte und zunehmende Abstraktionsgrad von Operationen erlaubt deduktiv-hypothetisches Denken. Die ist die Phase der formaloperationalen, gnostisch-überlegenden oder der
- erkennenden Intelligenz.
Piaget dokumentiert anhand zahlreicher Beispiele, wie sich im Verlauf dieser vier Phasen die Verlagerung vom konkreten Handeln auf die Ebene des Denkens vollzieht, ab wann und wie beispielsweise Beziehungen sukzessive erfaßt werden, wie Raum, Zeit, Klassen, Gruppen, Seriationen usw. sich ausbilden und zunehmend interferieren oder wie dabei immer deutlicher Kausalitäten und Optionen bewußt und Widersprüche über Synthese verschiedener Aspekte zielgerichtet aufgelöst werden können7 [7 ]. Er zeigt, wie aus dem gegenständlichen Erleben zunächst eine geistige Erfahrung wird, die mit einem Bewußtwerden der Wirklichkeit einhergeht - und wie sich die geistige Erfahrung schließlich zur logischen Erfahrung weiterentwickelt, die es ermöglicht, die Mechanismen der Wirklichkeitskonstruktion zu erkennen und zu nutzen8 [8 ].
Im folgenden möchte ich einige Aspekte dieser Entwicklung skizzieren:
? Zu Beginn der ersten Phase ist das gesamte Erleben noch auf die vererbten Strukturen angewiesen, auf Basis derer der Mensch auf die Welt »zugeht«. Dieses Zugehen auf die Welt bezeichnet Piaget als Anpassung der inneren Strukturen an das Außen, als »Akkomodation« des Organismus an eine bestimmte Situation9 [9 ]. Zu dieser einen Richtung des Prozesses gehört untrennbar ihre Gegenrichtung, die »Assimilation«10 [10 ]: Assimilation bezeichnet das Auf- und Wahrnehmen der Welt sowie die Anbindung dieser Wahrnehmungen an die inneren Strukturen. Durch Assimilation verändern sich die Strukturen, was eine erneute Akkomodation nach sich zieht - der Entwicklungsprozeß hat begonnen.
Der Verlauf der ersten Phase ist gekennzeichnet durch konkret physisches Erleben und durch die sensomotorischen Erfahrungen, die dabei gemacht werden. Auch wenn diese materiell ausgerichteten Erfahrungen sich immer besser koordinieren und sich dabei zu - noch unbewußten - Routinen zusammensetzen, bleiben Innen und Außen in der Wahrnehmung faktisch synonym und nicht unterscheidbar. Piaget bezeichnet den resultierenden maximalen Glauben an die eigenen Ideen und Potenzen als Egozentrismus11 [11 ]. Sämtliche Handlungen, die in dieser Phase über Anpassung erlernt werden, laufen in relativ festen Bahnen ab und sind weder in Teilen noch gesamt reversibel.
? Während der zweiten Phase bleibt der Egozentrismus voll ausgeprägt; aus ihm ergibt sich u.a. der intellektuelle Realismus, nach dem die Dinge als so, wie sie sind, und nur so, wie sie sind, wahrgenommen werden. So ist es relativ bald möglich, insbesondere figürliche Ähnlichkeiten von Gegenständen zu erkennen; aber Unterschiede an Dingen auszumachen und damit Klassen zu bilden, wird erst deutlich später möglich. Damit verbunden ist auch die Qualität von Begriffen, mit denen die Welt beschrieben wird: Solange es die inneren Strukturen noch nicht erlauben, Relationen zu verstehen (sprich: solange keine Strukturen ausgebildet sind, an die Relationsaspekte assimiliert werden können), solange sind nur beschreibende Prädikatsurteile, nicht aber Beziehungsurteile möglich12 [12 ].
Die enge Weltsicht13 [13 ] stößt natürlich relativ schnell an ihre Grenzen - und stört damit das bis zu diesem Zeitpunkt erarbeitete Gleichgewicht: Piaget konstatiert ein grundlegendes soziales Bedürfnis, am Denken anderer teilzunehmen, das eigene möglichst überzeugend darzulegen und dabei Sachverhalte zu verifizieren14 [14 ] (und deutet damit bereits an, daß es ein Streben nach einem großen, übergeordneten und möglichst allumfassenden Gleichgewicht gibt, das letztendlich Motor allen Denkens und Handeln ist15 [15 ]).
Dieses Bedürfnis erhält seine Ausdrucksmöglichkeit durch das Erlernen von Sprache. Dabei geschieht zweierlei: Zum einen werden auf sprachlicher Ebene die Aktivitäten bewußt16 [16 ]; und zum anderen können die Bewußtseinsinhalte kommuniziert und mit denen anderer ausgetauscht werden. Die Differenzen, die dabei deutlich werden, führend dann fast zwangsläufig zu einer Änderung der inneren Strukturen mit dem Ziel der Wiederherstellung der Homöostase (Piaget hat diesen andauernden Prozeß als Äquilibrierung bezeichnet17 [17 ]).
Damit verbunden ist eine beginnende qualitative Änderung des Handlungsrahmens: Einige wenige Handlungsmomente können sukzessive und partiell rückgängig gemacht werden. Da dies allerdings noch auf einer Ebene geschieht, die unmittelbar mit den Dingen und ihren äußeren Formen verknüpft ist und auf der Wahrnehmungen und Bewegungen als einfache Vorstellungsbilder verinnerlicht sind, spricht Piaget dabei von Intuition und noch nicht von freien logischen Operationen18 [18 ].
? Mit Phase drei löst sich der Egozentrismus im Denken und damit verbunden der Mangel an Unterscheidung zwischen Innen und Außen auf (was ein neues Ungleichgewicht bedeutet). Die Strukturen verändern sich dahingehend, daß relationales Handeln und Denken möglich und zunächst im konkreten Tun, dann auch sprachlich zum Ausdruck gebracht werden können und sich die Möglichkeit zur interpersonalen Kooperation eröffnet. Aus bloßen Handlungen werden logische Operationen, die zunehmend reversibel sind sowie verknüpft oder zusammengesetzt werden können, bis schließlich komplexe Operationssysteme entstehen.
Zwar sind die Operationen dieser Phase ansatzweise noch dem Gegenständlich- Konkreten verhaftet und demnach noch nicht als formal zu bezeichnen; dennoch tragen sie als logische Operationen bereits einen Ganzheits- oder Totalitätsanspruch in sich: Innerhalb des Intellekts bedarf es für jede Operation einer ihr genau entgegengesetzten, durch die sie aufgehoben werden kann19 [19 ]. Mit den durchaus mathematisch gemeinten Vorstellungen des inversen Gegenstücks, der Reziprozität und der Negation20 [20 ] sind der nächste Ungleichgewichtszustand und daraus resultierende Entwicklungsschritt im Grunde bereitsvorprogrammiert: Operationen, die noch nicht voll reversibel sind oder über keine Opponente verfügen, drängen über Assimilation und Akkomodation nach Ergänzung zu einem Ganzen.
? Dies geschieht in der vierten Phase: Hier liegen im Menschen nicht nur sich vervollständigende Denk- und Handlungssysteme vor, sondern es erwächst für ihn die Möglichkeit, zielgerichtet eigene, vom Realen gelöste Systeme zu entwickeln21 [21 ]: Das Denken wird abstrakt. Das gesamte Operationsspektrum ist erschlossen - von sensomotorisch über konkret bis rein formal. Und zum Prädikats- und Beziehungsurteil stellen sich die Möglich- und Notwendigkeit des Entscheidungsurteils22 [22 ].
Phase vier ist der Zeitpunkt, an dem das eigentliche Gleichgewicht sich beginnt herauszubilden, das als hochdynamisches, flexibles Kompensationssystem Störungen von innen und außen ausgleicht und das Ziel aller Entwicklung war und ist. Dieses Gleichgewicht ist ein stabiler, keinesfalls aber ruhender Zustand: Das Individuum, das sich im Gleichgewicht befindet, ist unablässig damit »beschäftigt«, tatsächliche und potentielle Irritationen konkret oder antizipatorisch auszugleichen - ein Zustand andauernder, lebhafter (bewußter und unbewußter) Aktivität23 [23 ].
Wenn Piaget darauf verweist, daß in der Sprache die für die Entwicklung so wesentliche Möglichkeit zur Kommunikation begründet liegt, so unterstreicht er gleichzeitig mit Nachdruck, daß es dennoch nicht die Sprache ist, die Entwicklungen ex nihilo hervorbringt24 [24 ]. Diese würden sich im Gegenteil unabhängig davon herausbilden, ja müssen es sogar: Würden nicht im präverbalen Bereich entsprechende Strukturvorbereitungen über Assimilation und Akkomodation erfolgreich stattgefunden haben, könnten nachfolgendenOperationen nicht gelernt und ausgeführt werden (Zählen lernt man zunächst auf der konkreten, dann erst auf der gedanklichen Ebene - sozusagen erst mit Äpfeln, dann mit Zahlen).
Sprache erleichtert die Anwendung und Koordination der genetischen Fakten, reicht aber nicht aus, das Denken zu erklären. Sie ist notwendige Bedingung, nicht aber hinreichende Begründung für die Entstehung der Logik. Und sie handhabt kollektive Begriffe und Erkenntnisse, die das individuelle Denken unterstützen25 [25 ]. Dabei wandelt sich Sprache vom Signal (als bloßer Stimulus) zum Symbol, bei dem Bedeutungsträger und -inhalt unterschieden werden können26 [26 ], und in dieser Funktion verbleibt sie so lange, bis sich die Fähigkeit zum abstrakten Denken ausgebildet hat: Erst auf der Ebene der formalen Operationen wird sie zum echten intellektuellen Werkzeug, zum Nährstoff der Intelligenz27 [27 ].
Gerade die Unterscheidung von symbolischen und formaloperativen Aspekten hat Bedeutung: So muß hinsichtlich des Lernens genau differenziert werden, ob das Wissen, das jemand über einen Gegenstand hat, ein rein figürliches ist (ob also Dinge, Begriffe etc. nur hinsichtlich ihres symbolischen Anteils wahrgenommen wurden) und als statisches Wissen vorliegt - oder eben ob die Bedeutung erfaßt und abstrakt, vom Bedeutungsträger losgelöst und damit flexibel als operatives Wissen verfügbar ist28 [28 ]. Ein in diesem Sinne echtes Lernen mit dauerhaften Ergebnissen ist also niemals eine Abbildung oder bloße Objektkopie und erst recht nicht passive Reaktion auf eine wie auch immer geartete Umwelt, sondern stets Austausch und Interaktion, Assimilation und Akkomodation29 [29 ].
Um so wichtiger ist also eine Erziehung zur Aktivität: Nicht Lernen und Schreiben im Sinne von Pauken, sondern strukturgebendes, kooperatives Handeln in der Sozialgemeinschaft und das Prinzip des »Self Government« sind entscheidend, um ein Maximum der Potentiale entfalten zu können30 [30 ].
Wenn sich das menschliche Denken auf nacheinander erreichbaren Gleichgewichtsebenen von den frühesten Reflexen über einfache Handlungen bis hin zu formalen Operationen entwickelt, dann ist Piagets Hinweis, daß letztendlich alle Aktivitäten, das angeborene wie das erworbene Wissen auf einen kleinsten gemeinsamen, nämlich den genetischen Nenner zurückzuführen sind, nur folgerichtig31 [31 ].
Da Piaget den Menschen aber nicht als Sklave seiner Determiniertheit begreift, sondern im Gegenteil als ein zum eigenen Denken und individueller Entwicklung befähigtes Geschöpf, macht er deutlich, daß die Entwicklung trotz aller Linearität und Verbindlichkeit menschlicher Reifungsprozesse kein Automatismus ist: Die Entwicklung führt zwar zum Aufbau eines unerhört großen und vielfältigen Repertoires an Potentialen, aber eben nicht zu dessen mehr oder weniger feststehender Realisierung. Sie ist abhängig auch von inneren und äußeren Faktoren, die jenseits von Reifung und Angeborensein liegen: Piaget spricht vom physischen und sozialen Milieu, von der direkten Erfahrung und der sozialen Übermittlung, allerdings ohne diese Punkte im Detail auszubauen32 [32 ].
Fazit
Jean Piaget zeigt, daß die Entwicklung des Denkens ein linearer Prozeß ist, bei dem sich die Weltsicht und Handlungsmöglichkeiten des Menschen Schritt für Schritt erweitern, und bei dem die relativ sichere Beherrschung eines »Niveaus« (Stichwort: Gleichgewicht) Voraussetzung für das Betreten des nächst höheren ist. Dabei gehen die Fähigkeiten des Vorniveaus nicht verloren, sondern reichern sich an: Die Verbindung der operationalen Strukturen bis zu ihren sensomotorischen Wurzeln und dort den kleinsten gemeinsamen genetischen Nennern Reflex und angeborenes Verhalten bleibt erhalten.
Der Sprache kommt keine initiative oder gar determinierende Rolle zu: sie ist entwicklungsbegleitender Faktor, der erst im abstrakten Denken Werkzeugcharakter erhält. Der Aspekt des individuellen Sinns, der für Leontjew ja ganz wesentlich ist33 [33 ], spielt für Piaget keine wesentliche Rolle: Sinnvoll ist, was dem Äquilibrierungsprozeß dient, was im Rahmen von Assimilation und Akkomodation verwendbar, »verwertbar« ist. Auch der für Lernprozesse so wichtige Begriff der Motivation ist untrennbar mit innerindividuellen Strukturen verbunden: Objekte wirken nur dann motivierend oder interessant, wenn sie Anlaß zur Anwendung und Differenzierung von Strukturen bieten34 [34 ]; anders gesagt: Interessant und motivierend ist nur, was assimiliert werden kann - und nur, was assimilierbar ist, kann gelernt werden35 [35 ].
Fraglich ist, ob der Ansatz des Gleichgewichts letztendlich nicht so global oder allgemein ist, daß er beliebig wird: Für jedwede Art menschlicher Aktivität läßt sich ein Äquilibrierungsprozeß postulieren bzw. unterstellen. Wenn ich Tennis spiele oder ins Kino gehe, mag das auf einen Gleichgewichtszustand des Spaßfaktors hinzielen. Wenn ich im Lotto gewinne und mich freue, dann mag auch das ein bloßes Wiederherstellen eines durch die gute Nachricht aus der Balance geratenen emotionalen Gleichgewichts sein. Aber was, wenn ich mich verliebe? Geschieht dies wirklich nur, weil ich unbewußt oder gar bewußt versuche, irgendein seelisches oder »hormonelles« Gleichgewicht wieder herzustellen?
Unabhängig davon würde ich den Ansatz wie folgt skizzieren: Im Zentrum steht der Organismus, darum die sich entwickelnden Handlungsräume.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ich stimme Furth in seiner Interpretation zu, daß nach Piaget Wissen und Strukturschemata weitestgehend gleichzusetzen sind36 [36 ]: Über Assimilation wird Information (das Außen) zur akkomodierbaren Struktur, zum abstrakt verwendbaren Wissen (formale Operation im Innen).
Daraus ergeben sich für die Aufbereitung von Informationen, von »Lehrstoff«, natürlich Konsequenzen: Informationen müssen so aufbereitet sein und präsentiert werden, daß sie zur strukturellen Entwicklungsebene tatsächlich passen. Das wiederum setzt einerseits eine möglichst genau Kenntnis der momentanen Situation des Individuums und ein sich anschließendes darauf Eingehen voraus - ein Ideal, das in mindestens dreierlei Hinsicht behindert wird:
- Erstens sind bis zu einem gewissen Alter weder die formale Operationalität noch die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten voll entwickelt, so daß eine Einschätzung der tatsächlicher Situation in Teilen stets ein »good guess« bzw. ein gemittelter Erfahrungswert sein wird und muß.
- Zweitens wird die Unschärfe eines solchen Mittelwerts noch weiter eingetrübt durch die Tatsache, daß Lehr-Lern-Konstellationen in den seltensten Fällen One-to-One-Kommunikation, sondern meist Gruppenprozesse sind. Von daher wird also ein weiterer Kompromiß zu schließen sein hinsichtlich der Informationsangebote und der Passung auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner der Gruppe.
- Drittens verlieren solche Kompromisse natürlich weiter an Qualität, je weniger die spezifischen Entwicklungssituationen und Anpassungsstadien kontrolliert werden können und je stärker die Individuation des Einzelnen fortgeschritten ist.
Nun sind aber jenseits einer akademisch-idealen Lernsituation Fremdeinflüsse und Störgrößen ebenso selbstverständlich an der Tagesordnung wie spezifische persönliche Momente (zum Beispiel Vorwissen, Erfahrungen, Lernhilfen, Medienkenntnisse oder und natürlich Tagesverfassung, Interessen und Begabungen). Weiter bestehen gerade solche individuellen Varianzen ja nicht nur hinsichtlich eines allgemeinen Entwicklungsstandes, sondern auch themenspezifisch unterschiedliche Gradationen der Breite und der Reversibilität von Operationen (ganz zu schweigen von subjektiven Präferenzen hinsichtlich der Art der Informationsvorhaltung, wie beispielweise die Einstellung bezüglich rationaler und emotionaler oder darstellender und experimenteller Präsentationsformen). Kurz und gut:
Wenn die Linearität der kognitiven Entwicklung auf Lehr-Lern-Arrangements angewendet werden soll, dann kann solchen multifaktoriellen Situationen im Grunde nur mit einem möglichst vielschichtigen Informationsangebot begegnet werden: Jedem Teilnehmer muß ein weit aufgefächertes und zugleich reich facettiertes Arrangement dargeboten werden, damit Assimilation und Akkomodation möglichst effizient verlaufen.
Damit zeichnet sich ein Problem ab: Mit der Zunahme der verfügbaren und zu vermittelnden Daten, Fähig- und Fertigkeiten, durch die ja die heutige Informationsgesellschaft gekennzeichnet ist, wächst der Aufwand für eine adäquate Vorhaltung geradezu exponentiell. Was aber wäre, wenn Information neutral vorläge und von Individuum selbst gemäß seiner Situation, Vorstrukturierung, Neigung etc. frei konfigurierbar wäre? Würde dies nicht der von Piaget geforderten »aktiven Schule« voll und ganz entsprechen?
Die genetische Erkenntnistheorie gibt darauf keine Antwort.
[...]
1 [1 ] Wetzel weist darauf hin, daß Piaget die Begriffe Denken, Erkennen und Intelligenz weitestgehend synonym verwendet. Vgl. Wetzel, Fred: Kognitive Psychologie. Weinheim 1980, S. 17
2 [2 ] Vgl. Piaget, J.: Urteil und Denkprozeß des Kindes. Düsseldorf 1972, 200 ff
3 [3 ] Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 156 ff
4 [4 ] Vgl. Buggle, F.: Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets. Stuttgart 1997, S. 27 ff
5 [5 ] Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 189 ff
6 [6 ] Die Termini »präoperational« und nachfolgend »konkret- und formaloperational« fand ich der Furthschen Übersicht der Entwicklungsphasen. Vgl. Furth, H. G.: Piaget für Lehrer. Düsseldorf 1973, S. 48
7 [7 ] Anm.: Die von Piaget herausgearbeiteten Alters-Cluster haben sich als idealtypisch herausgestellt: Der Zeitpunkt des Auftretens von Entwicklungsschritten setzt heute deutlich früher ein; und die operationalen Leistungen, die auf der jeweiligen Stufe erbracht werden, sind nicht als so ausschließlic h anzunehmen, wie dies Piaget noch vertrat. Vgl. Buggle, F.: Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets. Stuttgart 1997, S. 112 ff
8 [8 ] Vgl. Piaget, J.: Urteil und Denkprozeß des Kindes. Düsseldorf 1972, S. 233
9 [9 ] Vgl. Furth, H. G.: Piaget für Lehrer. Düsseldorf 1973, S. 189
10 10 Vgl. Furth, H. G.: Piaget für Lehrer. Düsseldorf 1973, S. 190
11 11 Vgl. Piaget, J.: Urteil und Denkprozeß des Kindes. Düsseldorf 1972, S. 200 ff.
12 12 Vgl. Piaget, J.: Urteil und Denkprozeß des Kindes. Düsseldorf 1972, S. 215 ff
13 13 Piaget sprich von »Enge des Aufmerksamkeitsfeldes«. Vgl. Piaget, J.: Urteil und Denkprozeß des Kindes. Düsseldorf 1972, S. 217 ff
14 14 Vgl. Piaget, J.: Urteil und Denkprozeß des Kindes. Düsseldorf 1972, S. 202 und 205 ff
15 15 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 281 ff
16 16 Piaget bezeichnet dies als zunehmende Verlagerung des Handelns ins Denken und weist darauf hin, daß alle Probleme und Schwierigkeiten, die auf der Handlungsebene bereits durchlaufen wurden, auf der gedanklichen Ebene nochmals abgearbeitet werden müssen. Vgl. Piaget, J.: Urteil und Denkprozeß des Kindes. Düsseldorf 1972, S. 213 ff
17 17 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 156
18 18 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 214 ff
19 19 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 302 ff
20 20 Vgl. Buggle, F.: Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets. Stuttgart 1997, 97 ff
21 21 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 247 ff
22 22 Vgl. Piaget, J.: Urteil und Denkprozeß des Kindes. Düsseldorf 1972, S. 233
23 23 Vgl. Buggle, F.: Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets. Stuttgart 1997, S. 37 ff
24 24 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 276 ff
25 25 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 206 ff
26 26 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 263 ff
27 27 Vgl. Furth, H. G.: Piaget für Lehrer. Düsseldorf 1973, S. 76 ff
28 28 Vgl. Furth, H. G.: Piaget für Lehrer. Düsseldorf 1973, S. 61 ff
29 29 Vgl. Wetzel, Fred: Kognitive Psychologie. Weinheim 1980, S. 149 ff
30 30 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 176 ff
31 31 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 297 ff
32 32 Vgl. Piaget, J.: Theorien und Methoden der modernen Erziehung. München 1972, S. 302 ff
33 33 Vgl. Leontjew, A. N.: Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit. Berlin 1979, S. 261 ff
34 34 Unter diesem Vorzeichen kann dann folgerichtig alles motivierend sein, was die Bedingung von Assimilation und Akkomodation erfüllt: Wetzel weist darauf hin, daß es so viele Motivationen wie Assimilationsschemata gibt. Vgl. Wetzel, Fred: Kognitive Psychologie. Weinheim 1980, S. 63
35 35 Vgl. Wetzel, Fred: Kognitive Psychologie. Weinheim 1980, S. 60 ff
36 36 Vgl. Furth, H. G.: Piaget für Lehrer. Düsseldorf 1973, S. 30 ff
- Arbeit zitieren
- Stephan Platt (Autor:in), 2002, Jean Piaget: Lernen als Entfaltung angeborener Möglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107020
Kostenlos Autor werden
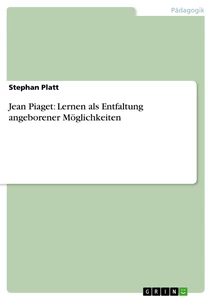








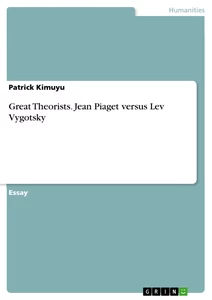



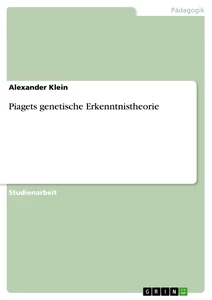






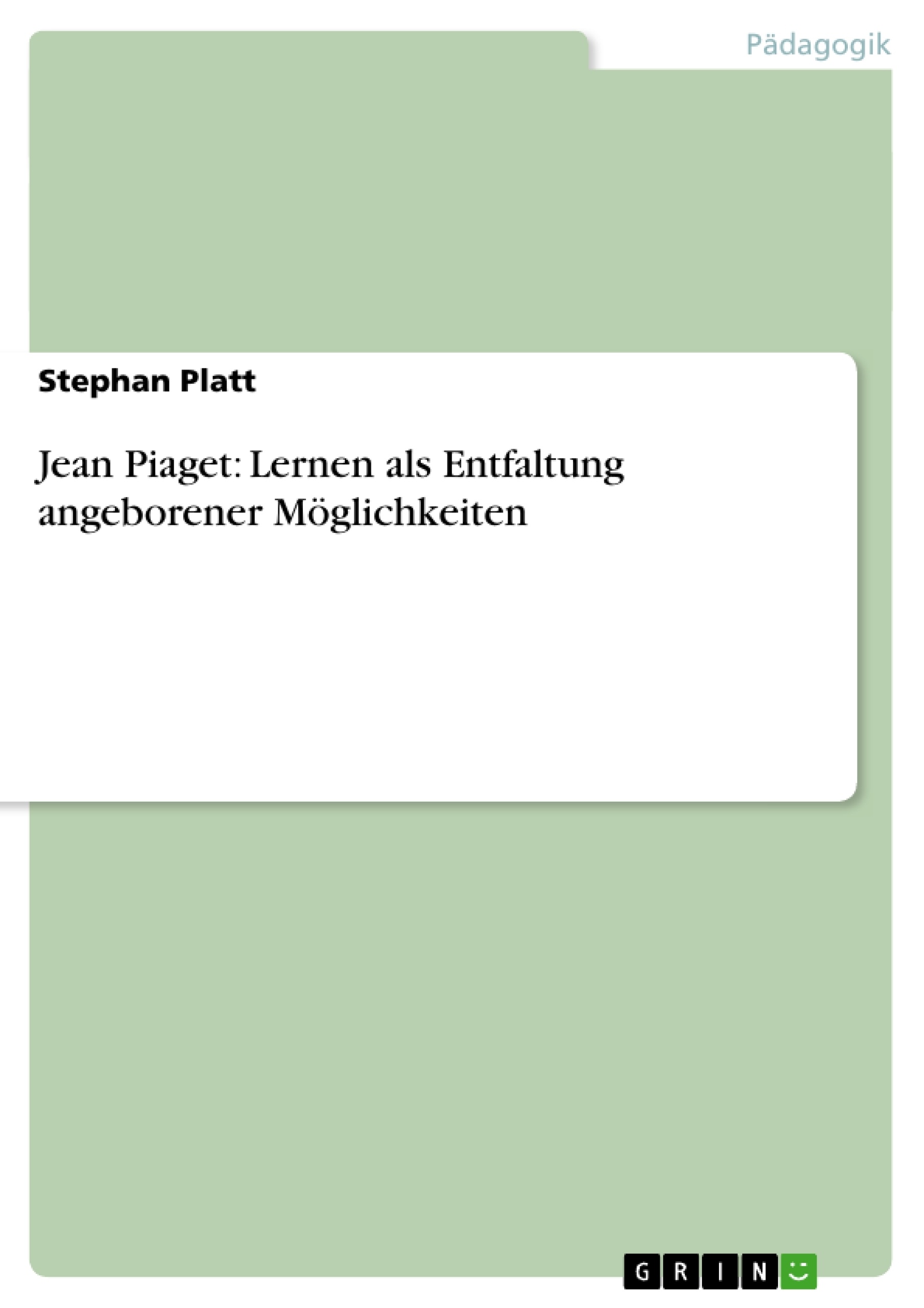

Kommentare