Leseprobe
1. Kapitel
Der Engel schwebte über die weiten Kontinente und unendlichen Meere. Wieder auf der Suche nach einem ihm zum Schutze Anbefohlenen war er. Seit nunmehr vierhundertvierundsechzig Jahren zog er still und in immer währender Gleichmäßigkeit seine Bahn. Auch er gehörte zum Korps der himmlischen Heerscharen.
Obwohl sie allesamt dem Herrn unterstellt waren, besaßen sie doch eine große Ermessensfreiheit. Diese Boten Gottes wurden nie älter und lebten ewig. Sie wurden nicht geboren, sondern waren schon seit unendlichen Zeiten existent. Weder weiblich noch männlich waren sie, sondern übernatürliche, geschlechtslose Wesen. Sie brauchten keine Luft und keine Liebe. Keine Namen besaßen sie. Nur die Manager unter den Engeln hatten solche. Da gab es die übermächtige Dreifaltigkeit der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Das waren die Chefs. Weiterhin gab es die sechsflügligen Cherubim und die vierflügligen Seraphim. Obwohl sie mehr Schwingen hatten und aufgrund dessen schneller hätten fliegen können als die gewöhnlichen Engel, waren sie doch nur dazu da, am Throne Gottes zu stehen und den Herrn immerfort zu lobpreisen. In der himmlischen Hierarchie standen sie unmittelbar unter der Dreiheit der Erzengel und waren diesen fast ebenbürtig.
Luzifer, der ehemalige Bote Gottes, der einst strahlendste aller Engel, war entlassen worden, weil er angefangen hatte selbstständig zu denken. Aber auch er musste sich dem ewigen Gesetz beugen, das da lautete, dass der Hochmut vor dem Fall käme. Er leitete jetzt seine eigene Entsorgungsfabrik. Der armen Seelen, die eine Todsünde begangen hatten und diese nicht mehr rechtzeitig bereuen konnten, nahm er sich an. Anfänglich heizte er die satanischen Öfen mit Koks. Später stieg er auf Öl um. Neuerdings bediente er sich der Kernenergie. Der Hölle stand er vor, die sich tief im Inneren der Erde befand und versuchte, so gut es ging den Betrieb aufrechtzuerhalten. Im Laufe der Jahrtausende bekam er immer mehr zu tun, denn die Zahl der Verdammten stieg unaufhörlich. Nach jedem Krieg musste er wieder Hilfsteufel, die auf Abruf bereitstanden, anfordern, damit die anfallende Arbeit bewältigt werden konnte. Wenn es einmal zu heiß wurde, aktivierte er einen Vulkan und ließ den überschüssigen Dampf entweichen. Außergewöhnlich gute Kunden waren in letzter Zeit die vermeintlichen Friedensstifter jener Völkerorganisation, die in New York ihren Hauptsitz hatte. Sie stellten das größte Kontingent der Verdammten, denn sie zogen die bewaffneten Auseinandersetzungen unnötig in die Länge, weil ihnen die Darwin’sche Lehre scheinbar unbekannt war. Ab und zu hatten Luzifer und seine Mannen so viel zu tun, dass sie sich wünschten im Himmel geblieben zu sein, denn dann hätten sie ein ruhigeres und beschaulicheres Dasein führen können.
Seit längerem schon trug Luzifer sich mit dem revolutionären Gedanken, das ganze höllische System zu reorganisieren und die gesamte Unterwelt, einschließlich des Furcht erregenden, aber treuen Wachhundes Zerberus in die Unendlichkeit des Weltalls umzusiedeln. Das arbeitsintensive Heizen wäre dann auch nicht mehr vonnöten, da es Sonnenenergie im Überfluss gäbe. Mit den Boten des Allgütigen würde es zu keinem Konflikt kommen, da diese völlig andere Aufgaben als der Diabolus hatten.
Manchmal kam es vor, dass die himmlischen Engel mehr als tausend Jahre frohlockend umherschwebten, bevor sie sich wieder eines Schützlings annahmen. Im Gegensatz zu Luzifer waren diese glücklichen Boten des Allmächtigen keinem allzu hohen Arbeitsdruck ausgesetzt.
Der Engel, um den es sich hier handelte, hatte als letzten Schützling den etwas ungestümen Albrecht. Dieser war am dreihundertachtundzwanzigsten Tag, an einem Samstag, Anno Domini MCDXIV, im sächsisch-anhaltinischen Tangermünde geboren worden.
Mit ihm hatte der Engel große Schwierigkeiten gehabt, denn Albrecht war sehr eigensinnig. Aber der Engel war ihm wohlgesonnen, legte Fürsprache für ihn ein und beschützte ihn mehr als siebzig Jahre. Am siebzigsten Tag, auch wieder an einem Samstag, Anno Domini MCDLXXXVI, begleitete er ihn, von Frankfurt am Main, zum Herrn. Während seines langen Lebens hatte Albrecht oft blutige Kriege geführt und mithilfe seines Engels neunzehn gesunde Kinder gezeugt. Er liebte das Essen und Trinken sehr. Der Engel hatte ihn gut geleitet und kehrte wieder, nach so vielen Jahren, in das alte Europa zurück. In den vierhundertvierundsechzig Jahren hatte sich nichts Wesentliches verändert. Die menschliche Natur war gleich geblieben. Aus der Sicht des Engels, mit seiner unendlich langen Erfahrung und dem kompletten Überblick, war also alles beim Alten geblieben. Beladen mit ihren Ängsten und erfüllt von ihren Sehnsüchten, zogen die Menschen weiter durch dieses Jammertal, das sie Erde nannten. Unentwegt hofften sie, wie schon so viele Generationen vor ihnen, dass es einmal besser werden würde.
Den Engel führte die Reise erneut nach Deutschland. Auch diesmal sollte sein zukünftiger Schützling ein Knabe sein. Bei einer Bauernfamilie ließ er sich am siebzigsten Tage, wiederum an einem Samstag, Anno Domini MCML, nieder. Ein kalter Tag war es mit leichtem Schneegestöber. Zwei Kinder gebar die Bäuerin kurz vor Mitternacht: Sebastian und dessen Zwillingsbruder, der als erster das Licht der Welt erblicken sollte, auf dass er dem Jüngeren den Weg bahne. Des kleinen und schwächlicheren Sebastians nahm sich der Engel an. Ab jetzt sollte er dessen Leben beobachten, führen und begleiten. Von alledem wusste Sebastian nichts. Außer dem Zwillingsbruder, seinem Alter Ego während der Fetalphase und in der frühen Kindheit, hatte er noch drei ältere Brüder.
Katholisch getauft wurden die Zwillinge bereits nach einundsechzig Stunden in der Reihenfolge ihrer Geburt, damit der Schwächere dem Vorbild des Stärkeren folgen könne. Einige Wochen später schon übernahm die Großmutter die Erziehung des Jüngeren der beiden. Sie wohnte auch auf dem Bauernhof und war die Mutter von Sebastians Vater. Zwischen ihnen gab es nur einen stark reduzierten Kontakt und daher auch keine Streitigkeiten.
Sebastians Mutter hatte auf den Hof eingeheiratet und deswegen keinen großen Einfluss. Diesem uralten, ungeschriebenen Gesetz, das da lautete, ora et labora, bete und arbeite, aber sei vor allem dem Manne und der Schwiegermutter untertan, hatte auch sie sich in Demut zu beugen. Die einzige Möglichkeit, die sich ihr in dieser ausweglosen Situation darbot, ergriff sie und zog sich in die Passivität zurück.
Dies sah der Engel und ließ es so. Zehn Jahre sollte es währen. Noch viele Tanten und Onkel hatte Sebastian, die ihn aber nicht sonderlich interessierten. Die wichtigste Bezugsperson für ihn war die Großmutter. Schon siebzig war sie zurzeit seiner Geburt. Außerdem hatte sie rotes Haar und war korpulent. Alle Zähne waren ihr schon ausgefallen. Aus diesem Grunde besaß sie ein Gebiss, das sie aber nur äußerst selten trug, da es nicht richtig passte. Meistens lag es im Schrank. Dort wurde es in einem Glas aufgehoben und nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt. Wenn die Großmutter es dann vorsichtig in den Mund hineinschob, dauerte es immer ein Weilchen, bis es an die richtige Stelle gekommen war. Mitunter tat sie sich sehr schwer damit, da ihr die notwendige Routine offensichtlich fehlte. Der Versuch dann den Mund zu schließen gelang ihr sogar mit einiger Mühe noch. Zusammenkneifen aber konnte sie die Lippen nicht mehr, selbst wenn sie sich dabei kräftig angestrengt hätte. Dafür waren die Zähne zu groß. Die untere Partie ihres Gesichtes, deren Konturen sich durch das Gebiss leicht veränderten, empfand Sebastian immer als etwas Lustiges, da alles so auffallend nach vorne gewölbt aussah.
Manchmal musste die Großmutter selbst darüber lachen, wenn sie sich im Spiegel betrachtete und mit leichtem Entsetzen feststellte, dass ihre Lippen kaum die falschen Zähne verbergen konnten. Außer ästhetischen gab es auch noch praktische Gründe das Gebiss so wenig wie möglich zu tragen. Ihre Artikulation wurde undeutlicher und manchmal fing sie an zu lispeln. Mitunter war es für Sebastian dann schwer sie zu verstehen. Aufgrund dieser unerwünschten Begleiterscheinungen kam es dazu, dass sie die künstlichen Zähne immer seltener benutzte, obwohl sie diesen ungeliebten Zahnersatz doch noch jedes Mal in ihre Handtasche steckte, wenn sie in die Stadt ging.
Viele Freundinnen hatte die Großmutter und war daher oft unterwegs, zu Fuß meistens. Zuweilen benutzte sie auch die Straßenbahn. Die Schimpferei war ihre liebste Beschäftigung. Ein gewilliges Opfer war Sebastians Mutter, denn die konnte sich nicht wehren. Das Gezeter über die ungeliebte Schwiegertochter fand nicht direkt statt, sondern lief über Sebastian und dessen Brüder.
Der Engel nahm keinen Anstoß daran, denn er wusste, dass es schon seit ewigen Zeiten so war und auch weiterhin so bleiben würde. Während ihrer Kindheit genossen Sebastian und sein Zwillingsbruder große Freiheiten bei der Großmutter. Im Heu und im Stroh, auf den Wiesen und am Bach, der in unmittelbarer Nähe des Hofes vorbeifloss, spielten sie tagsüber. Die schwarzweiß gefleckten Kühe sahen sie. Wie diese, täglich zweimal, mit der Hand gemolken wurden, konnten sie miterleben, sooft sie nur wollten. Es wurden Kälber, Katzen und Fohlen geboren.
Nach dem sonntäglichen Kirchgang und dem sich daran anschließenden Frühschoppen, brachte der Vater den Zwillingen immer eine Tafel Milchschokolade mit. Er redete nicht viel. Oft schimpfte er geradeso wie die Großmutter.
Als Sebastian drei Jahre alt war, fasste der Engel den Beschluss ihn langsam und sanft an die Sexualität heranzuführen. Aus seiner langjährigen Erfahrung wusste er, dass dies nicht früh genug geschehen könne, damit eine völlige Integration von Geist und Körper gewährleistet sei. Im Laufe von zwei Jahren hatte er drei außergewöhnliche Ereignisse geplant, damit Sebastian ja nicht erschrecke und womöglich ein immer währendes Trauma davontrage. Bei dem kriegerisch aggressiven Albrecht, vor fünfhundertsechsunddreißig Jahren, war dem Boten Gottes ein kleines Missgeschick unterlaufen. Er hatte ihn, in diesem zarten Alter, einer nymphoman-pädophil veranlagten Magd anvertraut, die sich schwer an ihm vergangen hatte. Diesmal sollte dieses Ungeschick vermieden werden. Drei männliche Kandidaten hatte sich der Engel für alle drei Vorfälle ausgesucht. Der erste Auserwählte war ein Nachbarsjunge von fünf Jahren.
Seit einiger Zeit schon kam dieses risikofreudige Bübchen zum Hof von Sebastians Eltern. Dort spielte es mit Sebastian und dessen Zwillingsbruder, meist in der frischen Luft auf den Wiesen. An einem Frühsommertag, dort draußen, zog es, während sie zu dritt froh und unbekümmert herum tobten, plötzlich seine Hose herunter, hockte sich hin und verrichtete seine Notdurft. Während es in dieser Hockstellung dort saß, bat es Sebastian und seinen Zwillingsbruder ihm Büschel frischen Grases zu pflücken, damit es sich den Hintern abwischen könne. In diesem Moment kam ein merkwürdiges Gefühl über Sebastian, das er noch nicht kannte. Er fühlte eine innere Aufwühlung, eine ihm noch unbekannte Spannung und eine, in dieser Stärke, erstmals erlebte Sensation. Mit all seiner Kraft rupfte er das duftende Gras und brachte es dem Hockenden. Dieses herrliche Ärschlein schaute er sich an, bewunderte und roch die Exkremente. Er war verblüfft über seine eigene Erregung. Der spontane Bengel wischte sich den kleinen Hintern säuberlich ab, stand auf, zog die Lederhose herauf und die drei Kerlchen spielten ausgelassen weiter.
Der Engel war zufrieden, denn dieses erste behutsame Heranführen seines Schützlings an die Sexualität war ihm glänzend gelungen. Fast ein Jahr später fand das zweite Ereignis statt. Einen Siebzehnjährigen hatte der Engel diesmal auserkoren.
An einem schwülen Tag im Spätsommer geschah es. Sebastians Vetter, ein schlanker Jüngling von siebzehn Jahren, war auf dem Hof zu Besuch. Im vierten Lebensjahr war Sebastian. Gegen Abend brach ein furchtbares Gewitter los. Dermaßen heftig war der begleitende Wolkenbruch, dass der kleine Bach, der am Hof vorbeifloss, in kürzester Zeit zu einem reißenden Strom anschwoll und über die Ufer trat. Die gesamte Familie musste hinaus und retten, was zu retten war. Bis fast zum Haus stiegen die wilden Wassermassen. Sebastian, sein Zwillingsbruder und die Großmutter hielten sich in der großen Wohnküche auf. Sie musste Sebastian trösten. Langsam zog das Unwetter vorbei, das Wasser sank und die älteren Brüder und der siebzehnjährige Vetter kamen, völlig durchnässt, wieder ins Haus. Draußen war alles in Sicherheit. Mittlerweile waren die Lampen an. Vor dem alten Küchenschrank stand der Vetter und fing an seine nassen Kleider auszuziehen. Sehr schnell ging der Vorgang des Sich-Entkleidens. Sebastian empfand das Gleiche wie ein Jahr zuvor, draußen auf der Wiese. Ganz nackt stand der Vetter am dunklen Schrank, im Schein der Lampe. Trockene Kleider wurden ihm gebracht. Während des Anziehens drehte er sich einmal um und Sebastian sah diesen prachtvollen, wohl geformten Arsch. Die leichte Behaarung der Arschbacken sah er im Lichterschein. Fasziniert war Sebastian. Diese wunderbare Spannung spürte er wieder und hoffte, es würde länger gedauert haben, aber der Engel ließ es nicht zu.
Nun, da er angekleidet war, setzte sich der Cousin zur Großmutter an den Tisch. Lebhaft diskutierte man über die zerstörerische Kraft der Naturgewalten und die verheerenden Auswirkungen, die sie haben könnten. Schließlich wurde die Unterhaltung dadurch beendet, dass sich der Großmutter ein tiefer Seufzer entrang, wobei sie die Augen gen Himmel erhob. Des Öfteren habe sie solche Überflutungen erlebt, sagte sie, indem etwas Wehmut in ihren Worten mitschwang. Dann fuhr sie mit beschwörenden Gesten fort, dass es eben so sei. Den Lauf der Dinge könne niemand aufhalten. Ganz besonders gelte dies für das Wasser. Es hole sich dasjenige, was es brauche, um anschließend wieder monatelang in friedlicher Ruhe dahinzuströmen. Mit fester Stimme fügte sie diesen Betrachtungen noch hinzu, dass es bittere Notwendigkeit sei den Menschen zeitweilig kleinere und größere Katastrophen vor Augen zu führen, damit diese ihre eigene Hilflosigkeit den Naturkräften gegenüber richtig einzuschätzen lernten. Letztendlich führe dieser Lernprozess zu der Einsicht, dass nicht alles beherrschbar sei. Dies behüte die Menschen davor, Opfer ihrer eigenen Überheblichkeit zu werden.
Alle ihre Enkel nickten zustimmend und ließen die Worte der Großmutter auf sich einwirken. Obwohl Sebastian noch nicht vollständig begreifen konnte, was sie sagte, hörte er doch am Ton ihrer Stimme, dass es sich um etwas Wichtiges gehandelt haben musste. Auch die Blicke der anderen ließen ihn erahnen, dass die Großmutter Wichtiges mitgeteilt hatte.
Der dritte Vorfall ereignete sich zehn Monate später. Fünf war Sebastian jetzt. Diesmal hatte der Engel sich seinen ältesten Bruder ausgesucht. Bereits sechzehn war dieser und dazu vorbestimmt, den Hof einmal zu übernehmen. So ein richtiger Naturbursche war er: schlank, stark und blond. Er hatte die Schule, die ihn nie sonderlich interessierte, schon mit vierzehn Jahren verlassen um sich ganz und gar der Landwirtschaft zu widmen. Nur wenige Freunde besaß er, weil er nichts Anderes als arbeiten im Kopfe hatte. Er liebte den Bauernhof über alles und fand in ihm sein ganzes Glück. Lediglich ein Hobby hatte er und das waren seine Brieftauben. Sein ganzer Stolz waren sie. Er verbrachte seine gesamte Freizeit voller Hingabe im Taubenschlag. Darüber hinaus hatte er noch eine sehr merkwürdige Angewohnheit. Er benutzte nämlich nie ein Klosett. Wenn er einmal austreten musste, machte er das im Freien auf den Wiesen oder in den Ställen.
In der Nähe des Hofes gab es ein Stück Brachland mit vielen Bäumen, Sträuchern und wucherndem Unkraut. Dort hielt Sebastian sich oft auf, wenn er alleine sein wollte. An einem warmen Sommertag, als er wieder einmal nachmittags dort verweilte um dem Stress seines Zwillingsbruders zu entfliehen, hörte er mit einem Male ein Rascheln im Gebüsch. Seinen ältesten Bruder erblickte er und ahnte instinktiv, dass etwas außergewöhnlich Spannendes geschehen würde. Er war sich auch ganz sicher, dass der Bruder ihn nicht bemerkt hatte. Dieser kam näher, drehte sich um, zog seine Hose herunter und begab sich in die Hocke. Dem kleinen Sebastian wurde blitzartig klar, was sich in unmittelbarer Nähe vor ihm abspielen würde. Er war jetzt auch in der Hockstellung und nur durch einige Blätter vor dem Entdecktwerden geschützt.
Der blanke Arsch des Bruders befand sich in gespreizter Stellung fast in Reichweite vor ihm. Er betrachtete diese wunderbaren, wohlproportionierten, weißen, unbehaarten Arschbacken und das Loch, das sich jetzt langsam öffnete. Etwas unglaublich Sensationelles vollzog sich vor seinen Augen. Dass es der Bruder war, hatte er schon längst vergessen und sah nur noch dieses sich öffnende Loch, inmitten dieser weißen Wölbungen. Langsam glitt, unhörbar, dieses Wurstförmige, wie eine Schlange, hinaus auf das Gras. Vor lauter Erregung konnte Sebastian kaum noch den Atem regulieren. Das erste Mal war es, dass er diesen spektakulären Vorgang, in allen Einzelheiten, aus einem sicheren Versteck, über eine verhältnismäßig lange Zeit, voller Hingabe und Herzklopfen, beobachten konnte. Er war Augenzeuge eines unvorstellbar überwältigenden Ereignisses. Jetzt kam der Höhepunkt: Das Loch schloss sich und die kräftigen Schließmuskeln machten noch einige leicht ausstülpende Zuckungen. Dieses Wunder der Natur war für Sebastian fast paradiesisch. Der Bruder stand auf, den Hintern wischte er sich nicht mehr ab, zog seine Hose wieder herauf und schritt ohne sich noch einmal umzudrehen von dannen. Wie gelähmt blieb Sebastian noch einige Zeit hinter den ihn schützenden Sträuchern sitzen, bevor er zur Großmutter ins Haus zurückging.
Mit niemandem sprach er über das Vorgefallene. Sein Geheimnis war es und zu kostbar, als dass es mit einem anderen geteilt werden könnte.
Sebastian war sich sicher, dass es mit der aufregenden Nacktheit dieser drei Ereignisse etwas Besonderes auf sich hatte. Er spürte, dass es ganz anders als bei seiner Großmutter war.
Schließlich sah er sie täglich im Evakostüm. Sie hatte nämlich die Gewohnheit völlig unbekleidet zu schlafen. Darüber hinaus durften Sebastian und sein Zwillingsbruder immer nackt neben ihr die Nacht verbringen. Dann erzählte sie vor dem Einschlafen immer ein Märchen. Manchmal waren es die klassischen von den Gebrüdern Grimm. Die Geschichte von Schneewittchen und dem gläsernen Sarg, in dem es jahrelang scheintot ruhte, mochte Sebastian ganz besonders. Er konnte erst dann wieder erleichtert aufatmen, wenn er hörte, dass der Sarg durch unglückliche Umstände fast zu Boden gestürzt wäre. Durch diese unbeabsichtigte Erschütterung löste sich die giftige Apfelgrütze in seinem Hals und Schneewittchen spuckte sie aus, denn sie hatte ihm die Luftröhre verschlossen. Dass das bösartige, grausame Weib, das dem unschuldigen Mädchen dieses unermessliche Leid zugefügt hatte, schließlich auf rot glühenden, eisernen Pantoffeln tanzen musste, bis es tot umfiel, stimmte Sebastian wieder zufrieden.
Die Großmutter sprach auch von Frau Holle, die für die Schneeflocken zuständig wäre. Vom armen Aschenputtel, das von der bösen Stiefmutter so furchtbar schikaniert worden war, berichtete sie. Innerlich freute Sebastian sich immer wieder, dass das leidgeprüfte Mädchen dennoch, in goldenen Gewändern gekleidet, zum königlichen Ball gehen konnte.
Jedes Mal sehr beruhigend wirkte das Hirtenbüblein auf Sebastian, da es alle Fragen, die der König ihm stellte, so klug beantworten konnte. Dieses weise Knäblein wusste sogar, wie viele Sekunden die Ewigkeit hatte. Auch Hänsel und Gretel begeisterten Sebastian. Fast wären diese unschuldigen Kinder verspeist worden, hätte Gretel nicht die mutige Tat begangen und die böse Hexe in den glühend heißen Backofen geschubst.
Ab und zu gab die Großmutter aber auch selbst gemachte Märchen zum Besten, in denen immer das ferne Afrika der Schauplatz war. Sie erzählte von undurchdringlichen Urwäldern, von wilden Löwen, riesigen Elefanten und Furcht erregenden Menschenfressern.
Sebastian liebte sowohl die alten als auch die neuen Märchen sehr. Jeden Abend wieder war er voller Erwartung der Abenteuer, die die Großmutter so inbrünstig erzählten konnte. Wenn ein solches Märchen dann zu Ende war, verfiel sie in ein merkwürdig- geheimnisvolles Gemurmel. Es war die Litanei all dieser Gebete, die sie für die Verstorbenen sprechen musste, denen sie diese zu deren Lebzeiten versprochen hatte. Manchmal geschah es, dass Sebastian noch den Anfang des Schnarchens der Großmutter hörte, das mitunter eine große Lautstärke erreichen konnte, aber das störte ihn nicht. Nur dass sie nicht ersticke, hoffte er. Ohne Sorgen waren für ihn die Abende und Nächte im behaglichen Bett der Großmutter. Auf das Schlafengehen freute er sich jedes Mal wieder.
Zum nahe gelegenen Waldfriedhof ging die Großmutter ab und zu mit ihm. Dort besuchten sie das Grab des Großvaters, den Sebastian aber nie gekannt hatte. Ein ruhiger Ort mit alten Bäumen war es. Das Grab pflegte die Großmutter selbst, obwohl sie ihren Mann, im Grunde ihres Herzens, verfluchte. Das, was sie gelegentlich von ihm erzählte, war ausschließlich negativ. Wie eine Sklavin habe er sie mitunter behandelt, sagte sie.
Zur Religion hatte die Großmutter ein äußerst ambivalentes Verhältnis. Obgleich sie katholisch war, nahm sie nicht am sonntäglichen Gottesdienst teil. Sie hasste den gesamten Klerus. Auch zur Beichte ging sie nie, da sie der Meinung war, dass man sich einem wildfremden Mann, auch wenn dieser ein Priester sei, nicht anvertrauen könne. Obwohl Sebastian noch nichts von Religion wusste, verstand er doch die Worte der Großmutter. Sein zweitältester Bruder, der mittlerweile schon eine Lehre als Feinmechaniker bei der Technischen Hochschule angefangen hatte, brachte ihm manchmal herrliche Nusseckchen mit, die er so liebte. An Wochentagen freute er sich immer schon auf diesen Bruder und die Köstlichkeiten, die er am Spätnachmittag vielleicht mitbringen würde.
Einmal wöchentlich bekamen die Zwillinge auch einen Groschen.
Dann begaben sie sich nachmittags zum Kolonialwarengeschäft und kauften sich eine Wundertüte. Der Inhalt war immer eine große Überraschung für sie. Die ganze Woche freute man sich auf dieses Vergnügen für zehn Pfennig das Stück.
Zuweilen durfte Sebastian auch mit seinem Zwillingsbruder zu einer Nachbarin, die aber keine Bäuerin war. Sie hieß Frau Kreusch und war seit Jahren schon Witwe. Wenn ihr Mann zur Sprache kam, pflegte sie zu sagen, dass er auf dem Feld der Ehre sein Leben für Volk und Vaterland dahingegeben habe.
Mit ihrer erwachsenen Tochter lebte sie in einem geräumigen Einfamilienhaus, nur wenige Minuten vom Hof der Eltern von Sebastian entfernt. Einen braungrau-weiß gefleckten Drahthaar- Foxterrier, dessen Schwanz nur aus einem unansehnlichen Stummel bestand, nannte sie ihr Eigen. Er war ihr ganzer Stolz. Sein Name war Duxi. Mitunter wurde er wie ein verwöhntes Kind verhätschelt. Die liebenswürdige Frau Kreusch hatte den kleinen Sebastian und dessen Brüderlein in ihr Herz geschlossen. Obwohl sie die beiden immerfort verwechselte, störte das die Zwillinge nur bedingt, da sie es immer gut mit ihnen meinte. Diese kleine Unzulänglichkeit konnten sie ihr, wegen ihres fortgeschrittenen Alters, verzeihen. Wenn diese Duxi-Besitzerin einmal traurig war, setzte sie sich an ihren Flügel und spielte voller Melancholie den Zwillingen die wehmütigsten Melodien vor. Die beiden Brüder und Duxi, der schon seit Jahren daran gewöhnt war, lauschten aufmerksam der Musik. Die Tochter von Frau Kreusch war meistens außer Haus und konnte daher das Klavierspiel ihrer Mutter und das andächtige Zuhören des Foxterriers Duxi, Sebastians und seines Zwillingsbruders nicht stören. Für diese beiden Knäblein und das Hündchen nur spielte sie ihre Sehnsuchtsmelodie aus einer längst vergangenen Zeit.
2. Kapitel
Damit sich der Horizont seines Schützlings erweitere, hatte der Engel beschlossen, dass Sebastian, als er gerade sechs Jahre geworden war, nebst seiner ganzen Familie vom östlichen an den westlichen Stadtrand umziehen sollte. Dort, in der Nähe der holländischen Grenze, in einem sehr schönen Tal, an den sieben Quellen des Wildbaches, ließen sie sich nieder. Der Bauernhof stammte aus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Dass in seinen starken Mauern sogar Napoleon einmal übernachtet haben soll, munkelte man gelegentlich. Auf einem seiner vielen Feldzüge hätte es den einstigen Kaiser aller Franzosen an diese sprudelnden Quellen verschlagen. Dass er dann, mehr als ein Dutzend Jahre später, so kläglich auf St. Helena, dieser gottverlassenen Vulkaninsel mitten im Atlantik, enden musste, war von der göttlichen Vorsehung so bestimmt.
Seit Menschengedenken hatte das Anwesen den wohlklingenden und passenden Namen "Septfontaines". Der Wohntrakt war weitläufig und bestand aus zehn Zimmern. Drei alte Kastanienbäume standen vor dem Gebäude auf einem dreieckigen Platz und in ihrem Schatten befand sich ein altes, eisernes Wegkreuz auf steinernem Sockel. Der Bach, der das Tal durchfloss, war sehr kurvenreich und wild, kristallklar und kalt sein Wasser. Im Obergeschoss bezog die Großmutter, zusammen mit Sebastian und dessen Zwillingsbruder, zwei Gemächer. Die Eltern und die drei anderen Brüder hatten ihre eigenen Zimmer.
In der neuen Umgebung fühlte sich Sebastian anfangs etwas unglücklich. Es gab hier keine bimmelnde Straßenbahn und nur wenige Nachbarn. Insgesamt zählte das Dorf etwas mehr als fünfzig Einwohner, fast ausschließlich Bauern. Viele wohnten schon seit Generationen dort.
Sebastians Großmutter, die mittlerweile schon sechsundsiebzig Jahre war, verschloss sich den Dorfbewohnern völlig. Hier, in diesem kleinen Ort, wo es nicht einmal eine Kirche gab, fing sie zum ersten Mal an über ihre Isolierung zu klagen. Öffentliche Verkehrsmittel gab es kaum. Lediglich einmal am Tag und sonntags, zweimal zum Gottesdienst, fuhr ein Bus.
Die Großmutter wurde manchmal mürrisch und schimpfte noch mehr als früher. Zuweilen aber sang sie auch wehmütige Melodien. Ganz besonders mochte sie das traurige Lied von dem müden Wanderer und der holden Gärtnersfrau, die den Eid der Treue gebrochen hatte. Von dunkelblauen Veilchen, tiefer Enttäuschung und vergeblich vergossenen Tränen der Reue wurde berichtet. In dieses Lied legte die Großmutter ihre ganze Sehnsucht. Sie sang es jedes Mal wieder voller Hingabe und heißem Verlangen nach besseren Zeiten. Wo und wie sie dieses schöne Lied erlernt hatte, darüber hat sie nie mit Sebastian gesprochen. "Müde kehrt ein Wandersmann" war einfach das Sehnsuchtslied der Großmutter und Sebastian musste sich diese Moritat von der schönen Gärtnerin oft anhören, genau wie das wehmütige Klavierspiel von Frau Kreusch, damals, vor dem Umzug. Abends aber war es wie früher. Die Großmutter nahm Sebastian und dessen Zwillingsbruder in ihr Bett und erzählte ihnen die so geliebten Märchen. Danach kam dann wieder das Gemurmel der vielen Gebete und das Schnarchkonzert. Zuweilen hatte Sebastian den Eindruck, dass sie ganze Wälder absägte. Aber jedes Mal, wenn er glaubte, sie würde ersticken, wurde ihr Schnarchen wieder regelmäßiger und erst das rhythmische Atmen beruhigte ihn wieder. Sebastian gewöhnte sich rasch an seine neue Umgebung und schon schnell freundete er sich mit Maria, der Nachbarstochter, an. Der Engel hatte bereits vorherbestimmt, dass Maria, die zwei Jahre jünger als Sebastian war, für die nächsten zehn Jahre seine Gefährtin sein sollte. Sie konnte gut klettern, andächtig zuhören und war eine rechte Frohnatur. Sebastian und Maria hatten viele Pläne. Sie hatten vor dem Lauf des Baches zu folgen und seine Ufer zu erkunden. Auch das Wäldchen, das sich unweit des Dorfes am Hang eines Hügels befand, wollten sie auskundschaften. Vielleicht gäbe es dort ein lauschiges Plätzchen, wo sie sich zurückziehen könnten, wenn ihnen danach wäre.
Marias Eltern waren streng. Der Vater besaß darüber hinaus noch einen jähzornigen Charakter. Noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder hatte Maria.
Voller Zufriedenheit schaute der Engel auf Sebastian und Maria herab und fand an ihnen sein Wohlgefallen. Doch war er der Ansicht, dass sein Schützling wieder etwas mehr an die Sexualität herangeführt werden müsse, damit er in seiner geschlechtlichen Entwicklung nicht gehemmt werde.
Als der Bote Gottes zum vierten Male eingriff, war es bereits Frühling und Sebastian in seinem sechsten Lebensjahr. Maria war nach kurzer Zeit schon seine neue, ständige Begleiterin geworden. Mitten auf dem Hof von Marias Eltern ereignete sich der bemerkenswerte Zwischenfall. Maria kam aus dem Kuhstall, stellte sich mit dem Rücken vor Sebastian, zog ihre Unterhose herunter, hob den Rock hoch, beugte sich vornüber und bat Sebastian ihr die Arschbacken zu spreizen, damit er nachsehen könne, ob sie sich auch den Hintern fein säuberlich abgewischt hätte. Diese unverhoffte Bitte, mitten auf dem Hof, am helllichten Tag, ließ Sebastian fast in einen Schockzustand geraten. Blitzschnell kamen ihm die früheren Erlebnisse mit Arschbacken ins Gedächtnis zurück. Noch nie hatte er ein Hinterteil direkt berührt. Maria aber harrte in ihrer Pose aus, als wäre es das Natürlichste von der Welt. Obwohl Sebastian sich ein wenig genierte, führte er doch die erbetene Handlung durch. Er näherte sich ihr, bückte sich leicht, legte die Hände auf ihre weißen Arschbacken und spreizte sie, so weit es ging. Beim Berühren der Haut fühlte er wieder die Spannung, das Herzklopfen und dieses außergewöhnlich Sensationelle. Nachdem beide Backen völlig gespreizt waren, sah er das rosabräunliche Loch sauber und fest verschlossen.
Weiterhin war er ein bisschen verwundert darüber, dass es zwischen ihren Schenkeln irgendwie anders aussah als er das gewöhnt war. Er sah kein Pissmännchen. So pflegte die Großmutter liebevoll seinen kleinen Penis zu nennen. Eine äußerst merkwürdige Erscheinung sei es schon, dachte Sebastian. Maria bat nochmals, jetzt etwas energischer, um Bestätigung, ob auch alles sauber abgewischt wäre und bekam eine bejahende Antwort.
Sebastian war perplex. Dies alles konnte er nur schwer verstehen. Maria blieb unterdessen seelenruhig, zog ihre Unterhose herauf, brachte ihren Rock in Ordnung und drehte sich freudestrahlend um. Sie und Sebastian sprachen nicht über diesen denkwürdigen Vorfall, denn für Maria war es anscheinend ein natürliches Ritual, das sich noch unzählige Male, in jenem Frühling und Sommer, wiederholen sollte. Sebastian gewöhnte sich daran und allmählich begannen die beiden Freude an der gegenseitigen Nacktheit zu empfinden. Auf den Heuschober gingen sie oder in den kleinen Wald in der Nähe und genossen ihre jungen Körper. Schnell lernte Sebastian, dass Maria sich hinsichtlich der Geschlechtsorgane wesentlich von ihm unterschied. Auch waren Marias Brustwarzen anders als die von Sebastian. Bei ihr waren sie nach innen und bei ihm nach außen gestülpt. Darüber machte er sich aber weiter keine Sorgen. Bei Maria sah er zum ersten Mal bewusst seine Erektion, schenkte diesem Phänomen aber weiter keine große Beachtung. Er merkte nur, dass es ein sehr angenehmes Gefühl hervorrief. Über ihre sexuellen Gefühle sprachen Maria und Sebastian nicht. Sie erlebten sie. Aufgrund dieser Vorkommnisse mit Maria, fragte Sebastian eines Tages die nackte Großmutter, warum sie denn nichts zwischen den Beinen habe. Kurz und bündig war ihre Antwort. Resolut sagte sie, dass jeder so ein Pissmännchen hätte, aber wenn man Schlechtes täte, würde es einem abgeschnitten. Sebastian war mit dieser knappen Antwort zufrieden. Das Problem war für alle Zeit gelöst.
Mit dem übergroßen Teil der Dorfbewohner baute Sebastian nur langsam einen Kontakt auf. Vorerst war Maria das Zentrum. Rasch fingen sie an sich ihre Schutzzonen aufzubauen und sich die ersten Freiräume zu schaffen. Dies waren Gebiete an den Ufern des Baches. Manchmal hielten sie sich auch in Bäumen oder unter Sträuchern auf. Diese Territorien waren nur für sie bestimmt.
Eindringlinge wurden vertrieben, manchmal mit Gewalt, unter Zuhilfenahme von Knüppeln, Stöcken und Steinen, wobei es vereinzelt zu größeren Verletzungen auf beiden Seiten kam. Bei einem solchen Verteidigungskampf wurde einmal einem Jungen der rivalisierenden Gruppe mit einem Stück Holz eine stark blutende Kopfwunde zugefügt. Erst wenn sie merkten, dass sie letztendlich die Unterlegenen sein würden, traten Sebastian und Maria den Rückzug an und begaben sich in ein anderes Refugium. Im Tal jenes Wildbaches besaßen sie etwa ein Dutzend solcher Schutzzonen.
Zwei junge Katzen bekam Sebastian eines Tages von Maria. Die eine war schwarz und obwohl sie weiblichen Geschlechts war, nannte er sie Moritz. Die andere war ein Käterchen. Schwarzweiß gefleckt war es und erhielt keinen Namen. Diese beiden Katzen gehörten nun Sebastian alleine. Anfänglich mussten sie noch mit der Flasche gefüttert werden. Diese beiden Tiere waren Sebastians ganzer Stolz. Auf dem Heuboden schliefen sie. Nach einigen Wochen schon konnten sie alleine trinken.
Inzwischen verbrachte Sebastian ungefähr die eine Hälfte seiner Zeit mit Maria und die andere mit der Großmutter. Eingeschult wurde Sebastian, als er sieben war. Lesen, schreiben, rechnen und singen lernte er. Unendlich lang kamen ihm die Unterrichtsstunden vor. Nach der Schule aber hatte er Zeit für Maria.
Manche ihrer Refugien bauten sie zu kleinen Hütten aus, die sie Häuschen nannten. Allerlei Gerümpel wurde dann herangeschleppt, damit diese Provisorien etwas wohnlicher würden. Oft geschah es, dass sie, nach kürzester Zeit, von einer Clique der Dorfkinder, wieder kurz und klein geschlagen wurden. Jedes Mal errichteten sie neue Häuschen und immer wieder wurden diese zerstört.
Der Engel sah dies, aber unternahm nichts. Er war davon überzeugt, dass sein Schützling daraus lerne sich nicht zu sehr an materielle Dinge zu klammern. Des Weiteren sollte er erfahren, dass ein erlittenes Unrecht leichter zu ertragen sei, wenn einem eine treue Gefährtin zur Seite stehe, die stark genug sei Trost zu spenden.
Maria, in ihrer fröhlichen und unbeschwerten Art, war eine rechte Trösterin der Betrübten. Sebastian schöpfte trotz der ärgerlichen Vorfälle und der wilden Zerstörungswut so mancher Dorfkinder jedes Mal wieder neue Hoffnung. Maria unterstützte ihn tatkräftig dabei.
Allmählich wurde ihnen bewusst, dass der Bau von Häuschen sich nicht mehr lohne. Durch die vielen Überfälle und großen Schäden klug geworden, hielten sie jetzt nach anderen Möglichkeiten Ausschau. Um keine weiteren Übergriffe mehr zu provozieren, gaben sie schließlich auch ihr letztes Häuschen auf.
Nun gingen sie dazu über, sich Bäume und Sträucher auszusuchen, denen sie Namen gaben um sie anschließend als Palast oder Land in Besitz zu nehmen. Im Gegensatz zu früher, brauchten sie jetzt nur noch ihre Vorstellungskraft um Gebäude zu errichten, die allen Angriffen standhalten würden. Ganze Länder machten sie sich untertan, ohne dass auch nur ein einziger Faustschlag nötig gewesen wäre.
Ein Haselnuss-Strauch, der mitten in einer Böschung stand und dessen Zweige bis zum Boden reichten, wurde von den beiden Kindern "Amerika" getauft. Dieses Wort hatte Sebastian vorgeschlagen. Von der Großmutter hatte er es erfahren, die zuweilen davon sprach, aber immer nur kurz ohne Einzelheiten preiszugeben. Auch Maria mochte dieses Wort. Sie meinte, es berge etwas Geheimnisvolles in sich. Oft hielten sie sich im wohl tuenden Schatten dieses Busches auf. Von ihrer kindlichen Fantasie angeregt, ließen sie sich dann weit hinaustragen, bis nach Amerika. Ob es sich um ein Land oder einen Erdteil handelte, wussten die beiden Träumenden nicht, noch war ihnen bekannt, wo es lag. Nur der Name war wichtig für sie, denn er übte eine große Anziehungskraft auf sie aus.
Ein anderer ihrer neuen Zufluchtsorte, dem sie den Namen "Haus des Königs" gegeben hatten, war ein alter Weidenbaum, der am trockengelegten Wassergraben einer prächtigen Burg stand. Dort gingen sie oft hin und kletterten im Baum herum. Dabei stellten sie sich dann vor, sie seien beim König zu Besuch. Vor allem wenn sie auf einem Weidenast saßen, der sich durch heftiges Rütteln weit durchbiegen ließ, war ihre Freude groß. Auf und nieder schwebten sie, wobei sie aber nie ihr Gleichgewicht verloren. Wie geschmeidige Katzen hielten sie sich in der Balance, ohne dass ihnen jemals in den Sinn gekommen wäre, wie gefährlich ihr schönes Spiel war.
Eines Tages nahmen sie auch Marias jüngeren Bruder zu jener Silberweide, die sie König nannten, mit. Sie stiegen mit ihm auf einen der höchsten Äste hinauf und fingen an zu schütteln. Marias Bruder konnte sich nicht mehr fest halten und fiel in den ausgetrockneten Wassergraben. Das arme Kerlchen lief blau an, aber es lebte. Auf schnellstem Wege schafften Sebastian und Maria den Bruder zu den Eltern zurück. Diese waren entsetzt, als sie das schreiende Kind sahen. Maria bezog eine gehörige Tracht Prügel, weil sie so leichtfertig das Leben ihres kleinen Bruders aufs Spiel gesetzt hatte und Sebastian ging, voller Schuldgefühle, nach Hause.
Sebastian ging jetzt auch öfter zu den Höfen der Nachbarn. Er sah die starken Knechte und die schönen, üppigen Mägde. Der dörfliche Tagesablauf wurde hauptsächlich von den Kühen bestimmt, denn die mussten täglich zweimal gemolken werden. Und so kam es, dass man nur am Nachmittag zuweilen ein Stündchen frei hatte. In der Erntezeit fiel auch das aus.
Ein Dienstmädchen hatte der aufmerksame Sebastian ganz besonders ins Herz geschlossen. Schwarzes, langes Haar hatte sie und war immer gut gelaunt, obwohl sie sehr schwer arbeiten musste. Während eines solchen Schäferstündchens, im Sommer, lag sie auf der Wiese und genoss die angenehm warmen Sonnenstrahlen. Sie war die Magd eines Nachbarhofes und oft dem sexuellen Verlangen der pubertierenden Bauernburschen ausgesetzt. Ständig musste sie sich wehren und die aufdringlichen Jünglinge von sich abhalten.
Trotzdem hatte sie ihre Lebensfreude noch nicht verloren.
Wahrscheinlich wusste sie auch, dass sie niemals, aufgrund ihrer sozialen Herkunft, eine ernst zu nehmende Ehepartnerin für die Jungbauern hätte sein können. Sebastian sah sie dort im weichen Gras liegen und gesellte sich zu ihr. Die schöne Magd blinzelte ihn an und lächelte milde. Nun fing sie an ein Liedchen zu singen. Wahrscheinlich fühlte sie sich sicher, denn Sebastian war ja keine Bedrohung für sie, war er doch noch ein Kind. Erst summte sie nur leise die Melodie. Dann ließ sie schöne unbekannte Worte einfließen und schließlich hob sie inbrünstig mit glockenreiner Stimme zur letzten Strophe an. Die Gesangskunst dieser Magd versetzte Sebastian in Erstaunen. Der Refrain "Addio, mia bella Napoli, addio, addio!" hallte noch lange in seinen Ohren nach. Ihre Augen glänzten, ihre Lippen vibrierten leicht und das Haar bedeckte wie schwarzer Samt, sanft ihre Schultern um die Haut vor der Sonne zu schützen. Was sie gesungen hatte, konnte er nicht verstehen. Er fragte, welche Sprache es denn wäre und sie entgegnete ihm, es sei Italienisch gewesen. "Addio!" bedeute "Auf Wiedersehen!", und Napoli sei der Name einer großen Stadt im transalpinischen Kampanien. Sie läge am blauen Meer und in ihrer Nähe befände sich ein Feuer speiender Berg. Derjenige, der diese Stadt gesehen habe, könne beruhigt sterben, denn ihre Schönheit wäre paradiesisch. All das überstieg fast die Einbildungskraft von Sebastian. Während sie diese Worte sprach verzog sie geheimnisvoll ihren sinnlichen Mund. Dem andächtig zuhörenden Sebastian wurde fast schwindlig von dem, was die schöne Magd mit dem langen, schwarzen Haar erzählte. Solche fremdländischen Wörter hatte er niemals zuvor gehört. Die Großmutter hatte nie von flammenden Bergen gesprochen. Nur die glühenden Pantoffel der bösen Stiefmutter von Schneewittchen waren Sebastian bekannt.
Die schöne Erzählerin stand auf und begann Gänseblümchen zu pflücken. Sebastian fragte nach dem Grund ihres Tuns und sie sagte, er solle abwarten. Als sie einen kleinen Strauß dieser Blümchen beisammen hatte, ließ sie sich wieder im Gras nieder.
Sie fing jetzt an einen Blumenkranz zu flechten, indem sie die dünnen Stängel mit ihren Fingernägeln durchbohrte und den Stängel der jeweils nächsten Blume hindurchzog, bis das ganze Sträußchen verarbeitet war. Bewundernd schaute Sebastian ihr bei dieser faszinierenden Beschäftigung zu. Ihre ganze Aufmerksamkeit schenkte sie dieser Tätigkeit. Als der Kranz gebunden war, bat sie Sebastian, der noch immer neben ihr saß, den Kopf ein wenig in ihre Richtung zu beugen, und sie legte ihm das geflochtene Kränzchen, wie eine Krone, auf den Kopf. Sebastian war überrascht und beglückt. Beide standen sie jetzt auf. An die Arbeit musste sie wieder. Der bekrönte Sebastian zog weiter und war stolz auf diesen Blumenkranz aus Gänseblümchen, die aber schon schnell zu welken anfingen.
An manchen Tagen begegnete Sebastian auch Erika. Sie war im ganzen Dorf bekannt, weil sie oft auf den Bauernhöfen, während der Kartoffelernte, aushalf. Da sie geistig leicht behindert war, wurde oft Schindluder mit ihr getrieben. Fünfundvierzig Jahre war sie und wohnte als Ledige bei ihrer alten Mutter. Einen Vater hatte sie nicht mehr. Nach dem Krieg hatte das Schicksal diese beiden in jenes Tal, an die sieben Quellen des Wildbaches, geführt. Wo sie herkamen und wovon sie lebten, wusste keiner so recht. Sie waren einfach da. Erika machte auf Sebastian einen faszinierenden Eindruck, da sie immer fröhlich war und fortwährend tanzen wollte. Sie schnappte sich dann den ersten Besten, oft auch Sebastian und drehte ihre Walzerrunden, meistens auf dem Platz mit dem eisernen Kreuz, unter den alten Kastanienbäumen. Körperlich war sie außergewöhnlich stark, sodass Sebastian, wenn er ihr Tanzpartner war, sich in keiner Weise wehren konnte, wenn ihm die Drehungen zu schnell wurden und zu lange anhielten. Diese Ausdauer war auch ein Grund dafür, dass sie immer wieder zur Kartoffelernte eingesetzt wurde. Sie besaß dieses Unermüdliche und konnte fast endlos lange die gleiche Handlung verrichten. Aber Erikas Augen waren leer und ausdruckslos. Nichts als Chaos konnte man in ihnen lesen. Eine sinnvolle Unterhaltung war denn auch unmöglich. Singen konnte die arme Erika ebenso wenig. Oft trieben die jungen Bauernburschen ihre derben Späße mit ihr. Aber da sie so stark war, wagte es keiner sich ihr zu widersetzen, wenn sie sich einen zum Tanze schnappte. Da machte sie keine Ausnahme hinsichtlich des Alters. Ob einer sieben oder siebzehn war, kümmerte sie nicht, wenn die Auserwählten nur dem männlichen Geschlecht angehörten. Erika trieb sich überall herum. Auf alle Höfe kam sie und keiner schickte sie fort. Sie gehörte einfach zum Dorf und war darüber hinaus eine billige Arbeitskraft beim Ernten der Kartoffeln. Eines Tages kam sie weinend zur Mutter von Sebastian und erklärte, dass ihr altes Mütterlein sich nicht mehr rühre und fast schon kalt wäre. Das waren die ersten, bitteren Tränen der Erika.
In ein Nonnenkloster wurde sie eingewiesen und musste fortan als Küchenhilfe täglich stundenlang Kartoffeln schälen. Anfänglich kam sie noch manchmal zu den sieben Quellen des Wildbaches, aber sie tanzte nicht mehr. Am Spätnachmittag ging sie dann wieder die fünf Kilometer zum Kloster zurück und gab sich wahrscheinlich am folgenden Tag wieder dem Kartoffelnschälen hin. Nach einiger Zeit stellte sie ihre Besuche an die Ufer des Wildbaches gänzlich ein und niemand hat je wieder etwas von der einst tanzenden und fröhlichen Erika vernommen.
Mit seiner Großmutter ging Sebastian ab und zu ins Zentrum der nahe gelegenen Stadt. Dort sah er zum ersten Mal den Dom von innen. Die Großmutter hatte ihm die Entstehungsgeschichte erzählt. Der Teufel, sagte sie, hätte einen Pakt mit den Baumeistern geschlossen. Die erste Seele, die den fertigen Bau betreten würde, sollte dem Satan gehören. Da die listigen Bürger aber einen Wolf, der ja auch eine Seele habe, hineingeschickt hätten, wäre der Beelzebub dermaßen verärgert gewesen, dass er beim Verlassen des Münsters, vor lauter Wut, die Tür so knallend zugeschmissen hätte, dass sein Daumen im Türschloss hängen geblieben wäre. Sebastian empfand den düsteren Innenraum dieser alten Kirche bedrückend und beängstigend. Auch der über tausendjährige Kaiserthron aus hellem Marmor, den man vom Oktogon aus sehen konnte, beeindruckte ihn nicht. An den Teufel dachte er fortwährend, der vielleicht erscheinen würde.
Die Stadt aber, in der einst Karl der Große und Barbarossa gekrönt worden waren, und die sich immer noch, nach den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges, im Aufbau befand, machte einen angenehmen Eindruck auf Sebastian. Vor allen Dingen der Elisenbrunnen mit seinen schönen, weißen Säulen gefiel ihm sehr. Am Spätnachmittag pflegte die Großmutter dann den langen Heimweg in jenes Tal anzutreten, wo Sebastian, jetzt schon seit einigen Jahren, zu Hause war.
Zweiundzwanzig Tage vor seinem achten Geburtstag ging Sebastian zum ersten Mal mit der Großmutter zum Rosenmontagszug. Er sah all diese bunten Wagen und die farbenprächtigen Kostüme. Diese Menschen, die so fröhlich und ausgelassen waren, faszinierten ihn. Zu diesem Höhepunkt des Straßenkarnevals trug die Großmutter einen breitkrempigen Hut aus schwarzem Filz, auf dem sie silbrig glitzernde Rosen aus rotem Krepp-Papier befestigt hatte. Vor allem die festlich herausgeputzten Pferde und die Trommelwirbel der Musikanten beeindruckten Sebastian tief. Dieser Narrenzug, der mit Pauken, Trompeten und Klarinetten an ihm vorbeizog, war wunderschön.
Die aufgesammelten Bonbons, die von den Prahlwagen in die Menge geworfen wurden, steckte er in die Einkaufstasche der Großmutter. Am Straßenrand, zwischen den anderen Schaulustigen standen die beiden und die Großmutter sang die bekannten Lieder zum Rhythmus der Kapellen mit. "Es war einmal ein treuer Husar" mochte sie ganz besonders gerne. Dann schunkelte sie und war außer Rand und Band. Sebastian schaute zur Großmutter hinauf und erfreute sich an ihrer Lebenslust. Und schon marschierte das nächste Musikkorps vorüber. "Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine" wurde gespielt. Begeistert stimmte die Großmutter mit ein.
Unterdessen versuchte Sebastian durch leise Zurufe mehrmals vergeblich ihre Aufmerksamkeit zu erregen, da er sie etwas fragen wollte. Nun griff er zu einer altbewährten Methode, die nie ihr Ziel verfehlte. Er zog einfach an ihren Röcken um sich Gehör zu verschaffen. Die Großmutter beugte sich zu ihm herab. Sebastian wollte wissen, warum denn alle so lebhaft mitsingen würden und dermaßen fröhlich seien. Die Großmutter, deren Kopfschmuck im Winde gefährlich zu schwanken begann, sagte, es sei Karneval und dann dürfe man verrückter sein, als die Polizei es erlaube. Sie richtete sich wieder auf und wiegte die Hüften noch stärker als vorher zu den Klängen der Musik. Sebastian war allerdings der Sinn ihrer Worte nicht klar geworden, aber dies beunruhigte ihn nicht.
Noch einige Stunden ging der Trubel weiter und Sebastian genoss das närrische Treiben. Diese Ausgelassenheit und Heiterkeit empfand er als etwas Außergewöhnliches. Er konnte sich daran nicht satt sehen. Niemals zuvor hatte er erlebt, dass die Großmutter sich dermaßen amüsierte.
An manchen Tagen, wenn die Großmutter besonders gut gelaunt war und sich unbeschwert fühlte, fing sie an von ihrem Bruder zu erzählen. Dieser habe in Breslau gewohnt und dort eine Fabrik besessen. Was für ein Betrieb es gewesen war, sagte sie nicht. Nur dass der Bruder Hermann hieße und im Kriege verschollen wäre, berichtete sie.
Auch ihren Vater erwähnte sie zuweilen. Dieser sei einmal in Amerika gewesen. Zu welchem Zwecke er damals diese Reise gemacht hatte und wie lange er in den USA geblieben war, verschwieg sie. Zuweilen bat Sebastian sie ihm etwas über Breslau und Amerika zu erzählen. Sie antwortete dann immer nur kurz, dass man ein Schiff benutzen müsse, um dorthin zu kommen und dass Breslau in Schlesien liege. Da er mit einer solchen Antwort nicht viel anfangen konnte, fragte er erneut. Aber jedes Mal glaubte er eine leichte Verärgerung in ihrer Stimme zu hören, wenn er sich danach erkundigte. Er unterließ es fürderhin die Großmutter mit seiner Fragerei über dieses Thema zu belästigen, da es ihr anscheinend unangenehm war.
Die sexuellen Handlungen mit Maria wurden im Laufe der Zeit immer spärlicher, weil beide nicht mehr viel Interesse daran hatten.
Im Winter, wenn es geschneit hatte, holte Sebastian seinen Schlitten vom Dachboden. Zunächst wurden die Kufen blank geschmirgelt und eingefettet. Danach begab er sich mit Maria in die Hügel und Berge. Stundenlang rodelten sie dann in den Hängen. Maria saß auf dem Schlitten immer hinter Sebastian und jauchzte bei den schnellen Abfahrten vor Freude. Manchmal stürzte man auch und tummelte durch den weichen Schnee. Es waren diese winterlichen Wonnen, an denen sie sich ergötzten. Zum Skifahren kam aber Maria nie mit. Das machte Sebastian zusammen mit anderen Dorfkindern. Im Vergleich mit den wilden Schlittenfahrten aber, war es weitaus weniger spektakulär. Auch fehlte ihm Maria sehr. Aber beim Schlittschuhlaufen, dass nur ab und zu stattfand, weil es dann gehörig gefroren haben musste, war sie wieder dabei. Es gab nur einen Weiher in der näheren Umgebung und es dauerte immer sehr lange, bis dieser so fest zugefroren war, dass man darauf Eis laufen konnte. Aber auch das Schlittschuhlaufen war nur mäßig interessant. Der alte Schlitten jedoch, mit dem sie so oft schon hinunter ins Tal gesaust waren, bereitete den beiden immer das größte Vergnügen.
Nach anfänglichem Zögern war der Engel zu dem Entschluss gekommen, dass sein Schützling Anno Domini MCMLIX die erste heilige Kommunion empfangen sollte, auf dass seiner katholischen Erziehung Genüge getan werde. Dem Boten Gottes war bekannt, dass aufgrund dessen nicht nur die geistige, sondern auch die körperlich-sexuelle Freiheit Sebastians nachhaltig eingeengt würde. Da sein Schützling jetzt aber im richtigen Alter dafür war, ließ er zu, dass es geschah.
Seit Anfang des Jahres schon nahm Sebastian am Kommunionsunterricht teil um sich gründlich auf dieses wichtige Ereignis vorzubereiten. Er lernte etwas über die Beichte, über die unbefleckte Empfängnis Mariens und über die Wandlung. Dass der Wein zum Blut und das Brot zum Fleisch Christi würden, erklärte man ihm. In einigen Monaten dürfe er also zum ersten Mal den Herrn zu sich nehmen. Ein eifriger Schüler war Sebastian und freute sich auf den Monat Mai jenes Jahres. In die Kirche ging er jetzt immer öfter und lernte die lateinischen Texte auswendig, damit er gar keinen Fehler während der Messe mache. Bei der Eucharistiefeier mussten die Brüder und Schwestern im Herrn dem Priester immer in Latein antworten.
Sebastian bekam sein erstes Gebetbuch mit seinem Namen, in goldenen Lettern, auf der ersten Seite. Er war stolz. Auch der erste Rosenkranz wurde ihm gegeben. Versilbert war er und hatte ein Kreuz aus schwarzem Holz. Wie der Rosenkranz zu beten war, wusste Sebastian nicht. Deswegen wandte er sich an seine Großmutter. Diese erklärte ihm das Betsystem dieser geheimnisvollen Schnur mit den silbernen Perlen und er war zufrieden. Auch die Zehn Gebote lernte er während der Beichtvorbereitungen. Sie wurden ihm ausführlich erläutert. In dieser Zeit wurde ihm auf einmal klar, dass er furchtbar viel Schlechtes getan hatte. Vor allen Dingen das sechste Gebot, das da lautete: "Flieht die Unkeuschheit!", machte ihm schwer zu schaffen. Schlagartig wurde ihm bewusst, dass diese wundersamen Regungen in ihm, die Lust an der Nacktheit, unbedingt zu unterdrücken seien. Dass er ein Sünder war, musste er jetzt schweren Herzens einsehen. Er dachte an den spontanen Nachbarsjungen, damals auf der Wiese, an seinen schönen Vetter während der Überschwemmung, an seinen ältesten Bruder im Gebüsch und vor allem an die wilde Maria.
Bei seiner ersten Beichte wurden hauptsächlich die Sünden, die er mit Maria begangen hatte, reuevoll vorgetragen, was Sebastian sehr schwer fiel, da er doch so große Lust dabei empfunden hatte. Der Priester erteilte ihm die Absolution. Als Sühne betete Sebastian vier Ave-Maria und verließ die Kirche überglücklich. Frei war er jetzt von allem Bösen. Auf Gott und sein neues, religiöses Leben konnte er sich jetzt konzentrieren.
Der Engel ließ dies alles geschehen, weil er der Überzeugung war, dass Sebastian nur auf diese Weise in das dörfliche Leben zu integrieren sei. Bei seinem vorigen Schützling, dem ungestümen Albrecht, war die Eingliederung in das soziale Umfeld, damals vor fünfhundertfünfunddreißig Jahren, auch auf diese Art und Weise einigermaßen gelungen. Diese Erkenntnis machte der Engel sich jetzt zunutze.
Einen dunkelblauen Kommunionsanzug mit kurzer Hose durfte er sich in einem Geschäft für Herrenoberbekleidung aussuchen. Dazu kamen noch weiße Kniestrümpfe, schwarze Lackschuhe und ein weißes Seidenhemd. Ein grünes Sträußchen mit weißen Blüten aus Seide, das aufs Revers gesteckt werden sollte, verliehen dem Ganzen noch eine besonders festliche Note. Schließlich kaufte man noch eine blaue Fliege und ein weißes Ziertaschentuch mit Spitze, für die Brusttasche des Jacketts.
Am Donnerstag, dem siebten Mai, war der lang herbeigesehnte Tag endlich da. Sebastians Eltern hatten alles für das Fest hergerichtet. Die ganze Verwandtschaft war eingeladen worden, sogar Tante Eugenie aus Brüssel, die sich nur selten im Elternhaus von Sebastian sehen ließ. Wenn sie kam, hatte sie immer einen Koffer voller Kleider bei sich, denn sie hatte die Angewohnheit sich mehrmals am Tag umzuziehen und sich neu zu schminken. Immer guter Laune war sie und küsste sehr herzlich: einmal rechts, einmal links und dann wieder rechts. Welchen Beruf sie hatte, wusste eigentlich keiner so recht. Sie kam, flirtete, war freundlich und gesprächig, zog sich ein paar Mal um und entschwand dann wieder in ihrem weißen Chevrolet, den sie eigenhändig steuerte, nach Brüssel. Es gab nie einen Mann an ihrer Seite. Jedes Mal, wenn sie kam, glaubte Sebastian, einen Hauch der großen, weiten Welt zu spüren. Nie wurde schlecht über sie gesprochen. Für Sebastian sah sie aus, wie eine arabische Prinzessin aus Tausendundeiner Nacht. Diese Geschichten der sagenumwobenen Märchenerzählerin Scheherazade kannte er aber zu jener Zeit noch nicht, da ja die Großmutter nur Jacob und Wilhelm Grimm und ihre eigenen, afrikanischen Horrorgeschichten in ihrem Repertoire hatte.
In jenem Mai, an einem herrlichen, strahlenden Himmelfahrtstag, war dann einer der wichtigsten Festtage für Sebastian und seinen Zwillingsbruder. In schwarzen Limousinen ließ man sich zur feierlich geschmückten Kirche chauffieren. Reservierte Plätze wurden den Eltern und Brüdern zugewiesen. Sebastian, sein Zwillingsbruder und all die anderen Kommunionkinder schritten zum Altar. Der Höhepunkt war der Empfang der Hostie, des Fleisches des Allmächtigen. Man war voller Aufregung. Würdevoll knieten sie, auf den Stufen zum Tisch des Herrn, in Gruppen von zehn, nieder. Andächtig schlossen sie die Augen und streckten, beinahe gierig, die Zungen so weit es ging heraus, damit die Oblate auch darauf Platz habe. Sebastian hörte die mit sonorer, warmer Stimme geflüsterten Worte des Priesters: "Corpus Christi", spürte die Hostie auf der Zunge, sagte "Amen", schloss den Mund, öffnete die Augen wieder, stand auf und verneigte sich ehrfurchtsvoll. Die Gruppe schritt gesenkten Hauptes wieder zurück und man begab sich auf seinen Platz. Sebastians innere Aufgewühltheit war grenzenlos. Nachdem er an seiner Betbank angekommen war, kniete er nieder, bedeckte das Gesicht mit den Händen und war überglücklich, dass er den Herrn hatte empfangen dürfen. Er vertraute dem Allerhöchsten seine geheimsten Gedanken an. Tausendfach dankte er ihm für die Ehre, die ihm zuteil geworden war.
Quia tu es, Deus, fortitudo mea. Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua.
Seit jenem denkwürdigen Tag änderte Sebastian sein Leben. Alle Körperlichkeiten mit Maria waren zu einem Tabu geworden, obwohl er sie noch sehr oft sah. Er wurde jetzt sehr religiös. Bei den Gottesdiensten sang er aus voller Kehle das Halleluja und Gloria. In seiner Freizeit betete er den Rosenkranz; meistens den schmerzhaften und zuweilen den glorreichen.
Um seine unkeuschen Gedanken, die sich trotz aufrichtiger Bemühungen immer wieder einschlichen, stärker unterdrücken zu können, schränkte er seine Freiheit noch weiter ein, indem er sich Kaninchen anschaffte. Die Pflege dieser Tiere war sehr arbeitsintensiv. Dadurch würde er weniger Gelegenheit haben einen Verstoß gegen das sechste Gebot zu begehen. Obwohl Sebastian
seine Langohren zum Schlachten züchtete, war er doch der Meinung, dass auch sie während ihres kurzen Lebens mit großer Sorge gehegt und gepflegt werden müssten, bevor sie als köstlicher Sauerbraten verzehrt würden. Darüber hinaus legte er einen Blumengarten an. Der Vater war gerne bereit, dem Sohn ein Stück seines großen Gemüsegartens, in dem er hauptsächlich Kopfsalat und Gurken anbaute, zu überlassen. Aus veredelten Blumen machte der Vater sich nichts, aber die wilden liebte er umso mehr.
Sebastian pflanzte blutrote Dahlien, rosafarbene Schmuckkörbchen und Astern in allerlei Farben für den Herbst. Dies alles und seine Schule vereinnahmten ihn fast völlig. Morgens fuhr er mit dem Fahrrad zum Unterricht, nachmittags machte er, sehr gewissenhaft, seine Hausaufgaben und danach, am frühen Abend, suchte er auf den Wiesen nach Kaninchenfutter. Vorzugsweise zupfte er Kettenkraut, denn das mochten seine Tiere am liebsten. Das war jetzt sein Leben.
Der Bote Gottes hatte sich nach langem Überlegen endlich dazu durchgerungen, Sebastian wieder eine sexuell gefärbte Episode erleben zu lassen, damit dessen geschlechtlicher Reifungsprozess keinerlei Beeinträchtigung unterliege. Das Für und Wider hatte er sorgfältig erwogen, denn er wusste, welche große Verantwortung auf seinen Schultern ruhte. Den Engel des Herrn kostete es immer sehr viel Mühe die hinderlichen Fehlentwicklungen behutsam zu beheben, die von den irdischen Würdenträgern des Allmächtigen aus Unwissenheit oder mit Absicht verursacht wurden. Eine fruchtbare Zusammenarbeit war offensichtlich nicht möglich.
In jener Zeit geschah es, dass Sebastian krank wurde. Er war schwer erkältet. Die Großmutter bat ihn abends, weil er so hustete und fiebrig war, sich an seine Mutter zu wenden und die Nacht im elterlichen Schlafzimmer zu verbringen. Traurig verließ Sebastian die Großmutter und begab sich zur Mutter. Diese versuchte ihn zu trösten und steckte ihn in ihr Bett. Sie erzählte nie Märchen und Übernachtungen im elterlichen Doppelbett kamen nur vor, wenn man krank war, denn dann weigerte sich die Großmutter den Kranken in ihrem Zimmer schlafen zu lassen. Dies war eines der wenigen Prinzipien, das die Großmutter strikt befolgte.
Sebastian lag nun im Bett der Mutter und der zweite Teil des Doppelbettes war für die Eltern vorgesehen in jener Nacht. Vor lauter Fieber konnte er kaum schlafen. Nach einigen Stunden des sich Hin- und Herbewegens hörte er, wie sich die Tür öffnete. Es waren seine Eltern, die sich zur Nachtruhe begeben wollten. Er tat so, als ob er schliefe. Nach einer Weile lagen die beiden im Bett. Was Sebastian jetzt zu hören bekam, erschütterte ihn zutiefst. Die Mutter stöhnte leidvoll und der Vater schnaufte wie ein wild gewordener Stier. Sebastian wurde stocksteif vor Schreck, kniff die Augen krampfhaft zu und hoffte nur, dass es bald vorbei sein würde. Die rhythmischen Bewegungen wurden sogar dermaßen heftig, dass selbst das Bett anfing zu schütteln. Er hatte das Gefühl, dass die Mutter etwas über sich ergehen lassen müsse, was ihr Schmerzen bereitete. So klang ihr seufzendes Gestöhne.
Am nächsten Morgen empfand Sebastian einen leichten Hass und eine gewisse Verachtung den Eltern gegenüber. Der Zorn, der sich in ihm regte, galt vor allem dem Vater. Noch mehr klammerte sich Sebastian jetzt an seinen Glauben.
Der Engel hatte in all seiner Weisheit beschlossen, dass noch ein sexuell angehauchtes Erlebnis stattfinden müsse, damit Sebastian ein wenig reifer werde.
Immer sonntags, vor dem Kirchgang gewöhnlich, ging Sebastian ins Schlafzimmer der Eltern, um seine Kleider dort aus dem Schrank zu holen und sich herauszuputzen. Einen eigenen Kleiderschrank besaß er noch nicht. Den der Mutter durften er und sein Zwillingsbruder mitbenutzen. Lediglich die Sonntagstracht der Zwillinge wurde neben der Festtagskleidung der Mutter darin aufbewahrt. Bei gewöhnlichen Kleidungsstücken übernahmen Stühle die Funktion einer Garderobe.
Manchmal war er alleine dort und zuweilen war der Vater auch anwesend, wenn er die gleiche Messe besuchte wie Sebastian. An einem solchen Sonntagmorgen, Sebastian war gerade dabei, das weiße Hemd anzuziehen, kam der Vater ins elterliche Schlafzimmer. Er hatte ein wohl tuendes Bad genommen und wollte sich fein für die Kirche machen. Er wurde Sebastians zwar gewahr, aber fing doch an sich auszuziehen. Im Spiegel konnte Sebastian den Vater ganz genau beobachten. Es war ungemein spannend. Als der Vater dann die Unterhose auszog und Sebastian diesen schönen, weißen, makellosen Arsch erblickte, wurde er ein wenig unruhig. Er sah, wie der Vater sich bückte um im Schrank einige Kleidungsstücke zu suchen. Sebastian schaute, ohne Unterlas, fasziniert in den Spiegel der Kommode, vor der er stand, und das schöne Arschloch des Vaters wurde immer sichtbarer. Wie gerne hätte er es berührt oder etwas hineingesteckt, aber er wusste, dass der Gedanke daran, unrealisierbar war. Diesen festen, bewundernswerten Arsch beobachtete er weiter im Spiegel, in der Hoffnung, dass der Vater es nicht bemerken würde, denn schließlich hatte dieser keinen Spiegel vor sich. Demzufolge könnte er überhaupt nicht feststellen, wohin Sebastian seine Augen wandern ließ. Irgendwie schien der Vater doch gemerkt zu haben, dass er von seinem Sohn beobachtet wurde. Er richtete sich wieder auf, zog hastig seine Unterhose an und bestrafte Sebastian mit einem vorwurfsvollen Blick. Die Mutter kam ins Zimmer und der Vater sagte ihr, dass er fortan nicht mehr wünsche, dass einer seiner fünf Söhne sich im Schlafzimmer aufhielte, wenn er dabei wäre, sich umzuziehen. Die Mutter versuchte als Schlichterin aufzutreten und den Vorfall, von dem sie gar nichts mitbekommen hatte, zu relativieren. Der irritierte Vater aber betonte noch einmal seinen Standpunkt.
Sebastian hörte diese dezidierte Forderung des Vaters. Er war nun umso mehr enttäuscht, da er einige Wochen zuvor, als er krank war, die beiden im Bett gehört hatte. Sie hatten ihn in jener Nacht nicht nur um den Schlaf gebracht, sondern auch noch einen schweren Vertrauensbruch begangen.
Sebastian, obwohl noch sehr jung, war jetzt der Auffassung, dass es ohne weiteres im Bereich des Möglichen liegen müsse, dass die Kinder den Schwanz des Erzeugers und die Vagina der Mutter anschauen dürften, wenn sie dies wünschten. Ein verbrieftes Recht müsste ihnen zugestehen, diese Geschlechtsorgane, aus denen sie entstanden waren, zu berühren.
Sebastian dachte über diese extremen Forderungen nach. Nach kurzem Überlegen schon gab er die Hoffnung auf, dass dies irgendwann einmal, in naher Zukunft, in Erfüllung gehen könnte.
Ein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Glauben bekam er, aufgrund dieser revolutionären Vorstellungen, sogar noch dazu, da er ja Gott dienen wollte und dieser, laut offizieller Lehre der Kirche, gewiss nicht mit solchen ungeheuerlichen Handlungen einverstanden sein würde. Ein eklatanter Verstoß gegen das sechste Gebot wäre es. Sebastian befand sich in einem Dilemma.
3. Kapitel
Der Engel sah sowohl diese aufkommende Frömmigkeit als auch die Sebastian vollkommen verwirrenden Vorkommnisse mit dem Vater und die merkwürdigen Gedankengänge und wilden, inzestuösen Fantasien, die er damit verknüpfte. Glücklicherweise wusste der Vater nichts von dem, was im Kopfe des Sohnes vorging. Wenigstens der übereifrigen Religiosität Sebastians wollte der Engel Einhalt gebieten, damit die Entwicklung seines Schützlings nicht zu einseitig verlaufe. Er griff zu einem drastischen Mittel. Zu diesem Zweck suchte sich der Bote Gottes einen Bauernknecht aus, der im Dorfe noch keine Vergangenheit hatte und dessen Vorgeschichte gänzlich unbekannt war. Nur ein solcher wäre imstande den schwierigen und riskanten Auftrag zu erfüllen.
Seit einigen Monaten schon arbeitete auf einem Hof in unmittelbarer Nachbarschaft des Elternhauses von Sebastian, ein neuer Knecht. Die Dörfler nannten ihn nur "Icke", da er aus Berlin stammte und das Personalpronomen "ich" beim Sprechen grundsätzlich durch das mundartlich gefärbte "Ick" ersetzte, wie das im Dialekt der ehemaligen deutschen Reichshauptstadt üblich war. Neunundzwanzig Jahre alt war er, von großer, schlanker Gestalt und dunkelblond. Wie alle Knechte, die immer schwerste, körperliche Arbeit verrichten mussten, war auch er sehr stark und besaß einen außergewöhnlich muskulösen Körperbau. Er war zu allen sehr zuvorkommend und freundlich.
Sebastian machte die erste persönliche Bekanntschaft mit diesem Knecht zu der Zeit, als die kleinen, hurtigen Schwalben sich auf den Stromleitungen versammelten um gen Süden zu ziehen. An einem solchen Herbsttag machte Sebastian einen Spaziergang zu den sieben Quellen des Wildbaches, die sich unweit des Dorfes, am Fuße eines bewaldeten Hügels, befanden. Es war am Spätnachmittag, als er den gut aussehenden Knecht dort antraf. Ein Jagdgewehr hatte dieser bei sich. Mit Schießübungen verbrachte er offensichtlich seine knapp bemessene Freizeit. Sebastian erschrak das Gewehr nicht, da er längst daran gewöhnt war, denn im Dorfe besaßen viele Bauern eine Jagdflinte. Einige von ihnen waren sogar Jäger. Als Treiber hatte Sebastian schon öfters an einer Jagd teilgenommen. Man hatte als solcher die Aufgabe laute Schreie auszustoßen, damit die verschreckten Hasen ihre Verstecke verließen und in Panik flüchteten um dann von den Weidmännern abgeknallt werden zu können. Meistens operierte man in Gruppen von fünf bis zehn Mann. Außerdem hatte auch Marias strenger Vater eine Flinte. Damit schoss er, dann und wann einmal, wenn ihm danach war, auf Spatzen, da es so viele davon im Dorfe gab. Töten war also für Sebastian nicht problematisch, wenn es nur einen Sinn hatte. Er selbst züchtete Kaninchen, die er eigenhändig schlachtete, ausnahm und dann verkaufte. Außerdem hatte er noch seine eigensinnigen, tigergleichen Katzen, die jedes Jahr einige Male Junge warfen. Da musste er auch notwendigerweise töten, damit es ihrer nicht zu viele würden. Eine Sterilisation von Haustieren kam nicht in Betracht. Vielleicht war das letztlich besser für die Tiere.
Dieser bewaffnete, geschmeidige Knecht nun wünschte Sebastian einen schönen Tag und fragte ihn, ob er keine Lust dazu hätte, mit ihm ein bisschen auf die Vogelpirsch zu gehen. Dieses verlockende Angebot nahm Sebastian gerne an. Der schöne Icke und Sebastian streunten einige Zeit durch die Gegend, bis sie auf einer Stromleitung eine Gruppe von Schwalben antrafen. Der Landarbeiter nahm seine Büchse, legte an, zielte und schoss. Eine Schwalbe fiel zu Boden, der Rest des Schwarms flog aufgescheucht davon. Der kräftige Schütze und Sebastian gingen zur abgeschossenen Schwalbe. Sebastian hob sie auf und hielt sie in der Hand. Einen weißen Bauch hatte sie. Tiefblau bis schwarz waren die Flügel und der Rücken. Sebastian fragte sich, warum es gerade eine Schwalbe hatte sein müssen, die doch im Begriffe war, sich nach Süden aufzumachen. Schwalben waren in den Augen der Bauern nützliche Vögel. Darauf schoss man nicht. Auf den Höfen und in den Ställen jagten sie nach Fliegen und allerlei anderen Insekten. Darüber hinaus hatten sie etwas Geheimnisvolles, denn sie flogen jedes Jahr nach Afrika und kündeten immer wieder, schon seit ewigen Zeiten, den Frühling an. Sebastian wagte nicht dem Knecht auch nur das Geringste über seine Gedanken zu verraten. Sein Gewehr hielt dieser fest in der Hand, lächelte nur und schaute abwechselnd die tote Schwalbe und Sebastian an. Die kleine Schwalbe ließ Sebastian fallen. Ins Dorf gingen beide zurück. Unterwegs fragte er noch Sebastian, ob dieser abends, gegen acht Uhr, bei ihm vorbeischauen würde. Direkt, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, sagte Sebastian zu, obwohl es das erste Mal war, dass der Knecht ihn darum bat. Sebastian ging froh gelaunt nach Hause, nahm das Abendbrot zu sich und freute sich unterdessen schon sehr darauf, der Einladung des Landarbeiters Folge zu leisten. Gegen acht Uhr begab er sich auf den Weg zum Hofe, wo der Knecht ein kleines Kämmerlein unter dem Dach bewohnte. Die Treppe stieg er hinauf und klopfte an. Der Freizeitjäger öffnete. Sein Zimmer war überaus ordentlich aufgeräumt. Auf einen Stuhl setzte sich der freundliche Icke und Sebastian nahm auf dem Bett Platz. Eine gewisse Spannung spürte er schon, da die Augen des Knechtes so funkelten, ungefähr derart wie einige Stunden zuvor, beim Abschuss der Schwalbe. Äußerlich machte er einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Sebastian sah diese fordernden Augen und den sinnlichen Mund. Nach einer Weile fragte er Sebastian, ob er stark sei. Den Sinn dieser Frage verstand der unwissende Sebastian nicht recht, aber entgegnete dennoch spontan, dass sein Zwillingsbruder stärker wäre. Dies entsprach auch den Tatsachen, da er Sebastian körperlich weitaus überlegen war. Was sich jetzt abspielen sollte, war kaum vorstellbar. Der Engel aber hatte es so vorherbestimmt. Für Sebastian gab es kein Entrinnen. Unaufhaltsam nahm die Sache nun ihren Lauf. Er war wie gelähmt. In Trance befand er sich. Weder in die Handlung eingreifen konnte er, noch sich ihrer erwehren. Die Stimmbänder versagten. Obwohl er aus Furcht vor dem Ungewissen völlig handlungsunfähig war, fühlte er dennoch eine große Spannung.
Nachdem Sebastian vom Landarbeiter aufs Bett gelegt worden war, wurden seine Augen mit einem Handtuch abgedeckt. Sein Hosenschlitz wurde vorsichtig geöffnet. Dann war es eine Zeitlang still. Eine warme Flüssigkeit spürte Sebastian in seinem Schambereich. Keinen Laut hörte er. Direkt wurde die Flüssigkeit wieder abgewischt und der Hosenschlitz geschlossen. Kurz danach wurde ihm das Handtuch vom Gesicht entfernt. Vor ihm stand dieser junge, schöne Knecht. Das geheimnisvolle Lächeln auf seinem Gesicht und die strahlenden Augen waren geblieben. Steif vor Schreck war Sebastian, da er nicht wusste, was geschehen war. Der charmant-gefährliche Knecht sagte nichts. Stattdessen machte er eine Gebärde, die angeben sollte, dass Sebastian sich erheben könne. Der unergründliche Bursche ging zu seinem Kleiderschrank, holte dort eine Mundharmonika heraus und überreichte sie Sebastian als Geschenk. Mit diesem kleinen Blasinstrument in den Händen stand Sebastian auf und machte sich auf den kurzen Weg nach Hause. An jenem Herbstabend war es ein schwerer Weg. Trotz seiner völligen Verwirrtheit, dachte er jetzt wieder an die dunkelblaue Schwalbe, die nie mehr die Reise in jenes ferne Afrika machen könnte, von der die Großmutter immer die selbst gemachten und doch so faszinierenden Märchen erzählte. Die geladene Flinte des Knechtes war ihr, an jenem herbstlichen Nachmittag, zum Verhängnis geworden. Zu Hause wagte Sebastian es nicht den anderen Familienmitgliedern in die Augen zu schauen.
Unterwegs schon hatte er das glitzernde Instrument in die Hosentasche gesteckt. Dass niemand es sehen würde, hoffte er, denn er spürte in seiner Seele ein unbestimmtes Schuldgefühl. Die silberfarbene Mundharmonika versteckte er ganz hinten, tief unter der Wäsche, in einem Schrank, in der Hoffnung, dass niemand sie jemals finden würde. Seit diesem Abend mied Sebastian den attraktiven Knecht, weil er große Angst vor ihm hatte. Nach einigen Monaten war dieser, aus unerklärlichen Gründen, verschwunden. Sebastian atmete auf, dachte aber immer wieder an jenen mysteriösen Herbsttag.
Nachdem der Engel vierzehn Monate ohne nennenswerte Zwischenfälle hatte verstreichen lassen, auf dass sein Schützling sich erhole und unbeschwert heranreife, griff er wieder ein. Diesmal schickte er Sebastian das erste wirkliche Leid, denn dieser war jetzt bereits zehn und stark genug es zu ertragen.
Anfang Dezember begleitete Sebastian seine Großmutter wieder in die Stadt. Auf dem Hinweg nahmen sie die kürzere, aber beschwerlichere Route über die Berge. Schon nach einem Kilometer klagte die Großmutter darüber, dass sie dringend urinieren müsse. Es gab aber weit und breit kein Haus, in das sie hätten einkehren können. Mitten in den herbstlich-kahlen Feldern waren die beiden. Kurzerhand zog die Großmutter die Unterhose aus, steckte diese in ihre Handtasche, in der sich auch ihr Gebiss befand, hob ihre langen Röcke auf und pisste. Während sie dies machte, bat sie Sebastian, sich vor sie hinzustellen, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen, obwohl im weiten Umkreis keine Menschenseele zu sehen war. Sebastian tat, was ihm befohlen worden war. Sie meinte nur, von hinten sehe doch jeder gleich aus.
In der Stadt geschah dann noch einmal Vergleichbares. Der Harndrang wurde ihr zu heftig und sie musste wieder urinieren. In eine stille Ecke stellte sie sich einfach und machte die Beine ein wenig auseinander. Sebastian stand wieder vor ihr und sah, wie das Rinnsal sich langsam auf dem Trottoir einen Weg zur Bordsteinkante bahnte. Bis dahin schöpfte er noch keinerlei Verdacht, da ja die Großmutter, in seinen Augen, oft Unkonventionelles und Außergewöhnliches tat. Gerade das war der Grund, weswegen er die Großmutter so liebte und schätzte. Dieses Besondere an ihr zog ihn in ihren Bann. Er erinnerte sich an das eine Mal, als die Großmutter zum Lastenausgleichsamt ging und die dortigen Beamten so fürchterlich beschimpfte, weil sie meinte, dass sie noch einen finanziellen Ausgleich für eine Kuh zu bekommen habe, die ihr die Amerikaner, im Herbst Anno Domini MCMXLIV, beim Einmarsch in Aachen, abgeschossen hätten. Sebastian nahm sie immer zu solchen Behördengängen mit, denn er sollte wahrscheinlich an diesen praktischen Beispielen lernen, wie man mit den Staatsdienern umzugehen hätte. Ein anderes Exempel für die außergewöhnliche Persönlichkeit der extravaganten Großmutter waren auch wieder Kriegserfahrungen. Es betraf hier einerseits die nächtliche Evakuierung und andererseits die amerikanischen Soldaten. Sebastian hörte nur schöne Erlebnisse der Großmutter aus dem Krieg, obwohl auch einer ihrer Söhne gefallen war. Die nächtlichen Ausquartierungen, die wegen des Bombenhagels der Alliierten notwendig geworden waren, mochte sie ganz besonders. Die Leute, die nicht in östliche Regionen geflüchtet waren, mussten sich, während dieser Angriffe, in Kasernen mit dem Emblem des Roten Kreuzes begeben. Diesen Aufenthalt unter Schicksalsgenossinnen liebte die Großmutter. Es gab dort diese großen Schlafsäle mit Etagenbetten. Sie konnte dann, mehr oder weniger ungestört, mit allerlei Menschen reden und ihnen ihre Geschichten erzählen. Ein gewaltiges Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelte sich in diesen Bombennächten. Hier zeigte der furchtbare Krieg seine schönen Seiten, wie die Großmutter zu sagen pflegte. Auch hatte sie eine Schwäche für die GIs, obwohl sie ihr diese eine Kuh abgeschossen hatten. Was ihr an diesen Soldaten so gut gefiel, waren deren Ärsche. Sie erzählte immer, dass sie von ihrem Küchenfenster aus, als das Haus noch nicht zerbombt war, den Donnerbalken in ihrer Wiese sehen konnte, wo dann diese jungen, schönen, prallen, oft auch schwarzen Ärsche sich in ihre Blickrichtung wölbten und spreizten. Sie schwärmte davon, obwohl man im Allgemeinen feststellen konnte, dass ihre Beziehung zu Männern eher reserviert war. Vielleicht aus einer gewissen Entfernung wie bei diesen Soldaten, war ihr Verhältnis zu Männern ein besseres. Die Großmutter hatte fast nur Freundinnen, die aber auf Sebastian immer etwas unterkühlt wirkten. Ausschließlich allein stehende Frauen waren es, die irgendwann einmal verheiratet gewesen oder ihr Leben lang ledig geblieben waren. Der einzige männliche Besucher, den sie zuließ, war Herr Schütz. Er kam so dann und wann einmal vorbei und erwies der Großmutter die Ehre. Körperlich behindert war er und zwanzig Jahre jünger als sie. Einen großen Buckel hatte er und war noch ein Stückchen kleiner als Sebastian. Er besaß einen kleinen, o- beinigen, hellbraunen Hund mit abgeschnittenem Schwanz aus der Rasse der Zwergpinscher. Zwischen der Großmutter und diesem Herrn Schütz wurden aber keine Körperkontakte ausgetauscht. Was man sich höchstens hätte vorstellen können, wäre vielleicht ein Fußkuss von Herrn Schütz gewesen. Ob dies jemals geschehen war, wusste Sebastian nicht.
Es war jetzt an der Zeit, dass Sebastian sich wieder mit seiner Großmutter auf den Heimweg machte. Dezember war es und schon früh würde es dunkel sein. Immerhin betrug der Fußmarsch sieben Kilometer. Auf dieser Wanderung, zurück in jenes Tal, an die sieben Quellen des Wildbaches, bemerkte Sebastian die Kurzatmigkeit der Großmutter zum ersten Mal. Sie nahmen demzufolge auch nicht den Weg über die Berge, sondern gingen durch das Tal. Während des letzten Kilometers musste sich die Großmutter an fast jedem Zaunpfahl fest halten und sich stützen, um wieder freier atmen zu können. Erst spät kamen die beiden zu Hause an. Es sollte der letzte Ausflug der Großmutter sein. Einige Tage später viel sie von der Treppe; wie ein Mehlsack schlug sie auf. Mit Blutergüssen lag sie dann eine Woche lang im Bett und konnte kaum noch essen. Dann, direkt nach Weihnachten, erlitt sie ihren ersten Schlaganfall. Sebastian schlief noch in ihrem Zimmer, aber schon seit einiger Zeit nicht mehr in ihrem Bett. Gegen Morgen stand die Großmutter auf und mit einem gewaltigen Knall, aufgrund ihres Gewichtes, viel sie um.
Aufstehen konnte sie nicht mehr. Sebastian musste seine Eltern rufen, die auf dem Hof beschäftigt waren. Die Kühe mussten gemolken werden. Sie eilten herbei und hoben sie wieder ins Bett. Seit diesem Tag schliefen Sebastian und sein Zwillingsbruder im elterlichen Doppelbett und der Vater und die Mutter im Obergeschoss bei der Großmutter. Der Todeskampf hatte eingesetzt. Es sollte noch einige Tage dauern, bis die Großmutter ihren Geist aufgeben würde. Sebastian wagte sich nicht mehr ins Zimmer der Sterbenden. Eine schwere, traurige Zeit brach an. Am frühen Morgen des achtundzwanzigsten Dezembers verschied die Großmutter. Die Nachricht von ihrem Tode wurde Sebastian am folgenden Morgen von der Mutter überbracht. Das Allertraurigste war es, was ihm bis dahin jemals mitgeteilt worden war. Er weinte bitterlich. Eine Welt brach für ihn zusammen.
Da es in den Weihnachtsferien geschah, hatte er genug Zeit, genau mitzuerleben, wie solch ein Trauerfall abgewickelt werden würde. Am Nachmittag wurde die von Sebastian so heiß geliebte Großmutter, in weißen Laken gehüllt, von den Angestellten des Bestattungsunternehmens vom Obergeschoss hinuntergetragen und im Flur eingesargt. Noch ein letztes Mal kämmte Sebastians Mutter das rote Haar der Großmutter und der schwere Eichensarg wurde für immer verschlossen. Dieses letzte Kämmen beobachtete Sebastian aus sicherer Entfernung. Er war voller Trauer und konnte kaum fassen, was geschehen war. Die Großmutter war tot. Entschwunden für alle Zeit. In den ersten zehn Jahren seines Lebens hatte sie ihn begleitet. So vieles hatte sie ihn gelehrt. Der schwere Gang hinter dem Sarg zu ihrem Grab stand Sebastian noch bevor.
4. Kapitel
Anfang Januar wurde die Großmutter auf dem Waldfriedhof begraben. Obwohl sie des Öfteren den Wunsch geäußert hatte, man möge sie dereinst in aller Stille zur letzten Ruhe betten, wurde diesem Verlangen nicht entsprochen. In feierlichem Rahmen und unter großer Anteilnahme fand die Beisetzung statt. Ein Tag voller Freudlosigkeit war es für Sebastian. Nach dem Herablassen des Sarges in die Gruft erhob der Priester, der von zwei Messdienern begleitet wurde, von denen einer das Prozessionskreuz trug, seine Stimme und sprach: "Staub bist du und zum Staube kehrst du zurück." Jetzt hielt der Geistliche kurz inne und fuhr fort mit der Verheißung: "Der Herr aber wird dich auferwecken am Jüngsten Tage." Auch diese Worte der Hoffnung konnten Sebastian keinen Trost spenden. Ähnliche Formulierungen hatte er schon früher, beim Auftragen des Aschenkreuzes und im Religionsunterricht, gehört, aber jetzt, hier am Grabe seiner Großmutter, litt er darunter.
Glücklicherweise brachte die Schule genügend Abwechslung und Zerstreuung. Zu Ostern kam Sebastian schon ins fünfte Schuljahr.
Ohne Großmutter ging jetzt die Zeit dahin.
Kurz vor den Sommerferien fand immer ein Wandertag statt, an dem jeder teilnehmen musste. Seit Jahren schon hielt man es so, dass die Kleinen, damit waren die Schüler des ersten bis vierten Schuljahres gemeint, Wanderungen durch die nähere Umgebung machten. Die übrigen Klassen, vom fünften Schuljahr aufwärts, suchten fernere Ziele auf. Für Sebastian war das jedes Jahr wieder ein besonderes Ereignis, worauf er sich monatelang freute. Im vorangegangenen Jahr waren er und seine Mitschüler durch den Aachener Stadtwald gewandert. Dort hatten sie die alten Hügelgräber besichtigt. Viel war nicht mehr von ihnen übrig, aber Sebastian konnte sich vorstellen, dass sie einst als Begräbnisstätten gedient haben könnten.
Diesmal sollten die oberen Klassen, die etwa hundert Schüler umfassten, einen ganzen Tag ins Bergische Land fahren. Es war vorgesehen die Reise mit der Eisenbahn zu machen. Diese Dampfrösser liebte Sebastian ganz besonders. Sie machten auf ihn den Eindruck, unendlich stark und unverwüstlich zu sein, da sie über Jahrzehnte ihren Dienst, ohne schlappzumachen, versehen konnten. Einmal hatte er einundsechzig Wagons gezählt, die von solch einer kräftigen Lokomotive gezogen wurden. Fast unvorstellbar war ihre ungezügelte Kraft.
Man wollte über die spektakuläre Müngstener Brücke fahren, die in weitem Bogen die Wupper überspannte und anschließend die alte Schwebebahn in Wuppertal in Augenschein nehmen. Die Lehrerin erzählte, dass sie eines der ungefährlichsten Beförderungsmittel sei. Bis auf einen beklagenswerten Zwischenfall, der aber jetzt schon fast elf Jahre zurückliege, habe es nie schwer wiegende Unfälle mit dieser Hängebahn gegeben. Bei diesem Unglück sei eine junge Elefantenkuh namens Tuffi, durch unglückliche Umstände, aus der Schwebebahn kopfüber in die Wupper gefallen. Zu Werbezwecken für einen in der Stadt gastierenden Zirkus sei der noch unerfahrene Dickhäuter in die Fahrgastkabine hineingezwängt worden, wobei sich schließlich das Malheur ereignet habe. Trotz dieses gefährlichen Sturzes, sei er aber mit dem Leben davongekommen. Diese Geschichte beeindruckte Sebastian nicht sonderlich. Trotzdem war er im Nachhinein doch froh darüber, dass dieses arme Rüsseltier sich keine tödlichen Verletzungen zugezogen hatte.
Der Ausflug wurde in allen Einzelheiten vorbereitet, wodurch die Spannung sich nur noch steigerte. Endlich war es dann so weit.
Sebastian stieg zum ersten Mal in einen Zug. Nach sechzig Minuten schon erreichte die schnaufende Dampflokomotive Köln. Während der Überquerung des Rheins, für Sebastian war es die allererste, lehnte er sich aus dem Abteilfenster hinaus, obwohl es verboten war. Da es aber keinen Lehrer in der Nähe gab, der ihn davon hätte abhalten können, ging er das Risiko ein. Diese gigantischen, wunderschönen Doppeltürme des gotischen Domes, an denen so lange gebaut worden war, bewunderte er. Den friedlichen Strom, der langsam unter ihm dahinfloss, betrachtete er. Seine Haare wurden vom Winde zerzaust. Die Wassermassen machten ihn schwindlig. Die alten Karnevalslieder, die seine Großmutter immer sang, bemächtigten sich seiner Sinne. Er sah den Himmel, der so kornblumenblau war und den treuen Husaren in seiner mit Goldbrokat verzierten Uniform.
Das ratternde Geräusch - Metall auf Metall - hörte plötzlich auf. Die Überfahrt, die nur kurz gedauert hatte, war vollbracht und Sebastian schloss das Fenster. Die Türme des Domes entschwanden allmählich und wurden eins mit dem Horizont. In rasendem Tempo ging es weiter nach Solingen. Man stieg hinunter ins grüne Tal, dessen Hänge üppig bewaldet waren und gelangte an die Ufer der Wupper. Von dort unten betrachtete Sebastian diese gewaltige, eiserne Brücke. Obwohl das Bauwerk ihn in großes Erstaunen versetzte, war er dennoch ein wenig enttäuscht, dass er diese imposante Konstruktion doch nicht mit dem Zug überqueren würde, wie es ursprünglich vorgesehen war. Die Schulleitung hatte kurzfristig ihre Pläne geändert.
Man ließ flache Kieselsteine über das Wasser hüpfen. Je öfter diese wieder aufsprangen, desto besser war der Werfer. Es war ein schöner Anblick kompakte Steinchen zu sehen, die über das Wasser tänzelten.
Nachdem man sich genügend ausgeruht hatte, traten die Ausflügler den langen Fußmarsch nach Schloss Burg an, das sich am anderen Ufer des Flusses, in südlicher Richtung, befand. Stolz thronte das Schloss auf einem Felsen und erwartete seine Besucher.
Sebastian schaute sich vor allem die alten Ritterrüstungen an, denn sie übten eine große Faszination auf ihn aus und regten seine Fantasie an. Die wilden Schlachten des Mittelalters malte er sich aus, in denen diese Rüstungen von tapferen Kämpfern getragen worden waren.
Zum Abschluss fuhr man nach Wuppertal und sah diese Schwebebahn, die aber nicht sehr beeindruckend auf Sebastian wirkte. Zufrieden und glücklich kehrte er am späten Abend wieder an die sieben Quellen des Wildbaches zurück.
Langsam wurde er etwas selbstständiger. Immer seltener sah er Maria. Er konzentrierte sich auf die Religion. Im Laufe der Zeit wurde er streng religiös und betete viel. Den Gottesdienst besuchte er mehrmals wöchentlich. Er züchtete weiterhin Kaninchen. Auch musste er manchmal auf den Feldern des Vaters arbeiten, was ihm aber immer sehr schwer fiel, da es so monoton war. Aber seine Hausaufgaben machte er fleißig und gewissenhaft. Ins sechste Schuljahr kam er jetzt. Zuweilen ödete der Unterricht ihn an, aber er fand große Stärke in seinem Glauben.
Lange Passagen aus Schillers "Wilhelm Tell" musste er dann im siebten Schuljahr auswendig lernen. So wollte es der Lehrer. Der Inhalt dieses Schauspiels interessierte ihn aber fast gar nicht. Außerdem las man Stifters "Bergkristall". In dieser Novelle wurde beschrieben, wie sich zwei Kinder am Heiligen Abend, im von Eis und Schnee bedeckten Hochgebirge, verirrt hatten und fast erfroren wären. Das sprach Sebastian schon etwas mehr an.
Auch die traurige Geschichte von Krambambuli, dem verstoßenen Hund, der treu war bis in den Tod, wurde behandelt. Diese Erzählung der österreichischen Marie von Ebner-Eschenbach mochte Sebastian ganz besonders, denn er empfand großes Mitleid für dieses anhängliche Tier.
Für den Religionsunterricht musste er die Sonntagsevangelien auswendig lernen. Die Frage nach dem Warum, war ihm unklar. Eine wahre Tortur war der Kirchengesang, der jeden Samstag von zehn bis elf Uhr stattfand. Die Lieder für den sonntäglichen Gottesdienst wurden dann eingeübt. Unzählige Male musste man das Gleiche singen, weil der strenge, cholerische und nie zufriedene Dirigent, der unentwegt über sehr starke Magenschmerzen klagte, der Meinung war, es wäre noch nicht perfekt genug.
Im Zusammenhang mit seiner religiösen Erziehung musste Sebastian auch einmal an einer kurzen Wallfahrt nach Kevelaer teilnehmen. Dort sah er dieses Übermaß an brennenden Kerzen auf dem Kapellenplatz. Nicht imposant, so wie Sebastian sich das vorgestellt hatte, sondern bescheiden, fast unscheinbar, stand in dessen Mitte die kleine, sechseckige Gnadenkapelle. Mit großen Lettern hatte man an deren Außenseite einen kurzen Text angebracht. Dort, über dem Bogen des Hauptfensters, das dem Betrachter den Eindruck vermittelte, früher einmal als Haupteingang gedient zu haben, las Sebastian die lateinischen Worte "Consolatrix Afflictorum". Er schaute in diesen winzigen Raum hinein und erblickte das Bild der Trösterin der Betrübten, ohne dass es ihn ergriffen hätte. Aber alles das machte er, ohne zu murren, denn die Glut der Begeisterung, die der Glaube ihm einst geschenkt hatte, war noch nicht erloschen, obwohl es schon erste Anzeichen dafür gab, dass es geschehen würde.
Ab und zu bekam Sebastian ein starkes Verlangen nach der Ferne. Zu diesem Zwecke hatte er sich die Mauer im Flur, an der ein schwarzes Telefon hing und wo seine Großmutter einige Jahre zuvor eingesargt worden war, ausgesucht. In den weißen Kalk ritzte er die wohlklingenden Namen seiner Sehnsuchtsorte. Städtenamen waren es allesamt, die er aus Erzählungen und aus der Zeitung kannte. Diese eingekerbten Buchstaben machte er dann mit einem Bleistift schwarz-glänzend. Seine Mutter ließ es geschehen und beschwerte sich nicht darüber. Mitunter war sie jetzt sogar etwas vergnügter als früher und trällerte dann "Ännchen von Tharau" wie eine Nachtigal. Von Reichtum und immer währender Treue erzählte das Lied. Kündete es ein Aufleben der Mutter an oder war es ein letztes Aufbegehren, bevor sie in die völlige Apathie versinken würde? Sebastian konnte das plötzliche Singen der Mutter nicht deuten.
Nach einigen Monaten stand dort, an der weißen Wand, neben dem schwarzen Apparat, eine ganze Liste: London, Berlin, Brüssel, Luxemburg, Amsterdam, Paris, New York, Madrid, San Francisco, Sydney, Hongkong, Honolulu, Las Palmas und Jerusalem. Sebastian hatte die stille Hoffnung, dass diese Wörter einmal sein Verlangen nach der Ferne stillen könnten. Täglich sah er diese verheißungsvollen Namen im Vorübergehen. Jedes Mal, wenn er telefonierte, las er sie und seine Gedanken schwebten hinaus um an diese exotischen Plätze zu gelangen. Diese vierzehn Namen wurden allmählich zum Inbegriff seines Fernwehs. Würden es Stationen der Freude sein oder brachte dieser bunte Städtereigen Sebastian unsägliches Leid, so wie einst die Via Dolorosa dem Herrn?
Der Engel war zu der Überzeugung gekommen, dass sein Schützling die bisherige Schule, auf der er nur noch wenig Nützliches lernte, verlassen müsse, da sie ihm nicht mehr angemessen sei. Etwas Kaufmännisches hatte er für seinen Schützling vorgesehen, damit dessen Talent auf diesem Gebiet gefördert werde. Um dies zu erreichen, musste der Bote Gottes zunächst einmal versuchen Sebastian dazu zu bewegen, seine schulische Lage zu überdenken. Aufgrund dessen würde er von selbst zu der Einsicht gelangen, dass ein anderer Schultyp vorteilhafter für ihn sei. Mit einigem Hin und Her schaffte der Engel es den Wechsel herbeizuführen. Ausgerechnet die Worte des Herren sollten, unbeabsichtigterweise, dazu beitragen, dass es sich erfülle.
Als Sebastian vierzehn war, geschah es zuweilen, dass er den Nutzen des Auswendiglernens der Evangelien nicht mehr einsah. Er hielt es für unangebracht und empfand es als Schikane des Lehrers. Auch der Kirchengesang mit dem cholerischen Dirigenten war ihm zuwider. Er sehnte sich nach mehr Freiheit und interessanteren Fächern. Die Französische Revolution, die im Geschichtsunterricht jahrein, jahraus behandelt wurde, konnte ihn nicht mehr inspirieren. Die Enthauptung von Marie Antoinette ließ ihn unberührt, denn er hatte die tragische Geschichte schon zu oft gehört.
Von Freunden seines Zwillingsbruders hatte er erfahren, welche verschiedenen Lehranstalten es gab und wann man sich dort anmelden müsse. Es sollte keine handwerkliche Ausbildung werden, denn er dachte wieder an die Monotonie der Feldarbeit. Etwas Kaufmännisches sollte es schon sein. Die Wahl fiel auf die zweijährige Handelsschule. Er meldete sich einige Tage nach seinem fünfzehnten Geburtstag an. Glück hatte er, denn fast wäre der Termin verstrichen gewesen. Diese vierundzwanzig Monate wären überschaubar und täglich würde er in die Stadt zum Unterricht fahren. Nicht mehr mit dem Fahrrad wie zu seiner jetzigen Schule, würde er diesen Weg zurücklegen, sondern mit dem Bus. Es war schon aufregend, diese große Veränderung. Im April fing Sebastian an und erlebte den Unterricht als eine große Herausforderung. Jetzt richtete er sich behaglich in den beiden Zimmern der Großmutter ein und war ein gelehriger Schüler. Die Katzen, Kaninchen und Maria bedeuteten ihm nicht mehr viel. Was ihm besonders viel Spaß machte, war der Englischunterricht. Nach kurzer Zeit schon war er der Beste in diesem Fach.
Sebastian war jetzt bereits sechzehn und der Engel war der Ansicht, es sei an der Zeit, dass sein Schützling zur ersten Ejakulation komme. Bei dem unbändigen Albrecht fand der erste Samenerguss vor fünfhundertsechsunddreißig Jahren statt. Er zählte damals erst fünfzehn Lenze. Es geschah im Badezuber mit einer lüsternen und zügellosen Dienerin, die ihm beim Waschen behilflich war. Am Hofe, an dem sich Albrecht damals aufhielt, hatte man die Wollust zu einer Tugend erhoben und man tat alles Erdenkliche um ihr zu frönen.
Im Gegensatz zu einst, achtete der Bote Gottes jetzt mehr auf Einzelheiten. Auch das Alter zog er nunmehr in Betracht, da ein Unterschied von einem Jahre große Folgen haben konnte. Eine Dienerin oder Magd war jetzt nicht mehr dabei, damit Sebastian diesen Ausbruch der Reife ganz privat erleben könne.
Mittlerweile war er zu einem ansehnlichen Jüngling herangewachsen. Es ging ihm ausgezeichnet und er genoss das Leben in seiner ganzen Vielfalt. Seine schulischen Leistungen waren optimal und er besaß einige gute Freunde.
Sein Geschlechtsorgan, das einst von der Großmutter liebevoll "Pissmännchen" genannt worden war, hatte sich zu einem stattlichen Körperteil entwickelt. Dieser Ausdruck der Großmutter und die Theorie, die sie damals damit verbunden hatte, verleiteten ihn nun zu einem leichten Schmunzeln, da er den Humor zu schätzen wusste, der sich hinter jener großmütterlichen Äußerung verbarg. Wie verblüffend einfach doch ließ sich so manches Schwierige erklären.
Ab und zu hielt er sich jetzt mit Mitschülern in Lokalen auf, meistens samstags. Vor einem solchen Kneipenbesuch, nahm er ein wohl tuendes, warmes Bad. Man putzte sich aufs Feinste heraus.
Bei einem derartigen Badevergnügen merkte er, dass der Penis langsam steif wurde, durch das warme, angenehme Wasser sicherlich noch verstärkt. Er seifte seinen Schwanz ein und während dieses Einschmierens rieb er unwillkürlich immer kräftiger. Er konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Ihm wurde ein wenig schwindlig, aber seine Bewegungen wurden immer schneller und dann, mit einem Male, wurde eine weiße, schleimartige Flüssigkeit herausgestoßen, ohne dass er es hätte beeinflussen können. Er wurde fast ohnmächtig vor Schreck und Erleichterung. Die gesamte Muskulatur erschlaffte. Er wusste nicht, wie ihm geschah. War es vielleicht Eiter? Eine Entzündung konnte es eigentlich nicht sein, denn er hatte nie Schmerzen verspürt. Nach einiger Zeit legte sich die Verwirrung, denn er hatte festgestellt, dass dieser vermeintliche Eiter in ihm jedes Mal eine Wollust hervorrief, obwohl er das Geschehen noch immer nicht richtig einordnen konnte.
Die Schule absolvierte er erfolgreich im April und fing als Lehrling bei einem Geldinstitut mit der Ausbildung zum Bankkaufmann an. Er musste am Schalter die Kunden bedienen. Diese abwechslungsreiche Arbeit gefiel ihm sehr.
Einige Monate später, im Sommer, machte Sebastian seine erste, große Reise. Einen Monat lang fuhr er nach London. Er wollte sein Englisch ausprobieren. Seine Mutter meinte, er wäre noch zu jung, aber Sebastian war dies einerlei. Die Adressen von den Londoner YMCAs besorgte er sich beim britischen Verkehrsamt und buchte ein Zimmer. Er kaufte die Fahrkarte und begab sich Anfang August auf den Weg. Alles war neu für ihn. Siebzehn Lenze zählte er und hegte große Erwartungen.
Über Brüssel und Ostende fuhr der Zug. Von dort ging es mit dem Schiff nach Dover, dann wieder mit der Bahn weiter nach London, Victoria Station. Diese ganze Reise verlief ohne Zwischenfälle. Auf Sebastian wirkte die britische Hauptstadt sehr sensationell. Die ersten unglaublich kurzen Miniröcke bekam er zu Gesicht, die von ausgelassenen, übermäßig geschminkten Mädchen getragen wurden. Diese Kürze war atemberaubend.
Die alte Westminster Abbey mit all den toten Königen und Königinnen besuchte er. Im Tower sah er die kostbaren Kronjuwelen. Er schlenderte über die immer mit Autos, Bussen und Taxis verstopfte Oxford Street mit ihren einladenden Geschäften. Den riesigen Buckingham Palace und die majestätische St. Paul's Cathedral bewunderte er. Er besuchte Theatervorstellungen im Westend. Was Sebastian aber am meisten faszinierte, war die Londoner U-Bahn und der Flughafen Heathrow. Niemals zuvor hatte er ein unterirdisches Beförderungsmittel oder einen Airport gesehen. Tagelang fuhr er mit der Underground von einem Ende der Stadt zum anderen. Mindestens zweimal wöchentlich machte er den kurzen Ausflug nach Heathrow. Er nahm dann immer die Piccadilly Line nach Hounslow und von dort den Bus. Es waren diese roten Doppeldecker. Eine wahre Sensation war dann der Flughafen. Die landenden und aufsteigenden Flugzeuge sah er. In alle Himmelsrichtungen ging es: nach Paris, Hongkong, New York, San Francisco, Madrid, Amsterdam und Sydney. Es waren lauter Städte, die Sebastian nur aus Zeitungsberichten kannte und die er damals auf jener weißen Wand, an der das schwarze Telefon hing, voller Sehnsucht eingeritzt hatte. Das Fernweh machte sich in ihm breit. Ungeheuer stark war die Anziehungskraft des Flughafens. Sebastian hatte das Gefühl, hier, im turbulenten Heathrow und im altehrwürdigen London am Nabel der Welt zu sein.
In der vorletzten Woche seines Aufenthaltes entschloss er sich einen Tag nach Paris zu reisen. Sein erster Flug war es. Er kaufte das Ticket zum sensationellen Preise von nur zehn Pfund Sterling. Mit dem letzten Flug, spätabends, wollte er nach Paris und am nächsten Tag mit der allerletzten Maschine, gegen dreiundzwanzig Uhr, wieder an die Themse zurückkehren. Er hatte geplant, nach Ankunft in Paris, den Rest der Nacht am Flughafen Le Bourget zu verbringen und morgens mit dem Bus ins Zentrum zu fahren. Was Sebastian aber in seiner Euphorie nicht wusste, war die Tatsache, dass Flugreisende, mehr oder weniger, wie Bus- oder Bahnreisende behandelt wurden. Man musste selbst dafür sorgen, dass man zur rechten Zeit am richtigen Ausgang stand. Die Naivität Sebastians war manchmal, im wahrsten Sinne des Wortes, grenzenlos. Abends begab er sich also nach Heathrow, passierte den Zoll und saß in der Abflughalle. Er wartete und wartete und niemand kam, der ihn zum Flugzeug nach Frankreich begleitet hätte. Um Mitternacht ging er zur Zollkontrolle zurück und trug sein Anliegen vor. Die Beamten konnten nur mit dem Kopf schütteln, ob derartiger Arglosigkeit. Der Emigrationsstempel in seinem Pass wurde wieder annulliert und er begab sich nochmals zum Schalter der Fluggesellschaft. Dort wurde sein Ticket auf den folgenden Tag um acht Uhr dreißig umgeschrieben. Mit einem Taxi fuhr er enttäuscht in die City zurück.
Am nächsten Morgen geschah wieder das Gleiche. Sebastian war zu spät, denn er hatte sich verschlafen. Erneut musste die Abflugzeit um zwei Stunden verschoben werden. Diesmal schaffte er es. Um elf Uhr dreißig landete er in Le Bourget. Den Flug empfand er als eine große Sensation. Unglaublich war es. Zum ersten Mal befand er sich in dieser Weltstadt an der Seine. Während des Fluges schon hatte sich ein freundlicher Passagier angeboten, Sebastian bis zum Airterminal in Paris, am Dôme des Invalides, unter seine Fittiche zu nehmen. Geborgen und sicher fühlte er sich. An der Alexanderbrücke wurde er dann wieder seinem Schicksal überlassen. Gott sei Dank hatte er schon einige Dinge über Paris gelesen. Er wäre sonst verloren gewesen. Lost in Paris. An diesem Pont Alexandre III sah Sebastian zum ersten Mal die Seine. Er erblickte zu seiner Linken den Arc de Triomphe und zu seiner Rechten, in ganz weiter Ferne, die Silhouette des Louvre, am Ende der Champs-Elysées. Er drehte sich noch einmal um und der majestätische Invalidendom bot sich ihm in seiner vollen Schönheit dar. Dass unter der mächtigen Kuppel die Gebeine Napoleons ruhten, wusste er.
Sebastian marschierte diese Prachtstraße hinunter, besichtigte den Louvre, diesen riesigen Gebäudekomplex, von außen und begab sich in die Rue de Rivoli. Die großen Warenhäuser dort bewunderte er und ging immer weiter, in der Hoffnung, dass er später den Rückweg zum Dôme des Invalides bequem finden würde, wenn er nur immer geradeaus ginge.
Äußerst wenig Geld hatte er in London umgewechselt. Ein Taxi konnte er sich deswegen nicht leisten. Auch besaß er keinen Stadtplan. Er musste also seinen Spaziergang durch Paris auf gut Glück durchführen. Unterwegs wurde er noch von einer Zigeunerin angesprochen, aber die verstand er nicht, da er fast kein Französisch sprach. Lediglich ein paar Worte beherrschte er, die er von seiner Tante Eugenie aus Brüssel gelernt hatte. Am Nachmittag machte er sich wieder auf den Rückweg zum Invalidendom, wo sich der Airterminal befand. Bis zu den Tuilerien schaffte er es, dann aber verließ ihn sein Orientierungsvermögen. Er sprach Vorübergehende an, aber keiner wusste, was er wollte. Schließlich kam doch einer, der die Worte "Air France" anscheinend verstand, richtig interpretierte und ihm mit Gesten deutlich machte, in welche Richtung er sich zu begeben hätte. Letztendlich kam er, fast der Verzweiflung nahe, am Airterminal an. Der Bus brachte ihn nach Le Bourget und das Flugzeug von dort nach Heathrow. Kurz vor Mitternacht landete er in London, erschöpft und unendlich müde. Dort nahm er ein Taxi in die Innenstadt. Als er endlich im Bett lag, war er glücklich und in Sicherheit, denn der Ausflug nach Paris hatte ihn sehr angestrengt. Während seiner letzten Woche in England dachte er noch oft an die französische Hauptstadt.
Ende August reiste Sebastian wieder über Brüssel nach Aachen zurück. Auch hatte er beschlossen, so schnell wie möglich Französisch zu lernen.
Im Herbst schrieb er sich bei einer Privatschule für einen Abendkurs ein. Zweimal wöchentlich fanden die Doppelstunden statt. Daneben meldete er sich bei einer Fahrschule an, weil er den Führerschein mit achtzehn haben wollte. Der theoretische Unterricht war abends, einmal wöchentlich. Diese Stunden bestanden daraus, dass einem die notwendigen Kenntnisse, die für die Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr unentbehrlich waren, beigebracht wurden. Sebastian lernte alles über Verkehrsschilder, Vorfahrtsregeln und Parkverbote. Das tatsächliche Autofahren geschah dann zweimal in der Woche während der Mittagspause. Sechzig Minuten dauerte die Praxis jeweils. Für Sebastian stellte das kein Problem dar, weil er eine neunzigminütige Brotzeit hatte. Darüber hinaus meldete er sich noch bei einer Tanzschule an. Einmal in der Woche ging er fortan dorthin. Ein volles Programm hatte er also jetzt zu bewältigen, aber er war noch jung und liebte diese Hektik. Tagsüber musste er natürlich noch die Arbeit am Bankschalter verrichten. Die Tanzstunden machten Sebastian nur wenig Freude. Er lernte zwar die klassischen Tänze, wie Walzer, Foxtrott, Cha-Cha-Cha, Paso doble und Tango, aber es gab nichts Sensationelles daran. Während der ersten Stunde mussten die Jungen und Mädchen noch getrennt tanzen. Glücklicherweise hatte Sebastian schon nach sehr kurzer Zeit eine feste Tanzpartnerin gefunden, mit der er sich gut verstand.
Die Fahrschule war zwar interessant, aber konnte keineswegs als spannend bezeichnet werden. Schon beim ersten Mal, einen Monat vor seinem achtzehnten Geburtstag, bestand Sebastian die Fahrprüfung. Noch dreißig Tage musste er auf seinen Führerschein wachten, bevor man ihn ihm aushändigte.
Der Französischkurs war jedoch sehr sensationell. Die Lehrerin machte einen großen Eindruck auf Sebastian. Zwanzig Jahre älter als er war sie und eine gebürtige Belgierin. Trotz ihres Alters wirkte sie noch sehr jugendlich. Sie sprach fließend Deutsch, obwohl ihre Muttersprache Französisch war. Da sie den Unterricht sehr abwechslungsreich gestaltete, war das Erlernen der Vokabeln eine reine Wonne. Die Beziehung zwischen ihr und Sebastian, die anfänglich ausschließlich auf das Schulische beschränkt war, wurde im Laufe der Monate immer privater, ohne dass er es hätte verhindern können. Das Verhältnis zwischen ihm und dieser Lehrerin entwickelte sich immer eigenartiger und bizarrer. Dies führte letztendlich auch zum Bruch zwischen ihnen.
Diese attraktive Frau war geschieden und hatte zwei Töchter, die aber nur am Wochenende bei ihr wohnten. Die restliche Zeit fristeten sie in einem ostbelgischen Internat, das von streng katholischen Nonnen geleitet wurde. Jeglicher Kontakt zu jungen Männern war den Mädchen unter Androhung von körperlicher Züchtigung verboten.
Ihr Ex-Mann, von dem sie seit einigen Jahren schon geschieden war, lebte in Hamburg und hatte sich eine neue Existenz aufgebaut. Seine jetzige Lebensgefährtin war etliche Jahre jünger als er. Diese beiden hatten bereits wieder eigene Kinder und die zwei Töchter aus erster Ehe kümmerten den Vater nicht mehr.
Sebastian genoss den überaus interessanten Unterricht der kapablen Dozentin. Ihr Lächeln war äußerst charmant und ihre Bewegungen graziös. Es war eine Lust ihr zuzuhören und sie zu beobachten. Aber wie sich nach kurzer Zeit schon herausstellen sollte, hatte sie eine äußerst negative Eigenschaft. Sie war ausgesprochen nymphoman veranlagt. Immer wieder neue Männer suchte sie, junge und alte. Auch vor Schülern oder Studenten schrak sie nicht zurück. Sebastian zeigte sie sich, aus fingierten Gründen, immer wieder nackt oder in Reizwäsche.
Anfangs empfand er dies noch als ein besonderes Vorrecht, aber schon rasch wurde es für ihn abstoßend und widerlich. Als sie merkte, dass sie mit ihrem eigenen Fleisch nicht zum Zuge kam, musste ihre eigene Tochter herhalten. Diese war drei Jahre jünger als Sebastian.
Der Engel wusste, was geschehen würde und ließ es zu, auf dass sich die Vorsehung erfülle.
Eines Tages sagte die Lehrerin zu Sebastian, dass sie gerne wolle, dass er ihrer ältesten Tochter die Unschuld nähme. So drückte sie sich aus. An Maria dachte Sebastian und sagte, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, zu. Die Tochter sollte an einem Sonntag alleine mit Sebastian in der Wohnung der Lehrerin sein. So hatte sie es eingefädelt.
Das fünfzehnjährige Mädchen saß auf der Couch und Sebastian näherte sich ihr. Alles ging sehr mechanisch. Sebastian nahm sie in den Arm und mit der freien Hand griff er ihr zwischen die Schenkel. Sie wehrte sich nicht. Sie sagte nichts. Sie saß nur einfach da. Nach kurzer Zeit zog Sebastian ihr die Unterhose aus und betastete ihre Schamlippen und spreizte sie. Er rieb ein wenig und es wurde feucht. Er drehte sie auf den Bauch, damit er weiterarbeiten konnte ohne ihr Gesicht sehen zu müssen. Einmal auch probierte er, in sie einzudringen, aber es gelang nicht. Sebastian hörte auf. Das Mädchen zog sich an. In ihren Augen konnte er die schwere Enttäuschung und große Traurigkeit sehen, die sie während des Aktes empfunden haben musste. Die erste Kopulation war misslungen. Es war keine Lust dabei. Ein missglückter, mechanischer Vorgang war es, der nur stattfand, weil ihre Mutter, die Kupplerin, es gewollt hatte.
Sebastian blieb weiter im Französischkurs, aber distanzierte sich von der Dozentin. Diese akzeptierte die Haltung von Sebastian. Der Engel hatte unterdessen den Beschluss gefasst, dass sein Schützling im zweiten Jahr seiner kaufmännischen Ausbildung erneut an die Sexualität herangeführt werden solle, damit eine ausgewogene Entwicklung gewährleistet sei. Dazu erwählte er einen Jüngling von zwanzig Jahren.
An einem Samstagabend im Sommer geschah es, dass Sebastian zusammen mit seinem Schulfreund die Stadt auf der Suche nach Abenteuern durchstreifte. Dieser Kumpan war mehr oder weniger schon mit dem städtischen Ausgangsleben vertraut. Für Sebastian war dies alles neu. An jenem Abend hatte der Begleiter den bizarren Einfall, dass man einmal, zur Abwechslung, in eine gewisse Kneipe gehen könne, in der sich hauptsächlich Männer trafen. Sebastian war zwar ein bisschen misstrauisch, aber sagte dennoch zu. Es gab damals in Aachen ein berühmtes Lokal mit dem Namen "La Boutique". Diese Gaststätte, die auch eine kleine Tanzfläche besaß, lag in der Nähe des Elisenbrunnens. Dorthin begaben sich Sebastian und sein Kamerad. Der Freund drückte den Klingelknopf und die Tür öffnete sich. Eine Wolke von Parfum drang nach draußen und die beiden wurden aufs Herzlichste hereingebeten. Eine eigenartige Atmosphäre herrschte in diesem klubähnlichen Lokal. Männer tanzten eng umschlungen miteinander. Sanft und melancholisch war die Musik. Sebastian spürte, dass es etwas Besonderes war. Nach kurzer Zeit schon sagte der Gefährte, dass er genug der Schwulen gesehen hätte. Er wollte wieder hinaus. Sebastian folgte ihm, aber er musste immer wieder an diese merkwürdige Kneipe zurückdenken. Das Wort "Schwule" übte auf ihn eine große Faszination aus, da der Freund diesen Ausdruck niemals vorher benutzt hatte und im Ton seiner Stimme etwas Verächtliches gelegen hatte. Instinktiv wusste er aber auch, dass dieses Wort etwas Tabuisierendes und gleichzeitig Negatives in sich barg.
Die Atmosphäre in der Gaststätte war irgendwie anziehend. Schon einige Wochen später ging Sebastian wieder in dieses "La Boutique". Diesmal war er jedoch alleine, da er den Schulfreund nicht darum bitten wollte, ihn dorthin zu begleiten. Die Art und Weise, wie dieser vor fast einem Monat das Wort "Schwule" ausgesprochen hatte, machte deutlich, dass er in diesen Kreisen offensichtlich nicht verkehren wollte.
Sebastian genoss die Zuwendungen und das Interesse, das ihm entgegengebracht wurde. Zum ersten Mal tanzte er mit einem Jungen. Das Paradies schien ihm nah. Was um ihn herum geschah, merkte er nicht mehr. Er fühlte die Erektion seines Tanzpartners. Die Welt fing an sich zu drehen. Er war im Rausch. Für Sebastian blieb die Zeit stehen. In ihm stieg die Lust auf. Es war das Nonplusultra dessen, was er bisher kannte. Dieser blonde, geschmeidige, zwanzigjährige Tanzpartner lud ihn dann noch zu einem Bier ein und brachte ihn zum Bus. Es war der Letzte, der Sebastian in die Nähe jenes Tales bringen konnte, wo der elterliche Bauernhof sich befand. Da es aber noch eine Weile dauern würde, bevor der Omnibus käme, benutzte der schöne Tänzer diese Zeit für sein Vorhaben. Sebastian ahnte nichts davon und war glücklich, dass er zur Haltestelle begleitet wurde. Der Tanzpartner schlug ihm vor, dass man sich noch kurz in eine Baustelle zurückziehen könne, die sich schicksalhafterweise am Straßenrand befand. Obwohl ihm jetzt doch langsam klar wurde, was geschehen würde, ging er mit. An einer nicht von der Straße aus sichtbaren Ecke stellte sich der Liebhaber vor Sebastian und begann, dessen Gesicht sanft zu streicheln. Anschließend bedeckte er es mit heißen, feuchten Küssen, wobei seine Zungenspitze abwechselnd in die Nasenlöcher und in die Ohrmuscheln eindrang. Sebastian fühlte, dass ihm das Blut zu Kopfe stieg. Der galante Verführer ließ seine Hose und Unterhose unmerkbar sinken.
Sebastian spürte den sich aufrichtenden Schwanz seines Partners. Die warmen Schenkel, die Rundungen der Arschbacken, die harten Brustwarzen und die Lippen berührte er voller Verlangen. Ein leichtes erwartungsvolles Zittern erfasste seine Hände. Mit den Fingern fuhr er zärtlich durch das samtweiche Haar desjenigen, der sich ihm jetzt hingab. Es war eine himmlische Sensation. Körper und Geist wurden gleichermaßen bis aufs Äußerste aktiviert. Man erlebte eine ungekannte Hemmungslosigkeit. Alles bisher Dagewesene wurde übertroffen. Sebastian und sein Tanzpartner kamen zur Explosion. Sie wurden zu Zeugen eines gewaltigen Ereignisses, dessen Initiatoren sie selbst waren. Diese alles übersteigende Erfahrung sollte Sebastian fortan stark prägen. Auf dieser Baustelle, an jenem Abend, hatte er ein Stück des Paradieses erfahren.
Der Engel war dabei und hieß es gut, denn er hatte es so vorbestimmt, damit sein Schützling rechtzeitig die unbezähmbaren Begierden kennen lerne, die von der Wollust entfesselt werden konnten.
Sebastian erreichte noch gerade den Bus. Die letzten zwei Kilometer musste er zu Fuß gehen, in jenes Tal, an den sprudelnden Quellen des Wildbaches. Er empfand jetzt diesen Weg, den er so oft mit seiner Großmutter gegangen war, als wohl tuende Erleichterung. Die frische, kühle Nachtluft tat ihm gut. Sein Engel musste erneut eingreifen. Er hatte die Aufgabe ihn zu führen, zu beobachten und zu beschützen. Also entschloss er sich dazu, Sebastian diesmal an den Abgrund des Möglichen zu führen. Es musste sehr drastisch sein, damit sein Schützling nicht zu leichtsinnig werde und sich seine Überschwänglichkeit keinesfalls noch mehr steigere. Der Bote Gottes wusste, dass die Enttäuschung, die der Euphorie folgen würde, umso größer wäre, je länger die Ernüchterung auf sich warten ließe.
Die Freude über das Vorgefallene war so groß, dass er seiner Kollegin, am Arbeitsplatz auf der Bank, von seinen amourösen Abenteuern berichtete. Die arglistige Frau aber, diese verräterische Kreatur, unterrichtete den Bankdirektor. Am folgenden Morgen wurde der unwissende und liebende Sebastian, in der Blüte seines Lebens, zum Direktor zitiert. Ihm wurde direkt ins Gesicht geschleudert, dass er sexuellen Umgang mit Männern hätte und daher erpressbar wäre. Außerdem seien diese Handlungen abartig, pervers und darüber hinaus sogar, nach dem Paragrafen einhundertfünfundsiebzig des StGB, strafbar. Die Bank, als Ausbilder, habe die Pflicht seine Eltern zu informieren. Wie gelähmt war Sebastian und unfähig etwas zu erwidern. Schweigend ging er wieder an seinen Schreibtisch zurück und sah dabei seiner Verräterin in die Augen. Diese Unglückselige wich seinen vorwurfsvollen Blicken aus. Sebastian bediente die Kunden weiter, etwas missmutig zwar, aber doch korrekt. Für ihn war eine Welt zusammengebrochen. Die Vorstellung, dass die Eltern seinen Blick ins Paradies, von offizieller Seite zu hören bekämen, war für ihn unerträglich. Die Großmutter, die Starke und Emanzipierte, die durchaus liberal und in sexuellen Angelegenheiten so offen und fortschrittlich war, lag schon lange im kühlen Grabe. Sie konnte Sebastian nicht mehr helfend zur Seite stehen. Die Mutter, die sich schon vor vielen Jahren in die Passivität zurückgezogen hatte, litt an sich selber und war im Grunde asexuell. Auch der Vater, sehr orthodox und auf sich selbst konzentriert, bot keine Alternative. Sebastian befand sich in einer lebensbedrohlichen Krise. Er hatte das Gefühl, die ganze Welt wäre gegen ihn. Wie sollte er sich jetzt entscheiden? Im Laufe jenes Arbeitstages nahm die Lösung konkrete Formen an: Selbstmord in Paris. Lost and dead in Paris.
Am Spätnachmittag hob Sebastian eine bescheidene Summe Geldes von seinem Konto ab, die gerade zur Deckung der Reisekosten ausreichte. Nach der Arbeit ging zum Bahnhof und löste eine Fahrkarte nach Paris. Diese Stadt war ihm ja noch bekannt. For ever lost in Paris.
Den Eiffelturm hatte er während seines ersten Besuches nicht besichtigt. Er kehrte an jenem Abend, im Herbst, nicht mehr in dieses schöne Tal, an der holländischen Grenze, zurück, sondern saß im Zug in die französische Metropole. Das Ziel hieß: La Tour Eiffel. Morgens, gegen fünf Uhr kam er, ohne jedes Gepäck, am Nordbahnhof an. Über die Rue du Faubourg St-Denis und den Boulevard de Sébastopol gelangte er im Morgengrauen an die Ufer der Seine. Er folgte diesem Fluss stromabwärts, Richtung Eiffelturm. Feucht und kalt war jener Tag im November und er wusste, dass es sein letzter Fußmarsch sein würde. Gegen neun Uhr fuhr er hoch, bis ganz oben. Dort wollte er springen und würde von allem befreit sein. Dieser Gedanke der absoluten Freiheit beflügelte ihn. Die Angst fiel von ihm ab. Eine große Ruhe und ungeheure Leere breitete sich in ihm aus. Er schritt auf das Geländer zu, damit sein sehnlichster Wunsch sich erfülle.
Festentschlossen ergriff er diesen letzten Halt und ließ seinen Blick in die Ferne schweifen.
Sebastian sah Paris, wie es sich den Schwalben darbot. Dieses wunderschöne Panorama machte einen so großen Eindruck auf ihn, dass er wieder neue Hoffnung schöpfte. Er hatte zwar kein Geld mehr, aber er wollte nur noch hinunter. Er war verloren in Paris. Jetzt hatte es sich buchstäblich bewahrheitet. Sebastian stand, ohne einen Pfennig, mitten in der französischen Hauptstadt, aber er hatte eine Läuterung erfahren.
In Aachen würden jetzt die ersten Suchaktionen anlaufen und die Kunde von seinen homosexuellen Handlungen bekannt werden.
Sebastian ließ dies kalt, denn er dachte jetzt nur noch an das nackte Überleben in Paris. Zur Mittagszeit knurrte ihm der Magen. Kein Geld, kein Essen! Sebastian versuchte die beschwerliche Rückreise per Anhalter zu bewältigen, aber das erwies sich als ein schwieriges Unterfangen. Er kam nur äußerst langsam voran. Bis zu den sieben Quellen des Wildbaches dauerte es achtundvierzig Stunden: ohne Essen, ohne Trinken und ohne jeglichen Schlaf. Sebastian war völlig gebrochen. Als er zu Hause ankam, machte seine Mutter ihm den schwer wiegenden Vorwurf, dass er mit Männern geschlafen habe. Für Sebastian war es, wie ein scharfer Stich mitten ins Herz. Wie konnte eine Mutter es wagen, einem heimgekehrten Sohn, diese vernichtenden Worte, die wie vergiftete Pfeile wirkten, als Begrüßung entgegenzuschleudern? Sebastian wünschte sich seine Großmutter, die Unersetzbare, zurück, damit sie ihn, einer aufgebrachten Löwin gleich, die auf Leben und Tod um ihre Jungen kämpfte, verteidigen könne.
Der Engel sah all dies und war zufrieden, denn es war unabdingbar, dass es geschehe, weil die Vorsehung es so gebot. Fiat voluntas tua, Domine!
5. Kapitel
Sebastian legte sich erst einmal ins Bett und wollte mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Vor allen und allem verschloss er sich. Die Mutter bat ihn zu essen, aber er weigerte sich etwas zu sich zu nehmen. Der Vater sah den verzweifelten Sohn, aber unternahm nichts. Die Brüder von Sebastian griffen nicht ein. Nur der Engel hielt die Wacht und sah Sebastian, den Leidenden, den Märtyrer und den aller Hoffnungen Beraubten. Er griff noch nicht ein, weil Sebastian erst zu sich selbst finden müsse. Nur noch die Zeit konnte die Wunden heilen.
Die Lehre war dahin. Niemals mehr wollte er zu dieser Bank zurück, die ihn so abrupt ins Unglück gestürzt hatte. Alleine der Gedanke daran, war für ihn schon wahrer Horror. In seinen hasserfüllten Vorstellungen hätte diese doppelzüngige Verräterin auf dem Schafott enden müssen, genauso wie damals Marie Antoinette. Sein unbändiger Zorn und seine beinahe unstillbaren Rachegelüste gingen sogar noch weiter. Selbst die Guillotine wäre eine noch zu milde Strafe für diese tückische, niederträchtige Schlange gewesen. Er hätte sie am liebsten steinigen lassen, wie es in solchen Fällen, bei abtrünnigen Verräterinnen und Vertrauensbrecherinnen, früher, im alten Arabien, Usus war. Nur diese grausamste aller Strafen hätte ihm Genugtuung verschafft, da sie Vertrauliches so schamlos verraten hatte.
Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos et te, pater, orare pro me ad Dominum, Deum nostrum.
Aus diesem verdammt schönen Tal wollte er weg. Der Umgang mit den Eltern fiel ihm schwer, die jeden Abend um sieben Uhr die Nachrichten hörten und darüber diskutierten, ob die Preise für Rindfleisch gestiegen oder gesunken waren. Das Leben wurde ihm zu einer unerträglichen Last. Diese Männergeschichte empfand er jetzt als etwas, dessen er sich schämen müsste. Er konnte nicht mehr in diesem Dorf leben, wo alles so standardmäßig ablief. An diesen sieben Quellen des Wildbaches, wo Männerliebe ein unüberwindliches Tabu war, geistig Zurückgebliebene als billige Arbeitskräfte eingesetzt wurden und Mägde wie Freiwild gejagt werden konnten, wollte er nicht mehr bleiben. Diesem schönen Tal, wo die katholische Kirche, diese heilige und apostolische, ihre Tentakel ausstreckte und jeden gnadenlos erdrückte, der aufmüpfig wurde, wollte er entfliehen. Sebastian hasste die Kirche, das Gebetbuch mit den lateinischen Texten und den Rosenkranz, sowohl den glorreichen als auch den schmerzhaften. Alles das hasste er, was er früher einmal so geliebt hatte. Er wollte nach London, New York oder Australien. Weit weg sollte es sein. In ihm war das Chaos ausgebrochen. In äußerster Bedrängnis und großer Not war Sebastian und wusste nicht, dass er einen Engel hatte, dessen einzige Aufgabe es war, ihn zu beobachten und zu beschützen. Sebastian war am Ende seiner Kräfte. Das Leben war für ihn ausgelebt. Er flüchtete sich in sich selbst und ließ keinen an sich heran. Gefühle tiefen Hasses, großer Verzweiflung und krankmachender Ohnmacht wechselten einander in hohem Tempo ab. Seine Gedanken drehten sich in einem Teufelskreis. Dieses gefährliche Fieber höhlte ihn aus. Es schwächte seinen Geist und seinen Körper. Der Lehrvertrag mit der Bank wurde aufgelöst, denn für Sebastian war dieser Weg nicht mehr relevant. Seine Mutter schaltete in dieser fast aussichtslosen Situation ihren zweitältesten Sohn ein. Er war zehn Jahre älter als Sebastian und zum damaligen Zeitpunkt schon verheiratet. Früher hatte er ihm immer diese herrlichen Nusseckchen mitgebracht. Zum Arbeitsamt musste dieser Sohn, der Bruder, Sebastian schleppen, damit er in einem anderen Betrieb seine Lehre beenden könne. Dieser Versuch zur Wiedereingliederung kam Sebastian vor wie ein viel zu kleines Nadelöhr, wo er sich mit aller Gewalt hindurchzwängen musste. Ganz allmählich versöhnte er sich mit dem Gedanken, dass er die Lehre beenden müsste. Man suchte für ihn eine Stelle bei einer internationalen Speditionsfirma. Sebastian nahm seine Arbeit wieder auf, obwohl sie ihm keinen Spaß machte. Diese zweite Lehre sollte nur dreißig Monate dauern. Die Gewissheit, dass es nur von kurzer Dauer sei, bewog ihn dazu, die Ausbildung anzutreten. Stundenlang musste er Frachtbriefe ausfüllen und unzählige Rechnungen kontrollieren. Eine furchtbarere und uninteressantere Tätigkeit war für ihn kaum vorstellbar. Ab und zu musste er, über das Gericht, eine Zwangsvollstreckung bei Kunden durchführen lassen. Im Grunde ödete diese Arbeit ihn an. Er überdachte seine Lage und kam zu dem einsichtigen Entschluss, dass er erst einmal die Lehre zu einem guten Ende bringen müsste. Eine Schule würde er danach wieder besuchen, das Abitur machen und anschließend an einer Universität studieren. Die Fächer waren ihm auch schon klar. Am liebsten würde er sich mit Englisch und Französisch beschäftigen, denn diese Sprachen liebte er. Als Endziel schwebte ihm der Lehrerberuf vor. Durch diese neue Zielsetzung wurde ihm die Arbeit bei der Speditionsfirma erträglicher und manchmal ging er auch ganz in ihr auf.
Der Engel sah, dass Sebastian guten Willens war und gewährte ihm, um sein Leben etwas zu versüßen, ein kleines Intermezzo mit einem fast gleichaltrigen Mädchen.
In jener Zeit geschah es, dass Sebastian die schöne Veronika traf. Sie stand bereits im Ruf sich mit jedem einzulassen.
Sebastian dachte, dass er bei ihr leichtes Spiel haben würde. Er überlegte, wie und wann er sie ansprechen könnte. Eines Tages sah er sie dann wieder im Bus. Da er wusste, wo sie diesen verlassen würde, blieb er einfach bis zu dieser Haltestelle sitzen. Sie stieg aus und er folgte ihr. Die pralle Veronika war noch Schülerin. Sebastian wusste nicht, ob sie selbst überhaupt Französisch auf der Schule lernte, die sie besuchte. Dessen ungeachtet aber sprach er sie einfach an und bat sie, ihm Französischstunden zu geben, da er so schlecht in diesem Fach sei, was aber nicht stimmte. Die junge Abiturientin reagierte wohlwollend. Sie sagte, dass Französisch eines ihrer Lieblingsfächer sei und dass sie es gut beherrsche. Man machte eine erste Verabredung in der Stadt, in einer ruhigen Gastwirtschaft und übte sowohl Vokabeln als auch Satzkonstruktionen. Diese Kneipe, in der sie sich zu Unterrichtszwecken aufhielten, lag in der Nähe der Antoniusstraße. In jenen Tagen reihte sich dort ein Bordell an das andere. Veronika störte das wenig und Sebastian überhaupt nicht. Die Wirtin, eine überaus freundliche Frau mittleren Alters, der man noch ansah, dass sie früher einmal im Milieu ihr Geld hatte verdienen müssen, ließ die beiden ruhig gewähren.
Sebastian hatte zuweilen sogar den Eindruck, dass es ihr eine willkommene Abwechslung war, auch einmal Gäste zu haben, die zwar nicht viel verzehrten, aber dafür eine gewisse Unschuld mitbrachten, wodurch sich das Ambiente in ihrem Lokal angenehm veränderte. Von den leichten Mädchen, die diese Wirtschaft frequentierten, wurden die beiden Lernenden unbehelligt gelassen. Stündlich bestellte man ein Getränk, damit die Kosten sich in Grenzen hielten. Mitunter machte Sebastian absichtlich Fehler, damit Veronika ihr Können als Lehrerin unter Beweis stellen konnte. Bereits schnell merkte Sebastian, dass dieses talentierte Mädchen anders war als ihr Ruf. Einen ernsthaften Charakter hatte sie und über alles Mögliche konnte man mit ihr reden. Die liebenswürdige Veronika stimulierte Sebastian sogar zu seinem Vorhaben den Lehrerberuf zu ergreifen.
Die Nachhilfestunden in Französisch wurden bereits schnell von zwei auf vier je Woche erhöht. Jeweils am Dienstag- und Freitagabend fanden sie statt. Nach kurzer Zeit schon merkte Veronika, dass falsch gespielt wurde. Dies sagte sie auch, leicht verärgert zwar, aber dennoch mit einem Schmunzeln, Sebastian.
Diesem war der zu erwartende Zwischenfall ein wenig peinlich. Ab jetzt unterhielt man sich über wichtigere Sachen. Sebastian erzählte ihr seine Geschichte und auch, warum er sie angesprochen hatte. Das Sexuelle wies sie direkt kategorisch zurück. Die wertvolle Freundschaft aber, die mittlerweile entstanden war, pflegte man weiter, obwohl Sebastian fortwährend das Gefühl hatte, dass von seiner Seite mehr investiert werden müsse als von der ihrigen. Diese kluge Veronika war im Grunde ein guter Mensch, aber sehr theoretisch. Sie wollte immer, dass man ihr lange Briefe schrieb und darin irgendein Problem analysierte und ausführlich eine These, Antithese und Synthese formulierte. Wie in den Aufsätzen sollte es sein. Er tat ihr den Gefallen, weil ihm ihr Wohlwollen und ihre Zuneigung sehr wichtig waren. Die liebenswürdige, zuweilen philosophierende Veronika hatte großen Einfluss auf Sebastian. Klar war ihm aber nicht, ob sie sich dessen bewusst war. Zwischen ihnen ist es nie zu sexuellen Handlungen gekommen, obwohl das anfänglich sicher Sebastians Absicht war.
Der Engel schaltete sich wieder ein und lenkte Sebastians Schritte in eine andere Richtung. Er wusste noch von seinem vorigen Schützling, zu welch einer verfahrenen Situation die Störung einer gleichgewichtigen seelischen und körperlichen Entwicklung führen könne. Frustration, Verklemmtheit und Menschenscheu waren dabei noch die geringsten Übel.
Damals im April zu Nürnberg, vor fünfhundertsechsunddreißig Jahren, hatte der Engel ein einziges Mal nur den Versuch unternommen, den schürzenjagenden Albrecht die süßen Früchte der Amour bleu kosten zu lassen. Zu jener Zeit war dieser achtzehn Jahre und seine ersten Kriegserfahrungen in Böhmen hatte bereits gesammelt. Das gleiche Alter hatte auch Sebastian, als der Bote Gottes ihn an die kurze Liebe heranführte, für die er so schwer büßen sollte. Aber das lag jetzt schon fast ein Jahr zurück und die geschlagenen Wunden waren geheilt.
Im Falle des manchmal zur Zote neigenden Albrechts gebot die Vorsehung damals, dass ein kräftiger Stallknecht von neunzehn Jahren sich ihm, dem noch ein bisschen Pummeligen, eines Abends näherte, um ihn zu bitten, beim Zäumen der Pferde behilflich zu sein. Während dieser Tätigkeit gerieten ihre jungen Körper ungewollt aneinander. Der Engel war der Ansicht, dass es jetzt der rechte Augenblick sei, den unbändigen Albrecht den Liebesakt ausführen zu lassen, auf dass die unliebsamen Zwischenfälle mit den nymphomanen Mägden, die sich drei Jahre zuvor bis ins Exzessive hinein gesteigert hatten, einigermaßen kompensiert würden. Ein unbeschreibliches Fiasko wurde es, da der schöne Knecht und der etwas rundliche Albrecht völlig ratlos waren. Sie hätten zwar gerne ihr Bedürfnis befriedigt, aber sie waren beide etwas zu zögerlich. Der athletische Knecht war zurückhaltend, weil es sein sozialer Status so erforderte und Albrecht hatte keine einschlägigen Erfahrungen mit Stallknechten, da die üppigen Mägde ihm zu Dienste waren. Der Engel hatte aus diesem unglücklichen Vorfall seine Lehre gezogen. Sebastian hatte er deswegen im Laufe von achtzehn Jahren peu à peu in alle Bereiche der Sexualität eingeführt. Er war sich daher sicher, dass seinem jetzigen Schützling nicht das Gleiche widerfahren würde wie dem ratlosen Albrecht vor mehr als fünfhundert Jahren.
Der Bote Gottes war der Auffassung, dass Sebastian jetzt für den folgenden sexuellen Kontakt reif wäre, denn seit dem letzten Liebesabenteuer waren schon mehr als zehn Monate vergangen. Zu diesem Zwecke suchte er sich einen jungen Mann aus, der fünf Jahre älter war als Sebastian. Ein Holländer sollte es sein. Neunzehn war Sebastian nun und ein frischer Bursche. Er hatte seine festen Zukunftspläne und strahlte wieder einen leichten Optimismus aus.
Eines Abends, gegen Ende des Frühlings, ging er zum ersten Mal wieder in eine Bar. Der Weg führte ihn nach Maastricht. Von einem Arbeitskollegen hatte er erfahren, dass es dort, an den Ufern der Maas, einen Klub gäbe, in dem hauptsächlich Schwule verkehrten. Die Begriffe homo-, bi-, hetero- und asexuell waren Sebastian mittlerweile geläufig. Die Wörter Schwuler, Hundertfünfundsiebziger und warmer Bruder waren fester Bestandteil seines Vokabulars geworden, obwohl er sie noch immer mehr oder weniger als Schimpfwörter empfand. Er machte sich also an einem Samstagabend auf den Weg nach Vaals. Dort nahm er den Bus. Gegen zehn Uhr betrat er, unter Herzklopfen, diesen Klub in Maastricht. An jenes "La Boutique" dachte er wieder, wo seine Misere angefangen hatte, wo er aber auch diesem wunderbaren Tanzpartner begegnet war. Er nahm an der Theke Platz und bestellte ein Bier. Die Bedienung sprach, wenn man das wünschte, auch mehr oder weniger gut Deutsch. Im Laufe des Abends kam ein junger Holländer und forderte Sebastian zum Tanze auf. Die Sinnlichkeit erwachte wieder und die Hoffnung auf das, was kommen sollte, erfüllte Sebastian. Er hieß Paul und stellte sich dermaßen beschützend auf, dass Sebastian sich nur in diese Sicherheit fallen zu lassen brauchte. Für ihn begann jetzt eine Zeit voller Hingabe und Liebe. Sie gab ihm all das, wonach er sich so lange gesehnt hatte. Auf der Arbeitsstelle verlief alles ohne nennenswerte Zwischenfälle. Zuhause gab es keine Unstimmigkeiten mehr. Der Vater und die Mutter diskutierten weiter über die sinkenden oder steigenden Fleischpreise. Sebastian genoss sein Leben. Paul und er unternahmen jetzt viele Reisen. In Luxemburg sah er das tief eingeschnittene Tal der Pétrusse mit den weit gespannten Bogen der alten Brücke und in London, das er schon gut kannte, wieder das bunte Treiben am Piccadilly Circus sowie die edlen Geschäfte in der Bond Street. Er bewunderte in Nîmes das römische Amphitheater und den seltsam schönen Stadtpark. In Amsterdam bestaunte er den königlichen Palast auf dem Dam und die Grachten mit den alten Kaufmannshäusern.
Über die Grand' Place in Brüssel schritt er an einem Samstag und ließ die reich verzierten Gebäude und kleinen Paläste, die diesen Großen Markt umsäumten, auf sich einwirken. Am Eingang der Maison du Roi sah er die kleine Gedenktafel zur Erinnerung an die Hinrichtung des Grafen von Egmont vor mehr als vierhundert Jahren. Sebastian musste sich schon arg bücken um die Inschrift auf diesem schmucklosen Stein überhaupt lesen zu können.
Am späten Vormittag des fünften Juni Anno Domini MDLXVIII erblickte dieser Edelmann, im Alter von fünfundvierzig Jahren, zum allerletzten Male diesen wunderschönen Platz, der immer voller Schaulustiger war. Er wurde enthauptet, weil man glaubte, er sei ein Verräter gewesen.
Hier in Brüssel griff der Engel wieder ein, auf dass sein Schützling sich vollends von der Pariser Frustration befreie. Er schickte Sebastian eine Vision und ließ ihn ein wenig in das Geheimnis des Todes eintauchen.
Sebastian schaute wie gebannt auf den Text und las noch einmal die ersten Worte: "Devant cet édifice..." Er war aufnahmebereit. Touristen wurden zu spanischen Soldaten, die, dem Ereignis angemessen, dunkle Uniformen trugen. Die großen, schwarzen Tücher, die an dem Holzgestell der Hinrichtungsstätte herabhingen, gaben diesem Schafott eine feierliche Würde. Die beiden brennenden Kerzen und das aufgestellte Kruzifix sollten vermutlich darauf hinweisen, dass alle Schuld schon im Vorhinein getilgt worden sei. Etwas Friedvolles verliehen sie dieser sich anbahnenden Tragödie. Gleichzeitig aber gaben sie diesem makabren Geschehen auch etwas Unabwendbares.
Nur ein einziger kräftiger Schlag mit scharfer Klinge und das Tor zum Paradies stünde offen. Bedeutete es für den Verurteilten, der mit abgeschnittenem Hemdkragen und in Schwarz gehüllt dort die Stufen erklomm, eine Erlösung, auf diesem Altar des Todes geopfert zu werden? Hätte der Bischof von Ypern die Kraft, Lamoraal trösten zu können, oder besaß der Graf selbst genug Stärke, diese letzten Minuten zu durchstehen? Vermutlich war ihm klar, dass es eine Umkehr nicht geben würde. Mit einem Male sah Sebastian sich selbst, dort oben, auf der freiwillig auserwählten Opferstätte des Eiffelturms und spürte wieder diese Befreiung, die er auf dieser Plattform erfahren hatte. Jetzt wusste er, dass Lamoraal auch dieses Gefühl der absoluten Freiheit gespürt haben musste, bevor ihm die Augen mit einem schwarzen Lappen abgedeckt wurden. Als er dann seine Knie zum letzten Mal beugte und den entblößten Nacken dem Henker darbot, damit ihm der Kopf vom Rumpf getrennt werde, war er bereits dermaßen entrückt, dass Irdisches ihn nicht mehr berührte.
In manus tuas Domine, commendo spiritum meum.
Wie lange sein eigener Dämmerzustand angehalten hatte, wusste Sebastian nicht. Dadurch, dass Paul zu ihm sagte, man habe jetzt aber genug Zeit an der Gedenktafel zugebracht, kehrte Sebastian wieder in die Gegenwart zurück. Die spanischen Söldner waren wieder friedliche Touristen. Erst jetzt sah er auch noch den Namen eines zweiten Hingerichteten auf der Gedenktafel, aber das sollte Sebastian nicht weiter beschäftigen, denn es war nicht von Wichtigkeit. Ausschließlich Lamoraals tragisches Schicksal barg die ungeheure Kraft in sich, derer es bedurfte, Sebastian in diesen tranceartigen Zustand zu versetzen. Der Tod des Grafen war unausweichlich, auf dass sich die Vorsehung und der Wille des Königs von Spanien erfülle.
Durch dieses Egmontsche Drama, das Goethe schon inspiriert hatte, erhielt dieser Marktplatz zusätzlich etwas Erhabenes. Hier in der belgischen Hauptstadt musste Sebastian auch an seinen eigenen Namenspatron denken, der, mehr als tausend Jahre früher als der Graf, auf grausame Weise, auch sein noch junges Leben lassen musste. Erst wurde er von spitzen Pfeilen durchbohrt und anschließend mit schweren Keulen erschlagen. Sowohl Lamoraal von Egmont als auch der heilige Sebastian waren zu ihren Lebzeiten Militärs gewesen. Vermutlich hatten sie selbst als Soldaten auch getötet und die Rache Gottes hatte sie eingeholt.
Das "Mannecken-Pis", das Pissmännchen, wie die Großmutter zu sagen pflegte, diese barocke, flügellose Putte, die immer während pissende, die an einer unscheinbaren Straßenecke, auf einem Sockel stand, munterte Sebastian wieder auf.
An der Côte d'Azur erblickte er das blaue Meer und sah die kleinen Städte mit den Namen fast aller Heiligen. Traumhaft schön war es.
Die Sexualität konnte sich zwischen ihnen frei entfalten.
Sebastian machte alles, wozu er Lust hatte und was Paul gefiel. Ihre Körper lernten sie in allen Einzelheiten kennen. Die Freude und Lust aneinander nahmen kein Ende. Eine Zeit des unaufhörlichen Rausches war es. Die Arbeit wurde zur Nebensache. Alles drehte sich um Paul, seine Zuneigung und seine Gegenwart. Seine braunen Augen waren leuchtende Sterne. Seine wundervoll geschwungene Nase wurde zum Vorboten und sein Schwanz zum Gipfel der Wollust. Sebastian wurde dies alles dargeboten und geschenkt. Im siebenten Himmel wähnte er sich. Es war die Zeit der ersten großen Liebe. Fast vollkommen schien es, bis auf den einen Punkt, der die Euphorie manchmal störte. Dies waren die Zukunftspläne von Sebastian.
Die Zeit floss wie ein Strom ohne Unterlass dahin. Der Winter kam und einige Monate später kündeten die ersten Schwalben wieder den Frühling an. Sie nahmen ihre alten, angestammten Nester in Besitz, zogen ihre Jungen auf, wirbelten beim Insektenfang durch die Lüfte und zogen im Herbst wieder nach Afrika. Manchmal noch dachte Sebastian an jene Schwalbe, die er damals, vor elf Jahren, tot in den Händen gehalten hatte. Paul hatte er die Geschichte von der kleinen Schwalbe und dem geheimnisvollen Knecht nie erzählt. Es war schon zu lange her. Was mit der glitzernden Mundharmonika, auf der er niemals gespielt und die er in irgendeinem Kleiderschrank versteckt hatte, geschehen war, wusste er nicht. Vielleicht lag sie noch dort, in der Erwartung, gefunden und bespielt zu werden. Möge sie, genauso wie die Schwalbe, in Frieden ruhen, so dachte Sebastian.
Et lux perpetua luceat eis.
Beide, das Instrument und der Vogel, hatten nicht das ausführen können, wozu sie geschaffen worden waren.
Es wurde Frühling und die Schwalben kamen wieder. Sebastian war gerade einundzwanzig geworden und beendete seine Lehre als Speditionskaufmann. Etwas Neues musste her. Er hatte noch immer den Lehrerberuf im Kopf und wollte dieses Ziel auch unbedingt verwirklichen. Paul berichtete er von seinem Vorhaben. Auch sagte Sebastian, dass man sich dann trennen müsse, weil er diese Vorbereitung auf die Hochschulreife nicht in Aachen, sondern in Neuss oder Bielefeld machen würde. Paul wohnte in Maastricht. Weit würde die Entfernung sein, aber nicht unüberwindbar.
Für das katholische Kolleg in Neuss hatte Sebastian sich entschieden. Ab und zu kam Paul noch, aber die Liebe ging unter unsagbaren Schmerzen zu Ende. Trauer und Verzweiflung hatte Sebastian glücklicherweise schon kennen gelernt und konnte deswegen, jetzt schon etwas besser, damit umgehen. Er hatte gelernt sie sinnvoll zu kanalisieren.
6. Kapitel
Im August kam Sebastian nach Neuss. Dort, an den Ufern des Rheines, die Brentano schon so überschwänglich gelobt hatte, schrieb er sich als Studierender am Friedrich-Spee-Kolleg ein. Der Name der Schule ließ Schlimmes erahnen. Der fromme Jesuit Friedrich, dieser einfühlsame Beichtvater der Hexen, der vor dreihundertsechsunddreißig Jahren an der Pest gestorben war, hatte dieser Lehranstalt seinen Namen gegeben. Fünf Semester sollte die Studiendauer betragen.
Der Engel war der Meinung, dass sein Schützling jetzt eine kleine Reise machen müsse. Die ehemalige deutsche Reichshauptstadt solle das Ziel sein, auf dass Sebastian sich von einer hinderlichen Frustration aus seiner Kindheit befreie.
In den Herbstferien schon begab er sich denn auch auf einen kurzen Ausflug nach Berlin. Er sah diese geteilte Stadt, die unüberwindliche Mauer und die beiden sehr unterschiedlichen Gesellschaftssysteme. Der kommunistisch gefärbte Sozialismus und der amerikanisch geprägte Kapitalismus prallten hier schonungslos aufeinander. In West-Berlin, das dem westdeutschen Standard vergleichbar war, betrachtete er, vor den Toren des barocken Schlosses Charlottenburg, die einäugige, unendlich kühl wirkende Nofretete, diesen wertvollen ägyptischen Gipskopf mit nur noch einem intakten Ohr.
In Ost-Berlin besichtigte er den architektonisch sehr hässlichen Alexanderplatz. Das sozialistische Grau in Grau der Gebäude machte Sebastian leicht depressiv. Gleichzeitig aber hatte er den Eindruck, dass das tägliche Leben hier etwas menschlicher als im Westen sei. Es schien, als ob die Zeit in diesem Ostteil der Stadt etwas gemächlicher dahinflösse. Unwillkürlich kam ihm hier, auf diesem traurigen Alexanderplatz der starke und gefährliche Knecht wieder in den Sinn. Er musste diese Stadt noch ungeteilt, aber dafür in Schutt und Asche erlebt haben. Für diesen geheimnisvollen Kinderfreund empfand Sebastian jetzt einen Hauch von Mitleid. Vermutlich war er sogar ein Opfer der russischen Soldaten geworden, wodurch sich seine Tat von dereinst erklären ließe. Damals, bei der Eroberung Berlins musste er vierzehn gewesen sein. Welches schwere Kreuz musste er getragen haben, da er unentwegt auf der Hut sein musste, auf das sein Vergehen nicht entdeckt werde. Sebastian sah wieder dieses Gewehr, hörte den Schuss und blickte in die funkelnden, schwarzen Augen des Knechtes und stellte sich jetzt vor, wie es gewesen wäre, wenn dieser raffinierte Icke ihm in jenen fernen Kindertagen, vor zwölf Jahren, nicht das Handtuch über die Augen gebreitet hätte. Er kam jetzt allmählich zu der Überzeugung, dass der schöne Knecht dieses Abdecken der Augen nur vorgenommen hatte um ihn zu schützen. Es hatte etwas Liebevolles und sehr Behutsames in der Art und Weise gelegen, wie dieser heimatlose Landarbeiter mit dem weichen Frotteetuch Sebastian das Augenlicht für eine kurze Zeit genommen hatte. Er konnte ihm jetzt die große Schuld, die er einst auf sich geladen hatte, vergeben. Sebastian versuchte sich nun sogar vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn er den mysteriösen Vorgang von damals hätte sehen und bewusst miterleben können. Vielleicht wäre dann die Angst, die er in jenen Tagen dem athletischen Knecht gegenüber empfunden hatte, erst gar nicht aufgekommen.
Die beginnende Depressivität war verschwunden. Sebastian begab sich frohgemut zum Checkpoint Charlie und überschritt die innerdeutsche Grenze. Am Bahnhof Zoo stieg er in den Eilzug, der ihn von der Spree wieder an den Rhein zurückbringen sollte.
Berlin war tatsächlich eine Reise wert! Dieser Werbespruch, den Sebastian schon sooft auf Plakaten an Litfass-Säulen gesehen hatte, entsprach tatsächlich der Wahrheit. Die Millionen, die der bundesrepublikanische Staat in diese Kampagne gepumpt hatte, waren demnach sinnvoll investiert worden. Was Sebastian aber mitunter als eine ungeheure Anmaßung empfand, war die Tatsache, dass die Bundesrepublik sich ex cathedra als alleinige Repräsentantin des gesamtdeutschen Volkes bezeichnete. Dieser Westteil von Berlin, diese Insel des übermäßigen Konsums, war schon längst von der Geschichte überholt worden. Aber immer noch diente dieses anachronistische Überbleibsel inmitten der DDR den Bonner Politikern als Paradepferd und Aushängeschild, das täglich die Wonnen der vermeintlich freien Welt verkündete.
In Neuss lernte Sebastian sehr viel Neues. In den Philosophiestunden interessierte ihn die Stoa ganz besonders.
Diese Lehre besagte, dass es erstrebenswert sei, mit der Natur und folglich mit sich selbst in Einklang zu leben. Versuchen solle man, so weit das möglich sei, seine Neigungen und Affekte der rationalen Einsicht unterzuordnen, damit das Emotionale zurückgedrängt oder ganz ausgeschaltet werde. Diese geistige Haltung, seine Gefühle in Zaum zu halten, könne man üben und sich auf diese Weise, gegen etwaige Krisen, besser schützen. Sebastian saugte, wie ein ausgetrockneter Schwamm, die theoretischen Abhandlungen des Lehrers in sich hinein. An seine eigenen Erfahrungen dachte er, die ihm manchmal so viel Leid gebracht hatten. Das Emotionale hatte er jetzt schon etwas besser unter Kontrolle. Wenn er jedoch, zielgerichtet, seinen Geist dermaßen trainieren könnte, dass ihn der seelische Schmerz, aber auch die Freude, nicht mehr so berührte, hätte er vielleicht die Chance, ein zufriedeneres Dasein führen zu können. Diese Vorstellung der geistigen Unverwundbarkeit faszinierte Sebastian. Das Auf und Ab der Gefühle würde durch eine rationalere Einstellung zwar abgeflacht, aber das Leben würde dadurch ruhiger und ausgeglichener sein. Sich nicht an etwas oder jemanden zu binden würde auch bedeuten, nicht jedes Mal wieder die Pein des Abschieds und des Verlustes ertragen zu müssen. Diese stoische Philosophie, auch wenn sie nur teilweise zu verwirklichen wäre, schien Sebastian wie ein Meilenstein auf dem Wege seiner Erkenntnis.
Viel Wissenswertes wurde auch im Fach Religion unterrichtet. Das Projekt: "Wer war Jesus?" empfand er als ganz besonders interessant. Ein Jahr lang fast behandelte der Religionslehrer, der einsichtige, meisterhaft dieses spektakuläre Thema.
Unumstritten war er ein Kenner der Exegetik. Über die Entstehungsgeschichte des Neuen Testaments und dessen sehr unterschiedliche Autoren diskutierte man, wobei sich manchmal unter einem Namen verschiedene Personen verbargen. Erörtert wurde die Rolle der Propheten. Die Bibel rückte man in ihren historischen Kontext. Die päpstlichen Dogmen und Enzykliken las und interpretierte man.
Nun, da der Schleier des Mystischen etwas gelüftet war, konnte Sebastian klarer sehen. Jetzt war er in der Lage, die katholische Kirche besser einzuschätzen und ihre sexualfeindliche Haltung wurde ihm verständlicher.
Vor allem aber zu den Evangelien, die er früher einmal auswendig lernen musste, hatte er nun einen leichteren Zugang. In ihnen gab es gewisse Wahrheiten, die konnte er gutheißen.
Mit den Augen eines Historikers betrachtete er jetzt die Entwicklung des Glaubens. An seinen Gemeindepfarrer und an die Großmutter dachte er und hoffte im Nachhinein, dass die beiden an diesem lehrreichen Projekt teilgenommen hätten. Vermutlich wäre ihnen die Theologie dadurch näher gebracht worden und hätten sie besser damit umgehen können.
Alles wurde relativiert. Hell erstrahlte das Licht der Erleuchtung. Der kindliche Glaube, der Sebastian in Aachen gepredigt worden war, gehörte jetzt der Vergangenheit an. Offener und weniger dogmatisch wurde alles. Es blieben sogar Punkte übrig, die unvereinbar waren, aber deswegen nicht negiert wurden. Oritur in tenebris ut lumen rectis, clemens et misericors et justus.
Sebastian lernte Latein, Griechisch und Hebräisch. In der Bibelauslegung übte er sich. Außerdem beschäftigte er sich mit römischen Schriftstellern. Aus der "Germania" von Tacitus und aus den "Amores" von Ovid wurde zitiert.
Der Geschichtsschreiber Publius Cornelius Tacitus, so lautete vermutlich sein Name in voller Länge, hatte das, was er über die Vorfahren der Deutschen wusste oder zu wissen glaubte, in einem Buche zum Besten gegeben. Der Nachwelt hat er dadurch eine bunte Mischung aus Historie und Fantasie hinterlassen. Er berichtete von den vielen Stämmen, die in Germanien ihr Unwesen treiben würden. Unter ihnen seien solche, die größtenteils aus Faulenzern und Trinkern bestünden. Nur dann würden sie aus ihrem Dauerrausch erwachen, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen auszutragen gelte. Daneben gebe es aber auch einen Stamm, dessen Mitglieder entsetzlich arm seien. Ihnen sei aber gerade aufgrund dessen das Schwerste und Herrlichste gelungen: nämlich wunschlos glücklich zu sein.
Von heiligen Hainen, in denen Götter verehrt würden und von jungen Kriegern, die zu feierlichen Anlässen nackt zwischen aufgepflanzten Schwertern anmutig umhertänzelten, erzählte er. Abschließend tat er noch kund, dass sich hinter Germanien vermutlich das Ende der Welt befinde, denn dort gehe die Sonne überhaupt nicht mehr unter.
Der Dichter Publius Ovidius Naso, so hieß er offiziell, hatte jahrhundertelang anonym das Himmlische der freien Liebe gepriesen. Er fasste die höchsten Wonnen des Menschen in Reime. Von nackten Mädchen, festen Brüsten, vollen Hüften und strammen Schenkeln dichtete er in überschwänglichen Worten. Über begehrende Blicke und buhlende Männer, die ihr Ziel zur Mittagszeit bei halb offenen Fensterläden erreichten, schrieb er. Sowohl bei Tacitus als auch bei Ovid ging es zwar um Profanes, aber trotzdem trug auch dies dazu bei, dass sich Sebastians Einstellung zur Religion änderte.
Man klärte Sebastian über den Buddhismus und die damit verknüpfte Reinkarnation auf. Diese Wiederverleiblichung faszinierte ihn, da den Gläubigen dadurch die Angst vor dem Tod größtenteils genommen wurde.
Auch vermittelte man ihm Wissenswertes von Allah und den einhundertvierzehn Suren des Korans. Diese göttlichen Offenbarungen, die der Prophet Mohammed zu Anfang des siebten Jahrhunderts in Mekka und Medina verkündet hatte, deckten sich teilweise mit dem Inhalt der Bibel. Nicht auf einen Zufall beruhte diese Ähnlichkeit, sondern sie war zwangsläufig, da das heilige Buch des Islams aus der Heiligen Schrift hervorgegangen war.
Die Universalität der Religionen brachte man ihm bei. Der tiefe Graben der Intoleranz, der sich zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hatte, stieß bei Sebastian zuweilen auf Unverständnis. Des ungeachtet aber versuchte er die unterschiedlichen Standpunkte zu verstehen. Das Wissen um die geschichtlichen Hintergründe konnte er sich dabei zunutze machen, wodurch vieles erträglicher wurde. Eine neue, verständlichere Welt tat sich Sebastian auf. Auch die scheinbare Notwendigkeit der Religionskriege konnte er nachvollziehen, obwohl sie ihm absurd erschienen. Selbst er hatte aus eigener Erfahrung lernen müssen, dass bewaffnete Auseinandersetzungen mitunter unausweichlich waren. Es lag im Wesen aller lebender Kreatur, bei tatsächlicher oder vermeintlicher Gefahr aggressives Verhalten zu zeigen oder zu flüchten, auf dass man überlebe.
Feindbilder waren genauso wichtig wie Ikonen und Weltanschauungen. Durch sie war man imstande sich voneinander abzugrenzen, auf dass der Streit zwischen den Verblendeten und Uneinsichtigen immer wieder neu entbrenne.
Zum Abschluss des Jesus-Projektes, im Herbst, machte man eine Reise nach Israel um die heiligen Stätten zu besuchen. Sebastian kam nach Jerusalem, Bethlehem, Jericho und an den See Genezareth. Auf dem Weg nach Jericho, dieser uralten Stadt, wo der Herr einst den kleinen Oberzöllner Zachäus auf einem Maulbeerbaum antraf, sah Sebastian den Jordan und dachte an Johannes den Täufer. Im See Genezareth, wo die Fischer, auf Geheiß des Herrn, fast vor lauter Meeresfrüchten mit ihren Booten untergegangen wären, so schwer waren die Netze, schwamm Sebastian, ohne auch nur einen Fisch gesehen zu haben.
Seiner Mutter schickte er einmal eine Ansichtskarte mit der Geburtskirche des Herrn aus Bethlehem und eine weitere aus Jerusalem, auf der die Klagemauer der Juden zu sehen war, da er wusste, dass die Mutter sich darüber freuen würde. Sie war auch katholisch und mit diesen Städtenamen nebst deren Geschichte aufgewachsen. Beim Schreiben dieser Karten dachte er, dass es schon ein Glück sei, dass die Mutter Jerusalem, aber vor allem Bethlehem nie sehen würde, weil es dann hätte geschehen können, dass sie ihren Glauben verloren hätte. Es war gänzlich anders, als man es sich in seinem kindlichen Glauben ausmalte. Besonders in Bethlehem konnte Sebastian feststellen, dass seine romantischen Vorstellungen sehr weit von der Wirklichkeit entfernt waren. Dieser Geburtsort des Herrn war kein katholisches Dorf, wie er sich das während der Christmetten beim Singen des Liedes "Zu Bethlehem geboren" immer vorgestellt hatte, sondern eine arabische Kleinstadt. In unzähligen, kleinen Andenkenläden verkauften moslemische Händler die begehrten Devotionalien. Kreuze, Dornenkronen und Rosenkränze gab es im Überfluss und in allen Größen und Farben. Zuweilen sah Sebastian auch, dass Touristen und Pilger um diesen religiösen Plunder feilschten. Wer ein frommer Wallfahrer oder nur ein Reisender war, blieb dabei unklar. Beides floss ineinander. Aber vom Glauben fiel Sebastian deswegen nicht ab, denn er hatte an diesem aufschlussreichen Projekt des Religionslehrers teilgenommen. Er konnte alles richtig einordnen und einigermaßen relativieren.
Bei weitem die interessanteste Stadt in Israel war für Sebastian Jerusalem. Dort musste er, in den Hängen der Knesseth, Unkraut jäten. Nicht aus heller Begeisterung an der Verschönerung des Parks oder zur körperlichen Ertüchtigung geschah das, sondern es war eine fünftägige Pflichtübung, weil die Reise unter der Aktion Sühnezeichen stattfand. Sie wurde aufgrund dessen, finanziell sehr großzügig, von der Bundesrepublik, unterstützt.
Auch den Ölberg besuchte Sebastian, wo die Himmelfahrt des Herrn stattgefunden haben soll. Er sah den Garten Gethsemani, in dem die Jünger des Herrn, vor lauter Erschöpfung eingeschlafen waren, obwohl sie hätten wachen müssen und die Via Dolorosa, über die der Herr einst sein schweres Kreuz nach Golgatha hatte tragen müssen. Natürlich waren dies alles touristische Attraktionen, aber des ungeachtet beeindruckend.
Obwohl Sebastian in Jerusalem fast einen Kulturschock erlitt, genoss er doch diese Stadt, die er schon so gut aus seiner Kindheit kannte, vom Hörensagen und von der Frohen Botschaft Christi, die er immer auswendig lernen musste.
Den holländischen Paul hatte Sebastian schon beinahe vergessen, obwohl er manchmal noch wehmütig an ihn denken musste. Zweiundzwanzig Jahre war er jetzt und mit seinem Leben zufrieden. Hier, im Heiligen Land, wo der Herr üblen Verrat, schweres Leiden und schließlich den Tod erfahren musste, war alle Unbill des Lebens etwas erträglicher.
Das Kolleg in Neuss inspirierte Sebastian sehr. Aufgrund dieses Theologie-Projektes konnte er sein eigenes Geschlechtsleben intensiver erfahren. Dieses Paradox hatte sich unbeabsichtigterweise als Nebenprodukt der Religionsstunden ergeben.
Der Engel fand es an der Zeit, dass Sebastian wiederum etwas näher an die Sexualität herangeführt werden müsse. Hier, in Jerusalem, war es fast ein Heimspiel für den Boten Gottes.
Fünfhundertsiebenunddreißig Jahre waren schon vergangen, seitdem er zum letzten Mal in der Stadt des Heiligen Grabes verweilt hatte. Damals hatte er Albrecht, seinen vorigen Schützling, dorthin begleitet. Dieser war zu jener Zeit ein Jüngling von zwanzig Jahren und der Aufenthalt sollte nicht der sexuellen Weiterentwicklung Albrechts dienen, sondern dessen Frömmigkeit fördern. Nicht als Krieger sondern als Pilger sollte er an die heiligen Stätten geführt werden, hatte er sich doch schon unzähligen Ausschweifungen hingegeben. Der Bote Gottes war sich seiner Verantwortung bewusst und führte ihn deshalb nur an jene Orte, an denen Albrecht dem Herrn näher käme.
An die Stelle geleitete ihn der Engel, an der Christus unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen war. Albrecht kniete in Demut nieder und küsste inbrünstig den Boden. Des Weiteren besuchte er die Schule, wo die Muttergottes Latein gelernt hatte.
Ehrfurchtsvoll und fromm schritt er weiter und kam an den Ort, an dem die Jungfrau Maria einst die Windeln des Jesuskindleins gewaschen hatte. Stumm stand er davor und bekreuzigte sich. Der Bote des Allmächtigen konnte an Albrechts Augen ablesen, dass dessen Reue für begangene Untaten aufrichtig war. Um die Religiosität noch weiter zu vertiefen und ihm gleichzeitig etwas Furcht einzuflössen, führte der Engel ihn auch noch an den Baum, an dem sich Judas, der Verräter, vor langer Zeit erhängt hatte. Albrecht, noch so jung und lebensfroh, wurde immer betrübter. Dem Engel war seine Haltung aber nicht reumütig genug und deswegen führte er ihn schließlich noch an die Stelle, wo Abraham vor undenklichen Zeiten seinen Sohn Isaak dem Herrn opfern wollte. Nach all diesen unauslöschlichen Eindrücken war Albrecht geläutert und gewillt dem Herrn wieder voller Hingabe zu dienen. Aus Dankbarkeit über seinen jetzt gefestigten Glauben nahm er an einer Prozession nach Zion teil und empfing dort den Leib und das Blut des Erlösers. Der Bote Gottes konnte feststellen, dass die Gesinnung Albrechts sich gewandelt hatte. Mit frommen Übungen verbrachte dieser nun die wenigen Tage in Jerusalem, die ihm bis zur Abreise in die Heimat noch blieben.
Nun, nach so vielen Jahren, befand der Engel sich erneut am gleichen Ort, aber diesmal mit Sebastian. Der Zweck des Besuches jedoch war ein ganz anderer. Was seinem vorigen Schützling auf dem Gebiet des Geschlechtlichen vorenthalten wurde, sollte seinem jetzigen umso reichlicher gegeben werden. Was damals noch unvereinbar schien, würde jetzt in Eintracht verbunden werden.
Der Engel suchte sich einen Araber von zwanzig Jahren aus. Die Vorsehung gebot, dass es sich im Stadtpark von Jerusalem zutragen sollte.
Zu jener Zeit geschah es, dass Sebastian in sich den starken Drang verspürte, in der israelischen Hauptstadt auf Abenteuer auszugehen. Dieses Kribbeln fühlte er im Bauch. Er machte sich auf den Weg in den Stadtpark. Dunkel war es bereits, obwohl es erst acht Uhr war. Sebastian schlenderte über die Pfade. An Bänken kam er vorbei, auf denen sich Leute niedergelassen hatten, deren einziges Begehren es scheinbar war, sich ihren bunten Träumen und der heilsamen Ruhe der blauen Stunde hinzugeben.
Manchmal waren es Pärchen und ab und zu traf er auch Menschen an, die alleine auf einer Parkbank saßen, die warme Nacht genossen und ihre unerfüllten Wünsche möglicherweise den Sternen anvertrauten. Bei einer solchen Sitzgelegenheit, auf der ein junger Araber sich aufhielt, blieb er stehen und setzte sich einfach daneben. Der schöne Palästinenser schaute ihn an und lächelte verheißungsvoll. Sebastian nutzte die Gunst dieses Augenblicks und ergriff jetzt zum ersten Mal die Initiative. An all die Vorfälle aus seiner Jugendzeit und an Paul dachte er. Innerlich war er fest davon überzeugt, dass alles so verlaufen würde, wie er sich das vorstellte. Linde war der Abend und ein junger Sarazene, schätzungsweise zwanzig, saß neben ihm. Dem Ganzen gab die Stadt Jerusalem noch eine religiös-romantische Dimension.
Die innere Aufwühlung begann. In seinen Lenden fühlte Sebastian die Erregung. Spüren wollte er diesen palästinensischen Jüngling und seine braune Haut berühren. Keinen Weg mehr gab es zurück, denn ein zügelloses Verlangen übermannte ihn. Einen einzigen Fixpunkt nur noch gab es, und das war dieser junge, feurige Araber in Jerusalem. Sebastian verlor fast seine Beherrschung. Sanft, fast andeutungsweise nur, berührte er den Arm des Arabers. Überwunden war die erste und schwierigste Barriere. Diese Geste erwiderte der prächtige Muselman und legte seine Hand auf den Arm Sebastians. Voller unbestimmter Sehnsucht waren seine dunklen, leuchtenden Augen. Sebastian fragte ihn, ob er aus Jerusalem sei, aber dieser Sohn Allahs verstand kein Englisch und Sebastian sprach kein Arabisch. Blitzschnell stellten sich beide auf die neue Situation ein, denn die Konversation spielte in ihrem Falle, an diesem Abend in Jerusalem, nur eine untergeordnete Rolle. Das Kommando übernahm Sebastian, denn er war sich sicher, dass der Palästinenser sich ihm unterwerfen würde. Dieses unausgesprochene Machtgefühl brachte das heiße Blut Sebastians in Wallung. Die Erregung erhöhte sich dermaßen, dass Sebastian alles um sich herum vergaß. In den Arm nahm er diesen Araber und führte ihn ins schützende Dickicht, auf dass sich die Vorsehung erfülle. Diese blitzenden Augen, in denen Sekunden nur der Knecht aus längst vergangener Zeit sich spiegelte, blickten Sebastian begierig an. Er stellte sich hinter den stolzen Sarazenen, öffnete die Knöpfe und den Gürtel dessen Hose und ließ sie hinabgleiten. Das feste Fleisch dieses jungen, strammen, arabischen Arsches fühlte er. Das Sensationelle dieser Handlung trieb die Erregung von Sebastian in schwindelnde Höhen. Der junge Moslem war äußerst willig. Ab und zu drehte er leicht den Kopf, und Sebastian sah den schwellenden Mund, dessen Lippen ein Lächeln erahnen ließen. Die wieder sanft gewordenen Augen, aus denen nun helles Wohlwollen strahlte, bekundeten sein Einverständnis.
Zwei junge Körper schmiegten sich im Sinnesrausch aneinander und erbebten vor Wollust. Ihre Seelen verschmolzen. In anschwellendem Rhythmus pochten ihre Herzen. Wie afrikanische Tänzer, die durch das immer schneller werdende Tempo der Handtrommeln in Ekstase gerieten, taumelten sie liebestrunken ihrer Erfüllung entgegen. Die Welt, die die beiden sich Begehrenden umgab, versank im Schatten der Nacht. Nur noch Blätter, Äste und die Unendlichkeit des Sternenhimmels waren über ihnen. Der Duft der Geschichte umflutete sie. In diesem Land der Juden vereinigten sich der Islam und das Christentum. Beide hatten ihre Wurzel im Alten Testament und obwohl sie Abraham und Ibrahim, die schon seit Anbeginn eins waren, zum gemeinsamen Erzvater hatten, war es ihnen unmöglich, miteinander zu sprechen.
Wie eine Ureruption kam der Klimax. Völlig unmöglich und ausgeschlossen war eine Willenssteuerung.
Fiat voluntas tua, Domine!
Sebastian führte den arabischen Jüngling aus dem wilden Grün hinaus, das sie wie eine schützende Mauer umgeben hatte, und Arm in Arm schritten sie dem Ausgang zu. Wehmut lag in ihren Blicken, denn sie wussten, dass die Stunde des Abschieds gekommen war. Sebastian wurde es schwer ums Herz.
Dieser Unabhängigkeitspark von Jerusalem war ihnen, für kurze Zeit nur, der Garten Eden gewesen. Eine sprachliche Verständigung war unmöglich, denn Sebastian war des Arabischen nicht mächtig. Der Engel, der seinen Schützling immerfort beobachtete und in dessen Hand sein Los lag, hatte den Beschluss gefasst, dass Sebastian in Israel nur einmal zur Ejakulation kommen solle. Aber dieses eine Mal müsse das Nonplusultra sein.
Einige Tage später flog Sebastian mit seiner Gruppe wieder von Tel Aviv über Frankfurt nach Düsseldorf zurück. Als er vom Flughafen Lod aufstieg, dachte er voller Melancholie an Jerusalem. Zwei Extreme hatte er in dieser geschichtsträchtigen Stadt so nahe beieinander erlebt: Die Via Dolorosa, auf der Jesus, der Sohn Gottes, mit dem Kreuz, unter unsäglichen Schmerzen, nach Golgatha gegangen war und den jungen Araber, der Sebastian das Paradies erahnen ließ.
Lauda, Jerusalem, Dominum.
7. Kapitel
Nachdem Sebastian ins Kolleg zurückgekehrt war, widmete er sich wieder voller Hingabe seinem Studium.
Der Engel ließ sieben Monate verstreichen, damit sein Schützling in Ruhe seinen schulischen Pflichten nachkommen könne. Nach dieser Zeit der Besinnlichkeit beschloss er, dass eine große und eine kleine Reise stattfinden solle, auf dass Sebastian Deutschland besser kennen lerne und sich in der Welt weiter orientiere. Der Bote Gottes war der Auffassung, dass eine Konfrontation mit unbekannten Städten und fernen Ländern Sebastian zu einem einfühlsameren Menschen mache.
Nach München fuhr Sebastian im Frühling. Die bayrische Hauptstadt wollte er unbedingt einmal sehen. War es wirklich so, wie man sagte, dass es die schönste Großstadt Deutschlands war? Mit dem Zug machte er sich auf den Weg an die Ufer der Isar. Das neogotische Rathaus mit all den Türmchen und die dicken, spargelähnlichen Zwillingstürme der Liebfrauenkirche sah er. Den Englischen Garten und das Stadtviertel Schwabing mit den vielen Studenten besuchte er. Aber er registrierte diese Sehenswürdigkeiten nur, als ob sie zu einem Pflichtprogramm gehörten, das man so schnell wie möglich hinter sich bringen müsse. Diese Baudenkmäler und Gartenanlagen brachten Sebastian nicht in Verzückung. Der Zugang zu dieser süddeutschen Stadt blieb ihm verschlossen. Vielleicht waren die Bayern anders als die Rheinländer. Man sagte zwar, dass es so wäre, aber ob das auch stimmte, konnte Sebastian nicht feststellen. Waren die Leute dennoch der Grund oder lag es an ihm selbst? Hatte er möglicherweise seine Erwartungen zu hoch geschraubt, sodass es zwangsläufig zu einer herben Enttäuschung kommen musste? München war zwar schön, aber wirkte auf ihn beklemmend. Er wurde depressiv. Es erinnerte ihn an die ausdruckslosen Augen der bedauernswerten Erika, deren trauriges Los ihn manchmal noch ergriff. Innerhalb von achtundvierzig Stunden fuhr er wieder an den Rhein zurück.
Im Sommer plante Sebastian seine erste große Reise, die ihn nach Amerika führen sollte. Dieses Land, von dem er schon so vieles gehört hatte, wollte er kennen lernen. Er entschloss sich in den Vereinigten Staaten als Freiwilliger zu arbeiten. Mit einer Organisation in Bonn, die sich mit dem internationalen Jugendaustausch beschäftigte, nahm er zu diesem Zwecke Kontakt auf. Nach kurzer Zeit schon war das Touristenvisum, das man zur Einreise in die USA benötigte, besorgt und das Ticket für den Hin- und Rückflug von Amsterdam nach New York bei einem Studentenreisebüro gekauft. An einem Projekt der Quäker-Church sollte er mitarbeiten. Unterbringung und Verpflegung waren frei. Die Transportkosten musste Sebastian selbst aufbringen. Sechs Wochen sollte die ganze Reise dauern. Die ersten vier Wochen würde er im Quäker-Church-Projekt arbeiten, in der Kleinstadt Virginia Beach, im Bundesstaat Virginia. Anschließend hätte er vierzehn Tage zur freien Verfügung.
Mitte Juli reiste Sebastian von Neuss an die sieben Quellen des Wildbaches. Einige Tage blieb er dort. Dann fuhr er mit dem Bus über die Grenze nach Maastricht und anschließend mit dem Intercityzug nach Amsterdam. Dort begab er sich an Bord einer KLM-Maschine, die ihn nach New York bringen sollte. Die erste transatlantische Überquerung war es für ihn. Der Flug war nicht besonders interessant. Als eher langweilig empfand er ihn. Während der gesamten Reise war der Himmel wolkenlos. Außer England und Irland sah er stundenlang nur den blauen Ozean. Ermüdend war das schon. Das Flugzeug, eine Boeing kleineren Typs, war bis auf den letzten Platz besetzt. Bewegungsfreiheit gab es daher kaum. Es war eine einzige Strapaze.
Für Sebastian war die erste Kurzstrecke, damals vor sechs Jahren, von Heathrow nach Le Bourget, eine außergewöhnlich sensationelle Erfahrung. Aber eher monoton war diese Atlantiküberquerung, weil es sich so endlos lang, über sieben Stunden, dahinzog. Gegen Ende des Fluges wurde es dann doch ein wenig interessanter. Labradors zahllose Seen und die unendlichen Wälder von Maine konnte er aus der Vogelperspektive bewundern. Vom Flughafen fuhr er mit dem Zugbringerbus zum Airterminal. Früher Nachmittag war es und der Koloss Manhattan lag im Sonnenschein. Während der Fahrt vom internationalen Airport an der Jamaica Bay nach Manhattan, dem einstigen Neu-Amsterdam, sah Sebastian die beeindruckenden, aber kalt wirkenden Stadtautobahnen und die enormen Wolkenkratzer, die das Panorama vollständig beherrschten. Winzig klein kam er sich in dieser riesigen Stadt vor. Glücklicherweise war er von der langen Reise so erschöpft, dass er New York nur noch bruchstückhaft in sich aufnehmen konnte. Nachdem er am Greyhound- Busbahnhof seine Fahrkarte gekauft hatte, stieg er in den Nachtbus nach Norfolk. Am frühen Morgen erreichte er diese mittelgroße, langweilige, amerikanische Hafenstadt. Geradeso wie in Manhattan, gab es auch hier schnurgerade, nummerierte Straßen. Die Stadt machte einen unpersönlichen, uninteressanten Eindruck auf Sebastian. Mit dem Regionalbus fuhr er nach Virginia Beach. Kurz vor Mittag kam er dort an. Was er bisher, seit seiner Landung in New York, von den USA gesehen hatte, war ziemlich wenig. Trostlos und so anders als er sich das vorgestellt hatte, bot sich ihm diese Ostküste dar. Fast am Ende seiner Kräfte war er von dieser langen Reise. Er begab sich zu dem von der Jugendaustausch-Organisation angegebenen Haus in der sechsundzwanzigsten Straße. Noch schlafende Menschen traf er dort an, zu dieser Tageszeit! Sebastian musste erst einmal gehörig Radau machen, bevor die Leute wach wurden. Begrüßt wurde er und den zukünftigen Mitarbeitern des Quäker-Projektes vorgestellt. Eine Gruppe von acht Leuten war anwesend: Zwei Engländer und sechs Amerikaner, die aus den verschiedensten Bundesstaaten kamen. Zwischen zwanzig und fünfundvierzig schwankte ihr Alter. Sehr alternativ sahen sie alle aus, obwohl die Hippiezeit eigentlich schon vorbei war. In Virginia lag die Flower-Power- Zeit noch in ihren letzten Zügen. Blumenkränze hatten sie zwar nicht mehr im Haar, aber die Kleidung war doch, in den Augen von Sebastian, eher unkonventionell. Jimi Hendrix war schon fast drei Jahre tot. Das virtuose Gitarrenspiel dieses schwarzen Sängers hatte Sebastian sehr fasziniert. Für ihn war der wilde, zügellose und Stirnband tragende Jimi, genauso wie Scott McKenzie mit seinem Song "San Francisco" die personifizierte Flower-Power-Zeit.
Bis zu diesem Zeitpunkt wusste Sebastian noch immer nicht, was sein Arbeitsbereich sein würde. Am Abend fuhr man in das Stadtviertel, wo das vierwöchige Projekt durchgeführt werden sollte. Das Community Center, eine Art Begegnungsstätte, wo man auch die Mahlzeiten zu sich nahm, diente als Unterkunft. Für die neun Volontäre war ein großer Raum zum Schlafsaal umfunktioniert worden. Vom Kirchenvorstand war ein Vertreter gekommen und erklärte, was das Projekt beinhaltete. Letztlich ging es darum, Einfamilienhäuser von innen neu anzustreichen. Erst einige Jahre alt waren die Häuser und gehörten der Quäker-Church. Fast nur allein stehende, schwarze Frauen mit sehr vielen Kindern waren ihre Bewohner. Um ein soziales Wohnprojekt der Quäker handelte es sich. Mit seiner Kolonne begab Sebastian sich am frühen Morgen des nächsten Tages zu den Gebäuden, an denen die Arbeiten durchgeführt werden sollten. Nach einigen Vorbereitungen fing man mit dem Anstreichen an. Eher eintönig und langweilig war diese Tätigkeit, aber Sebastian war fest entschlossen, die ihm aufgetragenen Aufgaben zu erledigen. Manchmal kam ihm das ganze kirchliche Projekt so sinnlos vor, weil er keinen Ausweg für die armen Menschen in diesem Quäker-Getto sah. Von der Sozialhilfe lebten alle Bewohner und aufgrund der vielen Kinder hätte auch keine dieser Mütter einer regulären Arbeit nachgehen können. Eine Ausbildung hatten sie wahrscheinlich auch nicht und wenn doch, dann hätten sie, wegen ihrer sozialen Herkunft und ihrer Hautfarbe, dennoch keinen Job gefunden. Zum ersten Mal sah Sebastian, hier in diesem Stadtviertel von Virginia Beach, ein amerikanisches Negergetto. So furchtbar öde und ohne jegliche Zuversicht war alles. Man spürte, dass es sich in absehbarer Zeit nicht ändern würde. Männern begegnete man kaum in jenem Getto. Außer diesen Müttern, die schon seit Generationen die Hoffnung auf ein besseres Leben aufgegeben hatten, sah man nur Kinder und heranwachsende Neger, die lustlos herumstreunten und in deren Augen man schon die bereits verlorene Zukunft erblicken konnte. Die Väter hatten anscheinend nur die eine Aufgabe ihren Samen zu spenden. Danach zogen sie weiter durch dieses weite Land der unbegrenzten Möglichkeiten und zurück blieben diese geschwängerten Negerinnen.
Weiß und Schwarz waren fein säuberlich getrennt, nicht aus Rassenhass, sondern aus finanziellen Gründen. Da Virginia Beach, wie der Name schon sagt, einen Strand besaß, der kilometerlang war und aus feinem Sand bestand, sah man die Trennung zwischen Negern und Weißen noch deutlicher. Wenn Sebastian abends am Meer spazierte, begegnete er kaum einem Schwarzen. Die Hotels und der Strand waren den finanzkräftigeren Amerikanern vorbehalten und die waren weiß. Aber dieses Schwarz-Weiß-Phänomen bereitete ihm kein großes Kopfzerbrechen, da er wusste, dass er nur vier Wochen in Virginia Beach bleiben würde. Tagsüber führte er seine Anstreicherarbeiten aus. Abends schlenderte er über den Strandboulevard und gab sich seinen Träumen hin. Manchmal sah er Delfine in Gruppen vorüberziehen. Sie machten immer wieder diese Sprünge aus dem Wasser. Warum sie springend schwammen, war Sebastian ein Rätsel.
Auch Repräsentanten vom Quäker-Kirchenkomitee kamen ab und zu und kontrollierten den Fortgang der Arbeiten an den Häusern. Bei einem solchen Besuch war auch einmal ein Bauer dabei, der in den Blue Ridge Mountains einen sehr großen Hof besaß. Fast an der Grenze zu North Carolina, in unmittelbarer Nähe von Cedar Springs, lagen seine Ländereien. Dort organisierte er Veranstaltungen über Traumdeutung, Astrologie und anderweitige Esoterik. Finanzielle Sorgen hatte dieser liebenswürdige Philanthrop mittleren Alters wahrscheinlich nicht, denn diese Nächstenliebe konnte er sich leisten. Im Gespräch mit ihm wurden Sebastian, die zwei Engländer und vier der sechs Amerikaner auf den Gutshof in den Blue Ridge Mountains, an der Grenze zu North Carolina, eingeladen. Die restlichen zwei Amerikaner hatten andere Verpflichtungen. Kostenlos durfte dieses siebenköpfige Team der uneigennützigen Helfer auf seiner Farm einige Zeit verbringen.
Nach den vier Wochen in Virginia Beach zog also der größte Teil der Quäker-Volontäre westwärts. Mit einem alten Straßenkreuzer, der einem der Amerikaner aus der Gruppe gehörte, machte man sich auf den Weg in die Appalachen. Obwohl die Entfernung lediglich sechshundert Kilometer betrug, dauerte die Fahrt fast zwölf Stunden. Anfänglich führte die Reise an nicht enden wollenden Maisfeldern vorüber. So weit das Auge reichte, sah man dieses Übermaß an lang blättrigem Grün. Nur zum Essen in Fast-Food- Restaurants, von denen es in den Vereinigten Staaten Unzählige gab, legte man eine Pause ein. Was die Dauer des Trips so in die Länge zog, war die immer wieder kochende Wasserkühlung des Motors des alten Autos. Endlich erreichten sie den Hof in der Nähe von Cedar Springs. Früher Morgen war es mittlerweile. Einige Kilometer außerhalb des Dorfes, an einem Bach, lag das Anwesen. Öffentliche Verkehrsmittel gab es keine. Noch viel einsamer, als in jenem Tal, an den sieben Quellen des Wildbaches war es, wo Sebastian einmal zu Hause war. Traumhaft schön aber war die Landschaft. Wiesen und Wälder, Kühe, Kälber, Pferde, Fohlen und Katzen gab es. Alles das, was Sebastian aus seiner Kindheit kannte, wurde ihm hier wieder dargeboten, nur noch bezaubernder. Der Quäker-Gruppe wurde ein riesiges hölzernes Haus, mit mehr als zehn Zimmern und einer immensen Veranda, zugewiesen, das unbewohnt, aber möbliert war. Neben einer geräumigen Küche befand sich auch das Wohn- und Esszimmer im Erdgeschoss. Alle übrigen Räumlichkeiten befanden sich in den beiden Geschossen darüber. Jeder bekam seinen eigenen Raum. Sebastians Schlafgemach befand sich im zweiten Stock. Die Gruppe musste sich selbst verpflegen. Für die benötigten Lebensmittel musste man mit dem Auto in das einige Kilometer entfernte Dorf fahren. Dem freigiebigen Bauern, deren Gäste sie waren, gehörte auch dieser Country Store. Am Ort war es übrigens das einzige Geschäft. Die Ex-Anstreicher-Gruppe brauchte nicht zu bezahlen, denn der Bauer erwies sich als ein außergewöhnlich guter Gastgeber.
Haschisch rauchte man abends manchmal und hörte Musik. Über die verschiedensten Themen diskutierte man, aber alles war stark theoretisiert. Einige Jahre zuvor hatte die liebenswürdige Veronika schon damit begonnen Sebastian in die Anfänge der rhetorisierten Auseinandersetzung zu verwickeln. Ganz vorsichtig und behutsam hatte sie ihn damals in die diffizile Kunst der Frucht bringenden Diskussion eingeführt. Eine wundervolle Zeit war es, auf jenem Hof, in den Blue Ridge Mountains. Von der Traumdeuterei und der Astrologie bekam Sebastian nicht allzu viel mit, da er diesen Themen etwas skeptischer als die Amerikaner und Engländer gegenüberstand. Darüber hinaus war alles für ihn neu. Sebastian wusste nur, dass es Horoskope gab, die er aber fast nie las. Weiterhin war ihm bekannt, dass sein Sternzeichen die Fische waren. Manchmal merkte er, dass ihn dieses leicht metaphysisch Angehauchte doch interessierte, aber dennoch kam es nicht zum Funkenübersprung. Für Sebastian war auch die Tatsache ein Novum, dass man sich stundenlang über theoretische Probleme unterhalten konnte, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Dass man dabei die Diskussionszeit nicht als eine verlorene empfand, sondern als persönliche Bereicherung, konnte etwas Beglückendes sein. Bei derartigen Gesprächen spürte man manchmal einen Zipfel der Unendlichkeit. Viele Wege gab es und keiner war besser oder schlechter als der andere. In seiner amerikanischen Zeit hatte Sebastian vor allem gelernt, dass Dogmatisches, Konventionelles und Revolutionäres nebeneinander stehen konnten, ohne sich gegenseitig auszuschließen. Nicht alles musste schlüssig sein. Es gab Wege und Möglichkeiten, die einfach offen blieben. Was ihn auch sehr tief beeindruckte, war die Tatsache, dass man reisen konnte, ohne dies nur auf die Ferien zu beschränken. Eine Zeitlang konnte man das Reisen sogar zum Lebensziel erklären. Hin und wieder einmal wurde ein wenig gearbeitet, aber Leute kennen zu lernen und deren Ideen zu hören war das Wichtigste. Eine kleine Revolution war diese Lebenseinstellung für Sebastian. Voyager pour voyager! Reisen um des Reisens willen!
Der Engel fand, dass es an der Zeit sei, dass Sebastian wieder kurz an seine Sexualität erinnert werden müsse, damit ihm auf diesem Gebiet auch nicht das Geringste vorenthalten werde. Der Bote Gottes wusste nur allzu gut, dass schon die kleinste Unachtsamkeit seinerseits, unliebsame Störungen und größte Probleme bei Sebastian auslösen könne, wodurch sich später möglicherweise ein Fehlverhalten entwickle. Die Folgen für seinen Schützling wären unabsehbar. Fingerspitzengefühl war erforderlich und dies beherrschte der Engel inzwischen meisterhaft. Seit Jahrtausenden schon hatte er sich darin geübt. Auf dass auch kein Ausrutscher geschehe, erwählte er einen jungen Amerikaner aus dem Virginia-Beach-Team, den Sebastian schon bestens kannte.
Fünfundzwanzig war dieser und ein ehemaliger Vietnam-Soldat.
Bedingt durch den Vietnamkrieg hatte er eine leicht negative Lebenseinstellung. Am Quäker-Projekt hatte er teilgenommen, weil er der Ansicht war, er müsse Sühne leisten. Für seine unterprivilegierten Landsleute wollte er etwas tun. Schlank und stark war er und manchmal konnte man an seinen braunen Augen sehen, dass er noch die Hoffnung hatte, dass das Leben einmal, auch für ihn, besser werde. Dieser ehemalige Krieger bewohnte ein Zimmer, das unter dem von Sebastian lag. Mehrmals täglich musste dieser daran vorbei, um auf sein Kämmerlein zu gelangen, das ihm ausschließlich als Schlafstätte diente.
Eines Abends, wie so oft schon zuvor, ging Sebastian, vom Esszimmer her kommend, die Treppe zu seinem Stübchen hinauf. Als er die erste Etage erreichte, sah er, dass des Ex-Soldaten Zimmertür offen stand. Er schaute hinein und erblickte den ehemaligen Kämpfer völlig nackt. Dieser hatte gerade geduscht.
Fast fertig war er schon mit dem Abtrocknen. Sebastian bemerkte er direkt und schaute ihn mit einem entwaffnenden Lächeln an. "Hi!", sagte er nur und kramte seine Kleider zusammen. Sebastian stockte der Atem. Fast genierte er sich, diesen weißen, muskulösen, nackten Körper zu betrachten. Diesen mächtigen Schwanz sah er, die schmalen Hüften und die außergewöhnlich selbstsicheren, alles dominierenden Augen. Der ehemalige GI drehte sich um und ging mit dem Kleiderbündel zum Schrank. Nur ganz kurz erblickte Sebastian diese geballte Kraft, die der geschmeidige Körper ausstrahlte. Einzigartig war diese wilde, ungezähmte, natürliche Nacktheit. Eine gewisse Grazie lag in seinen stolzen, federnden Bewegungen. In Verzückung erstarrte Sebastian und geriet in eine ungewollte Erregung. Als er sich wieder einigermaßen gefasst hatte, stieg er, schweren Schrittes, weiter die Treppe hinauf und erreichte, innerlich völlig aufgewühlt, sein Zimmer. Was geschehen wäre, wenn die Augen dieses jungen Amerikaners nicht so selbstsicher gewesen wären, denn sie hatten ihn dazu gezwungen, die Gelegenheit nicht zu nutzen, malte er sich in Gedanken aus. Würde der schöne GI sich ihm hingegeben haben? Hätte er das Kommando übernommen oder wäre er willig gewesen wie der Sarazene aus Jerusalem? Würde er überhaupt die honigsüßen Früchte der Amour bleu jemals gekostet haben? Aber alle diese Fantasien waren illusorisch, denn für Sebastian hatte in diesem Blick eine unüberwindbare Barriere gelegen. Eine unruhige Nacht voller Träume erlebte er.
Am nächsten Tage, frühmorgens, verließ Sebastian dieses schöne, große Holzhaus am rauschenden Bach, in den Blue Ridge Mountains, in der Nähe von Cedar Springs. Nach New York zurück musste er wieder, denn in fünf Tagen würde der große Silbervogel mit den gewaltigen Düsenschwingen an der Jamaica Bay bereitstehen, ihn wieder in sich aufzunehmen, um ihn, den immerzu Suchenden, vom einstigen Amsterdam der Neuen Welt über den Großen Teich in die holländische Hauptstadt zu bringen.
Zwei Amerikaner der Gruppe fuhren zu einem Campingplatz nach Cap Hatteras und Sebastian durfte mitfahren. Am Abend kam man dort an. Eine sehr lange, schmale Halbinsel war es. Rechts und links gab es breite Sandstrände und Häuser auf Pfählen. Was die Natur und die Landschaft anbetraf, war dieses Gebiet langweilig und uninteressant. In einem Wohnwagen von Freunden der beiden Amerikaner übernachtete Sebastian. Per Anhalter nach Norfolk trampte er am nächsten Tag. Den Nachtbus nach New York nahm er und kam in Manhattan am darauf folgenden Morgen an. Im YMCA mietete er sich ein Zimmer. Noch einige Tage blieben ihm jetzt New York zu besichtigen. Im riesigen Central Park spazierte er umher und sah ein Stück vom Broadway, mit seinen Theatern.
Abschließend besuchte er noch kurz das swingende Greenwich Village und den Stadtteil der Schwarzen, Harlem, wo er wieder diese Hoffnungslosigkeit wie im Quäker-Getto von Virginia Beach, vorfand. Durch die halb verfallenen Häuser wurde die Aussichtslosigkeit noch verstärkt. Obwohl er es versucht hatte, konnte er doch nicht wirklich New York genießen. Alleine und heimatlos fühlte er sich. Die Quäker-Gruppe und der schöne Hof am Bach, in den Blue Ridge Mountains, fehlten ihm in Manhattan. Die heißen Diskussionen, die er so lieben gelernt hatte, vermisste er. An den Heimflug nur noch dachte er. Im Laufe des folgenden Vormittags machte er sich mit dem Taxi auf den Weg zum Flughafen. Am Morgen des nächsten Tages landete er in Amsterdam. Auf schnellstem Wege fuhr er nach Hause, in jenes Tal an den Ufern des Wildbaches.
Ins Kolleg nach Neuss fuhr er wieder Mitte September zurück. Drei Monate später war das fünfte und letzte Semester zu Ende und Sebastian erhielt jetzt sein Abiturzeugnis. Amtlich wurde ihm also das Reifsein bescheinigt. Eine merkwürdige Bezeichnung war es. Auf einmal sollte er ausgereift sein. Er war reif für das Universitätsstudium. Die reifen Früchte der Liebe hatte er schon gepflückt. Er war reif für die Ehe. Vielleicht war er schon überreif nach dieser amerikanischen Reise.
In das Tal seiner Heimat kehrte Sebastian also wieder zurück, wo sich doch in der Zwischenzeit so allerlei verändert hatte, ohne dass er es gemerkt hätte.
Ein Teil des Gemüsegartens seines Vaters war sein Blumengarten wieder geworden. Alles war schon umgepflügt. Wo jetzt noch ein wenig Schnee den fruchtbaren Boden bedeckte, und wo einst blutrote Dahlien und rosafarbene Schmuckkörbchen erblühten, würden in einigen Monaten schon pralle Salatköpfe wachsen und dicke, krumme, giftgrüne Gurken heranreifen.
Seine Katzen beachteten ihn nicht mehr. Verschwunden waren seine Kaninchen, denn es gab niemanden, der sie hätte füttern wollen. Mittlerweile waren sie alle geschlachtet und zu Markte getragen worden.
Sein zweitältester Bruder hatte schon Kinder und lebte nicht mehr im Dorfe.
Einen reichen Bauern hatte Maria zum Traualtar geführt und war inzwischen auch schon Mutter einer Tochter. Auf einem großen Gutshof, irgendwo zwischen Aachen und Köln, wohnte sie jetzt und nannte mehr als hundert Kühe ihr Eigen. Berauscht vom jungen Eheglück und gesättigt mit Milch und Fleisch im Überfluss genoss sie das Leben. Der Herr möge ihr dieses Glück erhalten und sie immerfort schützen, denn sie war Sebastian nicht nur jahrelang eine treue Begleiterin, sondern hatte auch immer tapfer an seiner Seite gekämpft. Der jüngere Bruder von Maria, der damals, vor vielen Jahren, sozusagen aus dem Fenster des königlichen Palastes, den es einst in ihrer beider Vorstellung gab, in den ausgetrockneten Wassergraben gefallen war, hatte bereits seine eigene Wohnung in der Stadt. Frührentner waren die Eltern von Maria geworden. Die Bewirtschaftung ihres Hofes hatten sie aufgegeben und dafür einen ansehnlichen finanziellen Ausgleich aus Brüssel erhalten, denn die europäische Landwirtschaft hatte mit einer riesigen Überproduktion zu kämpfen. Jeder bäuerliche Betrieb, der nicht mehr produzierte, half mit, diesen Überschuss zu verringern und wurde dafür reichlich belohnt. Außerdem wollte keines der Kinder den Hof übernehmen. Alleine wohnten sie jetzt dort, an den sieben Quellen des Wildbaches und hielten sich als Hobby ein paar Hühner und ein Schwein, das jetzt täglich vom Stall in die Wiese ausgeführt wurde. Das Tal der Kindheit hatte sich verändert und Sebastian merkte es erst jetzt.
8. Kapitel
Voller Zuversicht ließ sich Sebastian im April an der Aachener Hochschule immatrikulieren. Als Hauptfach wählte er Anglistik und als Nebenfach Romanistik. Der Berufswunsch blieb auch weiterhin das Lehramt an Gymnasien. Er kam also mit seiner Planung diesem Ziel schon etwas näher. Ein Vorlesungsverzeichnis wurde Sebastian in die Hand gedrückt und er konnte sich die Kurse aussuchen, die er belegen wollte. Auf einem Computerformular musste er diese angeben und die Unterlagen bei der Hochschulverwaltung einreichen. Nach einigen Tagen bekam er sie abgesegnet zurück und musste dies, als Nachweis für die zukünftigen Zwischenprüfungen, in sein Studienbuch abheften. Er begab sich zu den Hörsälen in die Vorlesungen. Jetzt war Chaos und Überfüllung angesagt.
Manchmal gab es weit über fünfhundert Studenten in einem Saal, der höchstens der Hälfte dieser Anzahl Platz bot. Auf Treppen und Fensterbänken ließ man sich nieder. Fast hätte man ein Fernglas gebraucht um überhaupt den Hochschullehrer noch sehen zu können. Die Unterrichtsräume lagen über die gesamten westlichen Stadtbezirke verstreut. Es erwies sich als äußerst schwierig, zur rechten Zeit im richtigen Raum zu sein. Außerdem fanden immer wieder kurzfristige Veränderungen statt, die zu spät oder überhaupt nicht bekannt gegeben wurden. Manchmal hatte Sebastian den Eindruck, dass es das Hauptziel dieses Studiums war, das Improvisationsvermögen der Wissbegierigen zu steigern. Diese riesige Lehrfabrik, die eigentlich dazu bestimmt war, die Studenten zu stimulieren, war aus den Fugen geraten. Man hatte versäumt sich rechtzeitig mit dem Problem der Überfüllung auseinander zu setzen. Die geburtenstarken Jahrgänge stürmten jetzt die Pforten der Universitäten. Die Zahl der Immatrikulierten und derer, die sich mit dem Gedanken trugen, in naher Zukunft ein Studium aufzunehmen, stieg unaufhörlich weiter. Eine zufrieden stellende Lösung schien in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Für Sebastian begann eine unglückliche Zeit. Von Gott und der Welt verlassen fühlte er sich und irrte ziellos durch die Hörsäle und Seminare.
Der Engel war der Überzeugung, dass er eingreifen müsse. Es sollte für Sebastian ein schwerer Schock sein, denn nur ein solcher würde bewirken, dass er sich neu orientierte.
Um seine Enttäuschung über das Studium erträglicher zu machen und seine Frustration, die er tagsüber erlebte, etwas abzubauen, stürzte Sebastian sich ins nächtliche Vergnügen. Eines Abends, in jenem April, kam er sehr spät nach Hause. Er schloss die Haustür auf und oben im Treppenhaus, auf der letzten Stufe, stand sein ältester Bruder. Am Geländer hielt er sich krampfhaft fest.
Mittlerweile war er schon fünfunddreißig und noch immer unverheiratet. Zu einem eingefleischten Junggesellen hatte er sich entwickelt. Er fragte Sebastian, ob er auch all die ihn bedrohenden Soldaten und die schwer bewaffneten Polizisten vor dem Haus gesehen habe. Sebastian war, aufgrund dieser unerwarteten Frage, völlig überrascht. Er glaubte, der Bruder erlaube sich einen Scherz und wolle ihn auf seine Nüchternheit hin überprüfen. Dass er niemanden gesehen habe, antwortete ihm Sebastian. Dann gingen beide auf ihr Zimmer.
Am nächsten Tag begab sich Sebastian wieder in das Chaos der Hochschule, in der Hoffnung, er könnte in einem der Hörsäle doch noch einen freien Platz ergattern. Als er am Nachmittag nach Hause kam, erfuhr er von seiner Mutter, dass der älteste Bruder sich strikt weigere, irgendwelche Nahrung zu sich zu nehmen, da doch alles vergiftet sei. Er wolle ausschließlich noch Milch trinken, und zwar frisch von den Kühen. Für Sebastian stand jetzt fest, dass mit dem Bruder etwas geschehen war. Das Chaos war in seinem Gehirn ausgebrochen. Dies bestätigte sich dann auch abends, als er meinte, alle im Hause seien Spione, die nur das eine im Sinn hätten, ihn, so schnell wie möglich, zu verraten, um ihn anschließend der Polizei und den Soldaten auszuliefern.
Instinktiv wusste jetzt jedes Familienmitglied, dass man den anscheinend unter Verfolgungswahn leidenden Bruder vor sich selbst schützen müsse. Ihn in ein Krankenhaus einliefern zu lassen, wäre für alle Beteiligten die beste Lösung. Am nächsten Tag versuchten sie, ihn dazu zu überreden, sich freiwillig behandeln zu lassen. Das sah er jedoch nicht ein und ergriff daraufhin mit dem Traktor die Flucht. Aus freien Stücken wollte er sich nicht einsperren oder untersuchen lassen. Dazu war er die Freiheit zu sehr gewöhnt. Über die neu entstandene Lage mit dem Bruder zu sprechen war unmöglich. Schon zu weit hatte er sich von der Wirklichkeit entfernt. Er hatte jeglichen Realitätssinn verloren. Nur noch Belagerer sah er in seiner Fantasiewelt. Zwar glänzten seine Augen noch, aber sie verrieten auch schon dieses Chaos, das sich in seiner Vorstellung abspielte und mit dem er zu kämpfen hatte. Diese Veränderung, die so plötzlich und unerwartet bei dem geliebten Bruder auftrat, war fast unerträglich. Gerne hätte man eingegriffen und ihm geholfen, sich von seinem Wahn zu befreien, aber es gab keinerlei Kontakt mehr. Alles, was einmal war, gab es nicht mehr. Alle Brücken zu ihm waren schon zerstört. Ein Zugang war nicht mehr möglich.
Von der Polizei wurde er dann einige Stunden später wie ein tollwütiges Tier eingefangen. Er war ja so muskulös, aufgrund seiner schweren, körperlichen Arbeit. Eine ganze Gruppe von Polizisten war dazu nötig, ihn zu überwältigen. In Handschellen wurde er zum Polizeiarzt geführt. Eine Beruhigungsspritze verabreichte ihm dieser. Durch das Betäubungsmittel erschlaffte seine gesamte Muskulatur. Schwach und zerbrechlich wurde dieser einst so stolze Körper. Das Strahlen seiner Augen erlosch. Zu einem Stück Fleisch, ohne Willen und Widerstand, wurde er. In so kurzer Zeit war er gebrochen worden. Ins Krankenhaus lieferte man ihn ein und am darauf folgenden Tag gab er den Geist auf. Die Mutter und der Vater von Sebastian sahen die Hoffnung für den Hof entschwinden. In Schutt und Asche versanken all ihre Träume. Irreversibel. Exitus.
Die Mutter, die sich schon vor langer Zeit in die Passivität zurückgezogen hatte, wurde jetzt völlig apathisch. Ganz in Schwarz kleidete sie sich von nun an und gab sich der immer währenden Trauer hin. Der Vater versuchte noch zuweilen, ihr neuen Lebensmut einzuflößen, aber dafür war es bereits zu spät. Den Schmerz des Verlustes fühlte Sebastian auch und musste an seine Großmutter denken. Mehr als dreizehn Jahre war dies jetzt schon her, aber er stellte sich schon wieder diesen Gang hinter dem Sarg vor.
Nach drei Tagen fand das Begräbnis statt. Viele der Dorfbewohner begleiteten den schweren Eichensarg mit dem Leichnam des Bruders. Jener Frühlingstag im April war ein schwerer für Sebastian.
Wieder hörte er, genauso wie damals bei der Beisetzung seiner Großmutter, die Worte des Priesters: "Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken." Die Nuance in der Wortwahl des Geistlichen drang kaum an Sebastians Ohr. Die Trauer um den verstorbenen Bruder erfüllte ihn zu sehr, als dass er diese kleine Veränderung wahrgenommen hätte. Der "Staub" von einst war jetzt zur "Erde" geworden und bei der Verheißung von der Auferstehung ließ der Seelenhirte den "Jüngsten Tag" unerwähnt. Für Sebastian jedoch hatten derartige Überlegungen keinerlei Bedeutung, da ihm diese Details völlig entgangen waren.
Im Mai und Juni versuchte Sebastian mehrfach noch, sich einen Weg im Chaos der Hochschule zu bahnen, aber er hatte die Lust am Studium verloren. Depressiv wurde er und dachte über sein Leben und dessen Sinn nach. Manchmal noch erinnerte er sich an jenen warmen Sommertag vor neunzehn Jahren, als die fleischlichen Wölbungen seines toten Bruders für ihn einen Zipfel des Paradieses offenbart hatten. Eine Wiederkehr gab es nicht.
Geschichte war es geworden. Wo würde der Bruder jetzt sein? Eine unsterbliche Seele, so wie die Kirche lehrte, gab es die überhaupt? Für Sebastian musste Hilfe kommen. In die Hochschulbibliothek begab er sich Ende Juni. Auf der Suche nach Büchern war er, die ihn vielleicht etwas aufmuntern könnten. Nach stundenlangem Nachschlagen in den Katalogen, die nach Stichwörtern, Themen und Schriftstellern geordnet waren, nahm er drei Bücher mit: "Women in Love" von D.H. Lawrence, "Notre-Dame- des-Fleurs" von Jean Genet und "L'Histoire de l'oeil" von Georges Bataille. Zufallstreffer waren es allesamt.
Bei D.H. Lawrence musste Sebastian manchmal weinen vor Wehmut, Sehnsucht und Glück. Vor allem die Ringerszene war sehr ergreifend. Der Monolog am Bett des toten Freundes rührte Sebastian zu Tränen.
Jean Genet war eine Sensation. Einen Großteil seines Lebens hatte er in Gefängnissen zugebracht. Über Tod und Sex schrieb er. Diese beiden Extreme verband er aufs Genialste, indem er fast alle moralischen Werte umkehrte. An seine Großmutter erinnerte es Sebastian.
Bataille unternahm ebenfalls einen atemberaubenden Versuch, eine Versöhnung zwischen dem knabenhaft-schönen Eros und dem grausamen Apokalyptischen Reiter herbeizuführen. Sebastian war zutiefst beeindruckt. Die Depressionen verließen ihn. Er fasste den Entschluss, seinen Studienort radikal zu wechseln. Zu eng wurde ihm sein Heimattal. Es hatte sich zu viel verändert. Voller Wehmut dachte er noch einmal an die Tage mit Maria zurück. An seine Erlebnisse mit Paul und an den Tanzpartner auf jener Baustelle erinnerte er sich. Jerusalem, der Araber und die Blue Ridge Mountains mit dem Vietnam-Soldaten kamen ihm noch einmal in den Sinn. Stimuliert hatten ihn die drei Bücher. Die französisch- britische Belletristen-Dreifaltigkeit hatte Sebastian wieder handlungsfähig gemacht. Die schöpferische Kraft dieser drei begnadeten Schriftsteller war Labsal für seine Seele. Er spürte bei Lawrence das Verlangen nach Liebe und Freundschaft. Bei Genet las er über Verbrechen und Verrat. Bataille führte ihn an die Abgründe der Wollust.
Sein Entschluss, wegzugehen, stand jetzt endgültig fest. Sein Ziel aber blieb der Lehrerberuf. Vierundzwanzig war er bereits und dachte ans Ausland. Gute Erfahrungen hatte er ja immer dort gemacht. Die Stadt Dijon erwählte er zu seinem neuen Studienort. Es sollte die dortige Universität werden.
Nachdem er alles geregelt hatte, packte er seine Koffer. Anfang Oktober kaufte er die Fahrkarte. In voller Trauer war die Mutter von Sebastian und weinte. Er nahm ein Taxi zum Aachener Hauptbahnhof und anschließend den Nachtzug nach Paris. Morgens kam er dort an. Mit der Metro ging es dann zum Gare de Lyon. Den Schnellzug in Richtung Genf nahm er dort. Je weiter er sich von den sieben Quellen des Wildbaches entfernte, desto schneller fielen die drückenden Sorgen von ihm ab. In Dijon stieg Sebastian aus. In jenem Oktober sah er diese burgundische Stadt zum ersten Mal. Vom Bahnhof fuhr er mit dem Bus zum Foyer International des Etudiants, dem Studentenwohnheim für Ausländer, in der Rue Maréchal Leclerc. Dort war ihm bereits ein Zimmer zugesagt worden. Am vierzehnten Oktober schrieb er sich als Student an der Universität ein. Im Gegensatz zur Aachener Hochschule war hier alles geordnet und geregelt. Die neuen Gebäude dieser traditionsreichen, französischen Universität, deren Architektur einigermaßen monumental aussah, erinnerten Sebastian aus unerklärlichen Gründen an Russland, obwohl er selbst noch nie dort gewesen war. Es gab einen Campus, auf dem alle Hörsäle und übrigen Einrichtungen konzentriert waren. Diese Cité Universitaire lag am Stadtrand. Das Zentrum war innerhalb einer viertel Stunde zu Fuß bequem erreichbar. Dijon war eine kleine, gemütliche Stadt. Als Student wurde man nicht abgelenkt. Für sein Studium hatte Sebastian also genug Zeit. Malerisch war auch die hügelige Landschaft der Umgebung. Seine Wahl war ein Volltreffer. Schon schnell konnte er sich von seinem toten Bruder befreien. In die Vorlesungen und Seminare eilte er und genoss sie ebenso wie den köstlichen burgundischen Rebensaft. Lange Wanderungen am Kanal entlang machte er in seiner Freizeit. Es war herrlich: diese Natur, die Côte-d’Or, das Studium und die Kommilitonen. Bereits nach kurzer Zeit sprach er fließend Französisch. Sehr stolz war er darauf. Schon immer hatte ihn diese melodische Sprache, deren Klang, wie Musik in seinen Ohren war, sehr fasziniert. Manchmal ging er ins Musée des Beaux-Arts, um das wunderschöne Marmorgrabmal des burgundischen Herzogs Johann ohne Furcht und seiner Gemahlin zu bewundern.
Sebastian nahm auch am Kunstunterricht teil. Die Dozenten, die ausschließlich dem weiblichen Geschlecht angehörten, waren hervorragende Lehrer. Hauptsächlich wurden französische Maler aus dem achtzehnten Jahrhundert behandelt. Der Schwerpunkt lag auf Watteau, Boucher und dessen Schüler Fragonard. Diese drei Rokoko- Maler mit ihren bunten, kurvenreichen Werken wurden von der Dozentin voller Begeisterung analysiert. Anscheinend hatten diese drei Künstler sie bezirzt. Bei Watteau und Fragonard waren es vor allem die romantischen Gartenlandschaften, die ihr als Anschauungsmaterial dienten. Die weißen Statuen, steinernen Bogen und Säulen wurden vom üppigen Grün der Bäume umsäumt. Die reich gekleideten Menschen, die sich in diesen paradiesischen Parks aufhielten, gehörten offensichtlich der begüterten Klasse an. Die Kompositionen waren so schwungvoll und farbenprächtig, dass Sebastian sich gewünscht hätte, an einem solchen Ort zu lustwandeln.
Das wohl geformte, rosafarbene Fleisch des "ruhenden Mädchens" von Boucher war geradezu eine Herausforderung. Mit leicht gespreizten Beinen lag das Mägdelein völlig nackt auf einem Diwan. Die kostbaren Tücher, auf denen sich die Begehrenswerte ausstreckte und der kindlich-unschuldige Blick, den sie zur Schau trug, erweckten beim Betrachter den Anschein, als wäre sie im Begriffe etwas Verbotenes zu tun. Den Zipfel des violetten Tüchleins, das sie in der linken Hand hielt und die einladende Bauchlage aber, ließen darauf schließen, dass die schöne Nackte schon ein wenig ihrer Unschuld eingebüßt hatte.
Im Literaturunterricht wurde immer wieder über den berühmten Roman von Flaubert gesprochen. Manchmal geschah es dann, dass die Lehrerin fast in Ekstase geriet, wenn sie wieder einmal in überschwänglichen Worten von den Träumen der unglücklichen Madame Bovary sprach. Dabei konnte man ihren Augen ansehen, dass sie die Weiten des Indischen Ozeans und Mauritius mit den schlanken, hohen Palmen buchstäblich vor sich sah. Starke Sklaven, wilde Bergbäche und ein treuer Hund namens Fidèle ergänzten das Bild. Sie erzählte, Emma Bovary habe sich schon kurz nach ihrer Hochzeit in Träumereien geflüchtet, da die Wirklichkeit des ehelichen Alltags ihr keine Befriedigung geschenkt habe. Durch die Scheinwelt, die sie allmählich aufgebaut habe, sei es ihr möglich gewesen, noch eine Zeitlang zu überleben. Anfänglich habe sie sich in die Jugendzeit zurückgeträumt. Den Schriftsteller Bernardin de Saint-Pierre habe sie ganz besonders gemocht. In "Paul et Virginie" habe sie sich gut hineinversetzen können, da deren Liebesbeziehung so leidenschaftlich gewesen sei. Madame Bovary habe ihr eigenes Eheleben als unendlich langweilig empfunden. Das Zusammenleben mit ihrem Gatten habe sie letztlich dermaßen angeödet, dass ihr nichts Anderes übrig geblieben sei, als sich mit untreuen Liebhabern einzulassen. Schließlich sei ihr der Bezug zur Wirklichkeit fast völlig abhanden gekommen und sie habe sich immer mehr in Lügereien verstrickt. Mit rasendem Tempo sei sie ihrem unvermeidlichen Untergang entgegengeeilt. Dessen ungeachtet habe sie aber in den schönsten Farben geträumt. Wundervolle Städte mit Kuppeln, Brücken und Schiffen seien an ihr vorbeigezogen. Kathedralen aus weißem Marmor und Springbrunnen mit plätscherndem Wasser hätten sich ihr dargeboten. Hütten, Meeresbuchten und Gondeln habe sie im Traum gesehen. Sebastian lauschte den leidenschaftlich vorgetragenen Worten der Dozentin. Obwohl er wusste, wie Emmas tragisches Schicksal enden würde, berührte es ihn jedes Mal wieder.
Neben dem alles überherrschenden Flaubert kamen mitunter der streng katholische Claudel sowie der Komödiendichter Molière und sein "Malade imaginaire" kurz zur Sprache. Diese Ballettkomödie vom eingebildeten Kranken war zwar lustig, aber machte keinen großen Eindruck auf Sebastian.
Noch uninteressanter war die "Annonce faite à Marie" von Claudel. Dieses geistliche Spiel, in dem die Dogmen der Kirche noch nachdrücklicher verkündet wurden als dies bereits geschah, konnte Sebastian nicht begeistern. Die Träume aber von Madame Bovary und ihr Untergang übten eine gewisse Faszination auf ihn aus.
Unendlich oft wurden Emmas Leiden im Literaturunterricht wiederholt. Sebastian hätte sich gewünscht, dass man Bataille oder Genet behandelt hätte, aber er war doch zufrieden, in dieser französischen Provinzstadt; fern aller Schwermut. Auch das Mensaessen liebte er. Im Vergleich zum faden, durchgekochten Brei der Aachener Hochschule war es ein Festmahl. Vier Gänge gab es immer. Darüber hinaus wurde einem noch vorzüglicher Wein eingeschenkt und frisch gebackenes, knuspriges Stockbrot gereicht. Unvergleichbar war es mit dem, was Sebastian bis dahin auf kulinarischem Gebiet kannte. Zu einem Höhepunkt des Tages wurde das Dinieren. Es schmeckte ausgezeichnet. In Frankreich genoss Sebastian das Leben in vollen Zügen.
Der Engel fand es an der Zeit, dass Sebastian wieder etwas Erotik erleben sollte, damit sich die Entwicklung seines Schützlings nicht zu sehr auf das Schöngeistige verlagere. Zu diesem Zweck entschied er sich für einen Gleichaltrigen, der in Dijon irgendetwas Technisches studierte.
In jener Zeit geschah es, dass Sebastian in der Mensa einen französischen Studenten kennen lernte. Während des Essens saßen sie am selben Tisch. Sebastian wünschte ihm einen guten Appetit. Sie kamen ins Gespräch und die gegenseitige Zuneigung spürten beide auf Anhieb. In den darauf folgenden Wochen machten sie viele gemeinsame Spaziergänge und man lud sich gegenseitig ein. Um die Weihnachtszeit, unmittelbar vor den Ferien, lud François, so hieß der Studiosus, Sebastian auf ein Ski-Wochenende zu sich nach Hause ein. An einem Freitagabend nahmen sie den Zug nach Macon und begaben sich zum Elternhaus von François. Ein altes Gebäude im Stadtzentrum war es. Sebastian und François bekamen zusammen ein Zimmer mit getrennten Betten zugewiesen. Ein gebürtiger Hamburger war der Vater von François, der im Krieg in Frankreich als Soldat gekämpft hatte und dort hängen geblieben war. Die Mutter war eine liebenswerte Französin, die nur das Kochen im Kopfe hatte. Vor allem, wenn ein Gast anwesend war, verbrachte sie Stunden in der Küche. Während der ersten Nacht im gemeinsamen Zimmer geschah nichts Aufregendes, denn weder Sebastian noch François trauten sich zu irgendwelchen körperlichen Annäherungsversuchen. Über eventuelle sexuelle Kontakte wurde schon gar nicht gesprochen. Am nächsten Morgen machte man sich auf den Weg in den Jura. Aufs Dach des elterlichen Autos wurden die Skier montiert und man fuhr los.
Nachdem sie einige Kilometer oberhalb von St. Claude angekommen waren, widmeten sie sich einen ganzen Nachmittag dem Langlaufen. Zuweilen ließen sie sich auch von kleineren Hügeln hinabgleiten. Ski fahren konnte Sebastian, obwohl er nur äußerst selten diesem Sport frönte. Er hatte es als Knabe in jenem Tal an der holländischen Grenze gelernt. Bei diesem Sport war es genau wie bei allem anderen Erlernten: Wenn man es als Kind einmal beherrschte, dann konnte man es für alle Zeit. Das Langlaufen durch die Wälder des Jura beeindruckte Sebastian sehr. Eine unsagbare Stille strahlte die Landschaft aus. Diese Ruhe spürte er auch nach einiger Zeit bei sich selbst. An den schneebedeckten Ästen glitt er vorbei und hätte am liebsten gewollt, dass es unendlich lange so weiterginge. Ab und zu dachte Sebastian an die Nacht, die vor ihm lag. Vielleicht würde François am Abend oder während der Nacht, im gemeinsamen Zimmer, eine Anspielung machen und die Sehnsucht nach körperlicher Zuneigung könnte sich erfüllen. Am späten Samstagabend war man wieder zurück in Macon. Die sportliche Betätigung hatte alle müde und zufrieden gemacht. Sebastian und François begaben sich, nach dem herrlichen Abendessen, in das ihnen zugewiesene Schlafgemach. Als sie sich auszogen, hoffte Sebastian, dass der schöne Franzose noch irgendetwas machen würde, was eventuell dazu hätte führen können, Sebastians Sehnsucht zu stillen. Bis auf ein neutrales, freundlich geflüstertes "Bonne Nuit!" geschah nichts.
Glücklicherweise hatte der Ausflug in die verschneiten Berge die beiden so ermüdet, dass sie direkt einschliefen. Am folgenden Tag, es war ein Sonntag, mussten sie nachmittags wieder die Heimreise nach Dijon antreten. Ein wundervolles Wochenende war es, aber das gewisse Etwas, die Amour bleu, hatte gefehlt. Das spürte Sebastian. Dass irgendwann in der Nacht, dort in dem Zimmer in Macon, etwas geschehen wäre, hätte er sich gewünscht. François wäre in sein Bett gekommen und man hätte in inniger Umarmung die Nacht verbracht. Der Gedanke, dass er François körperlich genießen wollte, ließ ihn nicht los.
Während der Weihnachtsferien fuhr Sebastian zu seinen Eltern, an die Quellen des Wildbaches, zurück. Noch hoffnungsloser war dort alles geworden. Scheinbar litt der Vater jetzt auch, denn er sagte fast überhaupt nichts mehr. Jeden Sonntag ging die Mutter wieder in die Kirche, und wenn die Zeit es zuließ, auch noch während der Woche. Über allem schwebte der Geist des toten Bruders. Durch diese intensive Anwesenheit des Verstorbenen, der mittlerweile schon länger als ein halbes Jahr im Grabe ruhte und aufgrund der Tatsache, dass man jetzt keinen Christbaum mehr gekauft und geschmückt hatte, wurde Sebastian wieder etwas trauriger. Für ihn war der Christbaum Weihnachten. Die Niedergeschlagenheit der Eltern war aber so groß, dass sie mit dieser Tradition gebrochen hatten.
Nach Dijon fuhr Sebastian wieder Anfang Januar zurück und freute sich schon auf das Wiedersehen mit François. Fest entschlossen war er nun, seine Sehnsucht nach körperlichem Kontakt mit François zu stillen. Da dieser freiwillig nicht wollte, entwarf er einen Plan, der todsicher zum Erfolg führen würde. Ein Rendezvous organisierte er mit François. Zum Essen traf man sich in der Mensa und anschließend sollte auf dem Zimmer von Sebastian Alkohol getrunken werden. Zu diesem Zwecke hatte er schon einige Tage zuvor, von seinem wenigen Geld, einige Flaschen billigen Weines gekauft. Er hoffte, dass François unter übermäßigem Alkoholeinfluss ein gewilliger Liebhaber sein würde. Man machte sich also gemeinsam, nach dem verräterischen Abendmahl, auf den Weg ins Foyer International des Etudiants. Oben im zweiten Stock, auf Sebastians Zimmer, wurde die erste Flasche Wein entkorkt und zügig getrunken. Schon glaubte Sebastian eine Willigkeit in den Augen von François zu erblicken. Die zweite Flasche wurde geleert und man trank beflügelt weiter. In seinen Fantasien war Sebastian schon so weit, dass er den Zechgenossen, nackt im Bett, vor sich liegen sah. Auf den Bauch würde er ihn drehen und ihm die muskulösen Arschbacken extrem spreizen und dann langsam in diese warme, enge Öffnung hineingleiten. Zu einer fürchterlichen Explosion würde es kommen.
Die beiden Trunkenbolde bekamen glasige Augen und tranken weiter. Völlig unerwartet stand François auf, begab sich zum Waschbecken, und das Mensaessen und der Rotwein verließen, in einigen kräftigen Schüben, den Magen. François würgte noch eine Weile.
Sebastian kehrte wieder in die Wirklichkeit zurück. Nur noch daraus bestand der Abend, dass er den bleichen François bis zu dessen Zimmer im Studentenwohnheim auf dem Universitätsgelände begleitete. Seit diesem Tag hatte François seine erotische Ausstrahlung verloren. Sebastian unternahm keine sexuellen Annäherungsversuche mehr. Man redete und aß zusammen. Gebrochen war die Spannung. Sie hatten jetzt einen rein freundschaftlichen Umgang miteinander.
Im Februar ging das Semester als Austauschstudent langsam zu Ende. Sebastian war zu jener Zeit schon wieder damit beschäftigt, einen neuen Studienort zu suchen, denn er dachte mit Angst und Schrecken an jenes schöne Tal, wo noch immer der Geist des toten Bruders sein Unwesen trieb.
In der Vorhalle der Mensa, am schwarzen Brett, sah er zufälligerweise ein Informationsblatt der Oxford University. Es wurde mitgeteilt, dass man sich schon jetzt für einen Sommerkurs an dieser altehrwürdigen, englischen Universität einschreiben könnte. Um einen dreiwöchigen Kurs über englische Literatur am Somerville College handelte es sich. Direkt meldete Sebastian sich an, weil es etwas mit seinem Anglistikstudium zu tun hatte. Außerdem könnte er sich in Oxford darüber klar werden, wie er sein Studium weiter gestalten wollte. Auf jeden Fall wäre er für drei Wochen aus Aachen, vom toten Bruder und den leidenden Eltern, weg.
Ende Februar verließ er, schweren Herzens, Dijon und kehrte wieder an die sieben Quellen des Wildbaches zurück.
9. Kapitel
Auf dass sich die sexuelle Praxis Sebastians nicht zu einseitig entwickle, war der Engel zu dem Entschluss gekommen, ihn abwechslungshalber wieder einmal an eine heterosexuelle Beziehung heranzuführen. Damit sein Schützling gleichzeitig auch noch etwas mehr über asiatische Sensibilität erfahre, erwählte der Bote des Allwissenden eine fünfundzwanzigjährige Japanerin.
Bevor es aber zu dieser schicksalhaften Begegnung kam, sollten noch einige Monate vergehen, damit Sebastian hinreichend Zeit bleibe, sich auf das exotische Ereignis einzustimmen. Wie die Blütenblätter einer Lotosblume sich entfalteten, um das Licht aufzunehmen, so musste auch Sebastian sich öffnen, damit ihm das, was er selbst nicht einmal erahnte, in einigen Monaten zuteil werde.
Zunächst verbrachte er den Frühling in jenem Tal, an den sieben Quellen des Wildbaches, in der Nähe der holländischen Grenze. Ab und zu ging er noch in die Hochschule zu Vorlesungen und Seminaren. In den Augen von Sebastian war das Chaos noch größer geworden. Der Gedanke aber an Oxford wirkte fast wie eine Befreiung. Im Juli sollte er ja zu Studienzwecken, drei Wochen lang, dorthin fahren. Das war ihm aber nicht genug. Für immer wollte er weg aus jenem Tal. Die Fächer Anglistik und Romanistik sagten ihm auch nicht mehr zu. Deswegen entschloss er sich ab September in Holland zu studieren. Bereits im Mai bemühte er sich um einen Studienplatz an der Universität von Utrecht. Hier wollte er sich der Germanistik widmen. Auch versprach er sich Vorteile von diesem Fach- und Ortswechsel, glaubte er doch, dieses Studium in den Niederlanden spielend bewältigen zu können, denn Deutsch sei schließlich seine Muttersprache. Der Lehrerberuf war immer noch sein Ziel.
Als Erstes aber stand Oxford auf seinem Programm. Anfang Juli machte er sich auf den Weg. Er nahm den Expresszug von Aachen über Brüssel nach Ostende. Dann ging es mit der Fähre nach Dover und weiter mit dem Eilzug nach London. Diese Strecke war Sebastian schon bestens bekannt, da er seit seiner ersten Englandreise, damals vor acht Jahren, den Ärmelkanal bereits mehrere Male überquert hatte. Vom Victoria-Bahnhof nahm er die U-Bahn nach Paddington Station. Dort stieg er in den Zug, der ihn in die alte Studentenstadt bringen sollte. Der Bahnhof in Oxford befand sich etwas außerhalb des Zentrums. Die Stadt machte auf Sebastian den Eindruck eines riesigen Klosterkomplexes. All diese alten Türme und kirchenähnlichen Gebäude, die aus längst vergangenen Jahrhunderten stammten, ließen ihn eine wohl tuende Ruhe erahnen. Das Somerville College war jüngeren Datums, aber doch auch schon beinahe hundert Jahre alt. Wie damals bei seiner Gründung war es immer noch ein Frauen-College. Nur im Sommer, wenn die weiblichen Studierenden Ferien hatten, stand es auch Männern offen.
Dieser Sommerkurs in Oxford war nur ausländischen Englischlehrern und Anglistikstudenten beiderlei Geschlechts vorbehalten. Aus aller Herren Länder waren sie angereist, die Lernbegierigen. Eine bunte Mischung von Individuen hatte sich in der Woodstock Road eingefunden, deren Weltanschauungen genauso unterschiedlich waren wie die Anzahl ihrer Lebensjahre. Vom Christentum über den Islam bis zum Buddhismus reichte das Spektrum ihrer Religionen und ihre Altersstufen überbrückten drei Generationen. Sie alle waren in der alten Universitätsstadt nur mit dem einen Ziel zusammengekommen, sich der britischen Kultur zu widmen und sich ihr noch mehr zu öffnen. Ihr größtes Verlangen war es sich von der Historie dieses längst vergangenen Imperiums einfach treiben zu lassen. Sie hofften, dass sich ihr Wunsch erfülle, wenigstens einen letzten Zipfel noch dieser traditionsreichen Vergangenheit zu erhaschen, die seit vielen Jahrzehnten schon mitsamt ihrer "Splendid Isolation" zu einer Fata Morgana geworden war. Die Monarchie gab es noch, aber das "Empire", das einst unter Victoria die Welt umspannte, war lange schon entschwunden; zerplatzt wie ein Ballon, der zu sehr aufgepumpt wurde.
Das Einzige, was selbst Jahrtausende noch ohne größere Schäden überleben würde, war die Literatur und deren Kreatoren. Lawrence und Shakespeare würden auch weiterhin den Briten und Anglophilen dasjenige geben, wonach sie sich so sehnten: Glückseligkeit, Muße und reichliche Labsal für die Seele.
Sebastian war dem Charme des alten Oxford erlegen und sich dessen bewusst.
Jetzt aber ging er wieder zur Tagesordnung über. Ihm und allen übrigen Kursteilnehmern wurde ein eigenes Zimmer zugewiesen.
Etwas Internatsähnliches hatte dieses College schon. Sowohl die Gebäude, in denen die Unterrichtsräume untergebracht waren, als auch die Wohntrakte der Studentinnen bildeten einen großen, fast rechteckigen Komplex. Im geräumigen Innenhof gab es neben einem Tennisplatz weitläufige Rasenflächen, in deren Mitte eine alte Zeder mit mächtiger Krone stand. Dieser immergrüne Nadelbaum befand sich bereits seit hundertfünfzig Jahren an diesem Platze.
Es schien fast so, als hätte man das College um ihn herum gebaut, auf dass die zukünftigen Akademikerinnen sich an ihm erfreuen und in seinem Schatten Kühlung finden könnten. Diese Zeder mit ihren wundersam gebogenen Ästen und Zweigen war Sebastian ein Zeichen dafür, dass der Lebensweg mitunter einen bizarren Verlauf nehmen konnte. Des ungeachtet aber barg diese scheinbare Verschlungenheit und Abwegigkeit einen Sinn in sich, der oftmals erst im Nachhinein verständlich wurde.
Als man die Zeder als zartes Bäumchen pflanzte, sollte es noch mehr als fünfzig Jahre dauern, bevor sie die zentrale Lage einnehmen würde, die ihr angemessen war.
Durch diesen gewaltigen Baum wurde Sebastians Fantasie angeregt. Er hatte sich ein wenig seinen Tagträumereien hingegeben, denn Bäume und Sträucher hatten ihn schon seit seiner Kinderzeit fasziniert.
Bereits sechs Monate später sollte dieser friedliche Riese einem verheerenden Sturm anheim fallen, der ihn völlig entwurzelte. Von diesem traurigen Ereignis aber würde Sebastian nie etwas erfahren.
Jetzt wandte er sich wieder den Bauwerken zu und stellte mit Zufriedenheit fest, dass sie in einem guten Zustand verkehrten. Vor allem der große Speisesaal war beeindruckend. Er hatte eine rechteckige Form und nur an seiner Längsseite, die zum Innenhof lag, gab es Fenster. Ihnen gegenüber war die Tür.
An den Wänden hingen die Portraits der Rektorinnen, mehr oder weniger in chronologischer Reihenfolge. Dem Raum verliehen sie eine strenge Würde, gleichzeitig strahlten aber diese ehrwürdigen Häupter auch eine große Ruhe aus.
Sebastian sah diese langen, schweren Holztische, an denen jeweils sechzehn Personen Platz hatten.
Wenn man den Saal betrat, sprang sofort die "high table" ins Auge. Sie erstreckte sich über die gesamte rechte Breitseite des Raumes und stand quer zu den übrigen Esstischen. Ihren Namen verdankte sie dem Umstand, dass sie sich auf einer Erhöhung befand, die einer Bühne glich. Der theatralische Effekt, der dadurch zustande kam, faszinierte Sebastian ganz besonders.
Dieser majestätische Tisch war einem riesigen, lang gestreckten Altar vergleichbar, der nur darauf wartete, dass auf ihm irgendetwas geopfert werde. Einundzwanzig Stühle umgaben ihn. Wie sich später herausstellen sollte, war er ausschließlich den Dozenten und einigen auserwählten Kursisten vorbehalten, wobei die Letzteren täglich wechselten, auf dass jeder einmal informell mit seinem Lehrer sprechen könne.
Am Rande des Stadtzentrums lag dieses College wie eine feste Burg, die ihre Kraft aus sich selbst schöpfte. In der näheren Umgebung gab es viel Sehenswertes. Ganz besonders mochte Sebastian die Parks der Universität am Ufer des kleinen Flusses, dem man den Namen "Cherwell" gegeben hatte. Oft hielt er sich dort auf, denn das ruhig dahinströmende Wasser inspirierte ihn. Es erfrischte seinen Geist und gab ihm neue Kraft.
Traumhaft schön war die Landschaft um Oxford herum. Bäume, Hecken und Sträucher wechselten einander, in einer leicht hügeligen Landschaft, immer wieder ab. In einer solchen Umgebung musste es Sebastian gefallen. Im College wurden die Mahlzeiten mit den Kursteilnehmern und den Lehrern gemeinsam eingenommen. Es war wie in einer großen Familie. Sogar der Tee wurde jeden Tag pünktlich um vier Uhr serviert. Für den Sebastian war es der ideale Studienort. Die Welt war draußen, unendlich weit weg. Hier konnte er sich der englischen Literatur vollkommen hingeben, ohne dass ihn irgendetwas störte. Hauptsächlich behandelte man die Theaterstücke von Shakespeare.
In dieser beschaulichen Atmosphäre, in der man das Gefühl hatte, einen leichten Hauch des Geistes der "Old Fellows" von Oxford zu verspüren, traf Sebastian die schlitzäugige Kiyoko aus der alten Kaiserstadt Kioto. Sie war Japanerin und so alt wie er. Auch sie nahm an diesem Literaturkurs teil. Beim ersten Zusammentreffen schon sprang der Funke über. Langsam, aber intensiv entwickelte sich diese neue Liebe. Ihr Anglistikstudium hatte Kiyoko schon abgeschlossen und war jetzt Lehrerin in Kioto. Jeden Tag sah Sebastian sie. Allabendlich schlenderte man durch Oxford und besuchte die gemütlichen, wohnzimmerähnlichen Pubs.
Unzertrennlich wurden sie. Kiyoko hatte eine merkwürdige Lebenseinstellung. Fast allen Dingen stand sie sehr negativ gegenüber. Immer sprach sie von dem fast unerträglichen Druck, den ihre Familie stetig auf sie ausübte. Sie solle doch, in ihrem Alter, so schnell wie möglich, heiraten, sonst würde sie alleine bleiben. Schon mehrmals waren ihr potenzielle Freier von der Familie angeboten worden. Kiyoko wollte dies aber nicht. Alles das faszinierte Sebastian über alle Maßen. Weiterhin konnte man mit ihr über sehr viele Themen reden, denn die Grundeinstellung von Sebastian und die der zierlichen Kiyoko war die Gleiche. Sie wollten sich beide keinerlei gesellschaftlichen Zwängen unterwerfen.
Über Shakespeare unterhielt man sich und machte nächtliche Spaziergänge am Fluss entlang. Auch Lawrence, Genet und Bataille, diese begnadete Schriftsteller-Trinität, wurde ausführlich besprochen. Besonders die "Histoire de l'oeil" von Bataille übte auf Kiyoko eine magische Anziehungskraft aus. Sie kannte diesen genialen französischen Autor noch nicht. Den Inhalt dieser "‘‘Augen-Geschichte” musste Sebastian der aufmerksam zuhörenden Kiyoko erzählen. Anschließend diskutierten sie über die Philosophie, die möglicherweise dahinter stecken könnte. Die Zeit in Oxford war für Sebastian und Kiyoko so ruhevoll und doch so aufregend.
Am Wochenende machte man kleinere Ausflüge. Einer davon führte sie nach Stratford, zum Shakespeare-Gedächtnistheater, wo sie einer Aufführung der "Merry Wives of Windsor" beiwohnten. Danach pilgerten sie noch kurz zum Geburtshaus dieses talentierten Dichters. In einer der nahe gelegenen Kneipen konnte man dann über die lustigen Weiber von Windsor ausführlich weiterdiskutieren. Bei diesen schon vergebenen Frauenzimmern versuchte sich der tölpelhafte John als Gigolo einzuschmeicheln. Erwartungsgemäß war das Glück nicht auf seiner Seite, denn wo bliebe sonst das Erlebnis der Schadenfreude, das den Zuschauern so teuer war.
Der gute alte William kannte die Wünsche seines Publikums. Er wusste es meisterhaft zu bespielen und in seinen Bann zu ziehen, auf dass es sich sowohl am schönen Schein als auch an den klingenden Worten ergötze.
Um sich vor den eifersüchtigen Ehemännern in Sicherheit zu bringen, musste Falstaff allerlei Ungemach über sich ergehen lassen. Schließlich lockte man ihn zu einem vermeintlichen Schäferstündchen in den Park von Windsor. Dort wurde er entlarvt, malträtiert und von der Bürgerschaft verspottet. Eindeutig und simpel war die Moral der Geschichte. Vermutlich wären die "Merry Wives of Windsor" in Vergessenheit geraten, hätte es nicht den genialen Verdi gegeben. Dieser italienische Maestro hatte dem tollpatschigen John mit seiner Oper "Falstaff" postum zu großem Ruhm verholfen.
Sebastian und Kiyoko erlebten eine unbeschwerte Zeit; so weit entfernt vom Alltag. Kioto und Aachen waren fast nur noch auf geographische Namen reduziert. Aber dennoch unterhielt man sich zuweilen über den toten Bruder und die eventuellen Ursachen seines mysteriösen Ablebens. Während dieser ganzen Zeit kam es aber nie zu einer körperlichen Begegnung zwischen Sebastian und Kiyoko. Mit anderen Sachen war man viel zu beschäftigt, als dass man an Körperlichkeiten gedacht hätte. Diese Tage in England waren für Sebastian eine ungeheure Bereicherung und von großer Wichtigkeit.
Nach drei Wochen musste man sich trennen. Kiyoko machte noch einen anschließenden Europa-Trip und Sebastian fuhr wieder an die Quellen des Wildbaches zurück. Bereits während der Heimreise war er fest davon überzeugt, dass er Kiyoko wiedersehen würde.
Als er Ende Juli Zuhause ankam, lag dort schon der Brief der Utrechter Universität. Einen Studienplatz in der Germanistik hatte man ihm eingeräumt. Sebastian fühlte sich erleichtert und glücklich. Die Zeit, die ihm bis zur Abreise noch blieb, ließ er jetzt nutzlos verstreichen. Ende August fuhr er nach Utrecht, um dort das Studium der Germanistik aufzunehmen. Kurz zuvor schrieb er Kiyoko den ersten Brief, in dem er ihr mitteilte, wie sehr er sie vermisste.
Das Studium gestaltete sich zu Beginn, wegen der niederländischen Sprache, schwieriger als er erwartet hatte. Diese Anfangsschwierigkeiten waren aber schon rasch beseitigt. Manche Fächer wurden ausschließlich in Holländisch unterrichtet. Es betraf hier vor allem den Themenbereich der allgemeinen Sprachwissenschaft. Noam Chomsky war die alles beherrschende Autorität. Beinahe wie ein Heiliger wurde er verehrt. Seine Theorie von einer neuen Sprachlehre, die er als generative Transformationsgrammatik bezeichnete, war nicht nur den Dozenten, sondern auch einer Vielzahl von Studenten sozusagen die Bibel. Stundenlang musste Sebastian sich das anhören, was Chomsky erdacht und erprobt hatte, ohne dass auch nur der kleinste Funke einer etwaigen Begeisterung übergesprungen wäre. Sebastian war der Auffassung, dass die lateinischen Begriffe ausreichend seien, die Sprache und deren Struktur zu beschreiben. Den Sinn einer Erneuerung sah er nicht ein.
Bereits nach einigen Wochen fing Sebastian an intensiv nach Japan zu schreiben. Kiyoko erwiderte die Briefe. Immer stärker wurde die Sehnsucht nach der anmutigen Japanerin. Sebastian bemühte sich sehr, Kiyoko davon zu überzeugen, dass es für ihn die höchste Erfüllung bedeute, wenn sie sich zu dem Entschluss durchringen könne, nach Europa zu kommen, auf dass man die Freuden des Lebens vereint genieße. Er unterließ keine Anstrengung und setzte seine ganze Überzeugungskraft ein, auf dass Kiyoko seinem Wunsch nachkomme. Die wunderschönen Tage von Oxford und Shakespeare, dessen Werke Kiyoko so mochte, erweckte er in seinen langen Briefen zu neuem Leben, damit sich das erfülle, was Sebastian so ersehnte.
Anfänglich hatte Kiyoko große Bedenken und ersann vielerlei Gründe, die gegen eine solche Reise sprachen. Einen Einwand, den sie immer wieder in den Vordergrund schob, hatte die Finanzlage Sebastians zum Inhalt. Da er noch Student sei und infolgedessen noch kein ausreichendes Einkommen habe, müsse sie davon ausgehen, dass eine gemeinsame Haushaltsführung ein fast unüberwindbares Hindernis darstelle. Das Risiko, das sich daraus ergebe, wolle sie nicht eingehen. Sebastian musste seine ganze Überredungskunst aufbieten, um Kiyokos Zweifel aus dem Weg zu räumen, was ihm schließlich auch gelang.
Gegen Ende des ersten holländischen Semesters hatten Sebastian und Kiyoko schon Heiratspläne geschmiedet. Sebastian fühlte jetzt, dass er reif für die Ehe sei. In der letzten Februarwoche bezog er, nachdem er sechs Monate bei einem älteren, allein stehenden Alkoholiker gewohnt hatte, eine neue Bleibe. In einem riesigen Studentenhochhaus bekam er ein Zimmer. Dort mussten sich jeweils acht Studenten und Studentinnen zwei Duschen, eine Toilette und die Küche teilen. Im siebzehnten Stock landete Sebastian. Von dort oben hatte er einen einzigartigen Panoramablick über die Stadt. Er konnte wunderbar, tagein, tagaus, den Turm des Domes sehen. Die Gruppe, mit der er zusammenwohnte, war sehr bunt gemischt. Für die Studiengänge galt das Gleiche. Eine schöne, vollbusige Buschnegerin aus Aruba gab es, die Anglistik studierte. Einen wunderschön geschwungenen Mund mit dicken, herausfordernden Lippen hatte sie. Großen Wert legte sie auf ihr Äußeres. Sie wählte täglich sehr sorgfältig ihre Kleidung aus, auf dass auch alles in Harmonie mit ihrer jeweiligen Gemütsverfassung sei. Zuweilen erzählte sie von jener kleinen Insel vor der venezolanischen Küste, wo ihr altes und gebrechliches Mütterlein, von dem sie ausschließlich Liebesvolles berichtete, noch immer wohnte. Was bei dieser Arubanerin noch so anziehend wirkte, war ihr schön geformter, knackiger Hintern, mit dem sie manchmal auch ganz gehörig kokettierte. Im Grunde genommen verachtete sie die weißen Kommilitonen. Sie war stolz auf ihre afrikanischen Wurzeln und das zeigte sich auch in ihren graziösen Bewegungen.
Des Weiteren gab es einen schlanken, groß gewachsenen Hindustani aus Niederländisch-Guyana in ihrer Wohngemeinschaft. Dieser studierte Chemie. Er war liebenswürdig und hilfsbereit, aber gleichzeitig ein großer Redner vor dem Herrn. Seinem Namen tat er alle Ehre an, denn er hieß Elias wie der biblische Prophet.
Stundenlang konnte er über jedes willkürliche Thema schwadronieren. Eine bemerkenswerte Eigenschaft besaß er: Über alle Normen und jegliche Etikette setzte er sich elegant hinweg. Mitunter kam es deswegen zu kleineren Reibereien, die aber nie zu offenen Auseinandersetzungen führten. Klug genug war er seine Provokationen nicht auf die Spitze zu treiben.
Der Rest der Gruppe bestand aus Niederländern. Mit diesen Studenten kam Sebastian gut zurecht. Sein Holländisch wurde auch immer perfekter, obwohl der starke, deutsche Akzent blieb. Das zweite Semester hatte Sebastian zu seiner vollen Zufriedenheit abgeschlossen. Zu Beginn der Ferien fuhr er zunächst an die sieben Quellen des Wildbaches um sich einige Tage zu erholen. Die trauernde und in Schwarz gehüllte Mutter weihte er in seine Heiratspläne ein. Nur abweisend reagierte sie darauf, was Sebastian aber nicht von seinem Vorhaben abbringen konnte.
Nach Paris fuhr er und begab sich zum Flughafen Charles-de-Gaulle um Kiyoko abzuholen. In Kobe hatte sie sich vom niederländischen Generalkonsulat ein Touristenvisum für die Dauer von drei Monaten ausstellen lassen. Auf diesen Tag hatte sich Sebastian sehr gefreut, denn ein ganzes Jahr hatte er darauf wachten müssen. In ihrem Briefwechsel hatten sie sich schon alles in üppigen Farben ausgemalt, auch ihre gemeinsame Zukunft. Aber des ungeachtet war Kiyokos Misstrauen noch nicht ganz zerstreut.
Am Flughafen in Roissy traf Sebastian rechtzeitig ein und das Wiedersehen fand statt. Kiyoko wirkte etwas müde und ermattet. Solche hohen Erwartungen hatte Sebastian an dieses lang ersehnte Rendezvous geknüpft, dass er darüber fast die Realität vergaß. Er hatte noch immer das Bild von Kiyoko aus Oxford vor sich. Völlig anders jedoch als er sich das vorgestellt hatte, war diese erste Begegnung in Roissy. Diese Enttäuschung war aber ein hilfreicher, kleiner Schock, da sie Sebastian wieder in die Wirklichkeit zurückholte.
Gemeinsam fuhren sie in die Stadt, wo Kiyoko ein Doppelzimmer in einem Hotel, in der Nähe des Triumphbogens, hatte reservieren lassen. Beide waren völlig erschöpft. Bei Kiyoko lag es am langen Flug und bei Sebastian an der Aufregung des Wiedersehens.
Trotzdem hatte er gehofft, dass diese erste gemeinsame Nacht in Paris mit etwas mehr Körperlichkeit verbunden gewesen wäre. Ein wenig enttäuscht war er schon, konnte aber dennoch gut schlafen in jener ersten Nacht. Am nächsten Morgen besichtigten sie, nach dem Frühstück, den Eiffelturm, aber nur von unten. Man ging ins Louvre. Hier sah Sebastian zum ersten Mal die schmunzelnde Mona Lisa von Leonardo da Vinci im Original. Seit nahezu fünfhundert Jahren schon zeigte "La Giocconda" dieses unergründliche Lächeln. Böse Zungen behaupteten zuweilen, dass diese dunkelhaarige Mona Lisa ein Jüngling sei, dem Leonardo eine weibliche Frisur verpasst hätte. Das Geheimnis ihres Lächelns hatte Sebastian schon immer gefallen. An eine Interpretation wagte er sich aber nicht. Eigentlich hatte er sich dieses Bild viel größer vorgestellt.
Hinaus, in den Bois de Boulogne, fuhr man am zweiten Tag, weil es in Paris so unerträglich heiß war. Der Kontakt mit Kiyoko baute sich langsam auf und man verstand sich wieder. Die fleischlichen Gelüste aber ließen weiterhin auf sich warten. Auch in der zweiten Nacht geschah nichts in dieser Hinsicht. Kiyoko bettete sich abends, fast ritualisiert, und lag dort dann wie eine aus Stein gemeißelte griechische Göttin unter Laken. In seinem Innern begann Sebastian eine leise Unruhe zu verspüren, denn der Zweck von Kiyokos Reise sollte ja letztendlich die Ehe sein. Jedes Mal beruhigte er sich wieder mit dem Gedanken, dass es noch genug Zeit geben würde.
Am Abend des letzten Tages in Frankreich nahmen Sebastian und Kiyoko den Nachtzug nach Aachen, wo sie am folgenden Morgen eintrafen. Sie begaben sich an die Ufer des Wildbaches und kehrten in Sebastians Elternhaus ein. Leer stehende Zimmer gab es dort ja genug. Um die Ankunft von Kiyoko wussten die Eltern.
Freundlich und einladend war der Vater. Genau das entgegengesetzte Verhalten legte die Mutter an den Tag. Da Kiyoko aber kein Deutsch verstand, war es weiter nicht hinderlich. Sie konnte die Ablehnung der Mutter, ihr gegenüber, nur in deren Augen ablesen. Beide bekamen ein eigenes Zimmer zugewiesen. Man blieb einige Tage, aber sexuell geschah noch immer nichts. Abends ging Sebastian in sein Zimmer und Kiyoko in ihres, ohne dass sie auch nur den geringsten Versuch unternommen hätte, sich nachts in Sebastians Bett zu schleichen, um sich dem Beischlaf hinzugeben. Sebastian seinerseits enthielt sich aller nächtlichen Besuche in Kiyokos Zimmer, da sie ein Gast im Hause seiner Eltern war und es sich nicht schickte, das Recht des Besuchers auf Unversehrtheit zu schänden. Noch immer tröstete er sich mit der Vorstellung, dass es vermutlich doch genügend Zeit geben würde das Erhoffte nachzuholen.
Kiyoko, ihrerseits, signalisierte Sebastian auch nicht, dass ihr der Geschlechtsverkehr fehlen würde. Die sexuelle Spontaneität, wie er sie als Kind mit der wilden Maria und später, als Heranwachsender, in Jerusalem mit dem stolzen Araber oder dem schönen Tanzpartner erlebt hatte, war nicht vorhanden. Die langen Gespräche und tief schürfenden Diskussionen mit Kiyoko aber, verliefen zur vollen Zufriedenheit beider. Dem hoffenden Sebastian schenkte dieser Umstand ein wenig Trost.
Nach einigen Tagen verließ man das Tal des Wildbaches, wo noch immer unentwegt der Geist des toten Bruders umherschwebte. Mit dem Traktor, der von Sebastians Vater gesteuert wurde, begab man sich nach Vaals. Dieser war mächtig stolz darauf, eine echte Japanerin über die Grenze kutschieren zu können. Kiyoko hatte lediglich einen großen Koffer und eine Handtasche als Gepäck. Nur eine kleinere Wochenendtasche führte Sebastian mit sich. In Vaals nahm man den Bus nach Maastricht. Weiter ging es mit dem Intercity nach Utrecht. Sie begaben sich zu dem Studentenhochhaus. Dort oben, im siebzehnten Stock, wurde Kiyoko dann etwas zutraulicher. Sie stimulierte jetzt Sebastian geradezu zum Körperkontakt. Abends kam es zur ersten Kopulation. Ein wenig mechanisch ging alles vor sich. In ihren Schlafanzug gehüllt, lag Kiyoko auf einer Matratze, die sich auf dem Fußboden befand.
Sebastian war nackt und legte sich zu ihr. Er drehte sie auf den Bauch und zog ihr die Hose aus. Während er ihre Beine und Schamlippen spreizte, schaute er sich jede aufreizende Einzelheit an. Er führte den Finger ein und spürte diese feuchten, warmen Schleimhäute. Kiyoko erhob ihren kleinen, knackigen Arsch und wölbte ihn jetzt extrem in die Höhe, sodass alles sich öffnete.
Sebastian konnte nun den vollkommen erigierten Schwanz tief in sie eindringen lassen. Dieses herrliche Gefühl grenzenlose Macht über sie zu besitzen kam über ihn. Jetzt fing Kiyoko auch an, sich rhythmisch zu bewegen und stöhnte leise vor sich hin. Es kam zur Ejakulation. Kurze Zeit noch blieb Sebastian neben ihr liegen. Kiyoko drehte sich auf den Rücken. Nun sah Sebastian zum ersten Mal die kleinen, festen, japanischen Brüste und diese langen, glatten, schwarzen, asiatischen Schamhaare. Kiyoko zog die Hose ihres Schlafanzugs wieder an und bettete sich, ihrem Pariser Ritual ähnlich, wie eine griechische Statue unter Laken. Sebastian legte sich in sein eigenes Bett und schlief fast direkt ein. Während des Geschlechtsaktes wurde kein Wort gewechselt. Von nun an blieb Kiyoko nachts auf der Matratze auf dem Fußboden und Sebastian ruhte in seinem Bett. Diese sexuelle Praxis wiederholte sich täglich nach dem gleichen, ritualisierten Muster. Die Spontaneität vermisste Sebastian, sagte Kiyoko aber nichts davon.
Nach sieben Tagen kaufte Sebastian der liebenswert-unschuldigen Kiyoko ein gebrauchtes Fahrrad, sodass man gemeinsame Ausflüge machen konnte, um die Semesterferien sinnvoll und sportlich zu nutzen. Vorerst sollte Kiyoko bis Mitte September bleiben. Mit den anderen Studenten bekam sie schnell Kontakt, weil sie alle, mehr oder weniger gut, Englisch und einige sogar auch noch Französisch sprachen. Oft war Sebastian mit Kiyoko unterwegs. An manchen Aktivitäten jedoch beteiligte sich Kiyoko nur teilweise oder überhaupt nicht. So ging sie nie mit ins Freibad und auch das Sonnenbaden lag ihr nicht sonderlich. Ein merkwürdiges Ritual hatte sich bei diesem Sonnen herausgebildet. Sebastian radelte, zusammen mit ihr, zu einer Waldlichtung, in der Nähe des Hochhauses. Dort dann zog Sebastian die Badehose an, breitete die mitgebrachte Decke auf dem Gras aus und Kiyoko fing an, seinen ganzen Körper mit Sonnencreme einzureiben. Sie behielt dabei immer alle Kleider an. Sehr sorgfältig und intensiv wurde die Handlung des Einschmierens vorgenommen. Ungefähr dreißig Minuten dauerte diese japanische Prozedur. Bei Sebastian aber gab es keinerlei sexuelle Erregung während der Massage. Nach dieser Behandlung schwang Kiyoko sich aufs Rad und fuhr wieder heim.
Immer erst am Spätnachmittag kam Sebastian nach Hause.
Nach sieben Wochen klagte Kiyoko, zuweilen, über Kopfschmerzen.
Auch bekam sie einen unangenehmen Heuschnupfen und litt zeitweise unter schweren Depressionen. Manchmal sogar suchte sie auch Streit. Aber das Einreibe- und Beischlafritual wurden weiterhin regelmäßig ausgeführt. Sebastian fühlte, dass sich sein Selbstvertrauen von Tag zu Tag steigerte, da Kiyoko so vollkommen abhängig von ihm war. Es hatte nie in seiner Absicht gelegen, dass dies geschehen sollte. Aus der Beziehung der beiden ergab es sich einfach von selbst. Je abhängiger Kiyoko wurde, desto selbstsicherer wurde Sebastian. Ab und zu ging er jetzt abends alleine weg um Freunde zu besuchen. Anfangs fragte Kiyoko ihn dann oft, worüber sie gesprochen hätten. Diesen Fragen wich Sebastian aus und spürte, dass er sich emotional von Kiyoko entfernte. Gedanken über die versprochene Eheschließung machte er sich jetzt auch. Er zweifelte daran, ob sie wohl die richtige Partnerin für ihn wäre. Über Kiyoko und ihrer beider Beziehung dachte er nach. In Japan hatte sie ihre Stelle als Englischlehrerin aufgegeben. Die gesamten Reisekosten hatte sie bezahlt. Auf das Versprechen zur Ehe hin war sie nach Europa gekommen. Aufgrund aller dieser Überlegungen kam es Ende August zur Aussprache. Schwer enttäuscht war Kiyoko. Verzweifelt versuchte sie noch, Gründe zu finden, die die Lage hätten entschärfen können. Obwohl Sebastian Mitleid mit Kiyoko hatte, blieb er doch bei seinem Entschluss, vorerst nicht zu heiraten. Nach einigen Tagen hatte Kiyoko sich an die neue Situation gewöhnt. Die "Histoire de l'oeil" von Georges Bataille besorgte sie sich. Seit Oxford ließ ihr diese Geschichte über Tod und Erotik keine Ruhe. Sie rief die Fluggesellschaft an um sich ihre Rückreise für Mitte September bestätigen zu lassen. Für beide fing jetzt noch einmal eine beglückende Zeit an. Man machte wieder viele gemeinsame Ausflüge. Die furchtbaren Kopfschmerzattacken von Kiyoko verringerten sich. Die schweren Depressionen blieben, waren aber weniger heftig. Sebastian fühlte eine gewisse Erleichterung, diesem Ehegelöbnis entronnen zu sein, obwohl er auch oft daran denken musste, wie es Kiyoko ergehen würde, wenn sie, so unverrichteter Dinge, wieder in Kioto auftauchen würde. Sie wohnte noch bei ihren Eltern. Vorerst hätte sie ja noch ein Dach über dem Kopf. Wie sie sagte, wollte sie wieder nach Kioto zurückkehren und nicht, etwa aus Scham, wegen der misslungenen europäischen Expedition, ein neues, anonymes Leben in Tokio beginnen. Diese Dinge wurden aber als Gesprächsthema zwischen Sebastian und ihr so viel wie möglich vermieden, da es für beide äußerst unangenehm war.
10. Kapitel
Der Engel wusste um Sebastians schwierige Situation und schaffte Abhilfe. Er hatte eine Maßnahme vorgesehen, die für den sexuellen Reifungsprozess seines Schützlings von äußerster Wichtigkeit sein sollte. Aufgrund dessen erwählte er einen gleichaltrigen Pianisten in spe, auf dass Sebastian nicht abgleite. Außerdem war der Bote Gottes der Auffassung, dass ein fast professioneller Klavierspieler imstande sei, seinen Schützling dazu anzuhalten, das Spielen eines Instruments zu erlernen, auf dass er eigenhändig musiziere, anstatt sich nur Vorproduziertes anzuhören. Offensichtlich hatte die Muse der Musik Sebastian noch nicht in ihren Bann gezogen.
Just einen Tag bevor Kiyoko, die schon ihre Reisevorbereitungen traf, nach Japan zurückfliegen sollte, besuchte Sebastian eine Studentenkneipe, um sich etwas zu zerstreuen. Er hoffte, dass dadurch der herannahende Abschied, den er zwar selbst herbeigeführt hatte, der aber deswegen nicht weniger schmerzlich war, etwas erträglicher werde.
Die Dämmerung war bereits angebrochen, als Sebastian sich unter die Gäste mischte. Trotz seiner leichten Bedrücktheit, die sich aus der bevorstehenden Trennung ergab, machte er einen selbstsicheren Eindruck.
An der Theke lehnte ein Junge in seinem Alter und schaute ihn fortwährend an. Er ging auf ihn zu und fragte den Burschen, ob man denn irgendwann schon einmal das Vergnügen gehabt habe. Der Angesprochene verneinte dies, aber meinte, dass Sebastian einem gleiche, den er kenne. Noch einige Zeit führte man diese seichte Konversation weiter und Sebastian ließ sich von diesem Burschen, an jenem Abend, nach Hause einladen. Wie sich später herausstellte, hieß er Max und besuchte das Konservatorium um später einmal Pianist zu werden. Der Abend bei ihm verlief sehr ruhig und Sebastian fing an von der kleinen Japanerin und deren bevorstehender Abreise zu erzählen. Gegen Mitternacht fuhr er heimwärts, denn dort wartete Kiyoko. Als er ins Zimmer kam, lag sie schon, in der üblichen Pose, auf ihrer Matratze. Großes Mitleid empfand er für sie, aber begab sich dennoch gleich zu Bett, da man am folgenden Morgen, um fünf Uhr aufstehen musste. Die Sonne ging auf und der Wecker klingelte für Sebastian und Kiyoko. Die beiden standen auf und wussten, dass es der Tag der Trennung sein würde. Eine Dusche nahm man und frühstückte. Im Radio wurde "Kiss and say goodbye" von den Manhattans gespielt. Zutreffend war dieser Song zwar, aber es machte den Abschied umso schwerer. Um sieben Uhr waren sie so weit und traten hinaus auf den Flur. Am Ende dieses langen Korridors sah Sebastian einen weißen Briefumschlag auf der Türmatte liegen. Weit nach Mitternacht musste ihn jemand eingeworfen haben. Er hob ihn auf und stellte fest, dass er an ihn adressiert war. Auf seinen Schreibtisch legte er ihn noch schnell und man begab sich mit dem Bus zum Flughafen Schiphol. Während dieser Fahrt kam der ganze Trennungsschmerz über die beiden. An Oxford und an den einjährigen Briefwechsel dachte Sebastian. Neben ihm saß diese kleine Japanerin, die so zerbrechlich wirkte. Sie hatte die ganze Strapaze dieser Flugreise nach Europa, mit dem Ziel der Eheschließung, auf sich genommen. Jetzt war sie auf dem Weg zum Airport und flog wieder, unverrichteter Dinge, nach Japan zurück. Welches Los sie dort erwartete, konnte Sebastian nur erahnen. Beide sprachen sehr wenig während dieser letzten gemeinsamen Fahrt. Am Flughafen umarmte man sich ein allerletztes Mal und Kiyoko ging durch die Zollsperre. Einmal noch drehte sie sich um und Sebastian sah, wie diese kleine, tapfere Frau von der Menschenmenge aufgenommen und fortgetragen wurde. Ein schwerer Abschied war es. Über Paris, Moskau und Tokio würde sie nach Kioto fliegen. Da es in all diesen Städten jeweils einen mehrstündigen Aufenthalt gab, würde sie erst nach sechsunddreißig Stunden in ihrer Heimatstadt ankommen. Der bloße Gedanke schon an diese extrem lange Reisedauer, war für Sebastian eine fast unerträgliche Vorstellung. Er begab sich auf die Zuschauerterrasse und sah, wie die Maschine aufstieg und mit ihr entschwebte Kiyoko, die Liebe aus Oxford und die "Histoire de l'oeil" langsam in den wolkenlosen Himmel. Zurück blieb eine grauenvolle Leere. So unwirklich und offen war wieder alles, dass einem, vor lauter Freiheit, schwindlig werden konnte. Niemand war zur Stelle, an den man sich hätte fest halten können. Mit diesem Silbervogel war die ganze Hoffnung auf Ehe und Kinder, für alle Zeit, in unendliche Fernen entschwunden. Blau strahlte das Firmament, frisch und rein war die Luft an jenem Vormittag im Spätsommer, aber Sebastian konnte das nicht trösten. Missmutig und einsam fühlte er sich. Ein Experiment, das all seine Erwartungen erfüllen sollte, war misslungen: Aufgegangen in Schall und Rauch.
Er machte sich wieder auf den Weg nach Hause. Dort, auf seinem Schreibtisch, sah er jenes weiße Couvert. Er öffnete es und war völlig überrascht. Ein Brief von Max, dem angehenden Pianisten, war es. Er bat Sebastian, ihn noch am selben Abend zu besuchen, es sei dringend. Vollkommen erschöpft war Sebastian und legte sich erst einmal aufs Bett. Nach einigen Minuten schon fiel er in einen tiefen Schlaf. Kiyoko erschien ihm im Traum, aber weder als fernöstliches Sexualobjekt, in das er unzählige Male eingedrungen war noch als griechische Statue, sondern als gefährliche Rachegöttin, die voller Zorn auf ihn herniedersah und mit furchtbarer Vergeltung drohte. Nicht mehr den japanischen Fächer, sondern ein flammendes Schwert hielt sie in der Hand, den wehrlosen Sebastian, wegen seiner auf sich geladenen übergroßen Schuld, zu durchbohren. Schweißgebadet erwachte Sebastian und wusste, dass es nur ein Traum war.
Gegen Abend begab er sich mit dem Fahrrad zu Max. Mit einer Freundin, mit der er eine platonische Beziehung unterhielt, teilte dieser sich eine Zweizimmerwohnung. Sebastian klingelte und trat ein. In bester Verfassung traf er Max an. Dieser entschuldigte sich zunächst für seinen spontanen Brief.
Vielleicht sei er doch mit diesem Schreiben etwas zu aufdringlich gewesen, meinte er. Schließlich kenne man sich noch keine vierundzwanzig Stunden. Sebastian war noch so unter dem Eindruck von Kiyokos Abreise und seinem Traum, dass er Fetzen nur von dem auffing, was Max erzählte. Im Laufe des Abends spielte Max noch irgendeine Etüde von Chopin auf seinem Piano. Etwas Kurzes, Romantisches war es. Dies aber erreichte Sebastian kaum noch.
Gegen vierundzwanzig Uhr entschied man sich, die Nacht gemeinsam zu verbringen, entkleidete sich und legte sich aufs Bett. Die Haut des anderen berührte man und die Flammen der Liebe loderten auf. Für Sebastian existierte nur noch dieser eine Körper, dieses eine leuchtende Augenpaar und sie verschmolzen ineinander. Max drehte sich um und spreizte den nackten Hintern Sebastian wollüstig entgegen. Diese ihm so unvermittelt dargebotenen weißen Wölbungen ließen Sebastian vor lauter Vorfreude erschaudern. Voller Begierde berührte er sie. Dieses verlangende Loch würde seine Sehnsucht stillen! Erst einen, dann zwei und schließlich drei Finger steckte er hinein. Die Erregung steigerte sich. Auf Drängen von Max hin, stieß er den Schwanz in die manuell vorbereitete Öffnung. Mit ungeheurer Wucht spritzte er seinen Samen in Max hinein. Regelmäßig sah man sich jetzt. In ihrer Beziehung wurde der Beischlaf zum Mittelpunkt des Geschehens. Auch die Hämorrhoiden am Arsch von Max betrachtete Sebastian im Laufe der Zeit eher wohlwollend, als eine Bereicherung der Wollust. Sie störten ihn keineswegs. Eigentlich bewirkten diese knotenartigen Venenausstülpungen geradezu eine Steigerung des Wunsches, durch dieses, manchmal blutige, fleischliche Gestrüpp hindurch, doch eindringen zu wollen. Max hatte die außergewöhnliche Gabe und das große Talent, den schönen, festen Arsch so zu präsentieren, dass die Erektion und der Klimax von selbst kamen. Eine herrliche Zeit erlebte Sebastian.
Das Studium begann Ende September wieder. Für Sebastian war das nicht mit großen Schwierigkeiten verbunden. Das Wichtigste für ihn war Max und dessen strammer Arsch. Darauf freute er sich jedes Mal aufs Neue.
Wie im Fluge vergingen die Monate. Im Sommer, als Sebastian gerade das vierte Semester beendet hatte, machten sie eine gemeinsame Italienreise. Florenz war ihre erste Station. Entzückt war Sebastian. Vor allem die Piazza della Signoria beeindruckte ihn tief. Einen solch harmonischen Platz hatte er niemals vorher gesehen. Diese architektonische Ausgewogenheit war einzigartig. Den grandiosen David von Michelangelo bewunderte er, dort, am Eingang zum Palazzo Vecchio. Dieser wohl geformte Körper und diese nackte Kraft, eingefangen in fast weißem Marmor, waren atemberaubend.
Zum Schwimmen und Zelten fuhr man weiter nach Bolsena, an den See. Hier, wo dieses Wunder von der blutenden Hostie, vor mehr als sieben Jahrhunderten, geschehen war, fingen alle Probleme an. Über Lappalien, die früher nicht einmal der Rede wert gewesen wären, wurde jetzt heftig gestritten. Zu einer qualvollen Hölle wurde das Leben dieser beiden Liebenden, ohne dass sie in der Lage gewesen wären, der Situation eine positive Wendung zu geben. Unaufhaltsam wuchs die gegenseitige Abneigung. Der körperliche Kontakt fiel ganz weg. Es gab keine Rettung mehr. Max litt genauso wie Sebastian und man entschloss sich die Italienreise abzubrechen. Sie fuhren gemeinsam im Auto nach Holland zurück. Es war eine fast übermenschliche Tortur. Die Trennung ging mit unsäglichen Schmerzen einher.
Im September fing Sebastian mit dem fünften Semester an. Den Stoff saugte er förmlich in sich hinein. Daneben meldete er sich zu vielen sportlichen Aktivitäten an. Zur Ertüchtigung des Körpers und Entlastung des Geistes sollten sie beitragen.
Frühmorgens, noch bevor die Seminare und Vorlesungen begannen, spielte er, mehrmals wöchentlich, Tennis. Spätabends ging er, fast täglich, zum Schwimmen und schließlich nahm er jeden Freitagabend an der Gymnastikstunde teil. Außerdem besuchte er die Volkshochschule und lernte Neugriechisch. Einerseits litt er unter dem Bruch mit Max, andererseits aber hatte er jetzt wieder viel mehr Zeit für sein Studium. Gegen Ende des fünften Semesters nahm er wieder Kontakt zu Max auf. Sebastian äußerte den Wunsch den Beziehungsbruch von einem Psychologen untersuchen zu lassen. Max war damit einverstanden und sie begaben sich zur psychologischen Beratungsstelle der Universität und meldeten sich zu einem Vorgespräch an. Max zeigte sich kooperativ. Wöchentlich fanden die Sitzungen statt. Dabei waren zwei Psychologen anwesend. Man grub in ihrer Vergangenheit und suchte Ursachen, die eventuell zu dem Bruch geführt haben könnten. Die Therapie hatte nur das eine Ziel, die Gründe der Trennung aufzudecken und nicht die Beziehung wieder zu leimen. Max zog sich nach einigen Monaten schon aus der Behandlung zurück, weil er sie nicht mehr als sinnvoll empfand. Aber Sebastian war fest entschlossen weiterzumachen und kam deswegen in eine Gruppentherapie. Zehn Studenten, die allesamt abgebrochene Beziehungen hinter sich hatten, nahmen daran teil. Das therapeutische Ziel bestand darin, diese Menschen wieder funktionsfähig zu machen. Lernen sollten sie die gescheiterten Beziehungen zu verarbeiten um sich wieder neuen Partnerschaften öffnen zu können. Diese wöchentlichen Zusammenkünfte genoss Sebastian, da er dann alles erzählen konnte, was er in den vorhergehenden Tagen als störend oder unangenehm empfunden hatte. Sein Herz konnte er erleichtern. Die Probleme konnten in der Gruppe deponiert werden, ohne dass einer Anstoß daran genommen hätte. Nur die Beichte aus Sebastians Kinderzeit war schöner. Seine Seele schüttete man aus und war von aller Schuld befreit. Der Unterschied zum Beichten aber bestand darin, dass man in den Gesprächsgruppen über seine Unzulänglichkeiten reden konnte und eine Stellungnahme erhielt. Dahingegen gab es bei der regulären Beichte nur die Absolution und die einem auferlegten Sühnegebete, aber das Zwiegespräch fehlte.
Im siebten Semester war Sebastian jetzt schon. Alles verlief nach Wunsch. Die Therapie war ihm eine große Hilfe und gab ihm viel Kraft. In jenem Winter heiratete der drittälteste Bruder von Sebastian. Er war bereits dreiunddreißig und seine Frau hatte es schwer, denn sie wurde von Sebastians Familie nicht akzeptiert, weil sie schon einmal geschieden war. Allem anpassen wollte sie sich, aber es half nichts. Gleichgültig ließ es Sebastian, da er mit anderen Dingen beschäftigt war. Um die Therapie und das Studium drehte sich sein Leben.
Der Engel war der Auffassung, dass sein Schützling jetzt erneut mit der Sexualität konfrontiert werden müsse, damit ihn das Debakel, das sich aus der Beziehung zu Max ergeben hatte, nicht unnötig noch länger belaste.
Den Versuch, Sebastian an die Instrumente heranzuführen, auf dass er selbst musiziere, betrachtete der Bote Gottes vorerst als gescheitert. Er war zu der Einsicht gelangt, dass Maxens Klaviermusik wohl nicht der richtige Einstieg gewesen sei.
Möglicherweise könne ein neuer Anlauf, in einigen Jahren vielleicht, zu einem besseren Ergebnis führen. Der Engel konnte indes wohl feststellen, dass Sebastian die ihm dargebotene Musik und den Gesang in zunehmendem Maße genoss. Konzerte, Opern und Liederabende besuchte er sooft es nur ging. Den lieblichen Klängen zuzuhören und sich von ihnen forttragen zu lassen, bereitete ihm großes Vergnügen. Er fand darin angenehme Erholung, wohl tuende Zerstreuung und erfrischende Inspiration. Dies stimmte den Engel zufrieden. Zunächst aber kümmerte er sich wieder um die Kontinuität der geschlechtlichen Entwicklung seines Schützlings, auf dass er in dieser Hinsicht keine Schäden davontrage. Um sein Vorhaben zu verwirklichen, suchte er sich einen fünfundzwanzigjährigen Kommilitonen und einen dreißigjährigen Südländer aus.
Zunächst beendete Sebastian das achte Semester. Bisher war das Studium so verlaufen, wie er sich das vorgestellt und erhofft hatte.
Zu Beginn der Semesterferien trug er sich mit dem Gedanken erneut nach Italien zu reisen um sich dadurch völlig von Max zu befreien. Alleine wollte er aber nicht dorthin fahren. Sebastian machte sich also auf die Suche nach einem passenden Reisegefährten. Als Erstes versuchte er sich nun vorzustellen, welcher seiner Kommilitonen als Begleiter für eine solche Tour in den Süden infrage kommen könnte. Bereits schnell hatte er sich für den blonden Alexander entschieden. Mit ihm verstand er sich gut. Zurzeit hatte dieser keine feste Partnerin und stünde daher zur Verfügung. Er war sportlich und spontan. Mit ihm hatte Sebastian häufig Kontakt. Auch besuchte man sich regelmäßig.
Alexander stammte aus Maastricht und war zweisprachig. Seine Mutter war Holländerin und sein Vater gebürtiger Deutscher. Mit Alexander sprach Sebastian ausschließlich Deutsch. Auch die gleiche Sprache war es, die sie verband. Beide wohnten sie in jenem riesigen Studentenkomplex. Eines Abends begab sich Sebastian von der siebzehnten zur fünften Etage, wo Alexander wohnte. Er klingelte und ihm wurde Einlass gewährt. Alexander bat ihn auf sein Zimmer und Sebastian kam schnell zur Sache. Seinen Reisevorschlag legte er ihm vor und dieser war sofort damit einverstanden. Das Zelt sollte Alexander mitnehmen und Sebastian die Reiseroute festlegen. Die beiden einigten sich innerhalb kürzester Zeit. Eine dreiwöchige Bahnreise nach Sizilien sollte es werden. Sebastian plante die Route über Heidelberg, Luzern, Como, Florenz, Sorrent, Taormina und Agrigent. Zurück sollte die Reise über Venedig, Peschiera und Mailand führen. In den ersten Tagen des Augusts machten die beiden Studenten sich auf den Weg. Für Italien hatte man sich um allzu hohe Kosten zu vermeiden eine Bahnnetzkarte für vierzehn Tage gekauft. Bis Heidelberg kamen sie am ersten Tag. Auf einem Campingplatz, am Ufer des Neckars, schlugen sie ihr Zelt auf. Das alte Schloss, das jetzt schon seit fast dreihundert Jahren als mächtige Ruine den Fluss bewachte, sahen sie. Über den Philosophenweg, am Fuße des Heiligenbergs, der schon so manchen Poeten inspiriert hatte, wanderten sie ein Stück. Die bewaldeten Hügel von Heidelberg waren bezaubernd romantisch. An das Lied der Großmutter: "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in einer lauen Sommernacht", erinnerte sich Sebastian. In ihren letzten Lebensjahren sang sie aber häufiger dieses wehmütige und sehnsuchtsvolle Lied von der holden Gärtnersfrau, dessen Melodie genauso melancholisch war wie der Text. Überhöhte Preise und unzählige Touristen gab es in dieser traditionsreichen Studentenstadt.
Nach drei Tagen zog man weiter nach Luzern. Hier, am Ufer des Vierwaldstätter Sees, fiel Sebastian die Geschichte von Wilhelm Tell wieder ein. Am anderen Ufer lag Küssnacht und dort würde sich auch diese hohle Gasse befinden, wo der legendäre Wilhelm sich hinter einem Holunderstrauch, damals, vor vielen, vielen Jahren, versteckt hatte, um den tyrannischen Landvogt aus dem Hinterhalt mit einem spitzen Pfeil zu durchbohren.
In die alte Stadt Como, an den gleichnamigen See, ging die Reise weiter. Etwas außerhalb der Stadt, am Gebirgsrand, lag der Bahnhof. Alexander stieß einen stummen Seufzer aus. Mit einer leichten Ironie in der Stimme meinte er, man wäre jetzt - endlich - in dem Land, wo die Zitronen blühten und die Gold-Orangen glühten. Von Marmorbildern und Maultieren faselte er etwas.
Mignon und Goethe wären ihm schon immer das Liebste gewesen.
Gleichzeitig fügte er aber geschwind hinzu, dass er es vorgezogen hätte, in den herrlichen Bergen der Schweiz geblieben zu sein. Aber da er sich mit der Reiseroute von Sebastian einverstanden erklärt hatte und dieser ihn noch einmal kurz daran erinnerte, verschwand seine leichte Missstimmung nach wenigen Minuten schon. Auf dem Weg bereits, hinunter an das Ufer des Sees, hatte er das Land der Eidgenossen schon fast vergessen, da es auch hier tannenbedeckte Berge gab.
Am nächsten Tag reisten sie nach Florenz. Diesen wunderschönen Platz mit dem kräftigen, nackten David aus Marmor sah Sebastian wieder. In der Nähe des Piazzale Michelangelo, auf einem Campingplatz, schlugen die beiden ihr Zelt auf. Das Gelände lag auf einer Anhöhe und man hatte einen herrlichen Blick auf diese toskanische Stadt. Die mit roten Dachziegeln bedeckte, imposante
Wölbung der Domkuppel und den gemächlich dahinfließenden Arno verliehen dieser Aussicht eine große Ruhe und einen Zipfel der Unendlichkeit. Zweiundsiebzig Stunden später bereits eilten sie über Rom weiter nach Neapel. Dort nahmen sie die Circumvesuviana nach Sorrent. Neapel wollte Alexander nicht besichtigen. Er war, vor vielen Jahren, mit seinen Eltern einmal dort gewesen und für ihn war es seitdem immer noch eine schmutzige Stadt. In Sorrent blieben die beiden einige Tage. Eine herrliche Touristenstadt war es, mit all den Berghängen. In der Ferne sahen sie das viel besungene Capri und die kleinen Schiffe, die, unten vom Hafen aus, zu dieser kleinen Insel hin und her pendelten. Auch die mächtigen Flanken des Vesuv bewunderten sie. Auf dem Stückchen Erde befanden sich die beiden Reisenden, das so vielen schon Tod und Verderb gebracht hatte. Vor fast zweitausend Jahren hatte der mächtige Vesuv fürchterlich getobt. Damals, neunundsiebzig Jahre nach der Geburt des Herrn, hatte dieser Feuer speiende Riese eine blühende Stadt völlig ausgelöscht. Sebastian kam ein wenig ins Grübeln, obwohl er nicht in den Ruinen von Pompeji stand, sondern auf einem Berg in Sorrent, aber doch hatte dieser Vulkan seine Fantasie angeregt. Auch kam ihm diese schöne, dunkelhaarige Bauernmagd aus seiner Kinderzeit in den Sinn. Er erinnerte sich an dieses Liedlein vom schönen Neapel und an die Worte, die sie sprach: Napoli wäre eine Stadt in Kampanien an einem Feuer speienden Berg.
Mit einigen Umwegen ging es nach Kalabrien, zum Hafen von Villa San Giovanni. Das weiße Schiff, das die beiden Freunde über die Meeresstraße zu dieser großen, heißen Insel bringen sollte, von der man sagte, sie sei die Brutstätte der Mafia, war schon fast abfahrbereit. Der Zug fuhr, ohne dass man sein Abteil hätte verlassen müssen, auf die Fähre. Für Sebastian war es eine sensationelle Erfahrung. Auf Sizilien ratterte er wieder in den Bahnhof von Messina ein. Fast unerträglich hässlich war diese Stadt. Dadurch, dass sie einmal durch ein Erdbeben zerstört worden war, gab es fast nur Neubau. Bauwerke ohne Stil waren es. In dieser Stadt herrschte eine kalte Atmosphäre. Dieses negative Gefühl konnten auch die angenehmen Temperaturen nicht wegnehmen. Weiter reisten sie und jetzt versehentlich nach Catania. Dort stieg man nur kurz aus und schon ging es mit dem nächsten Zug wieder nach Messina zurück. Mittlerweile war die Morgendämmerung über Sizilien hereingebrochen und Sebastian konnte, vom Zug aus, sehr schön den langsam aufsteigenden Rauch des Ätna sehen. Von Messina fuhren die beiden nach Agrigent. Agrigento, du Stadt der Städte!
In Agrigento war so viel schon geschehen. Die Griechen waren dort gewesen und hatten diese wunderbaren Tempel gebaut, von denen einer nur, unbeschadet fast, die Jahrtausende überstanden hatte. Die Stadt an sich war ein Touristenort. Aber dieser Tempel von Agrigento ließ das Herz von Sebastian höher schlagen. Auch Alexander, ohne es jemals gewusst zu haben, brachte Sebastian, in Agrigento, das Paradies ein Stückchen näher. Abends kamen Sebastian und Alexander in Agrigento an. Sie suchten keinen Campingplatz mehr, sondern nahmen ein Hotel im Zentrum der Stadt. Ihnen wurde ein sehr geräumiges Zimmer mit komfortablem Doppelbett, eigener Toilette und großem Bad zugewiesen. Es war sehr heiß, an jenem Abend, in Sizilien. Sebastian und Alexander legten ihre Rucksäcke ab und schauten sich in der luxuriösen Bleibe um. Der Zimmertür gegenüber befand sich ein großes Doppelfenster. Von dort aus hatte man einen wunderschönen Blick auf den Piazzale Roma. Sebastian öffnete einen Flügel und eine schwache Brise drang in den Raum. Das Lüftchen bewegte die Gardinen, die bis zum Fußboden reichten, leicht.
Sebastian erbat sich die Seite des Doppelbettes, die dem Fenster am nächsten war, auf dass er ab und zu ein wenig frische Luft schnuppern könne. Alexander machte keine Einwände. Des Weiteren einigte man sich dahingehend, dass Alexander als Erster ein Bad nehmen würde. Er hatte viel geschwitzt, denn er musste immer den schwereren Rucksack tragen, weil das Zelt sich darin befand.
Seiner Kleider, bis auf die Unterhose, entledigte sich Alexander und begab sich ins Bad. Sebastian hörte das Plätschern des wohl tuenden Wassers und wie Alexander, voller Übermut, ein Liedchen pfiff. Als er nach einer Weile wieder aus dem Badezimmer kam, war er völlig nackt. Sebastian saß auf dem Bett und konnte seinen Augen kaum glauben. Ihn faszinierte dieser schlaffe Schwanz.
Alexander lächelte ihn an und begab sich zu seinem Rucksack. Göttlich war dieser nackte Alexander. Am liebsten wäre Sebastian aufgesprungen und hätte sich vor ihm, voller Ehrfurcht, niedergekniet, den Schwanz berührt, der so viel Kraft und fruchtbaren Samen erahnen ließ und ihm in die Unendlichkeit seiner blauen Augen geschaut. Der marmorne David von Florenz war Fleisch geworden. Unwillkürlich musste Sebastian an Lawrence, Genet und Bataille denken, denn diese begnadete Dreifaltigkeit imponierte ihm noch immer. Die weithin leuchtende Kraft ihrer Werke begleitete ihn jetzt schon seit mehr als fünf Jahren.
Die Sehnsucht nach dem Unmöglichen, das Erregende der Erotik, der unwiderstehliche Wunsch nach Sex und die todbringende Eruption wurden eins. Alexander kramte seine Kleider aus dem Rucksack und begann, sich anzuziehen. Hätte er doch das starke Verlangen von Sebastian gespürt! Jetzt nahm Sebastian sein Bad und war noch völlig benommen von dem Anblick des entblößten Alexanders. Diese geballte Kraft in äußerster Unschuld war fast unerträglich.
Nach dem Baden ging man hinaus in die Stadt, um noch etwas zu essen. Agrigento, diese ehemals griechische Stadt auf Sizilien, machte Sebastian zum Sklaven seiner Lust. Er dachte an die wilde Maria seiner Kindheit und an die zierliche Kiyoko aus dem Land der Tennos. An den liebevollen Paul und an den willigen Araber aus Jerusalem erinnerte er sich. Der Piano spielende Max, dessen fast undurchdringliches Hämorrhoidengestrüpp ihn immer wieder aufstachelte und der starke amerikanische Soldat aus den Blue Ridge Mountains kamen ihm in den Sinn. Die Welt fing an, sich zu drehen und alles war voll der schönsten Farben. Die Fleisch gewordene Sehnsucht war der blauäugige Alexander, den es unbedingt zu unterwerfen galt. Kaum noch einen klaren Gedanken konnte Sebastian fassen. Das Geringste hätte gereicht ihn explodieren zu lassen.
Fiat voluntas tua, Domine!
Gegen Mitternacht kehrte man ins Hotel zurück. Sebastian und Alexander entkleideten sich und begaben sich zu Bett. Die Hitze machte beiden schwer zu schaffen. Da lagen sie nun, in Agrigento, im großen Doppelbett; einmal mit und einmal ohne Laken wegen der Wärme. Von einer Seite auf die andere wälzte sich Alexander. Sebastian versuchte, Schlaf zu finden, aber aufgrund der hohen Temperaturen war das fast unmöglich.
Im Laufe der Nacht lag Sebastian zum wiederholten Male auf seiner rechten Seite, mit dem Rücken zum Fenster. Alexander, in seiner Verzweiflung, in Orpheus' Armen Ruhe zu finden, drehte sich wieder um und lag nun mit dem Gesicht zur Tür. Schon lange bedeckte das weiße Bett-Tuch nicht mehr seinen athletischen Körper. Die breiten Schultern, den Rücken, die schneeweißen, muskulösen Arschbacken und die kräftigen Beine sah Sebastian. Diesen durchtrainierten Körper von Alexander betrachtete er ohne ihn berühren zu können. Neben ihm lag er, so nah, aber ohne Möglichkeit, ihn jemals zu erreichen. An den florentinischen David aus hartem, fast weißem Marmor musste Sebastian denken. Neben ihm lag das Fleisch gewordene Verlangen, das seit ewigen Zeiten die sehnsuchtsvollen Herzen der Menschen zu unsagbaren Taten beflügelte. Alexander verkörperte, hier in Agrigento, alle Sehnsüchte der ganzen Menschheit. Die Erinnerung an jenen Ex- Soldaten aus den Blue Ridge Mountains drängte sich Sebastian immer mehr auf. Ihm kam es vor, als wären es die gleichen Körper: Der eine war Student und Holländer und der andere ehemaliger Kämpfer in Vietnam und Amerikaner. Was würden ihre Wünsche sein? In ihren Träumen würden gewiss unterschiedliche Bilder und Geschichten vorkommen. An die Augen des Ex-Kriegers dachte Sebastian, die für ihn eine unüberwindbare Barriere darstellten. Er sah jetzt diesen göttlichen Adonis an seiner Seite ohne dessen Augen sehen zu können. Die Erregung stieg. Wenn Sebastian seinen Arm ausgestreckt hätte, wäre er genau da gelandet, wo er glaubte, seine Sehnsucht stillen zu können. So greifbar nah neben ihm lag dieser makellose Körper. Die aufreizende Spalte, von der er wusste, dass sie die Verheißung, die sie suggerierte, auch erfüllen könnte, betrachtete er. Friedlich und ruhig schlief der schöne Alexander. Fast unhörbar war sein Atmen. Er zog ein Knie etwas, in Richtung auf die Brust, an. Die Ritze öffnete sich ein wenig und Sebastian war völlig erregt. Er nahm seinen Schwanz in die Hand und es kam zur Explosion. Große Mühe kostete es ihn, diese Erregung, so lautlos wie möglich, zu einem guten Ende zu bringen. Der kraftvolle Alexander schlief weiter, ohne je auch nur geahnt zu haben, dass er in jener Nacht, in Agrigento, das Paradies Sebastian fast offen gelegt hätte. Erschöpft und mit einigen Schuldgefühlen schlief Sebastian ein.
Am nächsten Morgen packten die beiden ihre Rucksäcke, nahmen den Bus hinunter nach San Leone, zum Campingplatz am Strand und bauten ihr Zelt auf. Den Tempel von Agrigento hatten sie schon während der Busfahrt gesehen. Er befand sich auf halbem Wege.
Sie schwammen im blauen Meer und freuten sich des Lebens. Am Strand wurde Sebastian von einem Italiener aus Mailand angesprochen, der in Agrigento, bei seiner Mutter, die Ferien verbrachte. Um die dreißig war dieser gebürtige Sizilianer und sehr charmant. Sebastian lud er ein den Tempel am Abend zu besichtigen. Sebastian sagte, dass sein Freund, Alexander, dann auch mitkomme, aber dem Italiener aus Mailand machte das nichts aus. Man badete noch weiter bis zum Spätnachmittag. Im Wasser kam es bereits zu ersten Intimitäten mit diesem Südländer. Was ihn im griechischen Tempel von Agrigento erwartete, wusste Sebastian also schon. Von dem Rendezvous und den Liebesbezeugungen im lauen Meereswasser mit diesem sizilianischen Italiener hatte Sebastian dem verständnisvollen Alexander ausführlich berichtet. Für Alexander war das kein Hindernis, wenn er nur in Ruhe den "Tempio della Concordia" besichtigen könne. Dieser lateinische Name sei übrigens nicht der ursprüngliche. Deswegen komme es gelegentlich auch vor, dass man diese einstige Kultstätte schlicht und einfach Tempel "F" nenne. Dieser Buchstabe habe aber keine weitere Bedeutung. Hiermit werde nur eine alphabetische Reihenfolge angedeutet, in die man diesen Tempel und die übrigen antiken Ruinen hineingepresst hätte, um ihrer habhaft zu werden.
Alexander hob hervor, dass er unbedingt die vierunddreißig dorischen Außensäulen nachzählen wolle, denn diese seien noch vollständig erhalten. Sebastian fragte ihn noch kurz, was "Außensäulen" eigentlich seien. Etwas entrüstet erwiderte Alexander, dass es sich dabei natürlich um die Kolonnade an der Außenseite handle. Offensichtlich hatte er bereits den bunten Hochglanz-Prospekt des Verkehrsvereins aufmerksam gelesen.
Vollständigkeitshalber fügte er noch schmunzelnd hinzu, dass "dorisch" von den "Doriern" abgeleitet sei. Dies wiederum sei ein Stamm, der im alten Griechenland beheimatet gewesen sei.
Sebastian hörte sich Alexanders kleinen Diskurs an, ohne sich anmerken zu lassen, dass ihn die Geschichte der antiken Baukunst zum jetzigen Zeitpunkt nicht sonderlich interessierte. Seine Gedanken waren schon ein wenig berauscht von dem, was im Tempel, hinter den Säulen, geschehen würde.
Mit dem Auto kam dann abends der Italiener und holte die beiden ab. Man fuhr die kurze Strecke vom Strand hinauf zum Tempel von Agrigento. Alexander besichtigte das ehemalige griechische Heiligtum der Eintracht und Sebastian begab sich mit seinem Sizilianer, seitlich der mächtigen Säulen, ins Gebüsch. Direkt ließ der Italiener seine Hose herunter und Sebastian musste sich seines Schwanzes erbarmen, sowohl oral als auch manuell. Schon nach kürzester Zeit spritzte der Italiener und Sebastian ging leer aus. Seinen gespreizten, sizilianischen Arsch streckte er Sebastian zwar noch entgegen, aber es half nichts. Sie gingen in den Tempel zu Alexander. Er berichtete, dass die Anzahl von vierunddreißig stimme. Gleichzeitig fügte er aber hinzu, dass das Zählen ihn gelangweilt habe, da jede Säule der anderen gleiche. Nach seiner Berechnung müsse sich die Gesamtzahl der Säulen einst auf achtundsiebzig belaufen haben, wenn man davon ausgehe, dass der ganze Raum mit Säulen gefüllt gewesen sei.
Man fuhr zurück zum Campingplatz. Anschließend machte sich der heißblütige Mailänder, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Staub. Er gab Vollgas und die Räder seines Autos verursachten eine derartige Sandwolke, dass man fast ein Taschentuch benötigt hätte, um sich vor den aufwirbelnden feinen Körnchen zu schützen. Nach einigen Tagen verließen Sebastian und Alexander Agrigento. In dieser Stadt hatte Sebastian die ganze Welt in ihrer unaussprechlichen Pracht und Vielfalt erlebt. Alle Gefühle und Neigungen hatte er gespürt. Die ganze Menschheit war an ihm vorbeigezogen. Manches von dem, was er sich vorstellte, glaubte er, tatsächlich erlebt zu haben. Im Louvre würde die mysteriöse Mona Lisa weiter schmunzeln. In Agrigento ist sie vielleicht einmal gewesen, vor vielen, vielen Jahren und ihr Lächeln barg möglicherweise das wundervolle Geheimnis von Agrigento.
Man begab sich nach Taormina. Diese Stadt lag auf steilen Klippen. Einen wunderschönen Blick hatte man auf das bläulich schimmernde Mittelmeer. Während des Spaghetti-Essens in Taormina fand eine Rückblende statt. Es war zur Mittagszeit, in einem Gartenrestaurant, im Zentrum. Unter den Blättern der Weinstöcke saß man, wegen des kühlenden Schattens. Tief unten hörte man das unaufhörliche Rauschen des Meeres. Sebastian träumte beim Essen schon wieder von Agrigento. Was war bei diesem Burschen aus Milano so anders gewesen? Warum hatte es nicht geklappt? Diese Fragen blieben für Sebastian unbeantwortet. Von Taormina ging es wieder nach Messina, in diese furchtbare Stadt, die Sebastian so unendlich hasste. Mit dem Fährboot begab man sich zum Festland und dann setzte man, fast ohne Unterbrechung, die Zugreise über Ancona nach Venedig fort. Dort, in Venezia, der viel besungenen Lagunenstadt, besuchten Sebastian und Alexander den Markus-Dom. Als sie durch diese byzantinische Kathedrale schritten, hatten sie das Gefühl, auf einem Schiff zu sein, denn der Fußboden war so furchtbar uneben und schief. Es waren eigentlich unregelmäßige Wölbungen, über die man fortwährend stolperte.
Von Venedig ging es dann nach Peschiera. Dort, am Gardasee, schlugen sie ihr Zelt auf. Einmal machten sie einen kurzen Ausflug nach Verona, zu einer Opernvorstellung in der dortigen Arena. Man sah "La Traviata", eine Oper von Giuseppe Verdi, der auch schon "Falstaff" unsterblich gemacht hatte.
Die Geschichte "La Dame aux Camelias" von Alexandre Dumas wurde ihnen arienmäßig dargeboten. Letztendlich starb die Mitleid erregende Kameliendame Violetta an Schwindsucht. Bevor diese Lebedame aber die Gelegenheit bekam, das Diesseitige mit dem Jenseits zu vertauschen, fing es in Verona an zu regnen. In diesem riesigen römischen Amphitheater war die Stimmung außergewöhnlich beeindruckend. Irgendwo, aus der Ferne, hörte man die Musik und den Gesang. Fast war es den Hörsälen in Aachen vergleichbar, nur dass man hier, in der Stadt von Romeo und Julia, wirklich ein Fernglas benötigte. Bei Sebastian kamen aus unerklärlichen Gründen weihnachtliche Gefühle hoch. Diese Massenhysterie und das Zusammenhörigkeitsgefühl, von dem die Großmutter während der Bombennächte erzählte, konnte man ganz deutlich spüren.
Von Peschiera reiste man nach Mailand. Einige Stunden nur blieb man in dieser stolzen lombardischen Stadt. Das Wunder von Milano war die Kathedrale. Die beiden Studenten begaben sich dorthin, und Sebastian musste sich, vor lauter Faszination, an einem Laternenpfahl fest halten. Dieses prachtvolle Gebäude mit den unzähligen, fast weißen Marmortürmchen, überwältigte ihn dermaßen, dass er gewünscht hätte, eine längere Zeit dort, vor dem Dom, zu verweilen. Aber der Fahrplan ließ es nicht zu. Noch schnell schaute man sich das Hauptportal mit diesen zig in Stein gemeißelten Figürchen an. Sebastian strich mit den Fingerkuppen über deren Relief. Er spürte die Liebe, die von den Handwerkern beim Einmeißeln und Eingravieren, damals vor mehr als fünfhundert Jahren, dort hineingelegt worden war. Schnell begab man sich wieder zu diesem bombastischen, mussolinischen Hauptbahnhof und reiste ohne Unterlas, über die Alpen nach Holland. Eine Höllenfahrt war es. Ende August kamen Sebastian und Alexander, völlig erschöpft, in Utrecht an. Für Sebastian hatte sich die Reise gelohnt, denn jene eine Nacht in Agrigento war so honigsüß. Von alledem aber ahnte Alexander nicht das Geringste.
11. Kapitel
Im neunten Semester war Sebastian bereits. Die zweite italienische Reise hatte ihm gut getan. Sie hatte sowohl seinen Körper als auch seinen Geist erfrischt.
Voller Energie widmete er sich dem Studium. Mit seinen Mitbewohnern unterhielt er einen freundschaftlichen Kontakt, dort oben auf der siebzehnten Etage. Die Buschnegerin und der Hindustani wohnten noch immer dort. Zuweilen kam es vor, dass einer auszog, weil er sein Studium beendet hatte. Bei einem solchen Bewohnerwechsel stieß ein noch junger Jurastudent zu ihnen. Er hieß Anton und wurde der direkte Zimmernachbar von Sebastian. Neunzehn Lenze zählte er und befand sich erst im dritten Semester. Er war der Benjamin der Gruppe. Manchmal geschah es auch, dass das achtköpfige Kommilitonen-Team ein gemeinsames Abendessen organisierte. Bei diesen Diners, die sich über einige Stunden hinzogen, wurde über das Studium, die Dozenten und allerlei Sonstiges gesprochen. Einer der besten Erzähler war der Hindustani aus dem fernen Surinam, das jetzt schon seit vier Jahren von Holland unabhängig war. Er berichtete von den wildesten Abenteuern und der schönen Natur, die es in diesem südamerikanischen Land gäbe. In den Flüssen kämen noch Krokodile vor. Bei solchen Gastmählern kam man sich näher.
Zunächst rundete Sebastian seine Nebenfächer, Italienisch und Spanisch, so weit dies schon möglich war, ab. Er musste mit seiner literaturwissenschaftlichen Untersuchung anfangen, denn im zehnten Semester würde ihm dafür nur noch wenig Zeit zur Verfügung stehen, da er dann, als Hospitant an einem Gymnasium, unterrichten würde. Mittlerweile war er neunundzwanzig Jahre. Gut entwickelt hatte er sich und schaute der Zukunft voller Zuversicht entgegen.
In sexueller Hinsicht war der Engel mit ihm zufrieden und auch sonst gab es, bis auf das Musizieren, nichts, was zu bemängeln gewesen wäre. Er hatte sich damit abgefunden, dass sein Schützling nicht dazu zu bewegen war ein Instrument zu erlernen. Sebastians pazifistische Einstellung erfreute ihn dahingegen umso mehr.
Was dem Boten Gottes bei Albrecht, trotz vieler Versuche, nicht gelungen war, sah er jetzt bei Sebastian erfüllt. Bisher hatte dieser noch nie eine Schusswaffe oder anderweitiges Kriegsmaterial in der Hand gehabt. Bei Albrecht, als dieser in Sebastians Alter war, vor mehr als fünfhundert Jahren, war das anders. Diesen Schwerenöter musste der Engel immerfort vom Töten abhalten. Das Gleiche galt für seine sexuellen Ausschreitungen. Neunzehn Kinder hatte er ja bei zwei verschiedenen Frauen gezeugt. Diese zahlreiche Nachkommenschaft sollte Sebastian erspart bleiben. Der Engel war der Ansicht, sein Schützling müsse kinderlos bleiben, damit ihm die große Verantwortung der Erziehung des Nachwuchses erst gar nicht aufgebürdet werde.
Obwohl der Engel nur Gutes über Sebastian berichten konnte, wenn er denn jemals danach gefragt worden wäre, hatte er sich trotzdem dazu entschlossen, ihm wieder ein Leid zu schicken. Im steten Auf und Ab von Freude und Schmerz sollte sein Schützling lernen, das Leben in seiner Wechselhaftigkeit zu meistern. Die stoische Lehre, die besagte, dass der Mensch von seinen Affekten befreit werden müsse, damit ihm ein zufriedeneres Dasein beschieden sei, hatte sich als zu utopisch erwiesen. Der Engel war der Auffassung, es komme nur darauf an, die Dosierung von Glück und Leid so zu verabreichen, dass Sebastian nie sein seelisches Gleichgewicht verliere.
Als der Sommer zur Neige ging, war die Zeit gekommen, dass sich die Vorsehung erfülle.
Ende September erhielt Sebastian ein Telegramm. Ihm wurde mitgeteilt, dass die Mutter ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Am folgenden Tag begab er sich zu ihr. Dort lag sie nun, erschöpft und kraftlos. Sebastian bemerkte die eingefallenen Augen, aus denen die Lebensfreude schon vor neunundzwanzig Jahren gewichen war. Zu einer alten, hilflosen Frau war die Mutter geworden. Seit dem Tode des ältesten Sohnes hatte sie nur noch Schwarz getragen und sich der Trauer hingegeben. Jetzt war sie selbst dem Tode so nahe. Die Ärzte hatten Gebärmutterkrebs festgestellt und benachbarte Organe waren auch schon angetastet. Es gab keine wirkliche Hilfe mehr. Chemotherapie wurde empfohlen. Die Lebensdauer schätzten die Mediziner auf höchstens zwei Jahre. Sebastian betrachtete die Schwerkranke und versuchte sich vorzustellen, welches Übermaß an Schmerzen sie noch zu erleiden habe, bis sie erlöst sein würde. Eine Verkürzung oder gar ein gänzliches Vermeiden dieses Martyriums lehnte sie strickt ab, da sie der Meinung war, sie müsse dieses harte Los geduldig ertragen, da es der Wille des Schöpfers sei.
Sebastian empfand lediglich ein leichtes Gefühl von Mitleid der Mutter gegenüber, eine aufrichtige Trauer stellte sich aber, trotz der aussichtlosen Lage, in der sie sich befand, nicht ein. Die Mutter und der Sohn redeten etwas miteinander. Aber nur über Belangloses sprachen sie. Gerne hätte Sebastian gewollt, dass sie aus ihrem Leben erzählt hätte. Was hatte sie geliebt? War ihr etwas verhasst? Hatte sie ihre Jugendträume verwirklichen können? Was hatte sie beim Heranwachsen ihrer fünf Söhne empfunden? Hatte sie ein Erziehungsideal? Warum verabscheute sie die Amour bleu? Aus welchem Grunde hatte sie die kleine, sanfte Kiyoko so negiert? Alle diese Fragen, die niemals gestellt worden waren, blieben offen.
Auf diesem Krankenbett lag die Mutter nur so da und schaute Sebastian an. Unterdessen war dieser schon dabei, sich innerlich von ihr zu verabschieden. Dieser Beginn des Todes, der sich über vierundzwanzig Monate, schmerzvoll und voller Hoffnungslosigkeit, dahin ziehen sollte, ergriff Sebastian nicht. Er wunderte sich selbst etwas über seine Einstellung. War der Tod einer Mutter nicht das Schlimmste, was einem Sohn widerfahren könnte?
Eigentlich hatte Sebastian sich schon einige Wochen nach der Geburt von der Mutter getrennt, aber damals noch ungewollt. Er fuhr wieder nach Holland zurück, um seine Studien fortzusetzen. Der Tod der Großmutter und des ältesten Bruders hatte damals dramatisch auf ihn gewirkt. Aber dieser lange Sterbensweg der Mutter war kein Drama, keine Tragödie. Er vollzog sich leise, lange und schmerzhaft. Die Mutter litt, aber öffnete sich nicht. Ein in sich selbst gekehrtes Leben hatte sie geführt. Sie war immer in der Abhängigkeit ihrer Umgebung stecken geblieben. Damals, als Sebastian heranwuchs, hatte sie ihn nicht stimuliert und nicht gelobt. Seine Geschichten hatte sie sich nicht angehört und darauf reagiert. Tagein, tagaus war sie mit der täglichen Hausarbeit beschäftigt. In diese Alltäglichkeiten hatte sie sich geflüchtet. Gab es in ihr eine unüberwindliche Barriere? Sie hätte Zeit genug dazu gehabt, sich davon zu befreien. Intime Freunde und Freundinnen besaß sie nicht.
Der Engel, der jetzt bereits seit mehr als neunundzwanzig Jahren sorgsam über seinen Schützling wachte, konnte beobachten, dass dieser den beginnenden Tod der Mutter nicht schwer aufnahm. Er stellte voller Wohlbehagen fest, dass Sebastian nun in der Lage war, mithilfe des Erlernten, auch schwierige Situationen selbstständig zu meistern. Um ihm dennoch zusätzlich eine kleine Hilfestellung zu geben, auf dass ein mögliches Versinken in Trauer und Schmerz unter allen Umständen vermieden werde, sorgte der Bote des Allwissenden für neues Liebesglück. Dazu suchte er sich einen älteren Studenten von einunddreißig Jahren aus. Der Engel hatte diesmal ganz besonders auf die Reife des Auserkorenen geachtet. Sowohl die Relativitätstheorie von Einstein als auch die Maxwell’sche Theorie des Lichtes sollten zu dessen geistigem Gepäck gehören.
An einem lauen Septemberabend war die Zeit gekommen, dass sich das vollziehen sollte, was der Bote des Allmächtigen vorherbestimmt hatte. Sebastian verspürte den unwiderstehlichen Drang auszugehen. Er besuchte eine der unzähligen Studentenkneipen, die es in Utrecht gab. Diese Treffpunkte der jungen und schönen Müßiggänger, in deren Köpfen der Samen der Weisheit schon keimte, den die Alma Mater dort hineingestreut hatte, wirkten mitunter wie eine Droge auf Sebastian. Sooft schon hatten sie die Rolle eines Mittlers erfüllt, damit sich seine Wünsche erfüllten. Dort traf er einige Bekannte und unterhielt sich animiert mit ihnen. Da er sehr intensiv mit seinem Studium beschäftigt war und alles so verlief, wie er es geplant hatte, war er guter Laune und strahlte eine große Selbstsicherheit aus. Unter den Gästen gab es einen, den er an jenem Abend zum ersten Mal sah. Im Vorbeigehen sprach er diesen Jungen an und fragte ihn, ob er am Ende des Abends mit ihm nach Hause gehen wollte. Der Angesprochene sagte einfach ja. Verblüfft über diese kurze Affirmation war Sebastian und begab sich wieder zu seinen Gesprächspartnern. Am späten Abend dann, ging er zu jenem Burschen und bat ihn, sein Versprechen einzulösen. Man ging hinaus, schwang sich aufs Fahrrad und begab sich zur siebzehnten Etage des Studentenhochhauses. Direkt zur Sache ging es dort.
Am nächsten Morgen erfuhr Sebastian, dass sein Bettgeselle Maurits hieß und ein Student der Mathematik war, und zwar im zwölften Semester. Fortan traf man sich regelmäßig. In der Freizeit wurden unzählige Fahrradtouren in die nähere Umgebung unternommen. Einmal kamen sie sogar bis nach Doorn. Zu seiner Überraschung musste Sebastian feststellen, dass im geräumigen Garten des dortigen Schlösschens der letzte deutsche Kaiser die immer währende Ruhe gefunden hatte. Er lag in einem winzigen Mausoleum, in dem nur dieser eine Sarg Platz hatte. Durch die kleinen Fenster konnte man hineinschauen. Still und friedlich stand der schwere Sarkophag dort, in dem der einstige deutsche Herrscher dem Jüngsten Tag entgegenschlummerte. Vor dieser schlichten Ruhestätte gab es fünf kleine Grabsteine. Dort waren die fünf Lieblingshunde des Kaisers begraben. Ein Schäferhund, von vier Dackeln flankiert, bewachte das unscheinbare, aber imperiale Mini-Mausoleum. Würden doch Engel herbeieilen und ihn heimtragen! Würde jemals der Tag kommen, an dem er an die Spree zurückkehren könnte, um in Charlottenburg zu seinen Ahnen, unter dem wohlwollenden Blick der einäugigen Königin des Nils gebettet zu werden? Sebastian hatte den Eindruck, dass diese Grabstätte für einen Kaiser zu klein sei, machte sich aber weiter keine größeren Gedanken darüber. Er wandte sich wieder Maurits zu und man radelte weiter in den frühherbstlichen Sonnenschein hinein. Der ausgeglichene Maurits erinnerte Sebastian irgendwie an die fernöstliche Kiyoko. Nur redete Kiyoko mehr. Auch war es so, dass Kiyoko bei der Kopulation leise vor sich hinstöhnte, was Maurits aber auch nicht machte. Maurits tat alles, was von ihm verlangt wurde und sagte wenig oder schwieg. Noch immer, einmal wöchentlich, war Sebastian in der Therapie. Er erzählte Maurits davon. Aber niemals fand ein ernsthaftes Gespräch darüber statt.
Maurits hörte sich alles an und enthielt sich jeglichen Kommentars. Was er liebte, war sein Fahrrad, seine Mutter und eine Gruppe von Kommilitonen, mit denen er einen engen Kontakt unterhielt. Streitereien zwischen Sebastian und Maurits gab es deswegen nur selten. Der Vergleich zu Kiyoko drängte sich immer mehr auf, jedoch mit dem Unterschied, dass Kiyoko abhängig von Sebastian war und Maurits seine eigenen Wege ging. Das Sexuelle in der Beziehung zu Maurits war weniger leidenschaftlich, dafür aber beständiger als in den vorherigen Partnerschaften. Ohne größere Probleme, konnte Sebastian sein Studium in vollem Umfange durchführen. Maurits verlangte nicht übermäßig viel Zeit. Ende Oktober beendete Sebastian seine Therapie, weil es nichts mehr, nach seiner Überzeugung, zu therapieren gab. Sie hatte ja auch fast drei Jahre gedauert. Der Nutzen dieser Langzeittherapie lag darin, dass Sebastian genug Zeit hatte, den Beziehungsbruch mit Max sinnvoll zu verarbeiten und über neu hinzugekommene Probleme zu diskutieren und akzeptable Lösungen für sie zu finden. Von vielen Psychosen war er befreit. Bequem und effektiv war diese professionelle Hilfe, wenn man sich ihr nur öffnete.
Ende Januar schloss Sebastian seine beiden Nebenfächer Italienisch und Spanisch endgültig ab. Er hätte sich jetzt schon ein wenig in diesen Sprachen unterhalten können. Seine germanistische Diplomarbeit hatte er auch zu einem passablen Ende gebracht. Analysiert hatte er das Gedicht "Auf den Mund" von Christian Hofman von Hofmannswaldau und dies dann in Beziehung zum Manierismus gesetzt. Ein Gedicht von zehn Zeilen wurde zu einer literaturwissenschaftlichen Arbeit von hundert Seiten. In die Untersuchung wurde sogar die geheimnisvoll vor sich hin lächelnde Mona Lisa mit einbezogen. Die Arbeit war zwar nicht so glanzvoll geworden, wie er sich das gewünscht hätte, aber der Professor war ihm wohlgesonnen. Fast ausschließlich seiner Arbeit als Hospitant an einem Gymnasium in Leiden, widmete sich Sebastian im zehnten Semester. Er unterrichtete Deutsch. In greifbare Nähe war der Lehrerberuf gerückt. Mit Maurits ergaben sich keine größeren Schwierigkeiten. Wöchentlich einmal besuchte dieser sein betagtes Mütterchen in Hilversum. Ab und zu machte er seine Fahrradtouren mit seinen Kommilitonen, auch längere nach Frankreich und Deutschland. Bis zum Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald schafften sie es. Diesem stolzen, kriegerischen und verräterischen Cherusker Arminius zu Ehren hatten seine Nachfahren ein Denkmal mitten im Wald errichtet. Maurits berichtete, dass es Touristen in hellen Scharen gegeben hätte.
Sie alle wären gekommen, diesen überlebensgroßen Hermann zu sehen, der schon mehr als hundert Jahre trotzig wie ein Fels seinen längst vergangenen Sieg feierte. Andächtig hätten sie zu diesem teutonischen Krieger hinaufgeschaut und in ihren Augen hätte Ehrfurcht gelegen. Wenn man von Westen käme, könnte man diesen Koloss schon aus weiter Ferne sehen. Aber auch ihn hatte die Rache Gottes eingeholt, da er selbst auch getötet hatte. Zu der Zeit, als der Herr in der Blüte seines kurzen, irdischen Lebens im einstigen Palästina umherschritt, wurde dieser Cheruskerfürst, noch bevor er vierzig war, von seinem eigenen Clan hinterhältig umgebracht. Ihm war das gleiche Schicksal beschieden, wie dem Herrn, dem schwer geprüften, dem schuldlosen, ein Dutzend Jahre später. Dieser musste damals geopfert werden, weil er es selbst so vorbestimmt hatte und auf dass sich der Wille Gottes erfülle. Dem heiligen Sebastian sollte dasselbe einige Jahrhunderte später widerfahren und Lamoraal traf das gleiche Los viele Jahrhunderte danach, mitten in Brüssel. Sie alle mussten in jungen Jahren sterben, weil die Vorsehung es so bestimmt hatte. Ein Entrinnen gab es nicht.
Die Mutter von Sebastian litt weiter und machte ihre Chemotherapie. Dann und wann schrieb Kiyoko. Immer noch wohnte sie in Kioto und hatte sich vollkommen dort eingerichtet. Die Probleme, die man erwartet hatte, waren ausgeblieben.
Mit dem Ende des zehnten Semesters schloss Sebastian sein Germanistik- und Lehrerstudium an der Utrechter Universität ab. Zu seiner vollsten Zufriedenheit war alles verlaufen. Er war jetzt Germanist, Deutschlehrer, dreißig Jahre und freute sich schon auf das Ende des Monats August, denn dann würde er seine Unterrichtstätigkeit aufnehmen.
Der Engel war der Ansicht, dass sein Schützling erneut eine erotische Sensation erleben sollte, auf dass sich seine Sexualität kontinuierlich entwickle. Aus diesem Grunde schickte er Sebastian auf die Pityusen.
Damit sich der Wille des Boten Gottes erfülle, flogen Sebastian und Maurits Anfang August nach Spanien. Zwei Wochen lang wollte man sich an den Fluten des Mittelmeeres erfreuen. Als Reiseziel hatte man die Insel Ibiza auserkoren und ließ sich in Ibiza- Stadt, im Viertel Figueretas, nieder. Man wohnte nicht in einem Hotel, sondern in einem großen Appartement mit drei geräumigen Zimmern. Luxuriös war die Einrichtung. Sebastian und Maurits hatten genau das gefunden, was sie suchten. Das Mittelmeerklima war angenehm und abends ging man ins Stadtzentrum und spazierte am Hafen entlang, wo die schönen, weißen Schiffe vor Anker lagen. Ibiza-Stadt war ein einziges Touristen-Eldorado. Kneipen und Restaurants gab es im Überfluss. Die Altstadt, die auf einem Hügel lag, war paradiesisch schön. Man musste durch jahrhundertealte Stadttore schreiten um dorthin zu gelangen. Die kleine Kirche war sehr beeindruckend. Die trügerische Ruhe dieses idyllisch gelegenen Gotteshauses jedoch wurde zeitweilig empfindlich gestört, weil es in der Einflugschneise der Jets lag. Manchmal hatte man das Gefühl, dass die Flugzeuge seine Turmspitze fast berührten. Was aber auf Sebastian den größten Eindruck machte, war der wunderschöne, mit dunkelgrünen Pinien umgebene, breite, feinsandige Strand, wo man nackt baden und schwimmen konnte. In Las Salinas konnte man die schönsten, männlichen Ärsche und Schwänze Europas sehen. Nur anfassen durfte man sie nicht. Diese herausfordernden Hinterteile waren ganz klar ein Wunderwerk des Schöpfers. Sebastian war zwar nicht erregt, aber doch bewunderte er diese schönen, weißen, jungen und elastischen Ärsche am Strand von Ibiza. Beruhigend wirkten sie auf ihn und in seinen Träumen konnte er diese maskulinen Hinterteile besteigen und sich an diesen Arschlöchern ergötzen. Tagsüber in der ibizenkischen Sonne zu liegen und sich abends in die Diskotheken zu begeben, machte ihn ein wenig übermütig. Er genoss auf dieser ehemals mondänen Balearen-Insel, die einst den europäischen Bohemiens als angenehmer Zufluchtsort diente, das Leben in vollen Zügen.
Als die beiden von dieser iberischen Insel zurückgekehrt waren, bezogen sie ihre erste gemeinsame Wohnung: Zwei Zimmer, Küche, Diele, Bad und Balkon. Man hatte sich häuslich niedergelassen.
Die wilden Jahre schienen vorbei zu sein. Ende August fing Sebastian als Deutschlehrer an einem Gymnasium in Rotterdam an. Mit dem Zug von Utrecht nach Rotterdam fuhr er jeden Morgen und nachmittags wieder zurück. Die Intrigen der lieben Kollegen und der Ärger mit den pubertierenden Schülern kamen noch hinzu. Die Letzteren hatten offensichtlich ganz andere Dinge als Vokabeln in ihren jungen Köpfen. Anstatt sich auf den Unterricht zu konzentrieren, überlegten sie sich, wie sie dem Lehrer das Leben schwer machen könnten und welche Streiche sie am Nachmittag aushecken würden. Des Weiteren waren sie ausführlich mit ihrem äußeren Erscheinungsbild beschäftigt. Sie dachten darüber nach, ob sie in Bezug auf das andere Geschlecht an Attraktivität einbüßen würden, wenn sich in ihrem Gesicht ein Pickel befände. Sebastian war enttäuscht über diesen Job, machte aber trotzdem weiter, denn er musste ja ein Einkommen haben.
Im zweiten Jahr seiner Lehrertätigkeit, im Herbst, starb dann seine Mutter. Zum Friedhof musste er wieder und abermals hörte er die Worte des Priesters: "Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken." An die Großmutter und an seinen ältesten Bruder dachte Sebastian. Die Mutter wurde zu ihnen gebettet und hatte nun den immer währenden Frieden und das ewige Licht leuchte ihr! Sebastian empfand noch immer keine Trauer.
Im fünfzehnten Semester war sein Gefährte, Maurits, der gloriose Radler, jetzt und entwickelte alle Anzeichen eines so genannten ewigen Studenten. Fahrrad fuhr er in jeder freien Minute, besuchte samstags immer sein altes, gebrechliches Mütterlein und seine, mittlerweile zu Ex-Kommilitonen gewordenen, Freunde. Eines Tages entschloss sich Maurits, der schon so viele mathematische Formeln in seinem klugen Kopf gespeichert hatte, sein Studium an den berühmten Nagel zu hängen. Einen Job bei einer Bank hatte er gefunden. Nicht unerwartet kam dieser Entschluss und war deswegen auch nicht spektakulär.
Sebastian schlug sich weiter mit den pubertierenden Schülern herum. Geld gab es im Überfluss und die beiden hatten keine Sorgen. Ab und zu besuchte Sebastian noch jenes Tal an der holländischen Grenze, wo jetzt sein Vater als unglücklicher Witwer lebte und Tag und Nacht über sein Alleinsein klagte. Die unakzeptierte Schwiegertochter, die schon zwei Kinder hatte und der drittälteste Sohn, der mit ihr verheiratet war, zogen zum Vater ins Haus, damit dieser nicht so einsam sei. Von Tag zu Tag nahmen die Hassgefühle des Vaters, der Schwiegertochter gegenüber, zu.
12. Kapitel
Sebastians Engel war zu dem Entschluss gekommen, dass sein Schützling ein weiteres Mal zu einem sexuellen Höhepunkt gelange, damit sein Leben wieder einen neuen Impuls erhalte. Zu diesem Zwecke suchte er sich, kurz hintereinander, zwei Männer aus. Ein Spanier von dreißig und einen Holländer von achtundzwanzig Jahren waren die auserkorenen. Der Engel wachte unaufhörlich über Sebastian und sorgte, ohne Unterlas, dafür, dass er immer zur rechten Zeit das Richtige bekomme. Es war seine einzige Aufgabe.
Zunächst beschloss Sebastian, in den Osterferien nach Las Palmas zu fliegen, da er von seinen Schülern so erschöpft war. Er glaubte, dass ein solcher Trip ihm die Zerstreuung bringen würde, nach der er verlangte. Er bat Maurits, mit dem er jetzt sein Leben in einer eheähnlichen Beziehung teilte, ohne dass es dabei zu persönlichen Einschränkungen gekommen wäre, ihn in den Süden zu begleiten. Voller Begeisterung hörte dieser sich Sebastians Vorschlag an und war direkt damit einverstanden. Maurits fügte noch hinzu, dass er seit langem schon den Wunsch hege, eine dieser spanischen Inseln vor der westafrikanischen Küste zu besuchen. Von Bekannten habe er gehört, dass es dort unendlich lange feinsandige Strände gebe.
Eine Woche nur sollte die Reise dauern. Man mietete sich in einem Hotel im Zentrum von Las Palmas, dieser größten kanarischen Stadt, ein. Die Insel Gran Canaria hatte in der Tat wunderschöne Sandstrände. Im Süden dieses atlantischen Eilandes lag die Playa del Inglés. Ein wüstenartiges Sandgebiet war es. Sebastian und Maurits begaben sich also dorthin, da es das Touristenzentrum der Insel war. Durch die Dünen wanderten sie und suchten sich ein Plätzchen zum Sonnenbaden. Nachdem man sich niedergelassen hatte, machte Maurits sich schon wieder auf und verschwand in diesen teilweise mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Dünen. Ein herrlicher Sonnentag war es. Durch die leichte Brise herrschte eine angenehme Temperatur. Auf seinem Handtuch lag Sebastian und träumte vor sich hin. Ab und zu kamen Leute vorbei, bepackt mit den üblichen Strandutensilien. Sebastian schenkte den Vorübergehenden keine große Aufmerksamkeit. Einer von ihnen aber, der offensichtlich ziellos durch diese karge Gegend streifte, fiel Sebastian auf. Nachdem er diesen Burschen eine Zeitlang beobachtet hatte, bemerkte er, dass dieser sich auf einen in der Nähe gelegenen Hügel zurückzog, der von Sträuchern umgeben war. Eine innere Unruhe erfasste Sebastian. Seine Erregung stieg; durch die Sonne und die exotische Umgebung sicherlich noch verstärkt. Zielgerichtet ging er auf jenen Hügel zu, auf dem der junge Mann, vermutlich ein Spanier, entschwunden war. Dem Drang, dort hinaufzusteigen, konnte er sich nicht widersetzen. Seines freien Willens beraubt war er. Dort, auf der Sanderhebung, lag der schöne Jüngling und schaute Sebastian an, als ob er ihn schon erwartet hätte. In den Augen dieses Spaniers konnte Sebastian dessen Verlangen, den Wunsch nach sexueller Befriedigung, bereits sehen. Er trat auf ihn zu, berührte ihn und die ganze Sehnsucht, die er in sich trug, erfüllte sich. Am Ende war wieder diese glückselige Erschlaffung der Muskulatur und das herrliche Gefühl, dass ein schöner Traum in Erfüllung gegangen war, ohne dass auch nur ein einziges Wort gewechselt worden wäre. Dieser urmenschliche Drang war es, der wieder einmal gestillt worden war, an jenem Tag, in den Dünen von Playa del Inglés.
Sebastian ging wieder zu seinem Handtuch hinunter. Maurits war schon da und ahnte, was geschehen war. Sanft lächelte er.
Gemeinsam ging man zum aufschäumenden Meer und tauchte in die kühlenden Fluten, die alle Schuld mit sich nehmen würden, um sie im unendlichen Ozean versinken zu lassen. Man machte Ausflüge und verbrachte einen angenehmen Urlaub.
Nach einer Woche flogen die beiden wieder nach Amsterdam zurück. Nachdem sie Zuhause angekommen waren, schaute Sebastian seine Post durch und fand einen Brief mit einem ihm nicht bekannten Absender. In gespannter Erwartung öffnete er das Couvert und las, dass jemand ihn besuchen wollte, an den er sich beim besten Willen nicht erinnern konnte, wie sehr er sich auch bemühte. Es wurde mitgeteilt, dass man sich von einer Geburtstagsfete im Studentenhochhaus kenne. Den Vornamen Erik hatte der Briefschreiber und wohnte in Utrecht. Seine Telefonnummer war auch angegeben, sodass Sebastian anrufen konnte. Den Kopf zerbrach er sich darüber, wer es wohl sein könnte. Er erzählte Maurits davon und dieser empfahl ihm, doch einfach den Hörer in die Hand zu nehmen und die Nummer zu wählen. Dies tat er dann auch. Am anderen Ende war eine Frauenstimme. Sebastian nannte seinen Namen und verlangte Erik zu sprechen. Die ominöse Dame, die, wie sich später herausstellen sollte, früher einmal Nonne gewesen war, aber aus Unzufriedenheit den Orden wieder verlassen hatte, verband weiter. Erik meldete sich und fragte, ob Sebastian ihn kenne. Dies verneinte er und sagte, dass der Brief für ihn völlig unerwartet gewesen sei und dass er nichts mit dem Namen Erik anfangen könne. Für den folgenden Abend, zwischen sechs und acht Uhr machte man eine Verabredung bei Sebastian. Zu dieser Zeit war Maurits nicht in der Wohnung, da er immer von siebzehn bis zweiundzwanzig Uhr im Computerzentrum der Bank arbeitete. Um zwanzig Uhr klingelte es. Sebastian öffnete die Wohnungstür und dort stand ein gut gebauter, junger Mann mit strahlenden Augen und schwarzem Haar. Sebastian bat ihn herein. Der schöne Unbekannte stellte sich vor. Achtundzwanzig war er und studierte Spanisch. Er sagte, dass er Sebastian auf der bereits erwähnten Geburtstagsfete bei einer Kommilitonin auf der siebzehnten Etage in jenem Studentenhochhaus gesehen habe. An die betreffende Fete konnte Sebastian sich wohl erinnern, aber nicht an diesen Studenten, der jetzt vor ihm stand. Nach dem Grund seines Besuches, fragte Sebastian den charmanten Erik, da es im Brief und am Telefon nicht klar geworden war. Verbal schlich der schöne Erik ein bisschen wie die Katze um den heißen Brei und meinte schließlich, dass die Freundin von der siebzehnten Etage ihm geraten habe, sich in sexueller Not am besten an Sebastian zu wenden, denn der hätte schon allerlei auf diesem Gebiet mitgemacht. Er habe nämlich der homo-, hetero- und bisexuellen Erfahrungen in seinem Leben schon so viele gesammelt.
Ob der schlaue Erik es nur als billigen Vorwand benutzte oder ob wirklich ein sexuelles Problem vorlag, war Sebastian einerlei.
Um die Ambiance etwas gemütlicher zu machen, zündete er eine Kerze an. Ganz auf den erotisch wirkenden Erik stellte er sich ein und erklärte diesem alles Wissenswerte über die verschiedenen Formen der Sexualität. Sowohl die Triebe und Neigungen zum eigenen als auch die zum anderen Geschlecht und die Mischung aus beiden wurden besprochen. Eine bunte Palette der Möglichkeiten gäbe es. Gleichzeitig fügte Sebastian hinzu, dass man sich unbedingt von sämtlichen gesellschaftlichen Zwängen befreien müsse und nur das machen solle, von dem man glaube, dass es das Richtige sei. Man müsse sich von vorgelebten Mustern trennen, wenn man der Meinung wäre, sie seien für einen selbst nicht das Optimale. Viele Theorien wurden behandelt. Aufmerksam hörte Erik zu und stellte interessiert einige Fragen. Unterschwellig musste Sebastian dabei manchmal an die Nachhilfestunden in Französisch denken, die Veronika ihm einst erteilt hatte. Damals war es Sebastian, der interessiert Fragen stellte, obwohl er die Antworten schon vorher wusste. Aber trotzdem, wie auch Veronika damals, ging Sebastian vollkommen in die Unterhaltung auf und letztendlich machte er dem abwartenden Erik den sinnvollen Vorschlag, dass man ja direkt die Probe aufs Exempel machen könne. Anfänglich stellte sich Erik noch etwas reserviert auf.
Kurzerhand zog Sebastian sich ganz aus. Diese völlige Nacktheit brachte Erik dazu, sich peu à peu bis auf die Unterhose zu entkleiden. Von dieser Hülle befreite ihn dann Sebastian, indem er ihm den weißen Slip mit einigen elegant-gekonnten Bewegungen abstreifte. In die Ecke des Zimmers, wo eine Matratze lag, führte er den charmanten Erik. Er bat den völlig Entblößten nun, eine derartige Position einzunehmen, dass dieser, auf Ellenbogen und Knien sich abstützend, seinen knackigen, wohl geformten Hintern dem begierigen Sebastian einladend entgegenstrecken konnte. Der verführerische Sebastian, schon voller Vorfreude der Dinge, die da kommen würden, kniete sich dahinter. Manuell stimulierte er das verheißungsvoll-warme, elastische Loch und die, wie Knicker in einem Säckchen hängenden Hoden und den bereits anschwellenden Schwanz, der sich noch wie das Perpendikel einer Standuhr zwischen den muskulösen Schenkeln hin und her bewegen ließ. Diese herrlichen Arschbacken spreizte der erregte Erik jedes Mal ein wenig mehr, bis Sebastian dann alles in voller Bereitschaft prächtig vor sich fand. Dieses Wunder der Natur, willig sich ihm darbietend, brachte das Blut von Sebastian in Wallung. Dieses weiße Fleisch, so herausfordernd gewölbt und aufreizend, peitschte ihn auf. Nichts ließ sich mehr aufhalten und das Erhoffte geschah. Langsam drehte sich der geschmeidige Erik um und Sebastian sah den Glanz seiner dunklen Augen im Kerzenschein. Sie diskutierten weiter über allerlei Formen der Sexualität und über die Erfüllung, die der Mensch in ihr finden könne. Man war der Meinung, dass sie sowohl Stress abbaue als auch befreiend und inspirierend wirke. Ihre positiven Auswirkungen auf Körper und Geist seien sogar imstande Depressionen und Migräne zu vertreiben.
Völlig entspannt war Erik. Sebastian war stolz auf diese Meisterleistung. Große Befriedigung schenkte sie ihm und die notwendige Kraft seinen Schülern wieder voller Energie entgegentreten zu können.
In einem solchen Zustand der Begeisterung fiel es Sebastian leicht sie zu manipulieren. Dann konnte er ihnen, außer der obligatorischen Grammatik, die diesen Gymnasiasten so verhasst war, auch etwas über Goethe, Schiller und Böll zu erzählen. "Die Leiden des jungen Werther", "Wilhelm Tell" und "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" gehörten zu den Werken, die den Schülern dargeboten wurden.
Bölls "Katharina Blum" gefiel ihnen am besten, da es sich in der Jetztzeit abspielte und der Stoff übersichtlich und klar strukturiert war. Diese Einfachheit liebten sie. Für Katharina Blum, die Hauptperson der Erzählung, empfanden sie Mitleid, weil ihr Leben größtenteils zerstört wurde, ohne dass sie Einfluss darauf hätte nehmen können.
Werthers Liebesschmerz, den Goethe so eindringlich beschrieben hatte, drang schon nicht mehr bis zu den Schülern durch, da sie die Art der Formulierungen als zu umständlich empfanden. Darüber hinaus missfiel ihnen die Weitschweifigkeit dieses Briefromans. Bei "Wilhelm Tell" war es bereits unmöglich ihr Interesse auch nur andeutungsweise zu wecken. Sebastian konnte das verstehen, da dieses Schiller’sche Schauspiel ihn damals auch nicht besonders ansprach, als er selbst noch Schüler war. Dennoch unternahm er ab und zu den fast aussichtslosen Versuch, seinen Schülern diese Prosa über die Entstehung der Schweiz näher zu bringen, was aber meistens nur geringen Erfolg hatte. Die Macht der Gewohnheit war es, die ihn manchmal dazu verleitete, auf Geßler, diesen mächtigen Landvogt, und dessen Widersacher, den tapferen Wilhelm, dessen Mut auf eine harte Probe gestellt wurde, zurückzugreifen. Vom Kopfe des Knaben, seines Sohnes, musste er mit Pfeil und Bogen den Apfel schießen. Aber auch eine kühne Tat wie diese, ließ die Schüler unberührt.
Sebastian berichtete dem besonnenen Maurits in groben Zügen das, was mit Erik, dem schönen Liebhaber, vorgefallen war. Wohlwollend hörte dieser zu, aber gleichzeitig konnte Sebastian an dessen Augen sehen, dass er sich noch etwas daran gewöhnen musste.
Wöchentlich kam der leidenschaftliche Erik jetzt zu einer Art Sex-Therapie und Sebastian war in einer euphorischen Stimmung. Mit Maurits einigte er sich dahingehend, dass Erik in den Stand einer "Maîtresse en Titre" erhoben würde. Dies in Anlehnung an die Tradition der französischen Könige, wo das ja sozusagen zu einer öffentlichen Institution gemacht worden war. Geradezu ein Paradebeispiel war damals Madame de Pompadour, die es als "Mätresse im Amt" am Hofe Ludwig XV. zu großem Ruhm gebracht hatte. Ein Schloss nach dem anderen wurde ihr geschenkt und ihr Reichtum stieg ins Unermessliche. Aber auch sie, "La Favorite du Roi", musste ihre irdischen Güter bereits früh, im Alter von dreiundvierzig Jahren, andern überlassen. Als man ihren Leichnam am siebzehnten April Anno Domini MDCCLXIV, zwei Tage nach ihrem Ableben, zur Kirche Notre-Dame de Versailles überführte, besaß sie einen Namen, der bereits aus mehr als einem Dutzend Wörtern bestand: "Madame Jeanne-Antoinette de Poisson, duchesse-marquise de Pompadour et de Ménars, dame de Saint-Ouen près de Paris, et autres lieux." In den ersten Stunden des darauf folgenden Tages wurde La Pompadour in der Kirche des Kapuzinerklosters an der Place Vendôme in Paris an der Seite ihrer Tochter Alexandrine beigesetzt.
Weder Schlösser noch Titel, die mit Geld verbunden gewesen wären, konnte Sebastian seinem Erik bieten, nur eben den Kern der Geschichte: Den Beischlaf und den Genuss, der sich daraus für beide Seiten ergab.
Man versuchte, sich mit der neu entstandenen Situation zu arrangieren. Maurits ging jetzt oft aus und fand sein Vergnügen mit den unterschiedlichsten Verehrern. Sebastian hatte seinen "Favori en Titre". Darüber hinaus kam man auch noch seinen sexuellen Verpflichtungen innerhalb der Partnerschaft nach. Alles ging reibungslos von statten und jeder war zufrieden. Die Arbeit als Deutschlehrer bereitete Sebastian, im Gegensatz zu den amourösen Aktivitäten, aber immer weniger Freude. Während der zwei Jahre, die er jetzt im Schuldienst tätig war, hatte er erfahren müssen, dass das Unterrichten ihm doch nicht die Befriedigung schenkte, die er sich davon erhofft hatte. Im Juli gab er seine Arbeitsstelle voller Enttäuschung auf und richtete seine ganze Kraft auf die Liebe. Nach einem Jahr der gelebten Lust besann er sich wieder. Erik hatte genug gelernt und inzwischen so große Fortschritte erzielt, dass er dem Meister ebenbürtig war. Er besaß jetzt genug Reifheit und Geschick, was ihn dazu befähigte, in freier Wildbahn überleben zu können.
Ab September nahm Sebastian eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer Schülerberatungsstelle an. Ihm gefiel diese Arbeit sehr. Aber jetzt merkte er, dass sein deutscher Akzent eher ein Hindernis als ein Vorteil war. Bei der Arbeit als Dozent war das kein Problem. Er fing an das Leben in Holland als eine Beeinträchtigung in seiner Entwicklung zu sehen. Immer wieder musste Maurits ihn trösten. Manchmal verlangte Sebastian wieder nach jenem Tal zurück, wo er seine Jugend verbracht hatte. Die wilde Maria und die geliebte Großmutter kamen ihm in den Sinn. An die Mutter dachte er, die jetzt schon zwei Jahre auf dem Friedhof ruhte und für die er keine Trauer empfinden konnte. Trotz der intensiven Bemühungen von Maurits, Sebastian etwas aufzumuntern, empfand dieser jetzt das Leben in den Niederlanden als eine große Bürde und schwere Last. Die Depressionen häuften sich. Zu dieser Niedergeschlagenheit trugen nicht zuletzt auch die holländischen Tageszeitungen bei. Die Berichterstattung über alles, was deutsch war, hatte häufig einen negativen Beigeschmack. Sebastian litt jetzt unter diesen Anspielungen, da er empfänglich für sie war.
Seit Jahrzehnten schon gab es eine seltsame Hassliebe zwischen beiden Ländern. Während die Zuneigung eine wechselseitige war, die hauptsächlich aus dem gleichen kulturellen Erbe herrührte, wurden die Gefühle der Feindseligkeit nur einseitig geschürt. Hier waren die Untertanen ihrer Majestät im kleinen Königreich hinter den Deichen unerbittlich in ihrer Auffassung. Da konnte sie auch der Export unzähliger Blumen sowie tausender Tonnen von Tomaten und Käse, den sie Gewinn bringend nach Deutschland tätigten, nicht auf andere Gedanken bringen.
Die sonst so friedliebenden Holländer machten aus verständlichen, aber längst überholten Gründen, ihrem Unbehagen Luft, indem sie die deutsche Besatzung und den Entzug der Freiheit, der damit einherging, stets wieder als Gesprächsthema aufgriffen. Immer noch spukte der Krieg in ihren Köpfen, von dem sie sich anscheinend nur schwer zu lösen vermochten. Dann schlossen sie einträchtig die Reihen und ließen ihren patriotischen Gefühlen den freien Lauf. Einhellig waren sie der Ansicht, dass die Deutschen zu überheblich seien. Außerdem hätten sie den rasanten wirtschaftlichen Aufschwung, der ihnen nach ihrer Kapitulation zuteil wurde, nicht verdient.
Könnte er doch in jenes Tal, an die sieben Quellen des Wildbaches zurück! Groß war die Sehnsucht nach der unwiederbringlichen Vergangenheit. Sie konnte nicht gestillt werden. Dennoch war Maurits stark genug Sebastian in jenen freudlosen Tagen ein wenig Trost zu spenden.
Der Engel war sich Sebastians misslicher Lage sehr wohl bewusst und griff erneut ein, damit sein Schützling nicht noch mehr leide. Dazu suchte er sich diesmal ein Novum aus. Er zeigte Sebastian das Summum der Wollust: Sex pur und im Übermaß. Der Bote Gottes war der Überzeugung, dass es für den Reifungsprozess Sebastians unabdingbar sei. Dreiunddreißig war dieser jetzt und reif genug dazu. Der Herr wurde im Alter von dreiunddreißig an das Kreuz auf Golgatha genagelt und hatte für alle Missetaten der ganzen Menschheit Sühne getan. Sebastian stand daher dieser Weg zu den Früchten des Paradieses offen. Für ihn gab es deswegen keine Kreuzigung, sondern Sex pur.
In jenen trüben Tagen geschah es, dass Maurits sich Sebastian in Sorge und mit großem Mitgefühl zuwandte. Schon seit einigen Monaten hatte er mit ansehen müssen, wie das Leiden Sebastians immer schlimmere Formen annahm. Manchmal starrte dieser stundenlang vor sich hin, ohne auch nur den geringsten Versuch zu unternehmen, sich aktiv an Gesprächen zu beteiligen. Die Schwermut hatte ihn fest im Griff und es schien, als wolle er sich gar nicht mehr daraus befreien.
Maurits fasste sich ein Herz und versuchte mit all seiner Kraft, zu Sebastian vorzudringen. Er machte ihm den Vorschlag zu Silvester gemeinsam nach Amsterdam zu fahren, denn dort gebe es diese berühmten Sex-Partys in einem alten Lagerhaus an der Lijnbaansgracht. Sebastian sagte zu.
Am einunddreißigsten Dezember begaben sich Maurits und Sebastian an die Ufer der Amstel. Gegen elf Uhr betraten sie das ehemalige Depot, wo einst die kostbaren Spezereien aus dem fernen Ambon und Bandalontar eingelagert wurden. Es war ein eisig kalter Abend, jener Silvester. Die warme Luft voller Verheißungen strömte ihnen entgegen, als sie die Tür zum ehemaligen Lagerschuppen öffneten.
Sie entrichteten den geforderten Obolus und gaben ihre Winterkleidung an der Garderobe ab. Es duftete nach frisch gebackenen Karpfen. Der aufpeitschende Rhythmus der Musik drang an ihr Ohr. Sie betraten einen großen, doppelstöckigen Raum. Sowohl im oberen als auch im unteren Stockwerk befand sich eine Anzahl von Theken, an denen hauptsächlich Bier und das gleich flaschenweise, verkauft wurde. Über hölzerne Stiegen konnte man sich von einer Ebene auf die andere begeben. Über allem aber lag etwas Bedrohend-Unwirkliches.
Im Obergeschoss wurden die perversesten, amerikanischen Pornofilme gezeigt. In alle möglichen Körperöffnungen wurden die unmöglichsten Gegenstände hineingesteckt, -gepresst und -gedrückt. Es schien, als ob die Öffnungen immer etwas zu eng für die Plastikutensilien waren, die darin versenkt werden sollten. In diesen Räumen, in denen Sebastian glaubte, bisweilen noch den Geruch fremdländischer Gewürze wahrzunehmen, hatten sich ausschließlich Männer eingefunden. Sie würden in dieser einen Nacht in Amsterdam zu allem bereit, damit sich ihre Träume ohne Einschränkung erfüllten. Vertreten waren alle Altersgruppen, Hautfarben und Größen. Manche waren bekleidet, andere nur teilweise und einige hatten sich völlig entblößt. Splitternackte Ärsche und Schwänze jeder Kategorie sah Sebastian. Seine Erregung stieg. Spärlich beleuchtete und fast dunkle Zonen gab es. Vor ihm lag der geballte Sex pur. Eine Arena der Lust in ihrer äußersten Konsequenz war es. An das Bild von dem Raubtier dachte Sebastian, das sich, aufgrund der großen Masse, nur schwer entscheiden konnte, welches Opfer es zuerst reißen sollte. Aber in diesem Tempel der absoluten Wollust war jeder Opfer und Täter zugleich. Wundervolle, knackige Ärsche und kühn geschwungene Schwänze, auf die man, unter normalen Umständen, Jahre hätte warten müssen, gaben sich hier gleich zu Dutzenden ein Stelldichein. Kleine, große, dünne, dicke, schlaffe, steife, gerade und krumme wurden Sebastian dargeboten.
Schon lange war Maurits in dem Getümmel der warmen, dampfenden Fleischmassen verschwunden. Sebastian brauchte noch eine gewisse Zeit, um sich an all das, was feilgeboten wurde, zu gewöhnen.
An die Blue Ridge Mountains und an den Ex-Vietnam-Soldaten, den er, wegen der Barriere seiner Augen, nicht überwältigen konnte, dachte er. Der schlafende Alexander im Doppelbett von Agrigento, den er nicht berührte, weil er fürchtete, abgewiesen zu werden, kam ihm in den Sinn. An diese, ihm verwehrten süßen Früchte von Ibiza, erinnerte sich Sebastian. Jetzt streckten sich ihm all diese Köstlichkeiten gleich zigfach entgegen. Dieses anonyme, feste Fleisch, parfümiert, gewaschen, naturell oder eingeschmiert, bot sich ihm dar, ohne dass er je erfahren würde, wer es offerierte. Diese sich bewegenden, strammen Körper en masse waren nur dazu geboren worden, Sebastian zu willen zu sein. Wie dumpfe Trommelschläge, deren Rufen man sich nicht entziehen konnte, dröhnten die tiefen Klänge unaufhörlich aus den Lautsprecherboxen. Der Alkohol, der seine Sinne schon berauschte, und die Vorahnung von dem, was geschehen würde, ließen Sebastians Körper erzittern.
Die besonderen Lichteffekte gaben diesem in sich verschlungenen, überdimensionalen Klumpen aus heftig pulsierenden, angeschwollenen Adern eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Die aufputschende Wirkung, die dieses verlockende Halbdunkel hervorrief und der Schutz, den es gleichzeitig bot, trugen dazu bei, dass die Begierde sich fast ins Unendliche steigerte. Es gab Augenblicke, in denen Sebastian glaubte, dem Irdischen völlig entrückt zu sein.
Paradies und Hölle verschmolzen. Konturen verschwammen und lösten sich auf. Grenzen wurden gesprengt. Chaos und Ordnung waren zu Synonymen geworden.
Hier offenbarte sich ihm die mit unsäglichem Schmerz zugepflasterte Via Dolorosa nicht als Leidensweg nach Golgatha, sondern als Straße der Wollust, die zu den Ausschweifungen von Gomorrha führte.
Sebastian war willenlos. Er ließ sich in die Menge gleiten und wurde eins mit dem Universum.
Am frühen Morgen war er vollkommen erschöpft. Sein Schwanz schmerzte. Einen gewaltigen Kater hatte er und sein Arschloch brannte fürchterlich. In jener Silvesternacht in Amsterdam hatte er das Summum des Möglichen erlebt und daran teilgenommen, mit all seiner Kraft. Er war dreiunddreißig und hatte erfahren müssen, dass die Grenzen zwischen Lust und Qual ineinander flossen. Es war eine äußerst gefährliche Gratwanderung allergrößter Bedrohung und himmlischster Glückseligkeit.
Man holte an der Garderobe seine Winterkleidung wieder ab und verließ diesen Ort der Extreme. Draußen war die Luft eisig. Maurits und Sebastian nahmen den ersten Zug wieder nach Hause. Man redete nicht. Benebelt noch vom Alkohol und vom Sex war man. Die beiden Lover befanden sich in einem Zustand völliger Apathie. Man war in Ekstase gewesen, jenseits von gut und böse.
13. Kapitel
Allmählich hatte sich Sebastian von der Amsterdamer Nacht der Exzesse erholt.
Im Frühling fing er mit der Jobsuche an. Als Lehrer wollte er wieder arbeiten, vorzugsweise an einer Fachhochschule. Nach kurzem Suchen in der Rubrik der Stellenanzeigen fand er einen Job als Deutschlehrer an einer Fachhochschule in Den Haag. Seinen Bewerbungsbrief schrieb er und wurde daraufhin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Im April fand dieses statt.
Sebastian bekam die Stelle und sollte im August anfangen. Nur einige Monate der Freiheit blieben ihm noch. Seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Schülerberatung gab er auf und bereitete sich auf seinen neuen Wirkungskreis vor. Die geeigneten Lehrbücher suchte er aus und erstellte einen Lehrplan. Bei dieser Fachhochschule lag der Schwerpunkt auf Tourismus. Für Sebastian war das kein Problem, da er selbst viele Reisen machte. Die deutsche Literatur brauchte nicht mehr unterrichtet zu werden, denn es kam hauptsächlich auf die praktische Anwendbarkeit der Sprache an. Die Studiendauer betrug fünf Semester und anschließend konnte man als Reiseleiter im In- und Ausland arbeiten. Mindestens siebzehn Jahre waren die Studenten und hatten entweder die Realschule oder das Gymnasium abgeschlossen. Ihm bereitete die Arbeit viel Vergnügen, denn die Studierenden waren schon fast erwachsen. Räsonabel waren sie schon, im Gegensatz zu den Kindern, die Sebastian früher unterrichten musste, denn diese befanden sich noch mitten in der Pubertät. Es gab keine Elternsprechtage mehr. Dieser ganze Firlefanz fiel weg. Eine ungeheure Erleichterung war es.
Die Tage wurden wieder kürzer und schon bald stand Weihnachten vor der Tür. Sebastian musste so intensiv arbeiten, dass er kaum noch wahrnahm, wie schnell die Monate verflossen.
Die ersten Schwalben waren bereits zurückgekehrt. Aber ohne ihrer gewahr zu werden, drohte Sebastian immer weiter in seinen Lehrbüchern und einen Berg von Papieren, den er selbst aufgetürmt hatte, zu versinken. Die vielen Unterrichtsstunden und Unmengen von Korrekturen sorgten dafür, dass er immerfort beschäftigt war. Ungewollt hatte er sich von seinem Beruf dermaßen vereinnahmen lassen, dass ihm für außerschulische Dinge nur wenig Zeit blieb. Als der Sommer kam, den er nur beiläufig registrierte, beanspruchten ihn die Examen so sehr, dass er selbst von der jährlichen Ferienreise absah, die er gewöhnlich mit Maurits zusammen unternahm. Diesen störte das nur wenig. In einer mehrtägigen Fahrradtour mit einigen seiner ehemaligen Kommilitonen sah er eine gleichwertige Alternative. Er wisse auch schon, wohin man radeln würde. Waterloo, das in der Nähe von Brüssel liege, solle das Ziel sein. Dieses Schlachtfeld, das Napoleon einst zum Verhängnis wurde, wolle er einmal sehen. Es gebe in Waterloo einen künstlich aufgeworfenen Hügel, den man über Treppen besteigen könne. Von dort oben habe man einen schönen Ausblick über das Terrain, auf dem das Schicksal des Kaisers, dieses stolzen Korsen, endgültig besiegelt worden sei. Abschließend meinte Maurits noch, dass die lebenslängliche Verbannung nach St. Helena als Folge dieser Entscheidungsschlacht ein hartes Los für ihn gewesen sein müsse.
Der Engel bemerkte, dass Sebastian auf dem besten Wege war, sich zu einem Workaholic zu entwickeln und griff behutsam ein, auf dass der Arbeitseifer seines Schützlings rechtzeitig gebändigt werde.
Einige Wochen nach Semesterbeginn, der Herbst hatte schon wieder seinen Einzug gehalten, erhielt Sebastian den Anruf, dass dem Vater ein Bein amputiert worden sei. An einem Wochenende reiste er an die sieben Quellen des Wildbaches und traf den Vater im Rollstuhl an. Ein trauriger Anblick bot sich ihm dar, aber der Vater lächelte nur und entschuldigte sich sogar noch für das verlorene Bein. Bis Sonntagabend blieb Sebastian bei ihm. Zu dieser Zeit war der Vater noch guten Mutes, weigerte sich aber, das Holzbein anzuschnallen und wieder gehen zu lernen. Etwas konfus kehrte Sebastian nach Holland zurück und stürzte sich in die Arbeit.
Zu Weihnachten besuchte er nochmals den Vater. Jetzt merkte er, dass dieser schon etwas an Lebensmut eingebüßt hatte. Endlos lang klagte er über seine Behinderung.
Im Sommer fuhr Sebastian wiederum zu seinem Vater. In ein seelisches Wrack hatte er sich mittlerweile verwandelt. Er wollte überhaupt nicht mehr aufstehen. Über seine Schwiegertochter, die bei ihm im Hause wohnte, klagte er ununterbrochen. Inzwischen hatte sie schon vier Kinder. Aber auch diese Enkel interessierten den Vater nicht mehr. Alle Hoffnung hatte er aufgegeben. Nur noch sterben wollte er. Stundenlang redete Sebastian mit dem Vater. Während eines dieser Gespräche vereinbarten sie, dass er nicht am Begräbnis des Vaters teilnehmen würde. Der Vater zeigte noch einmal ein letztes, schwaches Lächeln. Mit dem Vorschlag des Sohnes war er vollkommen einverstanden. Dass es der letzte Besuch und die allerletzte Unterredung sein würden, wussten beide. Sie schauten sich in die Augen und verabschiedeten sich. Sebastian fuhr nach Utrecht zurück. Eine gewisse Erleichterung machte sich in ihm breit.
Einige Monate später erhielt er das Telefonat, dass der Vater gestorben sei. Den größten Teil der Trauerarbeit hatte Sebastian schon bewältigt, weil der Sterbensprozess des Vaters mit diesem selbst bereits besprochen und abgeschlossen worden war. Zur Beerdigung ging er also nicht. Ab und zu litt er noch darunter, dass jetzt beide Elternteile im kühlen Grabe ruhten, dort, auf dem Waldfriedhof, wo schon seine Großmutter, die heiß geliebte Freibeuterin, der älteste Bruder und die Mutter lagen. Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Amen.
Einige Wochen später, kurz vor Weihnachten, kam es zur Verteilung der Erbschaft. Sebastian kehrte wieder in seine Heimatstadt zurück. Jetzt waren die Brüder unter sich: Sebastian, sein Zwillingsbruder, der dritt- und der zweitälteste. Nicht mehr dabei waren die Eltern. Eine völlig neue Situation war entstanden. Merkwürdig und beängstigend war es jetzt ohne Eltern, die doch immer der Mittelpunkt der Familie gewesen waren. Alle Erbschaftspapiere unterschrieb Sebastian und begab sich wieder nach Holland zurück. In Den Haag, an dieser Fachhochschule, arbeitete er weiter als Lehrer, aber er konnte jetzt seine Arbeit effizienter verrichten, sodass ihm genügend Freizeit blieb. Über die neue Situation mit seinen Brüdern dachte er nach. Irgendwie musste der Kontakt aufrechterhalten werden. Nächtelang überlegte er und kam zu der Einsicht, dass man sich, auf jeden Fall, einmal jährlich, sehen müsse, und zwar auf mehr oder weniger neutralem Boden. Seinen Brüdern schlug er dies vor. Die verblüffend einfache Lösung war unerwarteterweise schnell gefunden. Der ideale Treffpunkt war die Gartenlaube, die dem zweitältesten Bruder, dem hilfreichen Hermann, gehörte. Ausschließlich die vier, jetzt verwaisten, Brüder sollten dort unter sich sein, ohne Schwägerinnen und ohne Kinder. Durchgeführt wurde dieses Projekt zum ersten Mal im Mai, sieben Monate nach dem Tode des Vaters. Wunderbar funktionierte es. Als außergewöhnlich liebevoller Gastgeber erwies sich Hermann. Damals, vor vielen Jahren, hatte er Sebastian immer die honigsüßen Nusseckchen mitgebracht und jetzt stellte er seinen liebevoll gepflegten Garten, in dem die schönsten Blumen standen, zur Verfügung. Blutrote Dahlien und rosafarbene Schmuckkörbchen teilten sich mit prallen Salatköpfen und heranwachsenden Gurken das Terrain. Dermaßen zufrieden waren alle, dass man es jedes Jahr wiederholen wollte.
Sebastian und Maurits erfreuten sich noch immer aneinander. Nur fand man, dass die Maisonnette, die nur aus zwei großen Zimmern bestand, zu klein würde. Eine andere Behausung suchte man sich also. Im September bezog man eine Vierzimmerwohnung mit Dachterrasse. Ab jetzt hatten Sebastian und Maurits ihre eigenen Arbeitsräume und jeder war zufrieden. Immer noch arbeitete Maurits bei der Bank von fünf Uhr nachmittags bis zehn Uhr abends. Sebastian unterrichtete weiter. Die Tage und Monate verstrichen störungsfrei. Finanzielle Probleme gab es nicht.
Alles hätte so weitergehen können, bis ans Ende der Zeit.
Angenehm und ohne Sorgen war das Leben. Zu Besuch bei Freunden und Bekannten ging man. Kleinere Ausflüge wurden gemacht und manchmal begaben die beiden sich auch in die Oper oder zu einem Konzert. Der Himmel hing buchstäblich voller Geigen für sie. Gratias agamus Domino!
Der Engel beobachtete Sebastian immerzu, auf dass auch die geringste Fehlentwicklung sofort entdeckt und behoben werden könne. Da er feststellen musste, dass bei seinem Schützling eine gewisse Sättigung eingetreten war, sorgte er dafür, dass dieser erneut um eine sexuelle Erfahrung bereichert werde. Aus diesem Grunde suchte er sich einen langjährigen Bekannten seines Schützlings aus, damit er auch einmal das Außergewöhnliche eines solchen Ereignisses erfahre. Den fleischlichen Gelüsten erstmals mit einem ihm schon seit Jahren Vertrauten zu frönen, war Sebastian bis dahin völlig unbekannt.
Zuweilen kam Anton, der noch immer Jura studiert, zu Besuch. Er gehörte auch zu der Gruppe von ehemaligen Kommilitonen, die einst in dem Studentenhochhaus gewohnt hatten und mit denen Sebastian noch immer regelmäßige Kontakte unterhielt.
Seit einigen Jahren schon hatte Anton eine feste Freundin, die in ihrer Üppigkeit einer Rubens’schen Gestalt ähnelte. Sie zu malen, wäre für den flämischen Meister gewiss eine Lust gewesen.
Anton, inzwischen Student der Rechtswissenschaften im x-ten Semester, der eher dünn und lang war und seine füllige Gefährtin, die seit Jahren schon Pädagogik studierte, wohnten mittlerweile in einem kleinen Appartement. Da Antons Partnerin eine Schwäche für Tiere hatte, hielt sie in dieser Einzimmerwohnung ein schwarzes Kaninchen, zwei schwarzweiß gefleckte Meerschweinchen und drei weiße Mäuse. Zuweilen kriselte es in ihrer Beziehung, bis es dann zum endgültigen Bruch kam. Mit ihrem Kleinvieh verließ sie Anton von einem Tag auf den anderen und entschwand nach Frankreich. Einige Monate nach dieser abrupten Abreise, im Spätherbst, kam Anton, der ehemalige Zimmernachbar und einstige Benjamin, wieder zu Besuch. Sebastian und Maurits wohnten erst einige Wochen im neuen Heim.
Er litte noch immer unter dem Trennungsschmerz, sagte Anton.
Außerdem müsse er jetzt aus finanziellen Gründen als Busfahrer arbeiten. Er mache diesen Job an drei Abenden in der Woche und es reiche gerade aus, den Kopf über Wasser zu halten. Sein Studium wolle er aber unbedingt fortsetzen, und er habe vor, es in absehbarer Zeit auch zu einem guten Ende zu bringen. Sebastian hörte die Worte seines Gastes, ging aber weiter nicht darauf ein, da es ihm zwecklos und wenig hilfreich erschien, Anton mit Vorwürfen wegen der Studiendauer zu überhäufen. Schon zu oft war das geschehen, als dass es noch Sinn gehabt hätte.
Wie gewöhnlich bereitete Sebastian das Essen zu. Als Student schon hatte er die Kochkunst gründlich erlernt. Er liebte es, in den Töpfen herumzurühren und dabei daran zu denken, wie herrlich dem Gast die Köstlichkeiten schmecken würden. Wenn es briet und brutzelte war er in seinem Element. Der aromatische Duft der Gewürze breitete sich dann in der Wohnküche aus und in Sebastian stieg die Vorfreude auf das, was seinen Gaumen erwartete.
Jedes Mal ein großes Vergnügen war Sebastian das Zusammensein mit Anton, da dieser andächtig zuhören konnte. Sehr offenherzig war er Anton gegenüber. Im Laufe der Jahre hatte dieser schon vieles aus dem Leben von Sebastian erfahren. Von seiner Großmutter, von Jerusalem, von den Blue Ridge Mountains und von der Nacht in Amsterdam hatte Sebastian ihm erzählt. Immer interessiert hatte Anton zugehört und über dieses und jenes Fragen gestellt. An jenem kalten Herbstabend wurde wieder aus Sebastians Leben erzählt. Nach dem opulenten Mahl hatte Anton sich auf der Couch niedergelassen und lauschte diesen Geschichten. Nach einer Weile streckte er sich ganz auf dem Sofa aus. Während der Unterhaltung sagte er ganz unvermittelt, dass Sebastian ihm die Hose öffnen könne, wenn er Lust dazu verspüre. Unbekannt sei Männerliebe ihm nicht. Sebastian war dermaßen verblüfft aufgrund dieser völlig unerwarteten Aufforderung, dass er zunächst davon ausging, Anton erlaube sich einen deplatzierten Scherz. Aufrichtig aber meinte er es. Das vermittelten seine Augen. Die körperliche Erregung begann schlagartig bei Sebastian, weil Antons Vorschlag, ohne jegliche Vorwarnung, so plötzlich kam. Völlig überrumpelt war Sebastian. Er erhob sich aus seinem Sessel und setzte sich neben die Couch auf den Fußboden. Auf dem Rücken lag Anton und schaute ihn herausfordernd an. Den Hosenschlitz von Antons Hose knöpfte Sebastian mit leicht zitternden Fingern auf und holte den angenehm warmen Schwanz hervor. So aufregend war diese Handlung, dass es ihm fast den Atem verschlug. Nun lag dieser wohl geformte Schwanz so ganz nackt da. Anton schaute jetzt den innerlich aufgewühlten Sebastian milde und wohlwollend an. Wie ein unverdientes Geschenk kam Sebastian dieser entblößte Körperteil vor, den er zwar voller Vorfreude ausgepackt hatte, bei dem er aber noch leicht zögerte, ihn in Besitz zu nehmen. Irgendwie fühlte er sich schuldig, dieses jetzt ungeschützte Ding von seiner Umhüllung befreit zu haben. Die Jeans und den Slip, die noch in den Kniekehlen hingen, zog er Anton jetzt ganz aus. Den nicht erregten, aber wunderschönen, Schwanz betrachtete er, fasste ihn behutsam an, hob ihn nach vorne, in Richtung auf den Nabel, den dieser Samenspender mühelos erreichte. Jetzt konnte er die von einem rosafarbenen, prallen Säckchen verhüllten Hoden erahnen und einen Teil der Spalte und den Ansatz der viel versprechenden Arschbacken sehen. Zwischen die einladenden Schenkel ließ er die Hand gleiten und fühlte die angenehme Wärme. Seine Fingerkuppen spürten die sanft auffedernden Konturen dieser elastischen Öffnung, die geradewegs in das unendliche Land der schönsten Träume führte. Das Hauptportal der Kathedrale von Mailand! Würde ihm Einlass gewährt? Sebastian merkte wieder dieses Sensationelle, das er schon so oft empfunden hatte und das jedes Mal aufs Neue so aufputschend war. In der Spontaneität dieser Aufforderung lag das Faszinierende.
Sebastian bat den schmunzelnden Anton auf sein Zimmer, da Maurits zwischen zehn und elf von der Arbeit heimkommen würde. Ein Problem würde es zwar nicht sein, aber dennoch peinlich. Anton stand auf und ging zu dem angewiesenen Zimmer. Erstmals konnte Sebastian jetzt die volle Pracht dieses schön geformten Arsches bewundern. Fest war das Fleisch, weiß und unbehaart. Beim Gehen machte es leicht vibrierende Bewegungen. So verheißungsvoll war diese Spalte. Jerusalem und Agrigento rückten wieder in greifbare Nähe. In Sebastian stieg die Wollust unaufhörlich. Die honigsüßen Früchte des paradiesischen Baumes hatten ihre volle Reifheit erreicht. Der hemmungslose Sebastian drehte Anton auf den Bauch, spreizte ihm die prallen Arschbacken und sah dieses wundervolle Loch. Seinen Finger wollte er ein wenig hineinstecken, aber dieses Tor zum Garten Eden öffnete sich nicht. Es hätte erst eingefettet werden müssen. Während dieses Versuches des Eindringens merkte Sebastian bereits, dass es Anton äußerst unangenehm war. Ein anderes Indiz für die Peinlichkeit des Penetrierens war auch die Tatsache, dass Anton seinen Arsch nicht in die Höhe streckte, denn alleine dadurch schon wäre, fast automatisch, eine Spreizstellung erreicht worden. Ein weiterer Beweis für diese unerwünschte Situation lag eindeutig im leicht verärgerten Tonfall, der in Antons Bemerkung mitschwang. Vorwurfsvoll murmelte er, ob dies jetzt unbedingt nötig sei.
Sebastian erregte dies nur noch mehr, aber er hörte doch mit dem Eindringen auf, weil er Anton, den einstigen Benjamin des Kommilitonen-Teams, schon so lange kannte und ihn schonen wollte. Seine Freundschaft war Sebastian schon sehr wichtig. Auf den Rücken drehte sich Anton wieder und sein Schwanz war noch schlaffer als zuvor geworden. Zur Ejakulation kam Sebastian dann doch noch irgendwie, während Anton ganz deutlich angab, dass es ihm lieber sei, wenn es, so schnell wie möglich, vorbei wäre. Abschließend sagte er noch, dass er eigentlich froh darüber gewesen wäre, nicht zum Orgasmus gekommen zu sein. Dies alles störte Sebastian nicht so sehr. Er verzieh Anton diese Bemerkung. An diesem Sexualakt war das Aufregendste, das Unerwartete der Aufforderung zu Beginn. Sebastian und Anton besuchten einander weiter, aber jetzt, so wie früher, ohne Sex, obwohl noch immer etwas Erotik von Sebastians Seite zu spüren war.
Der Alltag begann wieder und die Arbeit als Lehrer ging weiter. Allmählich wurde es kälter und dann geschah es wieder, dass der nächtliche Glockenklang, wie seit uralten Zeiten schon, die Geburt des Herrn verkündete. Kurz darauf feierte man Silvester, mit allen guten Vorsätzen, die mit einem Jahreswechsel verbunden waren. Einige Wochen danach lugten schon die ersten Schneeglöckchen aus dem noch leicht befrorenen Boden hervor. Der Frühling ließ sein blaues Band wieder flattern und ein wenig später wirbelten abermals die prächtigen Schwalben durch die Lüfte, auf der Suche nach Futter für ihre neue Brut. Sebastian musste die Abschlussprüfungen für seine Studenten zusammenstellen.
Ein paar Monate vergingen und Sebastian korrigierte die Examen. Im September begann wieder das neue Semester.
Die Jahre zogen ins Land und Sebastian genoss seinen Beruf. Das Interesse, das die jungen Leute ihm und seinem Fach entgegenbrachten, tat ihm gut. Allerdings achtete er jetzt darauf, dass ihm genügend Freizeit blieb. Inzwischen war es ihm durch eine effizientere Einteilung der Zeit gelungen, sich des Berges von Papieren zu entledigen, die sich unmerklich, aber stetig angehäuft hatten. Sein Schreibtisch war jetzt aufgeräumt und lud zur Muße ein.
Im Deutschunterricht wurde von den Studenten erwartet, dass sie Referate schrieben und Vorträge hielten, in denen eine deutschsprachige Stadt behandelt werden musste.
Von Luzern und dem Provisorium Bonn erzählten sie. Über das geteilte Berlin referierten sie. Bewundernswert war es, wie sie sich mit diesen und anderen Städten des deutschen Sprachgebietes beschäftigten. Zur Zufriedenheit Sebastians hatten sie anscheinend gelernt, historische, kulturelle und touristische Aspekte so geschickt und folgerichtig miteinander zu verknüpfen, dass daraus ein harmonisches Ganzes wurde. Einige geistreiche Einlagen, an den richtigen Stellen platziert, verliehen dem Gesamten die notwendige Auflockerung.
In dieser Zeit der Ruhe und Beschaulichkeit, fing es dann im Osten plötzlich, aber nicht unerwartet an zu brodeln. Der Eiserne Vorhang zerriss. Die Betonmauern der Spaltung stürzten ein. Das Getöse war so gewaltig, dass selbst die Fundamente erschüttert wurden und auseinander brachen. Vieles von dem, was einst teuer und unverzichtbar erschien, wurde mit in den Abgrund gerissen. Nur ein Scherbenhaufen von zertrümmerten marxistischen Dogmen blieb übrig.
Der gesamte östliche Teil Europas befreite sich von dem Joch der Unterdrückung. Zu lange hatte man sich in Duldsamkeit geübt, als dass es noch länger zu ertragen gewesen wäre. Die Mauer in Berlin, die in fast dreißig Jahren zum Symbol gegensätzlicher Weltanschauungen geworden war, brach in sich zusammen. Dieser ungezügelten Kraft der Erneuerung hatte sie nicht standhalten können. Die Menschen taumelten freudetrunken einer unbekannten Freiheit entgegen, die ihnen noch so viel Leid und Tränen bringen sollte.
Sebastian konnte alles nur aus der Ferne miterleben. Seine Studenten fragten ihn, wie er sich diese abrupte Veränderung erkläre. Er, der Lehrer, wusste keine Antwort. Schneller als er es je hätte erahnen können, ging der Umbruch vor sich. Berlin, die Stadt, in der er vor achtzehn Jahren den realen Sozialismus, wenige Stunden nur, erlebt hatte, war im Begriffe, sich neu zu orientieren. Sebastians Überlegungen von damals in Bezug auf den Status dieser Stadt, hatten sich als falsch und unausgereift erwiesen. Spätestens jetzt stand fest, dass der kommunistisch geprägte Sozialismus eine Fehlentwicklung war. Auch Sebastian musste das einsehen, obwohl es ihm schwer fiel, denn er hatte insgeheim immer mit der Marx’schen Theorie sympathisiert, deren Umsetzung in die Praxis solche großen Schwierigkeiten bereitete. Dieser schöne Traum von der klassenlosen Gesellschaft war nun endgültig zerronnen. Die angestrebte Gleichheit war erneut zu einer Utopie geworden.
Die DDR war erloschen und Berlin war wieder zur gesamtdeutschen Hauptstadt aufgestiegen. Wie ein Phönix aus der Asche schwang sie sich empor, um erneut in dem Glanze zu erstrahlen, den sie einst besessen und den der Bombenhagel ihr fünfundvierzig Jahre zuvor so unvorbereitet genommen hatte.
Sebastian ahnte, dass auch einmal der Tag kommen würde, an dem der letzte deutsche Kaiser, von dem kleinen, verträumten Doorn aus, wieder nach Charlottenburg zurückkehrte. Genauso wie Napoleon, der letztendlich von St. Helena nach Paris überführt wurde, um im Dôme des Invalides beigesetzt zu werden, würde auch er, der Kaiser, an die Spree heimkehren, um zu seinen Ahnen gebettet zu werden. Nofretete, die Königin des Nils, würde dort über ihn wachen.
Diese hektischen Monate des Umbruchs gingen wie im Fluge dahin. Im Frühling, Sebastian war gerade einundvierzig geworden, wurde seinem Gefährten, dem klugen Maurits, der sich im Laufe der Jahre zu einem prächtigen Bürohengst und einem einfühlsamen Liebhaber entwickelt hatte, ein neues Arbeitsfeld bei der Bank zugewiesen. Nachdem zum wiederholten Male reorganisiert und rationalisiert worden war, landete Maurits im EDV-Bereich. Zum Einsatz kam er dann, wenn einer der vielen Computer verrückt spielte. Manchmal berichtete Maurits von Vorfällen an seinem neuen Arbeitsplatz. Nicht die Hard- oder Software seien die Bösewichte, die zuweilen Störungen verursachten, sondern die Mitarbeiter, die sich ihrer bedienten. Die Kenntnisse der elektronischen Datenverarbeitung seien mitunter erschreckend gering. Sie pumpten mithilfe der Programme die Festplatten so voll, dass es unweigerlich zum völligen Kollaps des Systems kommen müsse. Wenn wieder einmal etwas aus unerklärlichen Gründen von der Festplatte oder Diskette verschwunden sei, komme es gelegentlich zu hysterischen Wutanfällen, wobei ganze Tastaturen zu Bruch gingen. Diese Anzeichen der Ohnmacht konnten Maurits nicht erschüttern, denn er besaß ein heiteres Gemüt. Zudem profitierte er noch von der günstigeren gleitenden Arbeitszeit. Nicht mehr vom Spätnachmittag bis in die Nacht, sondern tagsüber konnte er jetzt seinem Job nachgehen. Maurits gewöhnte sich rasch an sein neues Umfeld und bereits schnell stieg er auf der Karriere-Leiter. Zum Koordinator wurde er befördert und genoss die neue Position. Die Betreuung der Computer-Ohnmächtigen überließ er jetzt anderen. Diese Verzweifelten blieben zurück und suchten weiter nach gelöschten Speichern, ohne begreifen zu wollen, dass der elektrische Impuls, der durch nur einen einzigen falschen Knopfdruck ausgelöst wurde, schon längst die Mühen vieler Stunden und Tage zunichte gemacht hatte.
Ein Jahr später begann es an jener Fachhochschule in Den Haag, an der Sebastian unterrichtete, zu kriseln. Mit einem Male gingen die Studentenzahlen im Fach Deutsch drastisch zurück. Einige Monate später, im September, zu Anfang des Wintersemesters, hatte Sebastian nur noch zehn Unterrichtsstunden je Woche; Tendenz sinkend! Er sah sich schon als Arbeitsloser durchs Leben gehen. Der Gedanke daran war ihm unerträglich. In Holland gab es, wie in fast allen europäischen Ländern, einen gewaltigen Lehrerüberschuss. Das Schwert von Damokles schwebte über ihm.
14. Kapitel
Der Engel war sich Sebastians miserabler Lage bewusst und schickte ihn deswegen auf eine Pilgerreise nach Südfrankreich, damit er dort die Verhältnismäßigkeit so mancher Dinge einsehe. Darüber hinaus sollte er in seinem Glauben gestärkt und seiner Frömmigkeit gefestigt werden.
Zunächst plante Sebastian, der jetzt wöchentlich nur noch zehn Stunden als Dozent arbeitete, eine Wallfahrt, um seine Religiosität neu zu beleben. Außerdem war er der Meinung, dass ihm eine solche Reise Erleichterung bringe, damit er seine schlechten beruflichen Aussichten besser ertrage. Ihm und Maurits, der ihn begleiten sollte, standen zehn Tage zur Verfügung und der Zielort war Lourdes, am Rande der Pyrenäen.
Eine Pilgerfahrt neuen Stils sollte es werden. Man ging also nicht mehr zu Fuß, dazu hätte die Zeit nicht gereicht, sondern bediente sich der modernen öffentlichen Verkehrsmittel. Ab und zu hörte man, dass es immer noch Menschen gäbe, die per pedes apostolorum nach Rom oder Santiago de Compostella pilgerten. Aber schon der Gedanke an eine solche Wanderung, die sich über Monate hinziehen würde, stimmte Sebastian missmutig. Außerdem hätte er dann alleine ziehen müssen, denn Maurits liebte seinen Job bei der Bank und dort gab es nur eine begrenzte Anzahl von Urlaubstagen. Die Pilgerfahrt sollte über Paris, Bordeaux und Biarritz nach Lourdes, dem Wallfahrtsziel, führen. Zurück hatte Sebastian die Route über Carcassonne und Avignon gewählt.
Im Herbst brachen sie dann tatsächlich auf, um in diesen Ort zu reisen, wo Anno Domini MDCCCLVIII, zum ersten Mal, die Mutter Maria diesem Bauernmädchen in einer Grotte erschienen war.
Sebastian war auch ein Bauernkind gewesen und konnte sich sehr wohl vorstellen, dass auf so einem Hof, zwischen duftendem Heu und knisterndem Stroh, im dornigen Gebüsch oder auf den Wiesen mit den wilden Blumen in den schönsten Farben, eine Erscheinung stattgefunden haben könnte. Schließlich hatten Sebastian und Maria in jenen fernen Tagen, in den fünfziger Jahren, auch ihren König und ihre Offenbarungen gehabt, die vom Engel vorbestimmt waren.
Die beiden nahmen den Zug nach Amsterdam und dort das Flugzeug nach Roissy-en-France. Sebastian erinnerte sich wieder an Kiyoko, deren Charakterzüge die des bedachtsamen Maurits' so ähnlich waren. In Paris blieben sie zwei Tage. Den Eiffelturm betrachtete Sebastian aus der Ferne nur. Seit jenem denkwürdigen Tag im Herbst, vor fast vierundzwanzig Jahren, hatte er diesen stählernen Giganten nie wieder bestiegen. Den Parisern war er Wahrzeichen und Sebastian überdimensionales Mahnmal.
Erneut stattete er dem Louvre einen Besuch ab und wieder stand er vor der ihm so vertrauten, schon fast fünfhundert Jahre lang geheimnisvoll vor sich hin lächelnden Mona Lisa. Des Weiteren besichtigten Sebastian und Maurits diesmal auch die Basilika Notre-Dame. Diese beeindruckende Kathedrale auf der Ile de la Cité, die schon seit beinahe tausend Jahren, wie ein Fels in der Brandung, Paris beschützte und seinen Bewohnern immer wieder neue Hoffnung gab. Die Erwartung stieg in Sebastian. Vom Gare de Montparnasse nahm man den TGV nach Bordeaux. Zum ersten Mal saß Sebastian in solch einem modernen Zug. Äußerst komfortabel war die Reise. In etwa drei Stunden erreichten sie Bordeaux, diese rötliche Stadt, bei der man immerfort nur an Wein denken musste. Die mächtigen Brücken über die Garonne bewunderten sie. Die Stadt wirkte ruhig und behäbig, genauso wie der Fluss, an dem sie lag. Von Bordeaux ging die Reise weiter nach Biarritz, dem alten Touristenzentrum am Atlantik. Dort sahen sie die stürmisch- aufgewühlte See. Dieses aufschäumende Wasser und die salzige Luft ließen Sebastian erschaudern. Dermaßen hügelig war die Stadt, dass man fortwährend das Gefühl hatte, einen Berg zu erklimmen. Außerdem hatte sie etwas Aufpeitschendes, das durch die wilde Kraft des Meeres noch unterstützt und verstärkt wurde.
Von Biarritz ging es weiter nach Lourdes, dem Ziel dieser Pilgerreise. Am späten Vormittag des sechsten Reisetages erreichte der Zug die Stadt Lourdes, am Fuße der Pyrenäen. Der Wallfahrtsort selbst lag im Tal, an einem Fluss. Am Berghang befand sich der Bahnhof. Vom Zug aus konnte man schon, inmitten der Wiesen und Wälder, den spitzen Turm der Basilika sehen. Ganz schwindlig, vor lauter Aufregung, wurde dem sich nach Mystischem sehnenden Sebastian. An dem Ort war er jetzt, wo die Muttergottes, vor über hundert Jahren, diesem Bauernmädchen mehr als ein Dutzend Mal in einer Grotte in der Nähe des Baches, den man Gave de Pau nannte, erschienen war.
Sebastian und Maurits gaben ihre Rucksäcke in der Gepäckaufbewahrung ab und schritten hinunter ins Tal. Es war kurz vor Mittag und schon sehr viele Pilger waren in der Stadt. Auf dem Weg zur Grotte sahen sie eine große Anzahl von Andenkenläden mit allerlei religiösem Kitsch. In allen Formaten gab es die Heilige Jungfrau. Für Sebastian war dies aber nicht abschreckend, denn er hatte schließlich auch Bethlehem gesehen. Man kam zum Eingang des großen Parks, in dessen Mitte die dreifach übereinandergebauten Kirchen das Zentrum bildeten. Jetzt erst konnte er in vollem Umfange die riesige Anzahl der Pilger wahrnehmen. Viele von ihnen waren ältere Frauen und körperlich Behinderte. Die Sensation steigerte sich, als er mit Maurits durch den Park schritt. Als er dann die Treppen zur Oberkirche hinaufging, musste er vor lauter Erregung seine Tränen unterdrücken. Am Ziel seiner Pilgerreise war er, umgeben von einer großen Menschenmenge, aus deren Augen die Verklärtheit strahlte. Das Gefühl, endlich angekommen zu sein, war überwältigend. Alles um ihn herum versank. Einen Klimax der Glückseligkeit, einen religiösen Rausch, erlebte er, dort in Frankreich, am Rande der Pyrenäen.
Nachdem Sebastian sich wieder etwas gefasst hatte, besuchte man noch schnell diese Grotte von Massabielle, die eher wie ein Stück überhängender Fels aussah. Sebastian und Maurits machten sich wieder auf den Rückweg. In der Ferne hörten sie noch den Anfang des Ave-Maria.
Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, da Sebastian wieder etwas wohlwollender an seine Mutter zurückdenken konnte. Dies alles geschah am sechsten Tag der Pilgerreise. Erschöpft war Sebastian. Völlig ausgelaugt kam er sich vor. Jetzt konnte er sich besser in die bäuerliche Jungfrau Bernadette hineinversetzen, die ja, achtzehnmal hintereinander, in vollkommene Ekstase geraten war. Dass sie so früh gestorben war, konnte Sebastian gut verstehen. An die Nacht seiner eigenen Ekstase, in Amsterdam, dachte er zurück. Welche Kraft solch eine Trance erforderte, wusste er nur allzu genau.
Mater intemerata, Sancta Virgo virginum, ora pro nobis.
Man begab sich wieder langsamen Schrittes hinauf zum Bahnhof von Lourdes. Unterwegs schaute Sebastian noch einmal zurück in dieses grüne Tal, das so vielen Entrechteten, Leidenden, Beladenen und Verzweifelten die verlorene Hoffnung wiedergegeben hatte. Einmal würde auch Sebastian vielleicht nach Nevers, an die Ufer der Loire, in jenes Kloster der Schwestern der Charité, reisen. Dort ruhte die arme, kleine, heilige, schwindsüchtige und zigmal in Ekstase geratene Bernadette seit nunmehr einhundertdreizehn Jahren; davon die letzten siebenundsiebzig in einem gläsernen Sarg, wie das scheintote Schneewittchen im Märchen. Der heilige Gildas erbarme sich ihrer.
Die beiden Freunde reisten weiter nach Carcassonne. Die Altstadt auf dem Hügel, die das Aussehen einer stark befestigten Burg hatte, wurde besichtigt. Am nächsten Tag fuhren sie nach Avignon. Dort bewunderten sie den mächtigen Palast der Päpste, den diese vor Jahrhunderten schon verlassen hatten. Vom Obergeschoss aus sah man die gemächlich dahinfließende Rhône mit der verstümmelten Brücke, die nichts mehr miteinander zu verbinden hatte. Seit dreihundertvierundzwanzig Jahren schon fristete sie ihr unnützes Dasein als romantische Ruine, um den Touristen zu verkünden, dass sie einmal die beiden Ufer verbunden hatte. Am darauf folgenden Tag ging es im Eiltempo nach Paris und am zehnten Tag, mit dem Flieger, zurück nach Amsterdam.
Sebastian musste wieder arbeiten und pendelte zweimal wöchentlich zwischen Utrecht und Den Haag hin und her. Die zehn Unterrichtsstunden lasteten ihn nicht aus.
Der Engel, der die fast ausweglose Situation seines Schützlings ganz genau beobachtete, war inzwischen zu dem weisen Entschluss gekommen, eine eingreifende Veränderung herbeizuführen. Aufgrund dessen schickte er Sebastian auf eine Weltreise, damit dieser auf andere Gedanken komme. Wenigstens einmal nur solle es ihm vergönnt sein, diesen Blauen Planeten in seiner vollen Pracht an sich vorüberziehen zu sehen. Dies solle ihm zuteil werden, auf dass die drohende Arbeitslosigkeit, die sein Schützling selbst schon schwach erahnte, etwas erträglicher werde.
In jenen Tagen grübelte Sebastian immer häufiger über seine verzwickte Lage. Beruflich war er weit unterfordert und er dachte darüber nach, wie er seine Freizeit sinnvoll gestalten könne. Manchmal stellte er sich vor, wie es wäre, wenn man auf einer Südsee-Insel leben würde. Die abenteuerlichen Geschichten von James Cook kannte er. Vor mehr als zweihundert Jahren hatte dieser berühmte englische Kapitän schon Tahiti, Neuseeland und Ostaustralien bereist, bis er dann, im Februar Anno Domini MDCCLXXIX, auf der Insel Hawaii von Einheimischen erschlagen wurde.
Ende November stand Sebastians Entschluss fest. Eine Weltrundreise sollte es sein. Immerfort nach Osten zu reisen, um dann aus dem Westen her kommend wieder den Ausgangspunkt zu erreichen, schien ihm eine grandiose Idee. Das Ende würde der Anfang sein; ein fast utopischer Gedanke. Schon die bloße Vorstellung an diese Erdumrundung machte ihn schwindlig. Sebastian unterrichtete seinen Gefährten Maurits über sein Vorhaben. Überrascht war dieser, stimmte aber, nach anfänglichem Zögern, zu. Sebastian war bei den Vorbereitungen freie Hand gelassen. In Sachen Reiseplanung hatte er ja schon relevante Erfahrungen gesammelt. Nur Einschränkungen bei der Dauer und den Kosten der Reise machte Maurits. Außerdem wollte er nicht nach Afrika, Japan, Russland und Indonesien. Er war der Auffassung, dass es auf dem schwarzen Kontinent zu viele Bettler gäbe. Das fernöstliche Nippon wollte er, wegen der Sprache, nicht besuchen. Das ehemalige Zarenreich käme nicht in Betracht, weil dieses Land sich noch immer im Umbruch befände. Die smaragdgrünen Sundainseln schließlich fielen weg, weil die Mutter von Maurits dort während des Zweiten Weltkrieges mehr als drei Jahre in einem japanischen Konzentrationslager auf Java interniert war. Die Reisedauer sollte vier Wochen und die Gesamtkosten den Betrag von vierzehntausendvierhundert Gulden nicht überschreiten. Voller Vorfreude machte sich Sebastian an die Arbeit. Die drohende Arbeitslosigkeit vergaß er. Nach vielen Briefen und Telefonaten war dann im Frühling, Sebastian war just dreiundvierzig geworden, alles geregelt. Die Hotels und YMCAs hatte Sebastian selbst gebucht. Ein Londoner Reisebüro hatte er für die Flugtickets eingeschaltet, weil es dort billiger als in Holland war.
Kalendermäßig betrug die Reisedauer dreiundzwanzig und tatsächlich vierundzwanzig Tage. Auf zwölftausendsechshundert Gulden beliefen sich letztlich die Gesamtkosten. Maurits war einverstanden. Für den neunundzwanzigsten Juni war der Reiseanfang geplant. Einige Wochen zuvor wurde Sebastian arbeitslos, was er eigentlich schon erahnt hatte. Trotzdem traf es ihn hart. Dreiundvierzig war er jetzt und ohne Job. Maurits tröstete den verzweifelten Sebastian.
Der Engel schaute zu und wusste, dass die Weltreise seinen Schützling ablenken würde.
In das Heer der Arbeitslosen, das Europa schon seit Jahren überflutete, reihte sich Sebastian also ein. Die Perspektivlosigkeit, die durch die stetig steigende Quote der Erwerbslosen nur noch verstärkt wurde, machte ihn depressiv. Aber der Gedanke an die bereits fertig geplante Weltreise richtete ihn wieder auf.
Am Morgen des neunundzwanzigsten Juni begaben sich Sebastian und Maurits, der verträgliche und so verständnisvolle, mit ihren Rucksäcken bepackt zum Flughafen Schiphol. Jetzt, auf dem Weg in die Ferne, zu diesen exotischen Orten, von denen er als Kind immer schon geträumt hatte, überkam Sebastian der Wunsch, seinem Gefährten Maurits ewige Treue zu schwören. Aber er tat es nicht, wusste der doch um den leeren Wahn dieser Worte. Es war ein zu schönes Klischee, als dass es jemals Wahrheit werden könnte. Nur im Rausch oder in Märchen und Liedern hatte es seine Daseinsberechtigung. Dann durfte man sich an diesen Schwüren der immer währenden Treue ergötzen, genauso wie das vertrauensselige Ännchen aus Tharau es getan hatte, von dem Sebastians Mutter einst sang.
In einer euphorischen Stimmung verkehrte Sebastian. Ein Gefühl fast grenzenloser Freiheit bemächtigte sich seiner. Über weite Ozeane und unbekannte Länder würde er schweben und die ganze Welt in ihrer Schönheit sehen.
Mit einer BA-Maschine ging es nach Heathrow. Dort stieg man um.
Am folgenden Morgen landete ihr Flugzeug, nach dreizehnstündigem Flug, in Hongkong. Fürchterlich warm, feucht und schwül war es in dieser brausenden Stadt am südchinesischen Meer. Hier, am Rande der Tropen, lagen die Temperaturen bei dreißig Grad. Nach wenigen Minuten schon triefte Sebastian der Schweiß von der Stirn. Ebenso erging es Maurits. Das Wasser drang aus allen Poren. Sebastian empfand dieses Schwitzen als wohl tuend und reinigend. Dass es ihn befreite und erleichterte, spürte er. So manches, was ihn in den letzten Wochen bedrückt hatte, wurde aus ihm herausgeschwemmt und stieg als Dampf in den wolkenschwangeren asiatischen Himmel. In Mongkok, einem Stadtviertel im unmittelbaren Einzugsbereich der "Goldenen Meile", dieser Straße des Überflusses, trafen beide am frühen Nachmittag ein. In diesem dicht bevölkerten Stadtteil, der den Anschein erweckte, schon zu überfüllt zu sein, als dass er auch nur einen einzigen Menschen zusätzlich aufnehmen könne, befand sich das gebuchte Hotel. Ein kleines Zimmer mit Klimaanlage bekamen sie zugewiesen. Das Thermostat, das man nicht selbst regeln konnte, war viel zu kalt eingestellt. Aber als kleinen Luxus gab es ein winziges Badezimmer, was diese kleine Unzulänglichkeit wieder wettmachte. Sebastian befand sich jetzt im Reich der Mitte und eine nicht perfekt funktionierende Airconditioning konnte seiner Freude darüber keinen Abbruch tun. Schon der bloße Gedanke daran, so weit weg von Holland zu sein, berauschte seine Sinne.
Englisch, obwohl auch eine offizielle Landessprache, wurde von den meisten Hongkong-Chinesen nur mäßig gesprochen, wodurch es zuweilen zu Verständigungsschwierigkeiten kam. In dieser Millionenstadt war immer alles überfüllt. Gehsteige dienten als Vergrößerung der Werkstatt. Überall wurde geklopft und gehämmert oder irgendetwas verkauft. Das Mobiltelefon, dieser netzunabhängige Funkfernsprecher namens Handy, gehörte genauso zum Straßenbild wie die enormen Leuchtreklamen, die diese Metropole abends in gleißendes Licht tauchten, auf dass sie wie ein gigantischer Diamant in der fernöstlichen Nacht erstrahle. Die öffentlichen Verkehrsmittel, wie U-Bahnen, Züge und Busse funktionierten sehr effizient. Ein Vergleich mit London drängte sich unwillkürlich auf. Dort hatte Sebastian vor vielen Jahren zum ersten Mal eine U-Bahn gesehen und war davon begeistert. Hier in Hongkong hatte er das Gefühl, dass dieses unterirdische Beförderungsmittel fast eine Kopie der Londoner "Tube" war. Wegen der Masse der Fahrgäste aber waren mehr Stehplätze vorhanden und gab es keine Trennwände zwischen den einzelnen Wagen. Wie ein versilberter Lindwurm schlängelte sich dieses schnelle Gefährt geräuschlos durch das Erdreich.
Am zweiten Tag ihres Aufenthaltes fuhren die beiden von Mongkok mit dieser U-Bahn zur Insel Hongkong. Dort gab es vor allem die modernen und oft architektonisch sehr schönen Bankgebäude. Mit der "Peak Tram" fuhr man hinauf auf den Victoria-Gipfel. Eine wunderschöne Aussicht auf Kaulun bot sich ihnen dar. Nachmittags begaben sie sich mit dem Bus über die grünen Hügel zur Repulse Bay. Dort am Strand zogen sie sich aus und schwammen im Meer. Die Abkühlung, die das Wasser ihnen verschaffte, war zwar nur gering, aber doch sehr angenehm. Touristen gab es fast überhaupt keine und schon gar keine Chinesen, denn die arbeiteten immer und gönnten sich keine Freizeit. Vor der Küste lagen einige kleine bewaldete Inseln.
Sie fuhren am dritten Tag mit dem Zug nach Sha Tin. Auf einem Berg befand sich dort das Kloster der zehntausend Buddhas. Über einen schmalen Pfad gelangte man, über Treppen, dorthin. In einem großen, hallenartigen Steingebäude befanden sich an den fensterlosen Wänden dutzende von Regalen voller dickbäuchiger Buddhas in allen Formaten. Kleine, mittlere und riesige Stein-, Ton- und Porzellanfiguren konnte man bewundern. Die meisten Figuren waren bunt bemalt. Manche aber waren auch gänzlich weiß. Draußen, auf dem Vorplatz, gab es diese kolossalen Buddhas, die mehr als vier Meter hoch waren. Eine Devise im buddhistischen Kult lautete: Je mehr, desto besser. Ob es wirklich zehntausend Statuen waren, konnte Sebastian nicht feststellen. Das war eigentlich auch unwichtig, denn die Reinkarnation, die mit dem Buddhismus untrennbar verbunden war und von der er einst im Kolleg in Neuss so viel gehört hatte, war eine wunderbare Lehre, an die es sich zu glauben lohnte. Man wurde fast unendlich oft wieder geboren, bis man das Nirwana, die vollkommene Übereinstimmung mit der Natur und die absolute Ruhe, erreichte. Bei diesem Gedanken war die Vorstellung vom Tod einer Einzelperson nicht mehr etwas Beängstigendes und Furchterregendes, sondern eine ungeheuerliche Erleichterung und große Befreiung, da man noch unzählige Male eine neue Chance bekommen würde, sein Leben derart zu gestalten, dass es im Einklang mit einem selbst war. Wahrscheinlich deswegen gab es die vielen figürlichen Abbildungen von Buddha, der den Menschen diese große Hoffnung gab.
Am Nachmittag machten Sebastian und Maurits einen Trip mit der berühmten, doppelstöckigen Straßenbahn. Dieses ratternde, liebenswerte, anachronistische Ungetüm überquerte die gesamte Insel Hongkong innerhalb von sechzig Minuten. Mitunter fiel Sebastian in Schlaf, da die Monotonie des Fahrens ihn ermüdete. Am Abreisetag fuhren sie zum Flughafen Kai-Tak, der sich im Zentrum von Hongkong oder genauer gesagt am Hafen von Kaulun befand, das eigentlich zum chinesischen Festland gehörte. Sebastian dachte an die Zukunft von Hongkong. In achtundvierzig Monaten würde diese fernöstliche Metropole wieder an China fallen. Der Pachtvertrag der Briten wäre dann ausgelaufen. Hoffentlich würde diese Kronkolonie der Engländer so bleiben, wie Sebastian und Maurits sie erleben durften. Die beiden hatten diese wunderbare, leuchtende und glitzernde Stadt mit ihrem Übermaß an Neonlichtern als eine Weltmetropole erfahren, in der man sich sicher fühlte. Überaus diszipliniert waren die Menschen und wie Chinesen eben sind sehr sachlich. Dass das höfliche, chinesische Lächeln in keiner Weise mit demjenigen der Pariser Mona Lisa vergleichbar war, konnte Sebastian jetzt ohne weiteres feststellen.
Über Bangkok, diese Stadt der Engel, die ihnen lediglich als Ort des Umsteigens diente, flog man nach Australien. Am frühen Morgen des vierten Juli kamen Sebastian und Maurits, völlig erschöpft, auf dem Kingsford Smith Airport an.
In Sydney war es Winter. Das Thermometer zeigte zehn Grad. Kahl waren die Laubbäume. Die Sonne schien blass und es war unbewölkt. Dieser Temperaturumschwung war eine willkommene Abwechslung. Das Hotel, in dem sie abstiegen, war eine Art Jugendherberge, aber anstelle der sonst üblichen kasernenmäßigen Schlafsäle waren Einzel- und Doppelzimmer vorhanden. Die Atmosphäre in Sydney, dieser größten und ältesten australischen Stadt, empfand Sebastian als angenehm. Außergewöhnlich schöne Parks mit prächtigen, alten Bäumen sah er. Tagsüber erwärmte sich die Luft doch noch auf fünfzehn Grad.
Sebastian und sein Begleiter waren am anderen Ende der Welt.
Schon der bloße Gedanke daran, war eine unglaubliche Sensation! An ihrem zweiten Tag in Sydney gingen sie zu Fuß nach Darling Harbour zum Frühstücken. Dort gab es Restaurants, Snackbars und Imbissstuben in Hülle und Fülle. Schier unerschöpflich war die Auswahl an Essenswaren und die Bedienung die Freundlichkeit selbst. Im Laufe des Nachmittags bedeckten jetzt graue Wolken den ostaustralischen Himmel.
Mit dem Vorortzug fuhren sie, am dritten Tag, nach Parramatta und der Regen setzte ein. In Parramatta wollten Sebastian und Maurits noch so viel besichtigen, aber leider fiel alles buchstäblich ins Wasser.
Am darauf folgenden Tag war es wieder trocken. Man besichtigte die Elisabeth-Bai mit dem nostalgischen "Elizabeth Bay House".
hatte eine ovale Form und war aus Stein. Von hier hatte man eine wunderschöne Aussicht über die Bucht. Abends schauten sie sich Lloyd Webbers Pop-Oratorium "Joseph and the amazing technicolor dreamcoat" an. In diesem Musical, das vor über zwanzig entstanden war, wurde die biblische Geschichte von Joseph in Ägypten besungen. Das Alte Testament wurde wieder zu neuem, strahlendem Leben erweckt. Joseph, der standhafte Sohn Jakobs, musste aufgrund seiner Träume viel Leid über sich ergehen lassen. Erst wurde er von seinen Brüdern verkauft und dann in Ägypten, wegen seines Sexappeal, von Potiphars Frau falscher Beschuldigungen ausgesetzt und deswegen in den Kerker geworfen. Joseph aber begehrte nicht auf, sondern fügte sich seinem schweren Schicksal.
Durch Traumdeuterei wurde ihm die Freiheit wiedergeschenkt und schließlich brachte er es am Hofe des Pharaos zu ansehnlichem Reichtum und großer Macht.
Die farbenprächtigen Kostüme waren eine Lust für das Auge. Die poppige Musik und der melodische Gesang begeisterten Sebastian. In Australien träumte Sebastian vom Land am Nil. Aber seine Träume waren so anders als diejenigen Josephs. Würde es jemals geschehen, dass sie dennoch eine fruchtbare Symbiose miteinander eingingen, oder waren die Ersteren nur Schimären, deren Daseinsberechtigung lediglich darin lag, diesen Prophezeiungen, die im Buch der Bücher aufgezeichnet waren, noch mehr Nachdruck zu verleihen? War der Wahnsinnige dem Genius ein Bruder oder erschlug einer den anderen, wie der habgierige Kain den unschuldigen Abel?
Am nächsten Tag regnete es ununterbrochen. Auf dass ihnen dieses trübe Wetter nicht die gute Laune verderbe, gingen Sebastian und Maurits ins Kino. Irgendeinen rezenten, amerikanischen Weihnachtsfilm schauten sie sich an, der so aalglatt und nichts sagend war, dass es einem die Freude am Kino schier hätte vergällen können. Bereits während der Vorführung des tränenfeuchten Streifens, hatte Sebastian fortwährend das merkwürdige Gefühl, er stehle jemandem die Zeit. Der Dauerregen aber entschuldigte vieles, sogar den Umstand, den Tag mit solchen Nichtigkeiten zu vergeuden. Wenn schon nicht die Augen, so blieben doch wenigstens die Füße trocken.
Die Abende verbrachten sie in der Oxford Street. Dort gab es neben modiösen Geschäften und glitzernden Diskotheken diese behaglichen Kneipen, in denen Sebastian sich so wohl fühlte. Er und sein Lover sahen die schönen, australischen Jünglinge, die wahrscheinlich von Amsterdam, New York oder San Francisco träumten.
Auch der letzte Tag in Sydney war regnerisch. Erleichtert, dem unangenehm nassen Wetter den Rücken zukehren zu können, flog man nach Neuseeland weiter. Dass es weder auf der Nord- noch auf der Südinsel Schwalben gebe, sagte man. Diese schönen Frühlingsboten würden niemals nach Auckland kommen. Fern der Heimat war Sebastian und auf dem Weg in ein schwalbenloses Land. Manchmal noch kam ihm jene tote Schwalbe in den Sinn, die einst ihr Leben lassen musste, weil die Vorsehung es gebot.
Am Spätnachmittag landeten sie auf dem Mangere Airport. Ziemlich kalt war es. Nachts sank die Temperatur bis in die Nähe des Gefrierpunktes.
Mit Sonnenschein begann der zweite Tag in Auckland. Stahlblau war der Himmel und bis auf sechzehn Grad stieg die Quecksilbersäule. Aber trotz alledem machte diese Stadt einen ungemütlichen Eindruck. Etwas Kaltes, Unwirtliches strahlte sie aus. Breite Straßen gab es und irgendwie musste Sebastian an die USA denken, wo ja auch die Autos das wichtigste innerstädtische Beförderungsmittel waren.
In Parnell Village aßen sie zu Abend. Den Wein musste man selbst in die Pizzeria mitnehmen. Obwohl es im Restaurant sehr kalt war, hatte es dennoch ein angenehmes Ambiente. Alle Gäste, genauso wie Sebastian und Maurits, hatten eine Weinflasche im Arm. Es sah so merkwürdig und komisch aus. In Holland oder Deutschland wäre es unvorstellbar, dass man erst in einen Spirituosen-Laden gehen musste und dann mit dem gekauften Alkohol in die Gaststätte. Aber einen großen Vorteil hatte diese eigentümliche Sitte schon, denn dadurch wurde das Essen um ein Vielfaches billiger. In dieser Hinsicht war es also für Budget-Traveller vorteilhaft und auch hatte man seinen Spaß beim Einkaufen der Weinflaschen.
Was in Auckland vor allem auffiel, waren die außergewöhnlich dicken Maoris, die Ureinwohner von Neuseeland. Teilweise waren sie unvorstellbar korpulent. Manchmal hatte die Körperfülle solch einen extremen Umfang, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, dass es beinahe wieder ein ästhetischer Anblick war. Sebastian genoss die fülligen Leiber dieser Menschen. Man konnte sich vorstellen, dass sie einen vollkommen hätten trösten können, wenn sie einen in die Arme schlössen. Das warme, einladende Fleisch würde einen ganz und gar aufnehmen und beschützen können. Wenn man die Hongkong-Chinesen mit diesen Maoris verglich, sah man, vor allem im Bereich der Augen, doch eine große Ähnlichkeit. Auch die Hautfarbe war ungefähr die Gleiche. Der große Unterschied bestand hauptsächlich in der immensen Körpermasse, die Sebastian so liebte. Manchmal stellte er sich vor, wie es wäre, wenn er auf einem solchen Maori liegen würde. Versänke man dann in die Unendlichkeit des Universums?
Mit der Besichtigung des "Alberton Cottage" begann der dritte Tag. Ein altes Holzhaus aus der englischen Kolonialzeit war es. Nichts Sehenswertes gab es darin zu besichtigen. Das Gebäude selbst hatte auch nichts Beeindruckendes.
Eine große Überraschung dahingegen barg der vierte Tag in dieser größten, neuseeländischen Stadt, am anderen Ende der Welt. Dieses Wunder der Natur hieß "One Tree Hill". Es war ein sehr weitläufiger Park auf einem Hügel vulkanischen Ursprungs. Leicht nebelig war der Morgen. Langsam lösten sich die Nebelschwaden auf und Sebastian konnte die volle Pracht der riesigen, uralten Bäume und die beeindruckende Landschaft bewundern. In diesem Park, in Auckland, erfasste ihn ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Wenn das Paradies hätte dargestellt werden müssen, dann hätte man schon den Prototyp hier zur Hand. Von Auckland führte die Reise weiter nach Honolulu, zur Hauptstadt des ehemaligen Königreiches von Hawaii, mitten im Pazifik.
Diesen Tag, den zwölften Juli, erlebten die beiden, wegen der Datumsgrenze, zweimal. Vom Flughafen fuhren sie in die Stadt zum Waikiki-Strand. Das Wetter war jetzt hochsommerlich warm. Für Sebastian und Maurits war dieses Klima wohl tuend, nach der nächtlichen Kälte von Auckland. Zum YMCA begaben sie sich, wo sie bereits ein Doppelzimmer reserviert hatten.
Die beiden Weltenbummler begaben sich am zweiten Tag ihres Aufenthaltes ins Zentrum von Honolulu. Den Iolani-Palast betrachteten sie dort, mit der halb nackten Statue des Königs Kamehameha I. davor, als er noch ein stattlicher Bursche war.
Erst Anno Domini MDCCCXIX gab er in Kailua, einem kleinen Ort auf der größten Hawaiiinsel, im Alter von siebzig Jahren, seinen Geist auf. Da er Nachkommenschaft hatte, blieb der Thron im Besitz seiner Familie. Einer seiner Nachfahren, Liholiho, bestieg diesen Thron von Hawaii Anno Domini MDCCCLIV als König Kamehameha IV. Er war ein stolzer Jüngling von zwanzig Jahren. Im Alter von zweiundzwanzig heiratete er ein dunkelhaariges Mädchen, das auch erst zwanzig Lenze zählte. Sie nannte sich Königin Emma, nicht zu verwechseln mit der holländischen Königin gleichen Namens. Dieser jungen, königlichen Familie von Hawaii war ein tragisches Schicksal beschoren. Der anmutige, braune König von Hawaii starb schon mit neunundzwanzig Jahren. Sein einziger Sohn hatte bereits ein Jahr vor ihm, im zarten Alter von vier, das Zeitliche gesegnet. Den Iolani-Palast hatte der schöne, dunkle König nie vollendet gesehen, da dies erst fünfzehn Jahre nach seinem Ableben geschah.
Königin Emma, der Herr sei ihrer Seele gnädig, jetzt des Gatten und des Sohnes beraubt, noch so jung und hübsch, hätte wahrscheinlich die Insel Oahu verfluchen können. Aber sie war gottesfürchtig und begab sich, zwei Jahre nach dem Tode ihres Mannes, auf eine Pilgerreise nach England, zu Queen Victoria, der zukünftigen Kaiserin von Indien und Herrscherin beinahe der ganzen Welt. Emma, die vom Schicksal so schwer geprüfte, reiste damals, vor einhundertdreißig Jahren, mit dem Schiff nach London, um sich von dem Oberhaupt der anglikanischen Kirche, in ihrer Not und Bedrängnis, trösten und im Glauben stärken zu lassen. Ob sie im Buckingham-Palast jemals eine Linderung ihres Leids und eine Stärkung im Glauben erfahren hat, war Sebastian nicht bekannt. Da er selbst, damals, vor einem Jahr, eine vergleichbare Pilgerreise unternommen hatte, konnte er sich sehr gut vorstellen, dass Königin Emma von Hawaii vielleicht doch noch eine Glaubensstärkung bei Victoria in London zu Teil geworden war, so wie er sie bei Maria in Lourdes gefunden hatte. Die Geschichte der tapferen Emma von Hawaii beeindruckte Sebastian tief. Auch sie, genauso wie Victoria, ruhte jetzt in Frieden. Et lux perpetua luceat eis.
Zwanzig Jahre nach ihrer Englandreise starb Emma. Sie wurde neunundvierzig Jahre alt.
An all das dachte Sebastian, als er vor diesem Iolani-Palast im Zentrum von Honolulu stand.
Noch schnell, wie damals in Lourdes, wo ihnen nur wenig Zeit blieb, die Felsengrotte mit der Madonna zu besichtigen, gingen Sebastian und sein Lover, Maurits, zur Kawaiahao-Kirche, wo vor hundertsiebenunddreißig Jahren die königliche Vermählung von Emma und Liholiho stattgefunden hatte. Schicksalhafterweise war wieder eine Hochzeit im Gange, am frühen Nachmittag dieses dreizehnten Juli. Sebastian konnte die Kirche also nicht von innen besichtigen.
Einen Ausflug nach Kailua, einer sehr kleinen Stadt mit einem traumhaft schönen Strand, machten sie am nächsten Tag. Es strahlte, mit all diesen Palmen, etwas Unberührt-Paradiesisches aus. Während der kurzen Busfahrt über die tief grünen Berge in dieses Kailua, das nicht mit dem Ort identisch war, wo einst der erste König von Hawaii seinen letzten Atem ausgehaucht hatte, kamen sie, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg, am Sommerpalast von Königin Emma vorbei.
Salve Regina Emma!
Sie aßen immer bei Sizzler, weil es dort diese herrlich großen Beefsteaks gab. Es schmeckte ihnen vorzüglich, der Preis war redlich und die Bedienung äußerst freundlich. Besonders die "Salad Bar" war ein wahrer Augenschmaus und eine exquisite Gaumenfreude.
Jetzt, am achtzehnten Tag der Reise, dem letzten Tag auf Oahu, griff der Engel erneut ein. Sebastian sollte wieder an Tod und Vergänglichkeit erinnert werden. Zu diesem Zwecke führte der Bote Gottes ihn und seinen Begleiter auf den Hügel der toten Soldaten in Honolulu.
Zum "National Memorial Cemetery of the Pacific" begaben sich die beiden Reisenden, auf dass sich die Vorsehung erfülle. Ein Friedhof für amerikanische Gefallene war es, am Rande von Honolulu, in einem Kraterkessel. Dieses Gräberfeld bestand hauptsächlich aus Rasenflächen mit kleinen Grabplatten, auf denen die Namen der umgekommenen GIs zu lesen waren. Vereinzelt sah man Plastikblumen. Die beiden hatten vom äußeren Rand des schon vor langer Zeit erloschenen Vulkans einen wundervollen Ausblick über Honolulu, Pearl Harbour und den Stillen Ozean.
Sebastian musste an den rebellischen Jean Genet denken, der wegen seines leichten Hanges zur Nekrophilie bei toten Soldaten in eine gewisse Ekstase geriet. All dieses schöne, feste Fleisch wurde hier von Würmern aufgefressen. Die Hoffnungen dieser jungen Männer waren hier begraben worden. Hatten sie vielleicht auch Georges Batailles oder D.H. Lawrence gelesen? Hatten sich ihre Träume jemals erfüllt?
In einem seiner Romane beschrieb D.H. Lawrence eine Szene, in der eine Musterung von Männern im besten Alter stattfand, die sich, aufgrund des Ersten Weltkrieges, gezwungenermaßen zum Heeresdienst gemeldet hatten. Einem der Wehrpflichtigen gelang es, nachdem er die obligatorische Fleischbeschau über sich ergehen lassen musste, vom Krieg verschont zu bleiben. Diese Schilderung hatte Sebastian damals, vor vielen Jahren, sehr fasziniert. Die Umstände, unter denen diese Untersuchungen durchgeführt wurden, wiesen beinahe schon groteske Züge auf, obwohl es für diejenigen, die daran teilnahmen, sicherlich peinlich und erniedrigend war. Die Ohnmacht des Individuums dem Staatsapparat gegenüber wurde auf unangenehme Weise spürbar. Die toten Krieger ruhten jetzt hier, auf diesem einst Feuer speienden Berg auf Oahu, dem die Amerikaner auch den traurig-schönen Namen "Hill of Sacrifice" gegeben haben.
Sebastian wurde es schwer ums Herz. Diese GIs hatten in vielen Ländern dieser Erde für eine Idee gekämpft, die sie mit dem Teuersten, was sie besaßen, bezahlt hatten. Ihr heißes Blut und ihr junges Leben hatten sie, genauso wie der Herr es ihnen, damals vor vielen, vielen Jahren, auf Golgatha vorexerziert hatte, willig dahingegeben. Für sie hatte keine andere Möglichkeit bestanden, als diesen bitteren Kelch des Schicksals, dem sie sich nicht zu entziehen vermochten, bis zum letzten Tropfen auszutrinken. Aber die majestätische Aussicht auf den unendlichen Pazifik, von diesem Hügel der unzähligen Opfer, beflügelte auch die Gedanken von Sebastian. Er schwebte in die Blue Ridge Mountains, nach Agrigento, Jerusalem und an die sieben Quellen des Wildbaches zurück. An die Wollust dachte er und an das Unmögliche, das diese Orte ihn hatten erleben lassen. Dreiundvierzig war er jetzt und wusste Maurits, seinen Lover, in der Nähe. Die verlorenen Söhne Amerikas, die ihn umringten, erfüllten ihn nicht mit Trauer, sondern spendeten ihm Trost. Die wohl tuende Stille dieses Friedhofs genoss er. In ihm war schon die Vorfreude auf das nächste und letzte Reiseziel dieser Weltumrundung: San Francisco!
Am Abend des fünfzehnten Juli begaben sie sich zum Flughafen. In San Francisco kamen sie am folgenden Morgen an. Sebastian sah die Golden Gate Bridge, die weltberühmte. Außer dieser gewaltigen, rostbraunen Brücke gab es viel Leid in San Francisco. Diese Stadt, die Scott McKenzie, damals, vor mehr als zwanzig Jahren, in der Flower-Power-Zeit, so schön besungen hatte, die hatte sich sehr verändert. Die ehemaligen Hippies waren anscheinend zu armseligen, drogenabhängigen Obdachlosen geworden. Der größte Teil davon waren Schwarze. Unwillkürlich musste Sebastian wieder an Virginia Beach denken, an jenes Quäker-Getto. Auch an Harlem erinnerte er sich. Mehr als zwanzig Jahre waren mittlerweile vergangen, und die Lage der amerikanischen Neger hatte sich nur noch weiter verschlechtert. Sebastian und Maurits sahen einerseits unsägliches Leid in San Francisco und andererseits empfanden sie eine angenehme Spannung in dieser kalifornischen Großstadt. Der Himmel war stahlblau, die Luft sauber und die Calle Car beförderte unaufhörlich die unzähligen Touristen aus aller Welt über die vielen Hügel dieser ehemals spanischen Mission namens San Francisco de Asís. Die geographische Lage dieser Stadt war einmalig. Die beiden Globetrotter hatten ihren Einzug im, zuvor reservierten, YMCA genommen. Die mittellosen Neger waren draußen, weit weg.
Am zweiten Tag in San Francisco ging man zu Fuß vom YMCA zur Fisherman's Wharf. Dort gab es Restaurants und Kneipen im Überfluss. Man sah sogar gut gebaute Burschen, die Rikschas zogen. Wie schwer zu zügelnde, arabische Hengste wirkten sie. Touristen konnten einsteigen und sich durch pure Muskelkraft am Hafen entlang transportieren lassen.
Sausalito war für den dritten Tag geplant. Man fuhr mit dem Bus über die Golden-Gate-Brücke in jenes kleine, ehemalige Fischerdorf. Man hätte auch das Boot nehmen können, aber das dauerte länger und war teurer. Von Sausalito hatten sie eine wunderbare Aussicht auf San Francisco und die Inseln in der Bucht. Man sah Angel Island, diese grüne Insel der Engel, und die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz. Wie viele Träume waren nicht auf dieser Felseninsel zerstört worden? Wie viele Hoffnungen waren hier nicht in den blauen, kalifornischen Himmel entschwunden? Jetzt war es ein Museum und die Fähren mit Touristen dorthin waren fast übervoll. Das legendäre, alte Alcatraz regte die Fantasie seiner Besucher an. Sebastian und Maurits sahen diese Insel der ehemals Verdammten nur aus weiter Ferne, als Silhouette.
Am vorletzten Tag in Kalifornien kaufte Sebastian einen schönen Rosenkranz mit grünen Perlen für die kleine Anna, auf dass sie sich, genauso wie er selbst, damals während der Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion, auf den katholischen Glauben einlassen solle. Anna war fast neun und eines der Kinder des drittältesten Bruders von Sebastian. Zum Zwecke dieses Ankaufs begab man sich in die Mission Dolores, die, wie die meisten kalifornischen Missionen, in spanischem Barockstil erbaut war. Am Nachmittag des zwanzigsten Juli bestiegen die beiden Freunde das Flugzeug zurück nach London, wo sie am nächsten Morgen ankamen. Noch einige Stunden blieben sie in der britischen Hauptstadt und besuchten das Reisebüro in Bayswater, wo Sebastian die Flugtickets für diese Weltumrundung gekauft hatte. Die Edgware Road war eine unscheinbare Straße und das Haus mit der Nummer zweihundertsechsundvierzig, war ebenfalls einfach gehalten. Sebastian und Maurits standen davor, doch keiner von beiden ging hinein. Sebastian kannte die Mitarbeiter nur vom Telefonieren und von den Briefen. Ein Gefühl der Dankbarkeit bemächtigte sich seiner.
Die beiden schlenderten zur Oxford Street und anschließend besuchten sie eine Pizzeria um etwas für ihr leibliches Wohl zu tun. Zufrieden und dem Allmächtigen dankbar war Sebastian, dass er diese Weltreise hatte machen dürfen, die er sich so sehr gewünscht hatte.
Celebrabo te, Domine, ex toto corde meo, quia audisti verba oris mei.
Um neunzehn Uhr fünfzehn flogen sie weiter nach Amsterdam. Diese herrliche Globusumrundung war zu Ende und Sebastian völlig erschöpft und unendlich müde. Die Arbeitslosigkeit war noch für einige Zeit fast vergessen, kam dann aber im September mit voller Heftigkeit zurück.
Der Engel schaute auf Sebastian herab und sah dessen Leid. Er war davon überzeugt, dass nur ein einschneidendes Ereignis dazu beitragen könne, die Gedanken seines Schützlings wieder etwas von dessen Arbeitslosigkeit abzulenken. In seiner unendlichen Weisheit erkor er den einzigen Bruder von Maurits.
In jener Zeit geschah es, dass Maurits, mit dem Sebastian jetzt schon seit zwölf Jahren einen gemeinsamen Haushalt führte, öfters von seinem jüngeren Bruder angerufen wurde. Dieser war einundvierzig Jahre und wohnte in Amsterdam. Er war HIV-positiv und seit einigen Monaten schon war bei ihm die Krankheit Aids zum
Ausbruch gekommen. Das Verhältnis zwischen beiden Brüdern konnte am besten als ein wenig unterkühlt-reserviert bezeichnet werden, obwohl sie sich mochten.
Mit aller Macht sträubte sich der Bruder, dessen Körper schon vom Verfall gezeichnet war, gegen diese tödliche Infektion. Die große Scham, die er wegen seiner Homosexualität empfand, konnte er nicht überwinden. Im Grunde betrachtete er seine sexuelle Präferenz als etwas Perverses, womit er nicht gelernt hatte umzugehen. Durch das Krankenlager hatte er die Gelegenheit erhalten, sich zu öffnen und seine Sorgen von sich abzuschütteln, aber er tat es nicht. Außerdem hatte er noch große Schuldgefühle seinem Mütterlein gegenüber wegen seiner Aids-Erkrankung. In diesem chaotischen Gemütszustand starb er dann, mehr oder weniger plötzlich, am dreißigsten Dezember Anno Domini MCMXCIII. Die Todesnachricht traf telefonisch ein und Sebastian hatte die traurige Pflicht sie Maurits mitzuteilen. Anfang Januar wurde der Bruder von Maurits begraben. Sebastian konnte noch immer nicht verstehen, warum dieser Bruder sich nicht dazu hatte durchringen können, seine Krankheit und den bevorstehenden Tod zu akzeptieren.
Sebastian und Maurits hatten beschlossen, dass man, als Zeichen der Trauer, einen kleinen Altar in der Wohnung einrichten müsse, damit das Leid erträglicher und sichtbarer würde. An seine eigene Mutter dachte Sebastian, die sieben Jahre lang die Trauer um ihren ältesten Sohn verinnerlicht hatte. Allabendlich saßen Sebastian und Maurits an diesem Altar und sprachen über den toten Bruder. Um es etwas einfacher und ritueller zu gestalten, geschah dies im Schein von Kerzen, die auf das Foto des Verstorbenen und auf die Madonna von Lourdes schienen. Zum Abschluss einer jeden Zusammenkunft sprach dann Maurits mit engelsgleicher, klarer Stimme: "Ave Maria,, Dominos tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen." Dieses Gebet las er von einem Zettel ab, da er es nicht auswendig konnte, denn er war Protestant und hatte es in der Schule nie gelernt. Dieses allabendliche Ritual half den beiden sehr, die Trauer erträglicher zu machen und sinnvoll zu bewältigen.
Nach sechs Wochen beendete man diesen wohl tuenden Ritus, der für Maurits und Sebastian eine große Erleichterung bedeutete. Der Engel sah dieses Verhalten seines Schützlings und hieß es gut. Um Sebastian doch auch noch ein wenig Freude zu schenken, ließ er ihn noch ein letztes Mal an die sprudelnden Quellen des Wildbaches, in das Tal seiner Kindheit, zurückkehren. In jenen Tagen war die Zeit gekommen, da Sebastian in sich den starken Drang verspürte, mit seinem drittältesten Bruder zu sprechen. Er wusste, dass dieser in Scheidung lebte und damit Schwierigkeiten hatte. Sebastian rief ihn an, um einen mehrtägigen Besuch anzukündigen, denn er wollte den Bruder moralisch unterstützen. Mitte März reiste er in jenes Tal, wo sein Vaterhaus noch immer stand und Maurits begleitete ihn. Der Bruder, der sichtlich unter der neuen Situation litt, empfing ihn. Seine vier Kinder, so viel waren es ja mittlerweile schon und die Ex-Frau waren nicht da. Er, dem der Bund fürs Leben immer so viel bedeutet hatte, erzählte, dass die lästigen Scheidungsformalitäten fast erledigt seien. In Norddeutschland halte sich zurzeit die Ex-Schwägerin zur Kur auf und die Kinder seien bei Gastfamilien untergebracht. Dergleichen hatte Sebastian schon erwartet und war daher nicht sonderlich überrascht. Mitleid indes empfand er für den Bruder. Dieser sprach davon, dass sein Leben verwirkt sei. Sehr verbittert und enttäuscht wirkte er.
Wieder zurück in seinem Elternhaus war Sebastian und sah, wie verfallen es schon war. Zwar waren die Außenmauern noch sehr stabil, aber innen war es feucht und der Putz fiel schon von den Wänden. Mit unnützem Tinnef war es voll gestopft und an den Stellen, wo der Kalk noch nicht abgeblättert war, hingen Blumen aus Plastik. Dies alles schaute Sebastian sich an und wusste, dass es sein letzter Besuch in diesem Haus sein würde. Zehn Tage blieben die beiden und versuchten den Bruder etwas aufzumuntern. Danach kehrte man wieder nach Holland zurück und Sebastian brach den Kontakt zu der Ex-Schwägerin per Brief ab.
Aufgrund der misslichen Umstände des Bruders und durch das Gefühl der Aussichtslosigkeit, das die noch immer anhaltende Arbeitslosigkeit hervorrief, wurde Sebastian depressiv. Es fiel ihm schwer die endlosen Tage des Nichtstuns zu ertragen. Ihm fehlte die Kraft sich Neuem zu öffnen. Selbst die Nachrichten in den Zeitungen interessierten ihn nicht mehr. Nutzlos verstrichen die Wochen und auch Maurits war nicht mehr in der Lage, dem trübsinnigen Sebastian neuen Lebensmut einzuflößen.
Der Engel sah die ausweglose Lage seines Schützlings und war der Auffassung, dass er eingreifen müsse. Für Abhilfe werde er sorgen, aber sie solle diesmal endgültig sein, um Sebastian auch vor zukünftigem Unheil zu bewahren. Der Bote Gottes vertrat die Ansicht, dass ein Aufenthalt in Spanien zur Durchführung seines Vorhabens am geeignetesten sei, da Sebastian dieses südliche Land so sehr mochte. Es sollte aber jetzt kein Eiland der Balearen oder Kanaren sein, sondern eine Insel im Zentrum dieses katholischen Königreiches. Ohne Begleiter solle Sebastian diese besondere Reise machen, damit nichts ihn ablenke.
Nachdem sein Zustand sich dermaßen verschlechtert hatte, dass er sich nur noch der Grübelei hingab, bat Maurits ihn inständig, doch für einige Zeit wegzufahren. Eine solche Veränderung bringe ihn schon auf andere Gedanken. Darüber hinaus sei er es leid, ständig einen Menschen in seiner Nähe zu haben, der unaufhörlich klage. Für beide Seiten sei eine kurzfristige Trennung jetzt vonnöten.
Im Frühsommer raffte Sebastian sich dann endlich auf und machte sich auf den Weg nach Spanien. Dort sah er erstmals Madrid. Diese wunderschöne kastilische Metropole inmitten der iberischen Halbinsel, so hoch und einsam gelegen, zog Sebastian in ihren Bann. Vor allem die eindrucksvolle Plaza Mayor, deren Proportionen in ihm das Gefühl einer wohl tuenden Harmonie hervorriefen, mochte er sehr. Im Schatten ihrer prächtigen Häuser aus vergangenen Jahrhunderten, die kleinen Palästen glichen, verweilte er so gerne. Abends konnte Sebastian dort den Planeten Venus und die zunehmende Mondsichel sehen. Ein herrliches Naturschauspiel bot sich ihm dar.
Die Sterne über ihm waren so unendlich weit und doch funkelten sie, seit ewigen Zeiten schon. Noch zahllose Generationen nach ihm, würden das Gleiche sehen wie er, hier, mitten auf der Meseta, im Herzen der spanischen Hauptstadt. Seine Gedanken fingen an zu schweben. Um sich herum hörte er Englisch, Französisch und Spanisch. Es gab viele Touristen, die auf den Terrassen saßen genauso wie er. An Maurits dachte er. Sein Leben zog langsam an ihm vorbei. An Madame Bovary, die ihre Leidenschaft nur schwer unterdrücken konnte, erinnerte er sich. Sie, die Schöpfung Flauberts, die im Grunde ein unglückliches Leben hatte führen müssen, beherrschte seine Gedanken. "Paul et Virginie" tauchten wieder auf. Der Schiffbruch, das Wasser und die meterhohen Wellen, die jegliche Flucht unmöglich machten, begruben die beiden Liebenden und schwemmten alle Schuld hinweg.
Emma Bovary lud Sebastian noch einmal ein, ihre deliriösen Träume mit ihr zu teilen. Kathedralen aus weißem Marmor und Hütten unter schlanken Palmen sah Sebastian. Gitarrenklang und das Geräusch plätschernder Brunnen drang an sein Ohr.
Sebastian wurde abrupt aus seinen Träumereien gerissen, da der Kellner kam und kassieren wollte. Das Plätschern rührte von den Bier- und Weingläsern her, die immer wieder nachgefüllt wurden. Das Gitarrenspiel war Rodrigos "Concierto de Aranjuez", das gerade von einer Gruppe junger spanischer Musikanten, denen die Plaza Mayor als überdimensionales Podium diente, voller Hingabe gespielt wurde. Diese verlockenden Klänge, dieser Ruf nach Aranjuez, war eindringlich und unwiderstehlich. Sebastian bezahlte und machte sich auf den kurzen Weg zu seinem Hotel, das sich in der Calle de la Montera befand. Die Arbeitslosigkeit, die noch immer andauerte, beherrschte wieder seine Gedanken. Er war in das Land Sancho Pansas und Don Quixotes gekommen, um sich, für kurze Zeit wenigstens, davon zu befreien, aber das gelang ihm nur teilweise.
Noch zwei Ausflüge sollte Sebastian machen. Die erste Exkursion führte ihn nach San Lorenzo del Escorial, am Fuße der Sierra Guadarrama. Dieser riesige Klosterkomplex, in dem die meisten spanischen Könige und Königinnen ihre letzte Ruhe gefunden hatten, war ein majestätisches Bauwerk. Seit mehr als vierhundert Jahren schon bewachte es, wie eine wehrhafte Burg, die sterblichen Hüllen der einst gekrönten Häupter. Verblendend wirkte dieses Gebäude auf Sebastian. Es war so überwältigend, dass es ihm unmöglich war, hineinzugehen.
Der letzte Trip führte ihn nach Aranjuez. Sebastian konnte sich diesen Gitarrenklängen der Straßenmusikanten, diesem Lockruf der Plaza Mayor, nicht mehr entziehen.
Er begab sich in die königlichen Gärten. Eine tiefe Stille lag über Aranjuez an jenem Tag. Hierhin, an die mit üppigem Grün bewachsenen Ufer des Tajo, hatte der Engel seinen Schützling an diesem Sonnabend im Juni geleitet, damit die Vorsehung sich erfülle. Schön und friedlich lag der Jardín de la Isla im Sonnenschein. Dieser Garten hatte die Form eines fast gleichseitigen Dreiecks, genauso wie der Platz vor Sebastians Vaterhaus; der allerdings war um ein Vielfaches kleiner. Bewusst hatte der Engel diesen Ort erkoren, da er wusste, dass Flüsse, Bäume und Plätze eine große Anziehungskraft auf seinen Schützling ausübten.
Zwei Seiten dieses Geländes wurden von dem Fluss begrenzt. Sanft umspülten seine Wellen dieses fruchtbare Erdreich, auf dass alles wachse und gedeihe. Von Osten her schlängelte er sich an diese Oase der Stille heran und wand sich dann in weitem Bogen nach Norden, um anschließend seinen Lauf in südwestlicher Richtung fortzusetzen. An der Stelle, wo seine Wasser die erste Ecke dieses Gartens erreichten, befand sich am linken Ufer ein Palast. Von dort hatte man, in gerader Linie, einen Kanal angelegt, der den Tajo mit sich selbst verband. Somit war diese Grünanlage auch zu ihrer dreieckigen Form gekommen und gleichzeitig zur Insel geworden.
Wie mächtige Säulen eines griechischen Tempels wirkten die uralten Bäume, unter denen Sebastian umherschritt.
Nun wurde er auch der Opferstätte gewahr, die lange schon hergerichtet war. Unübersehbar war dieser in der Nachmittagssonne funkelnde Becher auf dem riesigen Altar, an dessen Längstseiten einundzwanzig Stühle standen. Diesen Kelch, der nur für ihn bereitgestellt worden war, nahm er, setzte ihn an und trank ihn aus.
Unweit des Opfertisches sank Sebastian zu Boden und eine große Ruhe kam über ihn, die fast vollkommen war. Leise nur hörte er das Plätschern des Tajo, der nordwärts hinter ihm vorüberfloss. Scheherazade erschien im Jardín de la Isla. Sie trug kostbare Gewänder in den schönsten Farben. Langsamen Schrittes führte sie die Trinität der Belletristen an ihren Platz. An dem Ende des Tisches, das dem Palacio Real, der sich am Eingang des Gartens befand, abgekehrt war, ließ sich erst David Herbert nieder. Neben ihm nahmen Jean und Georges ihre Plätze ein.
Die zweite Gruppe, die von Scheherazade an ihren Platz geführt wurde, bestand wiederum aus drei Personen. Es handelte sich um Wilhelm, den tapferen, bei dem sich sowohl Ännchen als auch Katharina eingehakt hatten. Wilhelm nahm den Platz neben Georges ein. Dann folgte Katharina neben ihm. Der Stuhl zu ihrer Rechten blieb unbesetzt. Ännchen nahm neben diesem leeren Stuhl ihren Platz ein.
Nun wurde eine Gruppe, die sich aus vier Gestalten zusammensetzte, an den Tisch geleitet. Jimi und Giuseppe gingen Hand in Hand. Violetta am Arm von Jeanne-Antoinette folgte ihnen. Die arabische Prinzessin wies Jimi den Platz neben Ännchen zu.
Daneben ließ sich Giuseppe, dann Violetta und zuletzt Jeanne-Antoinette nieder. Nun waren die ersten zehn Plätze, bis auf den freien elften Stuhl in der Mitte, besetzt. Sebastian konnte sechs Männer und vier Frauen stumm nebeneinander sitzen sehen.
Nun begann Scheherazade die Plätze auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches, die dem Fluss am nächsten war, zu füllen. Die folgende Gruppe, die herangeführt wurde, umfasste lediglich zwei Personen. Seite an Seite schritten Lamoraal und Victoria, die ein kleines Krönchen trug, würdevoll zu ihren Stühlen.
Victoria nahm David Herbert gegenüber Platz. Ihr Rücken war Sebastian zugewandt. Daneben ließ sich Lamoraal nieder.
Als Nächstes wurde Emma, die von Paul und Virginie eskortiert wurde, an den Tisch geführt. Behutsam schritten diese drei ihren Plätzen entgegen. Emma nahm neben Lamoraal Platz. Daneben ließ sich Paul nieder und auf dem Stuhl zu seiner Linken nahm Virginie Platz. Vis-à-vis von ihr saß Katharina. Dem freien Stuhl gegenüber befand sich keine Sitzgelegenheit.
Die sechste Gruppe, die von Scheherazade an den Tisch geführt wurde, bestand aus zwei Personen. Sebastian sah Abraham, der Bernadette an der Hand führte, die sich zuerst hinsetzte. Ihr Gegenüber war der virtuose Jimi. Jetzt nahm Abraham noch Platz. An dieser Seite des Tisches, die Sebastian am nächsten war, gab es noch drei leere Plätze.
Nun führte Scheherazade Leonardo an seinen Platz. Er ließ sich neben Bernadette nieder.
Als Letzte brachte sie Marie an die Stelle, die ihr zugedacht war. Schließlich ließ auch sie, die vor unendlich langer Zeit ihrem Gebieter in tausendundeiner Nacht die wunderbarsten Geschichten erzählt hatte, sich auf ihren Stuhl sinken. Zu ihren Füßen gesellten sich noch drei treue Tiere: Krambambuli, Fidèle und Duxi. Die Haltung, die diese Hunde annahmen, ließ vermuten, dass sie alsbald einschlafen würden.
Scheherazade gegenüber saß die einstmals reiche und mit Titeln überladene Jeanne-Antoinette.
Die letzten zehn Personen konnte Sebastian nur von hinten sehen, da sie ihm den Rücken zukehrten. Es waren sechs Frauen und vier Männer. Bis auf die orientalische Märchenerzählerin, deren Kleider in allen Farben des Regenbogens schillerten, waren die übrigen neunzehn Personen der Tafelrunde in weiße Gewänder gehüllt. Nur Victorias goldener Kopfschmuck sowie der leere Becher erstrahlten im Licht. Kein Laut war zu hören. Nicht ein einziges Wort wurde gesprochen. Sebastian starrte auf den frei gebliebenen Stuhl, der sich zwischen Ännchen und Katharina befand. Jetzt wurde er gewahr, dass die ganze Tischgesellschaft mit fordernden Augen ebenfalls dorthin schaute. Obwohl die Gesichter der letzten zehn Personen ihm abgewandt waren, wusste er doch, dass auch ihre Blicke auf die gleiche Stelle gerichtet waren. Alle warteten nur darauf, dass auch dieser letzte Platz besetzt werde.
Der Engel hatte Sebastian gut geführt. Die außergewöhnliche Großmutter hatte er ihm gegeben und wieder genommen. Die Kindheit mit Maria, die Blue Ridge Mountains, Jerusalem und Agrigento hatte er Sebastian zuteil werden lassen. Die Nacht von Amsterdam hatte er ihm dargeboten. Den Tod des ältesten Bruders und des Bruders von Maurits hatte er Sebastian gebracht. Die Arbeitslosigkeit hatte er ihn spüren lassen und ihm Lourdes und die ganze Welt gezeigt. Der Engel hatte Sebastian durch tiefe Täler und in schwindelnde Höhen geführt. Maurits hatte er ihm als Gefährten an die Seite gestellt. Doch Sebastian ahnte nichts von seinem Engel.
War der Engel von Sebastian ein Liebes- oder Todesengel?
Sebastian berührte das nicht mehr, denn er hatte nichts von seiner Existenz gewusst.
Warum hatte der Engel sich Sebastian nie offenbart, sodass er ihn hätte fragen können, was zu geschehen habe?
Der Engel beobachtete unterdes seinen bleichen Schützling und sah, dass dessen Augen brachen. Er schickte ihm noch einmal den arabischen Traum von Jerusalem.
Domine, non secundum peccata nostra facias nobis.
Sebastianus, pulvis es, et in pulverem reverteris. Dominus autem resuscitabit te in novissimo die.
Amen.
- Arbeit zitieren
- Martin Sale (Autor:in), 2002, Sebastian und sein Engel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106819
Kostenlos Autor werden

















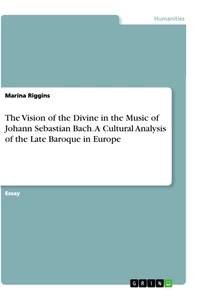




Kommentare