Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Demokratietheorien im Allgemeinen
2.1 Pluralistische Theorie der Demokratie
2.2 Partizipatorische Demokratietheorie
2.3 Deliberative Demokratietheorie
2.4 Direkte Demokratie
III. Demokratie und EU
3.1 Grundlagen einer europäischen Demokratie
3.2 Demokratisierungsprobleme in der EU
3.3 Integrationstheorien
IV. Demokratie und Internet
4.1 Der Einfluss des Internet auf Konzepte der Öffentlichkeit
4.1.1 Der Begriff der Öffentlichkeit
4.1.2 Exkurs Datenschutz
4.1.3 Exkurs Informations- und Meinungsfreiheit
4.2 Demokratietheoretische Potentiale des Internet
4.3 Demokratietheoretische Risiken des Internet
V. Demokratietheorie, EU und Internet - Eine Zusammenfassung
VI. Anhang
VII. Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Im modernen Sprachgebrauch gehört nach Schmidt zu den Minimalbedingungen einer Demokratie die Möglichkeit eines hohen Maßes an „unbehinderter Interessen- und Meinungsäußerung, Interessenbündelung und Opposition.“ (Schmidt 1995:206) Innerhalb der Demokratietheorien, von denen einige normative Ansätze in Kapitel zwei vorgestellt werden sollen, gibt es eine Reihe unterschiedlicher Modelle, die jeweils verschiedene Schwerpunkte, was die Anforderungen, Voraussetzungen oder auch Umsetzungen funktionierender Demokratien betrifft, setzen. Jedoch scheinen diese Ansätze allesamt vor einem supranationalen Gebilde wie der EU kapitulieren zu müssen, da sie entweder nicht weitreichend oder auch aber auch zu engführend zu sein scheinen. Auf jeden Fall wird die Demokratieproblematik verschärft durch die mit der europäischen Integration verbundenen, veränderten Rolle der Nationalstaaten. Es müssen Lösungen gefunden werden, damit nicht beispielsweise der europäische Prozess der Denationalisierung notwendig mit einer Schwächung der Demokratie einhergeht. Im Gegensatz zu dieser Gefahr soll die vorliegende Arbeit Möglichkeiten aufweisen, inwiefern der Demokratie auf der Ebene der europäischen Union Prozesse der Meinungs- und Willensbildung zu einer politisch aktiven europäischen Öffentlichkeit verhelfen könnten, die sich wiederum in einer erhöhten Bürgerbeteiligung am politischen Prozess äußern würde.
Demzufolge soll im dritten Kapitel der vorliegenden Arbeit auf verschiedene Spezifika einer möglichen europäischen Demokratie eingegangen werden. Als besonders wichtig und grundlegend erscheint dem Autor hierbei die Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit, die Voraussetzung jeglicher angestrebter Erhöhung der politischen Beteiligung von Seiten der Bevölkerung wäre. Es wird also in den Kapiteln 2 und 3 der vorgegebene Rahmen - Demokratie in einem supranationalen Raum - aufgespannt, an dem dann im vierten Kapitel die demokratietheoretischen Potentiale der neuen Informationstechnologien abgeglichen werden sollen.
Dabei wird sich die Arbeit darauf konzentrieren, inwieweit das Internet zur Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit beitragen könnte. Das Internet ist der deutlichste Ausdruck für die technische Entwicklung, die vor 2 allem darin zu sehen ist, dass „[v]ormals voneinander unabhängige Wirtschaftssektoren - Medien, Telekommunikation, Informationstechnologie - [...] im digitalen Zeitalter“ (in Weidenfeld/Wessels 2000:288) zusammenwachsen.
Eine europäische Öffentlichkeit ist m.E. vonnöten, da der Regelungsanspruch der EU immer weiter zunimmt und der Bürger häufiger von Entscheidungen der EU betroffen ist. Demzufolge hat er auch ein Recht, angemessen informiert zu werden und eine gewisse Kontrolle auszuüben. Wenn nämlich in der EU ein Konvent einberufen wird, der sich um die Entstehung einer europäischen Verfassung kümmern soll, so ist der Einigungsprozess deutlich über seine grundlegenden wirtschaftlichen Beweggründe hinausgegangen (vgl. Juncker 2002) und beinhaltet nun eine gravierende politische Dimension, die nicht mehr ausgeklammert werden kann. Dementsprechend muss auch der Bürger miteinbezogen werden und so bestehendem Unbehagen gegenüber der Politik der EU, das meistenteils wohl aus einem Mangel an Information entsteht, entgegengewirkt werden. Denn es ist nicht nur so, dass über die Einheitliche Europäische Akte 1986, den Maastrichter Vertrag 1992 bis hin zum Vertrag von Amsterdam 1997 die Entscheidungsbefugnisse der EU wuchsen und damit die Einflüsse der Nationalstaaten schwanden (vgl. Juncker 2002:105), sondern auch dem Bürger wird immer deutlicher, wo die für ihn relevanten Entscheidungen getroffen werden.
Eine gewisse Hierarchie ist der Arbeit bereits durch den zwar sehr allgemeinen Titel gegeben, der aber das Vorgehen und damit auch die Auswahl der relevanten Aspekte vorgibt. Den Hintergrund der Arbeit stellen verschiedene Demokratietheorien dar, deren kleinster gemeinsamer Nenner, nämlich die Befürwortung der Demokratie als der besten Staatsform, auch Ausdruck der politischen Ansichten der Mitgliedsstaaten der europäischen Union ist. Allerdings bringt dieses Gebilde EU gewisse spezifische Probleme mit sich, die mit den bisherigen Theorien wohl noch nicht lösbar sind. Aber eine Demokratie benötigt einen Minimalkonsens, um überhaupt funktionieren zu können. Dieser Minimalkonsens muss in einer politischen Öffentlichkeit anerkannt sein, dafür jedoch muss es eine solche Öffentlichkeit erst einmal geben. Den Rahmen für diese Öffentlichkeit 3 stellte bisher der Nationalstaat, doch fällt dieser zunehmend als Träger der politischen Öffentlichkeit aus. Demzufolge müssen sich die Demokratietheorien von bestimmten Konzepten, wie beispielsweise dem durch die Herkunft bestimmten Volk, lösen und sich neuen Möglichkeiten öffnen. Hier bietet das Internet verschiedene Potentiale, der Demokratie bzw. der Schaffung einer für die Demokratie notwendigen Öffentlichkeit unter die Arme zu greifen. Bei der Betrachtung der Möglichkeiten des Internet sollen in Kapitel 4 auch die Risiken nicht verschwiegen werden, so dass es im Grunde in der Arbeit vor dem theoretischen Hintergrund verschiedener Demokratiemodelle und ihrer Vereinbarkeit mit der EU darum geht, inwiefern das Internet tatsächlich „Chancen für eine Modernisierung der Demokratie“ birgt, ob mit Hilfe „globaler Kommunikation“ tatsächlich „neue Strukturen einer weltweiten Öffentlichkeit entstehen“ können und es dieser damit erlauben „auf die Globalisierung der Wirtschaft und Politik zu reagieren und Einfluß zu nehmen.“ (vgl. Leggewie/Maar 19971) Sicher sollte jedenfalls sein, dass „die Gestaltung der Informationsgesellschaft [...] nicht dem technischen Fortschritt und den Kräften des Marktes allein überlassen bleiben“ (ebd.) sollte.
2 Verschiedene normative Demokratietheorien
Wenn Manfred G. Schmidt davon spricht, dass es „nicht nur eine Demokratie, sondern viele verschiedene Demokratien, nicht nur eine Demokratietheorie, sondern viele verschiedene Demokratietheorien gibt“(Schmidt 1995:19), so ist ihm genauso zuzustimmen, wie Giovanni Sartori, der die politische Demokratie als „notwendige Vorbedingung“ für alle anderen möglichen Ausformungen der Demokratie, beispielsweise in der Industrie oder dem Kulturwesen, ansieht (vgl. Sartori 1997:21).In Anbetracht ihres Gegenstandes wird sich diese Arbeit auf die politische Demokratie, dabei auf einige ihrer modernen Theorien beschränken, um damit den Boden zu bereiten für eine Analyse in Bezug auf die Europäische Union und das Veränderungspotential hinsichtlich einer europäischen Demokratie durch das Internet.
Neben der Unterscheidung zwischen normativen und deskriptiv- empirischen Demokratietheorien lässt sich noch einmal eine Differenzierung zwischen identitären und repräsentativen Demokratietheorien treffen. Dabei wird es für ein derartig großes (sowohl geographisch als auch demographisch) Gebilde wie die EU einleuchtend sein, dass eine Theorie, die Rousseau folgend eine Identität von Regierten und Regierenden fordert, nicht umsetzbar wäre. Die Arbeit wird sich also auf die repräsentativen Formen der Demokratie beschränken. Dennoch sollte es auch das Ziel solcher Modelle sein, über eine gewisse Identifikation des Bürgers mit dem Staat zu einer höheren Bürgerbeteiligung und damit zu einer größeren Legitimation des Systems sowie einer gewachsenen Legitimität der Entscheidungen zu führen. Als entscheidend dürften sich hierbei die Möglichkeiten der Meinungs- und Willensbildung herauskristallisieren, die auch im Mittelpunkt der in der Arbeit vorgestellten normativen Theoriekonzepte der Demokratie stehen sollen. Nicht zuletzt wird auch hier der zu betrachtende Ansatzpunkt der neuen Informationstechnologien liegen.
Nur durch die Einigung auf das Repräsentationsmodell war es der Demokratie möglich, die Entwicklung von den Stadtstaaten zu den Flächenstaaten mitzugehen und nur dadurch war die Ausweitung der Demokratie auf beliebig große Staaten möglich. Allerdings wurde dies gleichzeitig mit einer Begrenzung der Partizipationsmöglichkeiten der einzelnen Bürger erkauft, wie sie in überschaubaren Gebilden natürlich besser möglich waren.
Abschließend soll in diesem Kapitel noch darauf eingegangen werden, inwieweit Möglichkeiten einer direkten Demokratie umsetzbar wären. Dies geschieht hier aufgrund der immer wieder angerissenen Diskussion, dass mit Hilfe des Internets direktdemokratische Elemente Einzug in die Entscheidungsfindung der EU nehmen könnten2. Allerdings kann an dieser Stelle bereits gesagt werden, dass den zu verbessernden Bedingungen der Meinungs- und Willensbildung eine größere bzw. realistischere Relevanz zugestanden wird in Bezug auf die Erhöhung der Bürgerbeteiligung als den Möglichkeiten der direkten Beteiligung.
In diesem grundlegenden Teil der Arbeit wird sich der Autor auf sein im Oberseminar gehaltenes Referat zu den Neueren Demokratietheorien stützen und sich demnach auch an der dort gewählten Literatur orientieren3. Zusätzlich finden die entsprechenden Artikel aus Nohlens „Wörterbuch Staat und Politik“ Eingang in die Überlegungen, sowie an verschiedenen Stellen die jeweiligen grundlegenden Theoretiker.
2.1 Pluralistische Theorien der Demokratie
Danach sind politische Inhalte im wesentlichen auf Kooperation, Konflikt und Machtverteilung zwischen organisierten Interessen zurückzuführen. Dem Kritikpunkt an anderen Demokratietheorien4, der Nicht-Anwendbarkeit auf vielgliedrige Gesellschaften wird hier Rechnung getragen, denn der Pluralismus an sich wird als ein normativer Begriff zur Kennzeichnung vielgliedrig organisierter Willensbildungsformen verwendet. Auch wird in diesem Modell die Macht durch das Recht und institutionelle Kontrollen und Gegengewichte gezähmt. Ziel ist die Verhinderung totalitärer Herrschaft und die Zügelung der Volkssouveränität, des Staates und der Gesellschaft. Das Leitmotiv ist also die Repräsentation der Wähler und deren pluralistisch gegliederten Sozialstruktur durch verantwortliche Repräsentanten. „Von daher kann auch nicht die Homogenisierung des Denkens und Wollens das Ziel aller Politik sein, sondern die möglichst vollständige Widerspiegelung (>Repräsentation<) der mannigfachen gesellschaftlichen Interessen- und Meinungsströmungen.“ (in Nohlen 1998:83) Voraussetzung einer solchen Demokratie ist ein Sockel an generellem Konsens, jedoch auch ein kontroverser Sektor, der offen ist für den Konfliktaustrag. Ein weiterer Vorteil der pluralistischen Demokratietheorie ist, dass sie von einer Wandelbarkeit der Präferenzen der Individuen ausgeht, diese also nicht als fixiert annimmt. Kritisch zu beurteilen ist allerdings ihre, wie Schmidt es formuliert, „eigentümliche Blindheit gegenüber den Defiziten und der Achillesferse der Demokratie.“ (Schmidt 1995a:159) Diese resultiert aus ihrer Gegenüberstellung mit dem totalitaristischen Kommunismus und Nationalsozialismus und bewirkt nicht zuletzt eine gewisse Unschärfe des „Waffengleichheitsprinzips“ (ebd.): Die pluralistische Demokratietheorie geht zwar davon aus, dass zur Erfüllung des Gleichheitsprinzips unterschiedlicher Interessen, sich der liberale zum sozialen Rechtsstaat entwickeln wird, jedoch bleibt die hier zugrunde liegende These unscharf und entspricht nicht unbedingt der beobachtbaren Realität: „Die Politik hört auf alle und folgt deshalb keiner Stimme uneingeschränkt. Die Pluralismuskonzeption unterstellt mithin ein Kräftegleichgewicht, welches die Funktionalisierung des politischen Handelns im Dienste einer gesellschaftlichen Teilmacht ausschließt.“ (in Nohlen 1998:85)
2.2 Partizipatorische Demokratietheorien
Bei diesen Modellen5wird die Beteiligung der Bürger als ein Eigenwert angesehen und damit geht es um die Maximierung der Partizipationschancen. Zum einen soll es zu einer Erweiterung des Kreises und der Beteiligung der Stimmberechtigten kommen, zum anderen sollen verallgemeinerungsfähige Interessen aufgedeckt werden. Dabei referiert Schmidt auf Dahl, der davon ausgeht, dass nur die partizipatorische Demokratie das Gegengewicht zu der durch Internationalisierung und Globalisierung aufkommenden undemokratischen Verfassung darstellen könne. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Typen von Partizipation6werden generell unter politischer Beteiligung alle Tätigkeiten verstanden, „die Bürger freiwillig mit dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems zu beeinflussen.“ (in Nohlen 1998:521) Dabei kann noch zwischen einer „generalisierten Handlungsvollmacht (wie etwa bei Wahlen)“ (ebd.:522) oder eben Formen der direkten Partizipation in Bezug auf spezifische Entscheidungen unterschieden werden. Jedenfalls gehen diese Modelle davon aus, dass die politischen Präferenzen der Bürger nicht von vornherein gegeben sind, sondern in einem Interaktionsprozess mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft oder dem politischen System entstehen. Demzufolge könnten erhöhte Partizipationsmöglichkeiten für die Bürger zu einer breiteren Konsensfindung führen und damit Gemeinschaft stärken: „Tatsächlich vergrößert Bürgerbeteiligung die Macht der Gemeinschaften und verleiht ihnen eine moralische Kraft, die andere nicht partizipatorische Herrschaftsformen selten erreichen.“ (Barber 1994:38)
Die Diskussions-, Beteiligungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten des Individuums sollen erweitert werden, wobei hier ein sehr positives Bild der politischen Kompetenzen bereits des durchschnittlichen Bürgers vorliegt, denn dieser sei nach der Theorie zu ungleich mehr und besserer Beteiligung als bisher befähigt, bzw. könne er durch angemessene Organisation des Willenbildungsprozesses dazu in die Lage versetzt werden. Die partizipatorische Demokratie setzt auf eine argumentative Auseinandersetzung ihrer Bürger. Somit gelten als die ausschlaggebenden Variablen für den Partizipationsgrad der Bürger deren sozioökonomischer Status, sowie Alter und Geschlecht.
Neben der kritischen Beurteilung dieses allzu positiven Menschenbildes7könnte ein zweiter Ansatzpunkt der Kritik lauten, dass eine zu hohe Partizipation zu einer Überlastung und damit zu einer Destabilisierung des politischen Systems führe. Demzufolge differenziert auch Schmidt: „Die Partizipation wird unterschiedlich bewertet. Für manche ist Partizipation ein Wert an sich, insb. auch unverzichtbarer Bestandteil eines Aufklärungsprozesses. Für andere ist die Partizipation vor allem hinsichtlich ihrer Eignung zur Bewältigung politischer Probleme zu bewerten. Als besonders problematisch gelten die exzessive Beteiligungsbereitschaft einer großen Masse der Bevölkerung und weitverbreitete Apathie.“ (Schmidt 1995:740) Sartori sieht außerdem die Gefahr, dass die sachliche Qualität politischer Entscheidungen leiden könnte. Jedenfalls setzt diese Theorie voraus, dass die am politischen Prozess beteiligten Personen, deren Kreis ja erweitert werden soll, sich auf die anspruchsvollen Prozeduren der Beratung und Beschlussfassung einlassen. Hier ist bereits ein prozeduralistischer Ansatz der Demokratietheorie erkennbar, der im folgenden bei der Theorie der deliberativen Demokratie eine Fortführung erfährt.
2.3 Deliberative Demokratietheorie
Diesem Modell liegt die Vorstellung einer idealen Prozedur der Beratung und Beschlussfassung zugrunde, die durch bestimmte Verfahrenseigenschaften charakterisiert ist, die hier allerdings nicht weiter beleuchtet werden können. „Demokratische Selbstregierung bedeutet nicht allein die Anwendung der Mehrheitsregel, sondern, in der klassischen Formulierung von John Stuart Mill >government by discussion<, also Mehrheitsentscheidung nach zwangloser, ausführlicher und abwägender Diskussion möglichst vieler Betroffener, wie es dem Ideal >deliberativer Demokratie< entspricht.“ (Leggewie 1998:38)
Die Demokratie gilt nach Habermas als die Emanzipation der Unterprivilegierten, wobei er wiederum die Partizipation betont. Er geht von den zwei Idealtypen des republikanischen8und des liberalen Modells der Demokratie aus und bildet dann aus den zwei Komponenten Rechtsstaat und Demokratie sein Modell der deliberativen Demokratie: „Wenn wir den Verfahrensbegriff der deliberativen Politik zum normativ gehaltvollen Kernstück der Demokratietheorie machen, ergeben sich Unterschiede sowohl zur republikanischen Konzeption des Staates als einer sittlichen Gemeinschaft als auch zur liberalen Konzeption des Staates als des Hüters einer Wirtschaftsgesellschaft.“ (Habermas 1992:19f.) Nötig sei eine rationale Selbstbindung der Demokratie. Es gibt im deliberativen Modell zwar auch die Trennung zwischen Staat und Gesellschaft, der Zwischenraum jedoch wird durch die Zivilgesellschaft geschlossen, wobei deren gewünschter Effekt die Kommunikation ist. Allerdings kann diese Zivilgesellschaft wiederum nicht die repräsentative Demokratie ersetzen, vielmehr wird ein Diskurs zwischen den beiden verlangt.
Im deliberativen Modell steht das Verfahren im Mittelpunkt, durch das verhindert werden soll, dass jemand die Macht hat, etwas ohne Diskussion zu bestimmen. Voraussetzung für eine fruchtbare politische Diskussion sei eine ideale Gesprächssituation. „Die Diskurstheorie macht die Verwirklichung einer deliberativen Politik nicht von einer kollektiv handlungsfähigen Bürgerschaft abhängig, sondern von der Institutionalisierung entsprechender Verfahren.“ (Habermas 1992:22) Entscheidend auf der Ebene des individuellen Bürgers ist eine gewisse kommunikative Vernunft, die durch Intersubjektivität entsteht und folglich immer wieder zur Diskussion gestellt werden kann und soll. „Deliberation ist mit anderen Worten kein Selbstzweck, und die Mehrheitsentscheidungen, die etwa probeweise im Sinne eines noch nicht endgültig bindenden Meinungsbildes durch Abstimmung herbeigeführt werden, gehören selbst zum Deliberationsprozess - man wird anders argumentieren, wenn man erfährt, daß die eigene Meinung hoffnungslos unterlegen ist.“ (Leggewie 1998:45)
Als Kritik kann wiederum das allzu positive Menschenbild angeführt werden, des weiteren wird hier wohl zweierlei überschätzt: die konsensstiftenden Möglichkeiten der Sprache als auch die motivationalen Kräfte der Vernunft. Außerdem gilt es die folgenden Faktoren zu berücksichtigen, die das Maß an politischer Partizipation beeinflussen: Ressourcenausstattung, Einstellungen zur Politik, Überzeugungen von der Wirksamkeit individuellen Handelns, was beispielsweise in einem umso größeren Gebilde auch umso schwerer einsichtig sein wird.
2.4 Kleiner Einschub: Direkte Demokratie
Eine direkte Demokratie hat die „ständige Teilhabe aller Bürger an allen Entscheidungen zur Voraussetzung. Dabei ist der Bürger ein homo politicus; eine Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, die sich in der Unterscheidung von citoyen und bourgeois niederschlägt, ist nicht möglich.“ (in Nohlen 1998:109). Wenn bereits bei den vorherigen Modellen das allzu positive Menschenbild eines ständig an der Politik und damit am Gemeinwohl interessierten Bürgers kritisiert wurde, so muss natürlich auch an dieser Stelle diese Kritik angebracht werden. Der Konzeption einer direkten Demokratie liegt ein viel weiter gehendes Demokratieverständnis zugrunde, das sich dann auch dementsprechend bei den Bürgern etablieren müsste. „Demokratie wird als gesellschaftliches Prinzip postuliert und nicht - wie in Konzeptionen der repräsentativen Demokratie - auf die politische und staatliche Sphäre begrenzt.“ (ebd.) Eine unabdingbare Voraussetzung dafür dürfte jedoch ein kleines und homogenes Staatsgebilde sein, was die Überlegungen in dieser Richtung für die EU im Grunde gleich obsolet werden lässt, da die bereits oben ausgeschlossene Identität von Regierenden und Regierten verlangt wird. In diesem heterogenen Gebilde kann im Höchstfall von gewissen plebiszitären Elementen auf verschiedenen Entscheidungsebenen gesprochen werden.
Außerdem setzen alle direktdemokratischen Überlegungen ein objektiv bestimmbares Gemeinwohl voraus, was wiederum in einem Gebilde wie der EU zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszumachen sein wird. Und auch vor dem Hintergrund neuer Möglichkeiten durch die modernen Informationstechnologien gibt es in Hinblick auf direkte Demokratie warnende Stimmen: „Es liegt auf der Hand (so die Kritik von Vertretern der Pluralismustheorie an Theorien der d.D.), daß direkt-demokratische Verfahren gerade angesichts der Entwicklung moderner Kommunikationsmittel und Wahlkämpfe leicht in Demagogie ausarten und cäsaristische Züge annehmen könnten.“ (ebd.)
3 Demokratie in der EU
Wie im vorigen Kapitel gesehen, gehen im Grunde alle drei vorgestellten normativen Demokratiemodelle davon aus, dass der repräsentative Charakter der Demokratie nicht verändert werden kann. Es geht also lediglich um die jeweiligen partizipatorischen, pluralistischen oder deliberativen Elemente, die ergänzend zum Repräsentativmodell Eingang in 11 die Ausformung der Demokratie finden sollen. Im folgenden Kapitel soll es nun darum gehen, aufzuzeigen, welchen Rahmen das Gebilde der Europäischen Union überhaupt bietet, um solche Elemente einzufügen. Dabei soll es zunächst um die demokratischen Grundlagen der EU gehen, bevor in einem zweiten Teil die spezifischen Probleme, die sich aus dem Gebilde für die Demokratie ergeben, dargestellt werden sollen. Im dritten Teil dieses Kapitels sollen schließlich Lösungsmöglichkeiten aus dem Bereich der Integrationstheorien vorgestellt werden, die dann im abschließenden vierten Kapitel der Arbeit Eingang finden sollen in die Überlegungen hinsichtlich des Potentials der neuen Informationstechnologien.
3.1 Grundlagen einer europäischen Demokratie
„Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedsstaaten gemeinsam.“ (Art. 6 des Vertrags über die Europäische Union)9Mit diesem Artikel im Europäischen Vertrag ist das Demokratieprinzip, das ja in den Mitgliedsländern ohnehin umgesetzt sein muss, auch auf europäischer Ebene zur Verpflichtung gemacht worden. Die EU ist also nicht mehr lediglich „ein Zusammenschluss demokratischer Staaten“ (Schorkopf 2001), sondern als Gebilde an sich demokratisch verfasst. Dabei beruht das Demokratieprinzip der EU auf einem normativen Minimalkonsens, der durch die heterogene Bürgerschaft tragbar erscheint. Denn ein demokratisches Modell als solches hat nur dann eine reele Überlebenschance, wenn „alle politisch signifikanten Gruppen die zentralen politischen Institutionen des Regimes als legitim ansehen und die Spielregeln der Demokratie befolgen, die Demokratie sozusagen ´the only game in town´ ist.“ (Puhle 2001) Voraussetzung dafür scheint aber zu sein, dass sich erst einmal eine europäische Bürgerschaft herauskristallisiert, die sich mit einem solchen Minimalkonsens auseinandersetzt und ihm dann gegebenenfalls durch ihre Zustimmung die entsprechende Legitimation verleiht. An dieser Stelle wird meist der Ruf nach einer civil-society oder einer bürgerlichen Gesellschaft laut, die, so Puhle in den „meisten Bereichen und Dimensionen der demokratischen Konsolidierung präsent (Puhle 2001) ist. Er sieht diese als zentrales Konzept zur „Absicherung von Demokratie“ (ebd.), wobei sich „ ´civil society´ vornehmlich auf die miteinander konkurrierenden und kooperierenden Akteure, Initiativen, Assoziationen und Interessengruppen im vor- und nichtstaatlichen Raum, also im intermediären Bereich zwischen Individuum und Staat, die ihre materiellen oder immateriellen Interessen selbstorganisiert vertreten“ (ebd.) bezieht. Schmidt führt die moderne Ausprägung des Begriffes „Bürgerliche Gesellschaft“ über die feststellbare Doppelexistenz des Bürgers „als privates Wirtschaftssubjekt (Wirtschaftsbürger) und Staatsbürger“ (Schmidt 1995:180) zu der Anforderung nach „regelmäßiger und folgenreicher Beteiligung der Bürgerschaft“ (ebd.:181), was wiederum durch die Zivilgesellschaft ausgeformt werden soll. Diese ist laut Schmidt „ein durch gesicherte Mitsprache- und Mitwirkungsrechte der Bürger festgelegter öffentlicher Bereich, in dem gesellschaftliche Interessen, sich in staatsunabhängigen Assoziationen frei organisieren und artikulieren können.“ (ebd.:1096) Dieser Raum wird augenscheinlich derzeit nur für Nationalstaaten in Anspruch genommen, so dass eine wirkliche Volkssouveränität ebenfalls nur für diesen Raum angenommen wird. „Aus diesem Grund werde die demokratische Legitimation hoheitlicher Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaft auch maßgeblich durch die Vertreter der mitgliedstaatlichen Regierungen im Rat, als zentralem Entscheidungsorgan, vermittelt.“ (Schorkopf 2001) Es geht also um die Herstellung einer europäischen Öffentlichkeit.
3.2 Demokratisierungsprobleme in der EU
Die gesamte Demokratieproblematik wird auf jeden Fall durch die veränderte Rolle der Nationalstaaten, an welche die Demokratie in hohem Maße gebunden scheint, stark beeinflusst10. Es ist also die Frage zu stellen, ob die Form der Demokratie, durch welche die Mitgliedsstaaten der EU zumindest auf der nationalstaatlichen Ebene geprägt sind, auf das Staatengebilde EU übertragbar ist. „Demokratie als Anforderung an die EU stößt jedoch auf das Problem, daß das dogmatische Demokratiemodell auf die institutionelle Organisationsform des Staates ausgerichtet ist. Das zeigt die - vor allem in Deutschland - unter dem Topos des „Demokratiedefizits“ geführte Diskussion um die demokratische Legitimation hoheitlicher Entscheidungen der EU.“ (Schorkopf 2001) Ziel müsste es also sein, das dogmatische aus dem Demokratiemodell zu nehmen und es stattdessen anpassungsfähig zu machen an die verschiedenen Herausforderungen, die an die Demokratie in einem Gebilde wie der EU gestellt werden. Dies beginnt eben damit, dass die Demokratie hier auf kein homogenes Staatsvolk trifft, wodurch der Begriff der civil society und der damit zusammenhängende Minimalkonsens eine neue Charakterisierung erhalten müsste. So dürfte auch keinesfalls der häufige Fehler der Reduktion von „Zivilgesellschaft“ auf die „Bestände und Mechanismen einer demokratischen ´politischen Kultur´ “(Puhle 2001) gemacht werden, vielmehr müsste man sich auch im Sinne der deliberativen Modelle auf Verfahren verständigen, die eine europäische Öffentlichkeit entstehen lassen könnten. „Dabei verlieren die Nationen und ihre kulturellen Traditionen an identitätsstiftender Kraft und machen einer Integration durch wachsende Arbeitsteilung Platz, deren elementare Einheiten nicht Nationen, sondern Individuen sind.“ (Münch 2001:177)
Die Forderung nach der Schaffung eines europäischen Bewusstseins als Voraussetzung einer europäischen Demokratie (vgl. Schmidt-Klingenberg 2002) kann also nicht auf einer Makroebene stehen bleiben und hier bestimmte Organisationen und Gruppen in die Pflicht nehmen, sondern muss sich ebenfalls auf die Ebene des Individuums begeben, dort Verfahren schaffen, mit deren Hilfe sich das Individuum mit dem neuen System auseinandersetzen kann. Jedoch bleibt natürlich auch auf der anderen Seite die Forderung an das politische System, auch innerhalb seiner eigenen Strukturen als „Vorbild“ voranzuschreiten: „Die demokratischen Strukturen der EU unterliegen den besonderen Bedingungen ihres institutionellen Charakters, weshalb sie sich an dem substantiellen Gehalt des Demokratieprinzips orientieren und notwendige integrationsbedingte Anpassungen vornehmen muss. Dazu ist es zunächst erforderlich, einzelne, mitgliedsstaatliche Perspektiven zu verlassen, um einen möglichst repräsentativen, von nationalen Eigenheiten befreiten Kanon demokratischer Kernbestandteile zu identifizieren.“ (Schorkopf 2001) Die Schlüsselwörter für die Demokratieproblematik in der EU lauten im Großen und Ganzen Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit und Kohärenz. Diese Begriffe sind neben der Effektivität auch zugleich die Grundsätze für eine Reform des Regierens, wie sie im Weißbuch „Governance“11der Europäischen Kommission vorgestellt wurden12. Zur Erreichung dieser Ziele setzt die Kommission auch zunehmend auf das Internet, doch dazu mehr in Kapitel 4.
Wenn jedoch die Elemente Offenheit, Partizipation und Verantwortlichkeit wie sie das Weißbuch auslegt, demokratietheoretisch und gleichzeitig kritisch angegangen werden, so lässt sich festhalten, dass sie eine Bindung der Kommission an Entscheidungen von außen ebenso wenig vorsehen wie eine politische Auseinandersetzung über Ziele und Mittel. So sieht das Weißbuch beispielsweise zwar eine transparentere und bessere Zuweisung von Verantwortlichkeit vor, sieht aber von konkreten Sanktionierungsmaßnahmen ab. Außerdem geht das Weißbuch an vielen Stellen über die Konzeptionen, wie sie auch verschiedenen internationalen Organisationen zugrunde liegen, nicht hinaus. Es weist noch nicht wirklich über den bisherigen, eingeschränkten Dialog der europäischen Demokratie mit Eliten und Korporationen hinaus. Die formulierten Vorsätze jedoch gehen in die Richtung der der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden Überlegungen hinsichtlich der Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit, mit der die EU-Regierung dann in einen besseren, weil ausgeprägteren Dialog zu treten hätte. „Structure the EU’s relationship with civil society.” (EU-Kommission 1997) ist hierbei der deutlichste Ausdruck des Vorhabens, aber auch die folgenden Vorsätze „Make greater use of the skills and practical experience of regional and local actors“, „Build public confidence in the way policy makers use expert advice”, „Support the clearer definition of EU policy objectives and improve the effectiveness of EU policies”, „Set out the conditions for establishing EU regulatory agencies” oder „Refocus the roles and responsibilities of each Institution” (ebd.) sind geprägt vom Bewusstsein, einen Dialog zwischen dem politischen System und der Gesellschaft zu forcieren bzw. durch eine erhöhte Transparenz zumindest einen höheren Informationsgrad zu erhalten.
Wie dies trotz der großen Heterogenität der EU zu verwirklichen ist und wie die unterschiedlichen Mitglieder innerhalb der EU zu einer funktionierenden Demokratie zusammengefasst werden können, soll anhand der integrationstheoretischen Überlegungen im folgenden Unterkapitel angedeutet werden.
3.3 Integrationstheorien
Ganz allgemein definiert Schmidt den Begriff der Integration als eine „(Wieder-) Herstellung eines Ganzen durch Einbeziehung außenstehender Elemente.“ (Schmidt 1995:431) Etwas spezifischer betrachtet, kommt Gierung zur der Aussage, dass „Integration in der Regel als die friedliche und freiwillige Annäherung bzw. Zusammenführung von Gesellschaften, Staaten und Volkswirtschaften über bislang bestehende Grenzen hinweg“ (in Weidenfeld/Wessels 2000:262) verstanden wird. Es gibt jedoch auch kritischere Überlegungen hinsichtlich des Prozesses einer Integration, die beispielsweise auch Bach referiert: „Integration ist für Lepsius gleichbedeutend mit: Einschränkung von Freiheiten, nämlich Schrumpfung demokratischer Selbstbestimmung, De-Institutionalisierung von ´Konstruktionen von Verantwortlichkeiten und Haftungen´ sowie Verlust von Autonomie national geformter politischer Kulturen, als deren legitime Träger die Nationalstaaten bisher erfolgreich fungierten.“ (Bach 2001:153)
Generell sind es die Fragen nach dem Warum, dem Wie , dem Wer und dem Wohin in Bezug auf eine angestrebte Integration, die dann mit Hilfe verschiedener Ansätze gelöst werden sollen. Speziell bei der europäischen Integration spielen drei solcher Ansätze von Beginn an eine entscheidende Rolle: der Föderalismus, der Intergouvernementalismus, der (Neo-)Funktionalismus13. Jedoch kommt auch Gierung in seinem Beitrag zu dem Schluss, dass „[i]n der Theoriedebatte [...] sich nie ein Ansatz allein durchgesetzt“ (Weidenfeld/Wessels 2000:266) hat.
„Die europäische Integration vollzieht sich so als ein umfassender und tiefgreifender Prozess des institutionellen und kulturellen Wandels.“ (Münch 2001:177) Infolgedessen sollte dieser Prozess von weitreichenden theoretischen Überlegungen unterfüttert sein, um die verschiedenen Prozesse der Integration, die laut vielen Integrationstheoretikern sehr ähnlich sind, optimal verlaufen zu lassen. Auch bei den Ursachen für die notwendig gewordene Integration der europäischen Einzelstaaten zu einem Gebilde EU herrscht im Großen und Ganzen Einigkeit: „Funktionsdefizite europäischer Nationalstaaten im Zeitalter der Industriegesellschaft führen zur Ausbildung supranationaler Strukturen.“ (Loth 2001:95) Diese Funktionsdefizite haben dazu geführt, dass nun die allgemeine Meinung herrscht, dass die folgenden Ziele besser durch eine Integration auf der europäischen Ebene erreichbar seien, nämlich „[...] die Wahrung des Friedens in der Region, die Durchsetzung gemeinsamer Interessen gegenüber Dritten, die Gewährleistung von Freiheit und Demokratie sowie die Herstellung gesellschaftlichen Wohlstandes durch die Bündelung ökonomischer Ressourcen.“ (in Weidenfeld/Wessels 2000:267) Diese Ziele gehen beinahe konform mit denen bei Loth angeführten Antriebskräften der europäischen Union, wobei er einschränkt, dass diese verschiedenen Kräfte nicht immer gleich bedeutend waren, sondern sich sogar manchmal diametral gegenüber standen. „Mit dem Hinweis auf die unterschiedlichen Antriebskräfte europäischer Integration kann auch erklärt werden, wieso bestimmte Integrationsmethoden erfolgreich waren, andere hingegen nicht.“ (Loth 2001:101)
Unterschiedlich gestalten sich dann die Perspektiven auf die Integration, die sich beispielsweise zwischen einer eher regierungskonzentrierten Betrachtungsweise und einer bürgernahen bewegen. Im Blickpunkt der vorliegenden Arbeit sollte eher der Bürger stehen, für den das politische System die entsprechenden Verfahren zu erhöhter Bürgerbeteiligung zur Verfügung stellen sollte. Mit der Übersicht zu verschiedenen theoretischen Konzepten der sozialwissenschaftlichen Europaforschung findet sich im Anhang.
Montanunion und den römischen Verträgen setzte sich allerdings zumindest zunächst eine Integration durch, „die wenig Wert auf Bürgerbeteiligung legte und die integrierten Politikbereiche der öffentlichen Diskussion entzog: Nur wenn man die Implikationen im Ungefähren beließ, war zu verhindern, dass negative Koalitionen die stets umstrittenen Integrationsschritte vereitelten.“ (ebd.:102) Allerdings ist die EU nun durch eine kontinuierliche Erweiterung ihrer Kompetenzen in ein Stadium eingetreten, dass eine solche Vorgehensweise für den Bürger nicht mehr akzeptabel erscheint (vgl. zu den Kompetenzerweiterungen auch Bach 2001:152).
So kommt auch Loth zu einem ähnlichen Schluss wie Münch: „Die Zukunft der Europäischen Union wird darum in ganz entscheidendem Maße davon abhängen, wieweit es gelingt, Entscheidungen in der Europäischen Union transparent, kontrollierbar und korrigierbar zu machen.“ (Loth 2001:102) Damit einhergehend kann auch die von Kaelble nachgezeichnete Entwicklung einer europäischen Öffentlichkeit hinzugezogen werden, die von einer „klassische[n] Ära der Öffentlichkeit schmaler intellektueller und liberaler Zirkel in der Zeit der ´Aufklärung´ über die ´Zeit nationaler Massenöffentlichkeit´ hin zu den Veränderungen seit dem Zweiten Weltkrieg reichen, die bestimmt sind durch die Massenmedien.“ (vgl. Loth 2001:103) In der Zeit des Internet soll nun im folgenden Kapitel angedeutet werden, welche Potentiale im Internet stecken, um Integrationsprozesse zu fördern und um Forderungen der unterschiedlichen Demokratietheorien zu erfüllen. Das Internet bietet jedenfalls verschiedene Möglichkeiten der Einflussnahme, die, vor dem Hintergrund, dass „die Binnenmarktintegration [...] einen Prozess des Struktur-, Institutionen- und Kulturwandels auf allen Ebenen in Gang [setzt], von der europäischen über die nationale bis zur regionalen und lokalen Ebene“ (Münch 2001:177), dem einzelnen europäischen Bürger auch zugänglich gemacht werden sollten.
4 Demokratie und Internet
Wie in Kapitel zwei gesehen, ist ein zentraler Aspekt der verschiedenen Demokratietheorien der Meinungs- und Willensbildungsprozess, zumindest in Bezug auf eine erwünschte Erhöhung der Bürgerbeteiligung. Diese 18 Prozesse vollziehen sich in einem öffentlichen Raum, aus dem heraus sich der Bürger seine Informationen besorgt und sich seine Meinung bildet. Wie in Kapitel drei angedeutet, gestaltet sich gerade diese Herausbildung eines öffentlichen Raumes bzw. einer Öffentlichkeit als solcher auf europäischer Ebene als schwierig. In diesem Kapitel soll es nun darum gehen, inwieweit das Internet zur Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit beitragen könnte, auf deren Boden es dann zu einer erhöhten Bürgerbeteiligung, zumindest jedoch zum Abbau politischer Apathie kommen könnte14. So stellt sich hier die Frage, ob das Internet möglicherweise das Ziel der von Münch angesprochenen Suche sein kann: „Die insgesamt geringe Zufriedenheit mit der Demokratie auf europäischer Ebene hat eine fieberhafte Suche nach der adäquaten Behebung dieses sogenannten europäischen Demokratiedefizits ausgelöst.“ (Münch 2001:199) Denn diese Suche gilt nicht zuletzt der Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit. Betrachtet man das Internet aus einer rein technologischen Sicht wie beispielsweise Bill Gates, so bietet es geradezu ideale Voraussetzungen für die Verwirklichung einer partizipatorischen, deliberativen oder direkten Demokratie. „Mit interaktiven Netzwerken verbundene Personalcomputer werden Bürgern die Möglichkeit geben, mit nahezu einzigartiger Leichtigkeit und Unmittelbarkeit an demokratischen Prozessen teilzuhaben.“ (Gates 1996)
Um jedoch auch nicht einer naiven Technikgläubigkeit zu verfallen, sollen in einem Unterkapitel auch die kritischen Stimmen zu den Risiken für die Demokratie, die das Internet in sich birgt, zu Wort kommen.
4.1 Der Einfluss des Internet auf Konzepte der Öffentlichkeit
An dieser Stelle soll auf eine technische Einführung sowie auf eine geschichtliche Einordnung des Internet aus Platzgründen verzichtet werden15. Vielmehr soll angedeutet werden, welchen Einfluss das Internet auf bekannte Konzepte wie den Datenschutz oder die Informationsfreiheit hat. Beide Konzepte betreffen eine Öffentlichkeit, von der auch schon an verschiedenen Stellen der Arbeit die Rede war und deren Begriff nun in einem kleinen Exkurs näher erläutert werden soll. Es liegt auf der Hand, dass aufgrund der weltweiten Reichweite des Internet sich Neuerungen ergeben, die nicht mehr mit Konzepten zu fassen sind, die sich auf die mehr oder weniger regional begrenzten bisherigen (Massen-)Medien bezogen.
4.1.1 Der Begriff der Öffentlichkeit
Im Handbuch der Publizistik wird Öffentlichkeit als eine „unbegrenzte anonyme Vielzahl von Menschen (einzeln oder verbunden), die allgemein erreichbar und allgemein ansprechbar sind“ (Dovifat 1971:13) definiert. Damit bezieht sich diese Definition auf die Dimension der Öffentlichkeit als Publikum, das von einem Außenstehenden erreicht bzw. angesprochen werden soll. Die Freiheit, diese Öffentlichkeit anzusprechen, ist sogar im Grundgesetz verfassungsrechtlich gesichert16. „Der gesetzlich sanktionierte Anspruch auf eine öffentliche Aufgabe und der gesetzlich garantierte Zugang zur Öffentlichkeit sind somit Grundvoraussetzungen einer demokratischen Meinungs- und Willensbildung.“ (ebd.:16)
Manfred G. Schmidt sieht vier verschiedene Dimensionen des „mehrdeutigen Begriffs“, nämlich die Öffentlichkeit als Bereich und als Prozess, die Öffentlichkeit als Publizität und im Sinne von Publikum (vgl. Schmidt 1995:672). Wenn Schmidt im folgenden auf Habermas und verschiedene Verfahren der empirischen Demokratieforschung verweist, wird deutlich, dass das Konzept der Öffentlichkeit keinesfalls nur eine periphere Variable im Feld der Demokratieforschung ist. Vielmehr wird an Variablen der Öffentlichkeit, wie beispielsweise der Meinungs- oder der Pressefreiheit der Grad der Demokratisierung eines Staates gemessen (vgl. ebd.)
Der Begriff der Öffentlichkeit bzw. der öffentlichen Meinung erhält so auch in die verschiedenen Demokratietheorien Einzug. Beispielsweise geht Guggenberger davon aus, dass die öffentliche Meinung im Pluralismus eine Art Schiedsrichterrolle übernimmt, um zwischen unterschiedlichen Interessen und daraus resultierenden Konflikten zu entscheiden (vgl. in Nohlen 1998:468)17. Zugestanden wird der Öffentlichkeit im Grunde in jeder Theorie eine Vermittlungsfunktion zwischen den Institutionen des Staates, seinen Bürgern und anderen sozialen Systemen.
Nicht zuletzt ist die Öffentlichkeit der „nichtprivate, allgemein zugängliche Kommunikationsbereich“ (ebd.), der also damit auch der Raum für jegliche politische Diskussion sein wird und demzufolge auch allen Bürgern gleich leicht zugänglich sein muss. Insofern ist dieser Bereich gar nicht zu unterschätzen, denn „[d]ie Kommunikation unter den Menschen ist der Grundstein jeder demokratischen Gesellschaft.“ (Rheingold 1995:194)
Habermas Überlegungen könnte man, ähnlich wie Rheingolds Aussagen, zu der These zuspitzen, dass die Massenmedien die Öffentlichkeit zu einer Ware verkommen ließen. Die neuen Medien wie das Internet würden nun aber die Möglichkeit bieten, diese Öffentlichkeit wiederzubeleben. „Ich sehe computer conferencing als eine potentielle Kraft, damit sich in unserer fragmentierten Gesellschaft wieder so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann. Die Fähigkeit und die Freiheit der Menschen, ohne jede Beschränkung miteinander kommunizieren zu können, ist meiner Ansicht nach für die Demokratie von genauso grundlegender Bedeutung wie für die Gemeinschaft.“ (ebd.:189) Dieses optimistische Bild ob eines Einflusses des Internet auf die Öffentlichkeit ist geprägt von der Hoffnung in eine Kommunikation Vieler an Viele ohne „Torwächter“ (ebd.:190), die den Informationsfluss zentralisieren. Ob hier allerdings nicht ein allzu hoffnungsfroher, ja beinahe von einer gewissen Naivität gezeichneter Glaube in die Versprechungen der Technik zu erkennen ist, soll im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit im Auge behalten werden.
In Bezug auf eine spezifische europäische Öffentlichkeit referiert Bach auf eine empirische Studie von Jürgen Gerhards, die sich mit dem „Öffentlichkeitsdefizit des europäischen Entscheidungssystems“ (Bach 2001:159) befasst. Dort würde explizit herausgearbeitet, dass „das Fehlen einer europäischen politischen Öffentlichkeit auch ´die Konstruktion einer europäischen Identität´ [blockiere], da das ´Einstellungsobjekt Europa´ öffentlich nur wenig präsent sei, es an Informationen über Europa mangele und sich dadurch eine entsprechende europäische öffentliche Meinung nicht bilden könne.“ (ebd.:159f.)18Wiederum geht es also um die Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit, die Einfluss auf den politischen Prozess nehmen könnte, ihm damit eine Identität verschaffen und zu mehr Legitimation verhelfen würde. Dabei wird im weiteren Verlauf Bachs Dokumentation bezüglich einer europäischen Öffentlichkeit auf andere Studien verwiesen, die den Begriff der Öffentlichkeit aufteilen, also nicht die Schaffung einer europäischen Gesamtöffentlichkeit anstreben, sondern sich damit begnügen, Teilöffentlichkeiten zu schaffen, innerhalb dieser es mit den jeweiligen Experten und Interessierten zu einer partiellen Deliberation kommen könnte (vgl. ebd.:160).
Sowohl zur Unterstützung einer Gesamtöffentlichkeit als auch zur Unterfütterung solcher möglicherweise partiellen Öffentlichkeiten könnte das Medium Internet einen nicht unwichtigen Beitrag leisten. Im folgenden sollen jedoch Überlegungen in die Arbeit Eingang finden, die bereits beim klassischen Begriff der Öffentlichkeit bedenkenswert waren und die nun eine ganz neue Dimension erhalten.
4.1.2 Exkurs Datenschutz
„Die Anforderungen an den Datenschutz werden in dem Maße zunehmen, wie das Potential der neuen Technologien, (auch grenzüberschreitend) detaillierte Informationen über Privatpersonen [...] zu gewinnen und zu manipulieren, genutzt wird. Ohne die rechtliche Sicherheit eines unionsweiten Konzepts wird der Vertrauensmangel auf Seiten des Verbrauchers einer raschen Entwicklung der Informationsgesellschaft im Wege stehen.“ (Bangemann 1995:276) Es sind hier also die Risiken für die Privatperson in Bezug auf ihre Privatsphäre, die den Möglichkeiten der neuen Technologien hinsichtlich jeglicher Transparenzforderungen entgegen stehen. Die Akzeptanz gegenüber der Ausnutzung der Technologien wird demzufolge davon abhängen, inwieweit dem Einzelnen klar gemacht werden kann, dass die Ressourcen der Technologie nicht auch zu Zwecken verwendet werden, die entgegen seinen persönlichen Rechten stehen. Diese Entwicklung betont auch Bull, wenn er sagt, dass „[n]euerdings [...] auch der Konflikt zwischen dem Geheimhaltungsinteresse Betroffener und Transparenzforderungen aufgrund des Demokratieprinzips oder zu Forschungszwecken deutlicher wahrgenommen“ wird (in Nohlen 1998:80). Meyer erkennt die Verschärfung dieses Konfliktes durch die neuen Technologien und fordert direkt die EU zu einem Ausgleich möglicher Dissonanzen auf: „Eine weitere Herausforderung ist die Wahrung des Datenschutzes in einer vernetzten Welt. Die EU muss eine Balance finden, einerseits die Privatsphäre des Bürgers zu schützen und andererseits kriminellen Gefahren mittels des Einsatzes von Kontrolltechnologien zu begegnen.“ (in Weidenfeld/Wessels 2000:292)
Dabei ist nicht nur der Schutz vor bzw. die Bekämpfung von kriminellen Gefahren von Belang, sondern der Bereich des Datenschutzes „ist generell ein Teilgebiet des sich erst entwickelnden Informationsrechts [...]; komplementär zum Schutz vor unangemessener Informationspraxis gehört zu diesem Rechtsgebiet auch das Recht auf Information (Informationsfreiheit) [...]“ (in Nohlen 1998:78) und damit eigentlich einhergehend auch das Recht der freien Meinungsäußerung.
4.1.3 Exkurs Informations- und Meinungsfreiheit
„Informationsfreiheit ist einerseits das von der Verfassung garantierte Grundrecht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu informieren [...]“ (in Nohlen 1998:282). Dabei handelt es sich um eine deutlich negativ ausgerichtetes Recht, das die „Abwehr staatlicher Behinderungen der Informationsgewinnung“ (ebd.) gewährleisten soll. Weitergehend stellt sich da schon das in einigen Ländern ausgeformte „allgemeine Bürgerrecht auf Zugang zu den Akten und Daten der Verwaltung“ (ebd.:78) dar, das also eine Offenlegung herrschaftlichen Wissens fordert und damit über das noch auf den „Obrigkeitsstaat zurückgehende >Arkanprinzip<: was nicht 23 ausdrücklich freigegeben oder veröffentlicht wird, gilt als geheim“ (ebd.:282) hinausgeht. Diesem Bürgerrecht liegt die Überzeugung zugrunde, „daß Informationsteilhabe von entscheidender Bedeutung für die Kontrolle der Staatsorgane und die politische Auseinandersetzung mit Machtträgern ist [...]“ (ebd.) Diese Ansicht begann sich auf EU-Ebene 1990 durchzusetzen, als zunächst Auskunfts- und Einsichtsrechte bei Umweltdaten durchgesetzt wurden19.
Leggewie sieht genau in den durch das Internet vergrößerten Möglichkeiten der Veröffentlichung von Regierungsdokumenten die Chance zur „Erhöhung der Transparenz“ (Leggewie 1998:29) und damit zu einer stärkeren „Mitwirkung interessierter Bürger am Entscheidungsprozeß selbst, in Gestalt elektronischer Petitionen oder Mediationsverfahren, aber auch durch elektronische Abstimmungen und Plebiszite.“ (ebd.) Hier befinden wir uns aber bereits mitten in den Potentialen des Internet bezüglich der Ausformung einer erhöhten Bürgerbeteiligung, um die es dann speziell in Kapitel 4.2 gehen soll. An dieser Stelle soll jedoch noch der hier ebenfalls inhärente Aspekt der Meinungsfreiheit angesprochen werden.
Hier liegen die Potentiale des Internet vor allem in der Aufhebung der klassischen Aufteilung in Informationsanbieter und -nutzer. Bedingt dadurch, dass ein Zugang zum Internet beide Rollen einschließt, ist die Möglichkeit für jeden gegeben, seiner Meinung einen freien Ausdruck zu verleihen. Soweit zumindest die Theorie, die in dieser Form auch von den Anhängern der neuen Technologie beinahe vorbehaltlos vertreten wird. Es soll hier nicht weiter auf bereits ansatzweise festgestellte Trübungen dieser Theorie eingegangen werden, doch haben neuere Untersuchungen, die auch die Anbieterseite stärker unter die Lupe nehmen, bereits gezeigt, dass es hier gar nicht so weit her ist, mit der freien Meinungsäußerung durch jedermann20.
4.2 Demokratietheoretische Potentiale des Internet
Zu einer erhöhten Bürgerbeteiligung, also einer Steigerung der Partizipation der Öffentlichkeit kann das Internet dann beitragen, „wenn und falls es die >Kosten< politischer Beteiligung senkt und spezielle Vorteile schafft.“ (Leggewie 1998:35) Wo aber könnten konkrete Vorteile liegen? Die Ziele sollten klar sein, denn wie bereits verdeutlicht, fehlt es der EU an einer politisch interessierten und engagierten Öffentlichkeit, die es eventuell mit Hilfe des Internet zu fördern gilt. Bangemann sieht den zu nutzenden Vorteil des Internet in seiner breiten Verfügbarkeit, was die Chance biete, für „mehr Gleichberechtigung und Ausgewogenheit in der Gesellschaft“ (Bangemann 1995:266) zu sorgen und „den europäischen Zusammenhalt zu stärken.“ (ebd.) Derzeit fehle es laut Bach in der EU zwischen der Gesellschaft und dem politischen System an der „sozialkommunikativen Rückkopplung von politischen Herrschaftspositionen und Entscheidungen an die Präferenzen der Bürger.“ (Bach 2001:159)
Ein mögliches Veränderungspotential verbirgt sich hinter der bereits angesprochenen Aufhebung der bisherigen Aufteilung von Informationsanbieter und -nutzer. Die Möglichkeiten der Interaktivität, die das Internet bietet, erlauben es dem Nutzer, sprich dem Bürger, aus seiner passiven Rolle des bloßen Informationskonsumenten herauszutreten und selbst seine Meinung zu äußern und publik zu machen. In den traditionellen Kommunikationsformen befanden sich der Anbieter und der Nutzer „in der Regel nicht in einem direkten Interaktionsverhältnis, vielmehr ist der Sender weitgehend anonym, und die Empfänger haben keine unmittelbare Möglichkeit der Reaktion auf eine Kommunikation.“ (in Nohlen 1998:420)
Auch Rilling weist trotz seiner insgesamt skeptischen Ausführungen in Bezug auf die demokratietheoretischen Möglichkeiten des Internet auf die hier schlummernden Potentiale hin. Diese sieht er in der „Senkung der Zugangsschwellen für Informationen“, der „Beschleunigung der Bereitstellung, Verteilung und Aufnahme politischer Informationen“, der „Erhöhung der Selektivität“, der „Erweiterung des individuellen Handlungsspielraums“, der „soziale[n] und informationelle[n] Dekontextualisierung“, der „Ausdünnung der Kommunikationshierarchien“ und der „interaktive[n] und polydirektionale[n] statt überwiegend 25 distributive[r] Formen politischer Kommunikation.“ (vgl. Rilling 1997) Er schränkt aber auch sogleich ein: „Noch werden die demokratiepolitischen Potentiale des Netzes kaum genutzt, läßt die Kommerzialisierung der Netze den politischen Diskurs zur Randerscheinung werden.“ (ebd., siehe auch Kapitel 4.3) Aufgrund der verschiedenen noch zu behandelnden Nachteile kommt Rilling zu dem Schluss, dass es zu keiner „Infragestellung der repräsentativen Demokratie durch Ausbau der sogenannten direktdemokratischen Technik“ kommen dürfe, aber durch „sachlich begrenzte Beteiligung auf ausschließlich kommunaler Ebene könne Politikverdrossenheit abgebaut und damit Legitimation gefördert werden.“ (ebd.) Er bezeichnet die neuen Technologien als ein „Medium politischer Akzeptanzbildung“, nicht ganz schlüssig erscheint jedoch, warum dies auf der kommunalen Ebene verbleiben sollte. Denn auf der Bundesebene werden entsprechende Angebote bereits seit längerem erfolgreich angeboten21und dabei gehen die anfänglich lediglich der Information dienenden Angebote bereits darüber hinaus: „Der Umsetzungsplan für die E-Government Initiative BundOnline 2005 legt den Fahrplan fest, um bis 2005 alle internetfähigen Dienstleistungen des Bundes online bereitzustellen.“ (Schily 2002) Auch die EU bietet verschiedenste Möglichkeiten zur Information im Internet, so ist beispielsweise die Europa- Homepage der Kommission die Startseite zu Institutionen und Politikbereichen sowie zu zahlreichen offiziellen Informationen und Dokumenten der EU (vgl. in Weidenfeld/Wessels 2000:435ff. mit einer Art Inhaltsverzeichnis an Internetadressen mit EU-politischem Hintergrund). In diesem Sinne stand auch eine Konferenz in Berlin am 21. September 2001 unter dem Titel „Internet for all - Equal opportunities on the net“, wobei Errki Liikanen, Mitglied der Europäischen Kommission betont: „The new economy and the Internet have been on top of the EU agenda since the Lisbon Summit, in March 2000.” Und diese Relevanz habe die Thematik auch noch nicht eingebüßt. Und auch Rechung getragen wurde dieser Relevanz, denn die Europäische Union hat eine neue Initiative zur interaktiven Politikgestaltung vorgestellt, deren Ziel die Verbesserung der Politikgestaltung mit Hilfe des Internet ist22. Dabei setzt diese Initiative auf zwei Mechanismen, nämlich zum einen ständigen Zugang zu den Meinungen der Nutzer und damit Bürger zu erhalten und zum anderen von der Politik der Kommission direkt Betroffene schneller und effizienter zu neuen Initiativen befragen zu können. Leicht erkenntlich ist, dass diese Mechanismen auf der möglichen Interaktivität des Internet basieren. Ebenso ist die Seite „Ihre Stimme in Europa“23 ein Teil der interaktiven Politikgestaltung, mit der die Kommission das Internet für die Gestaltung der EU-Politik nutzen will.
Bei all diesen Bemühungen ist erkenntlich, dass mit Hilfe vor allem der interaktiven Möglichkeiten des Internet, dieses dazu benutzt werden soll, dem Bürger mehr Möglichkeiten zur Partizipation am politischen Geschehen zu bieten. Der Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit durch das Internet werden zwar weiterhin die unter 4.3 noch näher zu erläuternden Risiken erschwerend im Wege stehen, doch sollten und werden erste realistische Schritte unternommen gemäß den optimistischen Einschätzungen Leggewies. Denn demnach bestünde der Gewinn des Internet vor allem darin, „daß es partielle Öffentlichkeit und temporäre Gemeinschaft zwischen Leuten herstellen kann, die sich fern stehen - was angesichts globaler Interdependenzen unbestreitbar ein Fortschritt wäre.“ (Leggewie 1998:44) Außerdem sieht er die Möglichkeit „einen eventuellen Beteiligungsschub von unten zu fördern“, „lokale Öffentlichkeiten zu verdichten“ und damit schlussendlich den „politischen Prozeß insgesamt wieder mit größerer Legitimität auszustatten.“ (vgl. ebd.:48f.)
4.3 Demokratietheoretische Risiken des Internet
„More people use infoseek finding Pamela Anderson than Bill Clinton. Sorry for that, Bill.” (Leggewie 1998:15)24Was durch diese Anzeige deutlich wird, ist weniger ein Risikopotential, welches mit dem Intenet verbunden sein könnte, als eine Unterstützung Rillings zentraler These: „Das Netz ist unpolitisch.“25(Rilling 1997) Rilling sieht sich die reale Ungleichheit im Netz verdoppeln und befürchtet, dass die auf Repräsentation basierende westliche Demokratie durch die direktdemokratischen Verführungen des Netzes untergraben wird. Diesem Argument liegt die „kulturpessimistisch getragene Mutmaßung“ (Rilling 1997) zugrunde, „die durch elektronische Demokratie das prekäre Arrangement indirekter, repräsentativer Elitendemokratie durch populistische Inszenierung eines schwankenden Mehrheitswillen bedroht sieht.“ (ebd.) Bedingt auch durch seine Feststellung, dass es im Netz durchaus ebenfalls gravierende ressourcenbedingte Unterschiede gibt26kommt er zu dem Schluss, dass „[d]as Netz [...] ein Medium für die ´grosse Unterhaltung´ , also politische Meinungs- und Willensbildung [sein kann]. Es ist kein Raum für politische Entscheidungen.“ (ebd.) Damit wäre die Konsequenz aus der in Kapitel 4.1.3 unter Fußnote 20 eingebrachten Problematik einer „Kommunikationsungleichheit“ (Leggewie 1998:41) gezogen, deren Gefahr auch Bangemann erkennt: „Die Hauptgefahr liegt in einer Zweiteilung der Gesellschaft in >Wissende<, die Zugang zu den neuen Technologien haben, sie problemlos nutzen und voll von ihnen profitieren können, und >Nichtwissende<, denen dies nicht möglich ist.“ (Bangemann 1995:266) Um also das Internet tatsächlich als ein politisches Entscheidungsmedium nutzen zu können, müsste es dem von Leggewie angedeuteten Idealbild als „allgemeine[m], freie[m], billige[m], leicht zugängliche[m] und bedienbare[m] Medium“ (Leggewie 1998:23) entsprechen. „[...] davon ist es weit entfernt.“ (ebd.)
Dennoch ist Leggewie in Bezug auf die demokratietheoretischen Potentiale des Internet optimistisch eingestellt und relativiert auch die Kritik: „Das meiste, was als verheerende Folge des Internet der Politik prognostiziert worden ist (elektronischer Populismus, Informationsüberschwemmung, Ende der Öffentlichkeit, Erosion staatlicher Souveränität, Schwächung des Repräsentationsprinzips und dergleichen), all jenes trifft man bereits unter den Bedingungen herkömmlicher politischer Kommunikation an.“ (Leggewie 1998:18)
Hier lässt sich auch Barber anfügen, denn „[w]enn die Technologie also zu politischen Differenzierungen führen soll, dann muß erst einmal die Politik geändert werden.“ (Barber 1998:124) Im Moment sieht er lediglich Konzentrationsbewegungen in der Medienlandschaft, die zu Monopolen führten und damit zu „Kommunikationsleviathanen“(ebd.: 128). „Das Ergebnis lautet: Zunehmend wird von Vielfalt geredet - und zunehmend hält Uniformität bei Produkten und Inhalten Einzug.“ (ebd.)
Aber auch von der Seite der Politik her betrachtet, erschwert diese Entwicklung den effizienten politischen Zugriff auf das Internet, das zunehmend kommerzialisiert wird und damit eher den Gesetzten des Marktes als denen der Politik zu gehorchen scheint. Aber diese Problematik ergibt sich nicht erst auf der Bühne der neuen Technologien und im virtuellen Raum des Internet, sondern ist in Zeiten der Globalisierung allgegenwärtig. „Diese Schwierigkeit, steuernd in die Entwicklung des Internet einzugreifen, illustriert den generellen Verlust der >externen Effizienz< staatlicher Eingriffe in die wirtschaftliche, technische und kulturelle Entwicklung im allgemeinen und den Kontrollverlust des Nationalstaates als der dafür zuständig erklärten Institution im besonderen.“ (Leggewie 1998:22) Vielleicht sind an dieser Stelle dann die Möglichkeiten einer konzentrierten politischen Nutzung des Internet von Seiten der EU sogar höher als die des Nationalstaates.
Eine weitere Problematik des Internet entspricht dann der auch dieser Arbeit nach grundlegenden Schwierigkeit der EU, nämlich der Heterogenität der Bevölkerung. Eventuell sind auch die Lösungsmöglichkeiten evident: „Nach dem gegenwärtigen Stand kann aus der Gesamtheit der Netz-Konsumenten [...] noch kein repräsentativer >demos< oder >mini-populus< geschnitten werden, und insofern bleiben Netze auf partielle Deliberation und punktuelle Partizipation zugeschnitten.“ (Leggewie 1998:42) Und auch Barbers Antwort auf die Frage, ob „dieser Entwurf der globalen Kommerzialisierung und der zunehmenden Monopolisierung also [bedeutet], daß alle technologischen Innovationen sich gegen die Demokratie richten“ (Barber 1998:131) fällt nicht eindeutig 29 aus. Um hier positiv antworten zu können, seien politische Direktiven nötig, um die technischen Potentiale im Sinne der Demokratie nutzen zu können. „Wir müssen also nicht bei der Technologie anfangen, sondern bei der Politik.“ (ebd.)
5 Demokratietheorie, EU und Internet - Eine Zusammenfassung
Die Beschäftigung mit den drei normativen Demokratietheorien und selbst die mit dem Modell der direkten Demokratie in dieser Arbeit hat gezeigt, dass die Herausbildung einer angestrebten aktiveren Öffentlichkeit, die sich durch eine erhöhte Bürgerbeteiligung äußern würde, eng verbunden ist mit den Konzepten der Meinungs- und Willensbildung. So kommen sowohl die pluralistische, als auch die partizipatorische und die deliberative Theorie der Demokratie zu dem Schluss, dass in den heutigen demokratischen Gebilden die Form der Repräsentation eigentlich unumgänglich ist, jedoch durch entsprechende Elemente zu ergänzen sei. Betont wurde demzufolge, dass es sich auch bei den Forderungen nach mehr direkter Demokratie lediglich um partielle plebiszitäre Elemente handeln könne. Alle diese in das unumgängliche Repräsentationsmodell einzufügenden Elemente hätten zum Ziel, die derzeit feststellbare politische Apathie der Bevölkerung zu bekämpfen und auf der europäischen Ebene die Entwicklung einer politisch interessierten Öffentlichkeit zu forcieren. Bei dieser Öffentlichkeit gilt es natürlich die Heterogenität des Gebildes EU zu beachten und das Anliegen nicht durch zu hohe Anforderungen von vornherein zum Scheitern zu verurteilen. Demzufolge schränkt auch Barber ein, dass nämlich nicht vorausgesetzt werden darf und kann, dass der Bürger an allen Diskussionen teilnimmt, jedoch es das Ziel partizipatorischer Demokratie sei, dass das Bewußtsein für mehr Diskussionsbedarf und das Interesse an einer Teilnahme um Meinungs- und Willensbildungsprozeß zunimmt (vgl. Barber 1994) Es geht also erst einmal darum, wie in Kapitel
4.3 dargestellt, die Strukturen in der Realität dahingehend zu ändern, dass überhaupt ein Interesse an mehr Bürgerbeteiligung von Seiten der Öffentlichkeit besteht.
Im momentanen Stadium kann das Internet im Grunde nur dazu beitragen durch erhöhte Möglichkeiten der Informationsverbreitung ein 30 wachsendes Interesse an den politischen Prozessen zu wecken. Ist dies geschehen, bietet das Internet wiederum ein enormes Interaktivitätspotential, das es zu nutzen gilt. Im Moment sind es also allenfalls deliberative Elemente, die mit Hilfe des Internet einen stärkeren Einfluss gewinnen könnten. Solche Elemente wären ein öffentlicher argumentativer Austausch, eine prinzipielle Unbegrenztheit der Diskurse, sowie eine Festlegung der Themen durch die Beteiligten selbst. Für all diese Elemente birgt das Internet die entsprechenden Ressourcen.
Allerdings liegt der deliberativen Theorie im Allgemeinen ein sehr positives Menschenbild zugrunde, das in der Realität auch gegeben sein müsste, damit das Internet überhaupt sein Potential zur Umsetzung der Theorie einbringen könnte. „Eine apathische Bürgerschaft wird das Internet genauso kalt lassen wie alle anderen suboptimal genutzten Beteiligungschancen.“ (Leggewie 1998:38)
In dem Sinne, das Internet als Möglichkeit der besseren politischen Information und zur Steigerung deliberativer Elemente zu nutzen, ließe sich auch Rillings kritische Bestandsaufnahme mit den eher optimistischen Einschätzungen Barbers und Leggewies vereinbaren. Demnach ist „[d]as Netz kein Ort demokratischer Entscheidungen, aber ein Ort der Kommunikation, ohne die Entscheidungen undemokratisch und ineffektiv sind.[...] Wir müssen das Netz als Raum der zweckgerichteten, nämlich entscheidungsvorbereitenden interaktiven Kommunikation zur Interessenrepräsentation nutzen.“ (Rilling 1997) Auch Leggewie sieht die kritischen Merkmale der derzeitig kaum vorhandenen politischen Öffentlichkeit bereits im realen Raum und nicht als Produkt des virtuellen Raumes: „Und wer (fälschlicherweise!) Beteiligungsschwäche und mangelnden Gemeinsinn der >Netizens< rügt, sollte die Partizipationsdefizite der real existierenden Zuschauerdemokratie und das Vordringen populistischer Stimmungsmacher heute nicht verschweigen.“ (Leggewie 1998:18) Bei dem Ruf nach einer erhöhten Bürgerbeteiligung oder auch der nötigen Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit geht es also immer noch primär darum, was Habermas bereits 1992 formulierte: „Die sozialintegrative Gewalt der Solidarität, die nicht mehr allein aus Quellen 31 des kommunikativen Handelns geschöpft werden kann, soll sich über weit ausgefächerte autonome Öffentlichkeiten und rechtstaatlich institutionalisierte Verfahren der demokratischen Meinungs- und Willensbildung entfalten und gegen die beiden anderen Gewalten, Geld und administrative Macht, behaupten können.“ (Habermas 1992:23) Dieses Vorhaben gestaltet sich in einem heterogenen und großen Gebilde wie der EU sicherlich nicht einfacher und das Internet bietet hier auch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern kann lediglich an verschiedenen Stellen mit seinem durchaus vorhandenen demokratischen Potential unterstützend eingesetzt werden.
In einer solch pluralistischen Gesellschaft wie der EU ist es naturgemäß ungleich schwieriger, die Öffentlichkeit für einen für die Demokratie notwendigen normativen Minimalkonsens zu gewinnen. Wie in Kapitel 3 angedeutet, ist es hier im Falle der EU erst einmal unabdingbar, überhaupt eine Öffentlichkeit zu schaffen, die annähernd als eine europäische Öffentlichkeit bezeichnet werden kann. Nur eine solche von Puhle geforderte civil society kann für eine „Absicherung von Demokratie“ (Puhle 2001) sorgen und damit auch die nötige Basis für eine geplante europäische Verfassung bilden. Denn zu einer Verfassung gehört allgemein auch eine Bürgerschaft, die in der Demokratie auch noch Träger der Herrschaft sein soll. Auf der Ebene der EU gilt es, althergebrachte Definitionen von Volk zu differenzieren: „Entscheidend ist nicht das durch Geburt, Sprache, Herkunft, Religion und Geschichte gebildete Volk, sondern die ´Willens- und Kommunikationsgemeinschaft´ der dauerhaft betroffenen Bürger eines Gemeinwesens.“ (Schorkopf 2001) Auch zu der Herausbildung einer solchen Gemeinschaft kann das Internet einen Beitrag leisten. Und wenn Beck sich auf Luhmann bezieht, nach dem die Gesellschaft nicht mehr durch geographische Grenzen definierbar sei, sondern eine Weltgesellschaft27entstehe, die auf der Kommunikation als Grundeinheit basiert (vgl. Beck 1998), so lassen sich die hier ebenfalls über Ländergrenzen hinweg Einflussmöglichkeiten des Internet finden.
Ein Schritt in die richtige Richtung scheint die Initiative der EU- Kommission zu sein, die ihren Ausdruck im Weißbuch „Governance“ erhält und durch die Schlüsselwörter Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit und Kohärenz geprägt ist. Dass es der Kommission mit den hier teilweise sehr allgemein gehaltenen guten Vorsätze auch ernst zu sein scheint, zeigt sich in den verschiedenen unter 4.2 angeführten praktischen Initiativen der EU im Internet.
Es ist zwar Münch einerseits zuzustimmen, wenn er sagt, dass „Europa [...] vielmehr ein wesentlich vielschichtigeres Gebilde aus lokalen Gemeinden, mehr oder weniger starken Regionen, immer mehr verblassenden Resten von Nationen und einer Vielzahl horizontal angeordneter Interessengruppierungen, vor allem aber selbstverantwortlich handelnder Individuen sein“ wird (Münch 2001:23). Aber andererseits wird der Ruf nach einer europäischen Identität laut und das trotz dieser Überlegungen in Richtung einer immer stärkeren Differenzierung. Im Verlauf der Arbeit sollte zumindest deutlich geworden sein, dass eine entsprechende Nutzung der Potentiale des Internet zu einer größeren Deliberation, Partizipation und erhöhten Informiertheit seitens der Bürger führen kann und damit auch identitätsstiftend wirken könnte. „Die Bildung von kollektiven Identitäten setzt ein objektivierbares Sinnsystem voraus, das eine Selbstbeschreibung als Einheit, eine Abgrenzung gegenüber Fremden sowie symbolisch Identifikation ermöglicht.“ (Bach 2001:161)
Allerdings stehen einer solchen Nutzung des Internet nicht nur die unter
4.3 angeführten Risiken im Wege, sondern vermutlich auch noch solche unnötigen Bedenken, wie sie Bangemann etwas drastisch formuliert: „Bei uns zählt ein gewisses Maß an Technikfeindlichkeit doch als ein Beweis für Intellektualität. Das gilt leider auch fürs Internet. Die Klage beispielsweise, der Mensch drohe in einer Flut von Information zu ertrinken, ist typisch europäisch: Lieber Himmel - ich schwimme doch lieber in einem Meer von Informationen, als daß ich in einer Wüste verdurste.“ (Bangemann 1998:180) Dies ist umso bedenkenswerter, da der folgenden Aussage Bangemanns Recht zu geben ist, dass nämlich „[d]ie Informationsgesellschaft mehr als nur die sogenannten Datenautobahnen umfasst. Am besten ist sie als Strukturwandel zu beschreiben, der nicht nur 33 die Wirtschaft, sondern die Gesellschaft umfasst.“ (Bangemann 1995:263) Damit geht dieser konstatierte Wandel mit dem der europäischen Integration einher und vermutlich wäre es vorteilhaft, beide miteinander zu verweben und sich damit gegenseitig unterstützen zu lassen. Denn wie im Kapitel 3.3 dargelegt, kommt der Transparenz, der Kontrolle und einer möglichen Korrektur europäischer Entscheidungen in Hinblick auf die Zukunft der EU eine wichtige, wenn nicht sogar entscheidende Rolle zu. Außerdem ist eine Voraussetzung zur Erfüllung der Forderungen verschiedener Theoretiker wie beispielsweise Barber, der einen freien Zugang zu den Informationen verlangt oder auch Habermas, der deren geregelten Austausch einklagt, erst einmal die Möglichkeit zur Verbreitung politischer Informationen und dies gerade in einer pluralistischen Gesellschaft wie der EU. In diesen Bereichen birgt das Internet wiederum hilfreiche Potentiale.
Worum es also letztlich geht, ist, die vorhandenen Potentiale für die Demokratie zu nutzen, was damit beginnt, sie der Bevölkerung erst einmal zu öffnen, womit nicht nur ein allgemeiner Zugang gemeint ist, sondern auch die Herstellung des notwendigen Anwendungswissens, auch um vorhandene Hemmschwellen zu beseitigen. Des weiteren ist der grundlegenden These aus Kapitel 4.3 Folge zu leisten, denn bevor Potentiale einer virtuellen Welt nutzbar gemacht werden können, müssen erst einmal die Voraussetzungen in der Realität verbessert werden. Denn: „Sicherlich, die Technologie als solche zeigt mal diese, mal jene Tendenz, hat Charakteristika und Implikationen, die menschliches Verhalten und menschliche Institutionen offensichtlich umgestalten können. Letzten Endes aber reflektiert sie die Welt, in der sie am Werk ist.“ (Barber 1998:122) Und für eine demokratische EU, die das Ziel aller Mitgliedsländer ist, gilt es zu bedenken: „Wenn wir dem nächsten Jahrtausend - in dem höchstwahrscheinlich unser Leben von Technologie beherrscht werden wird wie nie zuvor - die Demokratie bewahren wollen, dann müssen die bittersüßen Früchte der Wissenschaft unseren demokratischen Zielen untergeordnet und dazu gebracht werden, die kostbaren demokratischen Prozesse zu erleichtern und nicht zu unterminieren. Und ob dies gelingt, wird nicht von der Qualität und dem Charakter unserer Technologie abhängen, sondern von der Qualität unserer politischen Institutionen und dem Charakter unserer Bürger.“ (ebd.:131f.)
6 Anhang
Theoretische Konzepte der sozialwissenschaftlichen Europaforschung28
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7 Literaturverzeichnis
Bach, Maurizio 2001: Beiträge der Soziologie zur Analyse der europäischen Integration. Eine Übersicht über theoretische Konzepte. In: Loth/Wessels (Hrsg.): Theorien europäischer Integration. Opladen, S.147-173.
Bangemann, Martin 1995: Europa und die globale Informationsgesellschaft. In:
Bollmann, Stefan (Hrsg.): Kursbuch Neue Medien. <Mannheim, S.263-280.
Bangemann, Martin 1998: Martin Bangemann im Gespräch mit Christian Wernicke.
In: Leggewie/Maar (Hrsg.): Internet & Politik. Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie. Bollmann, S.177-182.
Barber, Benjamin R. 1994: Starke Demokratie. Hamburg.
Barber, Benjamin R. 1998: Wie demokratisch ist das Internet? In: Leggewie/Maar (Hrsg.): Internet & Politik. Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie. Bollmann, S. 120- 132.
Beck, Ulrich 1998: Das Demokratie-Dilemma im Zeitalter der Globalisierung. In: ApuZ 38/98, S.3-11.
Buchstein, Hubertus 1997: Demokratietheorie, in: PVS, Jg. 38, 1/1997, S. 129-148.
Dovifat, Emil (Hrsg.) 1971: Handbuch der Publizistik. Band 1, Allgemeine Publizistik,
Berlin.
Gates, Bill 1996: Internet und Demokratie. Gefunden am 25.01.2002 im Online-Archiv der Berliner Zeitung unter: http://berlinonline.de/wissen/berliner_zeitung/?ycl=nv Habermas, Jürgen 1992: Drei normative Modelle der Demokratie: Zum Begriff deliberativer Politik. In: Münkler (Hrsg.): Die Chancen der Freiheit. München, S.11-24. Habermas, Jürgen 2001: Warum braucht Europa eine Verfassung? „Hamburg Lecture“;
http://www.zeit.de/2001/27/Politik/200127_verfassung_lang.html
Leggewie, Claus 1998: Demokratie auf der Datenautobahn. In: Leggewie/Maar (Hrsg.):
Internet & Politik. Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie. Bollmann, S. 15-
54.
Leggewie, Claus/Maar, Christa 1997: Münchner Erklärung. Gefunden am 18.03.2002 unter http://www.akademie3000.de/html/index.html
Liikanen, Errki 2001: eEurope: An inclusive information society. Rede während der
Konferenz: Internet for all - Equal opportunities on the net. Berlin 2001.
Loth, Wilfried 2001: Beiträge der Geschichtswissenschaft zur Deutung der Europäischen
Integration. In: Loth/Wessels (Hrsg.): Theorien europäischer Integration. Opladen, S.87-106.
Neymanns, Harald 1996: Internet: Chancen und Möglichkeiten demokratischer Nutzung.
Unter: http://www.uni-greifswald.de/~politik/Mitarbeiter/neymanns/Inhalt.HTML Maar, Christa 1998: Internet & Politik. In: Leggewie/Maar (Hrsg.): Internet & Politik. Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie. Bollmann, S. 9-14. Münch, Richard 2001: Demokratie ohne Demos. Europäische Integration als Prozess des Institutionen- und Kulturwandels. In: Loth/Wessels (Hrsg.): Theorien europäischer Integration. Opladen, S.177-204.
Puhle, Hans-Jürgen 2001: Demokratisierungsprobleme in Europa und Amerika. Gefunden am
20.03.2002 unter: http://www.politik.uni-hd/lonline.htm
Rheingold, Howard 1995: Die Zukunft der Demokratie und die vier Prinzipien der
Computerkommunikation. In: Bollmann, Stefan (Hrsg.): Kursbuch Neue Medien. Mannheim, S.189-198.
Rilling, Rainer 1997: Auf dem Weg zur Cyberdemokratie. Gefunden am 17.12.2001 unter: http://www.telepolis.de/deutsch/special/pol/8001/1.html
Sartori, Giovanni 1992: Demokratietheorie, Darmstadt.
Scheuch, Michael: Neue Informationstechnologien und ihre Auswirkungen auf
Demokratietheorie. Gefunden unter: http://members.aol.com/Edemokrat/magister.htm Schmidt, Manfred G. 1995a: Demokratietheorien, Opladen.
Schorkopf, Frank 2001: Grenzen der Demokratie? Demokratie in der EU. Europäisches Forum Alpbach.
Waschkuhn, Arno 1998: Demokratietheorien, München/Wien.
Zürn, Michael 1996: Über den Staat und die Demokratie im europäischen Mehrebenensystem. In: PVS 37/1996, S. 27-55.
Zusätzliche Quellen:
Nohlen, Dieter (Hrsg.) 1996: Lexikon der Politik. Band 5: Die Europäische Union. Herausgegeben von Beate Kohler-Koch und Wichard Woyke. München Nohlen, Dieter (Hrsg.) 1998: Wörterbuch Staat und Politik. München. Daraus insbesondere die Artikel zu:
Datenschutz (Hans Peter Bull), S.78-80.
Demokratie/Demokratietheorie (Bernd Guggenberger), S.80-90.
Direkte Demokratie (Peter Lösche), S.108-110.
Elite/Elitetheorie (Peter Waldmann), S.113-117.
Informationsfreiheit (Hans Peter Bull), S. 282-283.
Massenkommunikation (Max Kaase), S.414-420.
Medienpolitik ((Hans J. Kleinsteuber), S.420-422.
Öffentliche Meinung (Hans J. Kleinsteuber), S.467-469.
Ökonomische Theorien der Politik (Franz Lehner/Klaus Schubert), S.476-482. Partizipation (Max Kaase), S. 521-527.
Pluralismus/Pluralismustheorie (Rainer Eisfeld), S. 537-542. Schmidt, Manfred G., 1995: Wörterbuch zur Politik. Stuttgart.
Weidenfeld, Werner/Wessels, Wolfgang 2000: Europa von A bis Z. Taschenbuch der europäischen Integration. Bonn.
Daraus insbesondere die Artikel zu:
Integrationstheorien (Claus Giering), S.262-267.
Medien- und Telekommunikationspolitik (Patrick Meyer), S.288-293.
Quellen der Europäischen Union:
Europäische Kommission 1997: Weißbuch Governance. Gefunden unter: http://europa.eu.int/comm/governance/white_paper.pdf
Europäische Union 1999: Textsammlung. Band 1. Luxemburg.
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (http://europa.eu.int) .
Aktuelle Medienberichterstattung:
Heye, Uwe-Karsten 2002: Deutschland schreibt sich mit .de. In: Cebit 2002 Verlagbeilage zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12.03.02, Seite B2.
39
Schily, Otto 2002: Wie die Wirtschaft, so der Staat. In: Cebit 2002 Verlagsbeilage zur
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12.03.02, Seite B13.
Spiegel Spezial 2002: Experiment Europa. Ein Kontinent macht Geschichte. Daraus vor allem die Artikel:
Juncker, Jean-Claude 2002: Das Europa der Europäer. S.96-105.
Schmidt-Klingenberg, Michael 2002: Auf der Suche nach der europäischen Identität. S.8-11.
[...]
1Bei den elektronisch vorliegenden Publikationen aus dem Internet ist eine verbindliche Seitenangabe leider nicht möglich.
2So wird beispielsweise bei Zürn als Alternative zur Behebung des Demokratiedefizits die Einführung von direkt-demokratischen Elementen diskutiert (vgl. Zürn 1996).
3Buchstein 1997, Sartori 1992, Schmidt 1995a, Waschkuhn 1998.
4Wie beispielsweise der elitistischen oder der ökonomischen Theorie der Demokratie, die aufgrund ihrer regierungszentrierten Betrachtungsweise hier außen vor bleiben sollen.
5Wenn man ein Kontinuum zwischen schwachen und starken Theorien der Partizipation annimmt, dann wären schwache solche, die eine Politisierung lediglich in Teilbereichen der Gesellschaft anstreben, während starke Theorien „keine unpolitischen oder privaten Räume“ (Schmidt 1995a:171) dulden. Die bei Barber dargestellte „starke Demokratie“ wäre in der Mitte eines solchen Kontinuums anzusiedeln, da sie die Notwendigkeit der Repräsentation in den modernen Flächenstaaten anerkennt und lediglich eine Ausweitung der partizipatorischen Elemente fordert (vgl. Barber 1994)
6Bei Nohlen wird hierbei auf eine Typologisierung von Uehlinger zurückgegriffen, die zwischen der Staatsbürgerrolle, der problemspezifischen, der parteiorientierten Partizipation, dem zivilen Ungehorsam und der Gewalt unterscheidet. (vgl. in Nohlen 1998:524)
7So ist bei Barbers Theorie der republikaische Begriff des Bürgers zentral, der sich durch aktive Teilnahme an den Diskussionen von öffentlichem Interesse auszeichnet. Ein Spannungsfeld ergibt sich hierbei automatisch zu dem auf Kosten-Nutzen-Relationen konzentrierten modernen Individuum.
8 Hierbei sollte jedoch vor allem auch der von Habermas erkannte Vorteil dieser Idealvorstellung in Hinblick auf die weitere Thematik der vorliegenden Arbeit im Auge behalten werden: „Den Vorzug sehe ich darin, daß es radikaldemokratischen Sinn einer Selbstorganisation der Gesellschaft durch die kommunikativ vereinigten Bürger festhält und nicht nur auf einen >deal< zwischen entgegengesetzten Privatinteressen zurückführt.“ (Habermas 1992:18)
9Dabei handelt es sich um die 1997 in Amsterdam konsolidierte Fassung des Vertrags von Maastricht.
10 Andere mögliche Einflussfaktoren, die jedenfalls den Kompetenzbereich des Nationalstaats bereits gehörig einengen, wie vor allem die wirtschaftliche Globalisierung, sollen an dieser Stelle außen vor bleiben.
11Im Internet unter http://europa.eu.int/comm/governance/white_paper/en.pdf .
12
“Five political principles
- openness, participation, accountability, effectiveness and
coherence underpin the proposals in this White Paper.” (Europäische Kommission 1997).
13Auf die einzelnen Ansätze soll hier nicht weiter eingegangen werden, sondern die Arbeit soll allgemein die integrationstheoretischen Anforderungen und Ziele darstellen. Eine
14Denn bei politischer Apathie handelt es sich, wie bereits unter Kapitel 2.2 mit Hilfe eines Zitats von Manfred G. Schmidt verdeutlicht wurde, um eine für eine Demokratie besonders problematische Haltung.
15Dies leistet beispielsweise Neymanns 1996 in seiner Diplomhausarbeit, wo er auch detailliert auf die verschiedenen Internetdienste wie e-Mail, das World Wide Web oder Newsgroups eingeht. Die vorliegende Arbeit wird sich auf das WWW beziehen, da hier eine Integration aller anderen Internet Dienste möglich ist.
16Grundgesetz Art. 5
17Kleinsteuber referiert hier auch auf einen elitär angelegten Ansatz von Hennis (1957), nachdem die Meinung als die öffentliche gilt, „die eine besonders verantwortliche Gruppe politisch informierter, rational eine Meinung bildender und dem Gemeinwohl verbundener Bürger vertritt.“ (in Nohlen 1998:468) Hier kann m.E. noch einmal verdeutlicht werden, warum solche elitistischen Ansätze einen nicht so starken Erklärungscharakter für ein solch heterogenes Gebilde wie die EU besitzen.
18Mit Zitaten nach Gerhards: Westeuropäische Integration und die Schwierigkeiten der Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit, in: Zeitschrift für Soziologie 22 (1993), S.96-110.
19Einer Richtlinie des Rates vom 7. Juni 1990 zufolge.
20Siehe etwas spezieller unter Kapitel 4.3: Demokratietheoretische Risiken des Internet. Bedacht sein soll hier lediglich die allgemein formulierte Warnung Leggewies, die auf das mögliche Problem auch des Internet hinführt: „Aus demokratietheoretischer Sicht ist jede >Kommunikationsungleichhheit< ein Problem, wenn auch kein sonderlich neues.“ (Leggewie 1998:41)
21„Das Internetangebot www.bundesregierung.de ist zur zentralen Informationsplattform der Bundesregierung ausgebaut worden. Die Website wird seit 1999 konsequent zum Regierungsportal im Internet entwickelt, in dem allen Bürgerinnen und Bürgern stets aktuelle, nachhaltige und verlässliche Informationen über Arbeit und Politik der Bundesregierung zur Verfügung stehen.“ (Heye 2002)
22Einen genaueren Einblick in die Initiative gewähren die entsprechenden Seiten der EU: http://europa.eu.int/comm/intemal.market oder über die Seite der Kommission: http://www.eu-kommission.de/html/12-presse/index-00-01.asp?2081 .
23http://europa.eu.int/yourvoice/index_de.htm .
24Dabei handelt es sich um eine Anzeige der Internet-Suchmaschine Infoseek am Tag der Wiederwahl des damaligen US-Präsidenten.
25Diese These will er auch empirisch belegen, wenn er sagt: „Insgesamt dürfte der Anteil politischer Sites in der Bundesrepublik bei gut einem halben Prozent liegen, in den USA sind es höchstens 2 Prozent.“ (Rilling 1997)
26„Natürlich gibt es die Media-Rich und die Media-Poor im Netz.“ (Rilling 1997)
27Allerdings ist diese Weltgesellschaft bei Luhmann unpolitisch, da das Politikmonopol beim Territorialstaat verbleibt.
28Übernommen mit verschiedenen Auslassungen (Spalten Literatur und Disziplin) von Bach 2001:168f.
- Arbeit zitieren
- Christian Schmitt (Autor:in), 2001, Demokratietheorie, EU und Internet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106758
Kostenlos Autor werden



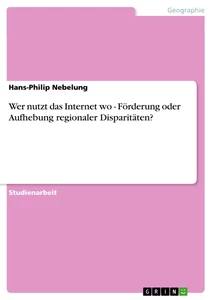







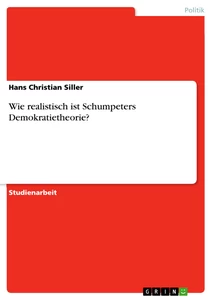










Kommentare