Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Die Beschäftigung der Geschichtswissenschaft mit sozialen Milieus: Selbstverständlichkeit oder unrechtmäßige Kompetenzerweiterung?
2. Relevante Begriffe
2.1. Milieu, Lebensstil, Habitus
2.2. Gibt es « das Bürgertum »
2.3. „ Modernisierung “
3. Bürgerliche Milieus im 19. Jahrhundert
3.1. Die Phase von 1815 bis 1848/49
3.1.1.Das Stadtbürgertum
3.1.2.Die Bourgeoisie
3.1.3.Das Bildungsbürgertum
3.2. Die Phase von 1871 bis 1914
3.2.1.Die Bourgeoisie
3.2.2.Das Bildungsbürgertum
3.2.3.Alter und neuer Mittelstand
4. Wie modern war das Bürgertum des 19. Jahr- hunderts?
Literaturverzeichnis
1. Die Beschäftigung der Geschichtswissenschaft mit sozialen Milieus: Selbstverständlichkeit oder unrechtmäßige Kompetenterweiterung?
Der Arbeitstitel dürfte alle Hoffnungen auf eine schneidige Diskussion dieser Frage ohne Gnade auf ein betrübliches Häuflein bestätigter Vor- ahnungen zusammenschmelzen lassen. Denn dem zweiten Teil der Antwort zuzustimmen hieße entweder die Arbeit unter der Flagge einer Farce zu schreiben oder aus meinem Fachbereich direkt in die Arme der Soziologie zu spazieren. Und da weder das eine noch das andere in meinen mittel- fristigen Absichten liegt, so muss wohl schon der Beginn dieser Arbeit den Impetus eines Plädoyers für den ersten Teil der Antwort haben. Es soll hier nicht die wissenschaftstheoretische Entwicklung des Fachs Geschichte rekonstruiert werden; die folgenden Zeilen stellen vielmehr den Versuch dar, Vor- bzw. Nachteile gewisser theoretischer Ansätze, in Zusammenhang damit aber auch ihre Zulassung als Erklärungsanwärter im zur Frage stehenden Fach zu besprechen.1
Eine der grundlegenden Unterscheidungen in der Geschichtswissenschaft ist die zwischen Ereignis- und Strukturgeschichte. Erstere wird oft als politische Geschichte bezeichnet; sie gibt das Vorfallen von Ereignis- sen resp. das Vollziehen von Handlungen an und bestimmt diese zeitlich und räumlich. Das bloße Kriterium der Faktizität würde jedoch bedeuten, dass Geschichte ein stetig wuchernder Berg hastig zusammengeklaubter und wirr durcheinanderpurzelnder Tatsachen ist. Den Ordnungsgeber mimt das Kriterium der Relevanz, und das heißt hinsichtlich der Ereignisge- schichte die Frage zu stellen, ob die betreffende Tatsache innerhalb der Politik- und Staatengeschichte einen signifikanten Platz eingenom- men hat. Was die Ereignisgeschichte uns also zu bieten hat ist eine diachrones Bild großer Politik und (in wohl eher übertragenem Sinne) großer Staaten, selbst wenn Wissenschaftler wie zum Beispiel Langewie- sche sagen, dass man „staatsbezogene politische Geschichtsschreibung [...] keineswegs mit gesellschaftsferner Historiographie über `große Männer` und `Haupt- und Staatsaktionen` gleichsetzen [darf].“2 Zur Be- gründung zieht er Treitschkes Hauptwerk heran und weist darauf hin, dass in demselben nicht ausschließlich politische Geschichte vorzufin- den sei. Nun, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Treitschke den Ausspruch: „Männer machen die Geschichte“ prägte und somit wohl auch nicht-politische Aspekte einer Betrachtung unterziehen kann, die- sen jedoch nie den Status eines Motors der Geschichte zugestehen würde.3 Und doch kann Ereignisgeschichte nicht zur reinen Chronologie degra-diert werden, denn die konkreten Begebenheiten bleiben keineswegs un-reflektiert nebeneinander stehen; sie werden zueinander in Beziehung gesetzt und erreichen damit einen Grad des Zusammenhanges, der der Er-eignisgeschichte einen spezifischen Erklärungswert verleiht. Chronolo-gien dagegen erklären nichts.
Anders das Vorgehen der Strukturgeschichte; sie hat es auf Strukturen, d.h. auf größere Zusammenhänge abgesehen, und dementsprechend groß ist ihr Erkenntnisgegenstand. Nicht das Handeln einzelner bedeutender Per- sönlichkeiten, sondern längerfristige Entwicklungen der Gesamtgesell- schaft sowie der sie betreffenden Faktoren stehen im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen. Auch die Srukturgeschichte kann Beliebigkeit als Ar- beitsmotiv nicht gutheißen; sie bringt spezifische Dinge wie Geogra- phie, Klima, Religion, Besitz- und Wirtschaftsverhältnisse oder Bräu- che zur Sprache. Man könnte nun im Hinblick auf die Merkmale der Ereig- nisgeschichte versucht sein, die Strukturgeschichte von ihr dadurch zu unterscheiden, dass der Strukturgeschichte das Charakteristikum der bloßen Synchronie zugeschrieben wird, was aber nur zum Teil stimmt. Denn eine der Fragen an die Geschichte lautet, warum etwas geschehen ist, und je nach dem Geschehen kann ein bestimmtes Ereignis (so seitens der Ereignisgeschichte) oder eine gruppenumfassende menschliche Dispo- sition bzw. die Struktur eines gewissen Faktors (so seitens der Struk- turgeschichte) als Grund angegeben werden. Nach einem Geschehen oder einer strukturellen Veränderung zu fragen heißt jedoch, sich schon im Rahmen des Zeitlichen zu bewegen. Die Strukturgeschichte stellt somit einerseits Material synchroner Qualität bereit, mit dem Strukturverän- derungen erklärt werden können, andererseits sind wir im Zuge ihrer Be- antwortung derartiger Fragen berechtigt, sie mit dem Prädikat „diachron arbeitend“ zu belegen. Und selbst wenn so mancher Historiker seine Ar- beit auf sogenannte „Querschnitte“ konzentriert, zwingt uns das noch nicht, ihn des Berufsverrates zu bezichtigen; Geschichte fragt unter anderem, wie eine bestimmte Gesellschaft funktionierte oder unter wel- chen äußeren Einflüssen sie stand, d.h Fragen, die nur unter Rückgriff auf das Zeitliche beantwortet werden können, fallen mitunter völlig weg.
Ereignisgeschichte operiert, so scheint es, an der Spitze des Eisber- ges, dessen nicht sichtbarer Teil Schössling der Strukturgeschichte ist. Sie suggeriert das Bild einer Menschheitsentwicklung, während der eine kleine Schar Privilegierter verzwickten und bühnenreifen Diploma- tenaktivitäten frönte, während weitab von ihnen ein graues Menschenru- del sich untereinander um ein Stück Brot zankte und glücklicherweise nicht allzu oft eine Ahnung davon bekam, wer Schuld daran sein könnte. Selbstverständlich muss zugestanden werden, dass es Fragen gibt, für die sie allein eine Antwort zu liefern imstande ist. Die Frage nach dem Warum einer Handlung verlangt als Antwort die Angabe eines Motivs oder Auslösers; Strukturgeschichte versagt an dieser Stelle, während Ereig- nisgeschichte adäquate Erklärungen abgeben kann. Fragen wir aber nach dem Warum einer Struktur oder einer viele Menschen umfassenden Hand- lung, so können wir eine Antwort nur innerhalb dieser Dimension finden; die Strukturgeschichte meldet sich zu Worte und hat passende Antworten parat, wo die Ereignisgeschichte mit den Schultern zuckt.
Es muss hier bemerkt werden, „dass es sich bei der `Strukturgeschichte` in erster Linie um ein methodisches Prinzip“4 handelt, wodurch sie sich von der Ereignisgeschichte grundlegend unterscheidet; diese besitzt ei- nen fest umrissenen Gegenstand und eine Methode, während die Methode der Strukturgeschichte die Untersuchung mehrerer ganz verschiedener Ge- genstände erlaubt.5
Nach anderen Kriterien erfolgt die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makrogeschichte. Während bei der Mikrogeschichte „kleine Gemeinschaften unter das historische Mikroskop gelegt“6 werden, richtet sich die Makro- geschichte auf „alles, was Macht hat oder auf der politischen Ebene da- rum kämpft [...], alles, was sich [...] eine irgend allgemeine Aufmerk- samkeit und Einfluss zu verschaffen weiß; alles, was Strukturen von Ge- sellschaften oder ihren wesentlichen Teilbereichen ausmacht; schliess- lich alle Formen des Wandels einer gesellschaftlichen Struktur“7. Ausge- hend von dieser Unterscheidung würden Ereignis- und Strukturgeschichte somit zu derselben Kategorie gezählt werden, nämlich zur Makrogeschich- te.
Verwirrung stiften die unterschiedlichen Auffassungen der Historiker des Begriffes Mikrogeschichte. Nach Meier lautet „die eigentlich Paro- le, unter der diese Geschichte in Deutschland angetreten ist, [...] Alltagsgeschichte“8, in der es sich „um wenig Abstraktes, Abgehobenes, kaum um komplizierte Strukturen [...] handelt.“9 Für Burke hingegen „entspricht sie einfach der Sozialgeschichte“10, was fraglich ist, da die Sozialgeschichte sehr wohl strukturiert ist. Bei Kocka liest man sogar eine deutliche Kritik seitens der Alltagsgeschichte an der So- zialgeschichte: „immer blieb ihr [...] Blick [...] gerichtet auf über- greifende gesellschaftliche Strukturen und Prozesse. Die Frage, wie denn diese Strukturen und Prozesse von den Menschen erlebt und verar- beitet wurden, wurde fast vollständig ausgeklammert.“11 Da die Alltags- geschichte immer sehr nahe an den Dingen bleibt, kann man sie meines Erachtens nach als tatsächlich wenig strukturiert bezeichnen. Zwar hat sie dieses Merkmal mit der Ereignisgeschichte gemeinsam, wird von ihr aber trotzdem angegriffen, da sie sich mit kleinen und relativ (in Be- zug auf den Fortschritt der Geschichte) unbedeutenden Welten befasst. Bevor wir zurückkommen auf die Eingangsfrage, sollen kurz die Vorzüge und Defizite der jeweiligen Ansätze genannt werden. Strukturgeschicht- liche Abfassungen leiden an ihrer geringen Tiefenschärfe; der Mensch als Individuum „geht als anonymer Bestandteil ein in Gruppen, Schichten oder Klassen, verliert sich in langen Zahlenreihen über Mobilität, Mi- gration oder Schülerströme preußischer Gymnasien.“12 Ihre typologisie- renden Resultate geben also keine Antwort auf die Frage, warum ein be- stimmter Mensch etwas getan hat. Allerdings würde sich die Strukturge- schichte auch nie anmaßen, für solche Fragen kompetent zu sein. Viel- mehr würde sie die Frage an die Ereignisgeschichte geben und von dieser zu Recht eine stimmige Antwort erhalten. Die Ereignisgeschichte wieder- um steht ratlos vor Fragen wie der nach dem sozio-ökonomischen Zusam- menhalt einer Gesellschaft; sie reagiert mit dem Weitergeben der Frage. Dabei wird seit geraumer Zeit von Historikern eine fruchtbare Synthese beider Konzeptionen gefordert; beschäftigte man sich ausschließlich mit Strukturgeschichte, würde man „hinter die fundamentale Erkenntnis zu- rückfallen, dass historische Strukturen vor allem in der Phase ihrer
Entstehung aus individuellen und kollektiven, erfahrungsgeleiteten und zielmotivierten Handlungen hervorgehen und von solchen [...] verändert werden“13. Ein integrierendes Verfahren würde darauf hinauslaufen, „den Zusammenhang von Strukturen und Prozessen einerseits, von Handlungen und Erfahrungen andererseits als ein historisch variables Verhältnis der Brechung und Nicht-Kongruenz zu begreifen“14.
Ist für den Historiker die Beschäftigung mit sozialen Milieus eine Selbstverständlichkeit? Denn soziale Milieus stellen eigentlich eine Domäne der Soziologie dar; wenn sich ein Historiker mit ihnen beschäf- tigt, scheint er eine überzeugende Begründung vorausschicken zu müssen. Doch die Öffnung der Geschichtswissenschaft hin zur Soziologie ist schon vor längerem vollzogen worden, und es ergab sich, dass beide Fachwissenschaften eine gemeinsame Schnittmenge aufweisen, in der auch die sozialen Milieus liegen. Eine auf sie gerichtete Analyse hat sowohl Erklärungswert für Soziologen, denn diese beschäftigen sich vorwiegend mit Gesellschaftsstrukturen und interessieren sich von daher mitunter für die Analyse der kleineren Einheiten dieser Gesellschaften, als auch für die Historiker, die die Bedeutung der jeweiligen Gruppe in Bezug auf spezifisch historische Faktoren bestimmen können.
Wie es der Titel der Arbeit sagt, wird der Leser auf den folgenden Sei- ten Bekanntschaft schließen (oder auffrischen?) mit bürgerlichen Mil- ieus in den Phasen 1815 bis 1848/49 und 1871 bis 1914, wobei für die jeweiligen Zeitabschnitte die für eine Milieubeschreibung spezifischen Dimensionen zu Worte kommen sollen. Das endgültige Ziel besteht darin, die Ergebnisse unter einem bestimmten Gesichtspunkt zu betrachten; un- ter dem der Modernisierung. Daraus ergibt sich die leitende Frage: Wel- chen (sowohl aktiven als auch passiven) Anteil hatte das Bürgertum in den betreffenden Zeitabschnitten am Prozess der Modernisierung? Die Phasen sind als mehr oder weniger weit auseinanderliegende gewählt wor- den, um die Konstanz bzw. Variabilität bestimmter Merkmale eines Mili- eus zu verdeutlichen.
Vielleicht wundert es den Leser, dass die Formulierung des Ziels dieser Arbeit relativ allgemein gehalten ist; das hängt zusammen mit der Er- klärungsbedürftigkeit der Begriffe, die für die Untersuchung von Bedeu- tung sind. Der Erkenntnisgegenstand des Geschichtswissenschaftlers ver- langt mitunter den Rückgriff auf soziologische Begriffe. Diese sollten jedoch aufgrund ihrer Erheblichkeit nicht den Charakter von Prälimina- rien haben, auch wenn sie streng gesehen Anleihen darstellen. So wie der „klassische“ Historiker seine Fragestellung erst im Zuge seiner Darlegungen konkretisieren kann (und dieser geht immerhin mit fachimma- nenten Begriffen um), so kann auch der soziologisch interessierte Hi- storiker bei seinen Lesern weder die vollständige Kenntnis der maßgeb- lichen Begriffe voraussetzen noch versuchen, sie in der Einleitung um- fassend erläutern.
Die folgenden Seiten beschäftigen sich vorerst mit den für diese Arbeit wichtigsten Begriffen, um anschließend unter ihrer Anleitung der ge- nannten Fragestellung nachzugehen. Besonders den Begriffen Milieu, Ha- bitus und Lebensstil muss hinsichtlich ihrer deflationären Verwendung seitens der Historiker Beachtung geschenkt werden, wobei die Ausführun- gen zum Habitus und Lebensstil hauptsächlich Bezug auf die Habitustheo- rie Pierre Bourdieus nehmen. Nach der Behandlung jeder der beiden Pha- sen wirft der Schlussteil schließlich die oben genannte Frage auf und nennt in diesem Zusammenhang den Sinn des ganzen Unternehmens.
2. Relevante Begriffe
2.1. Milieu, Lebensstil, Habitus
Der Milieubegriff wird schon seit längerem als brauchbarer angesehen als der Klassen-, Stand- oder Schichtbegriff. Unter dem primär mit Karl Marx verbundenen Klassenbegriff versteht man „typischerweise Gruppie- rungen mit konträren Interessen [...], die auf ungleichen materiellen Lebensbedingungen und Machstellungen beruhen, welche sich [...] im Pro- duktionsprozess ergeben.“15 Jegliche Lebensäußerungen sind nach dieser Theorie zurückführbar auf die objektiven sozio-ökonomischen Strukturen. Da es Gruppen gibt, hinsichtlich derer die Frage nach Besitz oder
Nicht-Besitz an Produktionsmitteln nicht gestellt werden kann (beispielsweise der Berufsgruppen des „Mittelstandes“), wir also für ihre Lebensäußerungen kein Erklärungsmuster besitzen, und da zudem eine Klasse hinsichtlich signifikanter Merkmale in sich differenziert sein kann, ist Marx` Theorie nur bedingt anwendbar.
„Stand“, definiert durch „Herkunftszugehörigkeit, durch gesellschaftli- che Funktion, durch spezifische Lebensführung und durch spezifische Rechte (Privilegien) und Pflichten“16, impliziert das Bild einer stati- schen Gesellschaft, wie es sie heute in Bezug auf alle genannten Merk- male nicht mehr gibt; dieser Begriff ist daher völlig unbrauchbar. Der Schichtbegriff referiert lediglich auf die deskriptiv erfassbaren Unterschiede der Güterverteilung und der damit verbundenen sozio-kultu- rellen Eigenheiten der jeweiligen Gruppe; er „beschreibt [...] bestimm- te Soziallagen und erklärt sie nicht und macht auch keine Aussagen über deren Entwicklung“17, d.h., er ist für manche Untersuchungen zu sehr bloß zuordnend und zu wenig analytisch.
Als zugleich dynamisch und differenziert angelegt kann hingegen der Mi- lieubegriff bezeichnet werden, da er versucht, zwischen den „objekti- ven“ Strukturen und den „subjektiven“ Handlungsdispositionen zu vermit- teln: „Die sozialen Strukturen sind demnach ebenso Handlungsbedingungen wie die Verhaltensdispositionen oder Mentalitäten“18. Letztgenannte wer- den nun ihrerseits wieder „relational bzw. aus den historisch prakti- zierten Beziehungen innerhalb und zwischen den in spezifischen Gesell- schaftsstrukturen wirksamen Praxisfeldern“19 bestimmt. Menschen mit ähn- lichen sozialen Lagen können nicht mehr zu einer Gruppe zusammengefasst werden, da objektive (zum Beispiel Alter, Geschlecht) und subjektive (zum Beispiel politische Präferenzen) intervenierende Faktoren20 die so- zialen Lagen differenzieren und somit ähnliche Lagen keine ähnlichen Faktoren implizieren, die Gruppenmitglieder sich also sehr unterschei- den können. Soziale Ungleichheit realisiert sich durch bestimmte Hand- lungen, und diese sind den genannten Faktoren unterworfen. Doch darf nicht angenommen werden, dass sich aus den Faktoren beliebig viele Handlungskontexte postulieren lassen, denn sonst wären wir zu keiner Definition des Milieubegriffes mehr fähig. Ausschlaggebendes Moment ei- ner solchen Definition ist der Begriff des Lebensstils; unter einem Mi- lieu versteht man „eine Gruppe von Menschen [...], die solcheäußeren Lebensbedingungen und/oder inneren Haltungen aufweisen, aus denen sich gemeinsame Lebensstile herausbilden. “ 21
Mit der Definition wird die kulturgeschichtliche Wende der Sozial- und Humanwissenschaften angezeigt, die sich vor nicht allzu langer Zeit vollzog. Wichtig in unserem Zusammenhang ist die Feststellung, dass Kultur keinen für sich bestehenden Bereich darstellt, sondern „die sym- bolische Dimension des sozialen Lebens, die auf die Sinn- und Bedeu- tungsebene sozialen Handelns verweist“22, weil sie „daran erinnert, dass alles Handeln auf der Vorstellung und Deutung von Tatsachen beruht.“23 Zu beachten ist dabei, dass das Handeln nicht einem zweckrationalen Vernunftbegriff untergeordnet werden darf; das würde fälschlicherweise die vollständige Kenntnis des Beziehungsgefüges der objektiven Struktur und eine einseitige Bindung der Interessen an materielle Vorteile vor- aussetzen. In den meisten Fällen wird das Interesse „oberhalb des Sinn- horizontes des handelnden Akteurs liegen“24, denn „Handelnde können nicht alle gesellschaftlichen Ursachen in ihre Beweggründe und nicht alle Folgen in ihre Intentionen einbeziehen.“25
Weitgehender Konsens herrscht über die Definition des Lebensstilbegrif- fes. Mit ihm bezeichnen wir „in erster Linie bestimmte Muster eines in gewisser Weise routinierten und für den Alltag typischen individuellen Handelns“26, welches sich in kulturell-symbolischen Strukturen als ein Zeichen-, Symbol- und Repräsentationssystem manifestiert. Die Debatte um die theoretische Verortung des Begriffes selbst brachte im Großen und Ganzen zwei Ansätze hervor; der erste „sieht die Ausprä- gung von Lebensstilen und die Milieubildung durch objektive Struktur- vorgaben bedingt“, während der zweite „die Wahl von Lebensstilen hand- lungstheoretisch auf individuelle Entscheidungen zurück[führt]“27 und somit den optionalen Charakter des Lebensstils betont. Pierre Bourdieu ist als Vertreter des strukturdeterministischen Kon- zepts anzusehen, da er „kulturelle Deutungen und Handlungen nicht aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang isoliert, sondern in ihn einbettet und mit ihm verknüpft.“28 Er entwarf die sogenannte Habitustheorie, die den Habitus als Vermittlungsinstanz zwischen Struktur und praktischem Handeln konstruiert. Unter Habitus versteht man das „ Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssy- stem “29. Er ist also ein System handlungsbestimmender Dispositionen, „ein Stück verinnerlichter Gesellschaft, deren Strukturen durch die So- zialisation einverleibt werden“30, aber auch „Erzeugungsprinzip von bzw. Ordnungsgrundlage für Wahrnehmung, Denken, Vorstellungen aller [...] Strukturen“31 und zeichnet sich dadurch aus, dass er unbewusst ist (ob- gleich bewusst gemacht werden kann) und nicht in Begriffen der „Befol- gung von bewussten Regeln oder Nutzenkalkülen“32 beschreibbar ist. Die Lebensstile sozialer Akteure nun sind Produkte des jeweiligen Habi- tus und werden von anderen sozialen Akteuren entsprechend ihrem Habitus wahrgenommen. Diese produzieren ihrerseits bestimmte Lebensstile, die jedoch nicht als Ableitungen aus der jeweiligen sozialen Lage, sondern vielmehr als Produkt der Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata des Habitus verstanden werden können. Die dem Lebensstil Ausdruck verleih- enden Symbole fungieren laut Bourdieu also „nicht allgemein als Zei- chen, sondern primär als Unterscheidungs-Zeichen “33. Lebensstile haben mithin Doppelfunktion; „zugleich Signalisierung von Zugehörigkeit wie auch von Distanz zu und zwischen `sozialen Kreisen` und damit Herstel- lung und Gewährleistung von Identität“34. Erinnern wir uns an die Fest- stellung, dass Milieus sich durch Lebensstile voneinander unterschei- den, so können wir jetzt sagen, dass Milieus „nicht nur Vermittler mit einer gewissen Eigenständigkeit der Gestaltungskraft, sondern zugleich eigenständige Gestalter [sind]: Produzenten ungleicher Lebensbedingun- gen für andere Mitglieder der Gesellschaft.“35
Die Habitustheorie vermittelt, und das macht ihre Brauchbarkeit für den Historiker aus, zwischen den „objektiven“ Strukturen einer Gesellschaft und den „subjektiven“ Leistungen der Individuen dieser Gesellschaft. Es ergibt sich hiermit die Möglichkeit, den Gegensatz bzw. das bloße Ne- beneinanderbestehen von Struktur- und Ereignisgeschichte zu überwinden; erforderlich ist dafür eine umfassende Kenntnis nicht nur der sozialen Lage des Handelnden, sondern auch der Praxis der ihn umgebenden sozia- len Akteure. Von hier aus wird dann auch ersichtlich, warum Menschen entgegen ihren eigenen Interessen handeln; nämlich aufgrund der Tatsache, dass zwar auch ihre soziale Lage Bedingung ihres Handelns ist, sie daneben jedoch der Konfrontation mit der Praxis anderer Gesellschaftsmitglieder ausgesetzt sind, die ihrerseits, indem sie wahrgenommen wird, den Habitus modifiziert.
Bürgerliche Milieus sind, da viele der Mitglieder eines sozialen Mili- eus sich wahrscheinlich nie begegnen werden, auf der Ebene der Makro- milieus anzusiedeln; ihren Lebensstil wird man wegen seiner charakte- ristischen Nähe zu den Individuen eher auf die Mikroebene einordnen. Die Verbindung zwischen Struktur und Individuum wird komplett, denn „im Ergebnis, d.h. der Kategorisierung von Gruppen, besteht [...] letztlich kaum ein Unterschied zwischen einer Lebensstilgruppe und einer Milieu- gruppe.“36
2.2. Gibt es„das Bürgertum“?
Der Umgang mit dem Begriff „Bürgertum“ scheint unproblematisch zu sein; bei seiner Verwendung sind wir selbst ziemlich sicher, was wir meinen, und kaum jemand stellt uns die Frage, was genau man unter dem Begriff zu verstehen hat. Die Beantwortung dieser Frage jedoch dürfte sich nicht in jedem Falle durch Höchstgeschwindigkeit auszeichnen. Schnell wird klar, dass wir solche Gruppen als dem Bürgertum zugehörig bezeich- nen, die hinsichtlich ihrer einzelnen Merkmale sehr stark voneinander abweichen. Doch etwas, so sagen wir uns, muss ihnen gemeinsam sein, denn sonst würden wir sie nicht mit demselben Begriff belegen. Es ist hier nicht der Ort, die Begriffsgeschichte von „Bürgertum“ de- tailiert nachzuzeichnen, und auch das jeweilige Selbstverständnis des Bürgertums in den verschiedenen Epochen soll für uns ohne Belang sein. Am Anfang steht die einfach anmutende, aber potentiell zu Verwirrungen führende Aussage, dass das Bürgertum des 19. Jahrhunderts keine homoge- ne Sozialformation ist. Für die frühe Neuzeit setzen wir Bürger mit dem Stadtbürger gleich; es entwickeln sich die Oberschichten (Patriziat bzw. Honoratiorentum) und das Kleinbürgertum (zunftgebundenes Hand- werk). Im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert treten zum Bürger- tum schon die Wirtschaftsbürger (die eigentliche Bourgeoisie) und das Bildungsbürgertum (Staatsbürger bzw. beamtete Intelligenz und freibe- rufliche Intelligenz) hinzu, um schließlich den im Laufe des 19. Jahr- hunderts sich herausbildenden neuen Mittelstand (neben dem Kleinbürger- tum als altem Mittelstand) als Teil des Bürgertums geltend zu machen.37 Das zeitgenössische Allgemeine Landrecht gibt im 18. Jahrhundert selbst eine Negativdefinition für das Bürgertum an; demnach gehören diejenigen zum Bürgertum, die weder dem Stand des Adels noch dem Stand der Bauern angehören. Trotzdem kann das Bürgertum nicht über seine rechtliche Lage definiert werden, da die Rechte der einzelnen Bürger- formationen unterschiedlich waren. Auch die Klassenlage kann kein Kri- terium gewesen sein, „denn die einen waren selbständig, die anderen be- amtet, und wieder andere zählten zu den Privatangestellten“38, ebenso wenig die Bildung; „der Wirtschaftsbürger verfügte im 19. Jahrhundert nicht über jene akademische Bildung, die die Bildungsbürger als solche definierte.“39
Annehmbar scheint der Vorschlag, eine spezifische Kultur zum Kriterium der Bürgerlichkeit zu erheben. Da Kultur, verstanden als Leistungen auf der materiellen, sozialen und geistigen Ebene, immer mit einer gewissen Geisteshaltung verbunden ist (diese kann sowohl bewusst als auch unbe- wußt sein und gehört im Grunde zu den kulturellen Leistungen selbst), soll diese kurz beschrieben werden: Es finden sich „ eine besondere Hochachtung vor individueller Leistung“, „eine positive Grundhaltung gegenüber regelmäßiger Arbeit, eine typische Neigung zu rationaler und methodischer Lebensführung“, „das Streben nach selbständiger Gestaltung individueller und gemeinsamer Aufgaben, auch in Form von Vereinen und Assoziationen“ und „die Betonung von Bildung (statt von Religion)“40 ; außerdem „das Verständnis von Familie als einer privaten Sphäre emotio- naler Geborgenheit [...], das Bekenntnis zu liberalen Tugenden wie Toleranz, Kompromissfähigkeit und Freiheitsliebe, die Bedeutung `guter` Umgangsformen“41.
Kultur äußert sich in Form bestimmter Symbole, und diese haben der Ha- bitustheorie nach nicht nur Zeichenfunktion, sondern auch Unterschei- dungsfunktion. Das Kriterium für Bürgerlichkeit ist demnach das Krite- rium der Abgrenzung in verschiedene Richtungen; „im 18. Jahrhundert und noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts profilieren sich bürgerliche Kreise zunächst noch stark als Gegenkultur zur feudalen Herrschaftsordnung und adeligen Hofkultur, in ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert [...] dominiert die Abgrenzung `nach unten`, gegenüber der Arbeiter- klasse“42. Es kann zudem erklärt werden, warum sich im Rahmen des Zeit- lichen der Umfang der dem Begriff „Bürgertum“ unterzuordnenden Personen änderte, ohne dass dabei der Begriff deshalb eine Bedeutungsverschie- bung erfahren hat, weil die „objektive“ Lage der hinzu- oder abtreten- den Gruppen eine andere war als die der bürgerlichen Gruppen. Erstens könnte selbst auf der synchronen Ebene „Bürgertum“ nicht über die so- ziale Lage definiert werden, weil sich die einzelnen Gruppen in dieser Hinsicht voneinander unterschieden, und zweitens müsste man aus demsel- ben Grund den Begriff angesichts der sozialen Lagen der hinzu- und ab- tretenden Gruppen der Sinnlosigkeit bezichtigen. Nun verwenden wir ihn aber sinnvoll. Zurückgreifend auf unser oben genanntes Kriterium von Bürgerlichkeit können wir sagen: Wenn bestimmte Gruppen hinzukamen, so wies ihre Kultur starke Ähnlichkeiten mit der bürgerlichen Kultur auf. Der Grund dafür mag in der vergleichbaren Konfrontation mit anderen Le- bensstilen (so des Adels oder des Proletariats) liegen; Konfrontation bedeutet Wahrnehmung und Bewertung sowohl der eigenen als auch der fremden Praktiken, verbunden mit der Abstimmung der eigenen Praktiken auf diese Wahrnehmungs- und Bewertungsakte hin. Somit wird es möglich, dass bestimmte Gruppen sich durch ähnliche Wahrnehmungen und Bewertung- en in ihren Praktiken einander nähern und also ähnliche kulturelle Lei- stungen hervorbringen. Der Begriff der Kultur darf indes, wie oben an- gedeutet, ausschließlich über materiellen Leistungen definiert werden; es steht nicht in Frage, dass die Zugehörigkeit von Personen zum Bür- gertum „sich zwar auch im veräußerlichten Kultur besitz erkennen lässt [...], dass letztlich aber ein bestimmtes Kultur verhalten [...] sowie eine durch bestimmte kulturelle Werte und Erfahrungen geprägte allge- meine Befindlichkeit die letztlich ausschlaggebenden Faktoren sind.43 Bürgerlichkeit zeichnet sich also ebenso durch eine gewisse Mentalität aus, deren Begriff es erlaubt, die aufgrund der inneren Differenziert- heit des Bürgertums bestehenden „objektiven“ Unterschiede nicht zu Zer- störern des Begriffs des Bürgertums werden zu lassen.
Es gibt allerdings eine soziale Gruppe, über deren Zugehörigkeit zum Bürgertum Uneinigkeit herrscht; es handelt sich um das Kleinbürgertum. Zwar „[teilten] Handwerker und Ladenbesitzer [...] mit Kaufleuten und Industriellen den Besitz von Produktionsmitteln und Immobilien“44, doch sollte ja gerade die soziale Lage kein Kriterium der Zuordnung sein. Die der Akkumulation kulturellen Materials dienende Bildung muss als Kandidat ebenfalls abgelehnt werden, da sich die unteren Mittelschich- ten in dieser Hinsicht oft nicht von der Arbeiterschaft unterschieden. Ihr geringes Einkommen erlaubt sogar für Teile des Kleinbürgertums die
Bezeichnung als „proletarisierter Gruppe“. Auch ohne einer etwaigen Be- griffsverbiegung anheim zu fallen kann das Kriterium „bürgerliche Kul- tur“ eingeengt werden auf den Begriff des Leistungsgedankens. Auffind- bar in allen bürgerlichen Gruppen, funktioniert er jedoch nicht als bloßes Kennzeichen, sondern auch als Unterscheidungsmerkmal zu anderen Schichten: „Er diente etwa dazu, die Welt der Meister und Ladeninhaber von den unteren Klassen abzugrenzen, die aufgrund ihrer Lebensbedingun- gen nicht einmal den Schein der Bürgerlichkeit aufrechterhalten konn- ten.“45 Das auf den Punkt gebrachte Kriterium fällt somit im engen Sinne in den Bereich der Mentalitäten und nur im weiteren Sinne in den Be- reich der Kultur.46
2.3.„Modernisierung“
Der Umgang mit diesem Begriff gebietet Vorsicht, denn er ist nicht nur sehr jung, sondern wird auch von den einzelnen Wissenschaftszweigen mit unterschiedlichen Konnotationen gebraucht. Seinen Ursprung verdankt er der US-amerikanischen Soziologie der 50er Jahre, die im Zuge seiner Verwendung auf „die soziale und politische Entwicklung der sogenannten `unterentwickelten` Länder“47 referierte und in der Manier ihres Faches auf diesen Vorgang einen synchronen Zugriff suchte, wobei Variablen wie „Alphabetisierungsrate, Wachstumsquoten, Verstädterung, Wahlrecht oder Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitswesen“48 über das Vorhandensein von Mo- dernisierungsprozessen entscheiden sollten. Anwendung fanden diese Va- riablen sowohl auf die politische und ökonomische Struktur als auch auf das kulturelle System und den psychologischen Status.
Die Geschichtswissenschaft übernahm den Modernisierungsbegriff mit dem Ziel der „Emanzipation der Sozialgeschichte.“49 In Abwendung von ein- zelnen Personen- oder Staatsaktionen und somit der Ereignisgeschichte, die unter den strukturgeschichtlich orientierten Historikern immer den negativ bewerteten Eindruck des Zufälligen hervorruft, startete man un- ter Zuhilfenahme sozioökonomischer Kategorien die Erklärung der gravie- renden Veränderungen seit dem späten 18. Jahrhundert. Das Hauptaugen- merk lag auf dem Wandel des ökonomischen und politischen Systems, im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte oft „Doppelrevolution“ ge- nannt; andere Faktoren konnten aufgrund des strukturalistischen Ansat- zes aber nicht Außen vorgelassen werden. Modernisierung meinte also in erster Linie den Prozess der Industrialisierung, der verbunden war mit dem relativen (!) Rückgang des Agrarsektors gegenüber dem nun anwachs- enden Industriesektor, einer mit erhöhter Geschwindigkeit fortschrei- tenden Arbeitsteilung, der sich ausweitenden Ersetzung menschlicher Ar- beitskraft durch Maschinen, dem Ansteigen der Produktion und des durch- schnittlichen Einkommens. Begrifflich getrennt von der Industrialisie- rung als einem lang andauernden Vorgang ist die industrielle Revolution zu betrachten, die als „take off“ die rasante Umwälzung der Produk- tionsmethoden sowie deren kurzfristige Wirkungen bezeichnet. Hinsicht- lich des politischen Wandels wird einerseits von der Zentralisation der Herrschaft gesprochen; der „Staat“ (bzw. Staatsapparat) eignet sich be- stimmte Kompetenzen an und entscheidet über die diesbezügliche Vertei- lung von Ressourcen. Das wiederum erfordert andererseits den expliziten Nachweis einer Legitimation, die ihre Artikulation im Hinweis auf politische Partizipationsmöglichkeiten findet. Das heißt also auch, dass mit der Modernisierung eine umfassende Politisierung in die Gesell- schaft Einzug gehalten hat.
Eher als Wirkungen bzw. Folgen der wirtschaftlichen und politischen Veränderungen wird dagegen eine Anzahl weiterer Faktoren angesehen; Ur- banisierung (vor allem durch den Wegzug der ländlichen Bevölkerung), demographische Revolution (die Urbanisierung verstärkend), verbesserte Hygienebedingungen und Lebensmittelversorgung, Entwicklung der modernen Wissenschaft und spezifischer Organisationsformen, Veränderungen des Schulsystems, Säkularisierung, wachsende Bürokratisierung, Wandel der Lebensformen (Pluralisierung derselben, Individualisierung, Werteum- bruch, Aufbrechen des Paternalismus), steigende Interessenkonzentration und -organisation (Parteien, Zeitschriften, Klubs, Gesellschaften). Kritik erfuhren die Modernisierungstheorien hinsichtlich ihrer Implika- tion, „Modernisierung sei ein revolutionärer, unausweichlicher, irre- versibler, globaler, komplexer, systematischer, langwieriger [...], tendenziell homogenisierender und [...] progressiver Prozess.“50 Ein solcher Vorwurf zielt ab auf die Erklärungsdefizite aufweisende Vogel- perspektive strukturgeschichtlich intendierter Untersuchungen. Dass Strukturgeschichte einem anderen Anspruch verpflichtet ist als die Er- eignisgeschichte und Theorien wie Bourdieus Habitustheorie die Kluft zwischen Struktur und Individuum zu überbrücken vermögen, wurde weiter oben bereits angemerkt. Zum Zweiten könne, so die Kritiker, der Unter- schied zwischen vorindustriellen und im Modernisierungsprozess begrif- fenen Gesellschaften nicht auf die universelle Dichotomie Tradition-Mo- dernität reduziert werden. Dieser Einwand ist insofern berechtigt, als Modernität einen Zustand, Modernisierung dagegen einen Prozess bezeich- net; im Modernisierungsprozess selbst sind also immer noch traditionel- le Elemente auffindbar.51 Doch sogar moderne Gesellschaften haben sich die Pfade in ihre Vergangenheit nie ganz verbaut; das Gegenteil zu be- haupten hieße zu sagen, die gesamte Gesellschaft hätte Einblick in das Projekt „Modernisierung“ und würde, einer zweckrationalen Vernunft fol- gend, das angestammte Haus vom Staub der alten Zeit gründlich befreien. Als Hauptkriterium der Modernisierung im geschichtswissenschaftlichen Zusammenhang gilt der Übergang von der Agrar- zur Industriegesell- schaft. Blickt man als Historiker dabei auf soziale Milieus, müssen je- doch vor allem die Auswirkungen modernisierender Eingriffe sowie das konkrete Verhalten einer begrenzten Personengruppe einer Untersuchung unterzogen werden.
3. Bürgerliche Milieus im 19. Jahrhundert
3.1. Die Phase von 1815 bis 1848/49
3.1.1. Das Stadtbürgertum
Zwischen dem ausgehenden 18. und dem beginnenden 19. Jahrhundert hatten sich die Verhältnisse der sozialen Rangstufen kaum verändert, was hieß, dass das Stadtbürgertum eine zwar latent schon bedrohte, aber immer noch die mächtigste Gruppe innerhalb des Bürgertums darstellte. Ihr An- teil an der gesamten Stadtbevölkerung machte gerade 1-6% aus, der am privaten städtischen Einkommen lag dagegen bei zwei Drittel bis drei Viertel. Die Bindung des städtischen Wahlrechts an ein (entsprechend hoch angesetztes) Einkommen kam sowohl den Wählern als auch den in die Stadtverwaltung Gewählten zugute, darf jedoch nicht insofern missver- standen werden, als mit der Besetzung der Stellen der einen Seite die bloße Beibehaltung ökonomischer und machtpolitischer Standards gewähr- leistet, der anderen Seite das Instrument der Durchsetzung gruppenspe- zifischer Interessen in die Hand gegeben wurde. Beide Seiten gehörten einer sozialen Gruppe an, die durch gewisse Praktiken charakterisiert war, und als soziale Praktik ist die Wahl nicht allein Ausdruck der so- zialen Lage und Interessen der betreffenden Personen, sondern gibt auch Auskunft über die Beziehung der Gruppenmitglieder zueinander; ihre ge- ringe Anzahl und Überschaubarkeit lässt einen vormodernen, auf persön- licher Bekanntschaft beruhenden Kontakt vermuten, in dessen Rahmen öko- komisches (Geld), soziales (Reputation, Prestige) und kulturelles (Bil- dung) Kapital zum Einsatz kommt und zur Herausbildung bestimmter Prak- tiken und eines bestimmten Lebensstils, wovon weiter unten noch die Re- de sein wird.
Auf der politisch-rechtlichen Ebene war es erklärtes Ziel dieser Grup- pe, die „Dichotomie von Stadtbürgern und Einwohnern“52 aufrecht zu er- halten. Eine potentielle Bedrohung ging hier von der staatlichen Büro- kratie mit ihrem Streben nach vereinheitlichender Reglementierung und zentralstaatlicher Gesetzgebung aus; der Erfolg dieser Politik wäre gleichbedeutend mit der Ersetzung rechtlicher und sozialer Ungleichheit durch die Stadtgemeinde gleichberechtigter Staatsbürgereinwohner. Ein wahres Horrorszenario für die von verkrusteten Denkmustern geprägte Stadtelite; sie bewies Standesbewusstsein, das durch die Wahrnehmung der konkreten Umwelt, nicht aber durch die Kenntnis der zeitgenössi- schen Rechtsformalie begründet wurde. Denn de iure gehörten auch Beamte und freiberufliche Akademiker zum negativ definierten Stand des Bürger- tums, die trotzdem ohne Bürgerrecht in den Städten lebten. Die identi- sche Rechtsbezeichnung veranlasste das Stadtbürgertum jedoch keines- wegs, standesfremde Personen wohlwollend in seine Arme zu schließen, zumal gerade Beamte als Personifizierung des Staates die abstoßende und bedrohliche Aura eines lauernden und die Tradition aushöhlenden Fein- desdiplomaten mit sich herumtrugen.
Rechtliche Veränderungen, die die ökonomischen Verhältnisse betrafen, stellten ebenfalls eine Bedrohung der althergebrachten Standesstruk- turen dar. Schuld an der Missgeburt der „Gewerbeanarchie“ war die Re- vision der Städteordnung von 1831, im Zuge derer Auswärtige die Erlaub- nis erhielten, ein städtisches Grundstück zu erwerben und einen Gewer- bebetrieb zu eröffnen. Die Scheu vor riskanten Neuerungen wie der Grün- dung, Leitung und Finanzierung moderner, maschinell ausgerüsteter Fa- briken zeugen von traditioneller Wirtschaftsmentalität; demonstrativ wurde an der Tradition des Handelskapitalismus festgehalten. Vorläufige Erfolge erzielten die bürgerlichen Schwureinungen mit ihrem Bestreben, Reichtumsmacht nicht in politische Macht umschlagen zu lassen. Gewiss kann man die Frage stellen, warum sich das Stadtbürgertum gegen den Wandel zum Industriesystem sperrte, denn eine Anpassung an dasselbe hätte nicht nur den Gewinn einer zwar neuen, aber genauso rentablen Einkommensquelle nach sich gezogen, sondern auch die Möglichkeit bein- haltet, aktuelle Machtverhältnisse in das neue Wirtschaftssystem selbst hineinzutragen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Gruppe sich nicht am immer öfter anzufindenden Leistungsgedanken stieß, denn den setzte auch ihre eigene Wirtschaftsaktivität voraus. Vielmehr bangte man um den Verlust der Überschaubarkeit machtpolitischer und ökonomischer Struktu- ren; die jeweiligen städtischen Bürgergeschlechter kannten sich unter- einander, wussten um ihre eigene und um die fremde Reputation, der ord- nungsmäßige Ablauf ökonomischer Prozesse war ihnen gewiss. Folge einer industriekapitalistischen Wirtschaft wäre ein in seinen Folgen unabseh- bares Bevölkerungswachstum und die Produktion derartiger sozialer Ver- hältnisse, die letztlich die politische Machtelite zu unbilligen Kon- zessionen zwingen oder bei Maßnahmenverweigerung die Ausartung in Ge- walt bedeuten würde. Zudem war der Beruf des Unternehmers mit einer ho- hen Risikobereitschaft verbunden, was außerhalb jedweder Handlungsprä- ferenzen eines Stadtbürgers lag, und selbst das persönliche Fernhalten von unternehmerischen Aktionen schloss nicht die Möglichkeit aus, dass Krisen des Industriekapitalismus auch ihn selbst treffen würden; die Anonymität des neuen Marktes hätte ein Einschreiten von vornherein verhindert.
Noch war die soziale Hierarchie von der anlaufenden Entwicklung kaum berührt. Das Großbürgertum, d.h. Großkaufleute, Bankiers, Verleger, ho- he Beamte, bewegten sich in eigene Verkehrs- und Heiratskreisen; das Kleinbürgertum, also selbständige Handwerker und Gewerbetreibende, Kaufleute, Krämer, mittlere Beamte, stellten das „Bollwerk des Tradi- tionalimus“53, verfügten jedoch nicht über das spezifische soziale Ka- pital, um mit dem Stadtbürgertum eine fruchtbare Bindung einzugehen; die rechtliche Lage der Hintersassen und Schutzverwandten war weiterhin labil; und der großen Mehrheit der Stadtbevölkerung (Handwerksgesellen, Handarbeiter, Tagelöhner, Dienstboten, Gesinde) war ein Leben in Passi- vität beschieden.
Ganz klar muss die Vorstellung angegriffen werden, nach der das Stadt- bürgertum die klassische Trägerschicht des modernen Industriekapitalis- mus gewesen sei. Im Gegenteil erwies sie sich als mentaler Hemmschuh der Dynamik des ökonomischen Modernisierungsprozesses. Eine zählebige traditionale Mentalität bestimmte jegliche Lebensäußerungen seitens dieser sozialen Gruppe.
3.1.2. Die Bourgeoisie
So wie das Stadtbürgertum die Bourgeoisie bekämpfte, machte die sich konstituierende Bourgeoisie ihrerseits dem Stadtbürgertum keinerlei Avancen. Durch den Vorbildcharakter der industriellen Revolution in England unter immensem Nachahmungsdruck stehend, bildeten die ersten Jahrzehnte des neuen Jahrhunderts den Beginn der Herausbildung zweier Klassen, die indes nicht sämtliche Gesellschaftsmitglieder umfasste, sondern eben nur bestimmte Personen. Als Besitzklasse verfügte die Bourgeoisie über ökonomische Kapitalien, zeichnete sich durch hohe Lei- stungsfähigkeit aus, übernahm dementsprechende Leistungsfunktionen und sicherte sich, indem sie diese Faktoren interessengemäß kombinierte, die Marktmacht. Wirtschaftliche Interessen waren beispielsweise Vertei- digung von Unternehmerinteressen, Vermehrung der Lebenschancen, Vermin- derung der Lebensrisiken, Minimierung der Fremdbestimmung und Maximie- rung der Planungs- und Handlungsautonomie. (Die zweite der beiden Klas- sen ist die industrielle Lohnarbeiterschaft als Erwerbsklasse, soll hier aber nicht behandelt werden.)
Doch „ging der wirtschaftliche Aufstieg dieser Klasse nur selten mit einem deutlichen Zugewinn an sozialer Geltung und politischer Macht Hand in Hand.“54 Noch begriffen sich die Bürger und Nicht-Bürger dieser Gesellschaft nicht als Angehörige einer Klasse, sondern eines Standes, war das Wirtschaftsbürgertum gerade erst auf dem Weg zu einer Klasse „an sich“, aber weit davon entfernt, eine Klasse „für sich“ zu sein. Zu Recht wird in der Wissenschaft von einer „Feudalisierung“ der Bourgeoi- sie gesprochen, die sich auf sozialer und kultureller Ebene abzeichnete und wovon weiter unten zu sprechen sein wird. Abgesehen davon lässt ein internationaler Vergleich das deutsche Wirtschaftsbürgertum, gemessen am Westen, insgesamt sogar eher schwach und schwunglos erscheinen. Der politische Kampf wurde einerseits gegen das starrsinnige Stadtbür- gertum geführt, welches mit seinen Zünften als Ausdruck handelskapi- talistischen Traditionalismus und seinem Festhalten an der Honora- tiorenherrschaft das Freigeben des Weges zu modernem Industriekapita- lismus und Kommunalpolitik rigoros verweigerte. Abgemildert wurde ihr Verhältnis zueinander durch zeitweiliges Konnubium (soziales Prestige wog in dieser noch ständisch geprägten Welt zumeist schwerer als die erfolgreiche Suche nach Erfüllungsgehilfen rein wirtschaftlicher Inter- essen) und die identische Haltung, nämlich Abwehr, dem vierten Stand gegenüber. Von genuin bürgerlicher Mentalität zeugt die Kritik am Adel; sein Müßiggang, die ungerechte Steuerbelastung und die Zurschaustellung des Militärischen passten nicht in die bürgerlichen Vorstellungen von Leistung, pro-forma-Egalität und Emanzipation des Menschen im Sinne der Aufklärung. Auch die eigenen Standesreihen verschonte man nicht; das Verhältnis zum Bildungsbürgertum, besonders zu den Beamten, gestaltete sich ambivalent. Der Druck des Beamtenstaates widersprach gewissen wirtschaftsliberalen Interessen, darf aber nicht dahingehend fehlinter- pretiert werden, dass das Wirtschaftsbürgertum die Abschaffung jegli- cher Kontrollinstanzen zum Ziel auserkoren hätte: „Extrem antigouverne- mentale Laissez-faire-Politik wurde von deutschen Unternehmern nur sel- ten gefordert. [...] Kollektive Orientierungen lagen ihnen näher“55. Trotz staatsliberalen und aufklärerischen Gedankenguts insistierte man mit Blick auf die unteren Klassen auf die „natürliche Ungleichheit“ und war voller Furcht vor der Pöbelherrschaft. Das politische Programm be- inhaltete zwar die unterschiedlichsten Arten von Freiheiten, sah jedoch nicht die Erringung einer „gleichmacherischen Demokratie“ vor. Sozialer und politischer Radikalismus lag dieser Gruppe sowohl bezüglich der In- halte als auch der Vorgehensweise fern; nicht mit Revolutionen, sondern maßvollen Reformen sollte der Übergang zum Verfassungsstaat vollzogen werden. Spätestens hier würde man zu „Koalitionen“ mit dem Bildungsbür- gertum bereit sein müssen, da höhere Einsicht (bedingt durch Bildung) größere Einsicht und somit verbesserte Handlungsdispositionen ver- sprach.
Innerhalb der Bourgeoisie herrschte ein hohes Maß an Selbstrekrutie- rung; der größte Teil der Unternehmer stammte aus Familien, in denen schon der Vater Fabrikant, Bankier oder Kaufmann gewesen war. Ein weit- aus geringerer Teil hatte einen Pfarrer, Lehrer, Beamten oder Gelehrten zum Vater, ungefähr genauso viele einen Handwerker, Händler oder Guts- pächter. Auch ihre Ausbildungslaufbahn hatte sich unterschiedlich ge- staltet; etwa die Hälfte nannte sich Bank- oder Kaufmann, ein Drittel war ausgebildeter Handwerker, die restlichen hatten eine Hoch- oder Fachhochschule besucht oder arbeiteten vor ihrer Unternehmerkarriere als Beamte oder Freiberufler.
Lokal verwurzelt, war auch das Wirtschaftsbürgertum in seiner Anfangs- zeit durch Immobilität gekennzeichnet, was aber den Vorteil der ver- trauten Umgebung mit sich brachte; ein fremdes Umfeld bedeutete härte- ren Existenzkampf, schloss jedoch auch den Gewinn unabdingbarer Erfah- rungen ein. Die Familienpolitik war auf die langfristige Steigerung des materiellen und sozialen Kapitals ausgerichtet, dementsprechend ge- schäftsmäßig kalkulierte man Hochzeiten und näherte sich damit adliger Familienpolitik an. Charakteristisch war das adelsgleiche Bestreben, die Ehre der Familie insgesamt zu vermehren, denn nur so konnten sich wahre Unternehmerdynastien herausbilden. Je mehr man versuchte, in Adels- oder bildungsbürgerliche Familien einzuheiraten, um so verpönter wurde das „Heiraten unter dem Stand“. Es entstanden also untereinander vernetzte Heirats- und Verkehrskreise, innerhalb derer die Regeln so- zialer Kontrolle strikt eingehalten als auch angewendet wurden. Trotz der Adelskritik seitens des Bürgertums ist eine anhaltende Adelsimita- tion feststellbar, die nur möglich war aufgrund des erwirtschafteten Profits. Gab man sich als Wirtschaftsbürger früher mit einem beschei- denen Wohngebäude zufrieden und wurde dieses „Verhalten so gerne durch Attribute wie `maßvoll` oder `bescheiden` charakterisiert“56, so wohnte man nun in einer geräumigen, zweckdienlichen Villa und führte einen „grandseigneuralen“ Lebensstil. Ökonomische und Statusziele standen demnach nebeneinander; der Stolz auf die eigenen Leistungen, die Befol- gung eines verpflichtenden Arbeitsethos und die rastlose Erfüllung im Berufsleben hinderten nicht daran, ständische Exklusivität für sich in Anspruch nehmen zu wollen. Im Dienste derselben standen auch der Ver- such, Titel bzw. Orden verliehen zu bekommen, und sich in den Stand des Verdienst- oder Geburtsadels zu versetzen. Richtmaß des öffentlichen Umgangs wurde der feudalaristokratische Ehren- und Verhaltenskodex; all das drückt einen Widerspruch aus, der sich selbst durch die Analyse der ökonomischen, sozialen und kulturellen Dimension nicht auflösen lässt. „So passt der liberale politische Standort kaum zu jener willkommenen Nobilitierung [...]. Da erhält der bürgerliche Wertehorizont wiederum sehr pragmatische, oft ambivalente Züge“57. Niederschlag findet diese Ambivalenz beispielsweise im Zuge der „Ausbildung einer bürgerlichen Form von Körper- und Bewegungskultur, die sich einerseits bewusst von adligen Mustern absetzt, andererseits aber auch solche Muster in anver- wandelter Form übernimmt.“58 Der Hang zum zeigefreudigen Lebensstil bil- dete sich allerdings erst im Laufe der Jahrzehnte nach 1820 heraus, vorher „disziplinieren [sie] sich in dieser Hinsicht selbst, bleiben demonstrativem Luxus und Konsum gegenüber meist ebenso reserviert wie etwaigen Bohemien-Moden.“59 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Ab- grenzung zum Adel hin sogar ausgesprochen stärker als zu den unteren Schichten und im Grunde signifikant für das deutsche Wirtschaftsbürger- tum. Das mag unter anderem daran gelegen haben, dass es zwar ein Unter- scheidungsmerkmal wie den Leistungsgedanken vorweisen konnte, dieser jedoch noch nicht ausreichte, sich vom Adel, der ja immer noch ein ho- hes Sozialprestige besaß, markant zu unterscheiden. Eine allzu frühe Übernahme spezifisch adliger Lebensformen wäre wahrscheinlich fast ei- nem Eingeständnis der eigenen Schwäche und Einfallslosigkeit gleichge- kommen. Die Überzeugung, „dass Erfolg und Glück keine unerklärlichen Geschenke des Zufalls, sondern vorhersehbare Ergebnisse von rationalem Handeln sind“60, musste unter Beweis gestellt werden; war dieser Beweis erbracht, konnte man daran gehen, auch fremde Kulturelemente zu absor- bieren, ohne sich des Aufgehens in einer fremden Schicht verdächtig zu machen. Förderung erfuhr typisch kapitalistisches Verhalten durch den vom frühneuzeitlichen Modernisierungsprozess geprägten protestantischen Arbeitsethos; das Ideal der disziplinierten Weltarbeit und des Erfolg- strebens stand Pate bei der Herausbildung wirtschaftsbürgerlicher Ar- beitsmentalität.
Sehr viel schwieriger war kulturelles Kapital in Form der Bildung zu erwerben. Die einem solchen Kapital verpflichtete Gruppe des Bildungs- bürgertums erhob Anspruch auf die Überlegenheit der Bildung gegenüber der industriellen Leistungsfähigkeit, worauf das Wirtschaftsbürgertum mit dem Verweis auf den Fortschrittsglauben und den ökonomischen Pro- gress der eigenen Klasse antworteten. Es war zudem argumentativ leich- ter, die Nützlichkeit der ökonomischen Modernisierung im Rahmen der Na- tionenbildung höher als die der Bildung einzuschätzen. Das bürgerliche Individualitätsideal bedingte allerdings ein gewisses Maß an Bildung, und so „suchen [sie] die Mitgliedschaft in Kunstvereinen, Salons, Zir- keln, in denen diese `feinere` Bildung gepflegt und vermittelt wird“61. Der politischen Zwecken entspringende „Koalitionszwang“ wurde weiter oben schon deutlich gemacht. Es dürfte noch etwas Weiteres gegeben ha- ben, was die beiden Bürgergruppen zusammenrücken ließ. Das war erstens der Stolz auf eigens erbrachte Leistungen, der natürlich beim beamteten Bildungsbürgertum hinsichtlich seiner exekutiven Funktion wesentlich geringer gewesen sein dürfte als beim Wirtschaftsbürgertum; diese Dif- ferenz hebt sich aber auf, da das Bildungsbürgertum sich ebenfalls vom „ungebildeten“ Adel abheben wollte und außerdem wie das Wirtschaftsbür- gertum in Abgrenzung vom Adel auf seine Nützlichkeit hinweisen konnte; nur dass das Wirtschaftsbürgertum im Dienste der Nation, die Beamten dagegen im Dienste des Staates Leistungen erbrachten.
Die Herausbildung verbindender Interessen machte sich bemerkbar am auf- blühenden Vereinsleben, durch welches bürgerliche Menschen oft schon in ihrer Studentenzeit Prägung erfuhren; in den studentischen Burschen- schaften pflegten sie „demonstrativ `gemeinsames deutsches Wesen` [...], gleichermaßen gerichtet gegen lokalbürgerliches `Philistertum` wie gegen kleinstaatliche Obrigkeiten.“62 Ähnlich identitätsstiftend wirkte die Mitgliedschaft in Freimaurerlogen, Wirtschaftsverbänden oder Handelskammern. Als modern sind diese Organisationsformen deshalb zu bezeichnen, „weil sich darin zum ersten Mal in dieser Form und Breite eine Art von politischem `Gesinnungshabitus` manifestiert“63 ; gesell- schaftspolitische Präferenzen wurden so zu einem von mehreren, vonein- ander nicht unabhängigen Merkmalen, anhand derer die Zugehörigkeit zur Gruppe des Bürgertums bestimmt wurde.
Hinsichtlich des Hauptkriteriums für Modernisierung im geschichtswis- senschaftlichen Zusammenhang kann das Wirtschaftsbürgertum tatsächlich als Hauptinitiator bezeichnet werden, da es den eigentlichen Übergang zur industriekapitalistischen Arbeitsweise nicht nur selbst vollzog, sondern auch die bisher einzige Gruppe war, die an die Fortschrittlich- keit des neuen Wirtschaftssystems glaubte. Neu war der Zusammenschluss zu Organisationen, die spezifische politische und wirtschaftliche In- teressen artikulierten und sich darüber hinaus als Instrument der Durchsetzung dieser Interessen verstanden; Ausdruck für die Auffassung, der Mensch hätte das Recht und die Möglichkeit, die durch rationale Einsicht gewonnenen Handlungsmaximen in die Tat umzusetzen. Der Tradi- tion war man insofern noch verhaftet, als man sich Gruppen gegenüber, die als nicht standesgemäß galten, verschloss. Das gilt sowohl für die unteren Schichten als auch für den Adel, auch wenn man von ihm gewisse Verhaltensweisen übernahm. Diese verstärkten im Grunde die Abgrenzung, da sie in der eigenen Wahrnehmung in einem anderen Kontext standen; zwar erwarb man beispielsweise Villen, die den adligen Wohngebäuden in nichts nachstanden, diese sollten jedoch den Stolz auf die persönlich erbrachten Leistungen (und nur durch den damit erzielten Profit konnte man sich Luxus leisten) ausdrücken. Das Wirtschaftsbürgertum folgte keinem Denken, das sich dadurch auszeichnete, dass man in opportunisti- scher und rein berechnender Manier nach jeder Möglichkeit griff, die die Steigerung der ökonomischen Handlungsfähigkeit versprach. Es stell- te auch noch keine überragende Mehrheit der Bevölkerung dar, sondern war ein „in sich geschlossener [...] und sowohl gegenüber dem Bildungs- bürgertum wie gegenüber dem Adel abgegrenzter“64 Teil der Gesellschaft.
3.1.3. Das Bildungsbürgertum
Das Bildungsbürgertum stellt neben der Bourgeoisie die das gesamte Bür- gertum prägendste Gruppe dar, hatte jedoch genau wie dieses vorerst ei- nen recht kleinen Umfang. Zu ihr gehörten die verschiedensten Berufs- gruppen; Ärzte, Rechtsanwälte, Richter, Gymnasiallehrer, Professoren, höhere Verwaltungsbeamte, Naturwissenschaftler, Ingenieure, Schrift- steller, Journalisten, Apotheker, Architekten, Pfarrer. Sie wiesen in der Regel eine hohe soziale Herkunft und einen hohen Grad an Selbstre- krutierung auf.
Ihr ursprünglicher Schwerpunkt lag in der Bürokratie, der Geistlich- keit, dem Medizinal- und Universitätswesen, bis zu Beginn des 19. Jahr- hunderts die freien akademischen Berufe vordrangen. Bislang bestand aufgrund der hohen Alimentierung der Beamten das höchste Ziel darin, in den Staatsdienst einzutreten, da sich aber die Aufnahmefähigkeit hier in den 20er Jahren erschöpfte, strömte man nun vermehrt in die freien Berufe.
Es findet sich in diesem Zusammenhang eine Spaltung innerhalb des Bil- dungsbürgertums selbst. Denn im Zuge der Ausbreitung kapitalistischer Marktbeziehungen wuchs der Bedarf an immer spezialisierteren Arbeits- kräften, die ihre jeweiligen Leistungen auf dem sich konstituierenden Markt anboten. Hieraus entsprang ihr Interesse an der Maximierung ihrer Autonomie gegenüber Laien und Konkurrenten, der Steigerung der Markt- macht und einem höheren, den Leistungen angepasstes Einkommen. Die staatliche Reglementierung der akademischen Ausbildung hielt jedoch an und wurde zudem von Personen durchgeführt, die aus den zu kontrollie- renden Berufen selbst stammten. Seit dem Vormärz gab es auffällige Spannungen zwischen der beamteten Intelligenz und gebildeten Bürgerli- chen; erstere leistete trotz der Verteidigung des Wirtschaftsliberalis- mus aus Angst vor einer „Expertenautonomie“ Widerstand gegen das Frei- geben mancher Berufe, letztere riefen nach der Privatisierung von bis- her staatlichen Tätigkeitsfeldern und begannen, die bürokratische Herr- schaft überhaupt in Frage zu stellen. Dieses Problem ist Ausdruck einer der Widersprüche, die aus bürgerlichen Auffassungen folgten; Bürokratie impliziert anonyme und rationale Bewältigung von Angelegenheiten der verschiedensten Lebensbereiche und wurde als säkulares und somit moder- nes Element begrüßt, andererseits befürchtete man eine dem Individua- litäts- und Selbstverantwortungsstreben entgegenstehende „Gängelei von oben“. Da man aber auch an die Vernunftbegabtheit des Menschen glaubte, fand man einen Kompromiss, der dem Staat, was die Kontrolle der Berufe anging, Einfluss in formaler Hinsicht gewährte, den Berufsangehörigen dagegen die jeweiligen inhaltlichen Bestimmungen überließ.
Die wachsende Spezialisierung der Berufe ist nun ein charakteristisches Merkmal des Bildungsbürgertums und hilft bei der Erklärung der immer stärkeren Fragmentierung dieser Gruppe. Nicht die Zugehörigkeit zu ei- ner bestimmten Besitzklasse, sondern „eher ihre Zugehörigkeit zu einer spezifischen Leistungsklasse [...] [wurde] zur Basis der kollektiven Identität“65. Da es dieser viele gab, erscheint das Bildungsbürgertum als zersplittert, was aber nicht über einigende Momente hinwegtäuschen sollte, zum Beispiel den Leistungsgedanken. Anders als beim Wirt- schaftsbürgertum setzte hier das Verhältnis zwischen Leistungsanbieter und -abnehmer ein gewisses Vertrauen voraus, welches nur durch die Ak- zeptanz des Expertenwissens seitens der Abnehmer gewährleistet wurde. Das Wirtschaftsbürgertum hätte in den Personen, die die Freiheit be- stimmter Berufe von staatlicher Kontrolle erreichen wollten, Verbündete finden können, da auch sie, wenngleich nicht in radikalster Form, das Zurückziehen des Staates aus manchen Bereichen forderten. Gerade das tat es nicht; Bildung war besonders in der Anfangszeit für die Bour- geoisie insofern interessant, als es dem Fortkommen im Beruf diente, während unter den Bildungsbürgern das Ideal der umfassenden Allgemein- bildung sehr viel höher stand und der Erwerb von Wissen nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit bewertet wurde. Eine Annäherung zwischen beiden Gruppen fand mit dem Eindringen von Freiberuflern in die freie Wirtschaft statt; die Heirats- und Verkehrs- kreise öffneten sich langsam dem Unternehmertum, auch wenn dieses somit einem „manchmal etwas antikapitalistisch gestimmten Bildungsbürgertum konfrontiert war“66. Es verband sie neben dem Stolz auf die eigene Lei- stung eine quasi-aristokratische Geisteshaltung, wobei das Bildungsbür- gertum sogar auf eine längere und gefestigtere Tradition zurückblicken konnte. Auch das Bildungsbürgertum glich sich in ihrem Verhalten ari- stokratischen Machteliten an und ist durch seine starken ständischen Züge sowie seine Exklusivitätspflege charakterisiert. Der ganze Vorgang mag sich folgendermaßen abgespielt haben: Während der Reformepoche hat- te sich das Prestige der Beamtenschaft dermaßen erhöht, dass die Zahl der Immatrikulationen an den Universitäten sprunghaft anstieg. Noch war der Zugang zum relativ billigen Studium einfach, der Andrang dement- sprechend hoch. Das Einschreiten des Staates in Form höherer Anforde- rungen führte in den 30er Jahren zu einem Einbruch bei der Zahl der Im- matrikulationen; das Bildungsbürgertum wurde so mit dem von ihnen selbst vertretenen Leistungsprinzip immens konfrontiert. Das wiederum festigte bei denen, die eine beamtete Stellung erlangt hatten, die eli- täre Grundhaltung. Angesichts des gestiegenen Leistungsdrucks nimmt es nicht Wunder, dass die wechselseitige Attraktivität von Wirtschafts- und Bildungsbürgertum stieg; ihre Synthese ließ den eigentlich bürger- lichen Wertekanon erwachsen, in den nun vor allem die Bildung inte- griert wurde, doch der Voraussetzung eines Mindesteinkommens nicht den Rang ablaufen konnte: „Wem es zwar nicht an Bildung, jedoch an Exi- stenzmitteln fehlte, um sich jener `bürgerlichen Gesellschaft` der Tee- nachmittage, der Ausflüge, der Bälle, der Essenseinladungen, der Ver- einsmitgliedschaften mehr oder weniger regelmäßig anzuschließen, der schließt sich auf Dauer selbst aus.“67
Voraussetzung für derartige Aktivitäten ist ein gewisses Maß an Frei- zeit, gemeinhin auch „Muße“ genannt. Ein Widerspruch mit dem geforder- ten Leistungsprinzip ergibt sich daraus nicht, denn Arbeits- und Frei- zeitwelt traten allmählich immer mehr auseinander; nur der Arbeitsbe- reich unterstand dem Primat der Leistung, während der Freizeitbereich Dingen wie bürgerlichen (Bildungs-)Reisen, der Bildung überhaupt sowie anderen standesgemäßen Beschäftigungen, die der Verwertung und Erhöhung sozialen und kulturellen Kapitals zugute kamen, vorbehalten war. Wie schon angedeutet. Gab es hinsichtlich der Bildung Unterschiede zwischen Wirtschafts- und Bildungsbürgertum. Letzteres favorisierte das neuhuma- nistische Bildungsideal, das „auf jener formalen, am fremden Gegenstand gewonnenen Bildung [beharrt]“68 und an einem unmittelbaren Nutzen für das Berufsleben nicht interessiert ist, während Bildungserwerb unter Wirtschaftsbürgern zumeist den Ansprüchen der späteren Karriere gerecht zu werden hatte.
Vormodern und teilweise widersprüchlich in seinem sozialen und kultu- rellen Verhalten (ständische Abschottung vor allem nach unten, obwohl de iure alle Menschen zu Bildung und Einsicht befähigt sein sollen), trug das Bildungsbürgertum doch insofern zur Modernisierung bei, als es durch sein Streben nach beruflicher Unabhängigkeit vom Staat den Weg zur „Professionalisierung“ einschlug, mit den Zug auf den sich entfal- tenden Markt marktwirtschaftliche Tendenzen forcierte und aufgrund sei- ner fortschreitende Spezialisierung das Prinzip der Arbeitsteilung för- derte.
3.2. Die Phase von 1871 bis 1914
3.2.1. Die Bourgeoisie
Die Zeit nach der Reichsgründung war gekennzeichnet von der trotz Kri- sen weiterhin anhaltenden Durchsetzung der marktwirtschaftlichen Prin- zipien und dem fortgesetzten industriellen Wachstum. Erstaunlich ist auf den ersten Blick, dass der „allmähliche [...] Übergang zum Inter- ventionsstaat seit den 1870er Jahren [...] auf wenig Widerstand seitens der sich etablierenden großen Unternehmerverbände [stieß].“69 In der wissenschaftlichen Literatur findet man fast gegensätzliche Behauptun- gen, was das Verhältnis der Unternehmer zu Beamten betrifft, doch an- gesichts der Fixierung des Unternehmertums und der bei beiden Gruppen vorhandenen Leistungsorientierung kann man davon ausgehen, dass „der typische Unterschied zwischen Unternehmern und Beamten [...] an Präg- nanz [verlor]“70. Ein solches Sicherheits- und Ordnungsbedürfnis hing mit der sozialen Unsicherheit zusammen; erstens war die Gruppe der Wirtschaftsbürger relativ klein, so dass ihre Ausstrahlungskraft nicht zur umfassenden gesellschaftlichen Anerkennung hinreichte, zweitens konnte es sich „in Deutschland viel weniger als in Frankreich auf das beruhigende Sicherheitspolster eines breiten Kleinbürgertums stützen“71 und sah sich einer breiteren Arbeiterbewegung gegenüber als in anderen europäischen Ländern.
Seit den 70er Jahren ist ein zunehmender Wechsel aus bürokratischen Karrieren in die Unternehmertätigkeit feststellbar; in diese Zeit fällt das Aufkommen des Managerberufs, in den vor allem Personen aus Beamten- oder höheren Angestelltenfamilien strömten und der die zunehmende Tren- nung von unternehmerischen Eigentums- und Kontrollfunktionen förderte. Ein weiteres Merkmal innerer Fragmentierung ist die von den klassischen Unternehmern zu unterscheidende Entwicklung der Großunternehmer, die ihre Abgehobenheit sowohl vom Adel als auch vom gesamten restlichen Bürgertum durch einen luxusdemonstrierenden Lebensstil zu betonen ver- suchte und für die akademische Bildung kein notwendiges Statussymbol darstellte.
Klassische Unternehmer dagegen weisen nun auch ein durchweg höheres Bildungsniveau auf als zu Beginn des 19. Jahrhunderts; „der alte Bil- dungsvorsprung der akademischen Beamtem, der freien Berufe, der Hoch- schul- und Oberschullehrer schmolz immer mehr dahin.“72 Unternehmertum und Bildungsbürgertum näherten sich so einander an, ohne jedoch inein- ander aufzugehen. Zwar stieg der Prozentsatz der Unternehmersöhne, die eine bildungsbürgerliche Laufbahn einschlugen, aber umgekehrt stieg nicht der Satz der in die Wirtschaft drängenden Bildungsbürger, und auch die Heiratskreise zwischen beiden Gruppen waren nur begrenzt mit- einander vernetzt. Bezeichnend für diese Zeit ist sogar die fortschrei- tende Zersplitterung des Bürgertums, die auf der Ebene des sozialen Ka- pitals seitens des Staates dadurch forciert wurde, dass er ein kompli- ziertes System von Orden und Titeln sowie von Ehrungen entwarf und so die Konkurrenz um persönliches soziales Prestige heraufbeschwor.
Eine Mentalitätskonstante stellte die Orientierung an einer starken und bürokratisierten Monarchie dar, was dem Wirtschaftsbürgertum den Vor- wurf des Defizits an liberaler Bürgerlichkeit einbrachte. Dieser Mangel äußerte sich auf sozialer und kultureller Ebene. Erstanwärter der Ver- kehrs- und Heiratskreise war die Unternehmerwelt, doch hinter ihr ran- gierte schon das Beamtenmilieu. Starke Attraktion ging besonders seit den 60er Jahren vom Militär aus; mit diesem wurden Dinge wie Autorität des Offiziers, Disziplin und Mannschaftsgehorsam assoziiert. Die damit verbundenen Verhaltensweisen finden sich in Form eines vormodernen Pa- ternalismus sowohl in der Arbeits- als auch Familienwelt wieder. Die
Übernahme spezifisch militärischer Eigenschaften war gleichbedeutend mit der Übernahme adlig geprägten Verhaltens, da der Adel die Spitzenpositionen der Armeen dominierte.
Doch nicht nur in der Armee, auch in der Verwaltung und Politik teilte sich das Bürgertum die Macht mit dem Adel. Während in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch die Abschottung des Bürgertums zum Adel hin Sammelpunkt bürgerlichen Gestus` war, setzte jetzt verstärkt eine Ab- grenzung nach unten ein, verbunden mit der Anpassung bürgerlicher Le- bensweisen an den adligen Lebensstil. Im Zuge dieser „Aristokratisie- rung“73 bauten sich Bürger schlossartige Villen, erwarben Rittergüter, waren die Söhne Mitglieder adliger studentischer Corps, wurden die Kin- der auf vom übrigen Bürgertum getrennten Schulen ausgebildet, gierte man nach der Nobilitierung. Eine Verschmelzung der bürgerlichen und adligen Gruppe fand jedoch nicht statt. Ein solches Leben, das nun von „der älteren, einfachen, an bürgerlichen Werten der Sparsamkeit und Solidität orientierten Lebensform“74 abwich, erforderte beträchtliches finanzielles Kapital, welches nur mittels intensiver Wirtschaftsaktivi- tät angesammelt wurde, wodurch wiederum die Betonung des Leistungsprin- zips bewirkt und die Abgrenzung zum Adel hin beibehalten wurde. Die Paarung des hohen Maßes an Innovationsbereitschaft und Fähigkeiten im ökonomischen Bereich mit der Unfähigkeit, den sich daraus erwachsenen sozialen Konflikten zu stellen, führte zur Rechtfertigung des unterneh- merischen Wettbewerbs anhand des sozialdarwinistischen Konfliktmodells; im Gesamtrahmen ein weiteres Merkmal bürgerlichen Konservatismus, der den Widerspruch zwischen deklariertem Ideal und tatsächlichem Verhalten demonstriert, wenn einerseits das Modell einer bürgerlichen Gesell- schaft mit dem Anspruch auf Allgemeinheit auftritt, andererseits die Bürger „diese Demokratisierung als zweischneidiges Schwert und poten- tielle Bedrohung erkannten“75.
Während also die ökonomische Modernisierung durch das Wirtschaftsbür- gertum rasche Fortschritte erleben durfte, traten auf der sozialen Ebe- ne Rückschritte in Form einer „Aristokratisierung“ und „sozialen Mili- tarisierung“ ein. Mit verschiedenen Widersprüchen war man konfrontiert; das Ideal der Selbstbestimmung jenseits stattlicher Autorität lief der Anhänglichkeit zu staatlicher Intervention zuwider, und kulturelles Ka- pital war de iure leider auch bürgerfeindlichen Kräften zugänglich, konnte aber „weder abgeschafft noch entscheidend eingegrenzt werden, ohne Struktur und Funktionsweise eben jener Gesellschaft zu beeinträchtigen, die weitgehend auf bürgerlichen Werten und bürgerlichem Kulturgut beruhte.“76 Die Abgrenzung zu Bildungsbürgertum und Adel hin nahm ab, die zu den unteren Schichten dagegen zu.
3.2.2. Das Bildungsbürgertum
Der bisher recht kleinen und nur gemächlich wachsenden Gruppe des Bil- dungebürgertums bot sich die mit der Reichsgründung einhergehende Plan- stellenerweiterung in der Verwaltung als Expansionschance; zwischen 1870 und 1914 stieg die Zahl der Studenten vehement an. Die Arbeits- markterweiterung erlaubte aber auch das weitere Vordringen der freien Berufe. Charakteristisch für die soziale Gruppe des Bildungsbürgertums war nun die innere Fragmentierung, ausgelöst durch die Aufsplitterung des Generalistenideals des Gelehrten zugunsten des Spezialwissens von Fachexperten. Fortschritte in der Wissenschaft, d.h. also auch quanti- tatives Anwachsen des benötigten Wissens, und die natürliche Zeitbe- grenzung ließen den einst als so wertvoll erachteten neuhumanistischen Bildungsanspruch immer mehr in den Hintergrund treten; was sich jetzt zu den Prämissen eines bildungsbürgerlichen Lebens drängte, war der Primat der Karriere. In seiner Eigenschaft als bedeutende Machtressour- ce wurde Spezialwissen für die nichtbeamteten Akademiker zum Anlass, auf die rechtliche Autonomie ihrer Berufe zu drängen; zumindest weitge- hende Teilautonomien konnte sie als Erfolg für sich verbuchen. Die be- amtete Intelligenz dagegen gebärdete sich in ihrer Klammerung an den Staat wie die Bourgeoisie; hinsichtlich der zunehmenden Zahl der Stu- denten, die eine Expertenausbildung anstrebten, „fußte die Professiona- lisierung solcher Berufe viel eindeutiger als anderswo auf staatlich bereitgestellter und staatlich normierter Universitätsbildung.“77 Sowohl die beamteten als auch die freien Berufe zeichneten sich durch eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Abneigung gegen das industri- elle System und seine Wirkungen auf die Gesellschaft. Sie beharrten auf dem althergebrachten und prestigebehangenen Bildungsideal und demon- strierten dies „durch Abschottung, durch eine Verweigerung neuer Bil- dungsinhalte an den Oberschulen und Hochschulen, durch zähes Festhalten an der klassischen, humanistischen Bildung, auf der ihr Prestige auf- baute“78. Das Dilemma des Bildungsbürgertums bestand darin, dass die Verflechtung zwischen Bildungssektoren und Wirtschaft schon zu weit fortgeschritten war, als dass man dieser Entwicklung etwas Andersarti- ges hätte entgegensetzen können; daher rührt einerseits das teilweise Anstreben von Karrieren, da nur so eine gewisse (wenn nun auch stark spezialisierte) Bildung zur Geltung zu bringen war, andererseits der oft als Verstocktheit erscheinende Habitus des Bildungsbürgertums. Einst stellte Bildung die Ersatzreligion in einer sich säkularisieren- den Gesellschaft dar, war sie umfassende und verbindliche Lebensorien- tierung, in deren Mittelpunkt die jeglichen pragmatische Zwecken eine Absage erteilende allgemeine Bildung der Persönlichkeit stand. Ihr An- spruch war es, „Gott einerseits an die wissenschaftlich ermittelte Na- turgesetzmäßigkeit, andererseits an die Postulate der neuen antiaske- tisch-säkularen Moral zu binden.“79 Es begannen sich jetzt mehrere an- dere Säkularreligionen zu bilden, die sich oft als der Bildungsreligion überlegen erwiesen. Einige seien hier aufgezählt: Nationalismus, Sozi- aldarwinismus, Antisemitismus, Naturwissenschaftsgläubigkeit, Lebensre- form- und Jugendbewegung, Imperialismus; alle sind sie Ausdruck eines allgemeinen Krisenbewusstseins, spezieller einer „Kulturkrise“. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Der Sozialdarwinismus (eher ein Merkmal des Wirtschaftsbürgertums) sollte, wie schon gesagt, die Ungleichheit zwischen reicher Bourgeoisie und armen Unterschichten rechtfertigen; der Antisemitismus brandmarkte das „jüdische Großkapi- tal“; der Nationalismus stellte eine Kompensation für die gescheiterte 48er-Revolution und die konservative Reichsgründung dar. (Natur-)wis- senschaftlicher Fanatismus war der Griff nach dem sicheren Strohhalm, denn man war der „Überzeugung, Harmonie der Welt und Gesetzmäßigkeit des Weltgeschehens heiße eo ipso Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit der Natur, was wiederum ein Gefühl von Sicherheit und Selbstvertrauen gerade im schwierigen Augenblick gab“80. Die hierzu gegenläufige Ten- denz der Lebensreform- und Jungendbewegung prangerte nackte materiali- stische Gesinnung und Spießertum an organisierte sich in Bünden, einer vorindustriellen Assoziationsform, statt in Vereinen. Sie kritisierte typisch bürgerliche Werte wie Liberalismus, Aufklärung und neuhumani- stischer Bildung, und forderte in ihrer verklärten Rückbesinnung auf nationale Kulturwerte eine neue Innerlichkeit.
Angesichts dieser (im Bürgertum selbst sich herausbildenden!) antimo- dernistischen Subkultur ist die Aussage, das Bürgertum sei Vorreiter und Träger der Modernisierung gewesen, in Zweifel zu ziehen. Mit dem Aufkommen antikapitalistischer und antidemokratischer Stoßrichtungen spaltete sich das Bildungsbürgertum immer mehr auf; gleichzeitig wurde es mit dem Erstarken des Wirtschaftsbürgertums konfrontiert. Die Zeit des Kaiserreichs dürfte ein Kampf um alte Werte gewesen sein, ohne dass das Hinwenden von Personen aus der eigenen Reihe zu neuen Säkularreli- gionen verhindert werden konnte. Ob jedoch an der alten Bildungsidee festgehalten wurde oder nicht, charakteristisch für das gesamte Bil- dungsbürgertum (auch für die, die auf der Karriereleiter emporkletterten, denn es blieb ihnen, um gewisse Werte aufrechtzuerhalten, oft nichts anderes übrig) war die Modernisierungsfeindschaft.
3.2.3. Alter und neuer Mittelstand
Der alte Mittelstand, auch Kleinbürgertum genannt, das waren die zahl- reichen Handwerker, Kleinhändler, Gastwirte und Spediteure, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Stadtbürgertum hervorgegangen waren. Zwar verfügten sie wie das restliche Bürgertum über Produktionsmittel, konnte jedoch kein so hohes Besitzniveau vorweisen, hatten kleinere Be- triebe, die zudem vorwiegend nicht maschinell, sondern handwerklich ar- beiteten. Bezüglich der Arbeitszeit, des Einkommens und der Labilität der Lebenslage näherten sie sich den Standards eines ungelernten Arbei- ters an; zahlreiche Kleinbürger lebten so unter quasi-proletarischen Verhältnissen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nun nahm die Binnendifferenzierung innerhalb dieser sozialen Gruppe zu. Einerseits setzte eine Entwicklung hin zu Großbetrieben ein, andrerseits vergrößerte sich die Zahl derer, die in proletarischen Verhältnissen lebten, während gleichzeitig eine Verschlechterung der ohnehin unter derartigen Umständen lebenden Kleinbürger eintrat.
Politisch rechneten sie sich zum Lager der Arbeitgeber und wurden somit interessant für die bürgerlichen Parteien, die in ihnen ein wirksames Instrument gegen die Sozialdemokratie sahen. Tatsächlich versuchte das Kleinbürgertum sich nach unten hin abzugrenzen und in einen höheren so- zialen Rang aufzusteigen. Es agierte im Rahmen einer bürgerlichen, spe- zieller einer kleinbürgerlichen Sozialmentalität und wies daneben Züge auf, die auch denen anderer bürgerlicher Gruppen widersprachen; „das
Lob der Arbeit stand gegen die Faulheit, die Sparsamkeit stach von der Verschwendungssucht ab, [...] das Eigentum leuchtete gegenüber der Be- sitzlosigkeit.“81 Obwohl also ihre soziale Lage denjenigen ähnelte, die für sozialdemokratische sozialistische Parteien optierten, nahmen sie sich selbst nicht als Angehörige dieser Gruppen wahr. Mitunter schwenk- ten zwar Kleinbürger zur SPD-Wählerschaft über, doch im Allgemeinen war es so, „dass die soziale Frage, die das bürgerliche Bewusstsein be- schäftigte und erschütterte, in den Veröffentlichungen des Kleinbürger- tums wenig Resonanz fand.“82 Umgekehrt stellte der Aufstieg in das Kleinbürgertum ein erstrebenswertes Ziel für die sozial Höherrangigen der unteren Schichten dar; die unterschiedliche soziale Lage implizier- te also nicht unbedingt unterschiedliche politische und soziale Inter- essen.
Obwohl das Kleinbürgertum zum Bürgertum gezählt wird, hatten die ande- ren bürgerlichen Gruppen doch Vorbehalte ihm gegenüber. Persönlicher Kontakt wurde nicht oder kaum gepflegt; oft kannten Wirtschafts- und Bildungsbürgertum diese Gruppe lediglich aus der Literatur. Als Träger eines relativ hohen sozialen, ökonomische und kulturellen Kapitals ver- achteten sie die Borniertheit und Begrenztheit der „kleinen Bürger“, was diese wiederum nicht daran hindern sollte, eine höhere Bildung ihr- er Kinder anzustreben, um ihnen somit die Chance des Aufstiegs in der sozialen Hierarchie zu ermöglichen. Die Erfolge waren aufgrund der Ab- schottungstendenzen seitens Bourgeoisie und Bildungsbürgertum beschei- den, der Aufstieg ins Bürgertum also nicht nur durch Bildung und Lei- stung bedingt und dementsprechend steinig. Die Gier nach einem höheren bürgerlichen Rang zog eine gewisse Fluktuation innerhalb dieser Gruppe nach sich, so dass sich genuin bürgerliche Werte und Normen hier kaum zu Konstanten entwickeln konnten. Insgesamt gesehen gab es zwischen Kleinbürgertum und dem restlichen Bürgertum mehr Unterschiede und Trenn linien als Gemeinsamkeiten und Verbindungslinien.
Während der 70er und prägnant während der 80er Jahre bildete sich eine neue Sozialfigur heraus; die des Angestellten. Die Angestellten rekru- tierten sich vornehmlich aus den Unterschichten und aus dem Kleinbür- gertum und gehörten zur Arbeitnehmerschaft. Was früher die Aufgaben von Unternehmern und gehobenen Bürokraten waren, fiel nun in ihren Arbeits- bereich; sie übernahmen arbeitsvorbereitende, kontrollierende, koordi- nierende, kaufmännische und verwaltungsmäßige Funktionen. Von den ge- lernten Arbeitern, die ebenso zur Arbeitnehmerschaft gehörten, unter- schied sie die größere Sicherheit am Arbeitsplatz, eine kürzere Ar- beitszeit, und der höhere Lohn. Indem ihnen häufig Anordnungsbefugnisse übertragen wurden, partizipierten sie am Herrschafts- und Informationssystem der Betriebsleitung.
Politisch verhielt sich die Gruppe der Angestellten uneindeutig; als Arbeitnehmer wiesen sie Streikbereitschaft auf und waren von daher teilweise der SPD gegenüber nicht abgeneigt, aber genauso gehörten sie zur Wählerschaft liberaler und konservativer Parteien. Ein Grund dafür könnte ihre recht unterschiedliche Herkunft gewesen sein. Wer bei- spielsweise aus den unteren Schichten stammte, dürfte „von Haus aus“ gewisse Tendenzen zur Sozialdemokratie gehabt haben, Angestellte mit einem kleinbürgerlichem Herkunftsmilieu werden eher spezifisch bürger- liche Parteien bevorzugt haben.
In der Selbsteinschätzung rechneten sie sich zum Kleinbürgertum, zeich- neten sich aber durch eine ambivalente ideologische Grundhaltung aus. Denn einerseits, zurückführbar auf ihre Herkunft, waren sie mental in vorindustriellen Traditionen verwurzelt, hatten meist eine Aversion ge- gen radikale sozialistische Bewegungen und die proletarische Lebens- welt, folgten in ihrem Lebensstil dem bürgerlichen Modell und hielten sich in eigenen Verkehrs- und Heiratskreisen auf. Andererseits war die Bürowelt der Angestellten der ökonomische Bereich, in den nun vor allem Frauen einzudringen begannen und damit einen Schritt in Richtung der Emanzipation machten. Auch das Konsumverhalten war nicht spezifisch bürgerlich; mit dem spontanen Erwerb modischer Gebrauchsgüter und dem Ausnutzen von Freizeit verzichtete man auf das alte Wertemuster der aufgeschobenen Befriedigung und gerechtfertigten Belohnung. Zudem waren sie zukunftsorientiert und innovationsbereit, bejahten den technisch- industriellen Fortschritt und suchten aufgrund ihrer Traditionslosig- keit nach einer modernen Kollektividentität.
Die Gruppe der Angestellten ist also nicht selbst Initiator, dafür aber Befürworter und Förderer der ökonomischen Modernisierung gewesen. Auf der Ebene des sozialen Verhaltens ist eine vormoderne Verwurzelung feststellbar, d.h. dass kein Zugang zu egalitären Gedanken gefunden wurde. Der Lebensstil hingegen setzte sich durch Ausschaltung des bloß belohnenden Konsums vom Bürgertum ab. Trotz ihres anfänglich kleinen Umfangs und späten Entstehens waren die Angestellten insofern Träger der Modernisierung, als sie mit der Funktionsdifferenzierung die Expan- sion der kleinbürgerlichen Berufsklassen vorantrieben. Die Frage nach der Form des gesamten „Überbaus“ zieht ihre Antwort nicht aus der Ent- scheidung, die Zugehörigkeit zu einer Besitz- oder zu einer Leistungs- klasse als bestimmenden Faktor anzuerkennen; man gehört immer zugleich beiden Klassen an, nur ihre jeweilige Gewichtung ist unterschiedlich. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde besonders hinsichtlich der Ange- stellten und Bildungsbürger die Zugehörigkeit zu einer Leistungsklasse mehr und mehr zum Kriterium sozialen, kulturellen und politischen Ver- haltens, daneben existierten aber auch noch vorindustrielle ständische Muster, die weder von Besitz- noch Leistungsklassen nahtlos abgelöst wurden. Ergebnis der Bildung von Leistungsklassen ist, „dass die Basis, auf der Personen gleiche marktbedingte Chancen und Interessen teilten, sich als zusammengehörig verstanden und gemeinsam handelten, speziali- sierter und spezifischer, die resultierende Gesamtstruktur im Endeffekt fragmentarisierter wurde.“83 Diese Klassen waren jedoch von „zutiefst [...] ständischen Rudimenten geprägt. Diese förderten die Entstehung umfassender, eben berufs ständischer statt berufs spezifischer Einheiten mit entsprechend traditionell eingefärbten Ansprüchen und wirkten damit der sozialen Spezifizierung entgegen.“84
4. Wie modern war das Bürgertum des 19. Jahrhunderts?
Das im 19. Jahrhundert sich herausbildende Bürgertum fällt zuweilen in zweifacher Hinsicht einer falschen Betrachtungsweise anheim. Erstens wird der monolithische Charakter des Bürgertums, unter dem Zugeständnis einiger weniger, aber eher unbedeutender Unterschiede zwischen den je- weiligen Gruppen, postuliert. Der eine verdiente zwar mehr, der andere weniger, aber im großen und ganzen war man brüderlich befreundet und sich einig darüber, dass verschwenderischer Adel und dumpfer Pöbel an- gesichts des bevorstehenden Generalfrühjahrsputzes in Deutschland wohl ihre Koffer packen müssen, es sein denn, sie würden ordentlich mit zu- fassen. Und hier kommt der zweite Griff in die verstaubte Kiste der Allgemeinplätze; sowohl große als auch kleine Bürger waren hocherfreut, als sie erfuhren, dass nun so manche Hände erfordernde Arbeit mit Ma- schinen betrieben werden könne, und als man begriff, dass man das wun- derbar mit Kapitalismus mischen kann und sich damit seine privaten Goldesel züchtet, fasste man sich an die Stirn und fragte sich, warum man darauf eigentlich nicht schon früher gekommen war. So war es eben nicht. Weder war das Bürgertum eine Einheit, noch war es eo ipso Träger der industriellen und politischen Modernisierung. Ini- tiator des wirtschaftlichen Fortschrittes war tatsächlich, zumindest zu Beginn des 19. Jahrhunderts, einzig das Wirtschaftsbürgertum. Das Tempo des Prozesses der Entstehung spezifisch wirtschaftskapitalistischer In- teressen und Marktstrukturen sollte dabei nicht überschätzt werden, und im Zusammenhang damit auch nicht die Rolle der Mentalitäten; denn eine Überschätzung würde heißen, der Geschichte einen teleologischen Cha- rakter zu unterstellen, was aber nicht bestätigt werden kann. Es würde auch bedeuten, den Menschen als ein nach bloß nach ökonomischen Vortei- len strebendes Wesen anzusehen. Die Ableitung jeglichen Verhaltens aus ökonomischen Interessen hätte es dann zum Beispiel der Bourgeoisie ver- bieten müssen, Kontakte mit dem Adel zu pflegen. Eine Betrachtung der Verkehrs- und Heiratskreise belehrt uns eines Besseren; mit der fort- schreitenden ökonomischen Modernisierung nahm die am Anfang durchaus vorhandene Abgrenzung zum Adel hin sogar ab. Ziel war (ebenfalls erst später) die Repräsentation des Stolzes auf die eigens erbrachten Lei- stungen. Der Adel hatte stets einen zeigefreudigen Habitus vorgelebt und übernahm somit Vorbildfunktion für das Unternehmertum. Der Schritt Richtung Moderne durch Ablegen ständischer Muster wurde vom Wirt- schaftsbürgertum nicht vollzogen; „gerade in Deutschland blieben be- kanntlich das Prestige-Status-System und das kulturelle Leben bis ins Dritte Reich hinein durch vorkapitalistisch-ständische Elemente zu- tiefst geprägt.“85 Auch neigte man immer noch der Staatsautorität zu, was dem modernen Ideal der Selbstbestimmung zuwiderläuft; Ausdruck da- für ist die bedeutende Rolle konservativer, bürgerlicher Parteien. Das Bildungsbürgertum steht im Grunde für die „ideologische“ Moderni- sierung, indem sie die Theologie durch die säkularisierte Form der Bildungsreligion ersetzt. Doch der Besitz wichtigen kulturellen Kapi- tals führte bei ihr nicht, wie auf dem Papier deklariert, zur Förderung einer nach humanistischen und demokratischen Prinzipien aufgebauten Ge- sellschaft, sondern zur elitären Selbstabgrenzung. Über Jahrzehnte hin- weg hielt man am alten Bildungsideal fest und sträubte man sich gegen den Erwerb eingegrenzter Bildung zum Zwecke der beruflichen Ausbildung. Staatsgläubigkeit war auch hier vielfach anzutreffen, trotz des aufklä- rerischen Rufs nach Eigenverantwortung.
Das alte Stadtbürgertum, besonders die Schicht der Honoratioren, hatte viel von seinem Prestige zu verlieren, da genau das, was ihren hohen gesellschaftlichen Rang sicherte, ihnen streitig gemacht werden sollte, im Besonderen die Rechte in der Stadtverwaltung. Von dieser Gruppe, die in traditioneller Ständementalität erstarrt war, war kaum ein Schritt hin zu wirtschaftlicher oder politischer Modernisierung zu erwarten. Ähnlich verhielt es sich mit dem Kleinbürgertum, aus welchem einzelne Personen den Aufstieg ins Wirtschaftsbürgertum schafften, das aber ins- gesamt durch den unübersichtlichen und Risikofreudigkeit voraussetzen- den Industriekapitalismus seine Existenz bedroht sah. Die Abneigung ge- gen „jüdischen Großkapitalismus“ bildete einen fruchtbaren Boden für antisemitische Tendenzen. Schutz suchte man in den Armen des Staates, dementsprechend unliberal war die Mentalität und politische Präferenz dieser Gruppe.
Die Angestellten stellen sich hinsichtlich des Modernisierungsaspektes als mehr oder weniger ambivalent heraus. Zwangloser im Konsumverhalten, die Arbeitswelt den Frauen öffnend, wichtige Funktionen wahrnehmend und den Prozess der Arbeitsteilung fördernd, neigten sie dennoch zu ständischer Selbstabgrenzung.
Auch wenn das allgemeine Urteil, das Bürgertum sei schlechthin Träger der Modernisierung gewesen, revidiert werden muss, sei darauf hingewiesen, dass wir trotzdem zu Recht vom 19. Jahrhundert als einer Zeit des Fortschritts reden. Man sollte sich jedoch einer differenzierten Analyse bedienen, um etwaigen Pauschalurteilen Einhalt zu gebieten und sich daneben in wissenschaftlichen Methoden zu üben.
Bei der Betrachtung historischer Phänomene ist also davon abzuraten, entweder bloß die großen objektiven Strukturen oder bloß die handelnden Personen mitsamt aktueller politischer Gegebenheiten zur Erklärung her- anzuziehen, denn die Menschen sind weder in ihren sozialen Lagen ge- fangen noch in ihren Entscheidungen frei von sozialer Herkunft. Sie werden geprägt sowohl durch ihre materiellen Ressourcen, ihren Rang in der sozialen Hierarchie und den Besitz kultureller Güter als auch durch die Wahrnehmung anderer gesellschaftlicher Gruppen, die wiederum einen wesentlichen Faktor der eigenen Lebensgestaltung darstellt und nicht gewissen Interessen, die wir den jeweiligen Gruppen unterstellen wür- den, entsprechen muss. Eine Analyse milieuspezifischer Aspekte bringt in der Vermittlung zwischen sozialer Strukturen und gesellschaftlichen Verhaltens meines Erachtens nach Licht ins Dunkel so mancher Probleme.
[...]
1 Der Abstand zwischen dem Nutzen (d.h. den Vor- und Nachteilen) eines Ansatzes und seiner erklärten Zugehörigkeit zu einem bestimmten Fachbereich kann im Grunde nicht groß sein. Wir können nicht sagen, ein Erklärungsmuster hätte überwiegend Vorteile, gehöre aber nicht zum Fach, oder umgekehrt, ein Muster hätte fast nur Nachteile, müsse jedoch dem Fach zugerechnet werden. Wenn ein Muster dem Fach nützt, dann ist dieses Fach bereits so definiert, dass genau die Erklärungen, nach denen per defi- nitionem gesucht wird, mit Hilfe des Musters gefunden werden. Streitereien um den Nutzen bestimmter Theorien erübrigen sich also oft, da natürlich unterschiedliche Geschichtsauffassungen unterschiedliche Erklärungsmuster verlangen.
2 Langewiesche, D. Sozialgeschichte und Politikgeschichte. In: Schieder W., Sellin, V. (Hg.) Sozialgeschichte in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im internationalen Zusammenhang. Göttingen 1986, S. 12
3 Wobei sich natürlich dann die Frage stellt, zu welchem Zweck er gesellschaftlichen Faktoren einen Platz in seinen Schriften überhaupt einräumt. Möchte er an ihnen die Folgen der eigentlichen Geschichte, nämlich der Politikgeschichte, deutlich machen?
4 Wehler, H.-U. Sozialgeschichte und Gesellschaftsgeschichte. In: Schieder, Sellin 1986, S. 36
5 (Diese wurden oben kurz genannt. Allerdings wird der Begriff „Strukturgeschichte“ nicht einheitlich gebraucht; Conze beispielsweise verwendet als Synonym den Begriff der Sozialgeschichte, was den Gegenstand der Strukturgeschichte erheblich ein- grenzt. Er soll aber hier im erstgenannten Sinne gemeint sein.)
6 Burke, P. Soziologie und Geschichte. Hamburg 1989, S. 154
7 Meier, C. Notizen zum Verhältnis von Makro- und Mikrogeschichte. Was ist Makro-, was Mikrogeschichte? In: Acham, K., Schulze, W. (Hg.) Teil und Ganzes. Zum Verhältnis von Einzel- und Gesamtanalyse in Geschichts- und Sozialwissenschaften (Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik. Band 6). München 1990, S. 112
8 Ebd., S. 112
9 Ebd., S. 116
10 Burke 1989, S. 157
11 Kocka, J. Sozialgeschichte zwischen Strukturgeschichte und Erfahrungsgeschichte. In: Schieder, Sellin 1986, S. 73
12 Langewiesche. In: Schieder, Sellin 1986, S. 21 3
13 Kocka. In: Schieder, Sellin 1986, S. 79
14 Ebd., S. 79
15 Hradil, S. Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Von Klassen und Schichten zu Lagen und Milieus. Leverkusen 1987, S. 60
16 Hartfiel, G. Soziale Schichtung. 2. Auflage, München 1981, S. 53
17 Hrdail 1987, S. 74
18 Vester, M., von Oertzen, P., u.a. Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Köln 1993, S. 127
19 Ebd., S. 128
20 (Die Begrifflichkeit wurde Hradil 1987 entnommen.)
21 Hradil 1987, S. 165
22 Reichardt, S. Bourdieu für Historiker? Ein kultursoziologisches Angebot an die Sozialgeschichte. In: Mergel, T., Welskopp, T. (Hg.) Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur Theoriedebatte. München 1997, S. 72
23 Tenbruck, F. H. Repräsentative Kultur. In: Haferkamp, H. (Hg.) Sozialstruktur und Kultur. Frankfurt/Main 1990, S. 37
24 Reichhardt. In: Mergel, Welskopp 1997, S. 74
25 Hradil 1987, S. 166
26 Zerger, F. Klassen, Milieus und Individualisierung. Eine empirische Untersuchung zum Umbruch der Sozialstruktur. Frankfurt/Main 2000, S. 79
27 Michailow, M. Individualisierung und Lebensstilbildungen. In: Schwenk, O. (Hg.) Lebensstil zwischen Sozialstrukturanalyse und Kulturwissenschaft. Opladen 1996, S. 72f.
28 Reichardt. In: Mergel, Welskopp 1997, S. 73 6
29 Bourdieu, P. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 4. Auflage, Frankfurt/Main 1987, S. 277
30 Reichardt. In: Mergel, Welskopp 1997, S. 73
31 Fröhlich, G. Kapital, Habitus, Feld, Symbol. Grundbegriffe der Kulturtheorie bei Pierre Bourdieu. In: Mörth, I., Fröhlich, G. (Hg.) Das symbolische Kapital der Le- bensstile. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Pierre Bourdieu. Frankfurt/Main 1994, S. 38
32 Ebd., S. 43
33 Ebd., S. 48
34 Zerger 2000, S. 76
35 Hradil 1987, S. 167
36 Zerger 2000, S. 82
37 Das Ab- und Hinzutreten bestimmter Gruppen macht den auf den ersten Blick unüberwindbaren Bruch zwischen diachroner und synchroner Ebene deutlich. Es wird sich zeigen, ob die Habitustheorie Abhilfe zu schaffen vermag.
38 Kocka, J. Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Europäische Entwicklungen und deutsche Eigenarten. In: Kocka, J. (Hg.) Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich. Band 1. München 1988, S. 14
39 Ebd., S. 14
40 Ebd., S. 27
41 Linke, A. Sprachkultur und Bürgertum. Zur Mentalitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Stuttgart 1996, S. 22
42 Ebd., S. 20
43 Ebd., S. 23
44 Haupt, H.-G. Kleine und große Bürger in Deutschland und Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts. In: Kocka 1988 (Band 2), S. 268
45 Ebd., S. 269
46 Benutzt man den weiten Sinn, fällt das Kleinbürgertum heraus, da es nicht über die Mittel verfügte, ein „bürgerliches“ Leben zu führen.
47 Mergel, T. Geht es weiterhin voran? Die Modernisierungstheorie auf dem Weg zu einer Theorie der Moderne. In: Mergel, Welskopp 1997, S. 204
48 Ebd., S. 205
49 Ebd., S. 209
50 Wehler, H.-U. Modernisierungstheorie und Geschichte. Göttingen 1975, S. 16
51 Beispielsweise wurde im 19. Jahrhundert im Namen der Nationenbildung, und diese war ein signifikanter Aspekt der Modernisierung, auf eine der Domänen der Tradition zurückgegriffen; auf die in Mittelalter und Antike wurzelnden Mythen.
52 Wehler, H-U. Von der Reformära bis zur industriellen und politischen „Deutschen Doppelrevolution“. 1815-1848/49. (Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Band 2). München 1987, S. 175
53 Ebd., S. 177
54 Kocka, J. Stand - Klasse - Organisation. Strukturen sozialer Ungleichheit vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert im Aufriss. In: Wehler, H.-U. (Hg.) Klassen in der europäischen Sozialgeschichte. Göttingen 1979, S. 142
55 Kocka. In: Kocka 1988, S. 71
56 Kaschuba, W. Deutsche Bürgerlichkeit nach 1800. Kultur als symbolische Praxis. In: Kocka 1988 (Band 3), S. 39
57 Ebd., S. 39
58 Linke 1996, S. 77
59 Kaschuba. In: Kocka 1988 (Band 3), S. 38 15
60 Kondylis, P. Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne. Weinheim 1991, S. 38
61 Kaschuba. In: Kocka 1988 (Band 3), S. 33
62 Ebd., S. 27
63 Ebd., S. 28
64 Kocka. In: Kocka 1988 (Band 1), S. 59
65 Kocka. Ungleichheit. In: Wehler 1979, S. 151
66 Kocka. In: Kocka 1988 (Band 1), S. 59
67 Kaschuba. In: Kocka (Band3), S. 25
68 Ebd., S. 49
69 Kocka. In: Kocka 1988 (Band 1), S. 72
70 Ebd., S. 72
71 Kaelble, H. Französisches und deutsches Bürgertum 1870-1914. In: Kocka, J. (Hg.) Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich (Band 1). München 1988, S. 134
72 Ebd., S. 120
73 Der Begriff „Feudalisierung“ sollte nicht auf die Imitation adligen Lebensstils seitens des Bürgertums angewendet werden, da er auf die soziale Schichtung einer Gesellschaft referiert, „Aristokratisierung“ dagegen sich auf den Lebensstil bezieht; soziale Schichtung und Lebensstil verhalten sich jedoch nicht kongruent zueinander.
74 Ebd., S. 118
75 Kocka. In: Kocka 1988 (Band 1), S. 53
76 Kondylis 1991, S. 52
77 Kocka. In: Kocka 1988 (Band 1), S. 73
78 Kaelble. In: Kocka 1988 (Band 1), S. 123
79 Kondylis 1991, S. 26 Nicht enthaltsam zu leben wurde allerdings erst mit der sich abschwächenden Abgrenzung zum Adel hin Verhaltensnorm und bedeutete auch dann nicht werteverachtende und bohemienhafte Ausschweifung. Antiasketisches Leben hieß, in den Genuss der wohlverdienten Belohnung zu kommen.
80 Ebd., S. 27
81 Haupt, H.-G. Kleine und große Bürger in Deutschland und Frankreich am Ende des 19. Jahrhunderts. In: Kocka 1988 (Band 2), S. 269
82 Ebd., S. 269
83 Kocka. In: Wehler 1979, S. 153
84 Ebd., S. 155
85 Ebd., S. 148
- Arbeit zitieren
- Grit Wagner (Autor:in), 2001, Bürgerliche Milieus im 19. Jahrhundert. Eine Nachzeichnung der Phasen 1815-1848/49 und 1871-1914., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106720
Kostenlos Autor werden
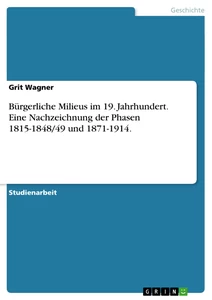



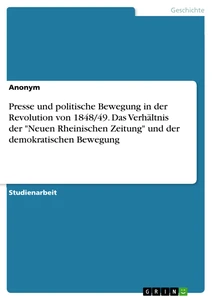



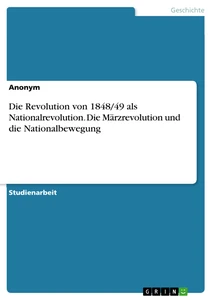

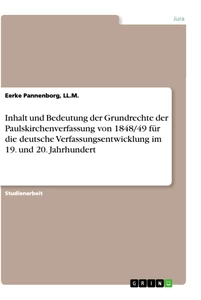









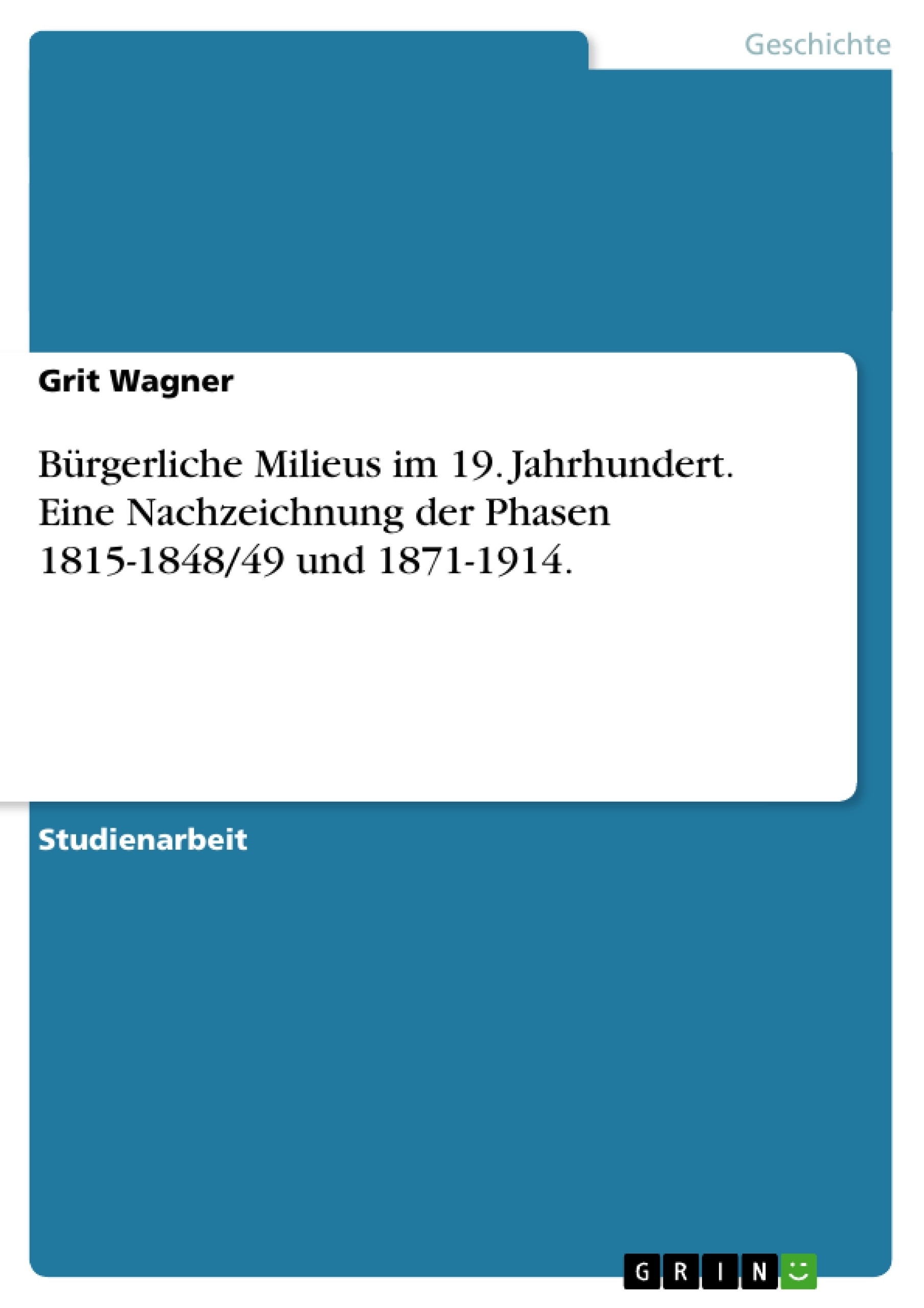

Kommentare