Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Das osmanische Reich als Gegenstand des Interesses
1.1. Osmanistik als Wissenschaft
1.2. Die Verschränkung von Ereignis und Struktur
2. Faktoren des Niedergangs
2.1. Das Timarsystem
2.1.1. Die Sipahi als Timarioten
2.1.2. Der Zerfall des Timarsystems
2.2. Die Janitscharen
2.2.1. Kampfkraft und Loyalität
2.2.2. Die Elitetruppe im Zerfall
2.3. Die Staatsbeamten der Zentral- und Provinzverwaltung
2.3.1. Der Status einiger wichtiger Staatsbeamter
2.3.2. Korruption im Staatsapparat
2.4. Die Institution des Großwesirats
3. Die Adäquatheit der Erklärung
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Das osmanische Reich als Gegenstand des Interesses
1.1. Osmanistik als Wissenschaft
Wem auch immer es geschuldet sein mag, sicher ist, daß manche Wortver- bindungen mitunter Stirnrunzeln verursachen, während andere ohne Bean- standung sich auf dem Felde unseres Wohlgefühls tummeln dürfen. So zwei- felt beispielsweise niemand an der Konkordia von Europa und dem Lehenswe- sen, und ebensowenig würde jemand, das Haremstreiben des Osmanischen Rei- ches deklamierend, ob der vermeintlichen `Sphärenfremdheit` von `Harem` und `Osmanisches Reich` der Rednertribüne verwiesen werden. Wahrschein- lich erwarten aber denjenigen, der Hörer oder Leser mit Ergebnissen sei- ner Befleißigungen zum Thema `Das Lehenswesen des Osmanischen Reiches` zu erfreuen beabsichtigt, skeptisch-verhaltene, im schlimmsten Fall mitlei- dige Blicke. Dazu muß bemerkt werden, daß es sich bei unserem imaginären Publikum um ein Laien publikum handelt; und es liegt eindeutig am betref- fenden Thema, nämlich dem osmanischen Reich, daß erstens die Zahl der versierten Kenner sich auf eine überschaubare Personenmenge reduziert und zweitens die unter der restlichen Bevölkerung verbreiteten Vorstellungen entweder zwar historisch angemessen aber zu mager, oder ausufernd, dafür jedoch durchtränkt von farbenprächtigem Märchenäther sind. Osmanistik heißt die Wissenschaft, „deren Gegenstand durch die Aus- breitung des osmanischen Staates in Zeit und Raum bestimmt ist.“1 Der Be- griff `osmanisch` leitet sich vom Namen Osman ab; er war der Fürst eines islamisch-türkischen Stammes und begründete mit mehreren Eroberungen, be- sonders zwischen 1298 und 1301, die Dynastie der Osmanen. In der Sultans- würde folgten ihm bis 1922 insgesamt 35 weitere Herrscher; die Nachfolger rekrutierten sich bis zum Jahre 1617 aus den jeweiligen Söhnen, welche einerseits durch das `Brudermordgesetz` Mehmed II. in ihrem Tatendrang gestärkt, andererseits durch das sogenannte `Prinzengefängnis` (kafes) in demselben beschnitten wurden. Beide Vorrichtungen dienten dazu, möglichst wenige und nur die anscheinend besten Männer als Thronkandidaten zuzulas- sen; seit 1617 zählten zu diesem Kreis auch Brüder, Neffen und Vettern des Sultans.
Sein akademisches Glück mit der Osmanistik zu versuchen bedeutet noch heute auf langen Strecken ein Dasein als wackerer Einzelkämpfer. Bis hin- ein die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Fach „ein Randgebiet, in das sich nur selten ein Fachkollege verirrte“2. (Anders in der Türkei; dort beschäftigte man sich mit der osmanischen Geschichte, Literatur und Sprache, seit es eine modernen Bildungsbetrieb gab.) Auch vorher finden sich allenfalls sporadische, dafür aber umso tiefere Spuren auf dem Ent- wicklungsweg der Osmanistik, „dereinst von Josef v. Hammer auf deutschen Boden gepflanzt“3. Dessen monumentale Gesamtdarstellung aus dem 19. Jahr- hundert hat Zinkeisens (19. Jahrhundert) und Jorgas (20. Jahrhundert)
Überblickswerke als Schwestern neben sich. An derartige `Steinbrüche` an- knüpfend, konnten sich Forscher nun an speziellere Themen heranwagen, mußten dabei aber immer noch die Herausforderung der türkischen Sprache überwinden. Mit der Epoche der Annales-Schule fand eine methodologische Umorientierung hin zu Interdisziplinarität und Strukturgeschichte statt, im Zuge derer das osmanische Reich „als ein integraler Teil der mediter- ranen Welt und nicht als ein Fremdkörper in der europäischen Geschichte“4 bewertet wurde bzw. werden sollte. Die Öffnung der Archive in Istanbul schließlich brachte erneut theoretische Probleme hervor; es ging nicht nur um die Klassifikation spezifisch osmanischer Quellen, sondern auch um die Disposition quantitativer Untersuchungen und Fragen der historischen Demographie, sozialen Mobilität, des Nomadismus und der Seßhaftwerdung und die Bedeutung der Provinzregister, der defter, mit denen sich fortan ein eigener Wissenschaftszweig, die Defterologie, befaßte. Ein Blick auf Literaturlisten zum osmanischen Reich offenbart die Do- minanz türkischer Autoren, zu etwa gleichen Anteilen unterlegen sind da- gegen deutsche, englische und französische Veröffentlichungen, wozu kommt, daß diese in manchen Fällen `nur` Übersetzungen anderssprachiger, oft eben auch türkischer Literatur, darstellen. Insgesamt hat sich das Spektrum der Themen innerhalb der letzten fünfzig Jahre vervielfältigt und vertieft, doch ist die Osmanistik als Wissenschaft weiterhin zumin- dest in der außerakademischen Öffentlichkeit wenig präsent; innerhalb des universitären Betriebes konnten sich zwar Lehrstühle für Osmanistik eta- blieren, diese sind aber dünn gesät, ebenso wie spezielle Veranstaltungen seitens der Nicht-Osmanisten (was natürlich angesichts ihres eigentlichen Lehrbereiches verständlich ist).
1.2. Die Verschränkung von Ereignis und Struktur
Als sich die türkischen Truppen 1683 zum zweiten Marsch auf Wien sammel- ten, war es da voraussehbar, daß sie den Kampf gegen die katholische Großmacht und ihre Verbündeten nicht gewinnen würden? Nun, jedenfalls hätte man zu diesem Zeitpunkt Prognosen über die Erfolgsaussichten ver- fertigen können, was aber weder Selbstüberschätzung der eigenen Kampf- kraft noch unerwartete Ereignisse ausgeschlossen hätte. Knapp 320 Jahre später bemüht man sich um Erklärungsversuche, bei denen Selbstüberschät- zung und Überraschungen durchaus die Rolle von Gründe-, Motiv- und Ursa- chenanwärtern zugewiesen bekommen können. Mit den Begriffen `Grund` und `Ursache` haben wir auch schon eine zentrale Unterscheidung angesprochen, nämlich die zwischen Ereignisgeschichte und Strukturgeschichte. Erstere rekrutiert ihre Erklärungskandidaten aus den Motiven der am Geschehen be- teiligten Personen und den konkret benennbaren Vorfällen, letztere be- dient sich eines bestimmten Paradigmas, zum Beispiel des ökonomischen oder geographischen, und ordnet das zur Debatte stehende Geschehen als Quasi-Instantiierung des abstrakten Musters unter selbiges ein. Daß in genuin ereignisgeschichtlichen Quellen sich strukturgeschicht- liche Fingerabdrücke nachweisen lassen, soll an einem Schriftstück ge- zeigt werden, welches in der Zeit der zweiten Belagerung Wiens durch die osmanische Armee entstanden ist; der Titel lautet `Kara Mustafa vor Wien. Das türkische Tagebuch der Belagerung Wiens 1683, verfaßt vom Zeremonien- meister der Hohen Pforte`. Der ursprüngliche Text gilt als verschollen, doch gibt es zwei Abschriften, die im Text identisch sind. Verfaßt wurde dieses, wie der Titel schon sagt, Tagebuch vom uns namentlich nicht be- kannten Zeremonienmeister des Sultans; der Zeremonienmeister hatte all- gemein die Aufgabe, Protokolle zu schreiben. Es liegt hier allerdings nicht das Tagebuch in seinem Gesamtumfang, sondern nur etwa ein Drittel vor; behandelt werden die Ereignisse ab dem Rückzug der kaiserlichen Truppen nach Wien bis zur Hinrichtung des Großwesirs Kara Mustafa. Formal gesehen hat das Tagebuch einen ausgeprägten dokumentarischen Charakter, es schreitet mehr oder weniger gleichmäßig Tag für Tag fort und hinter- läßt dabei lediglich nach dem 13. August und dem 4. September jeweils ei- ne mehrtägige Lücke. Akribisch zählt der Verfasser Zahl der verliehenen Gewänder und abgeschlagenen Köpfe auf, ebensowenig wie er vergißt, die Gefangennahme von Feinden, den Empfang fremder Gesandter, die täglichen Gebete und militärische Maßnahmen zu erwähnen.
Was auf den folgenden Seiten nicht zu finden sein wird, ist eine Ana- lyse und Interpretation des genannten Tagebuches; insofern bildet es also nicht den Mittelpunkt meiner Arbeit. Vielmehr soll die Kristallisation und Sammlung von Strukturen in einem umfassenden Geschehen deutlich ge- macht werden, ohne dabei jedoch bei einer bloßen Beschreibung zu verhar- ren; das Ziel ist die Erklärung der türkischen Niederlage 1683 bei Wien zwar aus der Struktur heraus, aber konkret aufgezeigt an Vorfällen, die im Tagebuch beschrieben sind. Die hier lauernde Gefahr ist greifbar: Es kann die Versuchung bestehen, das Tagebuch nach der Lektüre zu spezifi- schen Themen als ergiebigen Steinbruch zu mißbrauchen; wir würden uns so- zusagen nicht von der Quelle leiten lassen, sondern zwingen die Quelle in unser Strukturgitter hinein, um der Quelle die Literatur als Wahrheits- bürgen zuzuführen. Nun, das gezielte Aussuchen geeigneter Textstellen ist nicht per se Ausdruck ignoranter Willkür, da ich mich aus Zeit- und Kom- petenzgründen auf die bereits vorhandene Literatur verlassen muß (und oft auch kann) und außerdem etwaige Widersprüche zwischen dieser Literatur und Teilen meiner Quelle weder dazu führen, jener das Bibliotheks- und dieser das Authentizitätsdiplom zu entziehen; da beide unterschiedlichen Kategorien angehören, sind sie so jedenfalls nicht miteinander vergleich- bar (auch wenn sie Bezüge zueinander haben).
Trotzdem wird das Gewicht auf der strukturgeschichtlichen Darstellung liegen; aber möglicherweise bekommt die Leserin oder der Leser das Ge- fühl, die Quelle sei insgesamt zu kurz gekommen. Das wird nach einer vor- herigen Klärung nicht der Fall sein, denn im Mittelpunkt steht nicht die Belagerung Wiens, sondern die Ausführung all dessen, was diesem Geschehen von im Grunde relativ geringem Umfang das Epitheton `aus längerfristigen Tendenzen oder aus Strukturen heraus erklärbar` zu verleihen imstande ist.
Natürlich mußte ich vorher Sorgfalt walten lassen; so konnte ich nur denjenigen Bereichen eine Redeerlaubnis erteilen, die eine gewisse Ver- wandtschaft mit den Ereignissen von 1683 aufweisen. Es darf nämlich nicht angenommen werden, daß ich als Zeichen wissenschaftlicher Toleranz eine lustige Mischung beliebiger Kandidaten ins Spiel gewählt hätte. Manche waren schlicht ungeeignet für mein Vorhaben; ihnen fehlte, um es akade- misch auszudrücken, die Spezifität, was jedoch nicht heißt, daß anderwei- tig orientierte WissenschaftlerInnen sie nicht freudig in ihre Arme schließen würden.
Da wir es hier in erster Linie mit einem militärischen Geschehen zu tun haben, kommen vor allem die Heereseinheiten zur Sprache, d.h. eigent- lich diejenigen, deren Entwicklung als gravierend nachteilig für das os- manische Reich angesehen muß: Das ist erstens die belehnte Provinzreite- rei, die Sipahi, die unter dem Zerfall ihrer ökonomischen Substanz litt, und zweitens die sehr viel bekannteren Janitscharen, die sultansnahe Eli- te- und Prätorianergarde des Reiches, die allmählich aufgebläht wurde und dabei den größten Teil ihrer Zuverlässigkeit einbüßte. Nicht zu vernach- lässigen sind weiterhin die Staatsbeamten bzw. Würdenträger; durch teil- weise horrende Antrittszahlungen kamen sie für kurze Zeit an die begehr- ten Posten und durften dann dort ihre Inkompetenzen ausleben. Von geson- derter Bedeutung ist schließlich das Großwesirat, dessen jeweiliger Amts- inhaber die Zustände des Reiches mitunter diametral zu verdrehen vermoch- te und so den allerdings unberechtigten Anlaß zur Hoffnung gaben, das Reich noch retten zu können.
2. Faktoren des Verfalls
2.1. Das Timarsystems
2.1.1. Die Sipahi als Timarioten
Eine zentrale Rolle für die Aufrechterhaltung der staatlichen Macht spielte das Heer; dieses mußte entsprechend diszipliniert, zuverlässig und loyal sein, um einerseits die Schlagkraft gegen eventuelle innere oder äußere Feinde aufrechtzuerhalten, andererseits zu verhindern, daß sich diese militärische Kraft gegen den eigenen Staat wenden würde. Ge- währleistet wurden diese Anforderungen zum Teil durch eine für das os- manische Reich charakteristische Spielart des Lehenswesens, das soge- nannte Timarsystem.
Man unterscheidet zwischen drei Arten von Timaren: der Kleinpfründe (timar; das ist ein Timar im engeren Sinne, deren Inhaber Timarioten hießen), der Großpfründe (ziamet) und der Stabspfründe (has). Klein- und Großpfründen wurden für persönliche Dienstleistungen an Angehörige des Militärs (einfache Reiter, Offiziere) und an Beamte (subalterne und hö- here Zivilbedienstete) verliehen, Stabspfründen dagegen an Angehörige der Provinz- und Zentralverwaltung (Sandschakbegs, Beglerbegs, Wesire, restliche Diwansmitglieder).
Kleinpfründen warfen pro Jahr höchstens 19.999 Asper ab, Großpfründen zwischen 20.000 und 99.999 Asper, Stabspfründen mindestens 100.000 Asper. Unser Augenmerk wird nun besonders auf den militärische Dienste leisten- den Timarioten, also den mit einer Kleinpfründe belehnten Reitersoldaten, liegen. Die gesetzliche Festlegung und geregelte Ausweitung des Timar- systems fällt in die Herrschaftszeit Murad I. (1359-1389); es wurde be- stimmt, „daß jeder bewährte Krieger Anspruch auf eine Kleinpfründe (ti - mar) geltend machen konnte. Als Gegenleistung hatte er als belehnter Rei- tersoldat (spahi) zu dienen.“5 Das Land, welches als Timare vergeben wur- de, war Staatsland, „zu dem juristisch alle eroberten Gebiete mit Ausnah- me der Amlak (Pl. von mulk) und Wakuf gehörten.“6 Letztere waren ver- gleichbar mit dem europäischen Allod, dem vererbbaren Grundbesitz; und sie stellten aufgrund ihrer zentrifugalen Kräfte eine Gefahr für die Zen- tralgewalt dar. Sultan Mehmed II. ergriff hier die Initiative und schaff- te „1472 [...] durch Dekret den Mulk- und Wakfbesitz auf Staatsland ab und bildete daraus einen Fonds für Timare.“7 Das bedeutete nichts anderes als eine immanente Verflechtung von sozialer und militärischer Organisa- tion, wobei die Effektivität und Potenz eines Teils des Heeres direkt vom ökonomischen Gewinn, der aus dem Timar gezogen wurde, aber auch von der Macht der Zentralverwaltung des Reiches abhing. Die Pfründe stellte näm- lich zwar eine Belohnung für leistungsstarke Krieger dar, dennoch bildete sie allenfalls die Grundlage bzw. das Mittel, um dem Sipahi das Überleben zu sichern. Anders als in Europa war der Sipahi kein Grundherr, der auf seinem Fronhof die Hintersassen zu Arbeitsleistungen verpflichtete; er betrieb eher eine Rentenwirtschaft, indem er Teile seiner Pfründe mit ei- nem Bauernhof (ciftlik) an Bauern verpachtete, die ihm den Zehnten, meist in Naturalform, einige wenige Arbeitsdienste und den größten Teil der Ge- wohnheitssteuern zu leisten hatten. Es bestand nicht nur die Berechti- gung, diese Abgaben einzutreiben, sondern sogar die Verpflichtung, was sich nur mit der Nichterblichkeit der Lehen erklären läßt. Natürlich konnte einem Krieger eine Pfründe nur ein einziges Mal verliehen werden, doch das Anrecht auf das Timar war damit nicht fixiert. Um weiterhin Ti- marinhaber sein zu dürfen, mußte er erstens sich selbst genügend ausrü- sten und zweitens je nach Timargröße weitere berittene und bewaffnete Soldaten (cebeli) ausrüsten können: „For every 3000 akces of additional revenue accruing to the timar holder and 5000 akces to the zeamet holder, they were required to maintain, arm, and bring to campaigns an additional cebeli and his horse.“8 Über einen gewissen Betrag hinaus (2.999 Asper beim Timarioten, 4.999 Asper beim Zaim) konnte der Pfründeninhaber also keinen Gewinn anhäufen, da mit dem Erreichen einer festgelegten Summe (3.000 bzw. 5.000 Asper) wieder ein Reitersoldat gestellt werden mußte.9 Zudem war das Timar ursprünglich nicht erblich; der Inhaber besaß ledig- lich das Nutznießungsrecht an der Pfründe, konnte derselben aber bei Nichterfüllung der Pflichten wieder verlustig gehen. Nach dem Tode des Timarioten wurde die Pfründe zwar vorerst wieder eingezogen, die „hinter- bliebenen Söhne der Pfründeninhaber gingen jedoch nicht ganz leer aus: Sie hatten Anspruch auf eine angemessene Versorgung, [...] entweder eine mehr oder weniger einträgliche Stelle in der Staatsverwaltung bzw. in der Armee oder die Anwartschaft auf eine Pfründe, wobei eventuell einem der Söhne die Pfründe des verstorbenen Vaters zugewiesen werden konnte.“10 Als männlicher Nachkomme eines Timarioten hatte man allerdings kein unbe- dingtes, sondern ein eingeschränktes Recht auf die väterliche Pfründe; die abermalige Verleihung an die Söhne „erfolgte überhaupt nur dann, wenn sie binnen sieben Jahren nach seinem Tode sich zum Kriegsdienste melde- ten.“11
Die Qualität eines Heeres steigt zwar nicht proportional mit dessen Quantität, trotzdem ist die Stärke der Provinzreiterei erwähnenswert, da sie deutlich macht, wie sehr die Wirtschafts- und Sozialstruktur auf die Bedürfnisse der Armee ausgerichtet worden ist, wie erfolgreich die Zen- tralregierung dieses Konzept offensichtlich umgesetzt hat und wie em- pfindlich sich wirtschaftliche Verschiebungen auf den Status des Heeres auswirken konnte: „In 1607 Ayn-i Ali Efendi reported that there were some 44,404 timars producing a mounted force of 105,339 men. [...] Superiority in the quality of command, discipline, training, and tactics must, ra- ther, have been the decisive factor.”12 In Zeiten straffen zentralen Re- gierens dürfte die Disziplin der belehnten Sipahi wohl kaum Grund quä- lender Vernichtungsträume der Sultane gewesen sein, da die Unbotmäßigkeit eines Sipahi zur Einziehung seines Timars führte, was nicht in seinem In- teresse gelegen haben dürfte. Daneben oblag ihm auch nicht die Rechtsim- munität über seine Pfründe, und die das Land bearbeitenden Bauern waren zwar de facto von der Willkür des Sipahi anhängig, rein rechtlich jedoch hatten sie keinen Leibeigenen-Status und unterlagen auch keiner Gerichts- barkeit seitens des Sipahi.
Einem etwaigen Mißbrauch während der Vergabe der Pfründen versuchte man dadurch entgegenzusteuern, daß die Übertragung von Kleinpfründen auf die Beglerbegs beschränkt wurde, während Groß- und Stabspfründen gar nur durch die Hohe Pforte verliehen werden konnten.
2.1.2. Der Niedergang des Timarsystems
Dieses System funktionierte, solange genug Boden für alle Interessen- ten vorhanden war, die Subsistenzgrundlage der Pfründeninhaber nicht durch wirtschaftliche Krisen gefährdet wurde und die wichtigsten Regie- rungsposten des Reiches im Falle von Krisen mit einigermaßen starken Per- sönlichleiten besetzt waren. „Der Verfall des Osmanischen Reiches begann im Innern, lange bevor er in der äußeren Machtstellung zu Tage trat.“13 Schon im 16. Jahrhundert zeigten sich die ersten Risse; zum einen wären die großen Bauernfluchten zu nennen, die besonders am Ende des 16. Jahr- hunderts überhand nahmen. Da das Überleben eines Sipahi jedoch von den Arbeitserträgen dieser raya abhing, mußten sie sozusagen an die Scholle gefesselt werden, was nur dann gelingen konnte, wenn die Pfründe ihren bloßen Lehenscharakter verlor und in Eigentum (mülk) umgewandelt wurde. Bereits unter Suleiman II. erfolgten entsprechende Gesetzgebungen; die Zentralgewalt versuchte nun nämlich die Timare „in Feudalgüter zu über- führen, um die Spahi an das System zu binden, sie mehr an der Ausbeutung der Raya zu interessieren [...], was zwangsläufig zur Trennung dienst- licher Bindungen an den Staat vom Besitz an Grund und Boden führte.“14
Solche Regelungen vermochten es allerdings nicht zu verhindern, daß zwi- schen Sipahi und Mülkherren eine Art Konkurrenzkampf um den Boden aus- brach, der die Sipahi allein schon veranlaßte, ihr Interesse vermehrt auf das Timar zu lenken; in Kriegen okkupiertes Land fiel oft in die Hände von Mülkherren, so daß die Zahl der Timare sich nicht weiter vermehren konnte, die Sipahi also nicht in den Genuß der ihnen zustehende Belohnung kamen. „Die Lehenskrieger verloren dadurch das Interesse an Kriegsdien- sten, die ihnen wenig Beute und kaum noch Chassa einbrachten.“15 Aus dem Land, welches sie (noch) besaßen, versuchten sie nun rücksichtslos den größtmöglichen Betrag auszupressen, um überhaupt ihr eigenes Überleben sichern zu können. Daher nimmt es kaum wunder, wenn die Sipahi im Falle eines Kriegseinsatzes oft in ärmlicher Kleidung oder gar nicht mehr er- schienen; ebenso vernachlässigten sie ihre früheren Aufgaben wie zum Bei- spiel die Kontrolle über die Ordnung der Dörfer, in denen sie lebten: „In the feudal provinces the timar holders did no more than tax farmers, as- sessing and collecting taxes, while their former duties of keeping order and security were left to the sancak beys and governors“16. Derartige Phänomene können auf eine andere, vorhergehende und beglei- tende, Entwicklung zurückgeführt werden. Das osmanische Reich litt unter einem ökonomischen Entwicklungsdefizit; lange Zeit war die Levante einer der wichtigsten Verbindungswege in den Nahen Osten und brachte dem osma- nischen Reich durch Zolleinnahmen und Konkurrenzfähigkeit hinsichtlich der Waren wirtschaftliche Gewinne. Indem nun aber erstens europäische Länder wie Holland und England das Gewicht der Handelswege auf den Seeweg um Südafrika, namentlich das Kap der Guten Hoffnung, legten, wobei sie den Transport mit leistungsfähigen Schiffen abwickelten, und da zweitens durch den europäischen Frühkapitalismus mit seinen billiger produzieren- den Manufakturen die Konkurrenzfähigkeit des Osmanischen Reiches sank, kam es zu einer andauernden Inflation. „One result of the inflation was to encourage the abandonment of the timar system as a base of military power. The smaller Sipahi -held timars in any case were too small to fi- nance participation in campaingns due to the high prices now demanded for feed and arms.”17 Sowohl Sipahi als auch Mülkherren versuchten durch ge- steigerte Ausbeutung der Raya auszugleichen, was mit der Inflation ver- lorenging und letztendlich zur Abbröckelung des Timarsystems führte. Schließlich sahen sich die Sipahi des öfteren seitens der Provinz- statthalter, besonders der Beglerbegs, ihrer Existenzgrundlage beraubt: „Sie mißbrauchten ihr Recht zur Vergabe von Timaren, indem sie vakante Lehen zur Abrundung ihrer eigenen Besitzungen einzogen oder sie an Ver- wandte und Diener ausgaben, die keinen Anspruch darauf hatten.“18 Die Beglerbegs waren, wie eingangs erwähnt, bevollmächtigt, Kleinpfründen an verdiente Krieger zu vergeben. Als Staatsbeamte hatten sie selber ein Le- hen inne und trieben im Zuge der Inflation die Belastung der bäuerlichen Arbeitskraft in die Höhe, unter anderem, um die hohe Antrittszahlung ih- res Amtes wieder auszugleichen. Da sie jedoch außerdem an der Schaltstel- le der Landesvergabe saßen, bot sich ihnen hier die Aussicht auf ein ein- trägliches Geschäft. So wurden Timare an beliebige Leute und Anhänger verkauft; weder hatten diese sich im Kriege verdient gemacht, noch benö- tigten sie das Land wirklich, da sie nämlich schon mehrere andere Timare besaßen und so ihr Überleben im Grunde schon gesichert war. Die Zahl der Timare nahm schon während des 16. Jahrhunderts ab, was sich ungebremst im 17. Jahrhundert fortsetzte: „Während es im ersten Jahrzehnt des 17. Jh. noch fast 45000 Timare gab, von denen über 100000 Spahis und bewaffnete Reiter zur Verfügung standen, existierten 20 Jahre später nur noch 7000-8000 Klein- bzw. Großpfründen, an denen die Spahis kaum mehr Anteil hatte.“19
Unmittelbar in Mitleidenschaft geriet dabei natürlich die Qualität des Heeres; nicht nur die Zahl der Sipahis verringerte sich, auch ihre Ausrü- stung, die Fähigkeiten im Felde und ihre Einsatzbereitschaft wiesen arge Mängel auf. Die „Zentralgewalt benötigte deshalb Soldtruppen (sekban), um die Lücken im Heer aufzufüllen.“20 Zwar war damit für eine beeindruckende Anzahl an Soldaten gesorgt, nicht aber für den Kampfwert, der bei den halb irregulären Truppen allgemein alles andere als über die Stränge schlug.
Für jeweils bestimmte Zeiträume konnten die Mißbräuche und ihre Aus- wirkungen eingedämmt werden; regulierende Maßnahmen kamen dabei stets `von oben`, und zwar vom Großwesir. Doch selbst wenn er mit seinen Vor- haben erfolgreich war, so zerfiel das Geschaffene Gleichgewicht unweiger- lich zu Staub, sobald er von einem schwachen und handlungsunfähigen Groß- wesir abgelöst wurde. 1656 beschloß die Staatsführung, das Amt des Groß- wesirs an einen energischen Mann zu vergeben: In seiner Amtszeit zwischen 1656 und 1661 ergriff Mehmed Köprülü harte Maßnahmen, die ihm geeignet erschienen, die innere Anarchie, die in Heer und Verwaltung wütete, zu bändigen. „Zur Wiederherstellung der Schlagkraft des Provinzialaufgebotes leitete Köprülü eine großangelegte Überprüfung des völlig durcheinander- geratenen Pfründenwesens in die Wege.“21 Sein Sohn Ahmed Köprülü übernahm nach seinem Tode 1661 das Großwesirat und sicherte sich innenpolitischen Erfolg, indem er die straff angezogenen Zügel seines Vaters in die Hände nahm und seinen Stil 17 Jahre lang fortsetzte. Wie sehr die Stabilität des osmanischen Reiches von einer starken Person abhing und somit immer wieder offensichtlich wurde, daß das eigentliche Übel in der Struktur be- gründet war, zeigt sich an dem Wechsel des Großwesirats 1676, denn „nach Ahmed Köprilys Tod war das Großwesirat an Kara Mustafa (den Jüngern) ge- kommen, und alle von den Köprilys unterdrückten Mißbräuche lebten jetzt wieder auf.“22 Strukturelle Gegebenheiten konnten demnach allenfalls durch die jeweilige Persönlichkeit des Großwesirs modifiziert werden, und wenn, dann nur mit einem hohen Aufwand an Gewalt.
Gerade Kara Mustafa stellte eine heikle Mischung aus innenpolitischer Nachlässigkeit und außenpolitischen Wagemut dar. Mit einem Heer, welches weit davon entfernt war, ein Anrecht auf die Prädikate `diszipliniert` und `verläßlich` zu haben, wagte er 1683 den Angriff auf Wien; die Nie- derlage am Kahlenberg bildete gleichzeitig den Gipfel und Endpunkt des Zerfallsprozesses. Vom ehemaligen Leistungsgedanken der Sipahis, der mit dem Besitz eines Lehens verbunden war, spürte man während des Kampfes um Wien wenig mehr. Vielmehr mußten sie an ihre Aufgabe als Soldaten aus- drücklich erinnert werden, so „wurden einigen Lehensreitern, die mit der Herstellung von Schießpulver beauftragt waren, wegen Nachlässigkeit im Dienst öffentlich je hundertfünfzig Stockschläge aufgezählt.“23 Militäri- sche Dienste jeglicher Art hatten keine Priorität für die Sipahis; sie stellten keinen Anreiz mehr dar, da weder die Aussicht auf Beute noch Erhöhung des Sozialprestiges bestanden. Ähnliche Phänomene lassen sich bei der zweiten Säule des osmanischen Heeres finden, bei den Janitscha- ren.
2.2. Die Janitscharen
2.2.1. Kampfkraft und Loyalität
Die Janitscharen waren die Prätorianergarde des osmanischen Reiches: elitär und loyal. Zumindest waren sie das in den besten Zeiten des Rei- ches; was später folgte, waren Machtbewußtsein und irdische Gier. Dabei trafen die Sultane alle erdenklichen Maßnahmen, um diese `neue Truppe` einerseits zu einer ihm treu ergebenen Institution zu machen, die ande- rerseits gewisse damit verbundene Einschränkungen durch ein entsprechend hohes Sozialprestige hinzunehmen gewillt sein sollte (und es tatsächlich auch war).
Gebildet wurde das Janitscharenkorps aus jungen, christlichen Gefange- nen und später außerdem aus Christenknaben, die in den zum Reich gehören- den christlichen Provinzen lebten. Urheber der Idee, Christenknaben ihrem Herkunftsmilieu auf immer zu entreißen und in relativer Isolation zu ge- horsamen Soldaten zu erziehen, ist vermutlich Sultan Murad (1359-1389). Diese `Knabenlese` (devsirme) wurde mindestens alle 5 Jahre in den christlichen Provinzen durchgeführt; jeweils einer von fünf Knaben, die zwischen 10 und 15 Jahren24 alt waren, wurde mitgenommen, das Ganze wurde vollzogen von „agents, going through the provinces, conscripting the brightest subject youths for service to the sultan.“25 Die ausschlagge- benden Kriterien waren Stärke und Aussehen. Willkürlich wurden dieser Blutzehnt und damit auch Arbeitskräfte den christlichen Familien genom- men, um sie daraufhin in die Palastschule nach Istanbul zu bringen (oder an türkische Familien auf dem Lande zu vermieten). Dort erhielten sie Un- terricht in der türkischen Sprache und im Islam und dienten als Arbeiter im Palast und im Staatsdienst. Nach einer weiteren Auslese kamen sie ent- weder als Rekruten ins Janitscharenkorps und erhielten hier ihre militä- rische Ausbildung; nach ihrer Rekrutenzeit gehörten sie als vollwertige Mitglieder des Korps zur festbesoldeten Infanterie oder zu Reitereinhei- ten. Oder sie schafften es in die zwei Gemächer des Sultans und genossen eine höhere geistige und körperliche Ausbildung. Wer nach der folgenden Prüfung durchfiel, kam zu den Sipahi oder Silihdar, der Elite der Elite des Reiches, aus der sich die höchsten Würdenträger rekrutierten.
Bezeichnend für die Janitscharen war ihr absoluter Gehorsam gegenüber dem Sultan, der seitens der Ausbilder angestrebt wurde und lange Zeit wohl auch in den verschiedenen Janitschareneinheiten vorzufinden war. Rechtlich gesehen waren sie keine Freien, sondern Sklaven: sie waren `Sklaven der Pforte`, kapu kullari. (Im weiteren Sinne bezieht sich `Ka- pikuli` allerdings auf die gesamten Zentraltruppen, von denen die Jani- tscharen nur einen Teil darstellten.) Faktisch freilich führten sie nur in bestimmter Hinsicht ein Sklavendasein: Um ein Abschwenken ihrer Auf- merksamkeit vom Sultan und dem Serail zu verhindern, verbot man ihnen jegliche Art von Luxus. Sie durften weder heiraten oder einen Bart tragen noch etwas Überflüssiges besitzen oder ein Handwerk beherrschen. Im In- teresse des Sultans lag ebenso ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsge- fühl der Janitscharen: Indem man sie kasernierte und mit gewissen Privi- legien ausstattete, förderte man ihr Gefühl der Ununterschiedenheit un- tereinander, gab ihnen aber gleichzeitig das Wissen um ihre Differenz und Höherwertigkeit nach außen hin. So entwickelte sich ein spezifischer Korpsgeist, der sein Symbol in dem gemeinsamen Verpflegungskessel fand, aus dem die Janitscharen die Corba, also Reis und Fleischsuppe, ausge- teilt bekamen. „Es war ein schlechtes Zeichen, wenn die Janitscharen sich weigerten [...] zu essen. Stürzten sie gar die Kessel um, so bedeutete das den Aufstand.“26 Das Dilemma bestand darin, daß diese Einheiten un- verzichtbar, aber unter Umständen auch unwillig und rebellisch waren. Aufgrund ihrer Privilegien mußte sich der Garant derselben als potentiell erpreßbare Person begreifen; die Janitscharen erhielten zum Beispiel ein höheren Sold als die übrigen besoldeten Truppenteile und forderten dieses Recht unerbittlich für sich ein. Ebenso bestanden sie auf der Sicherung der besseren Verpflegung und der prestigewirksamen Kleidung. Innerhalb des Heeres kam ihnen eine immens wichtige Aufgabe zu: Während der Schlacht bildeten sie den Kern des Heeres und schützten den Sultan in der sogenannten Sultansschanze. Daneben gab es Janitscharen, die als Fe- stungstruppen in Grenzstationen, als Ortspolizei oder als Feuerwehrmänner ihren Dienst leisteten. Daß Zahl und Qualität sich in ihrer Größe nicht gegenseitig bedingen, ist auch an der Janitscharentruppe aufzeigbar: „Numbering no more than 30,000 men under Süleyman, they were not the largest group in the army, but because of their organization, training, and discipline [...] they formed the most important fighting force in the empire until well into the seventeenth century.”27 Manche Autoren geben die Größe des Janitscharenkorps sogar mit nur bis zu 20.000 Mann an und veranschlagen 30.000 für die gesamten Zentraltruppen. Im Vergleich dazu die Provinztruppen: Sipahis und cebeli machten zusammen ca. 90.000 Mann aus, der Effektivbestand des gesamten Provinzaufgebotes betrug etwa 200.000 Mann (!).
Die Verbindung von eiserner Disziplin, elitärem Korpsgeist, Hingabe dem Sultan gegenüber, militärischen Fähigkeiten, Tapferkeit und religiö- ser Überzeugung erzeugte also den überaus hohen Kampfwert der Janitscha- rentruppe.
2.2.2. Die Elitetruppe im Zerfall
Als Verhängnis sollte sich später die enge Verbindung zum Sultan und dessen persönlicher Abhängigkeit von den Janitscharen herausstellen. Zer- fallserscheinungen waren bereits lange vor dem 17. Jahrhundert zu beob- achten. Weiter oben war im Zusammenhang mit dem Timarsystem die Rede von den Raya und ihrer sich verstärkenden Auspressung seitens der Mülk- und neuen Ciftherren. Die eigenen Söhne in das Janitscharenkorps zu schmug- geln bedeutete nun zwar auch, Arbeitskräfte zu verlieren, stellte jedoch ebenfalls eine Möglichkeit dar, überzählige Esser loszuwerden und einen Teil des Soldes, den der Sohn als Janitschare bekommen würde, für die Fa- milie einzufordern. Nicht nur der Sold spielte eine Rolle: „Durch Beute und lukrative Geschenke anläßlich von Thronbesteigungen, Festlichkeiten und Feldzügen gelangten die Janitscharen zu Vermögen und Ansehen. [...] Muslimische Familien fanden bald Mittel und Wege, um ihre Söhne in den Verbänden unterzubringen.“28 Neben den Raya schickten auch Würdenträger und reiche Leute ihre Söhne in die Palastschule. Gegen Entgelt eines be- stimmten Betrages konnte man sich in die Listen der Janitscharen ein- schreiben lassen; die maßgeblichen Kriterien waren demnach nicht mehr wie beim System der Devsirme Kraft, Klugheit und gefälliges Aussehen. Schon allein das Einbrechen ungeeigneter Personen verminderte relativ gesehen die Qualität der Einheiten; indem sie mit ihren Familien in Kontakt blie- ben, war die wichtigste Bedingung für die Verläßlichkeit der Janitscha- ren, nämlich Ergebenheit dem Sultan gegenüber zu entwickeln, schon nicht mehr garantiert; Disziplinlosigkeit begann sich auszubreiten. Doch auch die eigentlichen Devsirme-Janitscharen strebten seit geraumer Zeit weni- ger nach hohem Prestige als vielmehr nach schnödem Reichtum. So durchbra- chen sie schlicht das Verbot, ein Handwerk oder Wucher zu betreiben, ohne freilich auf ihr Privileg der Steuerfreiheit zu verzichten bzw. verzich- ten zu müssen. Um an den Sold toter Kameraden zu gelangen, verhinderten sie die Streichung derselben aus den Listen und nahmen deren Sold ein; im Jahre 1630 betrug die Zahl der in den Listen eingeschriebenen Janitscha- ren 200.000 Mann. Die Landbevölkerung litt unter den Aktionen örtlicher Janitscharentruppen: „Die Janitscharen trieben mit Waffengewalt Steuern ein, verhinderten bäuerliche Fluchten und leisteten sich Willkürakte schlimmster Art.“29
Die Zahl der Truppe stieg beträchtlich an: „Aus gewöhnlichen Konstan- tinopolitanern und asiatischen Landstreichern rekrutiert, oft verheira- tet, in allerlei Händel verwickelt, [...] bildeten die privilegierten 42000 Janitscharen [...] nicht mehr den Kern der osmanischen Armee.“30 Zu Beginn des 17. Jahrhunderts schließlich waren zwischen 70.000 und 100.000 Janitscharen zu zählen.
Sogar der Sultan mußte vor der wachsenden Macht der Truppe zittern; denn auch wenn sie außerhalb ihres Korps die Vermehrung ihres Besitzes betrieb, so gab sie deshalb noch lange nicht ihren Sold auf; schließlich war er auch der höchste im gesamten osmanischen Heer. Verantwortlich für pünktliche und korrekte Auszahlungen war der Sultan; in arge Schwierig- keiten geriet er, wenn die Staatskasse sich leerte, was auf Verschwen- dungssucht am Hofe und Inflation zurückzuführen war. Das Korps „fühlte seine Macht und mißbrauchte dieselbe.“31 Fast schon zu einer (ungelieb- ten) Tradition wurde die Forderung nach exorbitanten Geldgeschenken bei der Thronbesteigung neuer Sultane, die sich der Penetranz und Beharrlich- keit der Janitscharen kaum entziehen konnten, geschweige denn es sich leisten durften, deren Wünschen eine Absage zu erteilen. Konnte oder wollte der Neuling den Forderungen der Janitscharen nicht nachkommen, so mußte er um sein Leben bangen; hatte er gar wie Osman II. vor, sich ihrer zu entledigen, so brachten sie unter Umständen den Sultan auch um (Der Tod Osmans war der erste Sultansmord.). Es blieb nicht dabei, daß sie un- liebsame Sultane absetzten oder ermordeten. „Bald sehen wir die Jani- tscharen in der Rolle, welche die Prätorianer zur römischen Kaiserzeit spielten, wenn sie auch in der Parteinahme für Thronaspiranten auf die Mitglieder des Hauses Osman beschränkt waren.“32 Vermeintlich oder tat- sächlich zahlungskräftige und -willige Personen wurden favorisiert; sie veranlaßten die Sultane daneben zu Morden an `orthodoxen` Funktionären. An dieser Stelle findet sich jedoch auch ein Widerspruch, der den für das 17. Jahrhundert so charakteristischen schnellen Wechsel in allen Ämtern und Würden erklären kann: Hatte der Sultan sich der Unterstützung der Ja- nitscharen gegen gewisse Antrittszahlungen an selbige versichert, so be- stand sein Problem nun darin, gerade die Personen zu liquidieren, denen er einen Teil seines Reichtums (vor allem auch in spe) verdankte; denn nur durch Korruptions- und Antrittsgelder der Würdenträger war der Sultan in der Lage, die Janitscharen in Form finanzieller Zuwendungen längerfri- stig im Zaum zu halten. Deren Forderungen liefen nun aber, wie gesagt, darauf hinaus, die mißliebigen Würdenträger loszuwerden, da diese nicht selten versuchten, wieder Ordnung in das anarchische Züge aufweisende Korps zu bringen, was natürlich nicht im Interesse der vergnügungsfreu- digen Janitscharen lag. Darüber hinaus konkurrierten sie mit den besolde- ten Sipahis, zu denen sie sich immer noch abgegrenzt wissen wollten, da die zentralen Reitertruppen weder so hohes Prestige (zumindest de iure) besaßen noch mit dem Sold der Janitscharen mithalten konnten. Ihre Riva- lität machte sich auch 1683 bei der Belagerung Wiens bemerkbar: „Die Freiwilligen der Sipah machten zwei Gefangene; als sie diese zum Großwe- sir bringen wollten, nahmen sie ihnen die Janitscharen [...] weg und führten sie selber vor den Großwesir“33. Wahrscheinlich um nicht zwischen den Fronten aufgerieben zu werden, belohnte der Großwesir schließlich beide Seiten gleichwertig. Trotzdem schien er sich nicht auf die Jani- tscharen voll und ganz verlassen zu können, so daß er auf die Sipahi zu- rückgreifen mußte, allerdings auch hier nicht unentgeltlich. So „erging der Befehl, unter den Sipah (und Silihdar) Freiwillige gegen Solderhöhung anzuwerben.“34 Bemerkenswert ist ebenfalls die Auswahl des Sultans bezüg- lich seiner Begleiter, da er hier den Janitscharen durchaus nicht den Vorrang gab, „als er mit etwa zehntausend Reitern ohne Gepäck aufbrach, um die Festung Wien in Augenschein zu nehmen und das Gelände zu erkun- den“35.
Eine völlige Abschaffung des Janitscharenkorps` konnte im 17. Jahrhun- dert nicht gelingen; noch war der Sultan in seiner Abhängigkeit zu ihnen gefangen, denn sollte er tatsächlich entschieden versuchen, sich diesen wachsenden Haufen vom Leibe zu schaffen, so mußte er damit rechnen, ent- weder von ihnen selbst bedroht oder aber Opfer anderer Gruppen zu werden, denen er nun, da seine Leibgarde fehlte, ausgeliefert war. Eine Maßnahme, den Zerfall der Janitschareneinheiten und seine Auswirkungen zumindest einzudämmen, war die Abschaffung des Devsirme-Systems im Jahre 1650; gleichzeitig fand jedoch auch die Auflösung der Palastschule statt, „ein Verlust für die Qualität der obersten Militärführung. Von etwa 1650 an machte sich eine technische wie auch militärtaktische Unterlegenheit des osmanischen Heeres gegenüber den Armeen der europäischen Länder deutlich bemerkbar.“36 Für die jeweilige Amtszeit gelang es durchsetzungsfähigen Großwesiren, der Macht der `Herren im Reiche` eine mehr oder weniger lan- ge Pause aufzuzwingen. So griff beispielsweise der Großwesir Mehmed Kö- prülü, seit 1656 im Amt, nicht nur zu rigorosen Maßnahmen, um die Ordnung im Lehenswesen, sondern auch die im Janitscharenkorps wiederherzustellen; definitiv senkte er die Mitgliederzahl des letzteren. Nachdem die Jani- tscharen 1648 nach einer Palastrevolution gar für ganze drei Jahre die Staatsmacht an sich gerissen hatten, schienen sie sich nun wieder der Botmäßigkeit eines energischen Politikers zu fügen. Köprülü entging einem Angriff von zwei Fronten, einmal seitens der Janitscharen, andererseits der zentralen Reiterei, als er die einen zum Feind der anderen machte: „When the Sipahis in Istanbul protested, he sent the Janissaries against them, using the occasion to slaughter all who resisted.“37 Sein Sohn und Nachfolger Fazil Ahmed Köprülü vermochte den vom Vater geschaffenen Zu- stand zu halten; unter Kara Mustafa allerdings brachen die alten Mißstän- de wieder aus, da sein Interesse wohl mehr der Außen- als der Innenpolitik galt, er aber angesehen davon weder auf dem einen noch auf dem anderen Gebiet Fähigkeiten bewies.
Wurde die Ergebenheit des Janitscharenkorps also ehemals durch ein ho- hes Sozialprestige und gewisse Privilegien erkauft, so wurden die Jani- tscharen nun geradezu zu Schutzgelderpressern, die dem Sultan nicht mehr ergeben waren, sondern ihn potentiell oder tatsächlich bedrohten und für ihr Wohlwollen enorme finanzielle Zuwendungen, mit denen sich der Sultan jeweils freikaufen konnte, verlangten. Sie beschützten nicht mehr, man hatte sich vor ihnen zu schützen; nicht sie waren dem Sultan ergeben und bekamen ihren Lohn dafür, der Sultan war ihnen ergeben und durfte froh sein, im Amt und am Leben zu bleiben. Die Janitscharen stärkten nicht mehr einen Machtfaktor, nämlich den Sultan, sie waren selbst zu einem gefährlichen selbständigen Machtfaktor geworden.
2.3. Staatsbeamte der Zentral- und Provinzialverwaltung
2.3.1. Der Status einiger wichtiger Staatsbeamter
Zu den Hauptprotagonisten des allmählichen Zerfalls des Reiches gehör- ten vor allem auch die Würdenträger; besonders häufige Erwähnung finden einige ihre weltlichen Vertreter wie zum Beispiel die Beglerbegs und die Amtsträger des Großherrlichen Diwans. Der Grund für ihre Bedeutung wird ersichtlich, wenn wir einen Blick auf die Verwaltungsstruktur des osmani- schen Reiches werfen.
Territoriale Grundeinheit war der Sandschak, dem jeweils ein Sand- schakbeg vorstand. Dieser hatte sowohl zivile als auch militärische Funk- tionen inne; so fungierte er unter anderem als Kommandant der in seinem Territorium seßhaften Truppenteile. Mehrere Sandschaks bildeten zusammen ein Wilajet, eine Großprovinz. Dem Leiter des Wilajets, dem von der Hohen Pforte ernannten Beglerbeg, lagen ebenso wie dem Sandschakbeg zivile und militärische Angelegenheiten ob; darüber hinaus hatte er ein begrenztes Recht, die Tätigkeiten der Sandschakbegs zu kontrollieren, ohne aller- dings selbst Verfügungen erteilen zu dürfen. Zu Beginn des 17. Jahrhun- derts zählte das Reich ca. 44 Wilajets und 250 Sandschaks. Als eigentliche Regierung des Reiches kann der Sultan samt dem Groß- herrlichen Diwan bezeichnet werden; hier wiederum kam dem Großwesir eine Schlüsselstellung zu. Zum Diwan gehörten außerdem drei Kuppelwesire, die beiden defterdar (Finanzbeamte für Anatolien und Rumelien), die beiden Heeresrichter und der nisanci (Chef der Reichskanzlei). Personell rekrutierten sich diese Würdenträger aus Absolventen der Pa- lastschule, zum Teil auch aus osmanischen Prinzen. Als Entgelt für ihre Arbeit bekamen sie die größte der drei Timar-Arten verliehen, das soge- nannte Chaßlehen, welches pro Jahr mindestens 100.000 Asper abwarf. Indem man sie somit an das Leistungsprinzip band, sollte ein Mißbrauch ihrer Macht verhindert werden. „Sie waren jederzeit ab- bzw. versetzbar, ja, es wurde durch eine regelrechte Versetzungspolitik bewußt dafür gesorgt, daß die Großgouverneure keine zu festen Bindungen an ihr Territorium entwikkeln konnten.“38
Dieses System blieb stabil genau so lange, als es keinerlei finanziel- le Probleme gab; aufgrund der zentralen Verfassung des Reiches kann sich nämlich die Staatsspitze nicht in Autonomie und Sicherheit wägen, wenn in einem Teil der Gesellschaft Finanznöte auftreten. Vom Zentrum läuft zwar die Kontrolle geradewegs zu allen Punkten der Basis, umgekehrt aber wird die Spitze auch mit den Konfusionen der untersten Ebene infiziert; die sich daraus ergebenden Probleme sind dagegen mehr als nur einer Art.
2.3.2. Korruption im Staatsapparat
Ich habe bereits auf die Vehemenz hingewiesen, mit der belehnte Sipa- hi, sich zu Ciftherren entwickelnd, und Mülkherren versuchten, die Raya auszupressen. Einerseits hatte das Reich unter Inflationen zu leiden, die unter anderem aus der sinkenden Konkurrenzfähigkeit mit europäischen Län- dern auf dem überseeischen Markt herrührten. Zweitens bestand ein sozial- psychologisches Problem, wenn die Sipahi ihrem eigentlichen Beruf, dem Kriegführen, nicht mehr nachkommen konnten. Sie verloren schließlich je- des Interesse daran und wandten sich so nahen Dingen wie ihrem Lehen zu, um ihren einst so hehren Kriegergeist zu bloßer Geldgier degenerieren zu lassen. An der Hohen Pforte selbst machte sich der Geldmangel natürlich bemerkbar, sowohl direkt als auch indirekt. So verlor sie wesentliche Einnahmen mit der sinkenden Zahl an durchreisenden Händlern, die bis da- hin einen gewissen Betrag an Zolleinnahmen für das Reich garantierten (der jedoch nebenbei bemerkt insgesamt relativ niedrig war). Daneben be- kam der Hof die allgemeinen inflationären Tendenzen zu spüren, was vor allem mit dem wachsenden Wuchergeschäft und hiermit verbundenen Preis- steigerungen zu erklären ist. Unglücklicherweise waren diese Erscheinun- gen mit anderen zersetzenden Vorgängen gepaart. Schon im 16. Jahrhundert, noch unter Suleiman, begann sich das Gebaren am Serail den Namen Ver- schwendungssucht zu verdienen. In der Folge produzierte der Hof diejeni- gen Zustände, die sich später als verhängnisvoll für den Weiterbestand des Reiches erweisen sollten: „Die Einkünfte reichten nun für die Luxus- bedürfnisse nicht mehr aus und da begannen die Erpressungen und Beste- chungen, sowie die Vernachlässigung der von den Spahis für den Krieg be- reitzustellenden Mannschaft.“39 Um in den Rang eines Wesirs erhoben zu werden, war es nicht mehr von Belang, vorzüglich an der Palastschule aus- gebildet worden zu sein; oft notwendiges Kriterium war nun der Status ei- nes zahlungskräftigen Günstlings. Der steigende Einfluß reicher Personen korrespondierte der sinkenden Stärke des jeweiligen Sultans; mitunter ge- langten Idioten, Kinder und Psychopathen auf den Thron. Für die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts wird zumeist der Name `Weiberherrschaft` re- klamiert; er bezeichnet den auffälligen Einfluß des Harems auf die Perso- nalpolitik der Hohen Pforte. Man mag sich fragen, warum ausgerechnet die- ser Bereich des Serails zu derartigen Aktionen fähig war, zumal die mei- sten Amtsanwärter ja auch um die Inkompetenz der Haremsmitglieder wußte. Mit anderen Worten: Warum übernahm statt des Harems nicht die Fraktion der Günstlinge das Steuer? Die Antwort ist, daß es mehr Fraktionen als nur die der Würdenträger gab, und selbst diese eine war in sich zersplit- tert; um Einfluß kämpfte schließlich auch das Janitscharenkorps, und im- merhin mit großem Erfolg. Vor dessen Kampfkraft mußte man sich berechtig- terweise fürchten. Von dieser Warte aus wird es sogar zweifelhaft, ob der Harem tatsächlich soviel Macht hatte, wie ihm nachgesagt wird. Zwar be- stimmte er, welche Personen jeweils in den Rang eines Würdenträgers er- hoben werden sollte, die Kriterien der Auswahl jedoch standen bereits fest. Der Harem legte nicht die grundsätzlichen Interessen fest, er paßte sich ihnen lediglich an. Da die Amtsstellen zentral vergeben wurden, lag es lediglich im Interesse der Amtsanwärter, den Bedingungen zur Vergabe zu entsprechen; das war deshalb nicht besonders schwer, weil die Ziele des Hofes und die der Würdenträger sich insofern überschnitten, als beide Seiten zu Geld zu kommen versuchten. Der Hof litt unter permanenter Geld- not und verkaufte deshalb die verschiedenen Posten; Sultan Murad III. gar holte nicht einmal mehr die Zustimmung der Großwesire ein und ernannte gefällige Personen gegen Bestechungsgelder. Wo sich die Sultane nicht gegen die Mitglieder des Hofes durchsetzen konnte, und das war mit Fort- schreiten der Zeit häufiger der Fall, herrschten trotzdem chaotische Um- stände. Die Großwesire selbst wurden häufig von den Janitscharen favori- siert und eingesetzt. „Zwischen 1604 und 1656 kam es in diesem hohen Amt vierundvierzigmal (!) zu einem Wechsel.“40 Ihr Interesse richtete sich in der Hauptsache darauf, ihre Antrittszahlung nicht nur auszugleichen, son- dern zudem ein Plus zu machen. Somit wurden der Inkompetenz alle Türen geöffnet, denn die Großwesire verkauften nun ihrerseits Posten in der zentralen und der Provinzialverwaltung, wechselten die Amtinhaber jedoch oft, um den höchstmöglichen Betrag für sich und den Staatsschatz erbeuten zu können. „Kein Wesir bekleidete mehr als drei Monate sein Amt, jeder Beamte bereicherte sich, unterdrückte die Steuerpflichtigen und duldete Übergriffe der Soldateska gegenüber den Re´aya (Bauern).“41 Die Bereiche- rung wurde also regelrecht durch alle Instanzen nach unten weitergeleitet bis hin zu den Bauern, auf denen letztendlich die gesamte ökonomische Be- lastung ruhte. Nun gelang es so zwar, dem Fiskus relativ hohe Beträge zu- zuführen, allerdings schnitt sich das Reich mit der Korruptionsförderung selber tief ins Fleisch, da sie „nicht nur das administrative Durcheinan- der verstärkte, sondern auch zum weiteren Abbau der ökonomischen Substanz der Zentralregierung führte.“ Katalysierend wirkte der Versuch, durch vermehrte Verpachtung von Steuereinnahmen (iltizam) den Staatsschatz aufzufüllen; der Verpachtung folgte meist die Unterpacht und damit eine noch höhere Belastung der Raya, da ja zwei gierige Würdenträger in ihren finanziellen Bedürfnissen befriedigt werden wollten. Die Lehen wurden jetzt vorrangig an die Würdenträger und nicht mehr an die Sipahis verge- ben; nicht nur sank damit das für die Lehensritter vorgesehene Maß an Landmasse, auch erwuchsen dem Staat aus den an Würdenträgern vergebenen Ländereien nicht mehr Leistungen als vorher, da diese genau wie die ein- fachen Sipahi-Timarioten das Lehen an sich zu binden versuchten. So wur- den manche Personen durch derartige Vergaben regelrecht für ihre Dienste erkauft, sogar aus der bloßen Not heraus wie 1683, als das osmanische Heer Wien belagerte: „Da nur ein einziger Schanzenmeister vorhanden war, setzte der Großwesir noch weitere neun Mann unter Verleihung von Kleinle- hen als Schanzenmeister ein.“42
Mehmed Köprülü griff, nachdem er 1656 zum Großwesir ernannt worden war, hart durch; er beschnitt den Luxus am Hof und beseitigte Amtsträger, die korrupt waren oder seinen Anweisungen nicht folgten. Ungefähr 36.000 soll er zur Abschreckung hingerichtet haben lassen. Kara Mustafa dagegen zeigte weniger Durchsetzungsfähigkeit, so daß Korruption und Nepotismus wieder durchbrachen. Leistung stellte kein anzustrebendes Gut mehr dar; so erteilte der Großwesir 1683 vor Wien „dem Beglerbegi von Rumelien und den Befehlshabern des rechten sowie des linken Flügels heftige Rügen und schweren Tadel, weil sie [...] eine gewisse Nachlässigkeit an den Tag legten.“43 In euphemistischer Verhüllung schreibt der Zeremonienmeister in seinem Tagebuch, daß militärische Dienste von Befehlshabern und Hee- resteilen nicht ohne eine materielle Gegenleistung erbracht wurden, denn Kara Mustafa „beschenkte die Aga der Freiwilligen (der Janitscharen und der Sipah) sowie die Freiwilligen (und die Männer), die in den Galerien und Minen Dienst taten, freigebig mit Goldstücken.“44 Es ließen sich üb- rigens an dieser Stelle noch etliche andere Textbeispiele aufzählen, in denen Angehörige der Armee für im Grunde selbstverständliche Leistungen reich belohnt wurden; die häufigsten Geschenke bildeten dabei neben dem Geld die Ehrengewänder. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammen- hang ein Vorfall, der sich am 4. September 1683 zutrug. Dem Hasan Efendi, einem Defterdar, wurde die Provinz Temeschwar samt der Paschawürde ange- tragen, die er allerdings ablehnte. Der Großwesir ohrfeigte ihn daraufhin und ließ ihn, da er sich weiter weigerte, inhaftieren. „Anschließend wur- de der Janitscharenkanzler Mahmud Efendi (aus Manisa) vorgeladen und ihm die hohe Würde des Defterdars verliehen [...] Nachher ließ der Großwesir wieder den Hasan Efendi holen und ihm das Ehrengewand als Beglerbegi von Jenö überziehen“45. Offensichtlich ohne jede Relevanz war hier, daß der Hasan Efendi Temeschwar übernahm, sondern daß er überhaupt aus seiner Funktion als Defterdar gedrängt wurde; denn als dies (durch Gewaltanwen- dung) gelungen war, bekam er eine völlig andere Provinz zugeteilt, und zwar ohne ersichtlichen Grund. Eine naheliegende Vermutung wäre diese: Das Amt des Defterdars war ein höherrangiges als das eines Beglerbegs; es gab ganze zwei (!) Defterdare, und zwar einen für Anatolien und einen für Rumelien. Doch nicht nur das jeweilige Amtsgebiet war über die Maßen um- fassend, auch die einzelnen Kompetenzen erstreckten sich über weite Be- reiche des Staatsapparates, da praktisch jeder Teil desselben sowohl Ein- nahmen als auch Ausgaben hatte und der Defterdar als Finanzbeamter hier- über Buch führte. In dem betreffenden Zeitraum nun war die Vergabe dieses Amtes demnach immer mit der Vergabe einer riesigen Machtfülle verbunden, die dem jeweiligen Beamten nur für eine gewisse Zeit zugestanden werden durfte. Zudem brachte ein derartig hohes Amt dem Staat entsprechend mehr Antrittsgelder ein, was außerdem einen Anreiz bzw. eine Notwendigkeit für einen regelmäßigen Personenwechsel darstellte.
Übergreifende und korrigierende Maßnahmen waren also von der Seite der Staatsbeamten nicht zu erwarten; weit ab davon, glühende Verfechter straffer Verwaltungstheorien zu sein, machten sie an die richtigen Perso- nen die richtigen Versprechungen und beschäftigten sich während ihrer Amtszeit eifrig mit der Überkompensation der stattlichen Antrittszahlung.
2.4. Die Institution des Groß wesirats
Es erscheint unangemessen, dem Großwesir eine Schlüsselstellung beim Zerfall des osmanischen Reiches zuzuschreiben. Es ist aber ebenso sicher, daß ohne seine jeweilige Person die Entwicklungen im Reich anders verlaufen wären. Nun, beide Ansichten müssen sich gar nicht widersprechen, wir müssen bloß überlegt mit ihnen umgehen.
Der Großwesir war nach dem Sultan der zweite Mann im Reich; auch wenn er weitreichende Beschlüsse formulierte, so war es doch der Sultan, wel- cher selbige ablehnen oder ihnen zustimmen konnte. Als Vorsitzender des Diwans hatte er neben sich drei Kuppelwesire und einige weitere Beamte, die jedoch alle im Rang unter ihm standen. Der Diwan stellte eigentlich ein lediglich beratendes Organ dar; der Großwesir übernahm trotzdem zu großen Teilen die Führung der Politik, da der Sultan als einzelnes Ober- haupt des Reiches unmöglich die Vielzahl der Aufgaben allein wahrzunehmen fähig war. Schon in diesen Richtlinien ist die Anlage zu erkennen, daß sich verschiedene Führungsstile entwickeln konnten: „Je nach Persönlich- keit des Großwesirs variierte das Ausmaß seiner Machtfülle.“46 Solange das System der Devsirme funktionierte, war auch beim Amt des Großwesirs das Leistungsprinzip gewährleistet, da die Palastschule die Rekrutie- rungsbasis bildete. Zerfiel allerdings das Janitscharenkorps, so wie es schon beschrieben wurde, so drangen auch inkompetente und eher am Geld- prinzip orientierte Personen in die höchsten Ämter ein. Besonders chaoti- sche Züge nahmen die Zustände in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein, während derer man es tatsächlich auf 44 Großwesire brachte. Ein schlagartiger Wandel trat mit dem Amtsantritt Mehmed Köprülüs ein; er un- terzog das Timarwesen, den gesamten Staatsapparat und das Finanzwesen seinen strikten Ordnungsmaßnahmen; gleichzeitig hatte er außenpolitische Erfolge zu verzeichnen. Sein Sohn Ahmed Köprülü übernahm das Geschaffene und hielt den Status quo, ohne dabei so brutal wie sein Vater vorzugehen bzw. vorgehen zu müssen, da es ja zu Amtsbeginn keine zu beseitigenden Mißstände gab. Die Nachlässigkeit seines Nachfolgers Kara Mustafa forder- te ihr Opfer; eine unheilvolle Mischung aus persönlichem Ehrgeiz und fachlicher Inkompetenz führte zum Aufblühen aller alten inneren Probleme, besonders der sinkenden Qualität des knapp 250.000 Mann umfassenden Hee- res. Als 1683 der Verlust des neuen Vasallenstaates Oberungarn unter dem Fürsten Thököly durch das dem Fürstentum konzedierende Österreich drohte, zog er mit ca. 200.000 Mann gegen Wien. Es sollte vorerst der letzte gro- ße Angriff des osmanischen Reiches auf europäischem Gebiet sein. Dabei hatte das Heer unter Kara Mustafa bis zum August 1683 die Stadt schon eingeschlossen; kurz darauf rückte aber ein polnisches Entsatzheer unter der Führung des polnischen Königs Johann Sobieskis an und schlug zusammen mit den anderen europäischen Verbündeten am 12. September 1683 die türki- sche Armee am Kahlenberge. Am 25. Dezember 1683 erlitt Kara Mustafa das Schicksal aller Großwesire, die während ihrer Amtszeit gescheitert waren und dafür zum Tode verurteilt worden waren; „der Kislar-Aga forderte ihm das Reichssiegel ab und, während er es ehrerbietig übergab, warf der an- dere den Strang über den Kopf des zum Tode verurteilten Verräters.“47 Im Tagebuch ist freilich zu lesen, daß dem Großwesir sein Urteil übermittelt wurde und er daraufhin geradezu an den Vorbereitungen zur Hinrichtung mitwirkte: „Eigenhändig legte er seinen Pelz und seinen Turban ab und be- fahl dann: `Sie sollen kommen! Und nehmt noch diesen Teppich weg - ich will, daß mein Leichnam mit Staub besudelt sei.`“48
Tatsächlich war es gefährlich für den Bestand des Reiches, wenn einem unfähigen Mann die Leitung übertragen wurde; bemerkenswert und typisch für das 17. Jahrhundert war, daß der Status des Reiches mit der Persön- lichkeit des Großwesirs scheinbar stieg und fiel. Er war die Variable in der ganzen Rechnung, er infizierte mit seinen persönlichen Fähigkeiten die Struktur; die Struktur ihrerseits war die Konstante, die immer nur oberflächlich modifiziert werden konnte. Kara Mustafa war nicht `schuld` am Niedergang des osmanischen Reiches, er war im Grunde selbst nur ein Symptom dafür; aber er führte die Armee in diesen wenigen Monaten des
Jahres 1683 in die genannte Katastrophe und trug damit eine Verantwortung für die konkreten Ereignisse dieser kurzen Zeit. Die Voraussetzungen, un- ter denen er das Großwesirat übernahm, waren derart, daß es unter einer Persönlichkeit wie seiner früher oder später zu einem Desaster kommen mußte. Unter einem anderen Großwesir wäre der Verfall vielleicht noch ei- ne Weile aufschiebbar gewesen, doch mit Sicherheit hätte es auch dann irgendwann eine `Strukturoffenbarung` gegeben. Es klingt paradox, doch gerade das ständige Auf und Ab des allgemeinen Zustandes läßt den Schluß auf anderweitige Gründe zu; die energischen Großwesire wandten stets Brachialmethoden an, um Ordnung zu schaffen. Sie erzielten damit auch relativ schnelle Erfolge, die aber wie eine Fata Morgana verschwanden, sobald die Maßnahmen des Vorgängers und ihre (positiven) Folgen nicht künstlich und mit aller Kraft aufrecht erhalten wurden.
Natürlich sah auch die Hohe Pforte selbst, daß ein unfähiger Wesir abgesetzt werden mußte, um Schlimmeres zu verhüten, so geschehen bei Kara Mustafa: „his opponents at court were able to convince the sultan that he was entirely responsible for the failure at Vienna as well as for the rout that followed. Thus he was dismissed and executed at Belgrade [...], leaving the army even more disorganized than before.”49
Während in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Janitscharen als Sieger aus den Kämpfen rund um den Hof des Sultans hervorgingen, sich da- bei den jeweils gefälligen Manne zunutze machten, indem sie ihn in das Amt des Großwesirs hievten oder gar zwangen, ihn aber nach Überschreiten der Gebrauchsfrist wieder aus dem Verkehr zogen, floß dem Großwesirat be- sonders nach 1656, dem Amtsbeginn Mehmed Köprülüs, wieder ungeahnte Macht zu. D.h., eigentlich war es kein bloßer und glücklicher Zufall, daß Meh- med als Erster seit langer Zeit gebieterische Manieren an den Tag legen konnte, sondern umgekehrt folgte auf sein Handeln hin eine Aufwertung des Amtes; er sorgte gewissermaßen dafür. Sein Sohn Ahmed vermochte die ge- wonnene Stabilität aufrechtzuerhalten; Kara Mustafa dagegen ließ den frü- heren Mißbräuchen wieder ihren Lauf, mit all den Folgen, die schon be- sprochen wurden.
3. Die Adäquatheit der Erklärung
Hat die Leserin oder der Leser nun eine adäquate Erklärung für die Nie- derlage des osmanischen Heeres im September 1683 am Kahlenberge erhalten? Nach kurzem Überlegen stellt man fest, daß die Frage zu undifferenziert ist; wann zum Beispiel war die Niederlage endgültig? Je nach dem kann man nämlich verschiedene Kandidaten und Verdächtige zur Klärung der `Schuld- frage` heranziehen. Doch selbst nach einer Differenzierung ist keine un- umschränkte Beliebigkeit erwünscht. Es sollte uns widerstreben, etwas mit `allem Möglichen` erklären zu wollen, da wir ja die `echten` Ursachen und Gründe eh nie herausfinden würden. Hätten wir das immer getan, gäbe es wohl nichts, was sich Wissenschaft nennt; dabei wissen wir sehr gut, was wir als zulässig gelten lassen und was nicht. Manchmal sollten wir uns zum Beispiel die Frage stellen, ob das, was wir unter Ursache oder Grund verbuchen, tatsächlich ein(e) solche(r) ist, indem wir untersuchen, ob das, was erklärt werden soll, auch ohne die in Frage stehende Ursache oder den betreffenden Grund eingetreten wäre (was nicht heißen soll, daß sie gar keine Rolle mehr spielen, da in den meisten Fällen Abhängigkeits- muster vorliegen statt einfacher geradliniger Abhängigkeiten und sie so- mit ihren angemessenen Platz bekommen können, ohne sich dem Dominanzvor- wurf aussetzen zu müssen oder eine berechtigte Vernachlässigungsklage einzureichen gedenken).
Die Niederlage des Jahres 1683 wurde hier von Beginn an nicht als los- gelöstes Einzelereignis, sondern als Gipfelpunkt einer allgemeinen Ent- wicklung aufgefaßt. Diese Entwicklung, im speziellen die des 17. Jahrhun- derts, stellt nun selbst keine Zufälligkeit dar; sie kann auf etwas Grundlegenderes zurückgeführt werden, das allen ihren einzelnen Abschnit- ten gemeinsam ist.
Bei unserem Thema bekam das Timarsystem einen vorrangigen Platz zuge- wiesen; oder besser, der Zerfall desselben, nicht es selbst in seiner Ei- genart, wurde als Grund `ersten Ranges` für die gehäuft auftretenden mi- litärischen Niederlagen bei außenpolitischen Konflikten, sprich: Kriegen, angegeben. Verständlich wird diese Erkenntnis, wenn man sich klar macht, daß das osmanische Reich seine Kraft vor allem aus seiner militärischen Stärke bezog, selbige aber auf dem Lehenswesen beruhte; die Vorbehaltung staatlichen Landes für bewährte Krieger, um ihnen mit der Vergabe von
Land eine Lebensgrundlage zu sichern, gleichzeitig ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Kampf zu steigern, ohne das Interesse am Besitz des Landes zu wecken, sondern das am Krieg beizubehalten, war also eine notwendige Bedingung für die Existenz und Expansion des Reiches. In der Literatur kursiert die plausible These, daß die nachlassenden Möglichkeiten, aus- wärtige Kriege zu führen und damit potentielles Timarland zu erobern, er- stens eine Ablenkung der Sipahi von ihrem Beruf und zweitens nicht nur die quantitative Stagnation der Lehnsreiterei (da ja kein Land gewonnen wurde, welches an potentielle Sipahis hätte vergeben werden können) nach sich zog, sondern auch durch die Allodialisierungstendenzen hinsichtlich der Timare deren Zahl verringerte. Die eben genannten Phänomene sollen auch gar nicht bestritten werden, aber der aufgeführte Grund: Denn es wurden noch genügend Kriege geführt, die, auch wenn sie nicht die Aussicht auf brauchbares Timarland boten, so doch den Sipahis eine Ausführung ihres `Handwerkes` gewährleisteten. Außerdem sind daneben eben ganz andere Gründe nennbar, auf die die Zerfallserscheinungen zurückführbar sind; ich bin in meiner Arbeit auf sie eingegangen.
Andererseits soll nicht gesagt werden, daß die Auflösung des Timarsy- stems sozusagen vom Himmel fiel; als ihr Grund wurde die Inflation ge- nannt, selbst jedoch nicht weiter begründet, da sie nicht Gegenstand die- ser Arbeit war. Der Staat bzw. Sultan hatte lange vorher schon teilweise und mit Erfolg versucht, die Sipahi auf eine Fesselung der Raya an ihren Boden zu lenken, um die Bauernfluchten einzuschränken; diese wiederum hatten ihre Ursachen in den vielfältigen Belastungen, denen die Raya aus- gesetzt waren, gegen die der Staat vorzugehen aber keinerlei Interesse aufbrachte. Es war also fast gleichgültig, was er tat, er handelte direkt oder auf Umwegen irgendwie gegen seine Interessen. Was er nicht in Kauf nahm, war der Zerfall der Heeresgrundlage; paradoxerweise mußte dazu das Lehensprinzip vorerst ausgehebelt werden, um später vergeblich zu versu- chen, den Vorgang rückgängig zu machen. Die Qualität der Provinzreiterei sank erheblich durch steigendes Desinteresse und schlechter werdende Aus- rüstung. Daneben begann die Verwässerung des einst so kleinen und exklu- siven Janitscharenkorps und die Bestechlichkeit in der Verwaltung; in beiden Fällen wurde, wie übrigens bei den Sipahi auch, Geld zum Zahlungs- mittel, die Leistung allmählich verdrängend.
Die Ereignisse, bei denen nun die militärische Schlagkraft auf dem Prüfstand kam, bieten entsprechend eine Konzentration der krisenhaften Symptome; so war es nicht nur 1683, so geschah es schon etliche Male vor- her im 17. Jahrhundert, nur daß 1683 die Niederlage bedeutender und sym- bolträchtiger war. Struktur und Ereignis bilden zwar jeweils eine eigen- ständige Kategorie, können aber, wie wir gesehen haben, unter der richti- gen Fragestellung durchaus aufeinander Bezug nehmen. Strukturen wären völlig inhaltslos ohne Singuläres, von welchem sie das Abstrakte sind, und umgekehrt wäre Geschichte ohne Struktur eine bloße Ansammlung von Tatsachen, eine Chronik; Chroniken allerdings erklären nichts.
Literaturverzeichnis
1. Brockelmann, Carl. Geschichte der islamischen Völker und Staaten. München, Berlin 1943
2. Eickhoff, Ekkehard. Venedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645-1700. München 1973, 2. Auflage
3. Jaeckel, Peter. Die Bewaffnung des osmanischen Heeres.
4. Jorga, N. Geschichte des Osmanischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt von N. Jorga. (Band 4) Gotha 1911
5. Kreiser, K. Der Osmanische Staat 1300-1922. (Oldenbourg Grundriß der Geschichte. Band 30) München 2001
6. Majoros, F., Rill, B. Das Osmanische Reich. (1300-1922). Die Geschichte einer Großmacht. Graz, Wien, Köln, Regensburg 1994
7. Matuz, J. Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte. Darmstadt 1985
8. Ritter von Sax, C. Geschichte des Machtverfalls der Türkei bis Ende des 19. Jahrhunderts und die Phasen der `orientalischen Frage` bis auf die Gegenwart. Wien 1908
9. Shaw, S. Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808. (History of the Ottoman Empire and the Modern Turkey. Volume 1) Cambridge 1976
10. Tietze, A. Mit dem Leben gewachsen. Zur osmanischen Geschichtsschreibung in den letzten fünfzig Jahren. In: Das Osmanische Reich und Europa 1683-1789. Konflikt, Entspannung und Austausch. (Heiss, G., Klingenstein, G. (Hrsg.) Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit. Band 10/1983) Wien 1983, S. 15-24
11. Werner, E. Das Osmanenreich im 17. Jahrhundert: Systemverfall und Systemstabilisierungsversuche.
12. Werner, E., Markov, W. Geschichte der Türken von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin 1978
13. Wirth, Albrecht. Geschichte der Türken. Stuttgart 1912
Quellenverzeichnis
Kreutel, R. (Hrsg.) Kara Mustafa vor Wien. Das türkische Tagebuch der Belagerung Wiens 1683, verfaßt vom Zeremonienmeister der Hohen Pforte. (Kreutel, R. (Hrsg.) Osmanische Geschichtsschreiber. Band 1) Graz, Wien, Köln 1977
Abkürzungsverzeichnis
Jorga 1911 =
Jorga, N. Geschichte des Osmanischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt von N. Jorga. (Band 4) Gotha 1911
Matuz 1985 =
Matuz, J. Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte. Darmstadt 1985
Ritter von Sax 1908 =
Ritter von Sax, C. Geschichte des Machtverfalls der Türkei bis Ende des 19. Jahrhunderts und die Phasen der `orientalischen Frage` bis auf die Gegenwart. Wien 1908
Shaw 1976 =
Shaw, S. Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280- 1808. (History of the Ottoman Empire and the Modern Turkey. Volume 1) Cambridge 1976
Werner =
Werner, E. Das Osmanenreich im 17. Jahrhundert: Systemverfall und Systemstabilisierungsversuche. Werner, Markov 1978 =
Werner, E., Markov, W. Geschichte der Türken von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin 1978
Kreutel 1977 =
Kreutel, R. (Hrsg.) Kara Mustafa vor Wien. Das türkische Tagebuch der Belagerung Wiens 1683, verfaßt vom Zeremonienmeister der Hohen Pforte. (Kreutel, R. (Hrsg.) Osmanische Geschichtsschreiber. Band 1) Graz, Wien, Köln 1977
[...]
1 Kreiser, K. Der Osmanische Staat 1300-1922. (Oldenburg Grundriß der Geschichte. Band 30) München 2001, S. 81
2 Tietze, A. Mit dem Leben gewachsen. Zur osmanischen Geschichtsschreibung in den letzten fünfzig Jahren. In: Das Osmanische Reich und Europa 1683-1789. Konflikt, Entspannung und Austausch. (Heiss, G., Klingenstein, G. (Hrsg.) Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit. Band 10/1983) Wien 1983, S. 15-24
3 Ebd., S. 16
4 Ebd., S. 18
5 Majoros, F., Rill, B. Das Osmanische Reich. (1300-1922). Die Geschichte einer Großmacht. Graz, Wien, Köln, Regensburg 1994, S. 114
6 Werner, E., Markov, W. Geschichte der Türken von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin 1978, S. 73
7 Ebd., S. 74
8 Shaw, S., Shaw. E. Empire of the Gazis. The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808. (History of the Ottoman Empire and the Modern Turkey. Volume 1) Cambridge 1976, S. 125
9 Widerspruch wäre hier wahrscheinlich von Ritter von Sax zu erwarten, nach dem der Timariot nie mehr als 3 Mann zu stellen hatte. Geht man zusätzlich davon aus, daß er sich selbst für ca. 3000 Asper selbst auszurüsten hatte und knapp die 20000-Asper-Grenze erreichte, würde er auf einen Privatgewinn von etwa 8000 Asper kommen.
10 Matuz, J. Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte. Darmstadt 1985, S. 104
11 Ritter von Sax, C. Geschichte des Machtverfalls der Türkei bis Ende des 19. Jahrhun- derts und die Phasen der `orientalischen Frage` bis auf die Gegenwart. Wien 1908, S. 30
12 Shaw 1976, S. 127
13 Ritter von Sax 1908, S. 39
14 Werner, Markov 1978, S. 88
15 Werner, E. Das Osmanenreich im 17. Jahrhundert: Systemverfall und Systemstabilisierungsversuche., S. 67
16 Shaw 1976, S. 171
17 Ebd., S. 173
18 Werner, Markov 1978, S. 95
19 Matuz 1985, S. 177
20 Werner, S. 67
21 Matuz 1985, S. 179 f.
22 Ritter von Sax 1908, S. 74
23 Kreutel, R. (Hrsg.) Kara Mustafa vor Wien. Das türkische Tagebuch der Belagerung Wiens 1683, verfaßt vom Zeremonienmeister der Hohen Pforte. (Kreutel, R. (Hrsg.) Osmanische Geschichtsschreiber. Band 1) Graz, Wien, Köln 1977, S. 62
24 Es werden unterschiedliche Altersangeben gemacht; nach Peter Jaeckel zum Beispiel liegt das Einzugsalter zwischen 8 und 14 Jahren.
25 Shaw 1976, S. 113
26 Jaeckel, P. Die Bewaffnung des osmanischen Heeres., S. 115 13
27 Shaw 1976, S. 123
28 Werner, S. 76
29 Werner, S. 76
30 Jorga, N. Geschichte des Osmanischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt von N. Jorga. (Band 4) Gotha 1911, S. 158
31 Ritter von Sax 1908, S. 34f.
32 Ritter von Sax 1908, S. 35
33 Kreutel 1977, S. 55
34 Ebd., S. 38
35 Ebd., S. 15
36 Matuz 1985, S. 178
37 Shaw 1976, S. 209
38 Matuz 1985, S. 95
39 Ritter von Sax 1908, S. 37
40 Matuz 1985, S. 170
41 Werner, S. 66
42 Kreutel 1977, S. 41
43 Ebd., S. 43
44 Ebd., S. 56
45 Ebd., S. 75
46 Matuz 1985, S. 89
47 Jorga 1911, S. 197
48 Kreutel 1977, S. 95
49 Shaw 1976, S. 215
- Arbeit zitieren
- Grit Wagner (Autor:in), 2001, Der Niedergang des osmanischen Reiches. Gründe und Entwicklungslinien des Zerfalls im 17. Jahrhundert., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106715
Kostenlos Autor werden

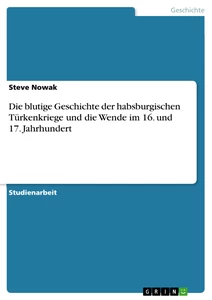



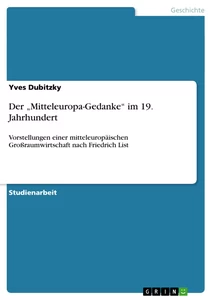




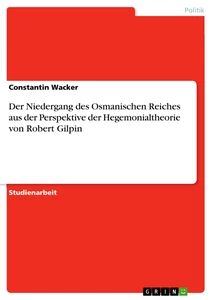
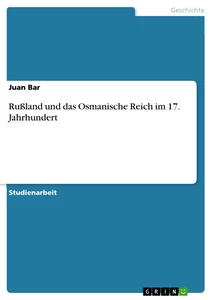


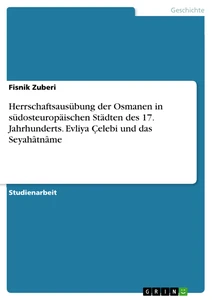
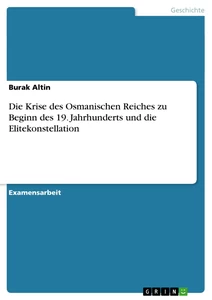


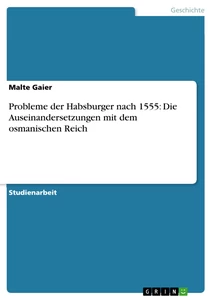
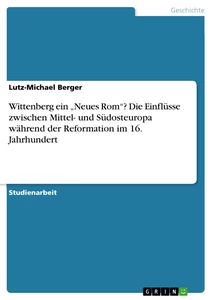
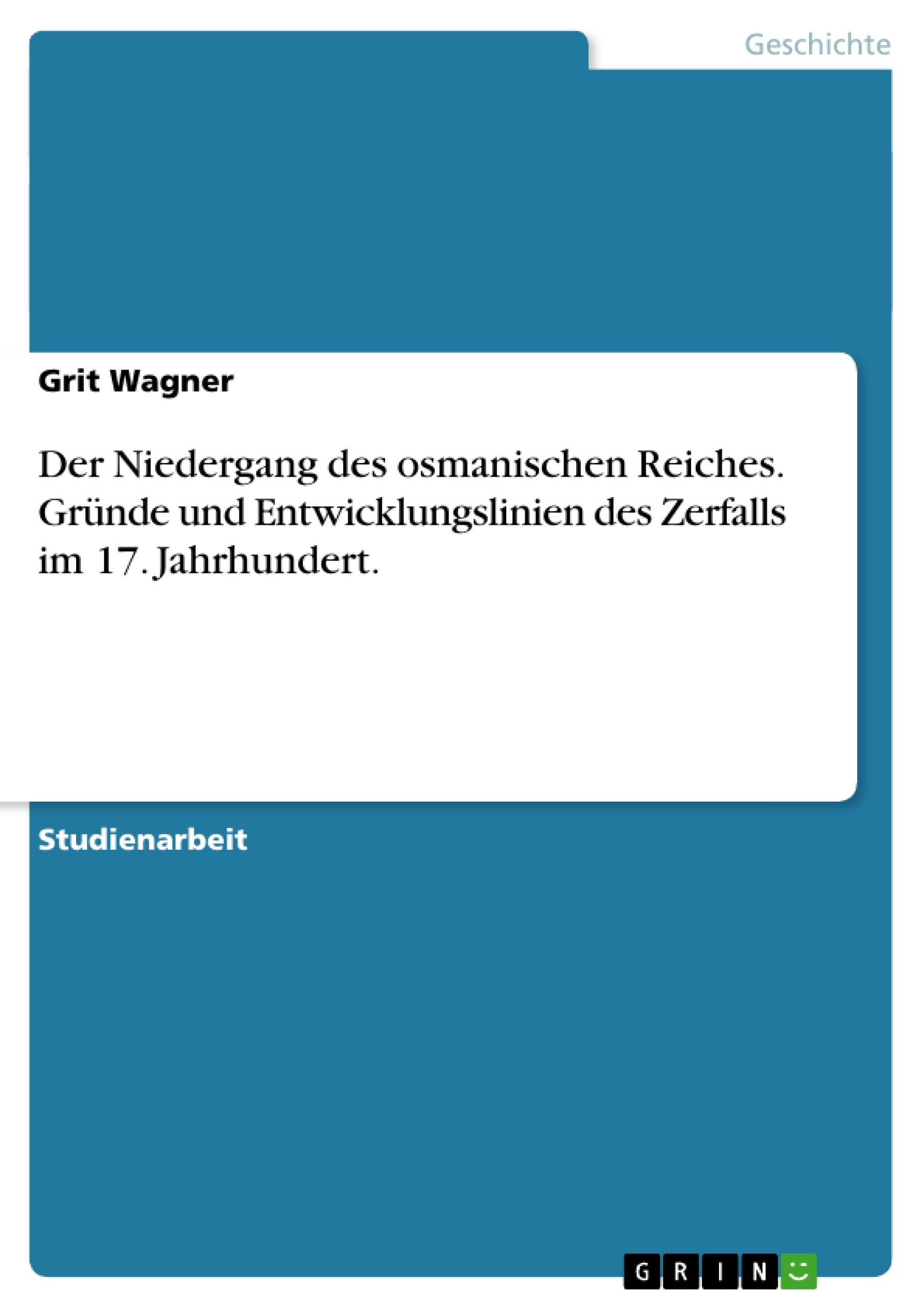

Kommentare