Leseprobe
Musiktheorie
1. Begriffsbestimmung/Definition von Musiktheorie
Der Begriff Theorie kommt aus dem griechischen (ϑεωρια) und bedeutet dort soviel wie Betrachtung, Untersuchung, Erklärung, Erkenntnis.1
Theorien gibt es in allen Geistes-, Gesellschafts-, und Naturwissenschaften, so z.B. die Relativitätstheorie in der Physik, die Literaturtheorie in den Literaturwissenschaften, die kritische Theorie in der Soziologie, der Philosophie und auch in der Musik. Im Laufe der Geschichte hat sich die Bedeutung dieses Begriffs stark verändert.2 So galt bei den Philosophen der antike Theorie als die kontemplative Betrachtung des Ganzen und Umfassenden, sie stellte damit die Krönung allen Denkens und allen Lebens dar. Die Denker des Mittelalters führten diese Auffassung fort und ergänzten sie vor allem um weitergehende theologische und spirituelle Aspekte. In der Aufklärung und dem damit entstehenden Wissenschaftsbild erfuhr der Begriff der Theorie zunächst eine radikale Abwertung. So forderte Francis Bacon z.B. die völlige Abschaffung aller Theorien und Allgemeinbegriffe. Bei Kant findet sich dann wieder eine Relativierung der Begriffe Theorie und Praxis:
„Man nennt einen Inbegriff selbst von praktischen Regeln ... Theorie, wenn diese Regeln als Prinzipien in einer gewissen Allgemeinheit gedacht werden, und dabei von einer Menge Bedingungen abstrahiert wird, die doch auf ihre Ausübung notwendig Einfluß haben.“3
In der Folgezeit existieren verschiedene Argumentationslinien nebeneinander, aber bereits Ende des 19. Jahrhunderts kam zum ersten mal eine gewisse historisierende Sichtweise von Theorie auf. Im 20. Jahrhundert wurde diese dann besonders in den Geisteswissenschaften anerkannt. Aber auch in der Physik ging man, aufgrund der durch Relativitäts- und Quantentheorie erzeugten gewaltigen Umbrüche, mehr und mehr dazu über, einen dynamischen (und damit die jeweilige historische Situation mitreflektierenden) Begriff von Theorie zu verwenden.
Stark vereinfachend gesagt, versucht Musiktheorie, allgemeingültige Prinzipien und Grundlagen hinter den musikalischen Erscheinungen zu erkennen, zu systematisieren und in Beziehung zueinander zu setzen.4
Der genaue Gegenstandsbereich der Musiktheorie lässt sich unterschiedlich bestimmen, zur Veranschaulichung der Bandbreite an Definitionsmöglichkeiten möchte ich hier zwei Beispiele anführen:
Tabelle 1: Allgemeinere Definition5
1.Theorie
A. Wissenschaft: 1. Mathematik, 2. Physik, 3. Psychologie, 4. Physiologie, 5. Anthropologie, 6. Soziologie
B. Technik: Parameter: 1. Tonhöhe, 2. Tondauer, 3.Tonfarbe
C. Kritik: 1. Analyse, 2. Ästhetik, 3. Bewertung
D. Historie
2.Praktisch
A. Kreativ: 1. Komposition, 2. Improvisation, 3. Synthetisch
B. Pädagogik: 1. Melodie, 2. Harmonie, 3. Kontrapunkt, 4. Orchestrierung etc.
C. Aufführung: 1. Instrumental, 2. Vokal, 3. Elektronisch oder Mechanisch, 4.Dramatisch und Choreographisch
D. Funktional: 1. Pädagogisch (z.B: Kinderlieder), 2. Therapeutisch, 3. Politisch, 4. Militärisch etc.
Der „theoretische“ Teil beschäftigt sich mit den naturgegebenen Grundlagen der Musik und den künstlich aufgestellten Prinzipien (Harmonielehre, Stimmung etc.).Der „praktische“ Teil beinhaltet vor allem die Theorie der Komposition und der Aufführung.6 Die Gesamtheit der in Tabelle 1 aufgeführten Gegenstandsbereiche wird auch als Musikwissenschaft angesehen.7
Eine eher engere und auch gängigere Darstellung der Bestandteile von Musiktheorie ist die Folgende:
Tabelle 2: Unterteilung der Musiktheorie und ihre wichtigsten Vertreter8
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Kenntnis dieser musiktheoretischen Disziplinen ist zum Teil als Vorbildung zum selbständigen Komponieren von großem Vorteil, in der Hauptsache dienen sie allerdings zur adäquaten und umfassenden Analyse von musikalischen Werken des westlichen Kulturkreises.
Hier wird auch der enge Bezug zwischen Musiktheorie und Praxis sichtbar, da u.a. namhafte Komponisten vertreten sind (Jean-Philippe Rameau, Hector Berlioz).
2. Geschichte der Musiktheorie in Europa
2.1.: Musiktheorie in der Antike
Die Musiktheorie wurde in der Antike in Beziehung zur Mathematik und zur Kosmologie gesehen. Sie diente auch zur moralischen Bildung des Individuums, indem sie die harmonischen Bewegungen des Kosmos widerspiegeln sollte. Diese Harmonie würde, so glaubten die Griechen, auch den Menschen zu einer seelischen Harmonie führen und dadurch ausgeglichen und gerecht werden lassen.9
Die theoretischen Leistungen der Griechen sind vor allem auf dem Gebiet der Intervall- und Konsonanzlehre und der Entwicklung eines Tonsystems, welches die Oktave in 12 Halbtonschritte teilt, zu erkennen. Bei diesem Tonsystem spielte der Tetrachord, also mehrere Töne mit einer Quarte als Rahmenintervall, eine große Rolle. Diese wurde gewählt, weil sie als kleinstes der sog. einfachen Intervalle (Oktave, Quinte, Quarte; Zahlenverhältnisse: 2:1 ; 3:2 ; 4:3) angesehen wurde.10 Zwei zusammengesetzte und gleich geteilte Tetrachorde ergaben dann die Tonleiter.11 Die wichtigste Teilung des Tetrachords bestand aus zwei Ganztonschritten und einem Halbtonschritt. Setzt man zwei solcherart aufgebaute Tetrachorde zusammen, so erhält man eine Intervallreihenfolge wie bei unserer heute gebräuchlichen Durtonleiter (Intervallfolge: 1-1- ½ -1-1- ½ ), bei den Griechen wurde sie die dorische Tonart genannt. Ein wichtiger Unterschied zur Durtonleiter bestand allerdings darin, dass diese Tonleiter von oben nach unten gedacht wurde (also auf der Klaviatur alle weißen Tasten von e beginnend eine Oktave nach unten). Weiterhin existierten die Tetrachordteilungen Ganzton - Halbton - Ganzton ( 1- ½ -1, phrygische Tonart) und Halbton - zwei Ganztöne ( ½-1-1, lydische Tonart). Diese Tonarten konnten auf verschiedene Tonhöhen transponiert werden. Außerdem bestand die Möglichkeit, bei der Teilung der Quarte auf das chromatische und das enharmonische Tongeschlecht zurückzugreifen.12
Die Intervall- und Konsonanzlehre wurde hauptsächlich von den Pythagoräern entwickelt. Man versuchte, alle Intervalle auf mathematischem Wege als Verhältnis zweier Zahlen darzustellen. Diese Zahlenverhältnisse sollten als Formel der Form (n+1):n darstellbar sein.13
Im Bereich der Rhythmuslehre und der Notenschrift blieb die griechische Musiktheorie hingegen ohne großen Einfluss.14
Die wichtigsten Theoretiker der Antike waren auf der einen Seite Pythagoras bzw. dessen Schüler (um 6. Jh. vor Chr.), welche sich stark auf die Mathematik (-> ratio) beriefen und mit deren Hilfe, wie oben bereits erwähnt, die Grundlage zu einer exakten Intervallehre lieferten.15 Eine Gegenposition dazu nahm Aristoxenes (354-300 vor Chr.), ein Schüler des Aristoteles ein. Im Gegensatz zu den Pythagoräern stützte er seine theoretischen Überlegungen nicht so sehr auf die Mathematik, sondern auf die Hörerfahrung (sensus). Ihm gelangen wichtige Beiträge zur Entwicklung des griechischen Tonsystems.16
Über den Bezug der griechischen Musiktheorie zur musikalischen Praxis ist nicht viel bekannt, allerdings ist anzunehmen, dass viele theoretische Überlegungen in der damaligen Zeit eher von Theoretikern für Theoretiker geschrieben wurden und die praktischen Musiker nicht erreicht wurden.17
2.2.: Frühes Mittelalter
Auch im Mittelalter wurde die Musiktheorie zur Mathematik gezählt, allerdings begannen nun vermehrt theologische Aspekte eine Rolle zu spielen. Musiktheorie war eine Teildisziplin der artes liberales (freie Künste).18 Diese bestanden aus den drei sprachlichen Teilgebieten Grammatik, Rhetorik, Dialektik (zusammengefasst auch Trivium („Dreiweg“) genannt) und den vier mathematischen Teilgebieten Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musiktheorie (diese wurden zusammen als Quadrivium („Vierweg“) bezeichnet). Die artes liberales musste jeder beherrschen, bevor er ein höheres Studium (z.B. Theologie, Philosophie, Jura oder Medizin) beginnen konnte.
In der Musiktheorie wurden acht verschiedene Modi oder Kirchentonarten unterschieden: 1. und 2. Modus endeten auf d (man spricht hier vom Finalis auf d), wobei im ersten Modus die Repercussa (wichtigster Ton der Melodie) um eine Quinte höher (also auf a) lag, im zweiten Modus lag sie eine Terz höher (also auf f). Der Ambitus im ersten Modus reichte von d aus eine Oktave nach oben, nach unten wurde das d höchstens um eine Sekunde unterschritten. Im zweiten Modus reichte der Ambitus eine Quinte über das d und eine Quarte von d nach unten. Analog zum 1. wurden der 3. (auf e), 5. (auf f, allerdings mit vorgezeichnetem b), und 7. (auf g) Modus gebildet, mit der Ausnahme, das im 3. Modus die Repercussa auf c, also eine Sexte über der Finalis e lag. Der 4. (Finalis e), 6. (Finalis f, mit b) und 8. (Finalis g) sind dem 2. Modus ähnlich; allerdings lag die Repercussa im 4. und 8. Modus eine Quarte über der Finalis (also auf a bzw. auf c).19
Abbildung 1: Die 8 Modi.20
Erläuterung: Die ganzen Noten bezeichnen die Finalis, rhombische Noten die Repercussa. Ausgefüllte Noten stellen den Ambitus, die Noten in Klammern mögliche Erweiterungen davon dar.
Neben diesen durchaus praxisrelevanten Überlegungen wurde aber auch viel Wert auf rein spekulative theoretische Überlegungen gelegt, welche auf mathematischer Berechnungen basierten. Man begründete dies mit der Annahme einer musica mundana und einer musica humana. Die erstgenannte war quasi die „stumme“ Musik des Kosmos bzw. der Planeten, die sich in bestimmten Zahlenverhältnissen widerspiegelte, die zweite bezog sich auf die Proportionen des menschlichen Körpers. Musik wurde also eher nicht als klangliches Ereignis angesehen, sondern als ein zur Kontemplation dienendes Teilgebiet der Mathematik.21 So errechneten mittelalterliche Theoretiker z.B. Vierteltoneinteilungen der Oktave, welche in der damaligen Praxis keinerlei Relevanz besaßen.
Wichtige Theoretiker waren: Boethius, welcher durch seine Übersetzungen griechischer Theoretikertexte in das Lateinische großen Einfluss auf die gesamte mittelalterliche Musiktheorie ausübte, dessen Schriften allerdings nichts mit der damals üblichen Musizierpraxis zu tun hatten, und Guido von Arezzo, der als erster ein Notationssystem mit Notenlinien im Terzabstand entwickelte und im Bereich des Choralgesanges durch Einführung der Solmisationssilben das Erlernen neuer Melodien erleichterte, dessen theoretische Überlegungen also in einem durchaus engen und einflussreichen Bezug zur Praxis standen.22
2.3.: Spätes Mittelalter und Renaissance
Im 14. Jahrhundert fand eine Entwicklung hin zur polyphonen Satzweise statt. Die Musiktheorie begann sich nun mit der Aufstellung von Regeln zu beschäftigt, die für mehrstimmige Kompositionen zu gelten haben.23 Man unterschied perfekte Konsonanzen (Prime, Oktave, Quinte), imperfekte Konsonanzen (große und kleine Terz, große und kleine Sexte) und Dissonanzen (Quarte, Sekunde, Septe und alle alterierten, also übermäßigen oder verminderten Intervalle). Ob nun eine Konsonanz verwendet werden musste oder eine Dissonanz zwischen den einzelnen Stimmen bestehen durfte, richtete sich danach, ob der Zusammenklang auf betonter oder unbetonter Taktzeit lagt. Des weiteren galten noch einige Verbote, die den linearen Verlauf der Stimmen betrafen. So dürften zwei Stimmen z.B. nicht in parallelen Oktaven (Quinten, Primen) fortschreiten, da in der Oktave (der Quinte, der Prime) der Verschmelzungsgrad der beiden Stimmen sehr hoch ist (->perfekte Konsonanz) und durch eine parallele Bewegung die Unabhängigkeit der Stimmen aufgehoben werden würde. Auch waren übermäßige oder verminderte Intervalle aufgrund ihrer Unsanglichkeit zunächst verboten und später nur in Sonderfällen gestattet. Hinzu kamen noch einige weitere Regeln, welche sich aber von Komponist zu Komponist und von Theoretiker (in der damaligen Zeit war jeder Theoretiker auch gleichzeitig Komponist)24 zu Theoretiker unterschieden.
Die kontrapunktische Kompositionsweise ist ohne theoretisches Fundament undenkbar.25 Allerdings wurde sie im 16. Jahrhundert zunehmend kritisiert, da durch die unabhängigen Stimmen die Musik keinem eindeutigen Ausdruck mehr zuzuordnen war.26 Man sprach vom „barbarischen Kontrapunkt“, der eine humane, einfache und expressive Musik verhindere. Um diese Expressivität zu erreichen, wurden die Kompositionen chromatisch erweitert (wichtigster Vertreter: Carlo Gesualdo), das System der Kirchentonarten verlor dadurch immer mehr an Bedeutung.
Wichtige Theoretiker:
- Johannes Tinctoris lieferte eine umfassende Darstellung des theoretischen Wissens seiner Zeit (Ende des 15. Jahrhunderts).27
- Glarean erweiterte im 16. Jahrhundert die Kirchentonarten auf 12 Modi und gab ihnen die bis heute gebräuchlichen antiken Namen (dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, äolisch, lokrisch, ionisch).28
- Vincenzo Galilei war überzeugter Humanist und führender Kritiker der polyphonen Musik (siehe oben). Er konstatierte auch als einer der ersten die Bedeutungslosigkeit der mittelalterlichen Kirchentonarten.29
- Listenius entwickelte eine Dreiteilung, die zwischen der musica theorica (Musiktheorie) , musica practica (praktische Ausübung von Musik) und musica poetica (Komposition) unterschied. Wie der Name schon andeutet, wurde die Kompositionslehre nun nicht mehr in Beziehung zur Mathematik gesehen, sondern orientierte sich verstärkt an der Poetik und der Rhetorik, was dann vor allem im Zeitalter des Barock zur Ausprägung einer umfassenden musikalisch-rhetorischen Sprache führte.30
- Gioseffo Zarlino beschäftigte sich bereits mit Dreiklängen und erklärte allein den Dur- und den Molldreiklang zu naturgegebenen Harmonien.31
2.4.: Barock
Aus der Praxis des Generalbassspiels entwickelte sich im Barock die dur-moll-tonale Harmonik, die in Jean Philippe Rameaus „Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels“ theoretisch fundiert wurde. Rameau bezog sich dabei auf die Entdeckung der Obertonreihe. Er leitete seine Überlegungen also aus einer physikalischen Entdeckung ab, die Physik (und damit die natürlichen Grundlagen) wurde zur neuen Bezugswissenschaft der Musiktheorie, die reine Mathematik, welche immer wieder den Anstoß zu spekulativen Überlegungen gegeben hatte, spielte zu dieser Zeit keine große Rolle mehr.32 Die Akkorde im dur-moll-tonalen System bestehen aus Terzen. Von unten nach oben aufgebaut ergibt eine große und eine kleine Terz einen Durdreiklang, eine kleine und eine große Terz einen Molldreiklang, zwei kleine Terzen einen verminderten Dreiklang und zwei große Terzen einen übermäßigen Dreiklang. Der Bass bildete das Fundament der Harmonie. Lag im Bass ein anderer Ton als der Grundton des Akkordes, so sprach man von Umkehrungen, welche dem Akkord einen anderen Klangcharakter gaben. Des weiteren waren Vier- und Fünfklänge Bestandteil des dur-molltonalen Systems.
Als Beispiel für die Denkweise der rameauschen Schriften hier nun die Herleitung des Durund des Molldreiklangs:
Der Durdreiklang erscheint in der Obertonreihe eines Tones als 4, 5 und 6 Ton. In der Obertonreihe auf C besteht dieser Akkord also aus c’-e’-g’.33
Die Herleitung des Molldreiklangs gestaltete sich als schwieriger.
In seiner ersten theoretischen Schrift (->Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels) baut Rameau den Molldreiklang aus dem 10., 12. und 15. Ton der Obertonreihe auf. Bei der Obertonreihe von C wäre das der Akkord e’’-g’’-h’’.34 Problematisch an dieser Herleitung ist, dass der Grundton diese Mollakkordes nicht mit dem der zugrundegelegten Obertonreihe übereinstimmt.35 Deshalb versuchte Rameau auch in der Folgezeit, den Molldreiklang auf verschiedene andere Arten zu erklären, was ihm allerdings nicht gelang. Selbst bis in die heutige Zeit wurde keine konsistente physikalische Erklärung des Molldreiklangs gefunden.36
Ein anderes, sehr praxisnahes Problem, mit dem sich die Musiktheorie dieser Zeit beschäftigte, war das Problem der Stimmung von Tasteninstrumenten.37 Dieses resultiert daraus, dass zwölf aufeinandergeschichtete Quinten, die alle zwölf Halbtöne innerhalb einer Oktave enthalten (also z.B. die Reihe C, G, d, a, e’, h’, fis’’, cis’’’, gis’’’, dis’’’’, ais’’’’, eis’’’’’, his’’’’’) etwas größer (ca. 23,5 Cent)38 sind als sieben aufeinandergeschichtete Oktaven (in unserem Beispiel von C bis c’’’’’’; das c’’’’’’ der Oktaven ist also um ca. 23,5 Cent tiefer als das his’’’’’ der Quinten, müssten auf einem Tasteninstrument aber auf einer Taste liegen). Dies gleichte man dadurch aus, das man eine Reihe von zwölf absteigenden Quinten vom letzten Ton der Oktavreihe aus bildete ( Beispiel: c’’’’’’, f’’’’’, b’’’’, es’’’’, as’’’, des’’’, ges’’, ces’’, fes’, heses, eses, Asas, Deses) und nun zwischen den beiden Tönen, die auf eine Taste fielen, den Mittelwert bildete. Diesen Vorgang nannte man Temperierung. Er wurde übrigens bereits vorher bei den Chinesen, die die Oktave auch in zwölf Tonschritte unterteilen, und in der Antike theoretisch begründet. Wichtige Leistungen erbrachten auf diesem Gebiet der Musiktheorie Werckmeister und Johann Philip Kirnberger, ein Schüler Johann Sebastian Bachs.
2.5.: 18. und 19. Jahrhundert
Durch die aufkommende Genieästhetik, die es dem einzelnen schöpferischen Individuum erlaubte, sich über alle Regeln des Tonsatzes hinwegzusetzen, falls der eigene Wille und das eigene Empfinden dies verlangten, wurde das Ansehen der Musiktheorie immer weiter geschwächt. Sie war nun nicht mehr dazu da, ein System von Regeln und philosophischen Gedanken aufzustellen, deren Erfüllung ein Werk dann in ästhetischer Hinsicht rechtfertigte. Vielmehr diente sie nun als Kompositionspropädeutikum.39 Aber es begann sich auch schon eine Entwicklung abzuzeichnen, die im 20. Jahrhundert dann zu einem der wichtigsten Einsatzgebiete der Musiktheorie avancierte: Die Analyse einzelner Kunstwerke und das Auffinden des jeweils Besonderen daran rückte in den Mittelpunkt des Interesses.40 Dazu war ein umfassendes musiktheoretisches „Analysewerkzeug“ nötig, dessen Bestandteile dann auf jedes zu analysierende Werk individuell zugeschnitten wurden. Ein Zitat von A. B. Marx bringt dies zum Ausdruck:
„die rechte Theorie ist nichts anderes, als das Bewusstsein von der Kunst, das niemals dem rechten Künstler, wohl aber dem Routinier und Handwerker fehlt. Man lese nur Gluck, und [...] Mozart, man frage bei Beethoven und Haydn an.“41
In der Nachfolge Rameaus beschäftigte man sich nun intensiver mit der Harmonielehre. Ihr galt das Hauptinteresse der Musiktheoretiker jener Zeit.42 Den entscheidensten Fortschritt auf diesem Gebiet erzielte dabei Hugo Riemann mit der Entwicklung der Funktionentheorie.43 Sie ist der Versuch, die musikalische Logik oder Grammatik, die in einer (dem dur-moll-tonalen System verpflichteten) Komposition steckt, zu erfassen. Dabei wird jeder Akkord eines Stückes auf eine der drei Hauptfunktionen der Kadenz, Tonika, Subdominante und Dominante, zurückgeführt und als deren Stellvertreter angesehen. Ein Stück besteht demnach aus einer - freilich variierten - Abfolge von Kadenzen.
Aber auch auf anderen Gebieten der Musiktheorie wurden wichtige Beiträge geleistet. So entstanden im 18. Jahrhundert vermehrt theoretische Schriften zur instrumentalen Praxis jener Zeit (so z.B: Carl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen; Johann Mathesson: Der vollkommene Kapellmeister; Leopold Mozart: Versuch eines gründlichen Violinspiels; Johann Joachim Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen).
Des weiteren gab es neue Impulse bei der theoretischen Fundierung von Rhythmus und Metrum, vor allem durch Joseph Riepel, Heinrich Christoph Koch und Hugo Riemann.44 Als Kompositionspropädeutikum erreichte das theoretische Lehrwerk Gradus ad Parnassum von Johann Joseph Fux, das sich mit der kontrapunktischen Satzweise beschäftigte, großen Einfluss.45 Auch zur Komponistenausbildung, allerdings auf einem anderen Teilgebiet wurde das Lehrwerk Versuch einer Anleitung zur Komposition von Heinrich Christoph Koch konzipiert. Darin beschäftigte sich der Autor umfassend mit den damals gebräuchlichen musikalischen Kompositions- und Satzformen, so zum Beispiel mit der Sonatensatzform oder der Konzertform, es handelt sich hierbei also um eine der ersten umfassenden Formenlehren überhaupt.46 Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang die Instrumentationslehre von Hector Berlioz, die sich wohl hauptsächlich an Komponistenkollegen wandte und von Richard Strauss für dermaßen konsistent erachtet wurde, dass er sie, mit eigenen Anmerkungen versehen, über ein halbes Jahrhundert später noch einmal herausgab.
2.6.: 20. Jahrhundert
Im 20. Jahrhundert ging man mehr und mehr dazu über, die Musiktheorie historisch aufzufassen.47 Es wurde angenommen, dass es keine über alle Zeiten und in allen Kulturen gültige Musiktheorie gäbe, sondern dass man Musiktheorie immer im Kontext der jeweiligen kulturellen, sozialen, politischen, etc. Bedingungen betrachten müsse. Bereits Arnold Schönberg nimmt in seiner Harmonielehre eine solche Position ein:
„Gäbe sich die Kunsttheorie damit [dem suchen nach den Gesetzen in der Musik] zufrieden, begnügte sie sich mit dem Lohn, den ehrliches Suchen gewährt, so könnte man nichts gegen sie einwenden. Aber sie will mehr sein. Sie will nicht sein: der Versuch, Gesetze zu finden; sie behauptet: d i e e w i g e n Gesetze gefunden zu haben. Sie beobachtet eine Anzahl von Erscheinungen, ordnet sie nach einigen gemeinsamen Merkmalen und leitet daraus Gesetze ab. Das ist ja schon deshalb richtig, weil es leider kaum anders möglich ist. Aber nun beginnt der Fehler. Denn hier wird der falsche Schluss gezogen, dass diese Gesetze, weil sie für die bisher beobachteten Erscheinungen scheinbar zutreffen, nunmehr auch für alle zukünftigen Erscheinungen gelten müssten. Und das Verhängnisvollste: man glaubt einen M a ß s t a b zur Ermittlung des Kunstwerts auch künftiger Kunstwerke gefunden zu haben.“48
Schönberg steht in der Tradition der romantischen Genie-Ästhetik, für ihn ist alle Theorie letztendlich grau, er lehnt alle verbindlichen Regeln für das Komponieren ab.(Seine Zwölftontechnik stellt für ihn nur eine von vielen Arten dar, strukturiert zu komponieren.)
Allerdings kam das „Suchen“ nach allgemeingültigen Gesetzen nicht zum erliegen. So entwickelte Ernst Kurth eine Musiktheorie, die sich der Musik auf eine bis dahin unbekannte Weise näherte. Kurth fasste Musik als Bewegung auf, das Eigentliche der Musik spiele sich zwischen den Noten und zwischen den Klängen ab.49 Das zentrale Augenmerk wurde auf den Übergang zwischen einzelnen Tönen gerichtet, das Wesen der Musik sei dynamisch, nicht akustisch.50 Dadurch wird die horizontale, zeitliche Komponente der Musik in bewusstem Gegensatz zur vorwiegen an der Harmonik ausgerichteten Musiktheorie des 19. Jahrhunderts stärker betont. Des weiteren spielte die Psychologie eine entscheidende Rolle in der Kurthschen Musiktheorie. Letztendlich wirke jede Musik vor allem im Unterbewusstsein („Der Ursprung aller Melodik vollzieht sich im Unbewussten, wie der weitaus größte Teil aller Lebensbetätigung“51 ). Folgendes Zitat veranschaulicht eindrucksvoll die Grundlagen Kurthschen Denkens:
„Alles Erklingende an der Musik ist nur emporgeschleuderte Ausstrahlung weitaus mächtigerer Urvorgänge, deren Kräfte im Unhörbaren kreisen. In ihnen liegt auch die Naturgewalt aller Harmonik, nicht aber im Tönespiel, dessen farbig leuchtende Bewegtheit überhaupt nur in Spiegelungen psychischer, aus dem unterbewussten Tiefenbereich ausbrechender Energien ersteht“52
Eine andere Tendenz musiktheoretischen Denkens im 20. Jahrhundert bildete die theoretische Fundierung einzelner Werke oder Werkgruppen durch die Komponisten selber.53 Hierzu ist unter anderem Paul Hindemiths Lehrwerk Unterweisung im Tonsatz zu zählen, auch wenn der Verfasser ursprünglich den Versuch unternommen hatte, „Grundzüge des Tonsatzes“ aufzuzeigen, „wie sie aus der natürlich Beschaffenheit der Töne sich ergeben und deshalb alle Zeit Gültigkeit haben.“54 Auch das Buch Technique de mon language musical von Olivier Messiaen beschäftigt sich mit theoretischen Überlegungen zur eigenen Kompositionstechnik, ohne universal gültigen Anspruch erheben zu wollen.
Durch Einbeziehung der Computertechnik versuchte man auf der Basis mathematischer und informationstheoretischer Überlegungen auf versteckte Strukturen in Kompositionen verschiedenster Stilrichtungen zu stoßen (Milton Babbitt, Allen Forte).55 Die Ergebnisse sind umstritten. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die „Unhörbarkeit“ der Erkenntnisse: Als Zuhörer wird man nichts von den versteckten Strukturen, die mit Hilfe von Computern entdeckt wurden, erkennen.
3. Musiktheorie als Hochschulfach
Musiktheorie ist an Hochschulen und Universitäten Bestandteil der Studiengänge zum Berufsmusiker, zum Musikpädagogen und zum Musikwissenschaftler.56 Problematisch hierbei ist die Tatsache, dass diese drei Studiengänge aus sehr unterschiedlichen Gründen einen musiktheoretischen Bestandteil haben:
Für Berufsmusiker geht es vor allem um eine praxisorientierte Ausrichtung, die schöpferische Impulse für das eigene künstlerische Schaffen vermittelt.
Musikpädagogen sollen zum einen dazu befähigt werden, ein musikalisches Kunstwerk adäquat zu analysieren, in seiner Besonderheit zu erfassen und dies auch den Schülern weiterzuvermitteln, zum andern sollen sie in der Lage sein, kleinere Arrangements und eigene Kompositionen zu schreiben, um diese dann z.B. bei Schulkonzerten durch den Schulchor, die Schulband oder das Schulorchester aufführen zu lassen.57 Wie dieser Punkt unter Musiklehrern angesehen wird, zeigt eine repräsentative Umfrage durch Schaffarth und anderen: Demnach erachteten im Jahre 1978/79 15,2% aller Musiklehrer die Vermittlung von allgemeiner Musiklehre (also unter anderem der Musiktheorie) als sehr wichtig, 63,7% hielten sie für wichtig, 5,8% für unwichtig und 0,5% für völlig unwichtig. 14,8% blieben unentschieden.58 Es zeigte sich also, daß nur ein geringer Anteil der Musiklehrer (6,3%) der Musiktheorie gegenüber kritisch eingestellt war.
Für Musikwissenschaftler schließlich zählt die Musiktheorie zum Forschungsgebiet. Aber auch bei ihnen stellt der Einsatz eines „funktionierenden Werkzeugs“ zur Einzelanalyse musikalischer Werke einen essentiellen Bestandteil der später möglichen Tätigkeiten dar. Allen drei Studiengängen gemeinsam ist allerdings der Vorteil, den man aufgrund theoretischen Wissens im Gehörbildungsunterricht erlangt, da man alle auf einem bestimmten historischen Stil beruhenden satztechnischen Unmöglichkeiten bereits im Voraus ausschließen kann.59
Verfolgt man die Bedeutung, die der Musiktheorie als Unterrichtsfach an Hochschulen und Universitäten zukam, so lässt sich erkennen, dass sich ihr Selbstverständnis von einer reinen Handwerkslehre hin zu einer Verstehenslehre gewandelt hat. So galt Musiktheorie bis in die 60ger als Kompositionspropädeutikum, die es künftigen Lehrern, Chorleitern etc. ermöglichen sollte, auf solider satztechnischer Basis eigene Stücke zu komponieren bzw. zu improvisieren. Grundlagen für den Unterricht bildeten in der Harmonielehre die Schriften Rameaus, in der kontrapunktischen Satzlehre das Lehrwerk Gradus ad Parnassum von Johann Joseph Fux.
Als man dann zunehmend zur musikalischen Analyse überging, versuchte man die Harmonielehre und die kontrapunktische Satzlehre zunehmend auf historisch „wirkliche“ Musik zurückzuführen. (z.B: Palestrina-Kontrapunkt, Bachscher Kontrapunkt, Tristan- Harmonik etc.). Dies erwies sich allerdings als äußerst kompliziert und ist deshalb pädagogisch fragwürdig.
Auch die Rolle der Musiktheorie im Kompositionsunterricht ist umstritten: Auf der einen Seite sieht man den Musiktheorieunterricht als wichtiges Kompositionspropädeutikum an, welcher den Studenten vor allzu viel Herumsucherei und den damit verbundenen Rückschlägen bewahrt. Auf der anderen Seite argumentiert man mit einer möglichen Einschränkung der kompositorischen Einbildungskraft durch den Musiktheorieunterricht.60 Abschließend ist zu sagen, dass Theorieunterricht als Hochschul- und Universitätsfach notwendig ist. Allerdings sollten die Inhalte und Anforderungen auf den jeweiligen Studiengang zugeschnitten sein, um eine unangemessene Überfrachtung der Studenten mit letztendlich für ihren späteren Beruf belanglosen Aspekten der Musiktheorie zu verhindern.
[...]
1 Dahlhaus, Theorie der Musik. In: Riemann Musiklexikon 1967, S. 954
2 Folgender Abschnitt zur Geschichte des Theoriebegriffs stellt eine Zusammenfassung dar von : König/ Pulte: Theorie. In: Historisches Handbuch der Philosophie 1998, Sp. 1128 - 1154
3 Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Th. Richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, 1793, zitiert in: König/ Pulte: Theorie. In : Historisches Handbuch der Philosophie 1998, Sp. 1136
4 Kühn, Musiktheorie. In: Das große Lexikon der Musik, 1981, S. 431
5 Palisca, Theory, theorists. In: The new Grove dictionary of music and musicians, 1980, S. 741, frei nach Aristides Quintilianus
6 Sachs, Musiktheorie. In: MGG 2, 1997, Sp. 1719
7 Palisca, Theory, theorists. In: The new Grove dictionary of music and musicians, 1980, S. 741
8 Kühn, Musiktheorie. In: Das große Lexikon der Musik, 1981 S. 431
9 Michels, dtv-Atlas Musik, 1977, S. 175
10 Sachs, Musiktheorie. In: MGG 2, 1997, Sp. 1718
11 Der folgende Abschnitt frei nach: Michels, dtv-Atlas Musik Band 1, 1977, S. 176 - 177
12 Die Begriffe chromatisch und enharmonisch hatten in der antiken Musiktheorie eine andere Bedeutung als in der heute üblichen Terminologie.
13 Sachs, Musiktheorie. In: MGG 2, 1997, Sp. 1718
14 Ebd., Sp. 1719
15 Ebd., Sp. 1718
16 Palisca, Theory, theorists. In: NGroveD, 1980, S. 742
17 Palisca, Theory, theorists. In NGroveD, 1980, S. 742
18 Sachs, Musiktheorie, MGG 2, 1997, Sp. 1719
19 Meier, Alte Tonarten, 1992, S. 14 - 19
20 Meier, Alte Tonarten, 1997, S. 17
21 Sachs, Musiktheorie. In: MGG 2, 1997, Sp. 1720
22 Ebd., Sp. 1720 - 1724 und Palisca, Theory, theorists. In: N GroveD 1980 S. 744 - 747
23 Der folgende Abschnitt nach: Michels, dtv-Atlas Musik, 1977, S. 92 - 95
24 Berhard Meier: Alte Tonarten
25 Dahlhaus, Theorie der Musik. In: Riemann Musiklexikon, 1967, S. 954
26 Palisca, Theory, theorists. In: N GroveD, 1980, S. 755
27 Palisca, Theory, theorists. In: N GroveD, 1980, S. 752 - 754
28 Meier, Alte Tonarten, 1992, Sp. 18 - 19
29 Palisca, Theory, theorists. In: N GroveD, 1980, S. 755
30 Sachs, Musiktheorie. In: MGG 2, 1997, Sp. 1727 - 1728
31 Palisca, Theory, theorists, In: N GroveD, 1980, S. 754 - 755 und Michels, dtv-Atlas Musik, 1977, S. 251
32 Kühn, Musiktheorie. In: Das große Lexikon der Musik, 1981, S. 431 und Dahlhaus, Theorie der Musik. In: Riemann Musiklexikon, 1967, S. 954
33 Rameau, Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, 1722, S. 36
34 Ebd.
35 Dachs/ Söhner, Harmonielehre: Erster Teil, 1953, S. 147
36 Ebd., S. 147 - 148
37 Der folgende Abschnitt: Michels, dtv-Atlas Musik, 1977, S. 88 - 91
38 Definition der Maßeinheit Cent: 1 temperierter Halbtonschritt = 100 Cent
39 Kühn, Musiktheorie. In: Das große Lexikon der Musik, 1981, S. 431
40 Sachs, Musiktheorie. In: MGG 2, 1997, Sp. 1731
41 zitiert in: Ebd.
42 Palisca, Theory, theorists. In: N GroveD, 1980, S. 758
43 Velten, Musiktheorie. In: Kompendium der Musikpädagogik, 1995, S. 139 - 141 und Sachs, Musiktheorie. In: MGG 2, 1997, Sp. 1732
44 Palisca, Theory, theorists. In: N GroveD, 1980, S. 759
45 Velten, Musiktheorie. In: Kompendium der Musikpädagogik, 1995, S. 142
46 Ebd., S. 758 - 759
47 Kühn, Musiktheorie. In: Das große Lexikon der Musik, 1981, S. 431
48 Schönberg, Harmonielehre, 1922, S. 2 - 3
49 Krebs, Innere Dynamik und Energetik in Ernst Kurths Musiktheorie, 1998, S. 27 ff
50 Ebd., S. 29
51 Kurth, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners Tristan, 1920 zitiert in: Krebs, Innere Dynamik und Energetik in Ernst Kurths Musiktheorie, 1998, S. 63
52 Ebd.
53 Sachs, Musiktheorie. In: MGG 2, 1997, Sp. 1733
54 zitiert in: Velten, Musiktheorie. In: Kompendium der Musikpädagogik, 1995, S. 142
55 Palisca, Theory, theorists. In: N GroveD, 1980, S. 760
56 Velten, Musiktheorie. In: Kompendium der Musikpädagogik, 1995, S. 141
57 Bergmann, Harmonie und Funktion in den Klavierwerken von Sigfrid Karg-Elert, 1991, S. 395
58 H. Schaffrath, E. Funk-Henning, T. Ott, W. Pape; Studie zur Situation des Musikunterrichts und der Musiklehrer an allgemeinbildenden Schulen, Mainz 1982, S.228 zitiert in: Bergmann, Harmonie und Funktion…, 1991, S. 385
59 Dieser und der folgende Abschnitt: Velten, Musiktheorie. In: Kompendium der Musikpädagogik, 1995, 141 ff.
60 Velten, Musiktheorie. In: Kompendium der Musikpädagogik, 1995, S. 144
- Arbeit zitieren
- Christian Kampkötter (Autor:in), 2001, Musiktheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106705
Kostenlos Autor werden



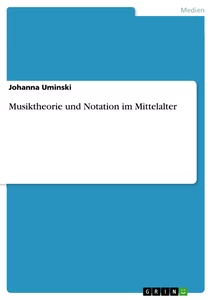

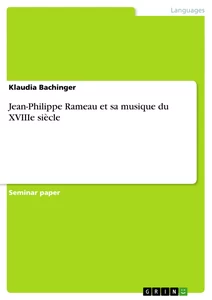








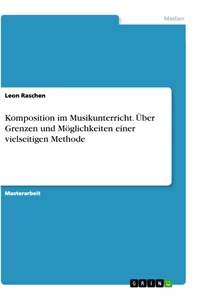

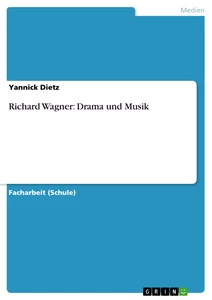

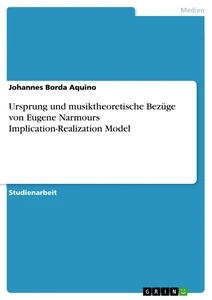



Kommentare