Leseprobe
"DER GEIST FIEL NICHT VOM HIMMEL" VON HOIMAR V. DITFURTH
ERSTE STUFE: DAS BIOLOGISCHE FUNDAMENT - DAS STAMMHIRN
1. Gehirn und Psyche
Das Gehirn dient nicht einzig und allein der Aufrechterhaltung des Bewußtseins und anderer psychischer Vorgänge. Das bewies um die Jahrhundertwende ein Würzburger Nervenarzt.
Um die Jahrhundertwende untersuchte der damalige Direktor der Würzburger Nervenklinik, Martin Reichard, die Gehirne von Pati- enten, die an einer Spätfolge der Syphillis starben, an der sog. pro- gressiven Paralyse. Bei dieser Krankheit werden Teile des Gehirns von spirochaeta pallidum befallen und zum Teil zerstört. Die Kranken wurden zunehmend dement, schließlich starben sie. Eini- ge magerten stark ab und verhungerten. Andere starben an Fieber. Aber wieso starben sie? Das Gehirn wies krankhafte Gewebsver- änderungen auf, das erklärt die Demenz, aber nicht den Tod. Kann man am Zusammenbruch psychischer Funktionen sterben?
Martin Reichard fand nun heraus, daß der Tod der Patienten mit bestimmten Gewebszerstörungen im Bereich des unteren Stamm- hirns zusammenfiel. Er zog daraus die richtige Schlußfolgerung, daß in diesem Bereich Funktionen lokalisiert sind, die nicht psychi- sche, sondern vegetative Prozesse steuern.
Wir wissen heute, daß das Stammhirn1 verschiedene Regelzentren für elementare Stoffwechselvorgänge enthält. Dort wird unter ande- rem der Blutdruck, die Körpertemperatur und die Flüssigkeitsbilanz reguliert. Somit ist das Gehirn nicht nur für psychische Abläufe verantwortlich, sondern auch für das biologische Funktionieren des Organismus.
Die Frage lautet nun: wieso sind so unterschiedliche Funktionen in ein und demselben Organ untergebracht?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in der Zeit weit zu- rückgehen.
2. Biologische Vorentscheidungen
Die Notwendigkeit der ersten Urzellen, sich von ihrer Umgebung abzugrenzen, war bereits ein erster Schritt in Richtung auf das, was wir Geist und Psyche nennen.
Die ganze spätere Entwicklung, und somit auch das Psychische, ist eine unmittelbare Folge dieser ersten biologischen Anfangs- prozesse.
Einer der ersten Organismentypen auf dieser Erde war eine primiti- ve Ur-Zelle. Diese Zelle hatte weder Organellen noch Zellkern. In ihrem Inneren befand sich lediglich die RNS, in dem ihr Bauplan gespeichert war, sowie einige Enzyme, die die Bauplananweisun- gen ausführen konnten.
Diese erste Zelle konnte nur überleben, wenn in ihrem Inneren ge- ordnet ablaufende chemische Prozesse stattfanden. Es war un- erläßlich, daß diese Kreislaufprozesse von den ungeordneten, chao- tischen Vorgängen ihrer nichtbelebten, äußeren Umwelt getrennt blieben.
Der erste Schritt des Lebens war ein Akt der Abgrenzung.
Die Außenwelt mußte ausgeschlossen bleiben - mit Ausnahme je- ner Stoffe, die zum Zellüberleben notwendig sind. Die Zelle brauchte "Nachschub", und der konnte nur von außen kommen. Die Zelle mußte sich - zumindest ein Stück weit - zur Außenwelt hin "öffnen".
Dem Zwang zur Abgrenzung steht also die Notwendigkeit gegen- über, sich der Außenwelt zu öffnen.
Der Kompromiß bestand in der Entwicklung der semipermeablen Membran. Eine semipermeable Membran sortiert - anders als ein mechanisches Sieb - nach elektrischen Eigenschaften.
An dieser Stelle in der Entwicklung schimmert zum ersten Male für uns das Psychische durch. Wieso? Fassen wir zusammen: Lebende Systeme mußten von Anfang an in der Lage sein, zwischen ver- schiedenen Eigenschaften ihrer Umwelt zu unterscheiden. Das setzt voraus, daß sie bestimmte Umweltfaktoren erkennen mußten, von denen sie zur Aufrechterhaltung ihres Stoffwechsels abhängig wa- ren (etwa Zucker- und Eiweißmoleküle). Diese z. B. mußten sie nämlich aus der großen Zahl der übrigen Moleküle, die für sie nutz- los oder gefährlich waren, irgendwie auswählen.
Unterscheiden, erkennen, auswählen. Das sind Formulierungen, die eine psychische Leistung ausdrücken. Ja, was soll denn das bedeu- ten? Haben die ersten Urzellen etwa Verstand gehabt? - Nein, na- türlich nicht. Aber die Sache ist trotzdem heikel. Es ist nämlich nicht so, daß unsere Sprache nur zufällig über Begriffe wie "unter- scheiden", erkennen", "auswählen" verfügt, sondern unsere Sprache enthält die Begriffe "unterscheiden", "erkennen" und "auswählen" deshalb, weil uns die entsprechenden Denkkategorien angeboren sind.
Das ist aber die Folge davon, daß das Verhältnis eines Organismus und seiner Umwelt von diesen drei Kategorien von Anfang an be- stimmt waren.
Diese Beziehungen sind primär biologischer Natur. Alles Spätere ist von ihnen geprägt, ist ihre Folge. Auch das Psychische.
3. Verfügen wir über eine objektive Wahrnehmung?
Für uns scheint die Außenwelt "so zu sein, wie sie ist". Aber in Wirklichkeit sind wir weit davon entfernt,über unsere Sinne ei- nen "wahren" Eindruck der Welt zu erhalten. Obwohl der Mensch- verglichen mit vielen anderen Lebewesen -über ein recht or- dentlich ausgestattetes Sinnessystem verfügt.
Das Maß an Außenwelt, oder, anders gesagt, die Zahl der Umwelt- qualitäten, die bei dem oben skizzierten urtümlichen Organismus überhaupt ankommen muß, ist sehr gering - jedenfalls von unserem heutigen Standpunkt aus gesehen. Aber die Zahl der zugelassenen Eigenschaften der Außenwelt wird im Laufe der Entwicklung in kleinsten Schritten immer mehr. Allerdings nur im Interesse eines unmittelbar eintretenden Vorteils, so wie es die Gesetze der Evolu- tion bestimmen.
Unsere menschliche Erlebniswelt ist unbestreitbar viel reichhaltiger als die von ganz wenigen Reizen gebildete Umwelt eines Mikroor- ganismus. Trotzdem gilt auch für uns das Prinzip: "so wenig Au- ßenwelt wie möglich, und nur so viel, wie unbedingt notwendig." Das heißt: auch wir nehmen von unserer Außenwelt nur gerade so viel wahr, wie es für unsere Existenz nützlich ist.
Das hat mit Objektivität nicht viel zu tun. Die Welt "so wie sie ist", können wir nicht wahrnehmen. Die Eigenschaften der Welt jenseits unseres Wahrnehmungsapparates sind zahlreich. So sind wir bspw. für das Gesamtspektrum der elektromagnetischen Wellen so gut wie unempfänglich - so gut wie -, einen außerordentlich kleinen Teil davon können wir als Licht sehen und als Wärme empfinden.
Wir können die Welt nicht so erkennen, "wie sie ist". Denn unser Gehirn ist ursprünglich kein Organ zum Erkennen der Welt, son- dern in erster Linie ein Organ zum Überleben.
4. Der gute Geschmack, die biologische Nützlichkeit und die Gefühle
Ein Gefühl spiegelt immer eine biologische Funktion wider, die außerhalb der psychischen Ebene abläuft. Das wird am Beispiel des Geschmacks besonders deutlich: wir können gar nicht an- ders, als mitzuerleben, was mit unserem Körper geschieht.
Der Geschmackssinn ist ein weiteres Beispiel für die biologische Abstammung des Auswählens. Die ersten Zellen durften in einem wäßrigen Milieu nur die unbedingt benötigten Moleküle in sich aufnehmen.
Auch wir können nur wasserlösliche Stoffe schmecken. Denn nur wasserlösliche Stoffe haben im wäßrigen Milieu unseres Stoff- wechsels eine biologische Bedeutung. So ein wasserlöslicher Stoff mit biologischer Bedeutung ist z. B. Zucker. Zucker schmeckt süß, und "süß" ist ein "guter" Geschmack. Zucker ist ein lebenswichti- ger Energiespender.
Dahinter steckt natürlich ein Prinzip: bekömmliche Nahrung schmeckt gut, potentiell schädliche schlecht. Das ist eine sinnvolle biologische Orientierungshilfe.
Viel später, als sich ein "Bewußtsein" entwickelte, spiegelte sich jenes darin als "angenehm", was schon Milliarden Jahre vorher richtig und bekömmlich gewesen war. Was dabei in unserem Be- wußtsein auftaucht, wenn wir schmecken, ist nur der Widerschein des biologischen Vollzugs. Anders ausgedrückt: wir können nicht umhin, das mitzuerleben, was sich an unserem Körper abspielt.
Auch dahinter steht ein Prinzip: sobald ein Organismus über ein Bewußtsein verfügt, spiegeln sich darin die Funktionen, auf denen seine biologische Existenz beruht. Diese Spiegelungen haben einen Namen: Gefühle.
5. Die Schichtung der Seele
Das Gehirn besteht aus Teilen unterschiedlichen Alters. Allein dieser Anachronismus ist dafür verantwortlich, daßvegetative Funktionen und psychische Phänomene an einem Ort anzutreffen sind, nämlich im Gehirn. Der Unterschied ist allerdings nur gra- duell, nicht prinzipiell.
Wie kommt es nun, daß so scheinbar unterschiedliche Funktionen vegetativer und psychischer Art in einem Organ untergebracht sind? Verglichen mit anderen Organen scheint das Gehirn aus dem Rahmen zu fallen. Alle anderen Organe haben spezifische Aufga- ben, haben einen geschlossenen Funktionskreis. Was haben aber die Fähigkeit zum logischen Denken mit der Regulation des Blut- drucks gemeinsam?
Wir haben schon gesehen, daß es einen Zusammenhang gibt zwi- schen vegetativen Funktionen und psychischen Phänomenen. Der Bau des Gehirns liefert Hinweise darauf, daß sich im Verlauf der Evolution aus vegetativen Funktionen psychische Phänomene ent- wickelt haben müssen.
Unser ältestes Hirnteil ist das Stammhirn. Es ist etwa 1,5 Mrd. Jah- re alt. Damals erschienen die ersten Mehrzeller auf der Erde. Auch heute kann man als primitiver Mehrzeller mit einem Stammhirn al- lein wunderbar leben.
Über dem Stammhirn entstand vor ca. 1 Mrd. Jahre das Zwischen- hirn, und vor etwa 500 Mio. Jahren begann sich das jüngste Gehirnteil zu entwickeln, das Großhirn. Alle Gehirnteile sind durch die Zeit hindurch kontinuierlich miteinander verbunden. Jedes Teil entspricht einer Stufe auf dem Wege zum Bewußtsein.
Aber was war vor dem Stammhirn?
6. Die Erfindung der Nervenleitung
Ein Einzeller braucht nur ein auf Hormonen basiertes Informati- onsübertragungssystem. Doch die Abstimmung der einzelnen Tei- le der immer gr öß er werdenden Organismen machte die Entwick- lung von Nerven notwendig.
Die hormonale Regelung ist sicherlich die älteste. Jede Zelle pro- duziert bei jeder Tätigkeit bestimmte Stoffwechsel-Endprodukte, die sie als Abfall nach außen abstößt. Bei einem Mehrzeller gelan- gen diese Sekrete in den extrazellulären Raum, wo sie bald in Kon- takt mit benachbarten Zellen kommen. Diese Abfallprodukte sind aber mehr als Abfall, sie sind nämlich gleichzeitig ein Signal für ganz bestimmte Zelltätigkeiten. Diese Signalfunktion hat wahr- scheinlich den evolutionären Ausgangspunkt für die die meisten Hormone gebildet.
Die Übertragungsform allein durch Hormone hat allerdings einen Nachteil: sie ist diffus und ungerichtet. Einen kleinen Mehrzeller kann das nicht stören, aber einem größeren ist das nicht genug. Ein schnelleres, zielgerichteteres Übertragungssystem mußte sich ent- wickeln.
Die ersten Nervenzellen haben vermutlich leitende Fortsätze entgegen des Konzentrationsgefälles der hormonalen Botschaft wachsen lassen. So könnten die Nervenzellen entstanden sein. Auch heute ist die Nervenverbindung ja nicht lückenlos. Im synaptischen Spalt werden hormonartige Überträgersubstanzen von einer auf die nächste Nervenzelle übertragen.
Mit der "Erfindung" der Nervenbahnen entwickelten sich gleichzei- tig spezialisierte Zellareale, die zu Organen zusammengefaßt wur- den. Ohne ein Nervennetz könnten Organe nicht optimal zusam- menarbeiten.
Auf dem jetzt beschriebenen Niveau befinden sich heutzutage z. B. Muscheln und Quallen. Von psychischen Phänomenen ist allerdings noch nichts zu sehen.
7. Programme im Nervennetz
Die Entwicklung der Nerven führt vom simplen diffusen Nerven- systemüber das Strickleiternervensystem zu Nervenknoten. Diese erweisen sich als fähig, bestimmte Programme zu koordinieren. Im Stammhirn sind eine Vielzahl dieser Regelungszentren unter- gebracht.
Ein Warmblüter kann seine Körpertemperatur auf 1/10° genau ab- stimmen, und zwar unabhängig von der Außentemperatur und sei- ner eigenen Aktivität. Diese Präzision ist Ergebnis einer Regelung, an der viele Organsysteme beteiligt sind. Wärme muß sowohl er- zeugt und transportiert als auch beseitigt werden. Dabei verengen oder erweitern sich zum Beispiel die Kapillaren der Blutgefäße. Oder wenn uns kalt ist, zittern wir, um in den Muskeln Wärme zu erzeugen. All das sind reflexartig ablaufende Funktionen, die paral- lel ablaufen.
Aber in der Summe sind sie durch ihre Parallelität kein Reflex mehr. Sie sind mehr, nämlich ein Programm, das durch bestimmte Reize ausgelöst wird.
Es geht auf dieser Stufe nicht mehr um bloße Synchronisation von- einander getrennter Teile. Vielmehr werden Teilsysteme von Orga- nen in den Dienst einer Aufgabe gestellt, und zwar zentral.
Was heißt zentral, und wo wird das koordiniert? Eine einzelne Ner- venzelle ist dazu offenbar nicht fähig. Aber eine Ansammlung von Nervenzellen schon.
Quallen verfügen über ein sog. "diffuses Nervensystem". Es ist ein einfaches Nervennetz, und es ist nicht hierarchisch aufgebaut. Trotzdem wird durch ein Nervennetz der Körper des Tieres wun- derbar harmonisiert, so daß es als geschlossene Einheit handeln kann. Ein unterschiedlicher Einsatz verschiedener Teile des Orga- nismus kann es aber nicht geben, weil nur "Gleichschaltung" vorgesehen ist.
Ein Regenwurm hat ein sog. "Strickleiternervensystem". Auch hier ist der Bau noch sehr monoton, aber am vorderen Ende gibt es eine kleine Konzentration von Ganglienzellen. Deren Impulsen müssen die übrigen Nervenzellen der "Strickleiter" folgen: hier finden wir die ersten, primitiven Programme.
Das vorläufige Ende dieser Entwicklung ist das Stammhirn der hö- heren Tiere. Hier findet man eine Vielzahl nervöser Regelungszent- ren.
Wir wären keine Sekunde überlebensfähig, wenn diese Zentren nicht in jedem Augenblicks unseres Lebens optimal auf die jeweiligen Erfordernisse abgestimmt reagieren würden. Deshalb ist schon die kleinste Verletzung des Stammhirns tödlich.
8. Abbilder der Außenwelt
Die Reize, die die Programme in den Regelzentren des Stamm- hirns auslösen, erfolgen direkt, d. h., das Regelzentrum wird mit dem Reiz unmittelbar konfrontiert. Auf diese Weise entsteht eine Art Abbild der Außenverhältnisse, welches aber noch extrem de- tailarm ist. Imübrigen gilt noch immer: "so wenig Außenwelt wie möglich".
Überraschend an den nervösen Regelzentren ist, das die pro- grammauslösenden Reize nicht indirekt erfolgen.
So könnte man z. B. denken, daß das Wärmezentrum im Stamm- hirn durch Nervenimpulse informiert wird, die von Rezeptoren in der Haut ausgehen.
Aber so ist es nicht! Der Meßfühler sitzt im Zentrum selbst und o- rientiert sich direkt an der Temperatur des umlaufenden Blutes. Die anderen Regelzentren scheinen prinzipiell ähnlich zu funktio- nieren.
Das heißt, daß der Reiz, der ein solches Programm auslöst, nichts mit dem zu tun hat, was wir "Wahrnehmung" nennen. Es ist die Außenwelt selbst, die hier am Organismus angreift, es ist noch im- mer "direkte Konfrontation".
Erstaunlicherweise ist aber auf dieser Entwicklungsstufe eine Art Abbild der Außenwelt in das Innere des Stammhirnwesens geraten. Es ist nämlich unmöglich, zu irgendeiner Aufgabe zweckmäßige Lösungen zu entwickeln, ohne daß in diesen Lösungen ein Abbild jener Gegebenheiten steckt, denen die Aufgabe entspringt. Konrad Lorenz sagt, "die Flosse eines Fisches ist in dem gleichen Sinne ein Abbild des Wassers, wie der Flügel des Vogels die Eigenschaften der Luft abbilde".
Die Stammhirnprogramme spiegeln also ganz zwangsläufig Infor- mationen über die Außenwelt wider. Diese Art "Bilder" sind äu- ßerst unscharf und detailarm.
Noch! Aber damit beginnt eine neue Stufe der Entwicklung.
ZWEITE STUFE: PROGRAMME FÜR DIE AUßEN- WELT - DAS ZWISCHENHIRN
1. Ein Mangel wird zum Vorteil
Das Phänomen der Gewöhnung ist ursprünglich ein systembeding- ter Mangel gewesen. Die Evolution hat diesen Mangel aber in einen Vorteil umgemünzt, und ihn in den Rang eines Informationsme- chanismus gestellt.
Einen schlechten Geruch im Zimmer riecht man nach kurzer Zeit nicht mehr, man gewöhnt sich daran, und kann in Ruhe weiterarbeiten. Das laute Ticken einer Standuhr im eigenen Heim hört man nur dann, wenn man sich darauf konzentriert: Gewöhnung. Eine sinnvolle Einrichtung, aber hier hat die Evolution, wie so oft, "aus der Not eine Tugend" gemacht.
Ein Sinnesrezeptor verbraucht Energie, wenn er einen Reiz regist- riert und weiterleitet. Sein Energievorrat an Glukose, ATP und an- deren Substanzen ist aber nicht beliebig groß. So kommt es, daß ein Rezeptor ermüdet, wenn er innerhalb einer kurzen Zeitspanne im- mer wieder vom gleichen Reiz getroffen wird.
Gewöhnung ist also eigentlich ein Mangel, eine negative Eigen- schaft biologischer Informationssysteme, eine Folge unvermeidli- cher Stoffwechselprozesse.
Trotzdem wurde dieser Mangel in einen Vorteil verwandelt. Es wurden sogar Regelmechanismen geschaffen, diesen Gewöhnungs- effekt "künstlich" hervorzurufen. Ein Beispiel dafür ist die Farbe Weiß, die physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung der sichtbaren Frequenzen darstellt.
Die Sonne ist von Beginn des Lebens an die häufigste natürliche Beleuchtungsquelle gewesen. Was liegt näher, sie als "Standard" zu definieren? Unsere Augen und unsere Sehzentren im Gehirn haben die im Sonnenlicht vorkommende Frequenzmischung zum Null- punkt gemacht. Nur die von dieser Norm abweichenden Fälle wer- den als "farbig" empfunden.
So macht die "Gewöhnung" Karriere als neuartiger Orientierungs- mechanismus. Sie greift aus den Umwelteigenschaften jene heraus, die eine Veränderung anzeigen.
Zum ersten Male werden von außen Informationen ü ber Dinge in den Organismus geleitet, und nicht mehr nur die Dinge selber !
2. Die Entwicklung des Auges
Dieüberragende und unmittelbare biologische Bedeutsamkeit des Lichtes für die Pflanzen ist "schuld", daß Pflanzen keine Augen haben, sondern nur einfache Lichtsinneszellen. Die Entwicklung des Auges von den Anfängen bis heute zeigt, daßdas "Sehen" als bewußtes optisches Erleben eine verhält- nism äß ig junge Fähigkeit ist. Nur 1 % der Zeit, die die Evolu- tion für die Entwicklung des Auges brauchte, entfiel auf das "Sehen".
"Sehen" bedeutet für die meisten Augenbesitzer - auch unter den höheren Tieren - etwas ganz anderes als für uns.
Aus physikalischen Gründen entstand bei der Entwicklung des Auges ein Abbild auf dem Augenhintergrund. Das Abbild war auf dieser Entwicklungsstufe eher störend, da es nur auf Bewegungen ankam. Aber das Abbild war da, bis ein Großhirn entstand, welches etwas mit dem Abbild anfangen konnte. Aber das Großhirn hat das "Sehen" vermutlich nicht erfun- den, sondern es war wahrscheinlich andersherum: das Groß- hirn wurde entwickelt, um sich des Abbildes bedienen zu kön- nen...
Am Anfang aller Sinne steht der Reiz. Der Reiz wird von denjeni- gen Umwelteigenschaften gebildet, die nicht ohne Nachteil für den Organismus ausgeblendet werden konnten.
Bei manchen Reizen wurde die biologische Bedeutsamkeit Schritt für Schritt zurückgedrängt, und es entstand ein Abbild der Welt. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung des Auges.
Es spricht einiges dafür, daß am Anfang dieser Entwicklung ein Einzeller wie Euglena stand.
Euglena betreibt Photosynthese und kann in Richtung auf Licht schwimmen, und zwar mit Hilfe einer Geißel. Dieser Einzeller hat schon ein ganz primitives Lichtsinnesorgan! Euglena verfügt über eine Pigmentansammlung, deren einziger Zweck darin besteht, ei- nen Schatten zu werfen. Fällt der Schatten auf die innere Geißel- motorik, arbeitet die Geißel so lange, bis sich Euglena parallel zum Licht ausgerichtet hat, denn nur dann fällt der Schatten woanders hin!
Allerdings ist dabei nicht ersichtlich, wie dieses Konstruktionsprin- zip auf das Auge hinausläuft. Und doch scheint es so zu sein, denn die Pigmentansammlung besteht aus Carotinoiden. Das aber ist keine beliebige Substanz: Sehpigmente gehören zu dieser chemi- schen Gruppe!
Bekannterweise haben Pflanzen keine Augen. Aber sie haben ganz einfache Lichtsinneszellen. Pflanzen können sich vom Licht ab- wenden oder zum Licht zuwenden. Mehr können sie nicht, aber für ihre Zwecke reicht es.
Eine höhere Ausbildung an Lichtempfangsorganen konnte aller- dings auch gar nicht stattfinden, denn das meiste Licht braucht eine Pflanze für die Photosynthese. Daß Pflanzen ü berhaupt Lichtemp- fangssensoren haben, liegt daran, daß für die Photosynthese über- wiegend Licht im roten und gelben Spektrum benötigt wird. Aber die kürzeren grünen und blauen Lichtfrequenzen sind frei!
Wie wurde diese "Erfindung" weitergegeben? - Zu der Zeit, als diese Entwicklung stattfand, war die Grenze zu den Reichen "Tie- re" vs. "Pflanzen" noch unscharf und schwankend. Euglena selber ist dafür noch heute ein schönes Beispiel: hält man Euglena im Dunkeln, verkümmern ihre Chloroplasten, und sie ernährt sich fort- an heterotroph.
Die Übertragung der "Erfindung" war also nur eine Frage der Zeit. Wie ging es weiter?
Den groben Weg können wir rekonstruieren. Beim Regenwurm z. B. sind Lichtsinneszellen in der ganzen Haut verstreut. Allerdings sind sie am Vorderende dichter konzentriert als anderswo. Die Pigmente sind "unterwegs" verlorengegangen.
Im weiteren Verlauf der Entwicklung rückten die lichtempfindli- chen Zellen zusammen, außerdem senkte sich die Oberfläche ein, auf der sie konzentriert waren. Das senkt die Verletzungsgefahr. So kam es zum "Becherauge" der Schnecken. Das Becherauge kann aufgrund seiner geometrischen Eigenschaften schon Bewegungen melden.
Dann begann sich die Öffnung des Bechers zu verengen, und er formte sich zur Hohlkugel. Das "Lochauge" entstand, in der einfa- che Abbildungen an die Rückwand geworfen werden. Solche Ab- bilder sind allerdings unscharf und dunkel.
Um diesen Mangel auszugleichen entstand die Linse. Damit wird das Abbild scharf und dennoch lichtstark, und das bei kleinem Ein- trittsloch.
Zwischen dem Pigmentfleck von Euglena und unseren Augen lie- gen 3 - 4 Milliarden Jahre. Augen bedeuten aber noch nicht "Se- hen". Das "Sehen", das optische Erleben, so wie wir es kennen, ist sicherlich höchstens 30 Mio. Jahre alt. Es entstand erst mit der Ausbildung des Großhirns. 30 Millionen ist 1/100 von 3 Milliarden. Das "Sehen" entstand erst im letzten 1 % der "Augenzeit"!
Das "Sehen" war offensichtlich nicht das eigentliche Funktionsziel. Wozu aber wurden die Augen geschaffen?
Unsere Art zu sehen ist vor allem gekennzeichnet durch ein Abbild der Außenwelt. Für uns ist das selbstverständlich. Dieses "Abbil- dungssehen" kann aber nur funktionieren, weil unsere Augen im Takt von 50 Hz zittern. Sie tun das, damit ein Netzhautpunkt nicht so schnell mit immer denselben Reiz "bombardiert" wird. Wird ein Netzhautpunkt nur kurze Zeit mit Licht derselben Intensität und Helligkeit ausgesetzt, tritt Gewöhnung ein: es wird dunkel. Man kann das künstlich provozieren, indem man das "Augenzittern" medikamentös unterdrückt. Allerdings genügt die kleinste Reizän- derung, damit wieder ein Bild entsteht. Dieses Bild erfüllt aber nur die Netzhautfläche, die "geändert" worden ist, alles andere bleibt dunkel. Nur bewegte Dinge werden registriert. Für einen Menschen ist diese Erfahrung sehr merkwürdig.
Für viele Tiere gehört dieses Prinzip zum Alltag. Es ist das "Bewe- gungssehen". Das Augenzittern ist nur bei Säugetieren beobachtet worden. Bei Amphibien, Reptilien und Fischen taucht es nicht auf.
Das alles läßt den Schluß zu, daß unsere Augen ursprünglich A- larmeinrichtungen gewesen sind: nur jenes konnte die optische Zensur passieren, was eine Reaktion notwendig machen konnte. Mehr Informationen hätten zu einer Überflutung des Gehirns mit überflüssigen Daten geführt.
Die wirklichkeitsgetreue, objektive Abbildung ist auf dieser Stufe noch ohne Bedeutung.
Unseren Augen ist die Alarm- und Bewegungssehfunktion noch deutlich anzumerken:
- eine scharfe Punkt-für-Punkt Abbildung funktioniert nur im kleinen Bereich der fovea centralis. Wir überspielen das da- durch, indem wir durch ständige Augenbewegungen die Um- welt regelrecht abtasten
- die sog. räumliche Summation unserer peripheren Netzhautzel- len bewirkt in diesen Bereichen eine bis zu 10.000 mal höhere Lichtempfindlichkeit als in der fovea centralis
- am äußersten Netzhautrand sitzen bei uns Sinneszellen, die kei- ne optischen Empfindungen auslösen, sondern nur auf Bewe- gungen ansprechen. Sie lösen reflektorische Kopfbewegungen in Richtung auf das bewegte Objekt aus
- unsere Augen gehören anatomisch gesehen zum Thalamus. Das primäre Sehzentrum und das sekundäre Sehzentrum in der Großhirnrinde kamen erst später
Die sich später entwickelnde Abbildungsfunktion ist nie "Ziel" ge- wesen. Die Abbildung auf der Augenhinterwand ergab sich bei der Entwicklung des Auges aus rein physikalischen Gründen, und eini- ge Einrichtungen wurden extra dafür geschaffen, Teile dieses Bil- des - nämlich die unbewegten Anteile - zu unterdrücken. Erst die Großhirnrinde war funktionell in der Lage, mit diesem Abbild et- was "anzufangen". Es ist wahrscheinlich, daß dieses Abbild über- haupt erst eine der Ursachen gewesen ist, daß sich ein Großhirn entwickelt hat - quasi "drumherum".
3. Das Zwischenhirn
Das Zwischenhirn speichert - wie das Stammhirn auch - Pro- gramme. Der Abruf dieser Programme funktioniertüber gleich- sam codierte Zeichen oder Signale. Dabei setzt das Stammhirn jedoch die Auslöseschwellen fest. Es gilt als Prinzip: der obere Hirnteil ist vom unteren Hirnteil abhängig.
Das Zwischenhirn ist jünger als das Stammhirn, aber älter als das Großhirn. Eine wichtige Hauptfunktion des Zwischenhirns besteht darin, daß es Verhaltensprogramme bereitstellt. Diese Programme werden durch Signale ausgelöst. So löst das Signal "Raubvogel" bei einer Gans das Programm "Flucht vor einem Luftfeind" aus. Wozu sind solche Programme gut?
Der größte Vorteil besteht darin, daß ein "Zwischenhirnwesen2 " keine Fehler machen kann. Jede typische Umweltanforderung wird mit einem bestimmten Programm beantwortet. Dieses Programm ist durch Tausende von Generationen hindurch auf seine Wirksam- keit getestet. Es wurde darüberhinaus durch Selektionsprozesse lau- fend optimiert. Es gibt einen Namen für derartige Programme: In- stinkte, angeborene, ererbte Erfahrungen, im Genom abgespeichert. Können Erfahrungen vererbt werden? - Ja, obwohl nicht von indi- viduellen Erfahrungen die Rede ist, sondern von überindividuellen. Von Erfahrungen der Art. Man kann auch sagen: bestimmte Hirn- strukturen werden vererbt. Vom Prinzip her ist es dasselbe.
Was kann das Zwischenhirn mehr als das Stammhirn? - zuerst ein- mal: der Unterschied ist graduell, nicht prinzipiell. Auch das Stammhirn verfügt über Programme. Der Unterschied ist: die Pro- gramme des Stammhirns, wie z. B. "Frieren" oder "Regelung des Wasserhaushaltes", kommen direkt zustande. Es ist die jeweilige Bedarfssituation selbst, die direkt auf den Mechanismus einwirkt. Im Falle des Frierens ist das ein Absinken der Bluttemperatur.
Auf der Zwischenhirnebene ist es nicht mehr die Bedarfssituation selbst, sondern ein Signal, welches für sich alleine keine biologi-sche Bedeutung hat. Dieses Signal erhält sozusagen erst durch Konvention eine Bedeutung.
Auf der Stammhirnebene ist die Beziehung zwischen Organismus und Umwelt rein chemisch-physikalisch. Auf der Zwischenhirnebene wird die Beziehung zwischen Organismus und Umwelt über "Zeichen" vermittelt.
Trotzdem sind die Programme des Zwischenhirns in komplizierter Weise von den "darunterliegenden" Programmen des Stammhirns abhängig. Z. B. fallen bei zunehmender Unterernährung Balz- oder Verteidigungsprogramme unter den Tisch.
Das Zwischenhirn kann nur arbeiten, wenn das Stammhirn seinen Dienst tut, und die Zentren auf der unteren Ebene schaffen die ele- mentaren Voraussetzungen dafür, daß überhaupt irgendwelche hö- heren Programme ablaufen können, indem sie z. B. die unentbehr- lichen Energievorräte zur Verfügung stellen.
Das Stammhirn steuert auch den Zeitpunkt, wann bestimmte Signa- le ein Zwischenhirnprogramm auslösen. Es steuert die Schwellen.
4. Das Abbild geht dem Original voraus
Das Abbild auf der Zwischenhirnebene ist viel schärfer als auf Stammhirnebene. Aufgrund der besonderen Funktion des Zwi- schenhirns ist es so, daßdas entsprechende Abbild schon in ihm existiert, noch bevor die reale Umwelt mit dem Zwischenhirn in Beziehung steht. Anders gesagt: die Welt der Instinkte besteht schon ohne Außenwelt fix und fertig im Kopf.
Es wurde schon gesagt, daß ins Stammhirn zwangsläufig, sozusa- gen als Resultat seiner Interaktion mit der Umgebung - eine Art un- scharfes Abbild hineingelangt.
Das gleiche gilt für das Zwischenhirn. Auch hier gilt die zwangs- läufige Beziehung von: "Anpassung an die Umwelt" und "Abbil- dung der Umwelt".
Auf der Zwischenhirnebene ist die Abbildung - der höheren Ent- wicklungsstufe entsprechend - vollständiger als auf Stammhirnebe- ne. Das führt zu einer merkwürdigen Konsequenz:
Das "Abbild" des Zwischenhirns ist bereits vorhanden, bevor der Organismus seiner Umwelt überhaupt begegnet! Es kann gar nicht anders sein, denn die Besonderheit des Zwischenhirns besteht ja gerade darin, daß es fertige, angeborene Verhaltensprogramme be- reithält, die bestimmten Umweltanforderungen haargenau entspre- chen müssen.
Die übliche Vorstellung ist, daßdas Gehirn eine zur Abbildung be- fähigte biologische Struktur ist. Eine Art Aufnahmeeinrichtung, in der die Welt sich spiegeln kann. Auf der einen Seite die "Wirklich- keit", auf der anderen Seite ein Gehirn, die diese Wirklichkeit er- fassen kann, und zwar umso "richtiger", je höher sein Entwick- lungsstand ist.
Diese Vorstellung ist falsch. Das Gehirn ist nicht "leer". Zumindest auf Zwischenhirnebene ist ein Teil der Welt darin schon fest einge- fügt, bevor der Organismus Zeit hat, mit ihr überhaupt richtig in Kontakt zu treten.
Das Abbild existiert früher als das Original. Diese Vorstellung ent- spricht nicht unserem Realitätsempfinden, und doch gibt es dafür Belege:
So läßt sich das Zwischenhirnprogramm "Abwehr eines Bodenfein- des" beim Hahn durch elektrische Reizung künstlich auslösen. Der Hahn macht das buchstäblich auf Knopfdruck, und zwar unabhän- gig davon, ob er überhaupt schon einmal einem Wiesel, einem Iltis oder einem anderen Bodenfeind begegnet ist.
Der reale Wiesel hat in der Zwischenhirn-Welt des Hahnes nur die Funktion eines spezifischen Auslösers. Der Feind ist im Gehirn des Hahnes schon vorhanden, bevor er ihm zum ersten Male begegnet.
Das ist auch bei uns so, denn auch wir besitzen ein Zwischenhirn. So ist unsere Angstbereitschaft nachts im dunklen Wald deutlich erhöht, und wir beginnen "Gespenster" zu sehen. Unsere Abhän- gigkeit vom Gesichtssinn - der dann weitgehend ausfällt - ist so groß, daß die Dunkelheit unsere Auslöseschwellen für Angstreakti- onen deutlich herabsetzt. Schon ein Knacken oder ein Schatten kann uns böse erschrecken.
In dieser Situation erfahren wir am eigenen Leibe, was geschieht, wenn sich ein untergeordnetes Zentrum durchzusetzen versucht!
5. Welt und Wirklichkeit des Zwischenhirns
Die "Wirklichkeit" wird für das Zwischenhirn durch austausch- bare Signale repräsentiert. Nur bestimmte Schlüsselsignale lö- sen Verhaltensprogramme aus.
Anders gesagt: Ein Signal oder "Auslöser" gehört nur dann zur" Wirklichkeit" des Tieres, wenn es auf sein Verhalten oder seine innere Verfassung auf irgendeine Weise "wirkt".
In der Welt des Zwischenhirns gibt es nichts, was ohne Bedeu- tung wäre. Diese Welt ist perspektivisch auf das Subjekt hin ge- ordnet
Die Zahl der Verhaltensprogramme, die im Zwischenhirn gespei- chert sind, ist relativ klein. Das ist natürlich eine Frage des Volu- mens, denn die Programme liegen in Form von Nervenzellverbin- dungen vor.
Die Beziehung zwischen dem Individuum und der Außenwelt wird auf Zwischenhirnniveau ausschließlich durch festgelegte Verhal- tensprogramme hergestellt.
Die "Wirklichkeit" eines Zwischenhirnwesens ist infolgedessen re- lativ beschränkt, es registriert nur einen vergleichsweise winzigen Ausschnitt aus der objektiv vorhandenen Realität. Das ist ganz selbstverständlich, denn noch immer gilt: "So wenig Außenwelt wie möglich".
Ein Beispiel: Bei einer Henne, die auf ihren ausgebrüteten Küken sitzt, ist die Schwelle für aggressives Verhalten stark erniedrigt. Sie attackiert alles, was sich dem Nest nähert, außer natürlich eines von ihren Küken, welches irgendwie aus dem Nest herausgeraten ist und wieder hinein möchte. Natürlich? Der Schlüsselreiz für die Henne ist nämlich in der Brutsituation das Piepsen des Kükens. Verstopft man der Henne die Ohren, attackiert es ihr eigenes Kü- ken, während es aufs Nest zuläuft.
Das, was die Henne sieht, hat mit dem, was wir in dieser Situation sehen, keineähnlichkeit mehr.
Wie sieht die Wirklichkeit eines Zwischenhirnes aus?
Vom Zwischenhirn aus gesehen, hat die Welt mit dem, was wir als unsere gewohnte Umwelt erleben, wenig gemeinsam. Der Besitzer eines Großhirns würde sich dort - buchstäblich, wie wir noch sehen werden - in einen Alptraum versetzt fühlen.
Auch unser Zwischenhirn ist noch voll in Funktion. Es wird norma- lerweise überwiegend vom Großhirn beherrscht, aber niemals ganz unterdrückt.
Die "Stammhirnwirklichkeit" bestand nur aus konkreten physikali- schen und chemischen Reizen. Die "Zwischenhirnwirklichkeit" be- steht darüberhinaus aus Signalen, die über die Fernsinne vermittelt werden. Diese haben den Charakter spezifischer Auslöser, die Ver- haltensprogramme in Gang setzen. Da die Umwelt voll von Auslö- sern ist, wachen vom Stammhirn geregelte Schwellen darüber, wie hoch die "innere Bereitschaft" für das jeweilige Verhaltenspro- gramm ist. Die Schwellen wiederum sind von bestimmten Umwelt- faktoren abhängig. Letztlich entscheidet die Umwelt also darüber, ob ein "Signal" Auslösecharakter hat oder nicht.
Ein Beispiel:
Beim Rotkehlchen-Männchen ist das Signal für das Balzverhalten "Federn + Rot". Eine Drahtattrappe, die sowohl Federn hat als auch rot ist, kann so als Auslöser wirken. Aber ist das Rotkehlchen über- haupt in "Balzstimmung"? Diese innere Bereitschaft ist abhängig von der Jahreszeit, genauer, von der jahreszeitlich wechselnden Tageslänge.
Auf diese Art und Weise entscheidet also die Umwelt darüber, wel- che Merkmale jeweils zu dessen Wirklichkeit gehören oder nicht!
Die Wirklichkeit des Zwischenhirns ist nicht konstant. Das ist der entscheidende Unterschied zu unserem gewohnten Erleben. Für uns ist es selbstverständlich, daß Dinge auch unabhängig von uns selber existieren. Das ist für uns deshalb selbstverständlich, weil wir es so gewohnt sind.
Für ein Zwischenhirn existieren Dinge nicht unabhängig von sei- nem Besitzer! Sie sind abhängig vom Grad des Interesses.
Die Welt eines Hahnes wird durch austauschbare Merkmale re- präsentiert, sozusagen indirekt.
6. Die Träume und das Zwischenhirn
Während die Trauminhalte oft aus der "Requisitenkammer" des Großhirns kommen, entstammen die Regeln des Traums der Zwi- schenhirnwirklichkeit. Diese Wirklichkeit wird für uns manch- mal zum Alptraum...
Die beschriebene Weltempfindung des Zwischenhirns weist ver- blüffende Parallelen zu unseren Träumen auf. Auch in unseren Träumen fehlt jede objektive Beständigkeit. Im Traum wechseln Ort, Zeit und Handlung unvermittelt, es passieren die unwahr- scheinlichsten und phantastischsten Sachen, ohne daß wir darüber erstaunt sind.
Vor allem hat im Traum alles irgendeine Bedeutung für uns (oft bedrohlicher Natur), nichts ist gänzlich neutral oder belanglos.
Wenn unser Bewußtsein während des Schlafes erlischt, ist das Zwi- schenhirn dann vielleicht von der Dominanz des Großhirns befreit?
"Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch". Ist das Großhirn die Katze, und was da tanzt, ist das das Zwischenhirn?
Präsentiert sich uns die Welt im Traum als Abbild des Zwischen- hirns ?
Natürlich, die Dinge und Personen im Traum entstammen unserer Erinnerung des Wachbewußtseins. Die Regeln des Spiels jedoch stammen aus einer anderen Welt.
Und warum fürchten wir uns so oft im Traum? Warum erscheint uns die Traumwirklichkeit so oft fremdartig und unheimlich? Viel- leicht, weil wir uns in einer archaischen Wirklichkeit, die seit vie- len Jahrmillionen nicht mehr die unsere ist, nicht mehr heimisch fühlen?
7. Geborgenheit und ihre Grenzen
Das Zwischenhirntier befindet sich in paradiesischer Einheit mit seiner Umwelt. Es befindet sich darin vollkommen geborgen. Wenn sich die Umweltbedingungen aber schnelländern, wird diese Geborgenheit zur Falle.
Der auf der Stufe des Zwischenhirns angelangte Organismus ist in sich vollendet. Das "Zwischenhirnwesen" ist in seiner Welt in einer Weise geborgen, die uns nicht mehr erreichbar ist.
Das Tier und die Umwelt bilden eine vollkommene Einheit. Ein Zugvogel, der seinem Winterquartier zufliegt, kann nicht irren. Es weiß nichts von Zweifeln.
Es ist eine für uns paradiesische Geborgenheit. Warum wurde sie aufgegeben, welche schwache Stelle darin rechtfertigte eine Wei- terentwicklung?
Wir haben schon gesagt, daß die Verhaltensprogramme des Zwi- schenhirns optimal auf bestimmte Umweltbedingungen und Le- benserfordernisse zurechtgeschnitten sind. Aber - und hier liegt der Haken - sie werden wertlos, wenn sich die Umweltbedingungen rasch ändern.
Rasche Umweltveränderungen sind die Grenzen der Geborgenheit. Sie sind "Gift" für ein Zwischenhirnwesen. Lernunfähigkeit ist die Kehrseite der Medaille! Ist das Zwischenhirn gänzlich lernunfähig? Nein! Das hoch entwickelte Zwischenhirn verfügt schon über einen Mechanismus, das feste Instinktprogramme mit dem Lernvermögen im üblichen Sinne verzahnt. Es ist die Prägung.
8. Lernen auf Zwischenhirnniveau
Vorher gab es nur verschwommene Schemen austauschbarer Merkmalsträger, denen man mit Hilfeüberindividueller Stan- dardprogramme begegnete. Nun gab es als revolutionierende Neuerung unverwechselbare Individuen.
Die Grenzen der Geborgenheit eines Zwischenhirnwesens befinden sich also dort, wo das Lernen anfängt. Aber - so einfach ist die Sa- che nicht.
Ein Muster angeborener Programme sorgt dafür, das das Zwi- schenhirnwesen überlebt. Jedoch - ein Igel wird niemals begrei- fen, daß sein Stachelpanzer ihn nicht vor Autoreifen schützt, und Kuckuckskinder werden noch in Tausenden von Jahren von "Stief- eltern" aufgezogen werden.
Das Zauberwort heißt "Lernen". Lernen ist keine Erfahrung der Art, keine angeborene Erfahrung, sondern eine Erfahrung auf indi- vidueller Ebene, eine erworbene Erfahrung. Instinkt und Lernen scheint etwas Gegensätzliches zu sein.
Die Änderung, der Weg dorthin, scheint radikal.
Er ist es nicht. Tatsächlich liegt hier kein Gegensatz vor. Es ist nicht eine Frage von "entweder - oder", sondern - wie so oft - eine Frage von "sowohl-als-auch".
Es geht um das Verhältnis von Instinkt und Lernvermögen. Dieses Verhältnis ist nicht diskret, sondern stetig! Es liegt an unserer Per- spektive, wenn uns das überrascht.
So gibt es Fähigkeiten, die angeboren sind, die aber zu ihrer Ver- wirklichung Lernprozesse benötigen. Es ist das Phänomen der Prä- gung. Ein Lebewesen auf der Entwicklungsstufe des Zwischenhirns läßt sich schon "prägen"! Schon ein Zwischenhirn kann also lernen, wenn auch in einem eingeschränkten Sinn.
Ein Beispiel: ein frisch geschlüpftes Küken3 erkennt jedes Ding, Person oder Tier, welches es zum ersten Male sieht, als "Mutter" oder "Vater" an. Für diese "Prägung" reichen schon wenige Minu- ten. Die "sensible Phase", also der Zeitraum, während dessen sich die Prägung vollziehen kann, beträgt nach dem Schlüpfen etwa 24 Stunden, denn nur in der allerersten Zeit nach dem Schlüpfen ist die Wahrscheinlichkeit groß genug, daß das Objekt, welches die Prägung auslöst, die eigene Mutter ist. Wird dieser Zeitraum ver- paßt, kann er nie mehr nachgeholt werden. Ist die "Prägung" aller- dings geglückt, ist sie irreversibel. Sie kann nicht mehr "vergessen" werden.
Prägung ist die angeborene Fähigkeit, etwas ganz Bestimmtes zu lernen. Warum hat die Evolution diesen Weg beschritten? Wäre es nicht einfacher, ein entsprechendes "Erkennungsprogramm" im Genom festzulegen?
Für ein brütendes Huhn ist die Merkmalskombination "fellige Be- schaffenheit" + "Anschleichen auf Boden" identisch mit einem Bo- denfeind. Diese Kombination ist generalisierend und schließt alle Wiesel, Füchse und Iltisse auf der ganzen Welt mit ein. In dieser Merkmalskombination steckt eine hohe Ökonomie und ein hoher Sicherheitsgrad.
Im Falle des frisch geschlüpften Kükens stellt sich aber genau die umgekehrte Aufgabe. Es sollen nicht die Gemeinsamkeiten einer großen Zahl einzelner Organismen erfaßt werden, sondern die Be- sonderheit eines konkreten Individuums.
Das ist eine Neuerung. Vorher gab es - im Falle des Kükens - lediglich die "Nachfolge": das Jungtier folgte zwar seiner Mutter, diese war aber nur durch eine Merkmalskombination "gespeichert". Verirrte es sich, konnte es seine Mutter häufig nicht wiederfinden. Vielleicht fand es eine andere, fremde Mutter, vielleicht auch nicht. Es war auf jeden Fall unsicher und risikobehaftet.
Die "Nachfolgeprägung" war also bei Tieren, die intensive Brut- pflege benötigten, viel vorteilhafter.
In das Verhaltensprogramm, das die alte Leistung der "Nachfolge" sicherstellte, wurde sozusagen eine "Leerstelle" eingefügt. Man kann sogar angeben, an welcher Stelle das geschah. Die Leerstelle muß an Stelle des bis dahin gültigen "angeborenen auslösenden Mechanismus" eingefügt worden sein, der das dazugehörige "Nachlaufprogramm" zündet. Diese Leerstelle ist eine Art "Wachs- tafel". Aber auf ihr kann sich nur ein einziges Mal etwas abdrü- cken, dann erstarrt sie und ist selber zum "angeborenen auslösen- den Mechanismus" geworden"!
Die Evolution hat es fertiggebracht, ein angeborenes Programm zu entwickeln, das auf Einzelindividuen anspricht!
Es ist die Stunde einer neuen Erfahrung: die Erfahrung eines in sei- ner Identität einzigartigen Individuums: der eigenen Mutter.
Mit der Prägung ist das Zwischenhirn "plastisch" geworden, denn jede Prägung führt im Gehirn zur Entstehung neuer Synapsen und zu neuen Querverbindungen. Das alles ist abhängig von der Art der gemachten "prägenden" Erfahrung. Freilich sind auf dieser Ent- wicklungsstufe die hirnphysiologischen Veränderungen bleibend. Ein "Lernen" in unserem Sinne gibt es noch nicht.
Trotzdem ist eine Grenze überschritten worden.
9. wovon werden wir geprägt?
Daß auch Menschen verschiedene Formen der Prägung durch- laufen, gilt als sicher. Wir scheinen aber nicht alle Formen bei uns selber zu kennen.
Deshalb darf man sich vor der Möglichkeit nicht verschließen, daßdurch den gesellschaftlichen Strukturwandel der letzten 200 Jahre bestimmte biologische Rahmenbedingungen (die wir in diesem Fall nicht kennen) verletzt worden sein könnten.
Das Phänomen der Prägung mit all seinen Besonderheiten - Be- grenzung der sensiblen Phase, Unabänderlichkeit des Resultats - gibt es auch beim Menschen. So lernen wir in einer frühen Phase der Kindheit bestimmte Gesetze des Sehens. Versäumen wir dies, ist das irreparabel. Von Geburt an Blinde, denen man operativ spä- ter das Augenlicht wiedergab, konnten zwar "sehen". Aber sie konnten mit ihren Erfahrungen größtenteils nichts anfangen. Das galt früher als rätselhaft, heute, im Licht der Prägung, nicht mehr. Vieles spricht dafür, das es prägungsartige Effekte auch in anderen Bereichen gibt, z.B. was den Erwerb der Fähigkeit betrifft, soziale Kontakte aufzubauen.
In diesem Bereich gibt es noch viele Wissenslücken. So wissen wir nicht genau, auf welche Umweltfaktoren Kinder in den beiden ers- ten Lebensjahren angewiesen sind, um bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten erwerben zu können. Da man nicht einmal dies genau weiß, weiß man ebenfalls nicht, in welchen Fällen zu diesem Erwerb erfolgreiche Bedingungen in unserer heutigen Gesellschaft noch erfüllt sind.
Das sind Risiken, die bei unserem heutigen Wissensstand noch ganz unübersehbar sind.
DRITTE STUFE: DIE SCHWELLE ZUR VERNUNFT - DAS GROßHIRN
1. neuronale Konvergenz
Auf dem Weg von der Körperperipherie zum Gehirn wird die Fül- le von Sinnesdaten immer mehr reduziert, die Informationen werden nach Wichtigkeit sortiert und immer kompakter. Alle In- formationen laufen ins Zwischenhirn, wo sie maximal kompri- miert sind. Das Zwischenhirn gibt von diesen Informationen al- lerdings nur einen kleinen Teil ans Großhirn weiter. Dieser Teil wird allerdings sorgfältigst ausgewertet...
Praktisch alle Sinnesdaten aus dem Körper laufen auf konvergie- renden Bahnen im Zwischenhirn zusammen. Die von ihnen trans- portierten Informationen werden unter Verzicht auf die ursprüngli- che Detailfülle mehr und mehr kondensiert. Die Synapsen vieler Neuronen münden - je weiter sie auf ihrem Weg zum Zwischenhirn sind - auf immer weniger Neuronen (neuronale Konvergenz).
Besonders auffällig ist diese Tendenz beim Sehen. Was das Auge dem Zwischenhirn "weiterreicht", hat mit einem "Bild" überhaupt keine Ähnlichkeit mehr. Es ist das Ergebnis einer komplizierten Verrechnungsarbeit, eine an mehreren Verrechnungsstellen herun- terreduzierte Auswahl jener Informationsfülle, die in den Netzhäu- ten eintraf. Diese Informationen wurden auf dem Weg zum Zwi- schenhirn nicht nur reduziert, sondern auch schon nach vorgegebe- nen Kriterien verarbeitet. Diese Verrechnungsarbeit merken wir in aller Regel nicht. Nur in künstlich herbeigeführten Situationen können wir indirekt feststellen, wieviel uns beim Sehen unbemerkt "untergeschoben" wird. Hierzu gehören die sog. "optischen Täu- schungen". Allerdings kann man getrost davon ausgehen, daß die tatsächliche Anzahl der "Verrechnungseffekte" viel höher ist als die Anzahl der optischen Täuschungen, die wir kennen. Wir bemerken sie nur nicht, weil sie untrennbar in dem uns gewohnten Anblick stecken.
Sobald das Zwischenhirn erreicht ist, kehrt sich die Tendenz der In- formationskonzentration in ihr Gegenteil um. Im Zwischenhirn sind die Informationen auf kleinstem Raum zusammengedrängt. Diesel- ben Informationen werden im Großhirn - jedenfalls soweit sie ans Großhirn weitergegeben werden - auf ein verhältnismäßig riesiges Rindenareal verteilt, welches nur stark gefaltet in unserem Schädel Platz findet.
Noch einmal: warum werden die Informationen in Richtung Zwi- schenhirn dermaßen konzentriert?
Diese Konvergenz spiegelt anatomisch jene Strategie wider, die für die Entwicklung des Zentralnervensystems maßgeblich war - bis zur Stufe des Zwischenhirns. Die Strategie heißt: "so wenig Au- ßenwelt wir möglich." Ein Minimum an generalisierenden Merk- malen war nötig, um auf bestimmte Umweltaspekte mit fertigen Reaktionsprogrammen zu reagieren. Alles höchst ökonomisch. In- dividuelle Besonderheiten bestimmter Umweltobjekte wurden kon- sequent unterschlagen, sprich: durch höchst komplizierte Verarbei- tungsprozesse eliminiert.
2. die Großhirnrinde
Das Großhirn ist die Weiterentwicklung der "Leerstellen" des Zwischenhirns. Die im Zwischenhirn räumlichäußerst kompakt gedrängten Informationen werden im Großhirn auf einer mög- lichst großen Fläche ausgebreitet - der Großhirnrinde. Bestimm- te Rindenareale haben sich im Laufe der Zeit auf bestimmte In- formationen spezialisiert. Das Großhirn dientüberwiegend der Analyse der eintreffenden Informationen, ein Teil ist aber auch dazu da, motorische "Befehle" an die Körperperipherie weiterzu- leiten.
Die explosive Auffächerung der Bahnen vom Zwischenhirn zum Großhirn spiegelt die Aufgabenstellung des Großhirns wider.
Darin sind keine Programme gespeichert. In ihm wird die Welt nicht mit Hilfe standardisierter Erfahrungen vorweggenommen. Es ist leer wie ein blankgeputzter Spiegel. Dieser Spiegel soll das "Bild" aufnehmen, jenes "Bild", welches schon so lange vorher in einer Mischung aus Zufall und Notwendigkeit entstand, und das bisher mehr ein lästiges Nebenprodukt gewesen ist! Das ist die neue Aufgabenstellung für den neuen Gehirnteil. Das Großhirn soll die Informationen nicht mehr nur integrieren, sondern analysieren. Zu diesem Zweck werden die einkommenden Informationen auf einer möglichst großen Fläche ausgebreitet - auf der Gehirnrinde.
Nicht jedes Rindenareal ist allerdings für die Aufarbeitung beliebi- ger Informationen in gleichem Maße geeignet. Besondere Felder sind spezialisiert für Informationen spezieller Art.
Unser Großhirn ist das Resultat einer Entwicklung, die mindestens 500 Mio. Jahre dauerte. Die spezialisierten Rindenareale, oder die "Zentren", waren natürlich nicht von Anfang an vorhanden.
Wie ist die Hirnrinde aufgebaut? Ein Teil der Hirnrinde dient nicht der Analyse eintreffender Informationen, sondern der Aussendung von Impulsen (oder "Befehlen") an die Körperperipherie. Infolge- dessen ergibt sich eine grobe Zweiteilung der Rinde in "Sender" und "Empfänger". Die Grenze verläuft zwischen zwei langgestreckten Arealen. Das erste Areal ist für die Innervation der Skelettmuskulatur zuständig (motorische Rinde des Stirnlappens), das zweite für die genaue Ortung von Berührungsreizen (sensible Rinde des Scheitellappens). In beiden Arealen ist der Körper Punkt für Punkt repräsentiert, und zwar auf dem Kopf stehend. In der Nähe des Schädeldachs werden Muskelbewegungen oder Kitzelgefühle im Fuß ausgelöst, ganz unten Bewegungen oder Reizgefühle im Gesicht. Das entsprechende "Rindenmännchen" ist ungewohnt proportioniert: sehr große Füße und Hände, großer Kopf, enorme Lippen. Sein bizarres Aussehen wird durch regelungstechnische Notwendigkeiten bestimmt. Die Hände als Werkzeuge des Hantierens, Lippen und Zunge als Werkzeuge des Sprechens, all das bedarf einer viel differenzierteren Steuerung als etwa die Oberarme. In die Steuerung dieser Körperteile sind überdurchschnittlich viele Hirnrindenzellen einbezogen - zu Lasten anderer Körperregionen, die unter einem viel geringeren Regelungsaufwand beherrscht werden können.
Das motorische und das sensible Rindenzentrum sind unmittelbar benachbart. Warum?
Jeder, der schon einmal mit einem "eingeschlafenen Bein“ versucht hat zu gehen, weiß warum. Ein geordneter Bewegungsablauf ist ohne ständige sensible Rückmeldung unmöglich. Beide Zentren konnten sich nur "Hand in Hand" entwickeln.
Daß das motorische Sprachzentrum, welches sich einseitig (bei Rechtshändern auf der linken Seite) an das motorische Rindenfeld drückt, leuchtet ein. Schließlich ist das motorische Sprachzentrum auch für die differenzierte Steuerung von Lippen- und Zungenbe- wegungen zuständig. Es ist trotzdem auffällig, daß es mit dem mo- torischen Zentrum nicht identisch ist. Sprechen ist offenbar mehr als nur eine besonders differenzierte Muskelkoordination. Darauf weist auch die andere Grenze des motorischen Sprachzentrums hin, das Stirnhirn, das es nur beim Menschen gibt. Das motorische Sprachzentrum leistet nämlich vor allem, gar nicht präsente Objek- te und abstrakte Begriffe in akustische Symbole umzusetzen!
Das Hörzentrum grenzt an die sensible Rindenregion. Das erinnert daran, daß das Gehör ein Abkömmling der Haut ist.
Die Sehrinde liegt weit entfernt von der sensiblen Hirnrinde auf dem Hinterhauptlappen. Müßte die Sehrinde nicht ebenfalls an die "Körperfühlsphäre" grenzen, da das Auge doch ebenfalls ein Ab- kömmling der Haut ist? - Jawohl, der "Lichtsinn" ist ursprünglich wahrscheinlich ein diffuser Hautsinn gewesen. Das liegt aber schon so unvorstellbar lange zurück, daß die gemeinsame Abstammung nicht mehr ohne weiteres erkennbar ist. Beide Zentren sind ausei- nandergewandert, die Sehrinde löste sich allmählich von der "Kör- perfühlsphäre" ab. Es entstand ein neues "Rindenkind". Dessen "Eltern" waren die Körpersensibilität und das Sehen. Welche Ei- genschaften hat so ein Kind?
3. die "Raum- und Zählrinde"
Das Rindenstück zwischen der sensiblen Rinde und der Sehrinde leistet etwas, was wir Raumvorstellung nennen. Dabei erweist sich, daßder Zahlenbegriff und die Rechenfähigkeit auf subtile Weise an die Raumvorstellung geknüpft sind.
Patienten mit einem typischen Scheitellappen-Syndrom - "Gerstmann-Syndrom" - haben Schwierigkeiten, rechts und links zu unterscheiden. Sie verwechseln die Finger ihrer Hände, und sie können kaum noch kopfrechnen.
Diese Störungen hängen mit dem zusammen, was wir "Raumvor- stellung" nennen. Daß die Raumvorstellung aus dem Gefühl für den eigenen Körper hervorgegangen ist, leuchtet ein. Zum Erleben dieses Raumes gehört aber auch die Wahrnehmung meiner Position relativ zur Außenwelt, die optische Wahrnehmung. Insofern leuch- tet auch die Verwandtschaft zur Sehrinde ein.
Ein Raum, der so im Bewußtsein auftaucht, ist in drei Dimensionen orientiert. Zwei davon sind eindeutig festgelegt, nämlich "senk- recht" und "waagerecht". Die Senkrechte ergibt sich durch die Schwerkraft ("oben" und "unten"). Die Waagerechte ergibt sich aus der Richtung meiner eigenen Bewegung ("vorn" und "hinten").
Die letzte Dimension ergibt sich nicht von selbst, nämlich die Dimension "links" und "rechts". Die rechte und die linke Körperhälfte sind symmetrisch und damit grundsätzlich - als Richtungen - austauschbar. Die Richtungen der ersten beiden Dimensionen sind eindeutig voneinander unterscheidbar und D ie "Links-rechts-Dimension" ist nicht eindeutig und objektiv un- terscheidbar. Sie ist eine Leistung des den Raum erlebenden Sub- jekts. Es ist ein Willkürakt, der eine bewußte Orientierung ermög- licht.
Dieser so gegliederte Raum scheint eine Voraussetzung zum Zäh- len zu sein. Erst diese Raumgliederung weist einem Objekt, wel- ches wiederholt vorkommt, einen bestimmten Ort zu. So wird es zu einem wiedererkennbaren, individuellen Einzelelement, und läßt sich mit einer Zahl belegen. Dadurch bekommt das Element eine unverwechselbare Stellung.
Es ist vielleicht nicht nur die Bequemlichkeit des Nächstliegenden, wenn ein Erstklässer beim Rechnenlernen zuerst an den eigenen Fingern abzählt, bevor er zum Umgang mit vorgestellten Zahlen übergehen kann.
4. der Ursprung des Denkens und das stereoskopische Sehen
Unsere Raumvorstellung ist aufs engste verknüpft mit unseren Augen. Eine entscheidende Bedingung der optischen Raum- wahrnehmung ist das stereoskopische Sehen, das allerdings keineswegs zu diesem Zweck "erfunden" wurde! Ein Beispiel für die Absichtslosigkeit evolutionärer Entwicklungen. Man kann davon ausgehen: auch Geist und Verstand waren keineswegs "Ziel" irgendeiner Entwicklung.
Es gibt eine Beziehung zwischen der optischen Wahrnehmung und dem, was wir "abstraktes Denken" nennen. Konrad Lorenz meint, daß ein innerer Vorstellungsraum der Ursprung allen Denkens sei. Dieser innere Vorstellungsraum kann aber nur dann entstehen, wenn man über eine Raumvorstellung verfügt. Die für Menschen wichtigste Raumvorstellung ist die optische. Diese wiederum hat eine Besonderheit zur Voraussetzung: das stereoskopische Sehen, eine Überschneidung der Gesichtsfelder beider Augen. Es ist gut, die Fähigkeit zur Raumwahrnehmung zu besitzen, es ist gut, ste- reoskopisch sehen zu können.
Das stereoskopische Sehen wurde aber nicht wegen der besseren Raumwahrnehmung erfunden!
Ein gutes Beispiel für die Zufälligkeit und Absichtslosigkeit der Evolution.
Die Augen waren ursprünglich seitlich angeordnet, so daß das Seh- feld insgesamt sehr groß war. Was hat die Wanderung der Augen im Schädel in eine frontale Stellung veranlaßt? Das stereoskopische Sehen kann es nicht gewesen sein, denn dieser Erfolg stand erst am Ende der Veränderung. Der Vorteil muß aber, um als Ursache ge- wirkt haben zu können, vom ersten Augenblick an spürbar gewesen sein. Er muß auch größer als der Nachteil gewesen sein, daß in Folge der Augenwanderung ein immer größerer Teil des rückwär- tigen Gesichtsfeldes der optischen Kontrolle entzogen war.
Die Überschneidung der Gesichtsfelder geht mit einer rund zehn- fach höheren Lichtempfindlichkeit einher! Das ist der immense Vorteil nachtaktiver Lebewesen.
Das "Eigenrauschen" oder "Eigengrau" ist eine schwache Licht- empfindung bei völliger Dunkelheit und resultiert aus geringfügi- gen molekularen Vorgängen in der Netzhaut, die oberhalb des ab- soluten Nullpunkts unvermeidlich sind. Lichteindrücke können nur so lange registriert werden, wie sie eindeutig vom "Eigenrauschen" der Netzhäute zu trennen sind. Das geht nur dann, wenn ein eintref- fender Lichtreiz über dem "optischen Rauschpegel" liegt.
Wenn man allerdings zwei Augen hat, die das gleiche sehen, gibt es noch eine andere Möglichkeit: den Vergleich. Ein schwacher Lichtreiz, der in beiden Netzhäuten im gleichen Augenblick an der- selben Stelle registriert wird, muß von außen kommen! Das Gehirn muß also "nur" die von beiden Augen kommenden Informationen miteinander vergleichen.
Aus diesem Grunde überlappten sich ursprünglich die Gesichtsfel- der! Die stereoskopische Augenstellung hat aber auch einen kleinen Mangel: das Abbild im Auge hatte eine Doppelkontur, eine Rand- unschärfe, da die projizierten Abbilder auf den beiden Netzhäuten niemals völlig identisch sind. Dieser Nachteil fiel anfangs nicht ins Gewicht, da es auf das "Bild" nicht ankam (Bewegungssehen). Und später wurde das Doppelbild dazu verwendet, um Tiefe und Kör- perlichkeit zu vermitteln. Schon wieder hieß es: "Aus der Not eine Tugend gemacht".
Die Evolution hat zweifellos noch in zahlreichen anderen Entwick- lungen überraschende Haken geschlagen, die wir noch gar nicht kennen. Die Evolution ist gänzlich ziellos und unvorhersehbar. Auch der "Geist", das Denken und das abstrakte Vorstellungsver- mögen waren nie Ziel, sondern ergaben sich stets unmittelbar aus dem Nächstliegenden, wobei oft ein Nachteil in einen Vorteil ver- wandelt wurde.
5. die stummen Zonen
Es gibt auf der Großhirnrinde Areale, die sich keiner bestimm- ten psychischen Leistung zuordnen lassen. Das sind die "stum- men" Zonen. Sie sind nicht auf bestimmte Funktionen festgelegt und deshalb für alle Zwecke offen.
Die Stirnhirnrinde ist eine besonders große "stumme Zone". Man könnte vielleicht sagen, daßdieses Gehirnareal den Menschen vom Tier unterscheidet, denn selbst bei anderen Primaten ist die Stirnhirnrinde - sofern vorhanden - ganz klein. Ist die Stirnhirnrinde das Organ der menschlichen Freiheit?
Die Rindenareale sind kein Mosaik, aus denen sich die Gesamtheit unserer psychischen Fähigkeiten zusammensetzt. Genau das war aber lange Zeit nicht klar. Man entdeckte die oben besprochenen Rindenareale, und fand, daß sie bestimmten Leistungen und Fähig- keiten entsprachen. Auf der anderen Seite fand man Rindenareale, die "stumm" zu sein schienen. Verletzungen in solchen Hirnrin- denbereichen führten zu keinen spezifischen Ausfällen. In ihnen ließ sich keine greifbare Funktion nachweisen.
Man bemühte sich hartnäckig, diesen stummen Zonen psychische Leistungen zuzuordnen. Irgendwo müßten die Leistungen, die durch die schon bekannten Rindenzonen nicht abgedeckt werden, doch zu finden sein? Insbesondere das Stirnhirnareal erwies sich als rätselhaft: eine einzige große stumme Zone. Dieser Teil des Ge- hirns war entwicklungsgeschichtlich gesehen der jüngste. Und ge- rade er sollte ohne Funktion sein?
Heute ist das Rätsel (wahrscheinlich) gelöst: die "stummen Zonen" ist die Vervollkommnung des Prinzips der "Leerstelle". "Leer" heißt: nicht auf bestimmte Funktionen festgelegt und deshalb frei verfügbar. "Leer" bedeutet aber auch, daß zum allerersten Male ei- ne Abbildung der Umwelt ohne deren Vorwegnahme durch Pro- gramme oder Instinkte wirksam werden kann. Eine objektive Au- ßenwelt taucht im Gehirn auf. Damit ist die Abtrennung des Indivi- duums von der Außenwelt vollzogen, die vor unendlich langer Zeit durch das Aufrichten einer trennenden Zellmembran eingeleitet worden war.
In dem Maße, in dem "leere" Rindengebiete entstehen, wird der Aktionsspielraums des Individuums größer und die Möglichkeit des eigenen Verhaltens beliebiger.
"Leere" Rindenareale dienen keinem bestimmten Zweck; selbst massive Schädigungen haben meist keine greifbaren Ausfälle zur Folge. Die Elastizität dieses auf keine bestimmte Aufgabe speziali- sierten Teil des Großhirns ist so groß, daß die Funktionen zerstörter Areale oft von intakt gebliebenen Stirnhirnteilen mitübernommen werden können.
Die Stirnhirnrinde ist der materielle Grund für die Vielfalt mensch- lichen Verhaltens.
Aber weder das Stirnhirn noch das Großhirn sind autonom. Sie ar- beiten selbstverständlich mit den anderen Teilen des ZNS zusam- men. Der Hirnstamm ist die biologische Voraussetzung des Zwi- schenhirns, und beide zusammen sind ihrerseits das biologische Fundament, auf dem das Großhirn ruht. Die menschliche Freiheit hat also Grenzen.
6. eine Frage der Kooperation
Die Informationen, die ins Großhirn gelangen, wurden vorher sämtlich auf Zwischenhirnniveau bewertet und dringen mehr oder minder deutlich auch ins Bewußtsein. Das ist manchmal problematisch, weil das Zwischenhirn in seiner Ausrichtung starr ist und nicht rational sein kann.
Gefühle sind nichts anderes als der Widerschein von Prozessen, die sich auf Zwischenhirnniveau abspielen.
Obwohl es im Verhältnis Großhirn zu Zwischenhirnöfters zu "Spannungen" kommt,überwiegt die Kooperation.
Alle Verbindungen zwischen dem Großhirn und der Außenwelt verlaufen durch Zwischenhirn und Hirnstamm. Alle. Das Stirnhirn und die übrige Hirnrinde mag hoch entwickelt sein, aber sie haben keinen direkten Zugang zur Außenwelt. Jede Information, die ins Großhirn geht, mußte vorher das Zwischenhirn passieren. Das Zwi- schenhirn hat aber seine eigenen, archaischen Gesetze. Das hat größten Einfluß auf das menschliche Verhalten.
Sowohl das Zwischenhirn als auch das Stammhirn sind nicht lern- fähig, diese Leistung taucht ja erst beim Großhirn auf. In den älte- ren Hirnabschnitten sind die Aufgabenstellungen und -lösungen fi- xiert, die in der Epoche galten, in der die Evolution diese Rege- lungsorgane hervorbrachte. Es handelt sich also um sehr konserva- tive Fixierungen. Das ist im Falle des Stammhirns belanglos. Die elementaren biologischen Bedürfnisse eines Vielzellers haben sich im Laufe der Jahrmilliarden nicht wesentlich geändert.
Zwischen dem Zwischenhirn und dem Großhirn liegt allerdings ei- ne Kluft, und zwar deshalb, weil das Großhirn die Bedingungen und Möglichkeiten unserer Existenz radikal geändert bzw. erweitert hat, und zwar um eine soziale und historische Dimension.
Die archaischen Gehirnteile färben das Bild der Welt, das sich dem Großhirn darbietet. Die Wirklichkeit des Zwischenhirns steckt nicht nur tief in den untersten Schichten unseres Bewußtseins und bestimmt beispielsweise den Ablauf unserer Träume. Die Wirk- lichkeit des Zwischenhirns ist auch im Wachbewußtseins stets le- bendig. So erscheint uns - sofern wir Hunger haben - ein gutrie- chendes Essen unweigerlich als verlockend. "Verlockend" ist ein Essen aber nur dann, wenn auf Zwischenhirnebene der Geruch der Speise als Auslöser wirksam wird. Ohne diese Bereitschaft gehört der Geruch nicht zur "Zwischenhirnwirklichkeit".
Wir können nicht umhin, auch die Reaktionen zu erleben, die sich an uns selbst auf Grund der Aktivität des Zwischenhirns abspielen.
Wir erleben so eine Reaktion stets als Gefühlserlebnis!
Wir werden also gefühlsmäßig verlockt, und zwar unabhängig da- von, ob die Speise uns gehört oder nicht! Es entsteht die Tendenz, sich der Speise zu bemächtigen, wobei die Intensität des Handlungsantriebs vom Grade der inneren Bereitschaft abhängt.
Es gibt also einen gewissen Zwiespalt zwischen den Antriebstendenzen unseres Zwischenhirns und unserer zivilisierten Umwelt.
Dieser Zwiespalt ist die Wurzel der Irrationalität menschlichen Verhaltens!
7. Stimmungen und Gefühle
Unser Körper ist in jedem Augenblick damit beschäftigt, eine Vielzahl von vegetativen Funktionen zu regeln. Das Prinzip die- ser Regelung ist die Rückkoppelung. Dieses Prinzip bringt es mit sich, daßfast alle Körperfunktionen um einen bestimmten Soll- wert rhythmisch schwingen: unser Biorhythmus. Ins Bewußtsein gelangen diese Abstimmungsprozesse als Gefühlsschwankungen oder Stimmungen.
Die Aufrechterhaltung des Ablaufs aller komplizierten Stoffwech- selvorgänge ist allen Lebewesen gemeinsam. Diese Aufgabe wird mit einem Regelungsmechanismus bewältigt, dessen Grundprinzip die Rückkopplung ist. Dieses Prinzip hat - wenn man es so nennen will - einen Mangel: es kann keinen Sollwert konstant stabilisieren. Alle kontrollierten Größen "schwingen" um den angestrebten Wert. Diese Eigentümlichkeit ist Ausdruck und Folge des gleichen Prin- zips, auf Grund dessen Rückkopplung überhaupt funktioniert und somit "systemimmanent". Zum Beispiel kann der Regelungsme- chanismus zur Aufrechterhaltung des Blutzuckers erst dann in Gang kommen, wenn der Traubenzuckergehalt des Blutserums um einen nennenswerten Betrag vom biologischen Optimum abgewi- chen ist. Passiert das, werden körpereigene Reserven mobilisiert, gleichzeitig wird die Schwelle für das Programm "Nahrungser- werb" herabgesetzt: wir haben Hunger. Bald beginnt der Blutzu- ckerspiegel wieder zu steigen, aber der Anstieg kommt nicht in dem Augenblick zum Stehen, in dem der Sollwert erreicht ist. So schnell lassen sich die Hormone nicht aus dem Blut entfernen, und also setzt unser Hungergefühl auch nicht "im richtigen Moment" aus. Auch hier muß der Traubenzuckergehalt um einen beachtli- chen Betrag "nach oben" abweichen, ehe er ein Signal darstellt. Der Sollwert selbst kann dieses Signal nicht sein, denn er ist identisch für die einzige Situation, an der nichts geändert werden soll. Das System muß über das Ziel hinausschießen, bis eine Gegenregulati- on in Gang kommt.
Alle unsere inneren, vegetativen Körperfunktionen funktionieren so. Es sind rhythmische Funktionen mit ganz unterschiedlichen Einzelrhythmen. Sie alle müssen aufeinander abgestimmt sein.
Diese Vielfalt an rhythmisch-koordinierten Einzelfunktionen hat eine Bewußtseinsentsprechung: unsere Stimmungsschwankungen.
Zwar ist es im Einzelfall kaum möglich anzugeben, welche Stim- mungsschwankung psychologisch und welche physiologisch ausge- löst ist.
Ein Gefühl von Lustlosigkeit nach einer schweren Enttäuschung unterscheidet sich für uns in nichts vom gleichen Gefühl, das wir als Folge einer beginnenden Grippe erleben können, die sich noch durch kein anderes Anzeichen verrät.
Auch der umgekehrte Fall ist häufig: grundlose Glücksgefühle, ei- ne unerklärliche "Beschwingtheit". Auch sie hat ihre Entsprechung im biologischen Fundament: eine vorübergehende, besonders har- monische Abstimmung aller vegetativen Einzelfunktionen des ei- genen Körpers.
So sind wir permanent auf irgendeine Weise gestimmt.
8. alles andere als souverän - unser Großhirn
Ein Gefühl ist nichts anderes als der Widerschein der Aktivität von Gehirnteilen, die dem Großhirn untergeordnet sind. Diese Aktivität wird vom Bewußtsein als "Gefühl" registriert. Insofern sind Gefühle weitgehend dem gewollten Einflußentzogen.
Da unser Stamm- und Zwischenhirn ständig aktiv sind, sind wir auch ständig irgendwie "gestimmt", sprich: in irgendeiner Weise auf unsere Umwelt ausgerichtet.
Kann man ein derartiges Weltbild "objektiv" nennen?
Das, was wir Geist nennen, - das ist auch ein Fazit dieses Buches - ist gebunden an die Struktur unseres Gehirns. Er ist bestimmten Bedingungen materieller Existenz unterworfen.
Das, was wir als unsere Stimmungen, Antriebe und Gefühle erle- ben, ist der Widerschein der Aktivitäten unseres Zwischenhirns in unserem Großhirn. Alle diese Erlebnisse sind unserem willentli- chen Einfluß entzogen. Wir können nicht vergnügt, müde oder hungrig werden, wann wir wollen. Es sind eben keine Aktivitäten unserer Psyche, sondern es ist unser Bewußtsein, welches das A- gieren untergeordneter Zentren registriert.
Unsere Stimmungen und Gefühle beeinflussen unser Tun und Den- ken, mehr noch: wir sind ihnen ausgesetzt. Jede Stimmung, jedes Gefühl richtet uns in ganz bestimmter Weise auf unsere Umwelt aus. Gefühle und Stimmungen sind nichts anderes als die Art und Weise, in der wir unsere Instinkte erleben.
Das permanente - lebensnotwendige - Funktionieren des Zwi- schenhirns bringt es mit sich, daß wir dauernd irgendwie "ge- stimmt" sind. Somit ist jeder Mensch in jedem Augenblick unter dem Einfluß der in unserem Zwischenhirn gespeicherten Programme in irgendeiner Weise ausgerichtet.
Die Regeln des Zwischenhirns beherrschen unsere Welt nicht mehr, aber sie bestimmen auf subtile Weise ihren Charakter. Denn unsere Welt ändert nicht mehr ihre Zusammensetzung (auf Zwi- schenhirnebene tauchen bestimmte Sachen ja gar nicht in der Reali- tät auf), aber ihre Qualität.
Eine solche Welt ist nicht objektiv. Das ist eine Illusion, die wir uns machen.
9. unsere biologische Hypothek
Die Frage "Was ist der Mensch" hat die Philosophen seit einigen tausend Jahren beschäftigt. Die Antwort der modernen Biologie lautet: "Der Mensch ist ein Wesen, welches aufgrund des Besit- zes anachronistischer Gehirnteile von unterschiedlichen An- triebstendenzen bestimmt wird": Der Mensch ist eben nicht (nur) vernünftig!
Diese reale Einschätzung unserer biologischen Situation hat nichts mit Fatalismus zu tun, sondern mit Einsicht.
Für mörderische Auseinandersetzungen und für blutige Schreckenstaten lassen sich immer auslösende Situationen und einleuchtende Motive angeben. Aber an dieser Stelle täuschen wir uns über unsere Situation. Was uns tief beunruhigt, ist die Erfahrung, daß der Mensch unfähig zu sein scheint, Konflikte friedlich und rational zu lösen. Wir treiben Friedensforschung und entwickeln komplizierte Theorien über die Wurzeln menschlicher Aggressivität.
Unser Erschrecken vor den Ausdrucksformen menschlicher Irratio- nalität ist berechtigt. Aber ist auch eine Folge der Tatsache, daß wir uns für rationaler und vernünftiger halten, als wir es in Wahrheit sind. Wer allzuviel erwartet, wird leicht enttäuscht!
Wer könnte Einsicht und Vernunft von einem Wesen verlangen, das in zwei verschiedenen Welten zugleich existieren muß? Unsere Gedanken und unsere Weltsicht werden von einem Hirnteil mitbe- stimmt, der nachweislich lernunfähig ist und der keine Fähigkeit zu rationaler Einsicht hat. Der anachronistische Aufbau unseres Ge- hirns setzt unserer Rationalität Schranken.
Warum wehren wir uns, biologische Faktoren als Rahmenbedin- gungen für die menschliche Freiheit anzuerkennen? Eine solche re- alere Einschätzung unserer eigenen Möglichkeiten würde uns viel- leicht toleranter werden lassen.
Solange wir den biologischen Rahmen nicht erkennen, der unsere Einsichtsfähigkeit beschränkt, laufen wir Gefahr, die Ursachen dieser Beschränkung an der falschen Stelle zu suchen.
Der Mensch geht nun einmal rational nicht ohne Rest auf. Manche Übel erweisen sich deshalb nicht als restlos aufhebbar, weil sie Ausdruck der Unvollkommenheit unserer Natur sind.
Diese Unvollkommenheit zu erkennen und hinzunehmen, das ist das äußerste, wozu unsere Vernunft fähig ist.
10. wo kommt der Geist her?
Die Frage nach der Herkunft des Geistes l äß t sich nicht er- schöpfend mit der Geschichte des Gehirns beantworten. Denn in Analogie zu Konrad Lorenz ´ "Die Flosse des Fisches ist das Ab- bild des Wassers und bildet dessen Eigenschaften ab" ist das Gehirn ebenfalls ein Hinweis auf die Existenz von etwas, wofür uns möglicherweise das Wort fehlt.
Die von uns erlebte Wirklichkeit ist stark abhängig von der Be- schaffenheit unserer Wahrnehmungsorgane und von der Struktur unseres Denkens. Somit ist diese von uns erlebte Wirklichkeit zu einem guten Teil die Schöpfung unseres Gehirns.
Es ist sicher nicht verkehrt anzunehmen, daß unser Gehirn sich mit der realen Welt irgendwie auseinandersetzt, wobei sie für uns je- doch hinter der Fassade unserer Wirklichkeit verborgen ist.
Die Welt hört mit Sicherheit nicht dort auf, wo unser Wissen zu Ende ist.
Augen waren eine Reaktion der Entwicklung auf die Tatsache, daß die Oberfläche der Erde von einer Strahlung erfüllt ist, die von fes- ten Gegenständen reflektiert wird. Das gab der Evolution die Mög- lichkeit, Organe zu entwickeln, die sich dieser Strahlung zur Orien- tierung bedienten. Deshalb sind die Augen ein Beweis für die Exis- tenz der Sonne, so wie ein Flügel ein Beweis ist für die Existenz der Luft.
Genauso wird auch unser Gehirn ein Beweis sein für die reale Exis- tenz einer von der materiellen Ebene unabhängigen Dimension des Geistes.
Geist und Verstand sind nicht erst mit uns in die Welt gekommen. Mit anderen Worten: es gibt Geist und Verstand nicht deshalb, weil es Gehirne gibt. Genau die umgekehrte Sichtweise gilt: Gehirne konnten nur deshalb entstehen, weil Geist und Verstand schon vor- her die Möglichkeit offenließen, sie entstehen zu lassen.
[...]
1 die Einteilung der Hirnentwicklung - Stammhirn, Zwischenhirn, Großhirn - ist eine mögliche von mehreren anatomischen Gliederungen unseres Gehirns
2 das "Zwischenhirnwesen" ist ein theoretisch abstrahierter Idealtyp, der die We- sensmerkmale eines bestimmten Entwicklungsniveaus in reinerer Form aufweist, als ein bestimmtes Lebewesen, welches immer mehr oder weniger vom "Typi- schen" abweicht
3 das Großhirn von Vögeln ist so klein, daß sie vorwiegend vom Zwischenhirn beherrscht werden
- Arbeit zitieren
- Christian Kubli (Autor:in), 2002, Zu "Der Geist fiel nicht vom Himmel" von Hoimar v. Ditfurth, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106682
Kostenlos Autor werden


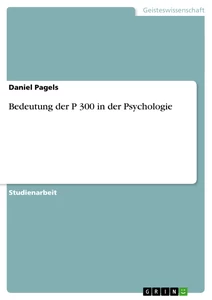

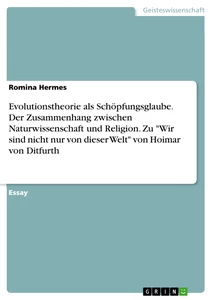




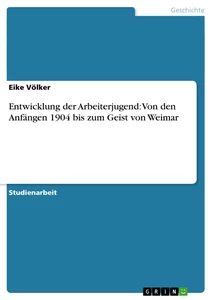



![Titel: Evaluation der Evaluation von Train-the-Trainer-e-Learning-Seminaren auf der Basis der Operativen Lerntheorie am Beispiel des Kurses [e-Moderationskurs]](https://cdn.openpublishing.com/thumbnail/products/30331/medium.webp)
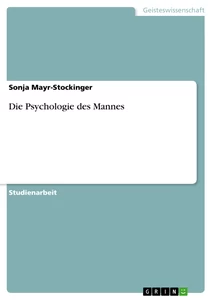
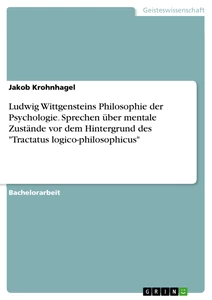






Kommentare