Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung - Die Relevanz einer Betrachtung der zünftigen Handwerkererziehung für eine moderne Theorie der Berufserziehung
2. Eine zeitliche Einordnung
3. Die Funktionen und Aufgaben der Zünfte in der ständischen Gesellschaft
3.1. Die Kontrolle des Marktes
3.2. Wahrung der Qualität der Handwerksarbeit
3.3. Die Zunft als Polizei
3.4. Die sittlich-kulturelle Funktion der Zünfte
3.5. Ihre religiös-kirchliche Funktion
4. Die zünftige Berufsausbildung
4.1. Die Aufnahmebedingungen
4.1.1. Das Erfordernis der ehelichen Geburt
4.1.2. Das Erfordernis der ehrlichen Geburt
4.1.3. Das Erfordernis der freien Geburt
4.1.4. Das Erfordernis der deutschen Geburt
4.1.5. Das Erfordernis der christlichen Geburt
4.2. Die Erziehung der Lehrlinge
4.2.1. Die Aufdingung
4.2.2. Der Lehrvertrag
4.2.3. Die familiale Struktur der Lehre
4.2.4. Das didaktische Prinzip der Imitation
4.2.5. Das Ziel der Lehre
4.3. Der Geselle
4.3.1. Die Gesellentaufe
4.3.2. Die Wanderschaft
4.4. Das Meisterrecht
4.4.1. Die Qualifikation des ‚Meister-Gesellen‘
5. Bibliographie
1. Einleitung - Die Relevanz einer Betrachtung der zünftigen
Handwerkererziehung für eine moderne Theorie der Berufserziehung Es stellt sich die Frage, warum die zünftige Handwerkserziehung der ständischen Gesellschaft im Rahmen einer Veranstaltung zu den „Stationen einer Theorie der (Berufs)erziehung“ behandelt werden sollte:
Ausbildung in der heutigen Zeit bedeutet vor allen Dingen eine Qualifizierung des Auszubildenden im angestrebten Beruf, während in der zünftigen handwerklichen Erziehung vor allem die Sozialisation des Zöglings in seinem Stande ausschlaggebend war. Dennoch läßt sich die traditionelle Form der Ausbildung immer noch, vor allem in der Dreigliedrigkeit von Lehrlingsschaft, Gesellenschaft und Meisterschaft , erkennen. Aus diesem Grund gehört sie in jedem Fall als Ausgangsstation der Berufserziehung in den Zusammenhang unserer Veranstaltung.
Wilhelm Wernet stellt in Bezug auf verschiedene andere Autoren noch einen weiteren Gesichtspunkt der Relevanz dar1.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Berufserziehung entstand ein geordnetes Ausbildungssystem in Form der Handwerkslehre unter den besonderen Umständen der mittelalterlichen Arbeits- und Produktionsgegebenheiten. Wie im folgenden gezeigt werden wird, war diese Erziehung nicht ausschließlich auf das Erlernen der berufsspezifischen technischen Fertigkeiten gerichtet, sondern sie führte den Lehrling in den gesamten Lebenskreis des Meisters ein. Sein ganzes Leben richtete sich aus auf das Vorbild des Meisters, seine handwerkliche Leistung und Berufshaltung.
Im Vergleich mit dem heutigen Ausbildungssystem wird deutlich, dass die Pädagogik sich bei der Herausarbeitung wesentlicher Züge des heutigen beruflichen Bildungs- und Erziehungswesens auf dieses Modell des Handwerks gestützt hat. Berufspädagogische Erkenntnisse, begründet auf einen unmittelbaren Bezug zum Handwerkswesen, bemühen sich um berufsspezifische Objektivität. In allen wesentlichen Punkten werden auf das Handwerk bezogene Überlegungen verschiedenster Art von der pädagogischen Lehre gestützt. So heißt es beispielsweise in der Literatur, dass der Auszubildende in den Erfahrungsbereich des Handwerks angemessen hineinwächst.2 Dieser Reifungsprozess während der handwerklichen Ausbildung findet durch absichtlich konstruierte oder zufällig auftretende Lebenserfahrungen statt, die entweder durch Einwirkung von Personen (Meister, Vorarbeiter, Kollegen, u.ä.) oder durch die Beschäftigung mit Sachen (Arbeitsstoffe, Werkzeuge, Maschinen) hervorgerufen werden. Dieser Prozess zielt auf angemessene und selbständige Haltung und Leistung des Lehrlings im angestrebten Beruf.
2. Eine zeitliche Einordnung
Die vorliegende Arbeit geht im Wesentlichen auf die beiden in der Bibliographie genannten Werke von Karlwilhelm Stratmann ein. 1967 befaßt er sich mit der Krise der Berufserziehung, die besonders im 18. und 19. Jahrhundert große Veränderungen mit sich bringt. In dem neueren Werk wird diese Entwicklung ebenfalls, wenn auch nicht so gründlich, abgehandelt. Hier wird die Zeitspanne zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs (1648) und der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (1806) näher beleuchtet. Im Berennpunkt steht die gewerbliche Lehrlingserziehung dieser Zeit, in der die Zünfte das Handwerk dominierten. Besonders auf die gesetztlichen Regelungen und Veränderungen in diesem Bereich nimmt Stratmann bezug.
Die Zünfte waren die Organisationsform des Handwerks in der ständischen Gesellschaft vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Die frühesten Urkunden stammen aus dem 11.Jahrhundert und bekunden ihre Entstehung aus freiwilligen genossenschaftlichen Zusammenschlüssen.
Anfangs standen die Zünfte allen Gewerbetreibenden mit uneingeschränkter Mitgliederzahl offen, im Laufe der Zeit und mit wachsender Bevölkerungszahl entwickelten sie sich schließlich zu kartellartigen Organisationen eines kleinen Kreises von Handwerkerfamilien. Trotz den auf Jahrhunderte gesehen und auf viele gesellschaftliche, soziale und politische Entwicklungen zurück zu führenden Veränderungen blieben bestimmte Grundelemente des zünftigen Selbstverständnisses bis zu deren Verfall erhalten. Dies lag vor allem an der bekannten Traditionsverbundenheit der Handwerker, die sie trotz der vielen gesetzlichen Vorschriften lange an den althergebrachten Vorgehensweisen festhalten ließ. Diese werden im weiteren näher beschrieben.
Die vorliegenden Ausführungen behandeln deshalb im Gegensatz zu Stratmann nicht die zünftige Handwerksausbildung unter Berücksichtigung der gesamtgesellschaftlichen Veränderungen. Vielmehr werden die grundlegenden Vorstellungen der Zünfte beschrieben, wie sie trotz wachsender staatlicher Beeinflussung bis ins 19. Jahrhundert im wesentlichen erhalten blieben. Denn obwohl im Rahmen des Merkantilismus ab dem 17. Jahrhundert die großgewerblichen Betriebsformen wie Manufakturen und Fabriken von der staatlichen Förderung vorgezogen wurden, hielten die etablierten Handwerker an ihrer Organisationsstruktur fest.
3. Die Funktionen und Aufgaben der Zünfte in der ständischen Gesellschaft
Hort aller Handwerkstradition bis zur Schwelle des 19. Jahrhunderts waren die Zünfte. Als genossenschaftliche Zusammenschlüsse verschiedenen Berufsgruppen stützten sie sich auf Zunftordnungen. Diese enthielten neben den Aufnahmebedingungen unter anderem die Bestimmungen über die Ausbildung von Lehrlingen und Gesellen3, die Rechte der Zunftangehörigen und die Arbeitszeit. Außerdem wurden in ihnen wirtschaftliche und organisatorische Aspekte geklärt.
Die Zünfte sorgten für ein standesgemäßes Einkommen der Meister und ihrer Familien wie auch für angemessene Preise zugunsten der Verbraucher. Außerdem unterlag die als Rohstoff von Kaufleuten gelieferte Ware zur Wahrung der Qualität strenger Gütekontrollen. Durch Vorschriften zur Regelung der Produktionsmenge begrenzten sie die Konkurrenz und verhinderten so die übermäßige Bereicherung weniger. In Wahrnehmung ihrer fürsorglichen Pflichten unterstützten sie die wirtschaftlich Schwachen unter den Zunftgenossen. Damit waren die Zünfte nicht nur genossenschaftliche sondern auch ständische Korporationen, ergo Glied der sozialen und politischen Ordnung.
Die Zünfte waren Gemeinschaften, die das Leben der Stadtbürger in gesellschaftlicher, sozialer und religiöser Hinsicht bestimmten.
3.1. Die Kontrolle des Marktes
Die Wacht über den Markt und der Schutz der Zunftgenossen im unumgänglichen alltäglichen Konkurrenzkampf war der wichtigste Zweck der Zunft. Die Grundlage dieser kontrollierten Marktwirtschaft ohne jegliche Gewerbefreiheit war der Grundsatz der ‚gerechten Nahrung‘, der besagte, dass „allen Handwerkern - unter Verpflichtung zur Lieferung brauchbarer Ware - gleichmäßig zu einer halbwegs anständigen Existenz“4 verholfen werde. Dies bedeutete angesichts der begrenzten Ressourcen und des engen Marktes, dass jedem Vollmitglied der Gesellschaft ein ausreichendes Einkommen gesichert wurde. Es sollte unter anderem dadurch gewährleistet werden, dass kein Meister einem anderen die Kunden abspenstig mache. Durch den privilegierten Bereich der zünftigen Obhut erhielt der Genosse mit seiner Familie einwenig Existenzsicherheit in einer unsicheren, von Hungerkrisen und Mängeln bedrohten Zeit. Dieser Schutz war wichtig und galt ebenso für private Notfälle wie Krankheit, Alter und Tod.
Die Methoden der Marktkontrolle waren grundsätzlich traditionsverhaftende Vorgehensweisen der Eingrenzung und Abgrenzung. Stichworte wie Zunftzwang und Zunftbann, Begrenzung der Mitgliederzahl und des Produktionsumfangs beschreiben die Mittel.
Der Zunftzwang band die Berechtigung zum Gewerbebetrieb an die Mitgliedschaft in der Korporation, um so ‚unzünftige‘ Handwerker, sogenannte Pfuscher, Störer und Bönhasen, aus dem Konkurrenzkampf zu verbannen. Die Ausgeschlossenen hatten häufig das Handwerk regulär gelernt und beherrschten es auch angemessen, hatten aber weder die Mittel noch die Möglichkeiten, sich als Meister der Zunft zu etablieren. Obwohl dem Landesherren seit jeher das Recht zustand, den Zunftzwang aufzuweichen, indem er Freimeister konzessionierte, die ohne Zugehörigkeit zu den Zünften arbeiten durften. So jedoch geschah es in den meisten Landstrichen äußerst selten, da die Landsherren häufig ausdrücklich gegen diese Vorgehensweise eingestellt waren. Erst in Laufe der geschichtlichen Entwicklung ergingen zahlreich Reichsabschiede zur Erleichterung des Zugangs zum Handwerk. Aber erst mit der Einführung der Gewerbefreiheit Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Zunftzwang allmählich unbedeutend.
Mit dem Zunftzwang ging der Zunftbann einher. Dies war das Recht der Zünfte auf das Gewerbemonopol in einem umgrenzten Raum, in der Regel im Umkreis von zwei Meilen rings um die Stadt.
Das Monopol nötigte zur strengen Abgrenzung der Produktionsbereiche zwischen den Zünften. Die Definition der Trennungslinien einzelner Gewerke nahm in den Zunftprivilegien breiten Raum ein.
Die Begrenzung der Mitglieder einer Zunft auf eine bestimmte Anzahl wurde die ‚Schließung‘ der Zunft genannt. Sie stellte eine weitere Möglichkeit der Marktkontrolle durch die Zünfte dar. Ein neuer Meister konnte nur aufgenommenwerden, wenn - in der Regel durch Tod - ein Platz frei wurde. Die Schließung wird heute als Abschließung gegen den Fortschritt gedeutet und als wichtigstes Merkmal des Zunftegoismus zur konservativen Erhaltung der Traditionen aufgefasst.
Die Kontrolle des Marktes vermochten die Zünfte zu leisten, solange die einfache Warenproduktion herrschte. Mit den Elementen des Kapitalismus, mit der Idee der Gewerbefreiheit und mit dem Aufkommen der Produktion in Manufakturen kamen Strömungen auf, die stärker waren als der zünftige Zusammenschluß.
3.2. Wahrung der Qualität der Handwerksarbeit
Gleichmäßige, saubere und kunstgerechte Arbeit sicherte das Vertrauen der Kunden und das Ansehen der Zunft, jeder Verstoß brachte sie in Mißkredit. Aus diesem Grund galt die Aufmerksamkeit der Zünfte stets der Qualität der Handwerksarbeit. Sie mußten auf Qualität bedacht sein, wollten sie die ‚Nahrung‘ der Zunftangehörigen behaupten. Die meisten Zünfte kannten daher seit dem Mittelalter die ‚Schau‘, also die Überwachung der Produkte auf Basis bestimmter Qualitätsmerkmale für den jeweiligen Arbeitsbereich. Die Prüfungen wurden von bestellten Schaumeistern oder Altmeistern durchgeführt. In Hinsicht auf die Qualitätswahrung enthielten die Zunftordnungen außerdem Verbote zur betrügerischen Verwendung minderwertiger Ausgangsmaterialien.
3.3. Die Zunft als Polizei
Auf die polizeilichen Funktionen sei kurz hingewiesen. Die Korporationen hatten in ihren Stadtvierteln, in denen Handwerker eines Berufes meist in den sogenannten Gewerbegassen Tür an Tür wohnten, auf Ordnung zu achten. Außerdem war es ihre Aufgabe, als Feuerwehr zu dienen und sich im Verteidigungsfall bzw. bei Unruhen als Bürgerwehr bereit zuhalten, wobei letzteres nach und nach durch die Änderung der Heerverfassung und den Aufbau einer städtischen Gendarmerie in staatliche Hände fiel.
3.4. Die sittlich - kulturelle Funktion der Zünfte
Die Lebensauffassung der Handwerker war sehr kollektiv geprägt. Für jedes Zunftmitglied war bis in den Tod nachvollziehbar, was es bedeutete, eine anständiges Leben zu führen, das durch die vielen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krisen leicht an Ehrbarkeit verlieren konnte.
Ein Beispiel für die sittlich-kulturellen Maximen der Zunft ist der Brauch, dass „ein Geselle nicht eher zum Meister angenommen (wurde), er verspreche denn, eines Meisters Wittwe oder Tochter zu heyrathen.“5
Dieser kollegialen Fürsorgepflicht gegenüber den Familienangehörigen der Zunftmitglieder lag der Gedanke zugrunde, die Zunft so schnell es ging von ihren Verpflichtungen gegenüber der Witwe und ihrer Kinder zu entlasten. Für den kollektiven Anspruch nicht weniger wichtig war außerdem der Gedanke, den Haushalt wieder in dafür schicklichen Hände zu geben. Die Pflichten des Hausvaters mußten um der Ehrbarkeit willen anständig erfüllt werden.
Ein unvollständiger Haushalt galt als unanständig. Besonders wenn ihm weibliches Gesinde angehörte, konnte dieses aus Gründen der Sittlichkeit nicht vom Mann beaufsichtigt werden. Ebenso galt es als unziemlich, wenn eine Frau einer Werkstatt vorstand, zumal wenn es Lehrlinge und Gesellen gab.
Deshalb war in der damaligen Zeit nicht die Liebe der ausschlaggebende Faktor für die Eheschließung, sondern vielmehr die zünftige Vernunft. Der Handwerkerhaushalt wurde in erster Linie als Produktionsgemeinschaft verstanden, in der es auf die ‚Kräfte‘, das Vermögen und die Geschicklichkeit beider zum Zwecke gemeinsamer Geschäftsführung ankam.
In diesem Beispiel zeigt sich, dass die zünftigen Ehrbarkeitsvorstellung und ihr Kollegialitätsbegriff viel mehr beinhalteten, als es im heutigen Verständnis auf den ersten Blick scheint.
Die Wertmaßstäbe gaben den Zunftmitgliedern eine gewisse Stabilität in einer Zeit allgegenwärtig drohender Gefahren. In der vorindustriellen Welt war die Gefahr der Verarmung durch vielseitige Gründe, wie zum Beispiel die vielen nachhaltigen Kriegsfolgen, Seuchengefahren aber auch durch das Altwerden, Leiden und Sterben, so derart bedrohlich und allgegenwärtig, dass das daraus resultierende Leid nicht durch individuelle Fürsorge kompensiert werden konnte. Diese Lebensumstände verlangten eine existenziell kollektive Sicherung.
Welchen hohen Stellenwert die soziale Absicherung der Handwerker auch in politischer Hinsicht hatte, wird bei der Betrachtung verschiedener Gewerbeordnungen dieser Zeit deutlich. Beispielhaft hierfür sei das bayrische Gewerbegesetz von 18256, in dem die „Unterstützung dürftiger Gewerbeangehöriger“ als eine Pflicht der Zunft festgehalten wird.
Die Ausführungen zu den sittlich-kulturelen Aufgaben der Zunft zeigen, dass der Fürsorgegedanke einen wichtigen Rang im kollegialen Selbstverständnis der Handwerkskorporationen einnahm. Er muß als Ergebnis der damaligen sozialen Wirklichkeit gedeutet werde, in der individuelle und kollektive Krisen im sozialen Verband besser überstanden werden konnten.
3.5. Ihre religiös - kirchliche Funktion
Die Zünfte hatten im kirchlichen Leben ihrer Mitglieder eine große Bedeutung. Das zeigt sich noch heute daran, dass wir in Kirchen von Zünften gestiftete Altäre und mit Zunftwappen geschmückten Fenster vorfinden.
Es herrschte eine starke Bindung an die christlich-kirchlichen Lebensformen, die von der Kontrolle des regelmäßigen Kirchgangs bis zum ehrbaren letzten Geleit eines Zunftkollegen reichte.
Jedes Gewerk rief seinen eigenen Schutzheiligen an (beispielsweise die Amler den Hl. Lukas, die Köche den Hl. Laurentius), ließ ihm zu Ehren Messen lesen und veranstaltete an seinem eigenen Partonatstag feierliche Umzüge durch die Stadt. Von der Heiligenverehrung ging eine nicht zu unterschätzende integrative Wirkung aus, indem ihr die Wahrung von
Eintracht und Frieden der Gemeinschaft sowie ihre Sicherung gegen äußere Widersacher und Stabilisierung der korporativen Selbständigkeit zugeschrieben wurde.
4. Die zünftige Berufsausbildung
Wie bereits gezeigt entwickelten die Zünfte ihre Wirksamkeit im Rahmen der mittelalterlichen Stadt in verschiedene Richtungen: sie waren zugleich politische, polizeiliche, kirchliche, gewerbliche und gesellige Vereine, die eine Gemeinschaftlichkeit des öffentlichen Lebens bezweckten. Da auch die Meistersfrauen und -kinder zu den Schutzbefohlenen der Zunft zählten, ragte die Familie in den Bereich der Arbeit hinein. Umgekehrt beeinflusste der übergreifende Zunftverband das familiäre Leben. Diese Zusammengehörigkeit von privaten und beruflichen Belangen wird durch die Einheit von Wohn- und Arbeitsstätte noch verstärkt, denn oft war der Wohnraum der Meisterfamilie gleichzeitig der Werkraum für den Meister mit seinen Lehrlingen und Gesellen. So wurde das Zusammengehörigkeitsgefühl und der Ethos der Zunft ebenso für Arbeit wie für das private Leben verbindlich.
So hatte die Zunft zugleich als Lebens- wie auch als Werkgemeinschaft eine große erzieherische Wirksamkeit, der sich kein Handwerker entziehen konnte. Während der Ausbildung sollte der Lehrling in das alle Lebensbereiche umfassende, von der Korporation geprägte und kontrollierte handwerkliche Leben hineinwachsen. Die handwerkliche Erziehung bedeutete die Aufnahme des Lehrjungen in den meisterlichen Haushalt, die den Charakter einer familiären Gemeinschaftserziehung stützte. Der Wille zur Gemeinschaft, dessen Träger der Junge werden sollte, stand so sehr im Vordergrund, dass die Zunftlehre nicht vorrangig auf Ausbildung und berufliche Qualifizierung angelegt war, sondern vielmehr einem Eingliederungsprozeß diente. Die berufliche Ertüchtigung wurde jedoch als der Eingliederung sehr förderlich angesehen.
4.1. Die Aufnahmebedingungen
Die Aufnahme neuer Mitglieder in die Zunft war seit dem späten Mittelalter abhängig von bestimmten Voraussetzungen. Neben dem Nachweis, sein Handwerk hinreichend zu beherrschen, verlangten die Innungen vom Anwärter außerdem ein Zeugnis über seine Reputation, also über seine zunftwürdige Herkunft und einen ordentlichen Lebenswandel. Dies geschah aufgrund bestimmter Belange der Korporation, soziale Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl wurde nicht übernommen. Anfangs, im Rahmen des mittelalterlichen Stadtwesens, hatte der geforderte Nachweis der handwerkswürdigen Herkunft, vor allem die eheliche, ehrliche, freie, deutsche und christliche Geburt dem Ausschluß des ‚lichtscheuen Gesindels‘ gedient, und darin weitgehende Zustimmung der Zeitgenossen gefunden. Später jedoch wurden diese Aufnahmebedingungen zu einem Mittel verfälscht, die Zahl der Lehrlinge gering und die freiwerdenden Meisterstellen den Handwerkssöhnen vorzubehalten. Diesem Exklusivitätsanspruch wurde zunehmend die öffentliche Anerkennung entzogen.
4.1.1. Das Erfordernis der ehelichen Geburt
Stratmann stütz sich bei der Erklärung zur Entstehung dieses Erfordernis auf die Ausführungen von Friedrich W. Stahl.7 Dieser sieht eine hohe Korrelation zwischen dem Bürger- und dem Meisterrecht. Da Unehelichen das Bürgerrecht verwehrt wurde, durfte es ihnen auch nicht erlaubt sein als Meister in einer Stadt ein ‚bürgerliches Gewerbe‘ zu betreiben. Da es nach der Tradition der Innungen keinen Gesellen geben sollte, der nicht das Meisterrecht erwerben konnte, forderten sie den Nachweis der ehelichen Geburt als prinzipielle Voraussetzung bereits bei den Lehrlingen.
Stratmann erkennt, dass diese Bedingung spätestens im Laufe des 16. Jahrhunderts als ein Mittel verwandt wurde, die Handwerkerzahlen zu beschränken. Aufgrund dessen wurde der Nachweis auch durch die Vorlage verschiedener beglaubigter Zeugnisse erschwert. Je mehr die Rechtsauffassung im Laufe der Jahrhunderte zur Anerkennung Unehelicher neigte, und sich der Kreis der Bewerber auf Ausbildungsplätze theoretisch erweitert, desto strenger scheinen die Zünfte an dieser Gewohnheit festzuhalten. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts erledigte sich das Thema zögerlich. In dieser Tatsache spiegelt sich, wie sehr die Berufserziehung von überkommenen handwerklichen Brauchtumsformen geprägt war. Diese enge Verhaftung mit Althergebrachtem zeigt sich auch in den folgenden Aufnahmebechränkungen.
4.1.2. Das Erfordernis der ehrlichen Geburt
Von einem Meister, und damit auch von einem Lehrling, der ja bereits als potentieller Meister angesehen wurde, verlangten die Zünfte moralische Makellosigkeit. Denn diese galt als erste Voraussetzung für Ehre und Achtbarkeit. Die bereits benannte Forderung nach Ehelichkeit war im Bewusstsein der Handwerker eng mit der Vorstellung verbunden, dass Kinder die unmoralische Lebensauffassung ihrer Eltern erbten.
In der zünftigen Gesellschaft waren viele Berufe als ‚unehrlich‘ bekannt. Dabei hing der Makel im strengen Sinne an der ausgeübten Tätigkeit, nicht an der jeweiligen Person. Dennoch ging er auf sie und damit auch auf ihre Kinder über.
Zu den unehrlichen Berufen zählten in erster Linie die Spielleute aufgrund ihres fehlenden Wohnsitzes , sowie für die Gerichtsknechte und Scharfrichter, die nach Volksauffassung freiwillig Blut vergossen. Interessant ist, dass neben vielen weiteren Berufen auch die Schäfer zu den Unehrlichen gezählt wurden, da sie erstens das Mißtrauen, Tiere zu veruntreuen, hervorriefen und zweitens ihre Schafe gemäß des überlieferten Ehrbegriffs verunreinigten, in dem sie zu Tode gekommenen Tieren das Fell abzogen.8
Wichtig zu wissen ist, dass Unehrlichkeit nicht mit Unzünftigkeit gleichgesetzt werden darf. Denn ein Teil der unehrlichen Berufe waren durchaus städtische, wenn auch von anderen Zünften verachtete, aber selbst zünftig organisierte Gewerbe. Außerdem waren viele von ihnen für das Gemeinwesen nicht unwichtig, so wie beispielsweise die Müller, Zöllner oder Leineweber.
Danckers konnte zeigen, dass die Unehrlichkeit „ auf urtümliche Sakral- und Kultkomplexe, die durch den siegreichen Kirchenglauben in die Bannzone der Verfemung und Verdrängung gerieten“9 zurückgeführt werden konnten. Somit ist die direkte Verbindung zwischen der berufsspezifischen Tätigkeit und der moralischen Verwerflichkeit nicht ursprünglich, es wurde von den Zünften jedoch so dargestellt.
4.1.3. Das Erfordernis der freien Geburt
Mit der Forderung nach ehrlicher Geburt war die nach freier Geburt verbunden. Unfreiheit machte in jedem Fall ehrlos. Und ebenso konnten nur Freie das Bürgerrecht erlangen. Und da, wie bereits erwähnt, die handwerkliche Berufserziehung bis zur Erlangung des Meisterund vollen Mitgliedsrechts einer Zunft konzipiert war, hatte die Innung ein Recht auf Prüfung der Gewerksfähigkeit des Jungen bei Antritt seiner Lehre.
4.1.4. Das Erfordernis der deutschen Geburt
Auch hinsichtlich der Nationalität eines Lehrjungen bestanden bestimmte Vorschriften. Auf diese Weise versuchten die deutschen Handwerker andere Volksgruppen vom zünftigen Gewerbe auszuschließen. Nach Hopp10 galt dies besonders für den Osten Deutschlands und bezog sich auf die Völker und Volksgruppen, die ‚im Kulturschatten der Deutschen‘ standen, also besonders die Elb- und Oderslawen, die Wenden und die Bewohner der Mark Brandenburg. Zurückgeführt wird dies auf eine Folge des Kriegrechts, nachdem den Besiegten lediglich der Ackerbau, nicht aber die ebenbürtige Teilnahme am städtischen Leben zugestanden wurde. Die Zünfte achteten auf die Reinhaltung ihrer Innungen, die nicht durch die Aufnahme Unebenbürtiger geschmälert werden sollte. Deutscher Herkunft zu sein beinhaltete die Abstammung von einer anerkannten Volksgruppe.
4.1.5. Das Erfordernis der christlichen Geburt
Das Zugangshindernis der christlichen Geburt wurde streng überwacht. Dieses Kriterium hing eng zusammen mit der bereits ausgeführten religiös-kirchlichen Funktion der Zünfte und wurde in den geistlichen Fürstentümern naturgemäß als katholische Geburt verstanden. Bei Engpässen wurde dieses Kriterium für Protestanten teilweise gelockert, unüberwindlich aber war das Christlichkeitsgebot für jüdische Kinder. Die Ablehnung der Juden griff weit über die Grenzen des Kleinbürgertums hinaus. So gab es in den Städten gesonderte Judengassen und Judenviertel, die abends verschlossen wurden. Die Diskriminierung ging aber über die Wohnstätte hinaus, in Prag mußten die Juden bis 1782 den gelben Davidstern tragen. Dies alles sind Zeichen eines tiefsitzenden Mißtrauens und beleidigender Vorurteile, aufgrund derer sie als nicht bürgerrechtsfähig galten. Und auch in diesem Fall nahm das Innungswesen die Regelung über den Erwerb des Bürgerrechts in seine Gewohnheiten auf.
4.2. Die Erziehung der Lehrlinge
‚Lehrjahre sind keine Herrenjahre‘ lautet der auch heute noch gern zitierte alte Spruch, der auf die Situation der Lehrlinge schließen läßt.
Zum einen ist darin die Tatsache zu erkennen, dass die Zeugnisse der damaligen Zeit viel Leid und wenig Freude aufzeigen. Besonders anrührig ist in diesem Zusammenhang die Autobiographie Karl Friedrich Klödens, die von Helga Schultz zitiert wird.11 Hier wird die elende Unterbringung im Hause des Meisters, die dürftige Ernährung und die mißbräuchliche Verwendung des Lehrlings zu Haus- Küchen- und Laufburschendiensten geschildert.
Zum anderen kommt in dem Ausspruch das große Abhänigkeitsverhältnis zum Ausdruck, in dem der Lehrling zum Meister stand. Die hierarchische Struktur des Handwerks in die Dreigliederung von Lehrling, Geselle und Meister war ein Kernstück des Systems. Der Lehrling mußte die niedersten Arbeiten verrichten und wurde erst allmählich vom Meister und den Gesellen an die eigentlichen Berufsarbeiten herangeführt.
Der Meister hatte gegenüber dem Lehrjungen ein Züchtigungsrecht, das bei seiner Abwesenheit dem ältesten Gesellen zufiel. Zweifellos konnte aus strenger Zucht rohe Gewalt wuchern. Die Lehrzeit geriet dann nicht selten zu einer harten Prüfungszeit für die jungen Menschen, unter der sensible Gemüter sehr litten oder gar ernsten Schaden nahmen. Auf diese Weise aber wurde das erwartete soziale Verhalten vermittelt, das für das Handwerkerleben ebenso nötig war wie für die Beherrschung des Berufs. Dazu zählten vor allem patriarchalische, traditionsbestimmte und autoritätsorientierte Verhaltensweisen.
Ein festgelegtes Lehreintrittsalter gab es nicht und scheinbar war die Altersbegrenzung weder nach oben noch nach unten festgelegt. Wie Ekkehard Wiest gezeigt hat12, war das Alter des Lehrantritts sogar innerhalb einer Stadt von Beruf zu Beruf verschieden.
4.2.1.Die Aufdingung
Bevor der Lehrling offiziell als Mitglied der Zunft eingeschrieben werden konnte, mußte er eine Probezeit von zwei bis sechs Wochen absolvieren, während der der Meister ungeschickte und unwillige Jungen noch zurückweisen konnte. Erst dann kam das feierliche ‚Aufdingen‘ vor dem gesamten Gewerk bei offener Lade, bei dem der Meister den Jungen der Gewerksversammlung vorstellte und darum bat, diesen als Lehrling anzuerkennen. Ordnungsgemäß aufgenommen worden zu sein war die Voraussetzung für die spätere Erteilung des Lehrbriefes, der für das berufliche Fortkommen wichtig war. Das Aufdingen war ein feierlicher Akt, bei dem es um mehr ging als um den Eintrag in ein Register. Die Innung war zugleich Rechtsvermittlerin zwischen Lehrling und Meister und im Hinblick auf die Anerkennung des Lehrverhältnisses ein erforderlicher Vertragspartner. Ihr waren sowohl Meister wie Lehrling verpflichtet. Der Abschluss eines Lehrvertrags konnte keine private Absprache sein, sondern benötigte zur zunftrechlichen Gültigkeit die Anerkennung der Korporation. Einzelne Modalitäten wie die Dauer der Lehrzeit und die Behandlung des Jungen im meisterlichen Haushalt wurden zwar zwischen dem Lehrherr und den Eltern vertraglich geregelt. Aber über die Voraussetzungen, Methoden und Inhalte entschied allein die Zunft.
Die Aufdingung glich einem Ritual, während dem verschiede Aspekte abgehandelt wurden13. Wichtig war in diesem Zusammenhang die Vorlage der erforderlichen Legimitationspapiere entsprechend den oben genannten Erfordernissen. Diese wurden vom Lehrmeister für den Lehrling eingereicht. Nachdem geprüft wurde, dass der Lehrling geeignet war und außerdem der Meister entsprechend den aktuellen Ausbildungsregeln einen Lehrling annehmen durfte, wurden die entsprechenden Zeugnisse vom Obermeisterin die Zunftlade gelegt.
Dieser Akt war von großer Wichtigkeit, denn zum Zeichen der Offizialität mußten die entsprechenden Handlungen ‚vor offener Lade‘ stattfinden. Nur so hatten sie Kraft und Gültigkeit. Neben der Aufdingung mußten auch alle anderen Amtshandlungen unter diesen Bedingungen geschehen, so die Freisprechung des Lehrlings am Ende der Lehrzeit und das Urteil über das Meisterstück und die Aufnahme des neuen Meisters in die Zunft. Die Zunftladen waren kunstvoll gefertigte kleine Truhen, in denen alle wichtigen Zunftakten und - insignien verwahrt wurden. Ihre besondere Bedeutung kommt auch daran zum Ausdruck, dass die Lade nur im Beisein des Obermeisters geöffnet werden durfte, und der Verdacht , dagegen verstoßen zu haben, wog schwer.
Der Aufdingung schloß sich eine gemeinsame Mahlzeit oder zumindest ein Umtrunk an. Diese wurden vom Lehrling gegeben. Durch diesen Brauch, der sich an den rechtslichen Akt anschloß, wurde der Charakter der Zunft als Lebensgemeinschaft unterstrichen, die weit über die kommerzielle Verbindungen hinausragte. Die Aufnahme des Lehrlings in den tragenden Kreis der Zunft, die ihn ab jetzt als Schutzgenossen umfing, wurde so besiegelt.
Das die Handwerkslehre vielmehr die Sozialisation der Lehrlinge entsprechend der zünftigen Gesellschaft bedeutete und die berufliche Ausbildung lediglich einen Aspekt bildete wird im folgenden klar. Denn neben der beruflichen Ertüchtigung war auch die charakterliche, religiöse und sittliche Erziehung Teil der Lehre. „Auf alle diese Bereiche bezog sich ein Versprechen, mit dem der Junge verpflichtet wurde, ‚dass er sich fleißig, getreu, verschwiegen und gehorsam bezeugen, Sonntags den Gottesdienst fleißig besuchen, auch ohne des Meisters Wissen und Willen nicht aus dem Hause, noch weniger aus der Stadt gehen, oder muthwilliger Weise auf der Gassen herum laufen, sondern bei rechter Zeit wieder nacher Hause kommen ... wolle.‘“14
4.2.2. Der Lehrvertrag
Die Regelungen über das Lehrgeld, die Ausbildungsdauer und die ‚Verwendung‘ der jugendlichen Arbeitskraft konnten in einem Lehrvertrag, dem sogenannten Aufdingungsbrief, festgehalten werden. Die bekannte gewordenen Kontrakte über die Modalitäten des Lehrverhältnisses waren formlos und nach den jeweiligen Abmachungen mehr oder weniger umfangreich. Scheinbar war der Vertragsabschluß rechtlich nicht erforderlich. Um die Lehre rechtskräftig zu machen genügte den meisten Zünften der Eintrag in das Lehrlingsbuch bei offener Lade.
Diese förmlichen Briefe wurden also nur selten erstellt, wenn sich auch die Regelung des Lehrgeldes weit zurück verfolgen läßt.
Bei dem Lehrgeld handelte es sich nicht nur um ein Entgeld für die vom Meister aufgewendeten Ausbildungsleistungen, sondern auch um einen Unterhaltszuschuß, den der Meister dafür bekam, dass er den Lehrling in sein Haus aufnahm und während der Lehrzeit verpflegte. Die Höhe der Zahlungen differierte nach Lehrzeit und Gewerbe. Außerdem schwankte sie je nach konjunktureller Lage des Handwerks.
Für die Lehrzeit hatte jedes Gewerk eine gesonderte, im Normalfall zwischen drei und sechs Jahren schwankende Festlegung. Konnte auf Grund der familiären Finanzsituation kein oder wenig Lehrgeld gezahlt werden, mußte der Lehrling eine zunftintern festgelegte Zeit länger bei seinem Meister bleiben ohne losgesprochen zu werden. Dem Meister stand somit eine als Geselle qualifizierte Arbeitskraft zu, die er nicht entsprechend entlohnen mußte. Auf diese Weise wurde er für den Verlust des Lehrgeldes entschädigt.
Umgekehrt war es möglich, durch eine über das verordnete Lehrgeld hinaus gezahlte Summe die Dauer der Lehrzeit zu verkürzen, die ‚Lehre abzukaufen‘. Der Gedanke hinter dieser Regelung war, dass sie auf der einen Seite den Eltern die Möglichkeit gab, ihrem Sohn durch höhere Geldzuweisungen gewisse Vergünstigungen auszuhandeln, auf der anderen Seite aber auch armen Kindern eine Berufsausbildung ermöglichte. Dieser sozialpolitische Aspekt der Aufdingung armer Lehrlinge entsprach der merkantilistischen Politik, möglichst viele Menschen in den Wirtschaftsprozeß zu integrieren und so unter anderem das Armenproblem zu lösen. Dennoch täuscht dies nicht über die Tatsache hinweg, dass Meister Waisen und arme Kinder nur ungern in die Lehre aufnahmen und sich der soziale Ethos der Zunft im Rahmen der Sorge um die Zunftgenossen hielt. Ziel der staatlichen Politik war es, diese Tendenz der Zünfte zu unterbinden, in dem sie die Meister dazu verpflichteten, Arme und Waisen in regelmäßigem Turnus in die Lehre zu nehmen. Im Maurer-Privileg von 1724 heiß es: “Wenn aber aus den Waisen-Häusern arme Kinder zum Gewerck gebracht werden, so sol jeder Meister nach der Reihe schuldig seyn, einen solchen Knaben das Handwerck umsonst zu lehren, wie es denn wergen eines verstorbenen und verarmten Mitmeisters Sohn ebenmäßig zu halten.“15
Die Lehrgeld-Zahlung ließ außerdem den Protest der Eltern zu, wenn die Behandlung des Jungen schlimmer als erwartet ausfiel oder die häufig auftretenden ausbildungsfremden Arbeiten überhand nahmen. Im Verständnis der ständischen Gesellschaft wurden die diese Verrichtungen jedoch als Bestandteil des Inkorporierungsprozeßes ausgelegt und in einem gewissen Rahmen als nötig angesehen. Natürlich war auch die Macht der elterlichen Klagen konjunkturabhängig und hatten wenig Macht, wenn der Andrang groß war und der Meister leicht einen neuen Lehrling finden konnte.
Die Auswirkungen der Lehrgeldzahlungen auf die Dauer der Ausbildung sind klar geworden. Auch die konjunkturelle Lage der einzelnen Gewerke nahm Einfluß darauf, wie lange ein Junge lernen mußte. „So wird von den Kölner Glocken- und Kannengießern berichtet, dass sie 1785 die Lehrzeit auf bis zu sieben Jahre hinaufsetzten, um die vielen Bewerber abzuschrecken, während ihre Kollegen von der Wollweberzunft sie zeitgleich aus den genau umgekehrten Gründen auf zwei Jahre senkten, um sie 1789 wieder auf drei Jahre zu verlängern.“16
4.2.3. Die familiale Struktur der Lehre
Im ständischen Berufserziehungsdenken dominierte die berufliche Sozialisation und umfing die handwerkliche Qualifikation. Auf das Sozialisationsgefüge der Handwerkserziehung verweist der Umstand, das der Lehrling sich der Erziehungsgewalt des Lehrherren fügen mußte. Denn die Lehre war auf Basis einer Primärgruppenbindung organisiert. Damit der Meister seinen Erziehungsauftrag erfüllen konnte, war es nötig, dass der Lehrjunge als Familienmitglied im Haus seines Meisters wohnte. Das Erziehungsprinzip war das einer Familienerziehung, in der der Hausherr das Sagen hatte und ausgerichtet am normativen Verständnis des Hauses als Lebens- und Arbeitsverbundes standen alle Mitglieder des Hauses unter der Leitung des Hausherren. Der Meister erhielt das Vaterrecht für den Jungen, die volle pädagogische Verantwortung ging von den Eltern auf ihn über. Im Funktionszusammenhang der ‚familia‘ mußte der Junge mehr lernen und leisten als die beruflichen Handgriffe.
Der Lehrling wurde als Mitglied des Hauses gesehen und auf ihm lastete ein wirtschaftlicher Funktionsdruck. Die familial begründete Selbstverständlichkeit, dass der Lehrling im Haushalt zu helfen und dem Meister in jeder Hinsicht aufzuwarten hatte, begründete oft angesichts des häufig jungen Alters (12 oder 14 Jahren) der Lehrjungen eine völlige Überforderung in arbeitstechnischer sowie emotionaler Hinsicht. Hinsichtlich der ökonomischen wie räumlichen Enge des Handwerkerlebens waren Härte und Rücksichtslosigkeit den Lehrlingen gegenüber an der Tagesordnung.
Neben den berufsfremden Arbeiten zur Unterstützung des Haushaltes umfaßte der geschlossene Sozialisationszirkel außerdem die standesgemäße Erziehung der jungen Menschen. Aus diesem Grund gehörte es zu den Pflichten des Meisters, auch die gesellschaftlichen Benimmregeln wie beispielsweise das Verhalten zu Tisch zu vermitteln. Somit wird deutlich, dass sich die handwerkliche Lehre nicht nur als Zeit der beruflichen Ausbildung, sondern zugleich als eine entscheidende Phase der Erziehung junger Menschen unter religiösen, sittlichen und zunftverantwortlichen Aspekten verstand. Die beiden Aufgaben der Handwerkslehre waren also Erziehung und Ausbildung. Grundlegend für die Auffassung der Berufserziehung war die Überzeugung, dass die saubere Werkarbeit den Charakter des Menschen forme und präge und dass ein guter Handwerker keiner verwerflichen Tat fähig sei. Eine Trennung beider Aspekte war also nicht möglich, weil die handwerklichen Tugenden an den während der Ausbildung erlangten Fertigkeiten und Kenntnissen ständig geübt und erprobt werden mußten.
4.2.4. Das didaktisch Prinzip der Imitation
Um die berufsbezogenen Tätigkeiten zu lernen mußte der handwerkliche Lehrling dem Prinzip der Imitation folgen. Dies bedeutete, die betreffenden Handgriffe schaute er sich bei Kundigen an und versuchte sie in gleicher Weise nachzumachen. Dabei war ausschlaggebend, dass lediglich die Arbeitsweise des Meisters die einzig richtige war. Sollte einer der Gesellen anders zu einem Ziel gelangen als der Meister, so durfte der Lehrling dies nur nachmachen, wenn es vom Meister erlaubt wurde. Eigenständige Veränderung der Arbeitsschritte durch den Jungen wurden als Ungehorsam interpretiert. Das vom Meister ‚Abgelesene‘ war also nicht situativ gültig, sondern war als Norm zu gewichten.
Dieser didaktisch geschlossene Zirkel der handwerklich-beruflichen Bildung fügte sich pädagogisch gesehen nahtlos in den der familial-beruflichen Sozialisation, denn das patriarchalische Selbstverständnis des alten familia-Prinzips wird hierin wieder deutlich. Hierin wird sowohl das ausbildungsmethodische wie berufspädagogische Prinzip der Handwerkslehre deutlich: „Es ging um die möglichst verläßliche Imitatio Majorum, nicht um die auf eine produktive Weiterentwicklung der Technik gerichtete Qualifizierung.“17
Ebenso steht diese Vorgehensweise in einer Linie mit der zunftcharakteristischen Traditionsverbundenheit. Die Zunft steckte den Rahmen für die angemessenen berufsspezifischen Arbeitsweisen. Wichtig war nun, diesen durch ‚traditio‘, durch Weitergabe zu sichern. Dies war also kein innovativer, sondern vielmehr ein reproduktiver Lernprozeß, bestimmt durch Vormachen und Nachahmen. Stratmann bringt dies auf eine kurze Formel: „Das Erziehungsprinzip der Zünfte spiegelt das der ständischen Gesellschaft: die Imitatio“18.
4.2.5. Das Ziel der Lehre
Den zunftgebundenen Lebensvollzug zu sichern war eigentliche Aufgabe der Berufserziehung und der auf sie bezogenen Sozialisation. Das zeigen auch die von der Zunft ausgestellten und bei der Lossprechung überreichten Zeugnisse. In den bekannten ‚Lehrbriefen‘ ist von einer berufsspezifischen Qualifikation nicht die Rede. Denn in der Tat ging es primär um die formale Erfüllung der Lehrzeit, nicht um den Nachweis erworbener technischer Fertigkeiten. Stratmann führt dazu aus: „Seinen ‚Lehrbrief gewonnen‘ zu haben hieß denn auch nicht, einem fachlichen Examen unterzogen worden zu sein, sondern auf Grund der ‚vor offener Lade‘ getätigten Aussage des Meisters aus dem Schutzverband des meisterlichen Haushalts ‚in Ehren‘ entlassen worden zu sein“19. Wichtig war in diesem Zusammenhang, dass der Meister vor dem versammelten Gewerk bekundete, der Lehrling habe sich redlich, fromm und treu sowie gottesfürchtig und ehrliebend gezeigt. Gemäß der sozialisatorischen Aufgabe der Lehre war auch ihr Ziel eindeutig in diese Richtung ausgelegt.
4.3. Der Geselle
Mit der Lossprechung war der Lehrling nun Geselle. In der Gesellenzeit hatte der Handwerker auf der Wanderung sein berufliches Wissen zu erweitern. Über diese Erweiterung hinaus war es eine Zeit der charakterlichen und sittlichen Bewährung, auf die der Lehrling durch seine hinreichende Erziehung vorbereitet worden war. Die äußeren Insignien des neuen Status waren der ausgehändigte Gesellenbrief und die Eintragung in das Gesellenregister der Zunft.
Die Freisprechung gab ihm das Recht, um Aufnahme in die Gesellenschaft seines Handwerks anzutragen. Nur als ‚gemachter Geselle‘ war es ihm möglich, auf der Wanderschaft die ‚Herberge‘ aufzusuchen und dort den Altgesellen zu bitten, für ihn ‚nach Arbeit umzuschauen‘. Kein Meister durfte es wagen, einen ‚Wilden‘ in seiner Werkstatt zu fördern, ohne Gefahr zu laufen, dass die Gesellenschaft ihn in den Streik trat. Denn die Gesellen sahen ihr Prestige gefährdet und wollten ihr Handwerk vor Landstreichern schützen, indem sie auf die Rezeption aller Neulinge beharrte.
4.3.1. Die Gesellentaufe
Durch die Freisprechung war der junge Geselle aus dem Schutzverband der Zunft entlassen worden. Ohne rechtlich und sozial gesichert zu sein, hätte er seine Wanderschaft nicht überstehen können. Aus diesem Grund mußte der Geselle um Aufnahme in die Gesellenschaft bitten.
Die Aufnahme in die Bruderschaft der Gesellen war an einen Initiationsritus von mystischer Eindringlichkeit gekoppelt. In der damaligen christlichen Gesellschaft hatte die Kirche eine dominierende Rolle. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Handwerkskultur Anleihen im Religiösen machte und die ‚Taufe‘ des ausgelernten Jungen zur Institution erhob. Über das ‚Taufen‘ oder ‚deponieren‘ wurde strengstes Stillschweigen bewahrt. Eine ausschließliche mündliche Weitergabe des Rituals erhöhte die Weihe des Aktes.
Der Ritus war ein derbes Zeremoniell, bei dem dem Neuling nach den Gewohnheiten des Handwerks meist übel mitgespielt wurde. Die Einkleidung dieser ‚Feier‘ in scherzhafte Formen und deftige Neckereien darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um einen für das Gesellenwesen rechtswirksamen Akt handelte. Nach überstandener Begrüßung in der Bruderschaft galt der neue Handwerksgeselle jetzt als ‚socius facticius‘ und als vollwertiges Mitglied des Verbandes konnte er die gesonderten Unterkunftsmöglichkeiten nutzen und erhielt bei Krankheit eine Unterstützung aus der gemeinsamen Gesellenkasse. Bei der Gesellentaufe lassen sich die gleichen Strukturen erkennen, wie sie der Aufdingung und Freisprechung zugrunde lagen: Von einem anerkannten Mitglied der Gesellschaft wurde der Neuling vorgestellt, das gleichzeitig für die Würdigkeit des Jungen haftete. Die Bruderschaft wählte einen ‚Pfaffen‘, der als Zeremonienmeister fungierte und die ‚Taufpredigt‘ hielt. Außerdem bestimmten sie Paten für den Neuling.
4.3.2. Die Wanderschaft
Aus der starken Gebundenheit des Lehrlings an den meisterlichen Haushalt trat der junge Mann nach der Lossprechung in die weite Welt, um sich in anderen Städten und fremden Landen sowie unbekannten Menschen weiterzubilden. Aus dem unfreien, nahezu rechtlosen untersten Glied in der Werkstatt wurde ein freier Handwerker, der einer über die Reichsgrenzen hinausragenden Gemeinschaft von Berufsgenossen angehörte. Bei der ‚Walz‘ kam es vor allem auf die Vervollkommnung der Kunstfertigkeiten des erlernten Handwerks an, indem die Erfahrung anderswo üblicher Vorgehensweisen gemacht wurde. Die Wanderschaft bildete eine sinnreiche, seit dem Mittelalter allgemein zur Pflicht gemachte Einrichtung.
Die Gewerksstatuten legten je nach Tradition und Bedarf die Dauer der Wanderzeit fest. Die berliner Schlächter und Leineweber zeigten sich beispielsweise als recht bodenständig, ihre Gesellen brauchten zur zwei Jahre zu wandern. Die Goldschmiede in Berlin kamen wie viele andere Gewerke mit drei bis vier Jahren aus. Aber es gab auch Innungen, bei denen die Wanderschaft bis zu 12 Jahre dauerte, zum Beispiel bei den Buchbindern und Futteralmachern in Nürnberg.
Das Wandern war aber nicht nur die Hohe Schule des Handwerks, sondern auch Mittel zum Ausgleich des Arbeitskräftepotentials. Außerdem diente es dazu, Arbeitslosigkeit zu überbrücken und zu verdecken, indem man fortwanderte.
Während ihrer Wanderschaft schliefen die Gesellen nicht unter freiem Himmel, sondern es gab ein reichsweit ausgespanntes Netz von Herbergen. Durch dieses Beherbergungssystem hoben sich die Gesellen von den Vagabunden und Bettlerscharen ab, die gleichfalls mit der wachsenen Bevölkerung im Laufe der Jahrhunderte immer stärker die Landstraßen bevölkerten. Um der Herberge zu beweisen, kein Landstreicher zu sein, gab es auch hier ein bestimmtes Ritual: nicht die Kundschaft der heimatlichen Meisters und auch nicht der amtliche Wanderpaß reichten aus, sondern einzig mit einem alten mündlichen Zeugnis wurde dem jungen Mann Einlaß gewährt. Wort für Wort genau hergesagt diente der gegen Außenstehende sorgsam verheimlichte Handwerksgruß des Gewerks der Identifizierung. Diese Grußformeln waren von beträchtlicher Länge und doch im ganzen Reich über Jahrhunderte nahezu unverändert bewahrt.
Hatte der Fremde sich entsprechend diesem Gruß ausgewiesen und sich gegen einige Groschen Gebühr in das Gesellenbuch einschreiben lassen, erhielt er ‚Willkomm‘. Dies bedeutet, er bekam eine Lage Bier in einem ebenfalls ‚Willkomm‘ genannten Krug im Kreise aller herbeigerufenen Gesellen vorgesetzt.
Wenn der Geselle die Stadt wieder verlassen wollte, erhielt er das ‚Geschenk‘, das meist aus einem abschließenden gemeinsamen Umtrunk sowie einiiigen Groschen bestand. Auch bei längerer Arbeitslosigkeit brauchte der Wandergeselle so nicht unbedingt betteln gehen, wenn er sich als Zunftangehöriger von Stadt zu Stadt durchschlug.
Zur Funktion der Wanderschaft beruft sich Stratmann auf eine umfassende Begründung Adrian Beiers in dessen Monographie über den Gesellen.1 Hier heißt es, dass selbst bei bestem Wollen des Meisters die Ausbildung unvollständig bleiben müsse. Im diesen Mangel auszugleichen, sei der Wanderzwang eine wichtige Maßnahme. Obwohl ursprünglich nicht aus berufspädagogischen Gründen eingeführt, war die Walz ein ausgezeichnetes Mittel, die Mängel der Ausbildung zu kompensieren, zumal in den häufig sehr kleinen Städten nicht alle Techniken und Kenntnisse vermittelt werden konnten.
4.4. Das Meisterrecht
Der Handwerker war erst dann anerkannter Vollgenosse der Zunft, wenn der den Status des Meisters (status magisteralis) erreicht hatte. Aus diesem Grund war das zünftige Meisterrecht für die handwerkliche Berufsausbildung von grundlegender Bedeutung. Die beiden Vorstufen des Lehrlings und des Gesellen hatten keinen Eigenwert und standen in der Tradition der auf die Meisterschaft angelegten Handwerkererziehung. Hinsichtlich dessen wird die Stellung des Meisters innerhalb des zünftigen Ranggefüges klar. Er genoß im Rahmen der Innung einen hohen Status und Prestige, außerdem wurden ihm bestimmte Rollenerwartungen entgegengebracht. Eine wichtige Aufgabe war die Verwirklichung der zentralen Werte des Gewerks. Wobei die Frage nach diesen Werten hinsichtlich der Funktionen2 der Zunft sowie der Ziele der Lehrlingsausbildung3 hinreichend beantwortet sein müßte.
4.4.1. Die Qualifikation des ‚Meister-Gesellen‘
Ein je nach Zunftbrauch mehrfach gegliedertes Examen diente als Nachweise der hinreichenden Qualifikation des Gesellen als Meister. Von Adrian Beier wurden acht Voraussetzung benannt, die ein Handwerker zu erfüllen hatte, bevor er als Meister anerkannt wurde.4
1. Der Geselle mußte bei der Zunft die Zulassung zum Meisterrecht beantragen.
2. Diesem Gesuch waren die Nachweise über die handwerksfähige Geburt, die ordnungsgemäße Lehre und Wanderschaft und das Bürgerrecht der Stadt beizufügen.
3. Waren diese Zugnisse vollständig vorhanden, wurde der Antragsteller in das KandidatenRegister der Zunft eingetragen und
4. zur Jahr-Arbeit zugelassen.
5. Damit verpflichtete der Geselle sich zur sogenannten Mutung.
6. Er mußte nun ein bestimmtes Meisterstück fertigen. Hatte er dies, mußte er
7. ein Meisteressen geben und schließlich
8. Eine je nach Zunftsatzung unterschiedlich hohe finanzielle Abgabe leisten.
Berufspädagogisch relevant waren in erster Linie der Jahr-Arbeiten und vor allem die Anfertigung des Meisterstücks. Auch die Vorschriften des ‚Mutens‘ sollen hier berücksichtigt werden.
Die ersten drei, formalrechtlichen, Bedingungen wurden bereits eingehend beschrieben.
Die Jahr-Arbeit wurde auch Probatio genannt und ist in unmittelbarer Verbindung zur Wanderschaft der Gesellen zu sehen. Um sich gegen untaugliche Kollegen zu schützen, wurden die Meisteranwärter für ein oder zwei Jahre geprüft. Der zugewanderte Geselle wurde aufgefordert, bei einem ihm von der Zunft zugewiesenen Meister zu arbeiten. Am
Ende der Probatio fällte dieser Meister sein Urteil. Hielt er den Gesellen für untauglich, konnte die Zunft das Gesuch ablehnen.
Die Jahr-Arbeit hatte im Hinblick auf den Wanderzwang eine positive Funktion. „Sie diente dazu, den ‚sittlichen Charakter und Geschicklichkeit eines künftigen Bürgers ... zu prüfen‘... Der Handwerker, der mehrere Jahre ungebunden gewandert war, wurde durch diesen Brauch wieder an Seßhaftigkeit und Stetigkeit gewöhnt.“5
Da es dem Gesellen nicht erlaubt war, den Meister während der Jahr-Arbeit zu wechseln, konnte die Probatio zu einer Strafe werden. Denn aufgrund zuvieler Bewerber hatten einige Meister Angst um ihr Einkommen und benutzten deshalb die Jahr-Arbeit als ein Mittel, die Gesellen abzuschrecken.
Nach der Jahr-Arbeit begann die Mutung (Sollicitatio). Indem der Geselle ein Jahr lang an den Gewerksversammlungen teilnahm und seinen Mutgroschen zahlte, sollte er seinen anhaltenden Willen bekunden, Zunftmitglied zu werden.
Erst nach verrichteter Sollicitatio war es dem Gesellen erlaubt, mit der Fertigung des Meisterstücks zu beginnen.
Dieser Teil der Meisterprüfung wurde nicht von Beginn der Zünfte an praktiziert. Solange den einzelnen Handwerkern ein ausreichendes Einkommen sicher war, wurde auf den förmlichen Nachweis der beruflichen Qualifikation verzichtet. Die Schauprüfungen reichten aus, um den Kunden vor schlechter Ware zu schützen. Als der Nahrungsraum jedoch enger wurde, war die Fertigung des Meisterstücks ein Mittel, den Andrang auf die Meisterstellen legal abzufangen.
Über die Würdigung und Eignung des Kandidaten für das Meisterrecht wurde aufgrund des gelieferten Meisterstücks entschieden. Es war der Nachweis seines fachlichen Könnens und die Anfertigung mußte gemäß den allgemeinen Arbeitsregeln und speziellen Vorschriften der Innung erfolgen.
Je nach Produkt und Gewohnheit der Zunft bekam der Stückmeister, wie er jetzt hieß, zwischen fünf und 16 Wochen Zeit, das Geforderte zu fertigen. In dieser Zeit stand er unter ständiger Aufsicht, meist in der Werkstatt des Obermeisters, um unlautere Hilfen zu unterbinden. War es gestattet zu helfen, mußte genau dokumentiert werden, wobei und in welchem Umfang dies in Anspruch genommen wurde. An kritischen Punkten kam das ganze Gewerk zur Begutachtung zusammen. Die Statuten forderten dies bei den Berliner Schuhmachern zum Beispiel, wenn das Leder zugeschnitten wurde, also der sogenannte ‚Meisterschnitt‘ erfolgte. Kein Rohmaterial und Werkstück durfte während der gesamten Zeit der Werksatt des Stückmeisters zu- oder abgetragen werden, um den heimlichen Austausch mißlungener Gegenstände zu verhindern.
Neben dem Nachweis der Qualifikation diente das Meisterstück der Abschreckung, um so die Anzahl der Meister in Grenzen zu halten. Dies läßt sich einerseits daraus ersehen, dass sie anzufertigenden Gegenstände meist sehr aufwendig waren und einen ‚großen Verlag‘, d.h. viel Geld erforderten. Dies lag zwar auch an Größe und Qualität der Meisterstücke, nach weitverbreiteter Meinung verfolgten die Zünfte damit jedoch auch das ziel der Abschreckung. Ebenso ist die Tatsache zu interpretieren, dass bei der Meisterprüfung äußerst hohe Anforderungen gestellt wurden. Obwohl berechtigt, diente dies weniger der Aussonderung unfähiger denn vielmehr der Entmutigung fremder Gesellen.
Sowohl Fehler am Meisterstück konnten berichtigt als auch die Prüfung überhaupt bei entsprechender finanzieller Leistung sehr häufig umgangen werden. Denn bei entsprechendem Gewinn waren die weniger Verantwortungsbewußten bereit, die Zunftsatzung und die oft beschworene Meisterehre zu verraten.
Weitere Kosten kamen für den Anwärter hinzu, wenn er den kontrollierenden Meistern einen Umtrunk reichte. Dieser erwies sich nämlich als wirkungsvolle Werbung um deren Gunst, da sie als Kostenerstattung für den den Prüfern widerfahrenden Arbeitsausfall.
Nachdem die formalen wie die fachlichen Bedingungen vom Kandidaten erfüllt worden waren, nahm die Zunft ihn als Vollmitglied auf. Eine nach altem Brauch vom Neuling auszurichtende Mahlzeit unterstrich den Gemeinschaftscharakter der Innung. Zu diesem Essen waren alle Zunftmitglieder mit ihren Frauen und Kindern eingeladen und die große Zahl der Gäste machte die Feier zu einer weiteren wirtschaftlichen Belastung des jungen Meisters. Im Laufe der Zeit setzte sich dann auch die Erkenntnis durch, dass der junge Mann zu sehr belastet wurde. Das Meisteressen wurde deshalb vielerorts in eine feste Geldabgabe umgewandelt. Somit blieb das Prinzip, dass der Neue der Gemeinschaft seine Reverenz zu erweisen hatte erhalten.
Neben dieser Anerkennung der Zunft hatte jeder neu ins Gewerk aufgenommene weitere festgesetzte Abgaben an die Kasse zu entrichten. Mit diesen Geldern bestritt die Innung ihre laufenden Kosten, wie beispielsweise die soziale Aufgabe der Versorgung alter und kranker Mitglieder. Diese Kosten wurden im übrigen durch Umlagen auf jedes Mitglied bestritten.
Schließlich mußte der neue Meister den Eid ablegen, die Entscheidungen der Innungsversammlung zu befolgen und sich in allem nach den Statuten und Gewohnheiten zu richten und über die Gewerksangelegenheiten jedem Außenstehenden gegenüber strenges Schweigen zu bewahren.
5. Bibliographie
Danckert, Werner: Unehrliche Leute: Die verfemten Berufe‘; A.Francke AG Verlag, Bern 1979
dtv Brockhaus Lexikon, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1989
Schulz, Helga: Das ehrbare Handwerk; Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1993
Stratmann, Karlwilhelm: Die gewerbliche Lehrlingserziehung in
Deutschland, Band I; Verlag der Gesellschaft zur Förderung arbeitsorientierter Forschung und Bildung, Frankfurt/Main 1993
Stratmann, Karlwilhelm: Die Krise der Berufserziehung, A.Henn Verlag, Ratingen 1967
Stütz, Gisela (Hrsg.): Das Handwerk als Leitbild der deutschen Berufserziehung; Vandenhoek &Ruprecht, Göttingen 1969
Ungermann, Silvia: Kindheit und Schulzeit von 1750 - 1850; Verlag Peter Lang, Frankfurt/Main 1997
Volkert, Wilhelm: Adel bis Zunft, Ein Lexikon des Mittelalters; Verlag C.H.Beck, München 1991
[...]
1 in: Stütz, S. 158ff
2 Stütz S.161
3 Siehe hierzu Kapitel 4
4 Adler zit. n. Stratmann 1963, S.137
5 J. Bergius in Stratmann(1993), S.119
6 in Stratmann(1993), S.123f
7 Stratmann 67, S.40
8 Mehr zu den ‚Unehrlichen Leuten‘ findet sich bei Danckert
9 Danckert in Stratmann 1967 S.46
10 In Stratmann 1967, S.54
11 Schultz, S. 60ff
12 In Stratmann 1993, S.196
13 Frisius in Stratmann, S.88f
14 Stratmann 1967, S.90
15 Art. XXIV des Maurer-Privilegs von 1734, zit. n. Stratmann 1993, S. 204
16 Stretmann 1993, S.205
17 Stratmann 1993 S.236
18 Stratmann1993, S.237
19 Stratmann 1993, S.239
1 Stratmann 1967, S.170
2 siehe Kap. 3
3 siehe Kap. 4.2.5.
4 vergl. Stratmann 1967, S.178
5 Stratmann 1967, S.180
- Arbeit zitieren
- Friederike Sturm (Autor:in), 2001, Die zünftige Berufsausbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106579
Kostenlos Autor werden










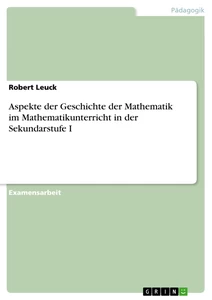









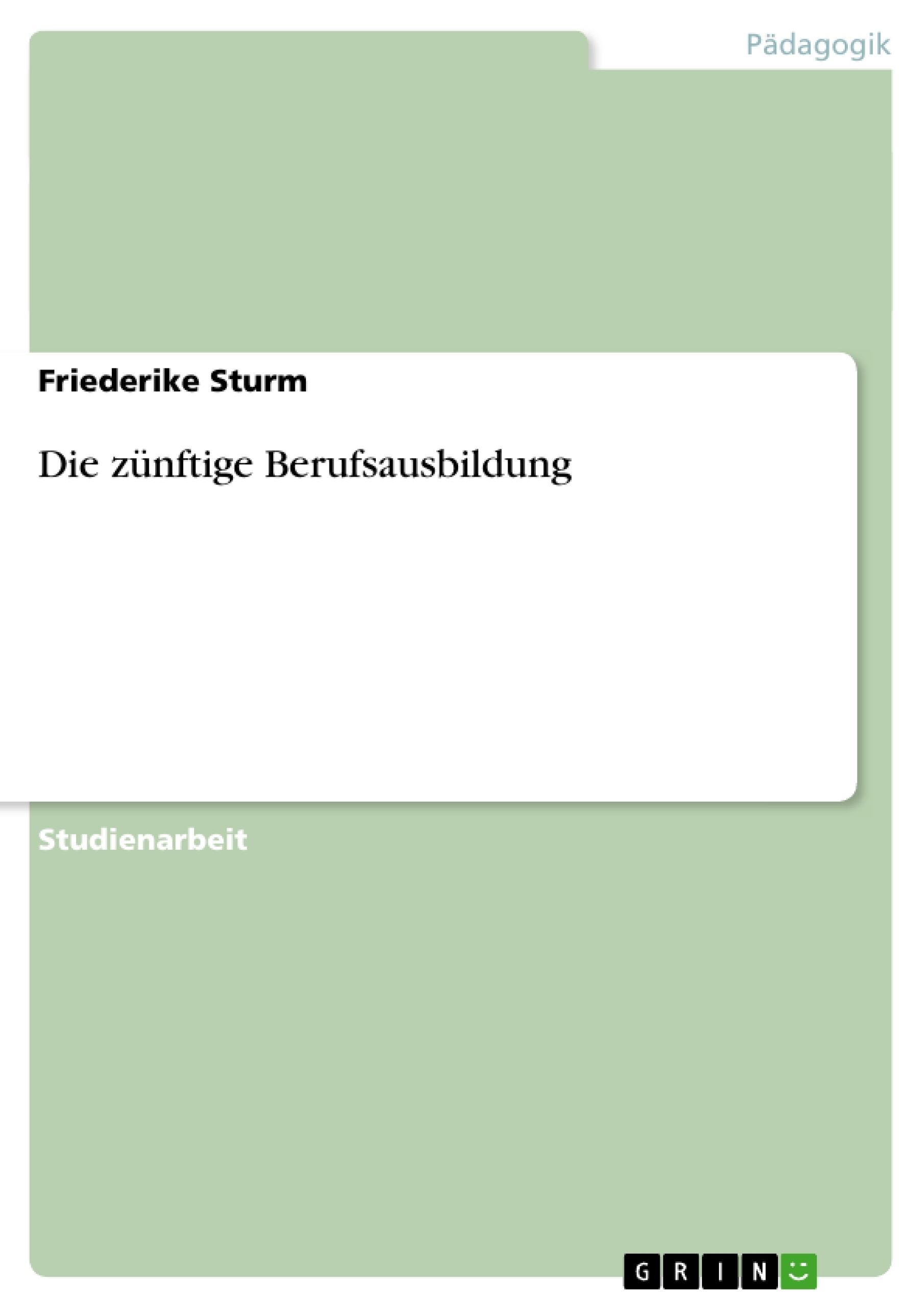

Kommentare