Leseprobe
1. Einleitung
Anfang der 60er Jahre kam es zu einem Bruch zwischen der Parteiführung der SPD und dem „Sozialistischen Deutschen Studentenbund“ (SDS): Die SPD stellte die Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in beiden Organisationen fest und schloß SDS-Mitglieder aus ihren Reihen aus.
Der SDS verstand sich als Teil der Sozialdemokratie, weshalb eine Betrachtung der Frage interessant erscheint, welche Gründe der SDS der SPD für diesen Schritt gelie- fert haben könnte: Hat er sich konkret gegen einzelne Forderungen, Pläne und Initiati- ven der SPD gerichtet? Ist die Parteiarbeit der SPD durch Mitglieder des SDS konkret behindert worden? Oder war er der SPD ledliglich zu revolutionär eingestellt, und stand er damit im Verdacht, dem Image der SPD als möglicher Regierungspartei zu schaden?
Da der SDS ein hochschulpolitischer Verband war, beschränkt sich diese Betrachtung auf die Bildungspolitik: Verglichen werden hier Stellungnahmen und Forderungen von SDS und SPD zum Verhältnis von Hochschule und Gesellschaft und zu den Studienbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland. Am Schluß wird die Frage beantwortet werden, inwieweit das bildungspolitische Konzept des SDS für den Unvereinbarkeitsbeschluß verantwortlich war.
2. Der Unvereinbarkeitsbeschluß
Der erste politische Studentenverband, der sich nach der Kapitulation Deutschlands gründete, war der SDS1. Erst 1951, fünf Jahre nach dem Hamburger Gründungskongreß des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, konstituierten sich CDU-nahe Studentengruppen in Bonn zum Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). Ein Jahr zuvor hatten sich liberale Hochschulgruppen zum Liberalen Studentenbund Deutschlands (LSD) zusammengefaßt2.
Erste Aufforderungen zur Gründung eines sozialistischen Studentenbundes erfolgten nicht oder kaum vom SPD-Parteivorstand aus3, vielmehr initiierten bereits bestehende größere Studentengruppen aus Hamburg, Frankfurt a.M. und Münster die Diskussion um einen sozialistischen Studentenverband. Hochschulgruppen anderer Städte unter- stützten den Vorschlag, wollten aber eine weitgehende organisatorische Unabhängig- keit innerhalb des Verbandes und von der Sozialdemokratischen Partei erreichen. In seiner politischen Zielsetzung stand der SDS in der Tradition der 1933 illegalisierten Sozialistischen Studentenschaft Deutschlands und Österreichs sowie des Republikani- schen Studentenkartells4. Im Gegensatz zur SPD, die an die Weimarer SPD anknüpfte, war der SDS allerdings keine Neuauflage der Sozialistischen Studentenschaft Deutschlands und Österreichs5.
Der Sozialistische Deutsche Studentenbund wurde als „studentischer Flügel“ der SPD begriffen, obwohl immer wieder Auseinandersetzung stattfanden, inwieweit der SDS unabhängig von der Partei organisiert werden müsse6. Bereits auf seinem Grün- dungskongreß vom 2. bis 6. September 1946 in Hamburg, auf dem mehrere Delegierte aus 20 Hochschulorten tagten, gab es zu diesem Punkt Kontroversen unter den Dele- gierten, und eine Mehrheit (40 zu neun) beschloß schließlich, daß kein Bekenntnis zur SPD in die Satzung des SDS aufgenommen wurde. Einzelne Gruppen sollten selbst entscheiden, ob die Mitgliedschaft in der SPD Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im SDS sei. Allerdings wurde auf einer Delegiertenkonferenz 1947 in Bielefeld ein Antrag gestellt, daß nur SPD-Mitglieder oder Parteilose dem SDS beitreten können sollten7. Der Antrag wurde abgelehnt, da die Gefahr bestand, den SDS zu einer Ar- beitsgemeinschaft der Partei umzufunktionieren. Die Ausgrenzung von Studenten anderer Parteien wurde auf Mitglieder der KPD und der SED beschränkt8.
Ende der fünfziger Jahre bildete sich eine undogmatische linke Mehrheitsfraktion im SDS9, die sich bei den Verbandsvorstandwahlen 1958 in Mannheim erstmals durchsetzte. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Politik des Verbandes zur geplanten Stationierung von Atomwaffen in der BR Deutschland. So wurde beschlossen, die studentischen „Aktionsausschüsse gegen den Atomtod“ verstärkt zu unterstützen. In dieser Zeit der „ Wende nach links “10 des SDS bereitete sich die SPD nach der schweren Wahlniederlage 195711 auf die programmatische Eingliederung in die herrschende Ideologie der Bundesregierung vor. Nun sollte Regierungsfähigkeit Ideologie der Bundesregierung vor. Nun sollte Regierungsfähigkeit bewiesen werden:
„ Die SPD betrieb die Trennung von allen Mitgliedern, die sich dem neuen Kurs wi- dersetzten oder von denen bef ü rchtet wurde, da ß sie die von konservativen Organisa- tionen in der Ö ffentlichkeit gesch ü rten Zweifel an der Zuverl ä ssigkeit und Dauerhaf- tigkeit sozialdemokratischer Anpassung an die CDU-Politik n ä hren k ö nnten. “ 12
Die SPD erreichte das Ziel der Regierungsbeteiligung am 1. Dezember 1966 als klei- ner Koalitionspartner der CDU. Vor diesem Hintergrund und dem auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zur Weltanschauung gewordenen Antikommunismus müssen die im folgenden dargestellten Auseinandersetzungen gesehen werden.
Im Januar 1959 fand ein Studentenkongreß gegen Atomrüstung statt. Nach Verab- schiedung der Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft II („Atomrüstung und Wiederver- einigung“)13 verließ Helmut Schmidt, in der Funktion des SPD-Wehrexperten und als Vertreter des Parteivorstands anwesend, aus Protest den Kongreß14.
Im Vorfeld des nächsten Kongresses „Für Demokratie - gegen Restauration und Mili- tarismus“ kam es zu Spannungen im SDS-Vorstand: Ein Teil sprach sich gegen den Kongreß aus, aber dennoch fand er im Mai 1959 in Frankfurt statt. Auch hier wurde eine Resolution verabschiedet, die die Auseinandersetzungen des SDS mit der SPD- Führung schürte. Gefordert wurden u.a. die Abschaffung der Wehrpflicht und die An- erkennung der Oder-Neiße-Linie15. Mehrheitlich sprach sich der Kongreß auch für die einseitige Abrüstung der Bundeswehr aus16. Bei diesen umstrittenen Anträgen gehör- ten Konkret -Redakteure zum Redaktionsausschuß: Sie formulierten in den Arbeits- gruppen die Anträge. Die Studenten um die Zeitung Konkret wurden in der Presse und auch im Parteivorstand der SPD als Hauptträger der kommunistischen Unterwande- rungsorganisation des SDS angesehen17. Diese Gruppe war allerdings auch im SDS umstritten: Die große Mehrheit der SED-kritischen Linken war nach der Verabschie- dung der Resolutionen nicht länger bereit, der Konkret -Gruppe Zeitpunkt und Inhalt des politischen Konflikts mit dem SPD-Parteivorstand zu überlassen18. Der SDS- Vorstand beschloß, die Mitgliedschaft im SDS und die Mitarbeit an der Zeitschrift Konkret für unvereinbar zu erklären, und stellte sich hinter den von der SPD geforder- ten Deutschlandplan19.
Trotzdem änderten das und weitere Distanzierungen von den Resolutionen der Kon- gresse nichts an den Vorwürfen des SPD-Parteivorstands an den SDS, durch die Stu- dentenzeitung Konkret infiltriert zu sein. Der parlamentarische Fraktionsführer der SPD Karl Mommer warf dem SDS vor, als „ trojanischer Esel f ü r Pankow “ zu fungie- ren. Eine bloße Distanzierung von den Frankfurter Resolutionen genüge nicht mehr20. Die SPD solle, wenn nötig, eine neue Studentenorganisation aufbauen, um der Unter- wanderung Einhalt zu gebieten. Er forderte alle sozialdemokratischen Studenten auf, sich vom SDS zu trennen21. An Stelle offener politischer Diskussion wurden die innerparteilichen Gegner zum Feind erklärt. Partielle Affinitäten zu KPD-Positionen galten in der Sozialdemokratie inzwischen als Landes- bzw. Parteiverrat22.
Im Februar 1960 wurde der Sozialdemokratische Hochschulbund (SHB) aufgebaut. Der SHB bekannte sich ausdrücklich zum neuen Grundsatzprogramm der Partei und wollte sich nur mit Hochschulpolitik und politischer Bildung beschäftigen. Die Folge war die Spaltung des SDS: Gruppen aus Bonn, Stuttgart und Saarbrücken traten aus dem SDS aus und in den SHB ein.
Einen Monat nach der vierten Bundestagswahl 1961, die die SPD wieder nicht hatte gewinnen können, wurde dem Parteivorstand ein Exposé über die Entwicklung des SDS vorgelegt, in dem es hieß, der SDS sei seit 1958 immer stärker in das Fahrwasser extremer Kräfte geraten; er handele „ im ö stlichen Sinne “ und spreche mit „ö stlichen Vokabeln “ 23.
Am 6. November 1961 beschloß der SPD-Vorstand die Unvereinbarkeit einer Mit- gliedschaft in SPD und SDS: „ Die Mitgliedschaft in dem Verein ’ Sozialistische F ö r- dergemeinschaft der Freunde, F ö rderer und ehemaligen Mitglieder des Sozialisti- schen Deutschen Studentenbundes e. V. ’ ist unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, wie es ebenso unvereinbar ist, Mitglied des SDS und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu sein. “ 24
3. Die Bildungspolitik des SDS
In der bereits erwähnten Hochschuldenkschrift erklärt der SDS, daß die Hochschule Teil der Gesellschaft sei25: Die Hochschule solle ihrer Aufgabe, aktiv an der Entwicklung zur sozialen Demokratie mitzuwirken, nachkommen - wenn sie das nicht tue, werde sie zu einem „ Instrument in einer Entwicklung zu autorit ä ren Gesellschafts formen “ und müsse den Anspruch der Aufklärung vollends aufgeben26.
Die weiteren Thesen des SDS in Kurzform:
3.1. Universität und Gesellschaft
Die Hochschule hat von der Gesellschaft die Aufgabe bekommen, verwertbare Ergeb- nisse zu erarbeiten, die vornehmlich von der Gesellschaft genutzt werden. Desweite- ren soll sie qualifizierte Fachleute ausbilden, die wiederum Funktionen in Staat und Gesellschaft übernehmen sollen. Die Universität ist somit ein Produktionsbetrieb und keine Institution der zweckfreien Forschung mehr: Demnach besteht ein Bruch mit der Ideologie der klassischen deutschen Universität von Einsamkeit und Freiheit, der Au- tonomie der Universität und der Einheit von Forschung und Lehre27. Diese Leitbilder, die die Universität zu Beginn des 19. Jahrhunderts geprägt haben, hatten die Funktion, den Einfluß des spätabsolutistischen Staates abzuwehren, der ähnliche Interessen hatte wie die Gesellschaft in der jetzigen Zeit: Er hat Staatsdiener und Forschungsergebnis- se für seinen „ Herschaftsapparat “ gebraucht 28 . Über dieser Auseinandersetzung mit diesem Staat hat die Universität die gravierenden Entwicklungen in der Geselllschaft übersehen29.
Die Industrielle Revolution und der deshalb gestiegene Bedarf an Fachkräften und Forschungsergebnissen hatten die Ansprüche der Gesellschaft und des Staates an die Universität verändert: Der Staat trat nun als Produzent für die Gesellschaft auf und gründete z.B. technische, natur- und wirtschaftswissenschaftliche Hochschulen30.
Die Universität paßte sich dieser Entwicklung an: Spezialisten wurden ausgebildet und nicht mehr der universal ausgebildete Gelehrte, im Vordergrund stand Spezialwissen und nicht mehr der „Blick für das Gesamte“. Die Universität nahm neue Fachwissen- schaften auf, übernahm die geforderte spezielle Berufsausbildung und reproduzierte Wissensstoff31.
Dies brachte eine Instrumentalisierung der Uni durch Staat und Gesellschaft mit sich: Somit hatte die Autonomie der Uni nur noch formalen Charakter.
Die Universität überprüfte nicht hinreichend, was mit den Ergebnissen ihrer Arbeit in der Gesellschaft passierte. Staat und Gesellschaft nutzten die Ergebnisse zu ihren Zwecken: „’ Leistungen deutschen Forschergeistes ’ und ’ deutsche Akademiker ’ wur- den so durch politische und gesellschaftliche Macht unbegrenzt manipulierbar. “ 32 Unter dem Deckmantel ihrer oben aufgeführten Prinzipien, die aber mehr als dieser Deckmantel nicht mehr sind, stellt die Universität ihre Ergebnisse weiter als absolute Wahrheit dar, unterstützt aber in Wirklichkeit „ handfeste Teilinteressen innerhalb und au ß erhalb der Universit ä t “ 33.
Wenn die Universität nur noch nach gesellschaftlichen Ansprüchen bildet und nicht mehr Wissenschaft im herkömmlichen Sinn betreibt, wird sie Mittel der offenen Indoktrination der Studenten im Sinne der bestehenden Verhältnisse.
Die Universität dient der Gesellschaft also
1. im Gesamtinteresse der ständigen Leistungssteigerung im Produktions- und Verteilungsapparat und
2. einflußnehmend auf die gesellschaftlichen Entwicklungen und auf die politischen und sozialen Machtverhältnisse.
Also darf die Autonomie der Universität sich nicht nur auf den formaljuristisch Aspekt beschränken, sondern muß auch inhaltlich begründet werden. Dafür muß die Hochschule begreifen, daß sie keine von der Gesamtgesellschaft isolierte „Insel“ ist, und sich selbst und ihre Funktion in der Gesellschaft reflektieren, damit Wissenschaft nicht nur den jeweiligen Machthabern dient34.
Spezialisierung ist nach Ansicht des SDS erforderlich, weil in einer arbeitsteiligen Welt die Universalbildung nicht mehr zu erreichen ist35. Der Wissenschaftler hat auch die Verantwortung für seine Resultate und muß überprüfen, wie die Gesellschaft in der Praxis mit ihnen umgeht36.
Dies kann aber nur geschehen durch „ permanente Kritik des Verh ä ltnisses von Ein zelwissenschaften und Gesellschaft “37. Wissenschaft darf nicht als Selbstzweck begriffen werden, sondern als „ kritische Rationalit ä t im Dienste des Menschen “ 38.
3.2. Die soziale Lage der Studierenden
Für die Gesamtverfassung der Universität hat die soziale Stellung des Studenten eine enorme Bedeutung, da der Student ein wichtiges Mitglied im Universitätsbetrieb ist. Seine soziale Stellung hat wiederum starke Auswirkungen auf die Gestaltung und Ziele seines Studiums.
Seitdem die Uni qualifizierte Fachkräfte für die Gesellschaft ausbildet, ist der Student „ funktional gesehen in einer ä hnlichen Position wie ein Lehrling oder ein junger Ar- beiter in der Fabrikausbildung “ 39. Er soll mitwirken: an der Herstellung seiner eige- nen wissenschaftlich qualifizierten Arbeitskraft für den Beruf, an der Ausbildung an- derer Studenten (z.B. als Tutor), an der Erarbeitung von Forschungsergebnissen.
Da er nun nicht bezahlt wird, müssen andere seine Ausbildung finanzieren. Unabhän- gig zu sein wäre aber notwendig, um kritisch, selbstständig und unabhängig seine Funktion im Arbeitsprozeß der Universität zu erfüllen. Die soziale Abhängigkeit und Abseitsstellung wirkt sich hemmend auf die von ihm erwartete geistige Selbständig- keit und Initiative aus: Er kann Gestaltung und Dauer des Studiums nicht bestimmen. Wenn die Eltern nicht bereit oder in der Lage sind, sein Studium zu finanzieren, hat der Student nur noch die Chance, zwischen anderen Abhängigkeitsverhältnissen zu wählen, wie z.B. der staatlichen Förderung nach dem Honnefer Modell40, Stipendien oder „ gr öß tenteils studienfremde(r)Werkarbeit “ 41, die ihn ebenfalls ideologisch beein- flussen42.
Das Honnefer Modell folgt dem Subsidaritätsprinzip: Erst wenn die Bedürftigkeit des Bewerbers festgestellt worden ist und er weder allein noch mit Hilfe der Familie die Kosten für das Studium aufbringen kann, greift ihm der Staat unter die Arme. Zuerst wird der Student also an seinen Vater verwiesen, der somit den Lebens- und Studien- weg bestimmen kann.
Das Geld ist zum Teil nur ein Darlehen, es muß nach Beendigung des Studiums zu- rückgezahlt werden. Der Bedürftige muß sich einer besonderen Eignungsprüfung un- terziehen, während bei Nichtbedürftigen das Abitur als Hochschulzugangsberechti- gung ausreicht43.
Der Student muß sich an mehrere Instanzen wenden, um die Studienförderung zu er- halten: an die staatliche Ministerialbürokratie, die seine Eignung an Kritierien wie „ geistige Reife “ 44 und „ Verst ä ndnis f ü r die Umwelt “ 45 mißt, an Hochschullehrer, die die Praxis der Eignungsfestellung bestimmen, und an die Bürokratie des Studenten- werks46. Er ist also „ Manipulationsversuchen mehrerer Instanzen ausgeliefert “ 47, die die Studienförderung zu geistig-erzieherischer Beeinflussung nutzen48.
Der Student soll ein besonderes Elitedenken anerzogen bekommen, indem er für seine Förderung kämpfen muß: Er muß besser sein als andere und darf auch nicht in Opposition zu seinen Förderern stehen, denn er ist auf ihr Wohlwollen angewiesen49.
Das Privileg des Studierens muß man sich also durch einen hohen Eigenbeitrag verdienen, sofern man nicht genug Geld hat, um das Studium selbst zu finanzieren. Andere Förderungsmaßnahmen des Staates wie Mensen und Wohnheime hingegen halten den Studenten in lebensfremder Unselbständigkeit, was ein Widerspruch zu der im Studium benötigten geistigen Selbständigkeit ist50.
Diese Vorstellung von Universität, die autoritäre Hochschulverfassung und die fakti- sche Nichteinbeziehung der Studentenschaft in die Gestaltung der Hochschule fördert eine „ paternalistisch-autorit ä re F ü rsorge- und Erziehungshochschule “ 51 , die Hoch- schule eines „ totalit ä ren Sozialstaats, der sich vom Element der sozialen Demokratie … entfremdet hat “ 52 .
Die in der Minderheit befindlichen Studenten aus der Oberschicht, die sich das Studium und den sozialen Aufstieg nicht erst durch den oben beschriebenen hohen Eigenbeitrag erkaufen müssen, gehören faktisch schon zu den „ Inhaber(n) der wirtschaft lich-gesellschaftlichen Macht “ 53. Das Studium ist für sie nur eine „ vornehme Art des ’ gehobenen Konsums ’“ 54 oder höchstens das „ formelle entr é billet “ 55 in die Machtelite, der sie ja durch ihre Familie bereits angehören.
Um sich „zum freien intellektuellen Arbeiter“56 zu emanzipieren, muß der Student das Studium als gesellschaftlich notwendige Arbeitsleistung bezahlt bekommen: Ein „ Studienhonorar “ soll die Lebenshaltungskosten sowie die Kosten für Lernmittel und kulturelle Bedürfnisse decken57, den Studenten „ aus allen sachfremden Abh ä ngig- keitsverh ä ltnissen “ 58 freisetzen und seine Selbständigkeit gewährleisten.
Das Studienhonorar verhindert auch eine Verletzung von Artikel 12 des Grundgeset- zes, da es freie Wahl des Berufes und der Ausbildungsstätte ermöglicht, während ohne eine unabhängige Bezahlung die Eltern bzw. die Gesellschaft die Erfüllung ihrer Vor- stellungen erzwingen und die monatlichen Geldzuschüsse von ihrem Votum abhängig machen59. Es entspricht dem Sozialen Grundrecht der Entlohnung einer Arbeitsleistung60 und sichert gleiche Startchancen und Entfaltungsmöglichkeiten61.
3.3. Die demokratische Hochschulverfassung
Besonderen Wert legt der SDS auf die Forderung nach studentischer Beteiligung in allen Gremien der Hochschule: Die Studentenschaft soll Gesamt-, Fakultäts- und Fachschaftsvertretungen bilden, denn die studentische Selbstverwaltung ist ein wert- volles Mittel zur demokratischen Erziehung und muß ideell und materiell unterstützt werden.
Die drei Teilverbände der Hochschule (Studentenschaft, Assistentenschaft, also alle nichthabilitierten wissenschaftlichen Mitarbeiter und Lehrkräfte, und Professoren- schaft62 ) müssen in dafür geeigneten Organen „ ihre unterschiedlichen Interessen zu einem Ausgleich bringen “ 63. Sie müssen sich nach dem Prinzip der „ Hochschulselbst- verwaltung “ über Rechte, Pflichten und soziale Beziehungen, über die Organisation der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre und über die Verwendung der vom Staat der Hochschule zur Verfügung gestellten Betriebsmittel einigen64. Außerdem obliegt ihnen die „ Vertretung der sozialen und politischen Interessen der akademischen B ü r- ger in der Gesellschaft und gegen ü ber dem Staatsapparat “ 65 .
„ Auf politische Stellungnahmen und Aktionen kann die Hochschule … und in beson derem Ma ß e die Studentenvertretung nicht verzichten. “ 66
Die Studentenvertretung hat das politische und soziale Bewußtsein der Studenten zu fördern. Zwar sind die geringe Wahlbeteiligung und das Desinteresse an der studentischen Selbstverwaltung Ausdruck von Konsumentenverhalten, doch die Bereitschaft zur politischen Aktivität ist bei Studenten größer als bei Altersgenossen außerhalb der Hochschule. Es besteht also gerade an den Hochschule die Chance, das Verharren im bloßen Konsumentendasein aufzubrechen67.
Da die mangelnde Bereitschaft der Studentenvertreter, die materialistischen Interessen der Studenten wirksam zu vertreten, ein Hauptgrund für das Desinteresse an der Stu- dentenvertretung ist, dürfen die Studentenvertretungen keine „ Elite der Elite “ sein, sondern müssen eine demokratische Beteiligung der Studentenschaft erreichen68.
Die Aktivitäten von Fachschaften, Allgemeinen Studierenden-Ausschüssen sowie bundesweiten Studenvertretungen, wie z.B. des VDS (Verband Deutscher Studentenschaften) dienen sowohl einer „ Demokratie ’ von unten ’“ 69 als auch den nächstliegenden Interessen der Studenten. Diese müssen davon überzeugt werden, diese Organisationen zu akzeptieren und zu nutzen.
Zu den Aufgaben der Fachschaften zählen Studienberatung durch ältere Studenten und Tutoren, die Bildung von Arbeits- und Diskussionskreisen, die Mitsprache in Fragen der allgemeinen Studienreform und bei Prüfungsordnungen sowie die Mitwirkung an der Planung von Lehrplänen und Studienprogrammen, außerdem die Berufsvorberei- tung und die „ Verbesserung der pers ö nlichen Kontakte unter Studenten und zu den Dozenten und Assistenten “ 70 .
4 . Die Bildungspolitik der SPD
Die SPD sieht in der Bildungspolitik die „ wichtigste Gemeinschaftsaufgabe unseres Volkes. Die Grundwerte des demokratischen Sozialismus Freiheit - Gerechtigkeit - Solidarit ä t bestimmen auch f ü r die Bildungspolitik das Wollen der deutschen Sozial- demokratie.
Freiheit ist die Grundbedingung aller Bildung des Menschen, der nur in einer reich gegliederten gesellschaftlichen und kulturellen Leben seine Pers ö nlichkeit entfalten kann.
Gerechtigkeit verlangt, allen Menschen ihren Anlagen entsprechende Bildungschan cen zu er ö ffnen.
Solidarit ä t beweist sich in der Hilfe der Gemeinschaft f ü r die freie Entwicklung eines jeden und ist Bedingung f ü r die Bewahrung der Freiheit aller. “71
Zur Sicherung der Beständigkeit der Demokratie nennt die SPD als Erziehungsziel den „ m ü ndigen “ , „ selbst ä ndigen “, aber auch „ verantwortlichen “ Bürger72.
4.1. „Die Zukunft meistern“
Bereits im Mai 1959 veröffentlichte die SPD die „ kleine Schrift “73 „Die Zukunft meistern“, in der sich folgende Thesen finden:
Die „ Zusammenballungen technischer, wirtschaftlicher und damit politischer Macht “ können gefährliche Auswirkungen haben und sind nur durch das ganze Volk kontrol- lierbar. Dafür muß sich der Mensch in „ freiheitlichen Lebensbedingungen entwi- ckeln “ 74 können. Politik ist dann „ nicht mehr nur Manipulation mit gegebenen Macht- verh ä ltnissen “ 75 .
Die Hochschulen brauchen mehr Mittel für Lehre und Forschung, mehr Professoren, Dozenten und Assistenten, bessere Lehrmittel und bessere Institute. Aber auch die materielle Not der Studenten muß gemindert werden, denn sie behindert sein Studium: Vom Honnefer Modell profitieren 19% der Studierenden, dabei hätten 70% diese Hil- fe nötig, also muß es weiter ausgedehnt werden76. Die Forderung des Grundrechts auf Gleichheit der Bildungschancen ergibt die Forderung, „ allen Begabten die gleichen Startbedingungen, … die ihnen gem äß e Bildung (und) … die notwendige wirtschaftli- che Hilfe “ 77 zu erbringen.
Im besonderen bildet die Hochschule diejenigen aus, „ die sp ä ter selber lehren und leitende Funktionen in der Gesellschaft ausf ü llen “ 78. An der Hochschule wird ge- forscht und experimentiert, um die Möglichkeiten und das Wissen der Gesellschaft zu steigern79. Die Industriegesellschaft hat die Nachfrage nach wissenschaftlichen Er- kenntnissen gesteigert. Folglich müssen mehr Menschen die Hochschule besuchen.80 Die bestehenden Einrichtungen müssen gefördert, neue Hörsäle und neue Institute ermöglicht und die Forschungs- und Ausbildungsstätten besser ausgestattet werden. Die Zahl der Dozenten muß ebenso erhöht werden wie ihre Bezahlung, um ihr Ab- wandern in fremde Berufe zu verhindern. Ein Fünfjahresplan für den Bau von Wohn- heimen muß erstellt werden81.
Die Finanzierung der dafür notwendigen Ausgaben soll durch Kürzungen bei einigen Steuern, Instituten und Ministerien erfolgen82.
4.2. Freiheit der Forschung
1959 erschienen, ebenfalls unter dem Titel „Die Zukunft meistern“83, noch „ Arbeitsmaterialien “, die verschiedene Initiativen der Jahre davor zusammenfassend darstellen und bilanzieren und aus denen folgende Forderungen stammen: Einsetzung eines unabhängigen Forschungsrates, ein umfassendes Programm zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, insbesondere der Geistes- und Sozialwissenschaften84 und der freien, nicht zweckgebundenen Forschung85.
Weitere Thesen aus diesen „Arbeitsmaterialien“:
Die Zahl der Studenten hat sich um 312% erhöht. Diesem Zustand muß durch Erweiterung der bestehenden Einrichtungen, die Erhöhung der Dozenten- und Assistenzahlen und die Einstellung von Verwaltungskräften86 begegnet werden. Das Tutorensystem ist auszubauen, ein NC ist abzulehnen. Nur diese Änderungen führen den Studenten über eine reine Fachausbildung hinaus.
Die Vorschläge des SDS nach Einführung eines methologischen und sozialwissen- schaftlichen Grundstudiums sind zu beachten87. Die Mitwirkung von Studenten und Nichtordinarien muß ausgebaut werden. „ Freiheit und Unabh ä ngigkeit von Wissen- schaft und Forschung sind die unabdingbare Voraussetzung jeder Hochschulre- form. “ 88
4.3. Studienförderung
Seit dem Wintersemester 1957/58 existierte das Honnefer Modell, gegliedert in eine Anfangs- und eine Hauptförderung, die im vierten Semester begann. Dazu stellte der Vorstand der SPD in seinen „Bildungspolitischen Leitsätzen“ fest, die Eignung für eine Förderung müsse je nach Ausbildungsziel unterschiedlich definiert werden, sie bedeute aber zunächst „ allgemeine Lebens- und Berufst ü ch- tigkeit “89. Die Förderung solle nicht nur überdurchschnittlich Begabten zugute kom- men, aber vor allem auf dem Subsidiaritätsaprinzip beruhen: „ Die Bemessungsgrund- lagen d ü rfen die Initiative und Verantwortung des jungen Menschen und seiner Fami- lie nicht beeintr ä chtigen. Ö ffentliche Hilfe ist notwendig, soweit die finanzielle Leis- tungskraft des einzelnen und seiner Familie die Ausbildung nicht bestreiten kann. “ 90 Allerdings seien die Familienverhältnisse zu berücksichtigen; die Höhe der Förderung müsse den Lebenshaltungskosten angepaßt werden, und die Förderungsbeiträge müßten sämtliche mit der Ausbildung zusammenhängenden Kosten decken91.
Für begabte Erwerbstätige sollte keine Altersbegrenzung gelten, und die freie Wahl des Studienortes und des Studienganges sollte nicht an der Höhe der Förderung scheitern, sondern nach Eignung und Neigung entschieden werden. Zu diesem Zweck war vorgesehen, die Förderung deutlich zu erhöhen92.
4.4. Hochschule und Studienreform
Zur Entlastung der Dozenten sollte eine Besoldungsreform erfolgen, die das Einkom- men unabhängig von der Zahl der Studenten und Vorlesungen machen sollte. Außer- dem sollte der Akademischen Mittelbau umstrukturiert werden: Assistenten sollten „ f ü r eine begrenzte Zeit pers ö nliche Mitarbeiter der Professoren sein “ 93., Tutoren sollten Einführungs- und Übungskurse leiten, Kustoden den Sachbestand des Instituts verwalten und Lektoren als Lehrkräfte einen wesentlichen Teil des akademischen Unterrichts übernehmen94. Schließlich sollte ein Kanzler in Dauerstellung langfristige Planung ermöglichen, indem er sich seine Aufgaben mit dem Rektor teilen sollte, des- sen jährliche Wieder- oder Neuwahl weiterhin vorgesehen war, oder indem er die Funktion des Rektors mitübernahm95.
Auch der Zugang zum Lehrberuf sollte erleichtert und attraktiver gemacht werden: Ein Beamtenverhältnis auf Widerruf wurde abgelehnt, und die Habilitation sollte auch ohne entsprechende Schrift möglich sein, wenn die Befähigung durch andere Veröffentlichungen nachgewiesen würde96.
Auch das Studium selbst sollte reformiert werden: Vorgesehen waren an die wissen- schaftlichen Anforderungen angepaßte Prüfungsordnungen, Zwischenprüfungen für die Leistungskontrolle durch den Studenten selbst und für die Feststellung der weite- ren Eignung für das betreffende Fach. Auch die Berufsbezogenheit sollte nicht außer Acht gelassen werden, also wurden Praktika gefordert. In den Abschlußprüfungen sollte der Nachweis einer dem Stand der Wissenschaft entsprechenden Ausbildung gebracht werden.
Die Studienbedingungen sollten durch den Ausbau von Instituts-, Hochschul- und Spezialbibliotheken, eine Vergrößerung der Lesesäle und eine Erhöhung des Beschaffungsetats verbessert werden97.
Auf dem Bundesparteitag 1960 wurde vom Parteivorstand ein Antrag verabschiedet, der vorsah, daß die Hochschulen die gesamtdeutschen Probleme in ihrer Arbeit stärker berücksichtigten98. Eine politische und sozialwissenschaftliche Bildung aller Studen- ten wurde angestrebt99, und die studentische Selbstverwaltung sollte einen festen Platz in der Hochschule finden100.
Die SPD stellt sich einen „ Staat und eine Gesellschaft “ vor, „ die in der Bildung des Menschen ihren letzten Sinn erblicken “: Staat und Gesellschaft sollten Raum für Bildung und Kultur schaffen, „ indem sie Einrichtungen ins Leben rufen und erhalten, die es dem Menschen erleichtern, aus sich herauszuholen, was in ihm an M ö glichkeiten zur Selbstverwirklichung angelegt ist. “ 101
5. Bilanz
Die Bildungsprogramme beider Gruppen beziehen sich unmittelbar auf die Situation der Studenten: Beide fordern eine Unabhängigkeit der Hochschule von gesellschaftlichen und staatlichen Interessen und sind für bessere Ausstattungen der Universitäten sowie höhere finanzielle Zuwendungen an das Lehrpersonal und die Universitäten selbst. Beide betonen, daß das Interesse des Menschen an der Verwirklichung seiner eigenen Ziele und Ideale im Mittelpunkt stehen und nicht durch ökonomische Zwänge eingeengt werden soll. Deshalb fordern sie mehr Gelder für die Bildung, damit das Studium ohne Zwang und zweckfrei vor sich gehen könne.
Der SDS äußert sich konkreter zu den Aufgaben und Zielen der Studentischen Selbstverwaltung, die SPD betont immerhin deren wichtige Rolle.
Beide sind für den Ausbau der finanziellen Studienförderungen, wobei der SDS in dieser Frage aber weiter geht als die SPD: Während diese das Honnefer Modell bejaht, es aber weiter ausgebaut sehen will, denkt der SDS mit seiner Forderung nach einem Studienhonorar unabhängig von der „Eignung“ darüber hinaus. Die Feststellung dieser Eignung wird vom SDS abgelehnt, die SPD hingegen betont ihre Wichtigkeit für das Funktionieren der Industriegesellschaft.
Der SDS stellt die Rolle der Universität in der Gesellschaft komplett in Frage, wobei die SPD insoweit mit ihm konform geht, als sie ebenfalls fordert, die Universität müsse den Menschen zu einem verantwortungsbewußten Bürger in einem demokratischen Staat erziehen. An diesem Staat und dieser Gesellschaft selbst kritisiert sie aber nicht so viel wie der SDS. Die oben angeführte Wissenschaftskritik, daß die Universität ihre Forschungsergebnisse unreflektiert an die Gesellschaft ausliefere102, ist in keiner Erklärung der SPD zur Bildung zu finden.
Selbstverständlich muß eine Partei, deren Ziel es ist, die Regierung zu stellen, sich positiv auf die Gesellschaft beziehen. Gefordert wird eher unter dem Machbarkeitsaspekt als nach ideellen Gesichtspunkten, eine grundlegende Kritik an der Funktion der Hochschule für die Gesellschaft kann nicht geleistet werden, weil sie zu „umstürzlerisch“ wirken würde. Immerhin wurden einige Forderungen des SDS übernommen, wie z.B. das methodologisch-sozialwissenschaftliche Grundstudium.
Es herrschen also einerseits sehr ähnliche Vorstellungen, andererseits unterschiedliche Schwerpunkte. Die Unterschiede sind graduell, aber als gemeinsame Grundlage lag ein sozialdemokratisches Menschenbild vor, das die Interessen der Studenten eingehend berücksichtigen wollte und an heutige Forderungen aus der SPD nach Studiengebühren und Mittelkürzungen nicht denken ließ.
Die Äußerungen des SDS sind also kritischer, richten sich aber nicht gegen die SPD. Vielmehr wurde vom SDS noch kurz vor dem Unvereinbarkeitsbeschluß großer Wert auf die Zugehörigkeit zur SPD gelegt, da der Studentenbund sich als Bestandteil der Sozialdemokratie begriff. „ Erst als sich immer deutlicher herausstellte, da ß der Par teivorstand tats ä chlich die Zerschlagung des SDS anstrebte, gaben die meisten der sozialistischen Studenten ihre lebensgeschichtlich begr ü ndete Treue zur Partei auf und brachen auch innerlich mit der Sozialdemokratie. “ 103
Die Angriffe des SPD-Parteivorstands richteten sich aber nicht nur gegen den SDS, sondern gegen die gesamte traditionelle Linke in der Partei104: Und eher darin als in konkreten Äußerungen des SDS kann der Grund für den Unvereinbarkeitsbeschluß gesehen werden: Er war Resultat einer wachsenden Intoleranz gegenüber der Linken.
„ Durch die Spaltung des SDS und die Gr ü ndung des absolut parteitreuen SHB ver- suchten die ’ Godesberger ’ 105 im SPD-Parteivorstand … prophylaktisch, weitere theo- retische Diskussionen ü ber die abstrakte Grunds ä tzlichkeit des neuen Programms abzublocken. “ 106
Die Mehrheit des Parteivorstands hatte sich bewußt auf das nach wie vor in großen Teilen der Bevölkerung herrschende rechte Meinungsklima eingestellt, was eine Aus- grenzung des SDS nötig zu machen schien: In den sechziger Jahren glaubte die SPD, es sich nicht leisten zu können, kommunistischer Umtriebe in ihren Reihen verdächtigt zu werden, und duldete allzu emanzipatorische Bestrebungen in ihren Reihen nicht. Dafür, daß konkrete Äußerungen des SDS zur Bildung nicht den Ausschlag gegeben haben können, spricht, daß die Hochschuldenkschrift des SDS auf einem Papier von 1953 beruht, dem auf der „Hochschulpolitischen Tagung“ in Kassel ausgearbeiteten Entwurf für ein „Hochschulprogramm des SDS“107. Die Forderungen des SDS waren also bereits lange genug bekannt, so daß der Unvereinbarkeitsbeschluß wohl eher in der Strategie der Parteiführung begründet liegt als in konkreten bildungspolitischen Differenzen.
[...]
1 Vgl. Tilman Fichter: SDS und SPD. Parteilichkeit jenseits der Partei, Opladen 1988, S.60
2 Vgl. ebd.
3 Fichter, S. 48
4 ebd.
5 ebd., S.52
6 ebd., S.48
7 ebd., S.63
8 ebd., S. 64
9 ebd., S. 17
10 Fichter, S. 269
11 Obwohl 77% der Bevölkerung die Stationierung amerikanischer Atomwaffen ablehnten, gewann die CDU, die dafür eintrat, 50,2% der Stimmen bei der dritten Bundestagswahl 1957. 2 Die SPD, die sich im Wahlkampf gegen die Stationierung ausgesprochen hatte und an der „Kampf dem Atomtod“-Kampagne beteiligt war, konnte die in der Bevölkerung verbreitete Angst vor dem Atomkrieg nicht in Wählerstimmen ummünzen.
12 Karl A. Otto: APO. Außerparlamentarische Opposition in Quellen und Dokumenten (1960- 1970), Köln 1989, S. 19
13 „ Die weltpolitische Lage wird in K ü rze die beiden Teile Deutschlands zwingen, miteinander zu verhandeln. Damit solche Verhandlungen m ö glich werden, ist es n ö tig, da ß Formeln wie ’ Mit Pankow wird nicht verhandelt ’ aus der politischen Argumentation verschwinden. Das Ziel notwendiger Verhandlungen, die bisher stets von der Bundesregierung ungepr ü ft zur ü ckgewie- sen wurden, mu ß sein: 1. die Umrisse eines Friedensvertrags zu entwickeln, 2. die m ö glichen- Formen einer interimistischen vorl ä ufigen Konf ö deration zu pr ü fen. “ Otto, S.141
14 Otto, S. 143
15 Fichter, S. 276
16 ebd., S. 277
17 Otto, S. 144
18 Fichter, S. 277
19 Fichter, S. 279 f.
20 ebd. S. 298
21 ebd.
22 ebd, S. 301
23 ebd., S. 345
24 Otto, S. 148
25 Vgl. Sozialistischer Deutscher Studentenbund: SDS-Hochschuldenkschrift, Berlin 1961, Vorbemerkung der Redaktion, o.S.
26 Vgl. ebd.
27 Vgl. ebd., S. 1.
28 Vgl. ebd., S: 2..
29 Vgl. ebd., S. 1.
30 Vgl. ebd., S. 1f.
31 Vgl. ebd., S. 2.
32 ebd., S. 2
33 ebd., S. 3
34 ebd., S. 4
35 Trotzdem forderte der SDS die Einführung einer „ methodisch-soziologischen Grundorientierung “: Dieses Fach sollte für alle Universitäten und Technischen Hochschulen verbindlich sein. Vgl. Fichter, S. 210.
36 Vgl. SDS-Hochschuldenkschrift, S. 5.
37 ebd., S. 5
38 ebd., S. 5
39 SDS-Hochschuldenkschrift, S. 133
40 Im Wahljahr 1957 beschloß die Mehrheit des deutschen Bundestages, aus seinem Haushalt eine allgemeine Studienförderung, vergleichbar dem heutigen BaföG, zu finanzieren.
41 SDS-Hochschuldenkschrift, S. 134
42 Vgl. ebd.
43 Vgl. ebd., S. 134f.
44 Zitiert nach: ebd., S. 135.
45 Zitiert nach: ebd.
46 Vgl. ebd.
47 ebd., S,. 134
48 Vgl. Ebd., S. 135.
49 Vgl. ebd.
50 Vgl. ebd., S. 136.
51 ebd.
52 ebd.
53 ebd., S. 138
54 ebd.
55 ebd.
56 ebd.
57 Vgl., ebd.
58 ebd., S. 139
59 Vgl. ebd.
60 Vgl. ebd.
61 Vgl. ebd.
62 Vgl. ebd., S. 143.
63 Vgl. ebd.
64 Vgl. ebd., S. 143f.
65 ebd., S. 144
66 ebd.
67 Vgl. ebd., S. 145.
68 Vgl. ebd., S. 146.
69 ebd., S. 147
70 ebd., S. 148
71 Bildungspolitische Leitsätze des Parteivorstandes vom 2. Juli 1964, in: Sozialdemokratische Partei Deutschlands: Programme und Entschließungen zur Bildungspolitik 1964-1975. Dokumentation, Bonn 1981, S. 7
72 ebd., S. 8
73 Vorstand der SPD: Die Zukunft meistern, Bonn 1959, S. 3.
74 ebd., S. 15
75 ebd.
76 Vgl. ebd., S. 10.
77 ebd., S.19
78 ebd., S. 20
79 Vgl. ebd.
80 ebd., S.20 f.
81 ebd., S.20 f. Mehr Wohnheime forderte trotz der „lebensfremden Unselbständigkeit“, zu der sie führen sollten (s.o.), auch der SDS. Vgl. BELEG ???
82 Vgl. ebd., S. 25 f. Beispielsweise sollte im Verteidigungshaushalt 1 Milliarde DM eingespart werden.
83 Parteivorstand der SPD (Hrsg.): Die Zukunft meistern. Arbeitsmaterialien zum Thema: Wissenschaft, Forschung, Erziehung und Bildung. 2. Aufl., Berlin/Hannover 1959.
84 Vgl. ebd., S.42.
85 Vgl. ebd., S. 43
86 Vor allem mit dem Ziel, die Dozenten und Assistenten von den verwaltenden Tätigkeiten zu entbinden.
87 ebd., S. 67
88 ebd.
89 Bildungspolitische Leitsätze, S. 22
90 ebd.
91 Vgl. ebd., S. 23.
92 Vgl. ebd., S. 23.
93 ebd., S. 27
94 ebd., S. 27f.
95 Vgl. ebd., S. 28.
96 Vgl. ebd.
97 ebd., S. 29ff.
98 Vorstand der SPD: Protokoll der Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vom ???, S. 740f.
99 Vgl. ebd., S. 741.
100 Vgl. ebd., S. 742f.
101 Vorstand der SPD: Protokoll der Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlandsvom 13.-15. November 1959 in Bad Godesberg, S. 263.
102 „ Die Selbstauslieferung der Universit ä t an den Nationalsozialismus, ihre ’ Brauchbarkeit ’ als Instrument seiner Rechtfertigung w ä hrend des ’ Dritten Reiches ’ ist hierf ü r gewi ß das pr ä gnanteste, keinesfalls aber das einzige Beispiel. “ SDS-Hochschuldenkschrift, S. 3.
103 Fichter, S. 323.
104 Fichter, S.299.
105 Mit diesem Begriff sind die Leute gemeint, die sich im Sinne des Godesberger Programms von 1959 stärker an der Regierungsfähigkeit der SPD orientierten und deshalb eher auf die
Linie der amtierenden Regierung einzuschwenken waren. Beispielhaft hierfür ist die Abkehr der SPD von der Kampagne „Kampf dem Atomtod“.
106 Fichter, S.17
107 Vgl. ebd., S. 207.
- Arbeit zitieren
- Marie Kuster (Autor:in), 2001, Konflikte in der Bildungs- und Hochschulpolitik zwischen der SPD und dem SDS Anfang der Sechziger, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106106
Kostenlos Autor werden






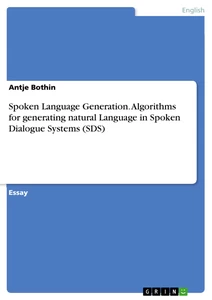



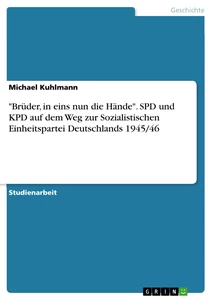



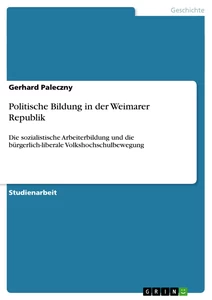
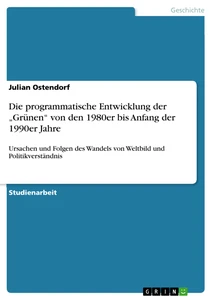






Kommentare
hallöchen.
Mal ausprobieren.