Excerpt
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Konsum und Mißbrauch von Alkohol und anderen Drogen
2.1 Konsumänderungen und Übergangsphasen im Lebenslauf
2.2 Einflußfaktoren für lebenslange Veränderungen im Konsumverhalten
2.3 Langfristige Folgen des Konsums für die zukünftige Lebensgestaltung...
3. Tabakkonsum, Interventions- und Präventionsansätze
3.1 Erklärungsmodell des Rauchens
3.2 Prävention des Rauchens
3.3 Techniken und Therapien zur Entwöhnung
4. Abschließende Betrachtung
5. Literatur
1. Einleitung
In dieser Arbeit soll das gesundheitliche Risikoverhalten am Beispiel von Rauchen, Alkohol und illegalen Drogen erläutert werden. Hierzu muß aus meiner Sicht zuerst geklärt werden, was Risikoverhalten eigentlich bedeutet: Risikoverhalten meint das Verhalten einer Person unter Risikobedingungen. Damit grenzt sich das Risikoverhalten klar von dem oft damit verwechselten riskanten Verhalten ab. Letzteres meint eher ein sorgloses Verhalten einer Person, z. B. Autofahren ohne Nutzung des Sicherheitsgurtes oder aber Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern ohne Nutzung von Verhütungsmitteln.
Weiterhin erscheint es mir sinnvoll zu ermitteln, was eigentlich unter dem Begriff Gesundheit verstanden wird. Sie wird als höchster Wert, als Lebensziel, als ein Gut verstanden1. Die bekannteste wertorientierte Umschreibung von Gesundheit ist die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO):
"Health is a state of complete physical, mental and social
well-being and not merely the absence of disease or infirmity." (WHO 2000)
Mit dieser Definition löste die WHO den Begriff aus einer rein biomedizinischen Sichtweise und den engen Bezügen des professionellen Krankheitssystems heraus. Gesundheit umfaßt körperliche, seelisch-geistige und soziale Anteile, die sich wechselseitig beeinflussen.
Diese Definition wurde durch die WHO selbst aus Kritik an mehreren Unterpunkten ergänzt und verändert. Gesundheit wird nun als ein Prozeß, als eine Suche nach dem stets optimalen Gleichge- wicht der drei Anteile beschrieben. Sie kann kein einmal erreichter und damit unveränderlicher Zustand sein, sondern ist eine lebensgeschichtlich und alltäglich immer wieder neu und aktiv herzustellende Balance. Gesundheit ist damit auch kein fernes, zukünftiges Ziel mehr, sondern ausdrücklich Bestandteil des täglichen Lebens und liegt weitgehend in der Eigenverantwortung des Individuums.
Im folgenden Teil meiner Arbeit möchte ich mich zunächst mit dem Konsum und Mißbrauch von Alkohol und illegalen Drogen befassen, während ich auf die Problematiken des Tabakkonsums, sowie die Interventions- und Präventionsansätze hierzu, erst im dritten Teil näher behandeln möchte.
2. Konsum und Mißbrauch von Alkohol und anderen Drogen
Vorweg kann schon einmal gesagt werden, daß Alkohol- und Drogenkonsum bei Jugendlichen die Funktion hat, sich einen Quasi-Erwachsenenstatus anzueignen. Es muß hier jedoch hinsichtlich mehrerer Unterpunkte differenziert werden:
-Konsumänderungen im Hinblick aufÜbergänge im Lebenslauf,
-Einflußfaktoren für lebenslange Veränderungen im Konsumverhaltenund
-Langfristige Folgen des Konsums für die zukünftige Lebensgestaltung.
2.1 Konsumänderungen und Übergangsphasen im Lebenslauf
Alkohol und Drogen unterscheiden sich hinsichtlich der Applikation, der erwünschtenRauschwirkung, sowie hinsichtlich denpsychischenundkörperlichen Auswirkungen. Drogen sind illegale psychoaktive Substanzen (z. B. Kokain, Heroin, usw.). Sie können aber auch Substanzen ohne medizinische Indikation (z. B. Amphetamine, Aufputschmittel, usw.) oder frei zugängliche Stoffe (z. B. Inhalatien = Lösungsmittel, Klebstoffe, Alkohol, usw.) sein, die man schon im Kaufhaus ohne weiteres erwerben kann.
Der Konsum muß im Kontext auf Häufigkeit und Zeitraum überprüft werden. Ein Beispiel hierfür ist z. B. Biere pro Trinkgelegenheit während des letzten Monats oder aber die Trinkgeschwindigkeit oder die Anzahl von Rauschzuständen.
Ebenso muß im Kontext eine Unterscheidung von Mißbrauch und Gebrauch getroffen werden. Mißbrauch hebt sich vom Gebrauch hinsichtlich folgender Punkte ab:
1. Ausmaßabträglicher physiologischer und psychologischer Effekte der Substanz, z. B. Konsum mittlerer oder großer Mengen über einen längeren Zeitraum.
2. Entwicklungsstandder Person z. B. Kinder vor der Pubertät.
3. Lebensumständeder Person, die den Konsum beeinträchtigen.
4. Physische Abhängigkeitder Person z. B. Entzugserscheinungen mit folgenden Dosis- steigerungen um die nachlassende Wirkung zu kompensieren.
5. Folgeschädenfür die Person, anderer Menschen oder Sachen z. B. Schaden soz. Bezie- hungen oder Rechtsbrüche durch Beschaffungskriminalität.
Mit diesen Punkten kann also Mißbrauch von Gebrauch hinsichtlich folgender Faktoren unterschieden werden:
1. Substanz- und Konsumumstände (o. a. Punkt 1.).
2. Person (o. a. Punkt 2.).
3. Reaktion (o. a. Punkt 4.)
4. Konsequenzen (o. a. Punkt 5.).
Schwarzer nennt folgende Konsumspitzen der verschiedenen Drogen2:
Alkohol: Ca. 25 % von 11 - 15 jährigen tranken vor dem 11 Lebensjahr einen
„richtigen Schluck“ Alkohol.
Jugendzeit: durchgehend steiler Anstieg der Häufigkeit.
Frühes Erwachsenenalter: gleichermaßen deutlicher Abfall.
Cannabis: Gipfel bei 18 - 22 Jahren, Ende der achtziger Jahre haben 10 % der 18
jährigen Cannabis konsumiert.
Harte Drogen: (= Kokain und Heroin) Der Konsum ist unterschiedlich über das Alter verteilt. Es wurden hier von den Konsumenten meist Vorerfahrungen mit Alkohol oder Haschisch gemacht, wobei diese aber nicht zwangsläufig zum Konsum dieser Drogen führen müssen (Einstiegs-Drogen-Problematik).
Inhalatien: Ende der achtziger Jahre wurden Untersuchungen an Schulen mit folgendem Ergebnis durchgeführt:
Schüler/innen: Klasse 7 = 9 %, Klasse 13 = 1 %.
Im Hinblick auf Übergänge im Lebenslauf kann für den Konsum von Alkohol und harten Drogen gesagt werden, daß er stärker bei Personen zu verzeichnen ist, die als Erwachsene keine feste persönliche Bindung hatten oder wechselnden Beschäftigungen nachgingen. Männliche Rentner zeigten z. B. im Vergleich zu männlichen Berufstätigen kurz vor der Pensionierung keine Veränderung der jährlichen Trinkmenge, wohl aber eine Veränderung in der Trinkgewohnheit. Sie griffen häufiger zur Flasche als die noch im Berufsleben stehenden Männer.
Frauen reagierten mit einer Abnahme des Substanzgebrauchs, wenn sie sich damit aus einem ungünstigen Lebenskreis lösen konnten, z. B. in Scheidungssituationen nach langjähriger Partnerschaft.
Cannabiskonsum geht dem gegenüber schon in Erwartung von Heirat oder Elternschaft zurück. Generell kann eine Zunahme von Alkohol- und Drogengebrauch durch nachlassende soziale Kontrolle von Familie und Nachbarschaft, sowie durch Ausweitung der Freizeit prognostiziert werden. Eine Abnahme des Konsums kann sowohl durch Veränderungen im politischen Bereich (z. B. Jugendschutzgesetz) oder durch Medienkampagnen, als auch durch die Erfahrung negativer Effekte seitens der Konsumenten hervorgerufen werden.
Das Fazit, das aus diesen Beispielen gezogen werden kann, ist, daß dieAuseinandersetzung mitgeänderten Umständen und neue Lebensperspektiven selbst langjährige Abhängigkeiten zu überwinden vermögen. Was also Entzugskliniken nicht schaffen, kann fortschreitendes Alter mit entsprechend neuen Einsichten und Kontexten bewirken.
2.2 Einflußfaktoren für lebenslange Veränderungen im Konsumverhalten
Wichtiger Ausgangspunkt sind hier die individuellen Entwicklungsbedingungen in der Kindheit und Jugend der einzelnen Personen. In diesem Lebensabschnitt findet nämlich ein Wechselspiel zwischen der biologischen Entwicklung (Pubertät) und Kontexteinflüssen hinsichtlich des Alkoholund Drogenkonsums statt. Schwarzer führt hier als verdeutlichendes Beispiel dieFrühreife vonMädchenan3. Diese Frühentwicklung stellt für ihn einen Risikofaktor dar, da diese Mädchen schneller Freundschaft mit älteren männlichen Jugendlichen schließen, durch deren Vorbild sie dann letztendlich mehr Alkohol und Drogen konsumieren, als ihre Altersgenossinnen. Der erhöhte Konsum dieser Mädchen liegt vielleicht in der Findung eines Gleichgewichts zwischen äußerer Erscheinung und sozialer Entwicklung begründet.
Hinsichtlich der lebenslangen Veränderungen im Konsumverhalten muß man zwischenExperimentierenundlängerfristigem Mißbrauchunterscheiden. Gründe für anfänglichesExperimentierensind dieVerfügbarkeitder Substanz/en, geeigneteVerhaltensmodellez. B. von Seiten der Eltern undbesondersderEinflußvon Peergruppen. Gerade von diesen geht Druck zu sozialer Anpassung aus, der vor allem bei Jugendlichen mit geringem Selbstwertgefühl greift. LängerfristigerMißbrauchresultiert dann aus dem physiologischen Effekt der Droge und aus den hieraus folgenden Defiziten. Diese sind z. B. die Bewältigung von Leistungserwartungen und sozialen Anforderungen oder den Aufgaben des täglichen Lebens gerecht zu werden.
Des weiteren gilt es auch die Art der Risikofaktoren näher zu differenzieren. Sie können a) nahe an der Person und ihrem Verhalten ansetzten (proximal) oder b) sich der Kontrolle der Person entziehen und einen indirekten Einfluß aus der Ferne ausüben (distal).ProximaleEinflüsse sind beispielsweise die Akzeptanz des Substanzkonsums bei anderen oder aber das Wissen über das Verhältnis von Schaden und Nutzen des Gebrauchs, etc.DistaleEinflüsse wirken sich dem gegenüber erst über dieProximalenaus.
Die Gründe für Alkohol- und Drogenkonsum sind letztendlich vielfältig und individuell verschieden. Als Schwerpunkt kann jedoch das Erheischen vonAufmerksamkeitund die Aneignung von Privilegien des Erwachsenenstatusgesehen werden4. Ca. 10 % der Population zeigen Alkoholund Drogenmißbrauch über die Jugend hinaus. Diese Personen sind in der Jugendphase jedoch nicht an Ihrem gesteigerten Konsum zu erkennen, sondern an Verhaltensweisen, wie z. B. Aggressivität, Scheu und Impulsivität. Die restlichen 90 % der Population, also die Mehrheit, zeigennurin der Jugend Alkohol- und Drogenmißbrauch. Die genannten 10 % fungieren hier jedoch als Schlüsselfiguren: Sie führen der Mehrheit am Anfang der Pubertät vor, daß man mit dem Konsum der jeweiligen Substanz/en die o. a. Funktionen erreichen kann.
Ein weiterer Schwerpunkt ist inelterlichem Fehlverhaltenwährend der Erziehung zu finden.
Fehlverhalten, die oft auch in Kombination auftreten, sind z. B. geringe Herausforderungen, Desinteresse oder aber geringe Wertschätzung gegenüber dem Kind. Akzeptable Verhaltensweisen sind dagegen die Vermittlung von Wärme und Zuwendung, entwicklungsgerechte Herausforderungen und klare Erwartungen. Aus den Fehlverhaltensweisen der Eltern können z. B. mangelnde Ich-Kontrolle, niedrige Ich-Stabilität und fehlende Selbstbestätigung der Kinder resultieren. Beispiele fürmangelnde Ich-Kontrollesind Impulsivität, leicht labiles Verhalten und ein nicht-Aufschieben-können von Belohnungen. Mitmangelnder Ich-Stabilitätist z. B. mangelnde Initiative, wenig Selbstvertrauen und wenig Vitalität der Kinder gemeint. Beide Fehlerziehungsresultate führten im Endeffekt dazu, daß diese Kinder in späterer Jugendphase stärker auf Peergruppen und deren Verhaltensnormen ausgerichtet waren, als `richtig´ erzogene Kinder.
Ein weiterer Grund für Alkohol- und Drogenkonsum können auchgenetische Faktorensein. Diese äußern sich vor allem bei ungünstigen Umweltbedingungen. Ein Beispiel hierfür sind Adoptionskinder aus alkoholbelasteten Familien. Ein Alkoholmißbrauch äußerte sich bei diesen Kindern später nur, wenn auch die Adoptionsfamilie einen niedrigen sozialen Status hatte. Dies führte bei den Kindern zu hohem Stimulationsbedürfnis und niedriger Angstvermeidung. Sie ließen sich also leicht durch Unbekanntes mitreißen und kannten dabei wenig Furcht. Ein hieraus folgendes hohes Risiko in Bezug auf Alkohol- und Drogenkonsum erscheint auf Grund dessen logisch.
Über dies hinaus kann auch eine gescheiterte Mißerfolgsbewältigung zu Alkohol- und Drogenkonsum führen, wenn Jugendliche beispielsweise den schulischen und elterlichen Anforderungen oder anderen normativen Entwicklungskontexten nicht gerecht werden konnten. Eine Folge dessen ist wieder mangelnde Selbstbestätigung, verbunden mit der Suche, diese auf anderen Wegen, nämlich über Peergruppen mit Alkohol- und Drogenkonsum, zu erreichen. Hier gilt somit das Sprichwort: `Gleich und Gleich gesellt sich gern.´
2.3 Langfristige Folgen des Konsums für die zukünftige Lebensgestaltung
Aus längerfristigem Alkohol- und Drogenkonsum ergeben sich in erster Linie Folgen für die Gesundheit. Personen, die im Jugendalter viel Substanz konsumierten und diesen Konsum im Alter dann senkten, erfahren eine Verbesserung der Gesundheit. Enthaltsam Lebende zeigten dem gegenüber ungünstigere gesundheitliche Veränderungen. Die Schlußfolgerung hieraus ist, daß Abstinenz nicht immer die beste Methode sein muß, um möglichst gesund zu leben. Sie kann bei Jugendlichen sogar als Zeichen für mangelnde Integration in soziale Bezüge gesehen werden. Ein weiteres Beispiel hierfür liefert die Altenpflege: Senioren mit mäßigem Alkoholkonsum weisen weniger psychiatrische Symptome auf, als abstinente Senioren. Dem Alkohol kommen also hier positive physiologische Auswirkungen zu, allerdings nur, wenn er in Maßen zugeführt wird. Ein weiterer gesundheitsfördernder Faktor hierbei ist auch die durch den Konsum zustande kommende Geselligkeit.
Im Hinblick auf die Vielfalt der in der Literatur zu findenden Beispiele wird in der folgenden Tabelle in Bezug auf die zugeführte Substanz jeweils ein Beispiel genannt:
Rauchen: Frauen, die in der Jugend geraucht haben, mit zunehmenden Alter aber den Konsum eingeschränkt haben, erfahren eine Verbesserung der Gesundheit. Inhalatien: Bei Frauen und Männern ergeben sich hier Gesundheitsprobleme gleich in der Jugend. Selbst im Erwachsenenalter sind die erworbenen Probleme noch akut, da durch den Konsum neurologische Veränderungen stattgefunden haben.
Cannabis: Gesundheitsprobleme wurden bei längerfristigem Konsum nur bei Frauen beobachtet, die selbst im Alter noch Cannabis rauchten.
Harte Drogen: Heroin: Mit Methadon (Warmer Entzug) wurde die Gesundheit durch eine bessere begleitende Versorgung verbessert, da die Personen nicht mehr unter Rauscheinwirkungen standen und den Aufgaben des täglichen Lebens gerecht werden konnten. Wurde jedoch von den Personen in dieser Methadonphase noch Alkohol konsumiert, erfolgte durch den kombinatorischen Effekt eine drastischere Verschlechterung der Situation der Personen, als wenn „nur“ Heroin weiterkonsumiert worden wäre.
Weiterhin ergeben sich aus längerfristigem Alkohol- und Drogenkonsum auch Folgen für die Normalbiographie. Durch Substanzkonsum kann es zuZeitverschiebungenim Lebenslauf kommen. So verschieben Alkohol- und Cannabiskonsum beispielsweise Elternschaft od. Heirat nach hinten. Mit zunehmendem Gebrauch wächst auch die Anzahl der Jobwechsel und die Dauer der beschäftigungslosen Zeiten, selbst wenn das erworbene Gehalt in dieser Zeit annähernd gleich bleibt. Außerdem wirkt sich der Konsum auch auf dieMißerfolgsbewältigungaus (z. B. vorzeitig abgebrochene Schulausbildung).Cannabiskonsumerhöht hier das Risiko um 2 %, mangelnde Schulleistungen (die eine Folge dieses Konsums sein können) erhöhen das Risiko um 10 %. Gründe hierfür sind wieder 1. eine vorzeitige Einnahme von Erwachsenenrollen, 2. eine gering ausgeprägte Normorientierung und 3. sozialer Druck von Peergruppen.
Über dies hinaus ergeben sich aus längerfristigem Konsum auch Folgen fürfamiliäre Beziehungen. Ein Beispiel hierfür ist die Zerstörung des Familienlebens durch Alkohol: Männer mit längerem Alkoholkonsum neigen zu häufigeren und roheren Gewalttätigkeiten. Dies resultiert jedoch aus antisozialem Verhalten, was erst eine Folge des Alkoholmißbrauchs ist. Generell kann auch gesagt werden, dass durch Drogenkonsum eine Beeinträchtigung der Erziehungsfunktion stattfindet: Es herrscht eine depressive Grundstimmung vor, die ein emotional distanziertes Verhalten zum Kind zur Folge hat. Die Beeinflussung des mütterlichen Erziehungsverhaltens ist hierbei größer, je länger und intensiver der Mann Alkohol konsumierte. Es zeigte sich hier ein „Klammern an das Kind“5, um die fehlende emotionale Wärme des Partners auszugleichen.
Die Anhäufung von mehreren Problemen zu Syndromen birgt auch Schwierigkeiten auf lange Sicht, z. B. die Anpassungsprobleme eines Teenagers mit folgendem Alkoholmissbrauch hinsichtlich der Entwicklung zum Problemtrinker im Erwachsenenalter. Es muß jedoch angemerkt werden, daß nicht alle Menschen mit (multiplen) Anpassungsproblemen zu Problemtrinkern werden. Je nach Balance der Risikofaktoren, z. B. früh auftretende Verhaltensprobleme, und der Schutzfaktoren, z. B. unterstützendes Milieu, sind die bereits genannten Störungen aufhaltbar und teilweise auch reversibel.
3. Tabakkonsum, Interventions- und Präventionsansätze
Fakt ist, daß der Raucheranteil in der Bevölkerung ab 14 Jahren abnimmt: Rückgang von `84 - `90 von 36 % auf 28 %6. Gründe für diesen Prestigeverlust des Rauchens sind breit gestreut: Auf der einen Seite klären wissenschaftliche Reporte und Medienkampagnen die Bevölkerung über die gesundheitlichen Folgen auf, auf der anderen Seite werden gesundheitspolitische Maßnahmen ergriffen und gesundheitserzieherische Intervention betrieben. Betrachtet man denRaucheranteil genauer, so fällt auf, daß die Prävalenz bei Männern (37 %) höher ist, als bei Frauen (22 %), wobei beide Geschlechter in der Jugend jedoch ungefähr zu gleichen Anteilen rauchen. Es muß weiterhin beachtet werden, daß in sozial schwächeren Schichten mehr geraucht wird, als in sozial höheren: So rauchen beispielsweise Männer mit Abitur nur halb so häufig, wie Männer mit Hauptschulabschluß. In diesem Zusammenhang schildert Schwarzer die auf den Daten von Kahl, Fuchs, Semmer und Tietze (1994, S.70) basierende Untersuchung von Schülern verschiedener Schultypen hinsichtlich des Tabakkonsums7:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
An diesen Daten ist auffällig, daß derRaucheranteilan der Hauptschule zwar um einiges höher ist, als am Gymnasium, daß aber bei beiden Schultypen trotz der alltäglichen Medienkampagnen und wissenschaftlichen Aufklärung zum Thema Rauchen der Anteil mit steigendem Alter nicht etwa fällt, sondern noch weiter steigt. Ein möglicher Grund für diesen Anstieg kann meines Erachtens vielleicht in der Pubertät der Schüler und dem damit verbundenen antiautoritären Verhalten begründet liegen.
Generell ist das Rauchen die wichtigste vermeidbare Einzelursache für ein vorzeitiges Sterben. Laut Schwarzer kommt es pro Jahr in Deutschland ca. zu 110.000 tabakbedingten Toten. Die Auswirkungen des Rauchens auf die Gesundheit sind also immens:
- Es erhöht das Risiko allerKrebserkrankungen(für ca. 30 % aller Krebssorten und 75 - 80 % aller Lungenkrebstoten verantwortlich). Das Lungenkrebsrisiko bei Rauchern ist 9 Mal höher, als bei Nichtrauchern.
- Es erhöht das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko (Schlaganfall, Herzinfarkt, usw.). Raucher erleiden 3 Mal so viele Schlaganfälle, wie Nichtraucher.
- Es erhöht das Risiko von chronischer Bronchitis → Anfälligkeit der Raucher gegenüber Krankheiten ist höher, als bei Nichtrauchern (Magengeschwüre, Lungenentzündung, Infektionskrankheiten, usw.)
ABER: Die genauen Auswirkungen des Rauchens sind hier schwer zu ermitteln, da Raucher generell ungesünder Leben (Trinken mehr Kaffee und Alkohol, Treiben weniger Sport, usw.).
Folgen dieser allgemeinen ungesunden Lebensweise sind synergistische Effekte: Es erfolgt ein `Aufschaukeln´ des Rauchens mit den bereits genannten Risikofaktoren:
Bsp.RauchenundAlkoholkonsum: Erhöhung des Mundhöhlenkrebsrisikos.
Bsp. Rauchen und Cholesterinspiegel: Erhöhung des Herz-Kreislauf-Erkrankungs- risikos.
Unklar ist bis jetzt jedoch das Zusammenspiel vonRauchenundStreß. Fakt ist, daßStreßbedingt durch Adrenalinausschüttung den Blutdruck erhöht und die Herzfrequenz steigert.Rauchenführt durch den damit verbundenen Nikotinkonsum zu einer Verringerung des Arterienquerschnitts und somit im Endeffekt auch zu einer Erhöhung des Blutdrucks und einer Steigerung der Herzfrequenz. Folglich müßten sich also beide Faktoren in ihren Auswirkungen summieren. Das dies aber nicht immer der Fall sein muß, hängt zum einen von der Dosierung des Nikotins ab, zum anderen aber auch maßgeblich von kognitiven Faktoren. So spielt die Erwartung, die eine Person in einer Streßsituation mit dem Rauchen einer Zigarette verbindet, eine wichtige Rolle: Es kann nämlich eine lindernde aber auch eine aufputschende Wirkung erwartet werden.
3.1 Erklärungsmodell des Rauchens
Vorweg muß gesagt werden, daß es kein einheitliches Schema zur Entwicklung einer Rauchenge- wohnheit gibt, da die einzelnen Gründe mitunter sehr individuell ausgeprägt sind. Es können hierbei auch biologisch bedingte Faktoren, z. B. eine genetisch bedingteNikotinsensitivität, aber auch Persönlichkeitsunterschiede, z. B. hinsichtlich derExtraversion(= Konzentration der Interessen auf äußere Objekte) oder dessensation-seekingseine Rolle spielen. Als gesichert gilt jedoch die Aussage, daß die Herausbildung eines (regelmäßigen) Rauchverhaltens in der Regel zwischen dem
10. und 20. Lebensjahr erfolgt. Schwarzer schildert in der Literatur im Wesentlichen 5 verschiedene Phasen der Entwicklung eines Rauchverhaltens8:
Phase I.: (= Vorbereitungsphase) Diese Phase findet zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr statt.
Es findet hier eineImitation des Rauchensmit kleinen Stöckchen, Schokoladenzigaretten, Bleistiften, usw. statt, wobei die Wirkung dieser Imitation auf das soziale Umfeld von den Kindern beobachtet und verinnerlicht wird.
Erwartungen an das Rauchenwerden durch Beobachtung von Bezugspersonen (Eltern) gebildet, z. B. die gut schmeckende Zigarette des Vaters nach dem Essen. Hier wird dem Kind eine positive Vorstellung des Rauchens vermittelt, was eine weitere Entwicklung zum Rauchen hin maßgeblich beeinflussen kann.
Phase II.: (= Experimentierphase) Diese Phase findet zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr statt. Ca. 80 - 90 % der Jugendlichen haben in diesem Lebensabschnitt mindestens 1 Mal eine Zigarette geraucht. Somit stellt dieses Probieren kein abweichendes Verhalten, sondern einenormative Entwicklungsaufgabedar, quasi um mitreden zu können. Wichtig ist hier die kognitive und emotionale Verarbeitung dieses Erlebnisses. → Bsp.: Kinder, die bis zur 4. Zigarette weiterrauchen, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit zu regelmäßigen Rauchen, als die Kinder, die schon vor der 4. Zigarette das Experimentieren abbrechen. Folgende graphische Abbildungen verdeutlichen die Situation der Jugendlichen in Bezug auf des Experimentieren und das darauf folgende längerfristige Rauchen9:
Phase III.: (= Gewöhnungsphase) Sie umfaßt den Zeitraum der Pubertät. Hier entscheidet sich, ob es zur Herausbildung einer festen Rauchgewohnheit kommt oder nicht.Wichtigist hier diesoziale Interaktion mit Freunden / Gleichaltrigen, die eine Zigarette zum Mitrauchen anbieten, und der Kontakt mitPeergruppen. Gerade bei Letzteren wird in Gruppen geraucht, z. B. in der Pause auf dem Schulhof oder an bestimmten Treffpunkten auf dem Schulweg. Gerade hier wird von den Gruppen auch sozialer Druck ausgeübt, nämlich sich selbst Zigaretten zu kaufen und nicht immer zu `schnorren´.
Eine Ausnahme bilden hier die sogenanntenFrustrationsraucher: Sie haben keinen Anschluß an eine Clique gefunden oder wurden ausgeschlossen. Sie greifen hauptsächlich zur Zigarette, um ihre soziale Isolation zu bewältigen. Des weiteren spielt hier auch dieWiderstands-Selbstwirksamkeiteine Rolle: Sie ist die Fähigkeit, in kritischen Situationen dem sozialen Druck zum Mitrauchen widerstehen zu können, trotz evtl. negativer emotionaler oder sozialer Konsequenzerwartungen.
Phase IV.: (= Aufrechterhaltungsphase) Hier ist das Rauchen bereits zur festen Gewohnheit geworden (Sucht). Es dient jetzt vor allem der Regulation interner psychologischer und physiologischer Zustände. Es existieren hier verschiedene Theorien zur Aufrechterhaltung:
1. DieNikotinregulationstheorie: Der Raucher versucht, seinen Nikotinspiegel im Körper aufrecht zu erhalten und Entzugssymptome zu vermeiden. Schwarzer führt hier folgendes Beispiel an: Es wurde wissenschaftlich erwiesen, das eine erhöhte Nikotinausscheidung vom Körper aus erfolgt, wenn der Harn sauer ist (niedriger pH). Folglich wurden der Hälfte einer gewissen Anzahl an Rauchern Vitamin C Präparate verabreicht und der anderen Hälfte nur ein Placebo zur Einnahme gegeben. Da überschüssiges Vitamin C von Körper über den Harn ausgeschieden wird und diesen gleichzeitig ansäuert ist das zu erwartende Resultat allzu klar: Die Raucher, die die Vitamin C Präparate verabreicht bekommen hatten, steigerten ihren Zigaretten- konsum, eben um ihren Nikotinspiegel durch die vermehrte Ausscheidung konstant zu halten.
Kritik: Wenn es beim Rauchen nur um den Nikotingehalt im Körper ginge, müßten Nikotinkaugummis oder -pflaster diesem Problem Abhilfe schaffen können. Das ist aber de facto nicht - oder nur bei wenigen Personen - der Fall. Außerdem kann die Theorie nicht die Rückfälligkeit erklären, da bei monatelangem Nichtrauchen der Nikotinspiegel längst auf null ist. Das Rauchen auch ein psychologisch motiviertes Problem sein kann kommt in dieser Theorie also zu kurz.
2.Multiples Regulationsmodell: Beispiel des Modells ist ein Jugendlicher, der raucht, weil es ihm ein Gefühl der Sicherheit und sozialen Anerkennung vermittelt. Wenn er seine Zigarette zuende geraucht hat, fällt der Nikotinspiegel und seine Angst wird wieder gesteigert. Immer, wenn der Nikotinspiegel absinkt, entsteht also ein emotionales Unbehagen, auch in Situationen, die vorher völlig neutral waren. Dies nennt man einekonditionierte Angstreaktion. Der eigentliche Drang zum Rauchen erfolgt also auf Grund von Unbehagen!
Kritik: Obwohl hier die psychologische Komponente berücksichtigt wird, kann diese Theorie auch nicht die Gegenargumente zur o. a. Nikotinregulationstheorie widerlegen.
3.Neuroregulationstheorie: Nikotin verändert die Verfügbarkeit aktiver Neuroregulatoren (Acetylcholin, Dopamin, usw.). Diese verbessern z. B. die Gedächtnisleistung, steigern die Genußfähigkeit, erleichtern Aufgabenbewältigungen, verringern Angst und Anspannung, usw. Nikotinkonsum erhöht bei Rauchern diese genannten Beispiele. Bei Entzug treten dann vermehrt die Gegenteile ein. Das erklärt dann auch die Rückfälligkeit von Ex-Rauchern, da sie mit Nikotin den Alltag besser bewerkstelligen konnten.
Kritik: Auch in dieser Theorie kommt die psychologische Komponente zu kurz.
4.Rauchen als gelernte Bewältigungshandlung: In diesem rein psychologischen Modell wird Rauchen als zielgerichtete intentionale Tätigkeit gesehen, mit der bestimmte Funktionen erfüllt werden sollen: Rauchen soll aufputschen oder entspannen, Unsicherheit oder soziale Ängste überspielen, Anforderungssituationen besser bewältigbar machen, ein bestimmtes Bild von sich bei anderen kultivieren, usw. Deshalb unterscheidet Schwarzer, basierend auf Forschungen von Tomkins (1968), vier Arten des Rauchens:
a) Gewohnheitsmäßiges Rauchen: Die Person hat kein ausdrückliches Vergnügen am Rauchen und merkt es oft gar nicht mehr. Sie hat evtl. früher einmal aus emotionalen Gründen geraucht.
b) Emotional positiv getöntes Rauchen: Die Person verspricht sich eine positive Verstärkung vom Rauchen (Genuß, Entspannung, usw.). Das Rauchen erfolgt hier meist in Gesellschaft oder nach dem Essen.
c) Emotional negativ getöntes Rauchen: Die Person will Angst, Anspannung, usw. mit dem Rauchen vermindern. Das Rauchen erfolgt hier häufig in Streßsituationen.
d) Abhängiges Rauchen: Die Person ist auf die Zeitspanne zur letzten Zigarette und auf die Nikotinregulation fixiert. Sie sorgt immer für einen Vorrat an Zigaretten, um nie in eine Mangelsituation zu geraten.
Dem Rauchen liegen also in kritischen Situationen eine bestimmte Konsequenz- erwartung zu Grunde. Diese haben einen relativ engen Zusammenhang zur Stärke von Entzugserscheinungen und zum Erfolg von Entzugsmaßnahmen. Die Aufrecht- erhaltung des Rauchens ist also nicht nur mit physiologischer Abhängigkeit verbunden, sondern auch ein Resultat festgefügter Erwartungsstrukturen. Eine Theorie, die neurochemische Mechanismen berücksichtigt, aber auch kognitive Prozesse der Verhaltensregulation beinhaltet und die Wechselwirkungen der beiden charakterisiert, fehlt bislang.
Phase V.: (= Rauchentwöhnung) Die Frage, die dieser Phase zu Grunde liegt, lautet: Woher kommt die Motivation zur Rauchentwöhnung? Auch hier nennt Schwarzer verschiedene Theorien, z. B. dastranstheoretische Modell der Verhaltensänderung, das im Folgenden näher ausgeführt wird:
Da die Motivation zur Verhaltensänderung bei Rauchern nicht immer gegeben ist, beinhaltet dieses Modell 5 verschiedene Phasen, die der Raucher auf seinem Weg zur Entwöhnung durchschreiten muß:
1. Stadium (Präkontemplationsstadium): In diesem Stadium hat der Raucher noch keine Absicht zur Entwöhnung formuliert. Er befindet sich also in der o. a. Phase IV.
2. Stadium (Kontemplationsstadium): Hier denkt der Raucher schon ernsthaft über das Aufhören nach.
3. Stadium (Präparationsstadium): Konkrete Pläne des Rauchers zu einem Zeitpunkt des Rauchstopps liegen vor.
4. Stadium (Aktionsstadium): Die Absicht des vorgenommenen Rauchstopps wird in die Tat umgesetzt.
5. Stadium (Aufrechterhaltungsstadium): Dieses Stadium gilt als erreicht, wenn mindestens 6 Monate nicht geraucht wurde. Erst dann kann man die Person alsNichtraucherbezeichnen.
In Auseinandersetzung mit den Stadien wird klar, daß ein Raucher erst ab dem 3. Stadium von einem Entwöhnungsprogramm profitieren kann, da erst ab diesem die Motivation zur Verhaltensänderung genügend hoch ist. Die Entwöhnungsprogramme müssen dann genau auf das jeweilige Stadium zugeschnitten sein, da sie sonst bei der Person nicht greifen. Des weiteren gibt es hierbei auch Veränderungsprozesse, die den Übergang von einem Stadium zum nächsten fördern, z. B. dieStimuluskontrolle:
Hier entsorgt der Raucher Dinge in seinem Haushalt, die Ihn an das Rauchen erinnern (Aschenbecher, Bilder, usw.). Ein weiteres Beispiel ist dasBekräftigungsmanagement: Bei diesem wird der Raucher von anderen Personen gelobt, wenn er nicht raucht. Aus diesen Beispielen geht hervor, daß es grob gesehen zwei verschiedene Arten von Veränderungsprozessen gibt:
a) erlebensbezogen: Hier wird dasBekräftigungsmanagementeingeordnet. Diese Prozesse greifen vor allem im 2. und 3. Stadium.
b) verhaltensbezogen: Hier wird die Stimuluskontrolle eingeordnet. Diese Prozesse greifen hauptsächlich im 4. und 5. Stadium.
Interventionsmaßnahmen in den ersten Stadien sollten also erlebenszentrierte und emotionale Motivationsstrategien sein. In den letzten Stadien kommt es eher auf verhaltensbezogene (behaviorale) und instrumentelle Unterstützung an. Der Übergang von einem Stadium zum nächsten ist aber nicht nur von solchen Prozessen oder Strategien abhängig, sondern auch hauptsächlich von zwei Persönlichkeits- merkmalen: Der Entscheidungsbalance und der Selbstwirksamkeit. Bei der Entscheidungsbalancegeht es um das Verhältnis der Pro`s und Contra`s bezüglich des Rauchens zueinander. Beim Durchlaufen der Veränderungsstadien gewinnen die Contra`s gegenüber den anfänglich dominierenden Pro`s immer mehr an Gewicht. Zum sogenanntencrossoverder Beiden kommt es im Bereich des 2. Stadiums.
Bei derSelbstwirksamkeitgeht es um die eigene Zuversicht des Rauchers, sein Problemverhalten zu ändern. Sie steigt vom 1. bis zum 5. Stadium fast linear an. Sie besitzt in den einzelnen Stadien jedoch eine ganz eigene Erlebnisqualität. Im 1. Stadium ist sie noch von allgemeinen Kontrollüberzeugungen abgeleitet, in den letzten Stadien basiert sie eher auf direkten eigenen Erfahrungen mit dem neu erworbenen Verhalten.
Die Rauchentwöhnung wird nach diesem Modell vor allem nicht mehr als ein Allesoder-Nichts-Phänomen, sondern als ein zeitlicher kontinuierlicher Prozeß begriffen, der lange vor der sichtbaren Verhaltensänderung beginnt. Typisch für einen solchen Änderungsprozeß sind aber auch zyklische Verhaltensformen, d. h. daß die Person oft in frühere, bereits durchschrittene Stadien zurückfällt, oder aber jahrelang in einem Stadium verharrt, ohne den Übergang ins nächste zu schaffen. Leider haben aber die Befunde dieses Modells meist nur deskriptiven Wert. Was den Übergang von einem Stadium ins Nächste nun verursacht hat, weiß man noch nicht genau, da diese Gründe oft auch individuell verschieden sind.
3.2 Prävention des Rauchens
Die Schule wird für die Prävention des Rauchens als Interventionsebene angesehen. Somit wird eine Großzahl von Kindern und Jugendlichen erreicht, die gerade hier einer großen Beeinflussung zum Mitrauchen ausgesetzt sind. Schwarzer schildert in der Literatur zwei primär-präventive Ansätze: DerAnsatz zum sozialen Einflußund derAnsatz zur generellen Kompetenzentwicklung, die beide nicht miteinander konkurrieren, sondern sich gegenseitig ergänzen sollen10. DerAnsatz zum sozialen Einflußist ein rein auf das Rauchen bezogenes Präventionskonzept, das auf einer Reihe pädagogisch-psychologischer Strategien beruht:
1. Standfestigkeitstraining: Hierbei geht es um die Entwicklung von spezifischen Verhaltenskompetenzen, um in kritischen Situationen dem Gruppendruck / -zwang zum Mitrauchen widerstehen zu können. Erworben werden diese Kompetenzen über Modellernen und Rollenspiele, oft zusammen mit Mitschülern.
2. Verhaltensimpfung: Dies entspricht einer Immunisierung der Kinder und Jugendlichen gegenüber Überredungsversuchen. Sie werden im Zuge dieser Vorgehensweise mit immer stärker werdenden Argumenten zum Mitrauchen konfrontiert, wobei sie sich Gegenargumente einfallen lassen sollen. Da diese selbst generiert werden, werden sie auch leichter verinnerlicht und in das eigene Überzeugungssystem eingebaut.
3. Image-Veränderung: Hier soll durch Diskussion und Reflexion das positive Image des Rauchers in Frage gestellt werden (z. B.Cool-Sein, unabhängig, stark, erwachsen, usw.). Stärke und Unabhängigkeit bedeuten aber gerade, sich nicht dem Druck zum Mitrauchen durch die Anderen zu beugen. Es bedeutet auch, die Tricks der Zigarettenwerbung zu durchschauen und nicht darauf hereinzufallen.
4. Direkte Informationsvermittlung: Die meisten Teenager wissen, daß Rauchen gesundheitsschädigend ist. Trotzdem rauchen sie weiter. Die logische Schlußfolgerung dessen ist, daß sie ein Teil ihres Wissens ignorieren. Sie denken außerdem noch nicht in längerfristigen Zeiträumen (Gesundheitsschäden treten oft erst 20 Jahre später auf!). Deshalb muß eine erfolgreiche Informationsvermittlung vor allem die kurzfristigen negativen Folgen des Rauchens betonen.
Dieser Ansatz kann in der Schule z. B. mit sorgfältig konzipierten Videopräsentationen unterlegt werden, die bei der Schülerschaft Beobachtungslernprozesse hervorrufen, die der Prävention des Rauchens dienlich sind. Dabei muß die Präsentation aber auf den jeweiligen Schultyp zugeschnitten sein, da jeder Schultyp ja wie bereits weiter oben erwähnt einen völlig anderen soziokulturellen Schüleranteil hat.
BeimAnsatz zur generellen Kompetenzentwicklunggeht es eigentlich nur am Rande um das Problemverhalten des Rauchens. Im Mittelpunkt stehen hier die Stärkung der Persönlichkeit der Jugendlichen, die Entwicklung von emotionalen Bewältigungsstrategien und soziale Kompetenz. Es wird davon ausgegangen, daß die Jugendlichen mit diesen Fähigkeiten den Verlockungen des Rauchens besser widerstehen können. Der Ansatz umfaßt 15 Sitzungen, in denen Gruppen- diskussionen und Rollenspiele, unterstützt durch ein breites Medienspektrum, durchgeführt werden. Themen sind hier die Bewältigung von sozialer Angst und Unsicherheit, Entscheidungsfähigkeit und der Erwerb von sozialen Techniken wie die Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht.
Bei beiden Ansätzen wurde mit den jeweiligen Methoden der Neubeginn des Rauchens um ca. 50 % reduziert.
3.3 Techniken und Therapien zur Entwöhnung
Die Motivation zur Entwöhnung unterliegt vielen sozialen Einflüssen (Medien,Ärzte,strukturelle Maßnahmen, usw.).Medienvermitteln Wissen und Meinungsklimas, die die Voraussetzungen für die individuellen Verhaltensänderungen schaffen. Der Konsument sieht sich hierdurch zunehmend einer ablehnenden Mehrheit gegenüber, was einen Verlust des nachsichtigen sozialen Umfeldes zur Folge hat.
Ärzte haben große Einflußmöglichkeiten auf Patienten, da sie in Momenten einer erhöhten persönlichen Vulnerabilität eine relativ hohe Bereitschaft zur Verhaltensänderung zeigen. Ein Beispiel ist hierfür die Schwangerschaft: Die Abstinenzdauer des Rauchens ist hier dreimal länger als die `normale´ Abstinenz.
Strukturelle Maßnahmensind unter anderem rauchfreie Zonen am Arbeitsplatz.
Eine Methode der Entwöhnung ist dieSelbstentwöhnung. Oft gelingt dem Raucher erst nach mehreren Versuchen eine langanhaltende Abstinenz. Bei jedem neuen Versuch steigt aber die Wahrscheinlichkeit, daß der Raucher es beim erneuten Versuch schafft, aufzuhören. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Reflexion der gescheiterten Versuche im Hinblick auf die eigene Person. Dies versetzt den Raucher in die Lage, beim nächsten Entwöhnungsversuch soziale und interne Ressourcen wirkungsvoller einzusetzen (Fehlervermeidung beim nächsten Versuch). Oft werden auch Selbsthilfeprogramme genutzt, z. B. Literatur zum Nichtrauchen. Diese haben aber nur bei den Rauchern Sinn, die sich schon Gedanken zur Entwöhnung gemacht haben11.
Bei verhaltenstherapeutischen Ansätzen zur Nikotinentwöhnung ist nach Schwarzer eine Kombination ausSelbstkontrolltechnikenundStrategien der Rückfallpräventiondie erfolgreichste Methode zur Entwöhnung, da sie die besten Abstinenzraten liefern12.
Eine weitere Methode ist das vierphasigeFreiburger Modell, bei dem kognitive Selbstmanagement- Strategien im Mittelpunkt stehen.
Phase I.: (= Motivationsphase) Es findet hier ein Aufbau der Motivation zum Nichtrauchen und eine Herausbildung von Selbstwirksamkeitserwartungen statt. Je stärker die Person überzeugt ist, den Herausforderungen des Entwöhnungsprozesses gewachsen zu sein, desto größer ist die Chance erfolgreicher Entwöhnung und langfristiger Abstinenz.
Phase II.: (= Entschlußphase und Planungsphase) Hier findet eine Festlegung des Zeitpunkts und der Methode der Entwöhnung statt. Wichtig ist hier auch die Besprechung der resultierenden Schwierigkeiten und wie mit ihnen umgegangen werden soll. Phase III.: (= Verhaltensmanagement) Diese Phase beinhaltet eine Vielzahl an kognitiv- behavioralen Techniken und Situationen. Am Anfang steht die systematische Selbstbeobachtung. Hier muß der Klient z. B. protokollieren, in welchen Situationen er raucht und welche eigenen und sozialen Reaktionen darauf folgen. Im Prinzip ist diese Vorgehensweise nichts weiter als eineAnalyse des eigenen Verhaltens. Auf dieses Protokoll wird dann die o. a. Technik derStimuluskontrolleangewandt, also die Einrichtung der physikalischen und sozialen Umgebung mit möglichst wenigen Reizen, die an das Rauchen erinnern13.
Wenn die Verhaltensänderung dann vollzogen wurde, folgt dieSelbstbelohnung. Ziel dessen ist das neue Verhalten somit attraktiver zu gestalten, als es das Rauchen war. Phase IV.: (= Rückfallprävention) Selbst jahrelange Ex-Raucher sagen, daß sie noch nicht völlig immun gegenüber einem Rückfall seien. Nach der zweiten Abstinenzwoche sind die Nikotinentzugssymptome meist abgeklungen. Ab diesem Zeitpunkt muß also `nur noch´ die psychische Abhängigkeit bewältigt werden. Hilfreich sind hier folgende Beispiele: Vermeidung von Risikosituationen, schnellstmöglichstes Verlassen solcher Situationen, wenn man hineingeraten ist, Ablenkung und Verzögerung, indem man sich über bestimmte Situationen `hinwegzuretten´ versucht.
Zur Unterstützung werden behaviorale Strategien eingesetzt, z. B. Entspannungstechniken, sportliche Aktivität und Mobilisierung sozialer Unterstützung.
Kommt es trotzdem zu einem Rückfall, wird dieses Ereignis in der therapeutischen Betreuung erst einmal entdramatisiert. Dann sollte versucht werden, daß der Klient den `Ausrutscher´ nicht auf stabile, unkontrollierbare Ursachen schiebt, z. B. auf einen schwachen Willen oder die körperliche Sucht, sondern auf veränderliche und kontrollierbare Faktoren, z. B. eine ungünstige situative Konstellation, für die noch keine optimalen Bewältigungshandlungen zur Verfügung standen. Der Klient soll dadurch die Fähigkeit erwerben, sich anbahnende Risikosituationen sensibel wahrzunehmen und frühzeitig die bereitgelegten Bewältigungshandlungen einzuleiten.
Eine weiteretherapeutische Maßnahmeist dieNikotinsubstitutionmit Pflastern, Kaugummis oder ähnlichem. Sie kann verhaltenstherapeutische Entwöhnungsprogramme flankierend unterstützen, ist jedoch singulär angewendet nicht sehr erfolgversprechend14. Die körperliche und psychische Abhängigkeit wird hier zeitlich getrennt voneinander behandelt. Um den Zigarettenverzicht zu erleichtern, wird Nikotin auf eine andere Weise dem Körper zugeführt. Raucht der Klient dann schon seit ein oder zwei Monaten nicht mehr, wird auch das Nikotin in geringerer Dosis zugeführt. Eine weitere Maßnahme ist dieAversionstherapie. Sie geht auf die Prinzipien der Konditionierung zurück. Rauchen wird hier mit aversiven Vorstellungen gekoppelt: Der Klient soll sich beim Zug an der Zigarette die negativen Aspekte möglichst anschaulich vorstellen, z. B. der beißende Rauch, das Brennen in der Kehle oder die Zerstörung der Alveolen. Wenn diese aversiven Bilder über längere Zeit wiederholt werden, rufen sie bei jeder Zigarette eine unangenehme emotionale Reaktion hervor. Somit kommt der Drang zum Rauchen früher oder später zum erliegen. Die gedanklich aufgebaute Aversion kann aber über eine längere Zeit des Nichtrauchens wieder verlernt werden, was dann zu Rückfällen führt. Geschmacksaversionen sind demgegenüber jedoch relativ zeitstabil. Die letzte von Schwarzer genannte Maßnahme ist dieHypnosein Verbindung mit derAkupunktur. Sie implizieren beim Klienten das Versprechen, daß ihm keine großen Anstrengungen bei der Entwöhnung abverlangt werden. Der Klient ist folglich zunehmend passiv! Der Autor hält von diesen Verfahren jedoch nicht sehr viel, da sie sich bis jetzt als wenig effektiv erwiesen haben.
4. Abschließende Betrachtung
Wie aus meiner Arbeit ersichtlich wird, ist sowohl das (krankhafte) Konsumverhalten als auch die Interventions- und Präventionsebene hinsichtlich Alkohol, Zigaretten und illegalen Drogen sehr vielschichtig. Da bei der Masse an Klienten die jeweiligen Gründe für den Konsum / Mißbrauch individuell verschieden sind, ist es aus meiner Sicht beispielsweise schwierig, das auf die jeweilige Person zugeschneiderte Entzugsprogramm zu ermitteln. Meiner Ansicht nach kommt es hierbei vielleicht auch auf den jeweiligen `Mix der Komponenten´ aus verschiedenen Programmen an, damit sich ein Entzug erfolgreich gestaltet. Schwarzer hat jedoch meines Erachtens eine Großzahl an Gründen für den Konsum / Mißbrauch, die daraus folgenden Konsequenzen und möglichen Interventionen gut und vor allem für den Leihen durch die vielen angeführten Beispiele verständlich geschildert. Meine Arbeit stützt sich somit im Schwerpunkt auf seine zusammengetragenen Informationen.
5. Literatur
Humboldt-Universität-Berlin Datum: Mo, 10.12. `01 HS „Gesundheitserziehung in der Schule“
Dozent: Prof. Dr. M. Jerusalem Referent: Volker Riedel
1: Schwarzer, R. (1997): Gesundheitspsychologie. 2. Auflage, Göttingen: Hogrefe.
2: Leppin, A., Hurrelmann, K., Petermann, H. (2000) (Hrsg.): Jugendliche und Alltagsdrogen. 1. Auflage, Berlin: Luchterhand.
3: Statistische Abbildungen: http://www.cc.jyu.fi/no-smoking/ger/gstatist.htm
4: Bengel, J., Strittmatter, R., Willmann, H. (1999): Was erhält Menschen gesund? Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung. Herausgeber: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 4. Auflage, Band 6, Als PDF-Datei im Download unter folgender Adresse erhältlich: http://www.bzga.de/fachpubl/pdf-datei/dfh06.pdf
5: Tina Hascher, Thomas Suter, Petra Kolip: Terminologie-Dossier zur Gesundheitsförderung, http://www.kl.unibe.ch/kl/sla/fsf/Gesundheitsfoerderung.pdf
Handout Gesundheitliches Risikoverhalten am Beispiel von Rauchen, Alkohol und illegalen Drogen
1. Alkohol und Drogen:
- Alkohol und Drogen unterscheiden sich hinsichtlich derGebrauchsform, der erwünschten Rauschwirkung, sowie hinsichtlich denpsychischenundkörperlichen Auswirkungen. Drogen können zum einen illegale psychoaktive Substanzen (z. B. Kokain, Heroin, usw.) sein, aber auch Substanzen ohne medizinische Indikation (z. B. Amphetamine, usw.) oder frei zugängliche Stoffe (z. B.: Inhalatien = Lösungsmittel, Klebstoffe, usw.).
-Unterschied von Missbrauch und Gebrauch: Missbrauch hebt sich von Gebrauch ab hinsichtlich desAusmaßesabträglicher physiolog. und psycholog. Effekte der Substanz (z. B. Konsum mittlerer oder großer Mengen über längere Zeit), des ungenügenden Entwicklungsstandesder Person (z. B. Kinder vor der Pubertät), den beeinträchtigenden Lebensumständender Person, der möglichenphysischen Abhängigkeitder Person (z. B. Entzugserscheinungen mit folgenden Dosissteigerungen um die nachlassende Wirkung zu kompensieren) und hinsichtlich derFolgeschädenfür die Person, anderer Menschen oder Sachen (z. B. Schaden soz. Beziehungen oder Rechtsbrüche durch Beschaffungskriminalität).
-Konsumspitzen der verschiedenen Drogen:
Alkohol: Ca. 25 % von 11 - 15 jährigen tranken vor dem 11 Lebensjahr einen „richtigen Schluck“ Alkohol.
Jugendzeit= Durchgehend steiler Anstieg d. Häufigkeit;
Frühes Erwachsenenalter= gleichermaßen deutlicher Abfall.
Cannabis: Gipfel bei 18 - 22 Jahren, Ende der 80er haben 10 % der 18 jährigen Cannabis konsumiert.
Harte Drogen: (= Kokain und Heroin) Unterschiedlich über das Alter verteilt. Es wurden hier von den Konsumenten meist Vorerfahrungen mit Alkohol od. Haschisch gemacht, wobei diese aber nicht zwangsläufig zum Konsum dieser Drogen führen müssen (Einstiegs-Drogen-Problematik). Lösungsmittel: Schüler: Klasse 7 = 9 %, Klasse 13 = 1 %, Ende der 80er erhoben.
-Experimentieren und längerfristiger Missbrauch: Gründe für anfängliches Experimentieren sindVerfügbarkeit, geeigneteVerhaltensmodelleund (besonders) derEinflußvon
Peergruppen(= Druck zu soz. Anpassung, greift vor allem bei Jugendlichen mit geringem Selbstwertgefühl). Längerfristiger Missbrauch resultiert aus dem physiolog. Effekt der Droge und aus den hieraus folgenden Defiziten (= Bewältigung von Leistungserwartungen und soz. Anforderungen, den Aufgaben des allgemeinen Lebens).
-Gründe des Alkohol- und Drogenkonsums:Aufmerksamkeiterheischen,Aneignung von Attributen des Erwachsenenstatus, genetische Faktoren, elterliches Fehlverhalten(z. B. geringe Herausforderungen, Desinteresse, geringe Wertschätzung, etc.), daraus resultierendmangelnde Ich-Kontrolle, niedrige Ich-Stabilität, keine Selbstbestätigung, etc. Ca. 10 % der Population zeigen Alkohol- und Drogenmissbrauchüber die Jugend hinaus(diese Personen sind i. d. Jugendphase an Aggressivität, Scheu, Impulsivität, etc. zu erkennen). Restliche 90 % der Population zeigennur i. d. JugendAlkohol- und Drogenmissbrauch. Die o. a. 10 % fungieren hier als Schlüsselfiguren: Sie führen der Mehrheit am Anfang der Pubertät vor, dass man mit dem Konsum der Substanzen die o. a. Funktionen erreichen kann.
-Langfristige Folgen von Alkohol- und Drogenmissbrauch: Folgen für die Gesundheit:
Personen, die im Jugendalter viel Substanz konsumierten und diesen Konsum im Alter dann erniedrigten, erfahren eine Verbesserung der Gesundheit. Enthaltsam Lebende zeigten dem gegenüber ungünstigere gesundheitliche Veränderungen (→ Abstinenz ist nicht immer die beste Methode!).
Rauchen: Bsp.: Frauen, I. d. Jugend geraucht, mit zunehmenden Alter aber Konsum eingeschränkt → Verbesserung der Gesundheit.
Inhalatien: Bsp: Frauen und Männer, Gesundheitsprobleme gleich i. d. Jugend, selbst im Erwachsenenalter Probleme noch akut, da neurolog. Veränderungen stattgefunden haben.
Cannabis: Gesundheitsprobleme bei längerfristigem Konsum nur bei Frauen beobachtet, die selbst im Alter noch rauchten / kifften.
Harte Drogen: Mit Methadon (Warmer Entzug) wurde die Gesundheit durch eine bessere begleitende Versorgung verbessert. Wurde jedoch zu Methadon Alkohol konsumiert, erfolgte durch den kombinatorischen Effekt eine drastischere Verschlechterung, als wenn „nur“ Heroin weiterkonsumiert worden wäre.
- Folgen für die Normalbiographie: Durch Substanzkonsum kann es zuZeitverschiebungen im Lebenslauf kommen, so verschiebenAlkohol- und Cannabiskonsumz. B. Elternschaft od. Heirat nach hinten. Mit zunehmendem Gebrauch wächst auch die Anzahl der Jobwechsel und die Dauer der beschäftigungslosen Zeiten.
Außerdem wirkt sich der Konsum auf dieMisserfolgsbewältigungaus (z. B. vorzeitig abgebrochene Schulausbildung).Cannabiskonsumerhöht hier das Risiko um 2 %, mangelnde Schulleistungen (die eine Folge des Konsums sein können) erhöhen das Risiko um 10 %. Gründe hierfür sind 1. eine vorzeitige Einnahme von Erwachsenenrollen, 2. eine gering ausgeprägte Normorientierung und 3. soz. Druck von Peergruppen. Folgen für familiäre Beziehungen (z. B. Zerstörung des Familienlebens durch Alkohol): Männer mit längerem Alkoholkonsum neigen zu häufigeren und roheren Gewalttätigkeiten, jedoch auf Grund von antisoz. Verhalten, was erst eine Folge des Alkoholmissbrauchs ist. Generell kann auch gesagt werden, dass durch Drogenkonsum eine Beeinträchtigung der Erziehungsfunktion stattfindet (→ depressive Stimmung → emotional distanziertes Verhalten zum Kind).
Anhäufung von mehreren Problemen zu Syndromen birgt Schwierigkeiten auf lange Sicht (z. B. Anpassungsprobleme eines Teenagers mit folgendem Alkoholmissbrauch hinsichtlich der Entwicklung zum Problemtrinker im Erwachsenenalter).
2. Rauchen:
-Fakten:Raucheranteili. d. Bevölkerung ab 14 Jahren nimmt ab (Rückgang von `84 - `90 von 36 % auf 28 %). Gründe hierfür sind wissenschaftl. Reporte, Medienkampagnen, gesundheitspolit. Maßnahmen und gesundheitserzieherische Intervention. DerRaucheranteilbei Männern (37 %) ist höher, als der bei Frauen (22 %). In der Jugendphase wird bei Männer und Frauen ungefähr zu gleichen Anteilen geraucht.
In soz. schwächeren Schichten wird mehr geraucht, als in soz. höheren (z. B. Männer mit Abitur rauchen nur halb so häufig, wie Männer mit Hauptschulabschluss).
-Auswirkungen auf die Gesundheit:
- Erhöht das Risiko vonKrebserkrankungen(für ca. 30 % aller Krebssorten und 75 - 80 % aller Lungenkrebstoten verantwortlich). Das Lungenkrebsrisiko bei Rauchern ist 9 Mal höher, als bei Nichtrauchern.
- Erhöht das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko (Schlaganfall, Herzinfarkt, usw.). Raucher erlitten 3 Mal so viele Schlaganfälle, wie Nichtraucher.
- Erhöht das Risiko von chronischer Bronchitis → Anfälligkeit der Raucher gegenüber Krankheiten ist höher, als bei Nichtrauchern (Magengeschwüre, Lungenentzündung, Infektionskrankheiten, usw.)
ABER: Die genauen Auswirkungen des Rauchens sind hier schwer zu ermitteln, da Raucher generell ungesünder Leben (Trinken mehr Kaffee und Alkohol, Treiben weniger Sport, usw.).
→ Es ergeben sich synergistische Effekte (= Aufschaukeln des Rauchens mir anderen Risikofaktoren.
Bsp.Rauchen + Alkoholkonsum: Erhöhung des Mundhöhlenkrebsrisikos.
Bsp.Rauchen + Cholesterinspiegel: Erhöhung des Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisikos.
-Erklärungsmodelle des Rauchens:5-Phasen-Modell:
Phase I.: (= Vorbereitungsphase) 2. - 6. Lebensjahr,Imitation des Rauchensmit kleinen Stöckchen, Schokoladenzigaretten, Bleistiften, usw. → Wirkung dieser Imitation auf das soz. Umfeld werden beobachtet und verinnerlicht.Erwartungen an das Rauchenwerden durch Beobachtung von
Bezugspersonen (Eltern) gebildet, z. B. gut schmeckende Zigarette des Vaters nach dem Essen → positive Vorstellung des Rauchens wird dem Kind vermittelt, was eine weitere Entwicklung zum Rauchen hin beeinflusst. Phase II.: (= Experimentierphase) 7. - 12. Lebensjahr, 80 - 90 % der Jugendlichen haben min. 1 Mal eine Zigarette geraucht → kein abweichendes Verhalten, sondern einenormative Entwicklungsaufgabe. Wichtig ist hier die kognitive und emotionale Verarbeitung dieses Erlebnisses. → Bsp.: Kinder, die bis zur 4. Zigarette weiterrauchen, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit zu regelmäßigen Rauchen, als die Kinder, die schon vor der 4. Zigarette das Experimentieren abbrechen.
Phase III.: (= Gewöhnungsphase) Pubertät, hier entscheidet sich, ob es zur Herausbil- dung einer festen Rauchgewohnheit kommt oder nicht.Wichtigist hier die soz. Interaktion mit Freunden / Gleichaltrigen, die eine Zigarette zum Mitrauchen anbieten, und der Kontakt mitPeergruppen. Gerade bei Letzteren wird in Gruppen geraucht (z. B. i. d. Pause auf dem Schulhof, an bestimmten Treffpunkten auf dem Schulweg, usw.) → Es wird von diesen Gruppen auch soz. Druck ausgeübt, selbst Zigaretten zu kaufen und nicht immer zu „schnorren“.
ABER:Frustrationsraucher= Haben keinen Anschluss an Clique gefunden od. wurden ausgeschlossen. → Rauchen, um soz. Isoliertheit zu bewältigen. Widerstands-Selbstwirksamkeitspielt eine Rolle = Fähigkeit, in kritischen Situationen dem soz. Druck zum Mitrauchen widerstehen zu können.
Phase IV.: (= Aufrechterhaltungsphase) Rauchen ist zur festen Gewohnheit geworden (= Sucht!). Es dient jetzt vor allem der Regulation interner psycholog. und physiolog. Zustände. Es existieren hier verschiedene Theorien zur Aufrechterhaltung:Nikotinregulationstheorie,Multiples Regulationsmodell, Neuroregulationstheorie,Rauchen als gelernte Bewältigungshandlung, usw. Phase V.: (= Rauchentwöhnung)Woher kommt die Motivation zur Rauchentwöhnung? → Verschiedene Theorien:Transtheoret. Modell der Verhaltensänderung, -Prävention des Rauchens: Die Schule wird als Interventionsebene angesehen, da hier eine Großzahl von Kindern und Jugendlichen erreicht wird, die auch gerade hier einer größeren Beeinflussung zum Mitrauchen ausgesetzt sind. →Ansatz zum soz. EinflussundAnsatz zur generellen Kompetenzentwicklung, die sich beide gegenseitig ergänzen sollen.
-Einflussfaktoren auf die Entwöhnungsbereitschaft: Die Motivation zur Entwöhnung unterliegt vielen soz. Einflüssen (Medien, Ärzte, Familie, usw.).Medienvermitteln Wissen und Meinungsklimas → Konsument sieht sich zunehmend einer ablehnenden Mehrheit gegenüber → Verlust des nachsichtigen soz. Umfeldes.
Ärztehaben große Einflussmöglichkeiten auf Patienten, da sie in Momenten einer erhöhten persönlichen Vulnerabilität eine relativ hohe Bereitschaft zur Verhaltensänderung zeigen.Strukturelle Maßnahmensind z. B. rauchfreie Zonen am Arbeitsplatz.
- Methode der Selbstentwöhnung: Oft gelingt dem Raucher erst nach mehreren Versuchen eine langanhaltende Abstinenz. Bei jedem neuen Versuch steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Raucher es beim erneuten Versuch schafft (Reflexion der gescheiterten Versuche → Fehlervermeidung beim nächsten Mal). Oft werden auch Selbsthilfeprogramme genutzt (z. B. Literatur: „Endlich Nichtraucher“, usw.).
-Verhaltenstherapeutische Ansätze zur Nikotinentwöhnung: Nach Schwarzer ist eine Kombination ausSelbstkontrolltechnikenundStrategien der Rückfallpräventiondie erfolgreichste Methode zur Entwöhnung (beste Abstinenzraten). Weitere Methoden sind z. B. dasFreiburger Modell(4 Phasen: 1. Motivationsphase, 2. Entschlussfassung und Planung, 3. Verhaltensmanagement und 4. Rückfallprävention), dieNikotinsubstitution(mit Pflastern, Kaugummis, etc.), dieAversionstherapie,HypnoseundAkupunktur.
Quelle: http://www.cc.jyu.fi/no-smoking/ger/gstatist.htm
[...]
1 vgl. Literatur[5]: Tina Hascher, Thomas Suter, Petra Kolip: Terminologie-Dossier zur Gesundheitsförderung, http://www.kl.unibe.ch/kl/sla/fsf/Gesundheitsfoerderung.pdf .
2 Vgl. Lit.[1], S. 192.
3 Vgl. Lit.[1], S. 196.
4 Vgl. Lit.[1], S. 197.
5 Siehe Lit.[1], S. 203, unten.
6 Vgl. Lit.[1], S. 210.
7 Vgl. Lit.[1], S. 210.
8 Vgl. Lit.[1], S. 214 - 225.
9 Quelle: Lit.[3].
10 Vgl. Lit.[1], S. 226 ff.
11 Vgl. Kap. 3.1, Phase V.,2. Stadium, S. 13.
12 Vgl. Lit.[1], S. 232
13 Vgl. Kap. 3.1, Phase V.,S. 14. oben
14 Vgl. Kap. 3.1, Phase IV., S. 10.,Nikotinregulationstheorie.
- Quote paper
- Volker Riedel (Author), 2001, Gesundheitliches Risikoverhalten am Beispiel von Rauchen, Alkohol und Drogen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105697
Publish now - it's free



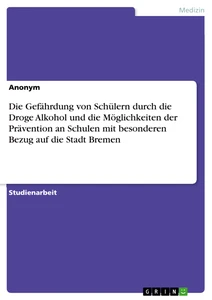


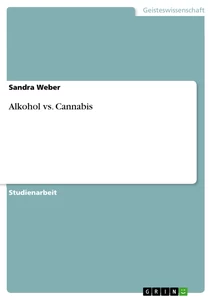













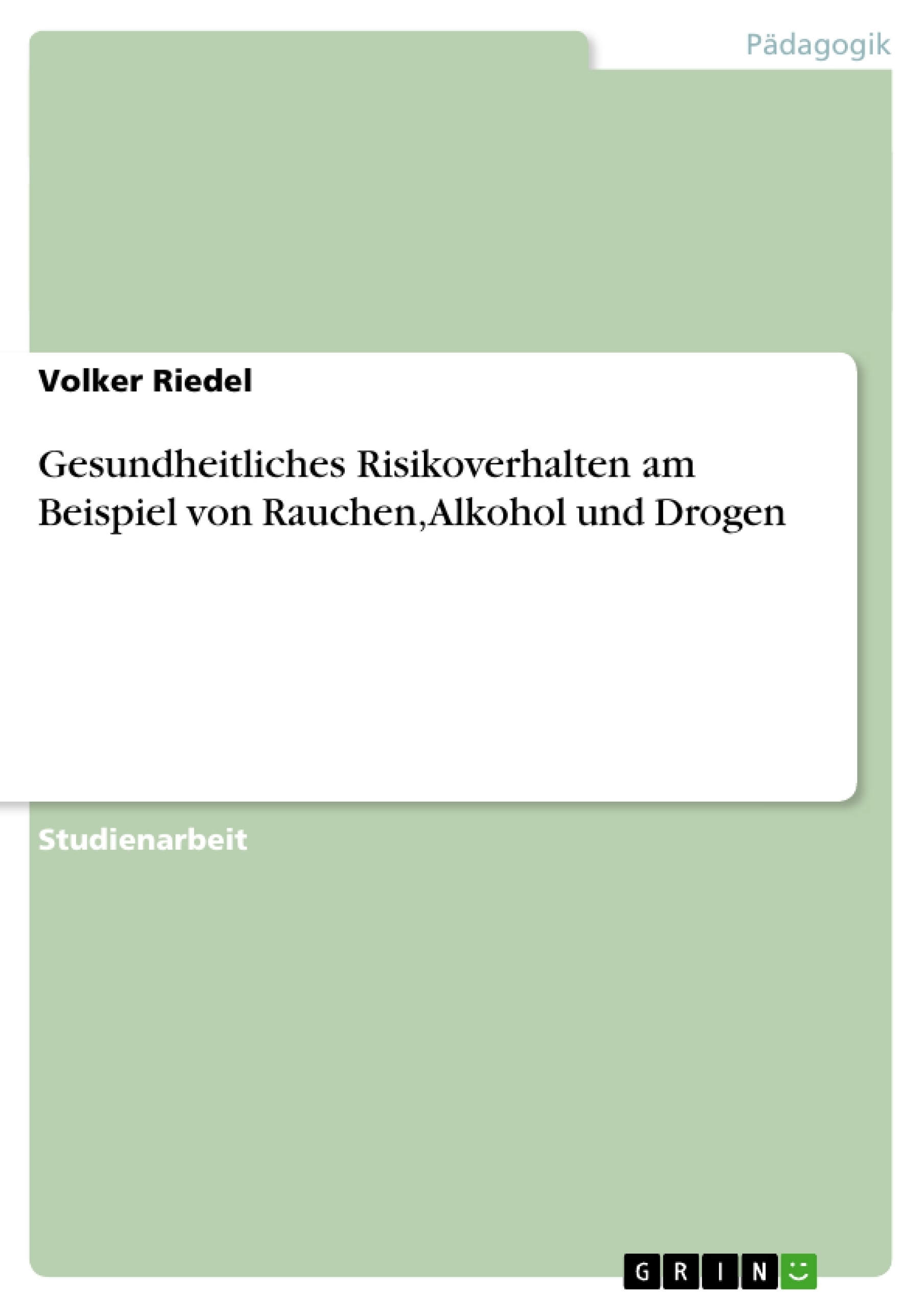

Comments