Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort.
2 Inhaltsangabe und Analyse
2.1 Einleitung und Herkunft (114)
2.2 Ausbildung und erste dichterische Versuche (1526)
2.3 Versuch, politische Karriere zu machen, und Tod des Bruders (2740)
2.4 Ovid in der literarischen Öffentlichkeit seiner Zeit (4164)
2.5 Ehe und Familie (6576)
2.6 Tod der Eltern und Rechtfertigung (7790)
2.7 Verbannung nach Tomis (91114)
2.8 Überleben in der Dichtung (115132)
3 Der arme Ovid!
3.1 Kälte und Unfruchtbarkeit
3.2 Feinde und Krieg
3.3 Der einzige Barbar
4 Der doch nicht ganz so arme Ovid?
4.1 Tomis, die Metropolis
4.2 Die Kornkammer der Antike
4.3 Nicht der archetypische Exildichter
5 Der lusor tristium?
5.1 Alles nur Gedankenspiel
5.2 N.B. Tristia 4.10. ist eine Elegie!
5.2.1 Parallelen zur klassischen Elegie:
5.2.2 Verkehrung der elegischen Motive:
6 Ovid, der Unsterbliche!
7 Fazit.
8 Literatur und Kommentare.
8.1 Literatur.
8.2 Kommentare.
1 Vorwort
In medias res: Zwei Kritikpunkte wird es wohl geben, wenngleich sie einander widersprechen. Die einen mögen behaupten das zweite Kapitel verdiene die Bezeichnung „Analyse“ in keinem Fall, weil sie viel zu kurz ausgefallen ist, die anderen könnten sich beschweren, dass eben jenes zweite Kapitel viel zu lang sei und das Ausmaß der gesamten Arbeit arg ins Ungleichgewicht dränge, wo doch eigentlich jeder den Inhalt von Tristia 4.10 kenne.
Ich kann zu meiner Verteidigung nur sagen: die gesamte Arbeit folgt einem Schema. Zuerst (Kapitel zwei) wird soweit wie möglich die Elegie unbefangen untersucht, ohne gewisse Merkmale schon vorwegzunehmen; ganz so, als gäbe es keine Diskussion über diesen Text.
In Kapitel 3 wird die älteste Auffassung über diesen Text vertreten: Sie geht von der absoluten Wahrheit des Textes aus. Im darauffolgenden Abschnitt wird gezeigt, dass einige Beschreibung nicht der Wahrheit entsprechen können, was den Leser/die Leserin ins fünfte Kapitel einführt. Dort werden zwei neuere Ansichten, nämlich die vollständige Irrealität der Verbannung und die Elegie 4.10 als eine ebensolche gelesen, kurz besprochen, bevor dann das letzte Kapitel beginnt.
Man könnte vorbringen, dass das letzte Kapitel, welches sich mit der Elegie als Totenkult
- Anleitung befasst, eigentlich ja ein elegisches Motiv behandle und deshalb ins fünfte Kapitel eingegliedert gehöre.
Wenngleich dieses Argument richtig ist, so habe ich mich dennoch für den jetzigen Aufbau entschlossen, weil ich im sechsten Abschnitt in groben Zügen den Aufsatz von King wiedergebe, der sich mit dem Gedicht nur in dieser Hinsicht beschäftigt hat und nicht auch noch mit der Frage, in wie weit sich das alles auch in das Schema der Elegie einfügen lässt.
Auch würde eine Einfügung dieses Kapitels in den fünften Abschnitt eben jenen vollkommen aus der Balance bringen, wenn ein Charakteristikum so genau untersucht wird und die restlichen nicht. Der Leser/die Leserin soll also wissen, dass sich der Totenkult zwar als elegisches Thema verstehen lässt, aber aus jenen vorher genannten Gründen ein eigenes Kapitel erhält.
Es wird also von Seite zu Seite Schicht für Schicht der Elegie abgetragen, um dadurch besseres Verständnis von ihr zu erlangen. So ist es dem/der Lesenden möglich, die Entwicklungsgeschichte der Betrachtungsweise persönlich mitzuerleben und zum Schluss sein/ihr eigenes Urteil zu fällen.
In den Kapiteln wurde anhand der mir zugänglichen Literatur versucht, einen möglichst aktuellen Überblick zu geben, wobei ich um der Lesbarkeit willen auf allzu viele Fußnoten verzichtet habe; nur Eckpunkte der jeweiligen Aufsätze, die Anleitung zu eigenen Gedanken lieferten, wurden genau zitiert. Der interessierte Leser und die interessierte Leserin werden also kaum Schwierigkeiten haben die Originale zu finden.
Ein Schwachpunkt ist natürlich die mangelnde Internationalität der Literatur. Der Grund dafür liegt ausschließlich bei mir: außer Englisch beherrsche ich keine andere „lebende“ Fremdsprache. Ich hoffe aber, dass ich die maßgeblichen Gedanken italienischer und französischer Philologen über die Artikel der englisch-schreibenden Wissenschaftler aufgenommen habe.
„Nimm an Nachwelt, wer ich war, der Spieler zarter Tändeleien, damit Du auch weißt, wen Du da liest!“, so beginnt Ovidius Publius Naso sein von der Tradition als Autobiographie bezeichnetes Gedicht. Doch beginnen wir der Reihe nach:
2 Inhaltsangabe und Analyse.
2.1 Einleitung und Herkunft (1-14).
Der Anfang richtet sich an ein lesendes Publikum, nicht an ein zuhörendes, typisch episches Auditorium. Dies ist ein Kennzeichen der Kallimacheischen Elegien - Tradition. Der dritte Vers ist seiner Heimatstadt Sulmo gewidmet, deren Reichtum an kühlen Wasser er hervorhebt.
Dann geht er zur Beschreibung seines Geburtsjahres über, doch anstatt genaue Zahlen anzubieten, schildert er das einmalige Ereignis, dass zwei Konsuln gemeinsam fielen. Hierbei bewegt er sich aber durchaus im üblichen Sprachgebrauch, da die beiden Politker A. Hirtius und C. Vibius Pansa, die im Kampf gegen Marcus Antonius in Mutina 43 v.Chr. fielen, nach mehr als fünfzig Jahren in Rom noch immer geläufig waren. Er, Ovid, sei auch aus altem Rittergeschlecht und nicht einer dieser Neureichen, denen „fortuna“ (V.8) zu diesem Stand verholfen hätte. Hier ist die Doppeldeutigkeit von „fortuna“ zu beachten: ist sie doch so wohl die Göttin, als auch das bloße Geld; gegen das Ende der Republik lag der Zensus für die Ritterwürde bei 400.000 Sesterzen.
In den folgenden sechs Versen geht er sehr behutsam vor: Zunächst berichtet er, dass sein Bruder zwölf Monate vor ihm geboren ist; und zwar genau am selben Tag. Erst in V. 13 folgt das Datum: es war der 20. März, der zweite Tag des fünftägigen Minervafestes. Diesen gesamten Teil prägen kunstvoll arrangierte Zahlenangaben. Ovid zwingt so den Leser zu größter Aufmerksamkeit, um sich im Labyrinth dieser Zahlenreihen zurechtzufinden, statt einfach handfeste Informationen zu liefern1.
Weiter fällt auf, dass Ovid zwar seine Heimat hervorhebt, sein Geburtsdatum aber nicht mit Kategorien Sulmos, sondern Roms beschreibt: dem Tod der römischen Konsuln, der Sulmo nur indirekt betraf, und dem römischen Minervafest, das in Sulmo nicht gefeiert wurde. Dies erklärt sich aber aus der Exilsituation, in welcher Ovid gezwungen war, dem römischen Publikum ihm allgemein bekannte Fixpunkte zu liefern.
2.2 Ausbildung und erste dichterische Versuche (15-26).
In diesen Versen geht er auf seine Erziehung, die in Sulmo begann, aber dann wie üblich in Rom fortgesetzt wurde, ein. Am Beispiel seines Bruders schildert er den normalen Werdegang eines römischen Adeligen, wovon er seinen Weg abgrenzt. Mit dem scharfen „at“ (19) führt Ovid zu seinem eigenen Streben, das er als „scaelestia sacra“ (19), eine Art Gottesdienst, umschreibt. Das hat aber nichts mit dem herkömmlichen Priesteramt zu tun, womit er ja wiederum in der Politik gelandet wäre, denn der folgende Pentameter schildert, wie ihn die Musen zu ihrer Kunst ziehen. Wenngleich er sich ihnen auch im Geheimen zuwendet, so bekommt dennoch sein Vater Wind davon und rät seinem Sohn von der professionellen Dichterei ab; mit dem Hinweis, auch Homer wäre nicht reich geworden.
Aufgrund der pietas, die er seinem Vater schuldig ist, bemüht er sich, ungebundene Sätze zu schreiben, was ihm nicht ganz gelingen will:“[...] et quod temptabam scribere versus erat“ (26). Doch auf die Dauer wird die Verleugnung seiner wahren Berufung zu anstrengend, wie der nächste Abschnitt zeigen wird.
2.3 Versuch, politische Karriere zu machen, und Tod des Bruders (27-40).
Ovid berichtet anfangs, wie beide Brüder das Erwachsenenalter erreichen, was das Anlegen der toga virilis am 17. März, den Liberalien (daher auch: „toga liberior“ in V.28), im Alter von ca. 17 Jahren symbolisiert. Der latus clavus dokumentiert die Vorbereitung auf die Politik, wozu sich Ovid nun durchgerungen hat. Aber in Vers 31f kommt es zu einer plötzlichen Wendung: im Alter von zwanzig Jahren stirbt ganz unerwartet sein Bruder, der wie ein Teil Ovids Selbst war. Trotz des Verlustes bemüht er sich weiter, ja man kann sogar wie Schmitzer das „cepimus“ (33) als Indiz dafür fassen, dass Naso sogar die Aufgaben seines Bruders übernimmt, und beginnt den cursus honorum. Er nennt exemplarisch das niedere Amt der tresviri, verschweigt aber, dass er den decemviri stlitibus iudicandis angehörte und auch Einzelrichter war. Er hätte nur noch die Quästur ausüben müssen, und er wäre in den Senat gekommen, doch weder Geist noch Körper waren fähig, die Belastung der Politik zu ertragen, so fiel wohl Mitte Zwanzig die Entscheidung für die Dichtung. Hier taucht zum ersten Mal das elegische Topos der recusatio auf, denn bisher beschränkte Ovid sich nur auf den Hinweis, dass ihn die Kunst zwar mehr anspräche, er aber dennoch den typisch römischen Weg einschlagen wolle. In V. 38 hingegen schildert er eindeutig seine Abwendung: „[...] fugax ambitionis [...]“.
2.4 Ovid in der literarischenöffentlichkeit seiner Zeit (41-64).
In diesen Distichen folgt eine Aufzählung von acht Dichtern, in deren Reihe er sich dann in V. 54 stellt. Insgesamt werden also neun Dichter genannt; -eine Anspielung auf die neun Musen? Er beginnt den Katalog mit Aemilius Macer, der hexametrische Lehrgedichte verfasst hat, geht über zu Properz und erwähnt noch die Epiker Ponticus und Bassus, den Verfasser sogenannter „Iamben“ (Spottgedichte). Ovid kannte auch Horaz, und das in diesem Zusammenhang fallende „ausonia lyra“ (50) ist eine Hinweis auf Horaz’ Bemühen lateinische (also italische oder eben ausonische) Sprache in griechische Metren zu fassen. Dass Vergil nur gesehen wurde, aber nicht zu Ovids sodalicium zu zählen war, liegt wohl an dessen Aufenthalt im Süden Italiens. Tibull hingegen konnte er nicht einmal mehr kennen lernen.
Im V. 53 folgt nun der Kanon der römischen Elegiker: Gallus, Tibull, Properz und Ovid. Von V. 55 spricht er von seinem Werk: Schon in seiner Jugend fanden öffentliche Rezitationen seiner Gedicht statt. Das Pseudonym der Geliebten Corinna umschreibt die Amores, die seinen Ruhm begründeten. Nach seiner Beteuerung, er habe viel verbrannt und nur das veröffentlicht, was ihm selbst auch gut schien, erwähnt er zum ersten Mal seine Verbannung, um dann aber sofort zur Schilderung seines Privatlebens überzugehen.
2.5 Ehe und Familie (65-76).
Ovid, wenngleich empfänglich für die Pfeile Cupidos, der ihn ja zum Elegiendichter machte2, schränkt diese Empfänglichkeit gleich auf die Dichtung ein, denn er beteuert, einen soliden Lebenswandel zu haben: er war zwar bereits zweimal verheiratet, bis er dann die richtige Frau fand, die auch zu ihm hielt, als er ins Exil (zweite Erwähnung der Verbannung, ohne aber näher auf sie einzugehen) geschickt wurde, doch nur weil er bei der ersten Hochzeit zu jung und die Beziehung zur zweiten Frau auch nicht lange hielt. Schon in den verschiedenen Bezeichnungen schwingen Ovids Gefühle für die Frauen mit: die erste bezeichnet er bloß als „uxor“ (69), die ihm -ganz passiv- gegeben wurde, der zweiten fühlte er sich schon eher verbunden: „coniugem“(71), doch über das gemeinsame Lager hinaus verband ihn wohl nichts mit ihr. Erst die Dritte war mit ihm („mecum“, 73). Er berichtet auch von seiner Tochter, die ihn schon zweimal zum Großvater machte, wobei es sich aber nicht um ein und denselben Kindesvater handelte. Wie wichtig ihm dieser Teil war (immerhin eine Art Leumundzeugnis), zeigt die penible Bearbeitung der Stelle: nirgendwo sonst findet man in dieser Elegie so viele Alliterationen, wie z.B.: „NominNe sub Nostro Fabula Nulla Fuit“ (68).
2.6 Tod der Eltern und Rechtfertigung (77-90).
Wiederum schildert sich Ovid als einen moralischen Bürger: er erweist seinen Eltern die letzte Ehre, wird also seiner pietas wieder gerecht. Auffällig ist auch das Beharren auf einer Verkomplizierung von Zahlangaben, wie auch in den ersten Versen: Anstatt seinen Vater gleich als Neunzigjährigen zu bezeichnen beschreibt er ihn als „[...] novemque / addiderat lustris altera lustra novem.“ (77f). Dann (81ff) folgt die dritte Erwähnung seiner Verbannung, er ist froh, dass seine Eltern diese nicht mehr miterleben mussten, besteht aber darauf, dass es sich bei dem Grund seines Exils um einen „error“ handelte und nicht um ein „scelus“ (beide 90). Mit diesem Schwur vor den Manen bekräftigt er die nun folgenden Worte, die er wieder an seine Leser richtet.
2.7 Verbannung nach Tomis (91-114).
Endlich kommt er auf die Verbannung zu sprechen: der Leser wusste ja schon vorher von ihr und kann es daher kaum noch erwarten, endlich von ihr zu lesen. Dreimal hatte Ovid sie schon angekündigt, wobei er von Mal zu Mal etwas detaillierter wurde, doch die vollständige Schilderung blieb immer aus. Nun aber scheint der Augenblick gekommen, wo Ovid endlich das Geheimnis lüften will.
Die ersten Verse dieses Teils klingen ähnlich dem Anfang der Elegie: ein Anruf an die Leserschaft, eine Schilderung seines Alters, noch immer in seiner spielerischen Art: dieses Mal wird das Jahr aber nicht durch Konsuln bezeichnet, sondern durch ein bei den Olympiaden siegreiches Pferd. Wichtig ist hierbei, dass er eine Olympiade einem Lustrum gleichsetzt3. Somit lässt sich auch das Jahr, in dem ihn die Verbannung traf, festlegen: ca. 8 nach Chr. Die Verwendung der Olympiade anstatt der sonst üblichen Konsulangabe hat auch den Sinn, den Blick des Lesers weiter nach Osten zu richten, liegt doch Olympia ungefähr in der Mitte des Seeweges von Rom nach Tomis. Darüber hinaus steht das siegreiche Pferd in starker Antithese zu seinem Schicksal.
Die Verwendung von „euxinum“ in V. 97, anstatt einfach pontus zu sagen, kann man einerseits als Euphemismus4 betrachten, oder man sieht darin Ovids Hoffnung, es könne nicht so schlimm werden, widergespiegelt. Allerdings lässt er in dem Adjektiv „laesus“ wohl mit Absicht die negative Konnotation mitschwingen. Der Leser ist also hin und her gerissen, der folgende Vers (98) lässt durch den Spondeus in „laesi“ noch etwas Zeit, bis dann mit einem Tusch der Rest des Pentameters hereinbricht; und mit ihm die Tatsache, dass der Kaisergott wütend ist.
Im nächsten Distichon scheint er den Grund seiner Verbannung angeben zu wollen, doch nach der Penthemimeris kommt der Umschwung: der Grund sei all zu bekannt und bedürfe einer neuerlichen Erklärung nicht mehr; ja er geht eigentlich so weit, dass er sagt, er dürfe nicht darüber sprechen. Über die Gründe ist, da Ovid sich bedeckt hält, viel gerätselt worden: nur so viel ist klar: „carmen et error“ (trist. 2,207). Mit „carmen“ ist die Ars Amatoria gemeint, die aber nur einen äußeren Anlass bilden kann, da sie schon Jahre vorher veröffentlicht wurde. Auch andere Vermutungen, die sich auf einen Sittenskandal beziehen, sind eher auszuschließen; nur eine Affäre mit politischer Dimension konnte so brisant sein, dass Ovid nicht einmal als schon Verbannter darüber sprechen durfte. Da bietet sich folgendes Szenario an5: ausgehend von der ungeklärten Augustusnachfolge, um welche die Söhne der Julia, der Tochter des Augustus, und Tiberius, der Sohn Livias, konkurrierten, ergibt sich die Möglichkeit, dass Ovid Gaius Caesar unterstützte. Als dieser aber starb (ein Mord vonseiten der Livia wurde nicht ausgeschlossen: „novercae Liviae dolus“ (Tac. Ann. 1,3)), rechneten Livia und Tiberius mit dessen Anhängern ab6: In der Folge wurden 8 n.Chr. sowohl Julia als auch Ovid verbannt; beide Opfer ihrer politischen Sympathien.
Nun beschreibt er, wie ihm seine Gefolgschaft noch kurz vor seiner Abreise Schaden zufügte: „[...]comitumque nefas[...]“ (101), womit er offensichtlich zwei Dinge hervorheben will: einerseits seinen nunmehr rechtlosen Status, der es den Dienern erlaubt, ihren Herrn zu betrügen, andererseits seine Gottgleichheit, da der Betrug an ihm als nefas bezeichnet wird; hier klingen wieder die Verse 19 („caelaestia sacra“) und 42 („rebar adesse deos“) an. Wenngleich ihm die Schifffahrt hart zugesetzt hat - sie fand ja auch im Winter (!) statt -, so lässt er sich doch nicht klein kriegen, vergisst sein bisheriges Leben und greift sogar zu den Waffen, da es die Umstände (106) erfordern. Und das ist auch gut so: immerhin wird er die Zeit bis zu seinem Tode im Land der köchertragenden Geten zubringen. Aus unserem Dichter, der bestenfalls den amor pharetratus kennt, wird nun ein Krieger, der seine militia (wohlgemerkt nicht die militia amoris) ableistet. Der einzige Trost, der ihm bleibt, liegt in seiner Dichtung. Sie erweist sich nun nicht als „inutile“ (21), wie der Vater meinte, denn sie verheißt Linderung und schafft Beschäftigung. Nicht einmal die Tatsache, dass ihn und seine Gedichte hier keiner verstehen kann, mindert die Bedeutung der Kunst für ihn.
2.8 Überleben in der Dichtung (115-132).
Mit Vers 115 findet Ovid den Übergang zum Schlusshymnus: Er preist die Muse nicht nur dafür, dass er ihr das nackte Leben („vivo“) verdankt, sondern auch, dass er nicht unter dem Leid zerbricht („laboribus obsto“) und durch sie sogar zu einer positiven Einstellung dem Leben gegenüber gelangt („nec me sollicitae taedia lucis habent“). Diese Klimax drückt sich auch in der zunehmenden Wortanzahl aus, mit zuerst nur einem, dann zweien und schließlich sechs Worten. Dem folgt in V.117ff ein fünffacher Musenanruf, der in einem Epos ganz am Anfang stünde. Überhaupt hat der Schluss etwas Episches: Held ist der auf dem Meer Dahintreibende (Wer denkt da nicht an Odysseus?), der sich mit Waffen vor den Feinden schützen muss. Anstatt von Liebschaften zu erzählen, geht es um Kampf...
Drei Aspekte hebt Ovid in seiner Anrede hervor: die Muse kommt als Linderung für die Leiden des Verbannten (solacia, requies, medicina). Sie führt ihn aus der Verbannung zurück in die Welt der Dichter, auf den Helikon, den er ja schon einmal um des Vaters willen (23) verlassen hat; nicht einmal Augustus kann dies verhindern. Und letztlich dankt er ihr für seinen Ruhm schon zu Lebenszeit, den nicht einmal der Neid und die große Konkurrenz schmälern konnten. Er weiß sich also unsterblich durch seine Kunst, womit er zurück in der Motivik der Elegie und am Ende des Gedichts wäre. Der letzte Vers richtet sich, wie der Anfang und die Mitte (91), an den Leser: ihm wird Dank gesagt; und das zu Recht, denn immerhin garantiert er das Weiterleben des Poeten.
3 Der arme Ovid!
„Nach langer Irrfahrt erreichte ich endlich die den köchertragenden Geten verbundene sarmatische Küste! Hier lindere ich, wenn auch von feindlichen Pfeilen umrauscht, mit der Dichtung, mit welcher ich dies vermag, mein trauriges Schicksal.“7
3.1 Kälte und Unfruchtbarkeit.
Er, der Dichter, ist also in Tomis, dem Ort seiner Verbannung angelangt; und sein Schicksal ist wahrlich hart! Die Stadt liegt im hohen Norden8 in der Region des polaren Klimas und der arktischen Kälte. Es ist unentwegt kalt und die gesamte Gegend leidet unter dem Dauerfrost. Wie denn nicht? -Es gibt ja nicht einmal einen Frühling, geschweige denn einen Sommer! So sind eben auch Orte möglich, an denen der Schnee nur jedes zweite Jahr schmilzt.9 Dementsprechend schlecht ist es auch um die Landwirtschaft und deren Erträge bestellt.
Doch nicht genug damit, dass draußen eisiger Frost herrscht, nein sogar der Wein im Haus friert, und will man welchen genießen, so empfiehlt es sich, den Wein in Eisbrocken zu sich zu nehmen, um ihn im Mund schmelzen zu lassen. Ebenso ist es unmöglich, Wasser einfach aus dem Brunnen zu schöpfen: vielmehr müssen aus einem See herausgeschlagene Eisbrocken mit nach Hause genommen werden10. Nur mit Tierfellen und dicken Hosen bekleidet kann man der Kälte einigermaßen trotzen; einzig das Gesicht bleibt unbedeckt, weswegen Bart und Haare auch vereist sind.
Aber nicht nur das Land und die Brunnen sind gefroren, auch die Donau („gelidus“ Pont. 2.4.1) und selbst das unermesslich große Schwarze Meer sind von einer dicken Eisschicht überzogen.
3.2 Feinde und Krieg.
Zu dieser unbarmherzigen und harten Kälte kommen noch ebensolche Völker. Sie sind wild, grausam und aggressiv. Man nennt sie u.a. Geten, Sarmaten, Skythen, Kolcher; welchem Vergil - Kenner11 laufen bei der Erwähnung des Namens der Skythen nicht schon Schauer über den Rücken?
Die Situation ist noch erträglich solange „Sommer“ herrscht, friert dann aber die Donau zu, ist das Leben in ständiger Gefahr, da die Barbaren nun ungehindert in die Stadt eindringen können. Zur Verteidigung wurde schon eine Mauer errichtet, und jedes Mal, wenn ein neuerlicher Angriff der Horden droht, dann müssen alle -also auch unser Ovid- zu den Waffen greifen und die Stadt schützen.
3.3 Der einzige Barbar.
Dennoch ist das Leben auch ohne Angriffe der Wilden alles andere als angenehm. Tomis’ Bewohner nämlich sind kaum der Bezeichnung „Mensch“ würdig12. Obgleich eine griechische Kolonie und ganz am Meer, also entfernt vom Hinterland, dominiert selbst in der Stadt das Getische. Die Barbaren reiten in voller Rüstung durch die Stadt, missachten die Gesetze und liefern sich blutige Schlägereien. Nicht einmal mehr Griechisch als Sprache ist erhalten, außer in verschliffener Form; geschweige denn Latein. Ovid ist nun derjenige, der sich nicht verständigen kann, weil er nicht verstanden wird, er ist nun das Absonderliche und Fremde, er ist hier, in Tomis, der Barbar13 ! Bedingt durch die Verständigungsprobleme ist er auch zu einem Leben in Isolation gezwungen und hat niemanden, dem er seine Gedichte vortragen könnte14.
Doch kennt man die Urgeschichte von Tomis wie Ovid, dann dürfen einen solche Zustände gar nicht wundern. Ist Tomis ja immerhin der Ort, an welchem Medea ihren Bruder Absyrtos zerstückelt zurückgelassen hatte, woher die Stadt auch ihren Namen bekommen hat: Tomis von τεµνω, τοµη. Nach diesem Aition Ovids15 ist nun allen Lesern klar, wie schrecklich und grauenhaft diese Gegend schon seit Urzeiten sein muss, oder?
4 Der doch nicht ganz so arme Ovid?
4.1 Tomis, die Metropolis.
Tomis, wie es uns von Ovid geschildert wurde, scheint es nie gegeben zu haben. Keine Rede von Barbaren, die kein Latein und Griechisch konnten, keine Spur von ständigen Raubüberfällen auf die Stadt. Vielmehr hat sich die im 7. Jahrhundert v. Chr. gegründete griechische Kolonie zur wichtigsten Stadt in jener Gegend entwickelt: Sie war Sitz der römischen Zivil- und Militärverwaltung und des römischen Statthalters und durfte sogar ihre eigenen Münzen prägen.
Wenngleich die Hauptsprache sowohl in der Verwaltung und im Handel als auch im geistigen Leben Griechisch war, so waren gerade in Tomis die Latein - Sprechenden zahlreicher vertreten als in anderen vergleichbaren Schwarzmeer - Städten.
4.2 Die Kornkammer der Antike.
Ein Blick in den Atlas beweist, was der Leser/die Leserin eigentlich immer schon vermutet hat: Tomis (das heutige Constanza, Rumänien) liegt zwar nördlicher als Rom, doch nicht in Sibirien, wie es Ovids Beschreibungen aussehen lassen. Ja, im 20. Jahrhundert ist Constanza sogar zur Riviera seines Landes geworden; da drängen sich einem gleich Vergleiche mit Rimini auf, das übrigens auf ungefähr derselben geographischen Breite liegt16. Neuere Klimaforschungen zeigen, dass in Tomis ungefähr die gleichen Bedingungen wie in Italien herrschen; nur dauern die Winter etwas länger und sind ein bisschen kälter. Einzig Eisbildung auf dem Pontos kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden, allerdings wird es sie zu Ovids Zeit nie in dem geschilderten Ausmaße gegeben haben.
Nun verwundert es bestimmt auch nicht weiter, wenn behauptet wird, die Gegend um Tomis, heute Dobrudscha genannt, sei auch nicht unfruchtbar, weil ständig vereist, gewesen. Vielmehr war die Landwirtschaft neben Handel und Schifffahrt immer schon ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, das Hinterland der Getreidespeicher der Antike17.
4.3 Nicht der archetypische Exildichter.
Obwohl über die Gerechtigkeit der Strafe, die Ovid in Form der Verbannung widerfahren ist, gestritten werden kann18, so steht eines fest: allein der Begriff Verbannung ist schon irreführend, weil es sich bei seinem Zwangsaufenthalt nämlich um die relegatio gehandelt hat. Er durfte also Staatsbürgerschaft und auch sein Vermögen behalten.
Noch viel weniger trifft aber das Wort Exil19 auf seine Lage zu: bedeutet doch Exil in unserem Sprachgebrauch, dass jemand aufgrund politischer Verhältnisse sein Land verlassen muss, wobei Flucht und Vertreibung ein Fehlen von Meinungsfreiheit signalisieren. Ein zweites Charakteristikum ist die materielle Not, in die ein Geflohener gerät, wenn er seine Habe ganz aufgeben hat müssen, und nun im neuen Land auch kein Publikum mehr für seine Bücher hat. Das führt uns zum dritten Punkt: der Sprachnot. Da kein Kontakt mehr zu Kollegen besteht, keine Rückmeldung aus der Leserschaft existiert, wird es für den Dichter schwer, ja geradezu unmöglich, am Puls der Zeit zu bleiben sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Viertens kann man noch die Entfernung aus dem gewohnten Umfeld und die Unmöglichkeit der Kommunikation mit den Verwandten nennen.
Aufgrund der Aufzählung dieser vier Merkmale eines Exildichters wird es moralisch unvertretbar Ovid als einen solchen, oder gar: den prototypischen, zu bezeichnen: Er durfte sein Vermögen behalten, er durfte schreiben, er durfte publizieren, er hatte Kontakt mit der römischen Oberschicht. Auch das oft erwähnte Entfernen seiner Werke aus den (ohnehin wenigen) öffentlichen Bibliotheken ist kaum als Zensur zu bewerten, durften ja die Reichen weiterhin seine Gedichte lesen. Ovid sagt ja selbst, er werde durch das Publikum unsterblich sein; dabei meint er aber nicht die denkmögliche Unsterblichkeit, sondern die schon existente.
5 Der lusor tristium?
„Nimm an Nachwelt, wer ich war, der spielfreudige Verfasser feinsinniger Liebespoesie20, damit Du auch weißt, wen Du da liest.“
In unserem Ovid - Bild hat sich einiges getan, nicht zuletzt auch in der Übersetzung des ersten Distichons! Doch wie weiter? Wir stehen vor dem Trümmerhaufen unserers Gedankengebäudes21, es handle sich bei Trist.4.10 um eine Autobiographie.
5.1 Alles nur Gedankenspiel.
Aufgrund dieser Lage der Dinge liegt es gar nicht mehr so fern überhaupt von Fiktion zu sprechen, also selbst die Relegation als nicht existent zu bezeichnen22. Aber diese Haltung wird gegen folgende Argumentation nicht zu halten sein: man stelle sich bloß das Szenario vor! Ovid ist in Rom, nimmt am gesellschaftlichen Leben teil, geht am Abend nach Hause und beginnt zu schreiben, er sei ans Ende der Welt verbannt worden und spart dabei nicht mit unterschwelligem Spott über Augustus. Hielte das Publikumsinteresse wirklich neun Bücher und neun Jahre (bis zu seinem Tod 17 n. Chr.) lang? Ließe sich Augustus derartig verspotten? Wohl nicht. Die Inszenierung seiner relegatio bedeutet noch lange nicht deren Fiktion.
Auf die Art der Inszenierung wird nun einzugehen sein.
5.2 N.B. Tristia 4.10. ist eine Elegie!
Ausgehend von der These, dass ein antiker Text nicht nach dem Kriterium der Wahrheit hin untersucht werden darf, sondern vielmehr darauf, ob er seinem Genre entspricht23, muss nun das Werk auf seine elegischen Merkmale hin untersucht werden24.
5.2.1 Parallelen zur klassischen Elegie:
Das Flehen des Dichters, doch endlich wieder nach Rom kommen zu dürfen, ähnelt zu sehr der Paraklausithyron - Situation, als dass man es ignorieren könnte. Der poeta/amator liegt dieses Mal aber nicht direkt vor der Tür der Geliebten, sondern in Tomis; doch die äußeren Umstände sind die gleichen: beide frieren, beide sind von der Sehnsucht nach der Geliebten erfüllt und beide begehren Einlass, der beiden jedoch verwehrt wird.
Der poeta/amator ordnet sich ganz offensichtlich dem Kaiser unter, und wirbt um dessen Gunst und Aufmerksamkeit, wobei er allerdings, wie das die Elegie nun einmal verlangt, erfolglos bleiben muss . Ovid leistet so seinen servitium amoris. Dieses erfolglose Werben, ein Kennzeichen der Elegie, steht demnach im Vordergrund; nur eben etwas versteckt.
Natürlich fehlen auch nicht die Beteuerungen des Dichters, er sei moralisch integer. Man denke nur an Ovids Schilderung seines Familienlebens: Frau, Tochter, Enkel und pietas prägen sein Dasein; der Kaiser hätte also wahrlich kein Recht (ebenso wenig wie die puella), den Dichter aufgrund seines familiären Hintergrundes so abzuweisen.
Geradezu aberwitzig ist die überspitzte Abwendung von der Gesellschaft, die den elegischen Dichter auszeichnet: abgewandter zu sein als Ovid (sich) in Tomis (beschreibt), ist gar nicht mehr möglich! Nicht einmal mehr dieselbe Sprache wie die ihn umgebende Gesellschaft hat er. Für ihn gibt es nur noch eines: das Wohlwollen des durus caesar und die Heimkehr nach Rom. Alles andere hat er diesem Ziel untergeordnet.
Auch wird er nicht müde, seine Armut zu beteuern, und so dem Bild vom pauper amator gerecht. Denn wer zweifelt allen Ernstes daran, dass Ovid nicht arm sei, wenn er nicht einmal flüssigen Wein hat?
5.2.2 Verkehrung der elegischen Motive:
Wie auffällig die Unterordnung des Dichters unter den Kaiser ist, so sehr sticht ins Auge, dass nun Augustus, also ein Mann, in die Rolle der dura puella gedrängt wurde. Dieses Bild taugt aber nur so weit, als man Augustus als Repräsentant der Stadt Rom sieht; denn Ovid will in die Stadt und nicht ins Schlafgemach des Kaisers.
Selbst die Berühmtheit, die ein jeder anderer Elegien - Dichter nach seinem Tod erreicht, hat Ovid schon zu Lebzeiten; er ist gewissermaßen wirklich unsterblich: denn er lebt ja noch und hat schon ewigen Ruhm, während sich seine Vorgänger auf den Nachruhm verließen; also erst einmal wirklich sterben mussten.
Er schafft es auch die recusatio in die zweite25 Richtung bis an ihr Ende auszureizen: ihr nämlich völlig zu kündigen.. Weigerte sich der junge Elegiker traditionell, Waffen zu ergreifen, so ist nun der alte Dichter eben dazu gezwungen, weil nunmehr nicht ein amor pheretratus, sondern die getae pheretratae seine Umgebung darstellen.
Und auch wird es unumgänglich, Kämpfe in einer Elegie zu schildern, wenn er zu Hause Eindruck schinden und Mitleid hervorrufen will. Dies dient alles dem Zweck, einen möglichst großen Unterschied zwischen dem jugendlichen Dichter in Rom und dem greisen Krieger in Tomis herauszuarbeiten. In dieser verkehrten Welt von Tomis ist eine recusatio schlichtweg unmöglich; doch was macht das schon für einen Unterschied? Ist diese Gegend doch allenthalben ein regelrechter locus horribilis 26.
Ja, Ovid verkehrt sogar die locus amoenus - Topik. Wurde in früheren Elegien ein schattiger, kühler Platz, womöglich noch am Land, gepriesen, so kann Ovid mit seinem momentanen Aufenthaltsort durchaus zufrieden sein: in Tomis ist es kühl und zutiefst provinziell. Er setzt also den schon alten und verbrauchten Begriff des locus amoenus bewusst ins Extrem, um damit Eines zu beweisen: ein angenehmer Ort zeichnet sich nicht primär durch klimatische Gegebenheiten aus, sondern durch Kultur, städtisches Flair und intelligenter und zivilisierter Gesellschaft. Der naive bukolische locus amoenus ist endgültig passé.
6 Ovid, der Unsterbliche!
Jetzt bleibt nur noch zu klären, warum Ovid in seiner Einleitung, seine eigene Grabinschrift zitiert. Ist die Elegie gleichsam ein Nekrolog? Ist sie etwa eine Anleitung, wie man dem Künstler huldigen sollte27 ?
Er gebraucht ganz offensichtlich die Metapher des Todes, wenn er von seinem Exil, das ja wie wir schon geklärt haben, kein Exil in unserem Sinne war, spricht. Und genauso wie ein Wanderer dem Toten die letzte Ehre erweist, indem er dessen Grabinschrift liest, erweist der Leser dem Dichter diese Ehre, wenn er sein Gedicht liest. Indem Ovid also alles einem Begräbnis angleicht, macht er seine Leser zu Mitgliedern der Trauergemeinde. Dreimal ruft Ovid seine Leser an und bezeichnet sie als seine Nachfolger, bezieht sie also in den engeren Kreis ein. Und wie er seinen Eltern gegenüber pius war, so muss nun die Leserschaft ihm gegenüber sein.
Wenn er Dichter als Götter bezeichnet (42) und sich dann selbst in die Reihe der wichtigsten Poeten stellt, so kann das nur eines bedeuten: er ist auch ein Gott und will auch solche Ehrungen empfangen und nie vergessen sein. Dieser Gottstatus findet sich auch in dem Ausruf, dass die Erde ihn nie haben werde (130), er also nie ein Grab brauchen wird; wie eben kein Gott ein Grab braucht: denken wir nur -das ist nicht blasphemisch- an Jesus.
Die Leserschaft, nunmehr einbezogen in sein sodalicium, das ursprünglich nur aus seinen Dichterkollegen bestanden hat, muss, um dem ius sodalicii gerecht zu werden, an Ovid denken und ihn in Erinnerung behalten. Er liefert auch zwei einfach zu merkende Anhaltspunkte, gewissermaßen Jahrestage28:
Erstens fällt - besser: Ovid lässt ihn dorthin fallen - sein Geburtstag genau in die Zeit des Minerva - Festes. Somit bezieht er sich auf eine der ersten Göttinnen Roms, und außerdem spielt er auf die Verbindung aller Dichter mit Minerva an.
Zweitens wendet er sich in V. 85 - 91 an seine Eltern, wobei die Rede zu den Manen sehr stark an die parentalia im Februar erinnert.
Ovid bietet also zwei Daten an: eines für seine Dichterkollegen und die Leserschaft , das andere für seine Familie. Er hat also mit Nachdruck dafür gesorgt, dass er nicht in Vergessenheit geraten kann, und hat sich somit seine Unsterblichkeit gesichert.
7 Fazit.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Elegie Tristia 4.10 wohl als eine solche zu lesen und zu verstehen ist. Das hat zur Folge, dass ihre Aussagen im Detail als nicht wahrheitsgemäß angesehen werden dürfen. Es gibt ja mannigfache Beweise, dass dieses Gedicht kein Tatsachenbericht ist und wohl nie als ein solcher gedacht war.
Dennoch ist äußerst wichtig, festzuhalten, dass die Realität der Relegation des Dichtes in den letzten Jahren der Forschung nicht in Frage gestellt wurde, wenngleich diese Theorie sehr verlockend ist angesichts des Fakts, dass der Dichter sogar bei seinem Geburtstag nicht ganz wahrheitsgetreu gewesen sein musste, weil dieses Datum auch einen anderen Zweck gehabt haben könnte. Genau so gut ist es natürlich nicht auszuschließen, dass das Datum sehr wohl stimmt.
Mit dem Beispiel des Geburtsdatums wollte ich nur klarmachen, wie wenig wir wirklich von Ovid selbst wissen, und dessen sollten wir uns bei seiner Lektüre immer klar sein.
8 Literatur und Kommentare.
8.1 Literatur.
Bretzigheimer, Gerlinde: Exul ludens. Zur Rolle von relegans und relegatus in Ovids Tristien. In: Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung. Bd. 98. Heft 1. 1991. S. 39 - 76.
Chwalek, B.: Die Verwandlung des Exils in der elegischen Welt. Studien zu den Tristia und Epistulae ex Ponto Ovids. In: Studien zur klassischen Philologie. Bd. 96 . Frankfurt am Main 1996.
Claassen, Jo-Marie: Ovid’s Poems from Exile. The Creation of a Myth and the Triumph of Poetry. In: Antike und Abendland. Bd. 34. 1988. S. 158 - 169.
Ehlers, Widu-Wolfgang: Poet und Exil. Zum Verständnis der Exildichtung Ovids. In: Antike und Abendland. Bd. 34. 1988. S. 144 - 157.
Fitton Brown, A. D.: The unreality of Ovid’s exile. In: Liverp. Class. Monthly. Vol. 10. 1985, S. 18 - 22.
Fränkel, Hermann: Ovid: A poet between two worlds by Hermann Fränkel. In: Sather
Classical Lectures. Vol. 18. University of California Press, Berkley, Los Angeles, 19451. Dt. Übersetzung: Ovid. Ein Dichter zwischen zwei Welten. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1970.
Froesch, Hartmut: Ovid als Dichter des Exils. Bouvier Verlag Herbert Grundmann, Bonn, 19761.
Harzer, Friedmann: Iste ego sum. Ovids poetische Briefschrift zwischen Dichtung und
Wahrheit. In: Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft. Bd. 29. Wilhelm Fink Verlag, München, 1997. S. 48 - 74.
Hofmann, H.: The unreality of Ovid’s Tomitian exile once again. In: Liverp. Class. Monthly. Vol.: 12. 1987. S. 23.
Holzberg, Niklas: Ovid. Dichter und Werk. C. H. Beck Verlag, München, 1997.
Kettemann, Rudolf: Ovids Verbannungsort - ein locus horribilis. In: Ovid. Werk und
Wirkung. Festgabe für Michael von Albrecht zum 65. Geburtstag. Teil I und II Hrsg.
Schubert, Werner. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/New York/ Paris/ Wien, 1999. In: Studien zur klassischen Philologie. Bd. 100. S. 715 - 735.
King, Richard J.: Ritual and Autobiographie: The Cult of Reading in Ovid’s Tristia 4.10. In: Helios. A Journal Devoted to Critical and Methodological Studies of Classical Culture,
Literature, and Society. Bd. 25, Nr. 2. Texas Tech University Press. Lubock, Texas, 1998. S. 99 - 119.
Little, D.: Ovid’s Last Poems: Cry of Pain from Exile or Literary Frolic in Rome? In: Prudentia. A journal devoted to the thought, literature and history of the Ancient World. Bd. 22. Heft 1. 1990. S. 23ff.
Nagle, Betty Rose: The poetics of exile. Program and polemic in the Tristia and Epistulae ex Ponto of Ovid. In: Latomus. Revue d ’ É tudes Latines. Bruxelles, 1980.
Nicolai, Walter: Phantasie und Wirklichkeit bei Ovid. In: Antike und Abendland. Bd. 19. 1973. S. 107 - 116.
Orbis Latinus. Hrsg.: Hubert Reitterer und Kurt Smolak. Bd.7.: Ovid. Auswahl. Textband. Hrsg.: Johannes Divjak und Christine Ratkowitsch. Verlag Hölder - Pichler - Tempsky; Wien; 1993. 1988 1. S. 6ff. und S. 92.
Richmond, John E.: The Latter Days of a Love Poet: Ovid in Exile. In: Classics Ireland. Bd. 20. University College Dublin, Ireland, 1995. S. 97 - 120.
Rosenmeyer, Patricia A.: Ovid’s Heroides and Tristia: voices from exile. In: Ramus. Critical Studies in Greek and Latin Literature. Bd. 26. Clayton, Victoria, 1997. S. 29 - 56.
Schmitzer, Ulrich: Ovid, Leben und Werk. Eine Einführung anhand der Elegie Tristia 4.10. In: Beiträge zur Gymnasialpädagogik. Referendarvertretung im Bayrischen Philologenverband. München, 1994.
Stirrup, Barbara E.: Ovid: Poet of imagined Reality. In: Latomus. Bd. 40. 1981. S. 88 - 104.
8.2 Kommentare.
Luck, Georg: Ovidius Naso, Tristia. Bd. II. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1977. S. 265 - 276.
de Jonge, Th. J.: Publii Ovidii Nasonis Tristium Liber IV Commentario Exegetico Instructus. De Waal. Groningen, 1951. S. 190 - 221.
Kommentar zum Orbis Latinus. Bd. 7. (s.o.). S. 115 - 121.
[...]
1 Vgl. Schmitzer, Ulrich: Ovid, Leben und Werk. Eine Einführung anhand der Elegie Tristia 4.10. In: Beiträge zur Gymnasialpädagogik. Referendarvertretung im Bayrischen Philologenverband. München, 1994. Schmitzer zieht nach dieser Einleitung schon den Schluss, dass sich Ovid dem römischen Kaiser Augustus ebenbürtig fühlt und Parallelen zwischen des Dichters und des Herrschers Leben klar sind.
2 Am.1.1. V.3.
3 Vgl. Schmitzer. S. 31. Anm. 184: „[...] Erstaunliches ergibt der Vergleich mit met. 14,325: Picus, der als Augustusenkel Gaius Caesar identifizierbar ist, hat ein Alter von fünf Olympiaden, also genau die Hälfte der Olympiaden Ovids: Sollte sich Ovid auch im Exil in Beziehung zu Gaius Caesar setzen, auf dessen Erfolg er bis zu dessen Tod seine Hoffnung gesetzt gebaut (sic!) hatte? Das läßt sich paraphrasieren: ‚Ich hatte doppelt so viele Olympiaden wie Gaius hinter mich gebracht, als mich ein vergleichbarer Schicksalsschlag (beide durch Livia und Tiberius verursacht) traf - das ist die causa nimium cunctis cognita ruinae meae. ’ Damit ist auch die ungewöhnliche Länge der Olympiade zu erklären.“
4 Als Euphemismus in zweierlei Hinsicht: a.) ist das Schwarze Meer von den Dardanellen aus betrachtet oft sehr stürmisch und b.) hieß das Meer bei auf persisch: „achsaina“ (schwarzblau), was man als griechisch αξενο übernahm. Da aber die Griechen aus Aberglauben solche negativen Ausdrücke scheuten, wurde daraus: ευξενο .
5 Vgl. Schmitzer, S. 32.
6 Eine ganz andere Sicht vertritt Ehlers, Widu-Wolfgang. Vgl. dazu Kapitel 4.3.
7 Trist. 4.10. V. 109ff.
8 Trist. 5.3.7.; 3.4.47.; 3.11.8.; 2.190.
9 Trist. 3.10.15f.
10 Trist. 3.10.23ff.
11 Georgica. 3, 350 - 390.
12 Trist. 5.7.45.
13 Trist. 5.10.37f.
14 Trist. 4.10.113.
15 Trist. 3.9.
16 Vgl. Kettemann. S. 731. Auch die folgenden Angaben zum Klima sind diesem Aufsatz entnommen.
17 Solinus 21.3 (ed. Mommsen); nach Kettemann: „[...] Moesia [die römische Provinz in der Dobrudscha. Anm.], quas maiores nostri iure Cereris horreum nominabant.“
18 Ehlers, Widu-Wolfgang: Poet und Exil. Zum Verständnis der Exildichtung Ovids. In AuA. Bd. 34. 1988. S. 144 - 157. Er sieht in Trist. 2. 27 - 206. ein Schuldgeständnis Ovids. Für Ehlers steht also die Rechtmäßigkeit der Strafe außer Frage, weil sie ja auch Ovid in jener Stelle als gerecht und mild bezeichnet hat.
19 Vgl. Ehlers: S. 151.
20 Vgl: Holzberg, Niklas: Ovid. Dichter und Werk. C. H. Beck Verlag, München, 1997. Diese Übersetzung von „lusor amarum“ wird auf S. 187 vorgeschlagen.
21 Diese Ansicht rührt wohl aus der Mittelschule her, wo eben genau jene Auffassung gelehrt wird. Vgl.: Orbis Latinus. Hrsg.: Hubert Reitterer und Kurt Smolak. Bd.7.: Ovid. Auswahl. Textband. Hrsg.: Johannes Divjak und Christine Ratkowitsch. Verlag Hölder - Pichler - Tempsky; Wien; 1993. 1988 1. S. 6f.
22 Fitton Brown, A. D.: The unreality of Ovid’s exile. In: Liverp. Class. Monthly. Vol.: 10. 1985, S. 18 - 22. und Hofmann, H.: The unreality of Ovid’s Tomitian exile once again. In: Liverp. Class. Monthly. Vol.: 12. 1987. S. 23. Beide nach: Ehlers.
23 Vgl.: Claassen, Jo-Marie: Ovid’s Poems from Exile.The Creation of a Myth and the Triumph of Poetry. In: AuA. Bd. 34. 1988. S. 158 - 169.
24 Vgl. Holzberg. S. 181ff.
25 erste Richtung: s.o. Kap.: 5.2.1.
26 Vgl. Kettemann. U.a. S. 735.
27 King, Richard J.: Ritual and Autobiography: The Cult of reading in Ovid’s Tristia 4.10. In: Helios. Vol. 25. No. 2. 1998. S. 99 - 119.
28 King: S. 116f.
- Arbeit zitieren
- David Kammerlander (Autor:in), 2001, Elegische Fiktion und historische Überlieferung in Ovids Tristia 4.10, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105643
Kostenlos Autor werden


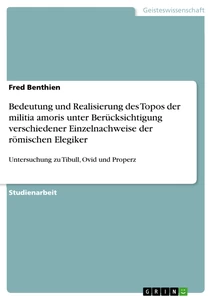
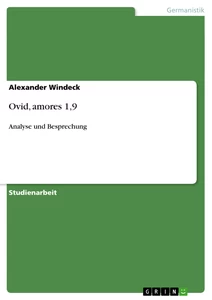





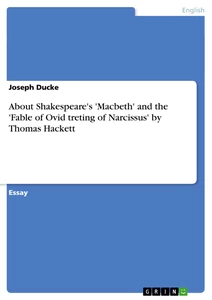


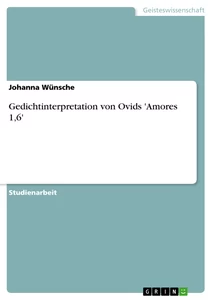
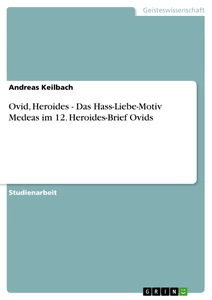


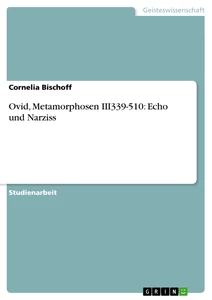





Kommentare