Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I.Skizze einer Theorie der Dekonstruktion
Revision der Differenz von Objekt- und Metasprache -- Perspektivenwechsel -- Logo-
bzw. Phonozentrismus -- Unterordnung der Schrift -- Dfferentieller Charakter der Sprache
-- Gute und schlechte Schrift -- Différance -- Spuren -- Überschreiten des Sinnzusammen- hangs -- Dekonstruktion vs. Hermeneutik -- Unlesbare Texte -- Primäre Rhetorizität -- Agnosie
II. Dekonstruktion in der Literaturdidaktik ..
Zur Konzeption Waldmanns -- Zur Konzeption Försters -- Zur Konzeption Spinners --
Zur Konzeption Fingerhuts -- Zur Konzeption Kammlers -- Didaktische Dilemmata
Anmerkungen
Einleitung:
Über die Art und Weise des Umgangs mit literarischen Texten wird nach wie vor trefflich gestritten. Gerade in der akademischen Diskussion dauert die Auseinandersetzung um adäquate Formen der Textauslegung an. Dabei tritt ein äußerst heterogenes Spektrum an Diskursen zutage, welches von literaturgeschichtlichen über (historisch-)diskursanalytische, psychoanalytische, semiotische, konstruktivistische bis hin zu systemtheoretischen Ansätzen reicht.1
Diese Pluralisierung innerhalb der Literaturwissenschaft hat mithin dazu beigetragen, dass eine Reihe differenter Sprech- bzw. Schreibweisen über Literatur miteinander koexistieren und kontrastieren, die mitnichten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Konnte man seit 1945 zunächst die wechselnde Dominanz unterschiedlicher Diskurse feststellen - die sog. werkimmanente Interpretation wurde von ideologiekritischer bzw. rezeptionsästhetischer Textauslegung abgelöst -, so läßt sich gegenwärtig geradezu eine Nivellierung der verschiedenen Traditionslinien erkennen, die nicht selten einen Cross-Over eigentlich disparater Arten der Textbearbeitung zeitigt.2 Eine dogmatisch durchgehaltene Methodologie ist häufig (trotz bisweilen anders lautendem Selbstverständnis einzelner Interpreten) einer Vermischung diverser Ansätze in der Praxis gewichen. Somit wird der Komplexität literarischer Artefakte insofern Rechnung getragen, als die Verschränkung verschiedener Diskurse zu einem differenzierteren Bild des Textes führen kann, indem sich die komplementären Perspektivierungen gegenseitig ergänzen. Nach diesem - wenn auch uneingestandenem - Pragmatismus wird in jüngster Zeit immer häufiger verfahren.
Was sich unter der Maxime von der ‘Freiheit der Wissenschaft’ als unproblematisch darstellt, wird unter dem Rechtfertigungsdruck der gesellschaftlichen Institution Schule möglicherweise zum Problem. Die Kultusbehörden sehen sich mit der Aufgabe konfrontiert, verbindliche Leitlinien für den Literaturunterricht im Fach Deutsch zu formulieren. Die Vielfalt literaturdidaktischer Ansätze mit ihren multiplen Zielsetzungen muß folglich in einer Weise selegiert werden, dass sich ein einigermaßen konsistenter curricularer Rahmen daraus ableiten läßt. Die Literaturdidaktik ist ihrerseits sowohl den schulischen Gegebenheiten verpflichtet als auch an einer Verknüpfung von pädagogischem Know-How und literaturwissenschaftlicher Theorie interessiert. Letzteres trägt somit insb. dazu bei, dass die Konfliktträchtigkeit heterogener Diskurse in die didaktische Modellierung des Literaturunterrichts Einzug hält.3 Die Hegemonie eines bestimmten Paradigmas gehört damit wohl der Vergangenheit an. So begrüßenswert diese Entwicklung zunächst erscheinen mag, sie birgt dennoch die Gefahr der Beliebigkeit: Da die Illusion einer konsensualen Konzipierung von Richtlinien zu recht aufgegeben wurde, könnten diese zum Sammelsurium diverser Diskursmodelle werden, aus denen sich jeder Deutschlehrer nach Gutdünken bedienen und seine persönliche Didaktik/Methodik damit rechtfertigen kann. Die viel beschworene Vergleichbarkeit der Leistungen von Schülern würde somit diskreditiert, der Allgemeinbildungsanspruch der Schule aufgegeben.
Will man eine solche desorientierende Diffusion vermeiden und zu einer reflektierten Auseinandersetzung (zurück)finden, ist es m.E. unabdingbar sich in einem ersten Schritt über die grundlegenden Theorien, die die Textwissenschaften bereitstellen, Rechenschaft abzulegen, wobei insb. diejenigen ins Zentrum der Betrachtung gestellt werden sollten, die sich der Literatur widmen. Der Literaturdidaktik obliegt es sodann, in einem weiteren Schritt die Vermittlerrolle zwischen der ‘Wissenschaft im Elfenbeinturm’ und der schulischen Praxis wahrzunehmen. Bevor eine Transposition - und das meint immer auch Modifikation - der ‘reinen Lehre’ in didaktische Konzepte gelingen kann, müssen zunächst ihre theoretischen Fundamente bloßgelegt werden; erst dann läßt sich prüfen, ob sich jene literaturwissenschaftlichen Begründungszusammenhänge als für unterrichtliche Belange geeignet heraustellen könnten bzw. ob sie sich für eine Fortentwicklung praxisorientierter Literaturdidaktik als fruchtbar erweisen.4
Dieser zweiphasigen Entfaltung didaktischer Argumentation soll auch diese Arbeit folgen. Zunächst soll ein literaturwissenschaftliches Diskursmuster erläutert werden, nachfolgend seine mögliche Didaktisierung diskutiert werden und schließlich die prinzipiellen Auswirkungen auf den Literaturunterricht gemäß der zuvor erarbeiteten Prämissen erwogen werden.
Einleitend sei angemerkt, dass die Reflexion über jene hier verhandelte Provokation einer postrukturalistischen Position, die vom Philosophen Jacques Derrida mit dem Namen Dekonstruktion versehen wurde, in der Bundesrepublik lange Zeit vermieden oder sogar verschwiegen wurde.5 Die Auseinandersetzung über Dekonstruktion hat sich erst jüngst mit vermehrtem Interesse Bahn gebrochen und ist immernoch weit davon entfernt, zum Normalfall literaturwissenschaftlicher/-didaktischer Beschäftigung geworden zu sein (wie es bspw. im angloamerikanischen Raum der Fall ist). Diese Verzögerung bringt es mit sich, dass gerade die didaktischen Bezugnahmen relativ spärlich sind sowie im ganzen auf eher pragmatischen oder strategischen Beschreibungen von Dekonstruktion fußen. Diesem Umstand zufolge werden die in dieser Arbeit vorgestellten didaktischen Konzeptionen auf ihre Theoriekompatibilität hin untersucht werden müssen. Nichtdestotrotz soll der Versuch unternommen werden, die didaktischen Annäherungen an eine Theorie der Dekonstruktion im Hinblick auf die Situierung dekonstruktiver Einsichten oder Lektüren im Schulunterricht kontrovers zu diskutieren.
I
„Die Dekonstruktion wird je nachdem ganz verschieden präsentiert: als philosophische Position, als politische oder intellektuelle Strategie oder als ein bestimmter Modus der Lektüre“, schreibt Jonathan Culler in seinem Buch über poststrukturalistische Literaturtheorie.6 So verwirrend dieses Konglomerat an Aspekten zunächst auch erscheinen mag, es deutet bereits auf unterschiedliche Momente hin, die einer Dekonstruktion inhärent sind: Zum einen wird qua Dekonstruktion eine Art theoretischer Standpunkt markiert; zugleich wird herausgestellt, dass die Wahl desselben eine strategische ist. Zum anderen wird darauf verwiesen, dass Dekonstruktion als eine Lektüre praxis zu verstehen ist, die bestimmte Lesarten zutage fördert.
So weit, so trivial - schließlich läßt sich über nahezu alle gängigen Literaturtheorien sagen, dass sie (explizit oder implizit) vor einem i.w.S. philosophischen Hintergrund operieren, welcher diese gleichsam präfiguriert.7 Deren Axiome beeinflussen wiederum wesentlich die Auslegungsmöglichkeiten/-weisen von (literarischen) Texten. Der Theorie-Praxis-Dualismus wäre also wieder einmal bestätigt, die hierarchische Trias Metatheorie (resp. ‘Weltbild’/Universalien) - (bereichsspezifische) Theorie - Praxis (als objektbezogene Anwendung der Theorie) wäre sichergestellt.
In analoger Weise strukturiert Dietrich Naumann die unterschiedlichen Reflexionsstufen des literaturwissenschaftlichen Diskurses: „Die Literaturwissenschaft und als ihr zentraler Bestandteil die Interpretation [(Methode)] spricht [...] ü ber Literatur [(Objekt)]. Die Wissenschaftstheorie bzw. literaturwissenschaftliche Methodologie spricht [...] ü ber die Wissenschaften bzw. die literaturwissenschaftlichen Tätigkeiten. Und metametatheoretisch kann man natürlich auch ü ber den Status der Wissenschaftstheorie sprechen.“8
Legt man einer Wissenschaftskonzeption ein solches Raster zugrunde, dann lassen sich die aufgezeigten Ebenen relativ klar voneinander isoliert halten. Dies hätte mithin zur Konsequenz, dass zwar die jeweils ‘höherrangigen’ Theoreme (nämlich diejenigen auf der entsprechenden Meta ebene) ihr jeweiliges Objekt (sei es der Untersuchungsgegenstand Literatur selbst, sei es die literaturtheoretische Methodologie) subordinieren, dass diese (Meta-)Theoreme jedoch ihrerseits von den spezifischen Gegenständen unabhängig sind. So bestimmt der gewählte literaturtheoretische Ansatz die Lesart eines Textes, der bestimmte Text modifiziert aber nicht seinerseits (immer aufs neue) die theoretischen Grundüberzeugungen des (akademischen) Interpreten.9 Schließlich ist die Praxis der wissenschaftlichen
Textauslegung, immer rückgekoppelt an die sie legitimierende Theorie, welche einen mehr oder minder universellen Anspruch erhebt.
Folgt man den „Denkrichtung[en]“10 dekonstruktiv verfahrender Theoretiker - insb. des Philosophen Jacques Derrida und des Literaturwissenschaftlers Paul de Man -, so wird klar, dass ihre Schriften nicht nach einem im bereits skizzierten Sinne arbeitenden Diskursmuster organisiert sind. Zwar bedienen sie sich einer - teils traditionellen, teils innovatorischen - Terminologie, und sie vetreten auch gewisse Standpunkte. Dennoch scheinen sie, einer vereinheitlichenden (Meta-)Theorie sowie der damit verbundenen Methodologie gegenüber eher abgeneigt zu sein:11 Zum einen würden diese nämlich eine totalisierende Inanspruchnahme von Texten bedeuten, zum anderen müssten sie eine eindeutige Unterscheidung zwischen Meta sprache (wissenschaftliche Begrifflichkeit) und Objektsprache (z.B. Literatur) ermöglichen. Ersteres ist jedoch - wie noch darzulegen sein wird - mit den theoretischen Prämissen der genannten Wissenschaftler unvereinbar; letzteres ließe sich allenfalls dekretieren, womit aber jedwedes Universalisierungsbestreben bereits vom Ansatz her aufgegeben werden müsste. Denn der im Duktus der Text theorie formulierte Text müsste sich auch auf sich selbst anwenden lassen, womit desgleichen behauptet würde, dass er seine theoretischen Fundamente tautologisch in sich selbst fände. Damit wäre er freilich sowohl meta- als auch objektsprachlich konstituiert, wodurch es - zumindest in diesem Falle - unmöglich wäre, trennscharf zwischen diesen beiden Zuordungen zu unterscheiden. Um dieser paradoxen Struktur der Selbstreferenz12 zu entgehen, wird - unter Absehung von der medialen Gleichartigkeit von Texten - eine pragmatische Einteilung, deren Kriterium einzig eine letztenendes willkürliche Setzung darstellt, in metasprachlich literaturwissen- schaftliche Texte und objektsprachlich literarische Texte vorgenommen. Diese Form der Kategorisierung läßt sich aber nur durch Preisgabe des Objektivitätsanspruchs leisten.13
Überdies ließe sich zeigen, dass in theoretischen Zusammenhängen verwendete Termini zur Beschreibung sprachlicher Einheiten, wie z.B. Metapher oder Begriff, einstmals selbst der sog. Objektsprache entnommen worden sind. Hierzu müsste man lediglich ein wenig Etymologie betreiben. Diesem Umstand verdankt es sich, dass aller sog. metasprachlicher Begrifflichkeit der ‘Makel’ des eigentlich immer schon Metaphorischen, will sagen: des bereits Ü bertragenen, anhaftet.14 Derrida führt hierzu aus:
Jede Aussage, gleichgültig über welches Thema - also auch jede Aussage über die Metapher selbst
-, wird sich ohne Metapher nicht bilden lassen, wird nicht ohne Metapher auskommen. Keine Meta- phorik, keine Lehre von der Metapher, keine Metametapher wird beständig genug gewesen sein, um diese Aussagen zu beherrschen.15
Sobald die Rhetorik die Metapher bestimmt, enthält sie nicht nur eine Philosophie, sondern ein be- griffliches Netz, in dem sich die Philosophie gebildet hat. Jeder Faden bringt in diesem Netz zusätzlich eine Windung (tour) hervor, die man Metapher nennen könnte, wenn dieser Begriff hier nicht zu hergeleitet wäre. Das Bestimmte ist also im Bestimmenden der Bestimmung enthalten.16
Die Begriffe Begriff, Grund, Theorie sind metaphorisch und widersetzen sich jeglicher Meta-Meta- phorik. [...] Dem Begriff des Begriffs [...] wird immer, auch wenn er sich darauf nicht reduzieren läßt, das Schema der Geste des Beherrschens anhaften, das Jetzt-Greifen, Begreifen und Ergreifen der Sache als Objekt.17
Da auch die Sprache des Theoretischen und Abstrakten je schon Resultat eines Übertragungsprozesses ist, lässt sie sich nicht prinzipiell ü ber eine als literarisch oder poetisch definierte Sprache stellen.18 Ihre Differenz scheint nur ein Effekt der konventionalen Zuschreibung von unterschiedlichen Bedeutungen/Funktionen zu sein.19
Naumann insistiert in diesem Zusammenhang auf der pragmatistischen Dimension von solchen Kategorisierungsversuchen, indem er hervorhebt, dass dabei nicht das Ideal der Wahrheit als Ziel der Bemühungen angesehen werde, vielmehr sei es wesentlich, was ein solches System leiste; „und die Einschätzung dieser Leistung ist abhängig davon, welche Aspekte des Gegenstandsbereichs man für relevant hält. Daher das wissenschaftliche Spiel permanenter expliziter und impliziter Umdefinitionen, von Begriffserweiterungen und Begriffsverengungen, wechselnden Identifikationen und Differenzierungen.“20
Weil die traditionsdominierenden Denkschulen vielfach auf ein Telos der Erkenntnis hin orientiert sind, erscheint die Wissenschaftssprache in ihnen oft als wohldefiniertes System, in welchem die Irrtümer der Vergangenheit begrifflich überwunden sind und das nur noch der Fein jus tierung bedarf. Die Diskursgeschichte lagert ihre Sedimentationen21 ab, welche in ihrer jüngsten Formation das Fundament der aktuellen Wissenschaftsprache bilden. Nach diesem Modell einer sukzessiven Approximation schichtet22 und mehrt sich damit der epistemische Gehalt des systematisch Erfassten. Man könnte - um im Bild zu bleiben - sagen, dass man sich gerade dann auf (wissenschaftlich) sicherem Grund23 bewegt, wenn die darunterliegenden diskursgeschichtlichen Ablagerungen sich ausreichend verfestigt haben. Der einzig statthafte Standpunkt, von dem aus alles ü ber sehen24 werden kann, ist auf dem Gipfel des angehäuften Wissens.
Ohne die geologische Metaphorik weiter strapazieren zu wollen, bleibt festzuhalten, dass derartige Denkschulen nahezu immer von einem festgefügten Standort aus operieren, der sich zumeist nur graduell verschiebt, nämlich dann, wenn neue Wissensbestände akkumuliert worden sind, die eine Korrektur des Blickwinkels nötig machen. Anders hingegen die Dekonstruktion, sie ist von einem permanenten Perspektivenwechsel gekennzeichnet. Heinz Kimmerle schreibt - am Beispiel Derridas - hierzu:
Die Perspektive, von der aus Derrida denkt, ändert sich ständig. Sie wird mitbestimmt vom Gegen- stand, um den es geht. Sie hat sich verändert, wenn die Dekonstruktion dieses Gegenstandes stattgefunden hat. Die Dekonstruktionen gehören mit zu der Bewegung, die sie konstituieren. Es gibt keinen festen Orientierungspunkt außerhalb ihrer.25
Folglich ist die Dekonstruktion immer an den (Kon)Text gebunden, in/an/mit dem sie sich vollzieht. Trotz dieser Relationalität ändert der dekonstruktive Text ständig die Perspektive auf seinen Gegenstand und damit die Lesart des behandelten26 Textes. Die „Heterogenität des Textes“27 wird dadurch offenbar, wodurch zugleich die Unmöglichkeit, Wahrheit zu textualisieren, gezeigt wird.
Die Dekonstruktion verfügt über keine bessere Wahrheitstheorie. Sie ist Praxis der Lektüre und der Schrift, die auf die Aporien eingestimmt ist, die sich aus den Versuchen ergeben, uns die Wahrheit zu erzählen. Sie entwickelt keinen neuen philosophischen Rahmen und bietet keine Lösung, sondern pendelt mit einer Gewandtheit, von der sie hofft, daß sie sich als strategisch erweisen wird, zwischen nicht synthetischen Momenten einer allgemeinen Ökonomie.28
Somit stellt Dekonstruktion kein epistemologisches Projekt dar; sie erweist sich letztlich als erkenntniskritisch. Die damit verbundene Skepsis gegenüber jedweder Form von Text als Erkenntnismittel/-medium findet ihre Begründung v.a. in den metaphysikkritischen und sprachtheoretischen Annahmen Derridas. Diese sollen nachfolgend - in gebotener Kürze - erläutert werden.
Wie u.a. Bettine Menke - im Anschluß an Derrida - herausstellt, ist für das abendländische Denken das „Ideal des sich selbst vollständig präsenten Sinns“29 charakteristisch:
Die Sprache und die Texte werden nicht nur von der Philosophie, sondern auch in Modellen der Li- teratur dem Primat der Wahrheit, eines Sinns, den sie zu sagen haben, unterstellt. Die Verpflichtung der Sprache auf einen Sinn soll das ‘Heilsein’, die Reinheit, die Identität der Wahrheit sichern.30
Um den Wahrheitsanspruch von Texten garantieren zu können, bedarf es aber der Instanz eines Logos, die den unmittelbaren Sinn der Worte gegenwärtig hält. Diese Anwesenheit des Sinns setzt aber die gleichzeitige Präsenz des Bedeuteten in der Sprache voraus. Diese Statuierung primärer Inhaltlichkeit im sprachlichen System und die damit einhergehende Idealisierung desselben bezeichnet Derrida als Logozentrismus. Dieser ist jedoch in der abendländischen Geistesgeschichte (von Platon über Hegel bis zu Husserl) als „Selbstrepräsentation des Sinns“31 zumeist mit der mündlichen Äußerung verknüpft:
Das Wesen der phone [...] stünde unmittelbar dem nahe, was im „Denken“ als Logos auf den „Sinn“ bezogen ist, ihn erzeugt, empfängt, äußert und „versammelt“ [...], weil die Stimme als Erzeuger der ersten Zeichen wesentlich und unmittelbar mit der Seele verwandt ist. Sie bezeichnet den „Seelenzustand“, der seinerseits die Dinge in natürlicher Ähnlichkeit widerspiegelt und reflektiert. Zwischen dem Sein und der Seele, den Dingen und den Affekten bestünde ein Verhältnis natürlicher Übersetzung oder Bedeutung; zwischen der Seele und dem Logos ein Verhältnis konventioneller Zeichengebung. Die erste Konvention, welche ein unmittelbares Verhältnis zu der natürlichen und universalen Bedeutung hatte, entstünde als gesprochene Sprache.32
Die Selbstgewißheit über den Sinn des Verlautbarten im S ’ entendre-parler begründet somit zugleich einen Phonozentrismus, „um mit der Transparenz des Ausdrucksmediums die Bedeutung und Wahrheit der Sätze zu garantieren“33. Da diese im schriftlichen Text - in Ermangelung der Gegenwärtigkeit eines Subjekts34 - nicht gewährleistet ist, erscheint das Medium Schrift dem ‘sinnerfüllten’ Sprechen untergeordnet:
Wenn Distanz, Abwesenheit, Mißverständnis, Unredlichkeit und Ambiguität Aspekte der Schrift sind, kann man durch die Gegenüberstellung von Schrift und Rede ein Kommunikationsmodell konstruieren, dessen Norm ein an der Rede orientiertes Ideal ist - in dem die Worte Träger von Bedeutungen sind und der Zuhörer das, was der Sprecher meint, im Prinzip präzise erfassen kann.35
Folglich wird innerhalb des dualen Schemas Sprache zwischen einer privilegierten mündlichen Rede und einer dieser gegenüber geradezu parasitären Schrift unterschieden.
Diese Differenzierung wird auch vom Linguisten Ferdinand de Saussure beibehalten, der im Cours de linguistique générale behauptet:
Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen: das letztere besteht nur zu dem Zweck, um das erstere zu repräsentieren.36
Nicht die Verknüpfung von geschriebenem und gesprochenem Wort ist Gegenstand der Linguistik; sondern [...] das gesprochene Wort allein ist ihr Objekt.37
Durch die Priorität der mündlichen Rede wird die Schrift zum bloß Abgeleiteten degradiert. „Die Schrift wird [...] die äußerliche Repräsentation der Sprache und des
‘Laut-Gedankens’. Sie wird notwendig von bereits konstituierten
Bedeutungseinheiten ausgehen und mit ihnen arbeiten müssen, doch hat sie an deren Herausbildung keinen Anteil gehabt.“38 So resümiert Derrida die Position Saussures. Sie bildet zugleich die Voraussetzung für die Dualität des Saussureschen Zeichenbegriffs, die ‘Zweifaltigkeit’39 von Bezeichnendem und Bezeichnetem. Diese werden terminologisch als Signifikant (Lautbild, das für den Ausdrucksaspekt eines Zeichens steht) und Signifikat (Konzept/Vorstellung, das letztlich für den Inhaltsaspekt eines Zeichen steht) gefasst. Es gibt also hinter dem „materiellen Zeichenträger“ (Signifikant) immer eine „mentale (ideelle) Bedeutung“ (Signifikat).40 Beide sind miteinander gekoppelt.
Wie läßt sich nun aber die Bedeutung eines Zeichens ausmachen ?
Saussure argumentiert, dass einzig der differentielle Charakter die Zeichen voneinander unterscheidbar macht. Das System der langue stellt eine endliche Menge an voneinander verschiedenen Zeichen (z.B. Haus, Maus, Nikolaus, aus usw.) bereit, welche eine ebensolche Menge an Bedeutungen beinhalten. Die Identität eines Zeichens - samt seiner Bedeutung - wird erst ex negativo durch seine Differenz von allen anderen Zeichen hergestellt.41 Zusammengenommen bilden diese die Struktur des jeweiligen Sprachsystems - einer Struktur ohne Zentrum42 freilich, denn jedes Zeichen bezieht sich distinktiv auf alle anderen.
Das bisher Gesagte heißt, anders ausgedrückt, daß die Bedeutung in einem Zeichen nicht unmittelbar präsent ist. Da die Bedeutung eines Zeichens davon abhängt, was es nicht ist, ist seine Bedeutung immer auch in bestimmten Sinne abwesend. Bedeutung ist [...] der ganzen Signifikantenkette entlang verstreut oder verteilt; sie kann nicht so leicht festgenagelt werden und ist niemals in einem Zeichen alleine vollständig präsent, sondern stellt mehr eine Art konstantes Flackern von gleichzeitiger An- und Abwesenheit dar.43
Aus dieser Komplikation ergibt es sich, „daß es Bedeutung als solche nicht ‘gibt’, weil jedes Signifikat in die ‘ Bewegung des Bedeutens’, deren Effekt es ist, erneut als Signifikant zurückgestellt werden muß“, wie Menke die derridasche Radikalisierung der Semiologie Saussures zusammenfasst.44
In dieser „Zersetzung der Sinnpräsenz“45 im differentiellen Spiel der Sprache wird aber die potentielle Polysemie der mündlichen Rede der Vieldeutigkeit der schriftlichen Äußerung gleichgestellt.46 Derrida zeigt mit seiner Saussure-Lektüre, dass - obwohl Saussure an der Abwehr des Mediums Schrift festzuhalten versucht - der Schweizer Linguist dennoch nicht umhin kann, die Arbitrarität und Differentialität des sprachlichen Zeichens am Beispiel der Schrift vorzuführen, da „man die gleichen Verhältnisse in einem anderen Zeichensystem, nämlich der Schrift feststellen kann“.47 Die Konsequenz die Derrida daraus ableitet, ist folgende:
Da die Differenz niemals an sich und per definitionem eine sinnlich wahrnehmbare Fülle ist, wider- spricht ihre Notwendigkeit der Behauptung einer von Natur aus lautlichen Wesenhaftigkeit der Sprache. Zugleich aber stellt sie die angeblich natürliche Abhängigkeit des graphischen Signifikan- ten in Frage.48
In gewisser Weise sind also gesprochene Sprache und Schrift Zeichensysteme gleichen Typs, die voneinander unabhängig gedacht werden können. Das genealogische Rückbezogensein der alphabetischen Schrift auf die Lautsprache kann nicht mehr als Argument für das Primat der Mündlichkeit gelten. Ohne die äußerst komplexe Argumentation Derridas (ob nun im einzelnen zutreffend oder nicht) an dieser Stelle nachzeichnen zu können,49 soll hier nur auf einen der Zielpunkte seiner subversiven Strategie hingewiesen werden: die Neuformulierung des Schriftbegriffs. Im Rekurs auf die geistesgeschichtlich logozentristische Bedeutung der Schrift schreibt er:
Die Schrift im geläufigen Sinn ist toter Buchstabe, sie trägt den Tod in sich. Sie benimmt dem Leben den Atem. Auf der anderen Seite aber wird die Schrift im metaphorischen Sinn, die natürliche, gött- liche und lebendige Schrift verehrt; sie kommt an Würde dem Ursprung des Wertes, der Stimme des Gewissens als göttlichem Gesetz, dem Herzen, dem Gefühl usw. gleich. [...] Die natürliche Schrift ist unmittelbar an die Stimme und an den Atem gebunden. Ihr Wesen ist [...] pneumatolo- gisch. Sie ist hieratisch, ganz nahe der heiligen inneren Stimme [...]: die erfüllte und wahrhafte Prä- senz des göttlichen Wortes in der Innerlichkeit unseres Gefühls. [...] Das Ur-Wort ist Schrift, weil es ein Gesetz, ein natürliches Gesetz ist. [...] Es gibt also eine gute und eine schlechte Schrift: gut und natürlich ist die in das Herz der Seele eingeschriebene göttliche Schrift; verdorben und künstlich ist die Technik, die in die Äußerlichkeit des Körpers verbannt ist. [...] Die gute Schrift ist also immer schon begriffen.50
Obwohl die Schrift einerseits als akzidentiell und unzuverlässig diskreditiert wurde, dient sie doch andererseits als Metapher für ein transzendentales Programm. In dieser Extension des Schriftbegriffs innerhalb der schriftlichen Überlieferung des okzidentalen Denkens - für die noch viele Beispiele anzuführen wären - erkennt Derrida die Ambivalenz desselben. Während die metaphysische Tradition aber die Duplizität des Schriftbegriffs durch eine interne Spaltung in eine (gute) Schrift des immer schon verstandenen logos und eine (schlechte) Schrift als Derivation der sinnerfüllten gesprochenen Sprache hierarchisiert, beharrt Derrida auf der disseminalen 51 Zeichenhaftigkeit beider. Er zeigt überdies, wie sehr der logozentrische Schriftbegriff von der Fiktion eines transzendentalen Ursprungs abhängig ist.52
Aus alldem folgert Derrida letztlich, „daß die gesprochene Sprache bereits dieser Schrift zuzuordnen ist“53, und versucht damit die traditionelle Linguistik im Projekt einer allgemeinen Grammatologie aufzulösen. Dies bedeutet jedoch mehr als eine (scheinbare) Umkehrung der tradierten Ordnung, wie Sarah Kofman ausführt:
Eine erste Geste kehrt die metaphysischen Hierarchien um, ‘vertauscht oben und unten’, indem sie einen der beiden Gegenpole [(Schrift/gesprochene Sprache)] - den von der Tradition am meisten in Mißkredit gebrachten - Allgemeinheit verleiht. Diese Geste wahrt den alten Namen, aber durch die Generalisierung, die sie mit sich bringt, verschiebt sie den Sinn. [...] Die andere Geste schreibt ent- weder den alten Namen von neuem in ein altes Spiel ein oder aber läßt einen neuen Begriff zutage treten, der sich nicht mehr [...] einer idealisierenden und sublimierenden Aufhebung unterziehen läßt.54
Durch diese doppelte Operation kollidiert die konsolidierte Ordnung mit dem von ihr Ausgeschlossenen und wird fundamental erschüttert55. Durch die Rückholung und Zentrierung des ‘Exkommunizierten’56 wird die ursprünglich interne Differenz wiederhergestellt. Zum ‘Signum’ dieser Differenz wird bei Derrida der Schrift zug 57: différance. Dieser ist für ihn „ à la lettre weder ein Wort noch ein Begriff“.58 Was es damit auf sich hat, soll im folgenden erläutert werden.
Derrida streicht zunächst die unhörbare Differenz zwischen der gängigen französischen Schreibweise différence und seinem ‘Kunstwort’ différance heraus, die durch die Ersetzung des Buchstaben e durch die Letter a 59 einen Effekt der Befremdung auslöst, der nur dem Lesenden zuteil wird. Dieses „schweigende[ ] Denkmal“60 bedeutet allerdings mehr als bloß Irritation. Es steht für die Komplexität der Schrift, die bereits eo ipso semantisch wirksam wird.
Das Einsetzen des Buchstaben a ruft gewissermaßen das Partizip Präsens (différant) zum französischen Verb différer auf und verweist damit - im Rückgriff auf das lateinische differre - auf den Doppelsinn des Verbs: nicht identisch (/anders) sein, aufschieben (verzeitlichen).61 Einerseits wird dadurch das aktive Moment der différance unterstrichen, andererseits läßt die Endung -ance in Analogie zu Wörtern wie „mouvance“ (Beweglichkeit) oder „résonance“ (Resonanz) im Französischen eine Unentschiedenheit zwischen Aktiv und Passiv erkennen, die der différance eigen ist.62 Sie ist damit „weder als Erleiden noch als Tätigkeit eines Subjektes, bezogen auf ein Objekt“63, zu denken. Ferner möchte Derrida die Bedeutung von différend als Widerstreit oder Meinungsverschiedenheit in der différance berücksichtigt wissen.64 Durch diesen (strategischen) Zug - so könnte man sagen - wird also die Bedeutung des ‘graphemischen Komplexes’ différance um zusätzliche Aspekte angereichert.
Wozu - kann man berechtigterweise fragen - vollführt Derrida derlei ‘Capriolen’ ? - Zunächst einmal versucht er zu zeigen, dass die Schrift als Zeichensystem auch ohne den Umweg über die gesprochene Sprache eigenständig bedeutungsbildend ist. Die nächste Folgerung wäre, „daß die bezeichnete Vorstellung, der Begriff, nie an sich selbst gegenwärtig ist. Jeder Begriff ist seinem Gesetz nach in eine Kette [...] eingeschrieben, worin er durch das systematische Spiel von Differenzen auf den anderen, auf die anderen Begriffe verweist.“65 Denn das ‘Schriftwort’ différance - was sowohl als Beispiel wie auch als ‘Signum’ für die allgemeine Differentialität fungiert - erlangt seine Bedeutung(en) erst im Spiel assoziativer Verknüpfungen. Überdies erweist sich diese differentielle Bedeutungszuweisung als Effekt. Denn die Differenzen „sind nicht in fertigem Zustand vom Himmel gefallen; sie sind ebensowenig in einen topos noetos eingeschrieben noch in der Wachstafel des Gehirns vorgezeichnet.“66
Wenn aber dieses Spiel von keinem einfachen Ursprung her gedacht werden kann, dann ist die darin arbeitende Differenz selbst ursprünglich.67 Somit gäbe es aber keinerlei Rückgriff auf eine primäre Präsenz. Diese würde immer wieder im gegenseitigen Verweisungszusammenhang der Signifikanten aufgehoben und aufgeschoben. Die „Enthüllung der Wahrheit als Darstellung der Sache selbst in ihrer Anwesenheit“ in den Worten - also die gesamte „Thematik der aktiven Interpretation“
- wird von Derrida deshalb „durch unaufhörliches Dechiffrieren ersetzt.“68
Der Modus dieses fortwährenden Dechiffrierens ist aber weder aktiv noch passiv, man müßte vielmehr sagen: das Spiel der différance passiert. Dieses permanente Sich-Ereignen vollzieht als „ Denken der Spur“69 eine Bewegung, die, wie Derrida behauptet, bei weitem die Möglichkeiten des ‘intentionalen Bewußtseins’ übersteigt.70 Diese Metapher der Spur deutet auf die verlorene Gegenwart der Bedeutung im sprachlichen Zeichen hin; „ihr entspricht die ‘befremdliche Struktur’ [...], die nachträglich erst das (ein angeblich ehemals Anwesendes) erzeugt, wovon sie angeblich bloß Spur ist.“71 Das ‘Wirken’72 der Spur ermöglicht allererst Bedeutungsbildung; Derrida schreibt vom „ seminalen Abenteuer der Spur“73. Die Bezeichnung „Abenteuer“ weist auf die Unwägbarkeit dieser Unternehmung hin. Als „Urphänomen des ‘Gedächnisses’, welches vor dem Gegensatz zwischen Natur und Kultur, Animalität und Humanität usw. gedacht werden muß“, ist die Spur nicht von einem Subjekt kontrollierbar.74
Der Mensch ist dem Spiel der différance ausgesetzt; es geschieht, ohne allerdings von einem vorgängigen Bewusstsein (vollkommen) regiert werden zu können.75 Bezogen auf die allgemeine Textualität mündlicher und schriftlicher Äußerungen bedeutet das aber nicht, dass es keine Gewissheiten über solche Texte geben kann. Denn das hieße ja zu bestreiten, dass es Annahmen über den Sinn76 von Texten überhaupt gibt, will sagen, dem Text Intentionen unterstellt werden. Derrida macht stattdessen die wesentliche Einschränkung, dass solche Gewissheiten gewissermaßen psychische Fiktionen sind, deren provisorischer Charakter77 sich im Spiel dekonstruktiver Lektüren erweisen wird.
[Derrida meint], man könne die Intention als einen besonderen Effekt des Textes ansehen, die durch die kritische Lektüre wohl herausdestilliert werden könne, die vom Text aber immerüberschritten werde.78
Diese unhintergehbare Überschreitung eines (wie auch immer) intendierten Sinnzusammenhangs wird von dekonstruktiv arbeitenden Theoretikern gegen eine vermeintliche Totalität der Textbedeutung (ein-)gewendet. Entgegen einer „reduktiv verfahrende[n] Sinnzuschneidungsstrategie“, die einen Zentralsinn im Text fixiert und das gesamte Textfeld daraufhin (ein-)ordnet,79 wird das in diesem Prozess Marginalisierte nicht als unwesentlich disqualifiziert, sondern mit seinem Konfliktpotential gegen eine synthetisierende Interpretation ins Spiel gebracht.80 Mit dieser Strategie wird „jegliche Form einer totalisierenden Zentralperspektive dementiert“81. Damit steht Dekonstruktion im Gegensatz zur traditionellen Hermeneutik82, die Harro Müller treffend zusammengefasst hat:
Hermeneutik [...] als Kunstlehre des Verstehens schriftlich fixierter Lebensäußerungen (Dilthey) läßt sich [...] von einem Strukturmodell leiten, das auf Ganzheit, Einheit, und durchgängigen Zusammenhang des Textes setzt. Modell für den hermeneutischen Verstehensakt ist nach Gadamer das Gespräch, Interpret und Text befinden sich in einer dialogischen Situation. Im Hin und Her des dialogischen Prozesses findet ein Aus- tausch von Differenzen statt, der freilich auf Kohärenz, Korrespondenz, Identität und sinnvolle Totalität abzielt. Interpretation funktioniert nach dem Frage-Antwort-Modell und verfährt nach den Vorgaben des hermeneuti- schen Zirkels, in dem zwischen Teil und Ganzem solange hin- und hergekreist wird, bis eine gegliederte To- talität sich hergestellt hat, die zumeist noch das Prädikat ‘ organisch ’ erhält [...]. / Dabei ist es wichtig zu se- hen, daß zu Beginn des hermeneutischen Verstehensprozesses weder Teil noch Ganzes feststehen [(sic!)], sondern im Laufe eines durchaus diskontinuierliche Bewegungen kennenden Erprobungsspieles fest gestellt werden müssen. Er hält erst ein, wenn die Einheit des Sinnes eindeutig fixiert ist. [...] Interpretation ist Technik und Kunst zugleich. 83
Die grundlegenden Diskrepanzen zwischen Hermeneutik und Dekonstruktion treten klar zutage: Während die Hermeneutik sich am Modell der gesprochenen Sprache, das am ‘lebendigen’ gegenseitigen Verstehen interessiert ist, orientiert, stützt sich die
Dekonstruktion auf ein Modell radikaler Textualität (des ‘Schriftlichen’). Während die Hermeneutik die Totalität des Sinns einfordert, favorisiert die Dekonstruktion das Herausarbeiten unversöhnlicher Differenzen. Während die Hermeneutik mit Wahrheits- oder zumindest Plausibilitätskriterien operiert, wird ein solches Vetrauen auf Gegenstandsadäquatheit und Stringenz des Textes durch Dekonstruktion fundamental in Zweifel gezogen. Während sich Hermeneutik mithin auch als Technik begreift, ist Dekonstruktion so vielfältig auszugestalten, dass sie in kein technisches Schema eingepasst werden kann ...
Die Reihe derartiger Gegensätze - oder besser: Polaritäten - ließe sich noch verlängern,84 aber das hieße nur, die Differenzen zwischen beiden Positionen in ein binäres Schema einzu fügen, das alle Interdependenzen ausschließt. Wie aber Müller aufgezeigt hat, ist einerseits Hermeneutik auf diskontinuierliche Bewegungen im Herstellen der Teil-Ganzes-Relation angewiesen; andereseits bezieht sich Dekonstruktion in negativer Weise auf die hermeneutisch postulierte ‘Sinneinheit’ im Text.
Dekonstruktive Lektüre zerbricht immer wieder den hermeneutischen Zirkel und schert aus dem Dialogmodell aus, ist aber bei der disjunktiven Verknüpfung von thematischer, ästhetischer und rhetorischer Lektüre auch auf ein Verfahren thematischer [d.h. hermeneutischer] Textanalyse angewiesen, muß also bei aller Präferenz von Detotalisierungsbewegungen auch immer unreine hermeneutische Totalisierungsbewegungen machen. [...] Insofern ist Dekonstruktion nicht strikt jenseits der Hermeneutik anzusiedeln, vielmehr ist Dekonstruktion u.a. auf hermeneutische Verfahren angewiesen, wie überhaupt Dekonstruktion als massive Form der Metaphysikkritik strukturell von metaphysischen Bewegungen in der Abkehrbewegung abhängig bleibt.85
Derrida hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Dekonstruktion unverzichtbar der „metaphysische[n] Komplizenschaft“ bedarf.86 Trotz dieser Überschneidungen ist ein Dialog zwischen den wohl prominentesten Vertretern von Hermeneutik und Dekonstruktion (Gadamer und Derrida) an unüberbrückten Missverständnissen gescheitert, was in der Dokumentation eines Symposiums am Goethe-Institut Paris mit dem Titel Text und Verstehen nachzulesen ist.87 Im Beitrag Manfred Franks zu dieser Debatte stellt dieser eingangs fest, „daß die beiden Standpunkte einander verdächtigen“88. Mit seiner Explikation einer zwischen hermeneutischer Position (im Anschluß an Schleiermacher) und - wie er es nennt - ‘neostrukturalistischen’ Position vermittelnden Konzeption spricht er auch über das Problem transparenter Kommunikation:
Es gibt kein dem Diskurs übergeordneten Ort, von dem aus semantische (bzw. veritative) Identität der Äußerung bezeugt werden könnte: beide Gesprächspartner entwerfen - in Gestalt „konjektura- ler Hypothesen“ (IF I, 56) - permanent die Einheit der Bedeutung dessen, worüber sie glauben einig geworden zu sein; aber sie tun es ohne die Gewißheit, darin Erfolg zu haben. Die Einheit der Bedeu- tung steht also in Frage. Sie scheint den Status einer regulativen Idee zu haben, auf die das Gespräch abzweckt, ohne ihre Verwirklichung denken zu können.89
Mit diesem nahezu pragmatistischen Standpunkt versucht Frank eine Brücke zwischen den Antipoden zu schlagen. Zwischen den widerstreitenden Überzeugungen lassen sich derlei Konnexionen jedoch nur unter Missachtung paradigmatischer Grundsätze - sofern man bezogen auf Dekonstruktion überhaupt von solchen sprechen kann -herstellen. Wenn bei Gadamer eine „Horizontverschmelzung“ von individuellen Bewusstsein und historischem Bewusstsein, das sich aus der Kontinuität der Wirkungsgeschichte speist,90 zum Text verstehen notwendig ist, dann lässt sich das mit der Position Derridas, die das „lineare Denken als Reduktion der Geschichte“91 aufweist, nur schwer konvergieren. Desweiteren stehen die Ansicht „Der Text muß lesbar [also verstehbar] sein“92 mit einem Behaupten der „Unmöglichkeit des Lesens“93 unvermittelbar im Widerspruch. Letzteres vertritt der dekonstruktiv verfahrende Literaturwissenschaftler Paul de Man. Er tritt - laut Peter V. Zima - für eine „Ethik des Lesens“ ein, die darin besteht, „daß der widersprüchliche, unlesbare Charakter des Textes erkannt und das Scheitern der Lektüre offen zugegeben wird und daß der Interpret darauf verzichtet, den Gegenstand seiner Untersuchung dem begrifflichen Diskurs seiner Theorie zu unterwerfen.“94 Diese Selbstverpflichtung ergibt sich aus der „Unentscheidbarkeit von Leseweisen, die sich widersprechen und aufeinander angewiesen sind“.95 De Man schreibt dazu:
Da welche Erzählung auch immer vornehmlich Allegorie ihrer eigenen Lektüre ist, ist sie in einem schwierigen double-bind befangen. Solange sie ein Thema behandelt (den Diskurs eines Subjekts, die Berufung eines Schriftstellers, die Bildung eines Bewußtseins), wird sie immer zu einer Konfron- tation unvereinbarer Bedeutungen führen, zwischen denen es nötig aber unmöglich ist, in Begriffen von Wahrheit und Irrtum zu entscheiden. Wenn eine der Lektüren für wahr erklärt wird, wird es stets möglich sein, sie mit Hilfe einer anderen zunichte zu machen; wenn sie für falsch gehalten wird, wird es allzeit möglich sein zu beweisen, daß sie die Wahrheit ihrer Abirrung konstatiert.96
Diese Annahme unüberwindbarer und aporetischer Ambiguität von Lesarten wird von de Man behauptet, indem er auf die primäre Rhetorizität sprachlicher Texte verweist. Stark vereinfachend gesagt, besteht, von der Materialität der Zeichenketten her (welche Texte konstituieren), keine Möglichkeit, zwischen sog. eigentlichem und uneigentlichem Schreiben zu differenzieren:
Es ist nicht so, daß es einfach zwei Bedeutungen gäbe, eine buchstäbliche und eine figurative, und wir nur zu entscheiden hätten, welche von beiden Bedeutungen in dieser bestimmten Situation die richtige wäre, Die Verwirrung kann nur durch die Intervention einer auß ersprachlichen Intention auf- gelöst werden [.]97
Vom ‘Textmaterial’ allein - und das bedeutet: ohne intentionale Zutat - läßt sich keinerlei (definitive) Aussage über die sog. Buchstäblichkeit der Worte treffen. Wenn selbst philosophische oder sprachwissenschaftliche ‘Begriffe’ unhintergehbar als rhetorische Figuren entlarvt sind,98 dann sind sie prinzipiell mit vielfältigen Bedeutungen auszustatten. Da zwischen Referentialität und Figurativität von sprachlichen Zeichen nicht unterschieden werden kann, bzw. eine ausschließlich referentielle Sprache keinen metasprachlichen oder abstrakten Diskurs erlauben würden, sind Texte ohne rhetorische Dimension undenkbar. Weil sprachliche Zeichen darüberhinaus letztlich immer vom phänomenal Gegebenen abstrahieren müssen, ist ihnen ein rhetorischer Charakter unabdingbar eigen.99 Dieser Generalverdacht eines je schon uneigentlichen Geschriebenen führt in ausweglose Konfusionen über den Sinn eines Textes: „Rhetorik ist die radikale Suspendierung der Logik und eröffnet schwindelerregende Möglichkeiten der referentiellen Verirrung“, schreibt de Man.100 In diversen Lektüren und diskursiven Umkreisungen versucht er, diese These mit Beispielen zu belegen.101 Aus diesen resultieren schließlich eine ganze Reihe offener Fragen, die aber weder zugunsten der einen oder der anderen Möglichkeit ihrer Beantwortung entschieden werden; exemplarisch seien ein paar dieser Fragestellungen angeführt: Ist eine Frage als sog. rhetorische Frage zu lesen ? Ist eine Aussage ironisch zu verstehen ? Ob und wann spricht ein Text bildlich über sich selbst (ist also selbstreferentiell) ? Handelt es sich bei einer Trope um eine Metapher oder Metonymie, ein Symbol oder eine Allegorie, und wie sind diese (be)deutbar ? Ist ein Satz nur konstativ oder immer auch performativ ? ... Da Texte in diesen Entscheidungsvarianten nie zur Bestimmtheit gelangen können, da eine Lesart immer durch eine andere konterkariert werden kann, bleibt dem Interpreten schlussendlich nur das Eingeständnis ihrer Unlesbarkeit. Der Nachweis dieser zwangsläufigen misreadings wird bei de Man durch eine zweifache Lektüre erbracht, bei der die erste von der nachfolgenden unterminiert wird, ohne jedoch von dieser ersetzt (oder überboten) zu werden.102 Insofern enden dekonstruktive Lektüren schließlich im Aufweis der Aporie.
Jörg Lau kritisiert diese Vorgehensweise als „reflexhaften Agnostizismus“103, der einen „Jargon der Uneigentlichkeit“104 in bestimmten literaturwissenschaftlichen Zirkeln ‘salonfähig’ gemacht habe. In seiner mithin polemischen Abrechnung mit dem Poststrukturalismus argumentiert er, der Versuch, jedweder Festlegung zu entkommen, lasse dieses Denken in die Nähe der Paranoia geraten.105 Diese These erläutert er am Beispiel Derridas:
Immer will ihm jemand die Anführungszeichen wegnehmen, eine Identität zuschreiben, ihn auf ir- gend etwas reduzieren. Und so muß er nach jedem Schritt gleich wieder alle Spuren verwischen, die seinen Aufenthaltsort verraten könnten, den Ort, von dem aus hier gesprochen wird.106
Diese zwanghafte Sich-Enziehen-Wollen, diese Strategie der Sinnverweigerung erinnert z.T. an die Traditionlinien der hermetischen Moderne in der Literatur. So werden die Texte Derridas schlussendlich selbst (ein Stück weit) literarisch.107 Die Revision der Differenz zwischen theoretischem und literarischem Text108 wird damit (auch stilistisch) vollzogen.
Dieser Versuch, die Grund züge der Dekonstruktion in geraffter und unvollständiger Form darzustellen, sollte die (text)theoretischen Einsichten einer geistes- wissenschaftlichen Richtung des Poststrukturalismus erhellen. Ausgehend von dieser Klärung der Präsuppositionen, die der Begriff ‘Dekonstruktion’ mit sich bringt, kann nachfolgend über die (Un-)Möglichkeit ihrer Didaktisierung diskutiert werden.
II
Möchte man prüfen, ob Dekonstruktion in die Didaktik des Unterrichtsfaches Deutsch (insb. in der Sekundarstufe II) eingebunden werden kann, dann muß zunächst über die Art ihrer Integration reflektiert werden. Es läßt sich nämlich zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten ihres Einsatzes differenzieren: Einmal kann man versuchen, aus der theoretischen Konzeption von Dekonstruktion generelle Konsequenzen für die Didaktik des Faches abzuleiten, zum zweiten ließe sich eventuell das Spektrum an etablierten analytischen und interpretativen Verfahren der Textarbeit um dekonstruktive Lektüren bereichern. Auch im fachdidaktischen Diskurs wird mit dieser Unterscheidung - wenn auch häufig implizit - gearbeitet. Obschon keine strikte Trennung zwischen den beiden ‘Ebenen’ vollzogen wird, lassen sich dennoch theoretische Fundierung und praktischer Einbezug voneinander unterscheiden; im ersten Fall beziehen sich die Schlußfolgerungen auf das didaktische Paradigma im ganzen, im zweiten Fall handelt es sich lediglich um eine ergänzende Alternative zu herkömmlichen Textbearbeitungsmethoden. Diese Differenzierung soll für die nachfolgenden Ausführungen implizit leitend sein.
Um den Stellenwert von Dekonstruktion in der didaktischen Diskussion zu eruieren, soll zunächst das Verständnis verschiedener Literaturdidaktiker vom sog. ‘Dekonstruktivismus’ auf seine Übereinstimmung mit den Postulaten dekonstruktiv arbeitender Theoretiker befragt werden.109 Im Anschluß daran kann dann über das Für und Wider einer unterrichtlichen Implementierung von Dekonstruktion argumentiert werden.
Einer der Begründer des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtsparadig- mas, Günther Waldmann, beruft sich in seinen differenztheoretischen Überlegungen zur Literaturdidaktik u.a. auf Derrida. Die Rede vom Spiel der Differenzen aufgreifend, zeichnet er das Saussuresche Theorem vom differentiellen Charakter der Sprache nach, um dann schließlich den literarischen Text als „eine Kombinatorik, ein offenes System von Differenzen “ definieren zu können.110 Obwohl Waldmann sich explizit auf Derrida bezieht,111 weist sein differenztheoretischer Ansatz argumentativ keine über die strukturalistische Sprachauffassung Saussures hinausgehende Qualität auf. Dies wird an seiner Erläuterung der Differenzhypothese deutlich:
Eine bestimmte Wortbedeutung [...] besteht nicht isoliert aufgrund etwa phonetischer oder auch etymologi- scher Merkmale dieses Wortes, sondern aufgrund des bestimmten Ortes, den das Wort innerhalb des Wort- feldes [...] auf der bestimmten paradigmatischen Reihe einer allgemeinsprachlichen [...] Wortfeldschicht von euphemistischen [...] zu sachlich benennenden [...] bis zu krassesten [...] Wörtern einnimmt. Seine Bedeu- tung ist bestimmt durch seine Differenz zu den nächsten, näheren und entfernteren Wörtern, die es nicht ist, die man aber kennen muß, wenn man es richtig gebrauchen will. Eine Sprache beherrscht und versteht man nur dann wirklich [...], wenn man ihre Wörter in dieser Weise semantisch zuzuordnen vermag. Entsprechen- des gilt für [...] literarischeTexte.112
Wenn Waldmann die Struktur des sprachliche Systems durch paradigmatische Reihen und eingrenzbare Wortfelder klar geordnet sieht und ein wirkliches Verstehen als möglich erachtet, dann könnte die Differenz zu Derrida, der ja gerade die Unabschließbarkeit des Spiels der Differenzen113 betont, kaum größer sein. Wenn Waldmann sein Differenztheorie überdies aus dem platonischen „Verfahren der dihaíresis (griech. Unterscheidung)“ sowie aus dem „Gesetz der Differenzen“ beim Hermeneutiker Schleiermacher entwickelt,114 so wird die Diskrepanz zur theoretischen Richtung Derridas abermals offensichtlich. Nichtsdestotrotz wird Derrida (nach Saussure) im entsprechenden Teil am zweithäufigsten zitiert. Der Verdacht liegt nahe, dass Waldmann Derrida als Autorität einer differenztheoretischen Position anführt, um den Anschein zu erwecken, diese noch aktuell in der Diskussion befindliche Position in das eigene Modell einer „produktiven Hermeneutik“115 integrieren zu können. Dieses ist wiederum orientiert an dem theoretischen Standpunkt Franks, der ja in gewisser Hinsicht im Gefolge von Postrukturalismus einerseits und Hermeneutik andererseits steht.116 Im Rekurs auf diesen formuliert Waldmann:
Sinnverstehen ist nicht einfach Sinnübernahme, denn Sinn ist nicht etwas, das im Text enthalten ist, das sozusagen an den Wörtern und Textteilen haftet und das automatisch und mechanisch mit ih- nen übernommen wird. Im Text ‘ist’ nicht einfach Sinn, sondern [...] er „steht zur Disposition“ [...], nämlich für den, der ihn setzt [...]. Im Bereich des Lesens ist Sinn analog keine Eigenschaft des Tex- tes, sondern ein Geschehen zwischen Leser und Text, ein Geschehen textueller Sinnsetzung oder Sinnzuschreibung durch den Leser innerhalb eines übergreifenden Sinnsystems, das den Lesenden bestimmt.117
Obwohl Waldmann zugesteht, dass Sinn ein dem Text Hinzugefügtes ist, und damit mit den Theoretikern der Dekonstruktion übereinstimmen dürfte, schränkt er die Möglichkeiten der Sinnerzeugung sogleich wieder ein, wenn er ein übergreifendes Sinnsystem annimmt, das sich im Zusammenspiel sämtlicher Lebenszusammen- hänge des Lesers entwirft und „entscheidend geschichtlich und sozial geprägt“ ist.118 Trotzdem fordert Waldmann ein „ eigenes Lesen “, dass gerade darin bestehe, dass „mit individueller und sozialer Fantasie eigene Einschätzungen und Zuordnungen der Muster und Normen des Gelesenen vorgenommen werden.“119 Diese aktive Rezeption - wider das „bloß affirmative[] Lesen “120 - läßt sich in gewissem Sinne durchaus als diskurskritisch verstehen. Man könnte sie folglich als eine Bedingung der Möglichkeit von Dekonstruktion auffassen. Da diese Verbindung seitens Waldmann jedoch nicht hergestellt wird, verbieten sich an dieser Stelle weitere Spekulationen.
Es bleibt aber festzuhalten, dass Waldmann keineswegs mit einer dekonstruktiven Konzeption zur theoretischen Grundlegung seiner Didaktik arbeitet, sondern sich allenfalls begrifflicher und theoretischer Anleihen bedient, die jedoch bei genauerem Hinsehen nicht in seine theoretische Konstruktion eines sich u.a. aus rezeptionästhetischen, konstruktivistischen und hermeneutischen Prämissen zusammensetzenden Modells überführbar sind.
Jürgen Förster hingegen ist bei der Darstellung der Theorie Derridas sehr viel präziser. In ausdrücklicher Abgrenzung von den ‘hermeneutischen Evidenzen’ „Subjekt, Vernunft, Geschichte, Intention, Interpretation sowie die Verbürgtheit des hermeneutischen Wissens“121 entwickelt er entscheidende Annahmen des dekonstruktiven Textverständnisses. Folgende Passagen aus seinem thematisch darauf fokussierten Aufsatz Subjekt - Geschichte - Sinn belegen die genaue Kenntnis Försters:
Das Werk ist allererst Text und solcher viele Texte. [...] Ein solcher Text hat [...] nicht einen Autor, sondern viele Autoren, viele Stimmen; er ist mehrsprachig, polyphon und hebt damit Originalität, Genialität, Authenti- zität und Subjektivität des Autors auf. [...] Vielmehr bietet er ein Mosaik von Schreibweisen, diversen Text- fragmenten, gesprochener und zitierter Sprache auf [...]. Als solcher verfügt er über keinerlei Homogenität, gibt sich nicht länger ontologisch aufgeladen oder von einem metaphysischen Sinngehalt beseelt, sondern bietet ein inhomogenes, zerstreutes Feld, das sich von keinem archimedischen Punkt oder Zentrum her überschauen oder auflösen läßt [...].122
[Es kann] in der Schrift keine Idealität von Bedeutungen geben, sondern nur Ansammlungen von Spuren, von Signifikanten, die einer ursprünglichen Signifikatannahme entbehren [...]. ‘Schrift’ firmiert insofern nur als ein Name für das Funktionieren aller Zeichen als solcher, die sich selbst nicht gegenwärtig sind [...].123
Sinnverhältnisse konstituieren sich überhaupt erst in den potentiell unendlichen Verweisungen, Bezügen, Un- terscheidungen der diversen Text-, Rede-, Schreibfragmente, aus denen er sich aufbaut; sie sind insofern stets abgeleitet, nachträglich, kurzum: ein Effekt von Differenzen. Zugleich schiebt sich damit auch jede sich verfestigende Sinnzuweisung immer wieder auf, da das „Spiel mit den ästhetischen Zeichen und Vorhalten“, weil auf kein Bedeutungszentrum [...] oder ein abschließendes Signifikat beziehbar, potentiell unabschließbar ist, unendlich viele Verweise und Bezüge ermöglicht, da keine Zeichenverwendung endgültig bestimmt wer- den kann.124
Der literarische Text fällt damit aus dem Sinnhorizont von Subjekten heraus und wird zum Intertext, zu einem Text in einer Reihe unendlicher Texte, die - gleichsam subjektlos - produktiv sind [...].125
Ferner erläutert Förster Derridas Kritik an der abendländischen Metaphysik und dem damit verbundenen Logo- bzw. Phonozentrismus, ohne jedoch deren Wiederholung bei Saussure zu unterschlagen.126
Seinen theoretischen Ausführungen stellt Förster fragmentarische Zitate des Prosatextes Paare, Passanten von Botho Strauß zur Seite, um das dekonstruktive Textverständnis anhand des zeitgenössischen Textes zu veranschaulichen.127 Zwar möchte Förster, dass damit „einige Verbindungslinien zwischen postmoderner Literatur und Kategorien sowie Motiven neuerer (Literatur-)Theorien herausgestellt werden,“ dass solche Theorien jedoch über den Anwendungsbereich sog. ‘postmoderner’ Literatur hinausreichen, ist ihm dabei gleichwohl bewusst.128 Diese Verschränkung von poststrukturalistischer Theorie und zeitgenössischer Literatur birgt dennoch das Problem einer Engführung, da Förster nur in Bezug auf Gegenwartsliteratur von Texten schreibt, für die sich „Differenz, Heterogenität, Diskontinuität, nicht reduzierbare Pluralität fernab von Durchsichtigkeitsphantasmen [...] als konstitutiv erweisen und [die] sich dergestalt den hermeneutischen Leseverfahren verweigern“129. Er verdeutlicht das dekonstruktive Textverständnis also anhand von Beispielen, die sich ohnehin dafür zu eignen scheinen. Dadurch vermittelt er schließlich doch den Eindruck, dass vornehmlich neuere Literatur einer veränderten Textheorie bedarf; was allerdings den (Fehl-)Schluss nahelegt, dekonstruktive Theorie beschränke sich auf derartige Phänomene. Diese Form von Restriktion des Anwendungsbereichs durch Gegenstandsadäquatheit ist einer dekonstruktiven Perspektive jedoch fremd.130
Försters Forderung, es brauche eine innovative Didaktik, die sich um ein anderes Textverständnis bemüht, wird folgerichtig nur von den Erfordernissen, die die gegenwärtige Literatur an einen veränderungsbereiten Deutschunterricht stellt, her begründet.131 Wer jedoch die zeitgenössische Literatur aus dem Unterricht ausschließt, der kann in althergebrachter Art und Weise weiter unterrichten, gibt Förster zu.132 Somit ist allerdings die Notwendigkeit eines anderen Umgangs mit Texten in keiner Weise zwingend. „Soll indessen der Auseinandersetzung mit den Umwälzungen literarischer Diskursnormen als Zeitgenossenschaft, wie sie in postmoderner Literatur begegnet, nicht ausgewichen werden, sondern diese produktiv-kritisch aufgegriffen werden, so muß ihre Lektüre entsprechend literaturdidaktisch reflektiert und angeleitet werden“, konstatiert Förster.133 Um dieses Ziel zu erreichen, skizziert er einige didaktische Leitlinien:
Die Aufmerksamkeit wäre [...] zunächst auf [die] Binnenanalyse zu richten. Welche Äußerungsmodalitäten gibt es, nach welchen Regeln sind thematische,ästhetische und rhetorische Elemente verknüpft, wer spricht von welchem Ort aus ? Sodann: sind geordnete Ordnungen und Unordnungen in synchroner und diachroner Dimension feststellbar ? Lassen sich Verteilungsregeln benennen, die bestimmte Felder desÄhnlichen her- vorbringen [...] ? Kurzum: es wird also zunächst darum gehen, die Beobachterperspektive einzunehmen [...].134
[Dennoch] kann auch die Lektüre bei aller disjunktiven Verknüpfung thematischer, ästhetischer, und rhetorischer Analyse, nicht auf Verfahren thematischer Textanalyse verzichten.Es bedarf also stets auch thematischer Zuordnungen [...]. Unreine hermeneutische Totalisierungsbewegungen müssen etsprechend, bei aller Präferenz von Detotalisierung, gleichwohl vorgenommen werden. Die Lesartenproduktion [...] kann eben nicht in einem Zentralsinn aufgehen, nicht als letzte Metasprache funktionieren.. Der Text trägt in sich die Zeichen jener Differenz, die es unmöglich machen, eine Auslegung zu beenden. Die Lektüre bleibt stets angewiesen auf Anschlußkommunikation, die auch für sozial-historische Kontextuierung offen ist. Hier ist dann auch die Teilnehmerperspektive wieder einzubringen.135
In diesen Vorschlägen Försters sieht Elisabeth K. Paefgen ein „Verfahren, das der klassischen Textanalyse verwandt ist.“136 Der Text wird zunächst einer akribischen und textnahen Binnenanalyse unterzogen, die eine Distanzierung vom Ausgangstext notwendig macht („Beobachterperspektive“).137 Dadurch kann der Text in seinen unterschiedlichen Dimensionen (thematisch, rhetorisch, strukturell ... usw.) wahrgenommen werden. Durch diese Aspektpluralisierung soll der analysierte Text in seiner Heterogenität und Diskontinuität sichtbar werden, die in keiner hermeneutisch metasprachlichen Totalisierung mehr aufgehoben werden kann.
In dieser Vorgehensweise lassen sich durchaus Parallelen zu Lektüren de Mans erkennen.138 Dieser versucht mit seinen misreadings allerdings, die internen Paradoxien der Texte durch gegenläufige Lektüren aufzudecken, um daran die Unmöglichkeit angemessener Interpretation zu verdeutlichen. Vor dieser extremen Positionierung scheut Förster jedoch zurück. Er warnt vor einem „fröhlichen anything goes“139 im Literaturunterricht und stellt damit insgeheim die Diskurshegemonie der Lehrperson sicher. Desweiteren betont er die Notwendigkeit von „Anschlußkommunikation“, die eine sozial-historische Rahmung des Textes gewährleistet bzw. das identifikatorische Moment des Lesens wieder einzubringen sucht. Diese flankierenden Maßnahmen sollen - so darf man spekulieren - die zuvor ins Werk gesetzte Entfremdung der Leser vom Text überwinden oder zumindest relativieren helfen. Somit würde auch dem Bedürfnis der Leser nach einer lebensweltlichen Einordnungs- oder Anschlußmöglichkeit von Literatur Rechnung getragen. Diese Situierung des Gelesenen geht aber über dessen bloße Dekonstruktion hinaus; die Texte werden deren verwirrendem Zugriff wieder entzogen, intersubjektive Sinnbildung wird ermöglicht.
Für seine didaktischen Hinweise, glaubt Förster, ist es unmöglich eine - wie er es nennt - „Rezeptologie“ aufzustellen, da man vor dem Hintergrund einer Theorie der Dekonstruktion nicht mehr methodologisch argumentieren kann.140 Stattdessen rät er den Lehrern „in Partizipation an den Reflektionsprozessen und der je konkreten Arbeit an den Texten die Theorie praktisch werden zu lassen und die Praxis in Theorie zu überführen, ohne die Differenz zwischen beiden aufzulösen“141. Bei solchen reichlich vagen Empfehlungen beläßt es Förster. Den Lehrern bleibt die Konkretisierung seiner didaktischen Konzeption selbst überlassen.
Sehr viel praxisorientiertere Vorschläge zur unterrichtlichen Umsetzung dekonstruktiver Textarbeit macht Kaspar H. Spinner. Bevor diese dargelegt werden, soll allerdings zunächst die didaktische Ausgangslage Spinners verortet werden. In seinem gleichnamigen Aufsatz zur Literaturdidaktik der 90er Jahre eröffnet er „Perspektiven eines zugleich subjekt- und textzentrierten Literaturunterrichts“142. Für dessen Didaktik postuliert Spinner die Einbeziehung von rezeptions- und mentalitätsgeschichlichen Fragestellungen, die Aktivation der Schüler durch produktionsorientierte Verfahren sowie die textzentrierte „Arbeit an Widersprüchen, Ambiguitäten und intertextuellen Bezügen“ im Rahmen einer poststrukturalistischen Literaturtheorie anstelle traditioneller Interpretationsweisen.143 Damit werden poststrukturale Lektüren - neben anderen Textbearbeitungsformen - zu einem Element neuerer Literaturdidaktik. Diese Lektüren orientieren sich sowohl an Prinzipien der (historischen) Diskursanalyse (nach Michel Foucault)144 als auch an dekonstruktiven Lesarten.145 Mit den texttheoretischen Vorgaben des Poststrukturalismus lassen sich verschiedene, konkurrierende und widersprüchliche „Sinndimensionen“ die immer schon im Text enthalten sind, aufzeigen, ohne sie interpretatorisch miteinander „versöhnen zu müssen“,146 erklärt Spinner. Da bei derartigen Textanalysen kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht, ist es für ihn durchaus legitim, im Unterricht diejenigen Diskurse oder Sinndimensionen herauszuarbeiten, die dem Interessenhorizont der Schüler zugänglich sind.147 Somit ließe sich auch Schülerorientierung durch eine poststrukturalisisch innovative Didaktik sicherstellen, wodurch gleichfalls evident wäre, dass sich eine solche auch in anderen Schulformen und Klassenstufen als der gymnasialen Oberstufe anwenden läßt, argumentiert Spinner.148
Diese sehr allgemeine und undifferenzierte Bezugnahme auf Poststrukturalismus spezifiziert Spinner in einer weiteren Veröffentlichung, in der er anhand der Grimmschen Märchen die Möglichkeit poststrukturaler Lektüren beispielhaft macht. Zunächst entfaltet Spinner - ohne philosophische Begründungen anzuführen oder sich auf bestimmte Theoretiker zu beziehen - schlaglichtartig ein poststruktulalistisches Textverständnis. Auf zentrale Punkte sei hier kurz hingewiesen:149 1. Der „Gedanke der unendlichen Semiose “, wonach sich beim Interpretieren ein prinzipiell endloser Prozess der Ersetzung von Zeichen durch andere in Gang setzt; „eine Deutung löst immer weitere Deutungen aus.“ 2. Die Aufhebung statischer Bedeutungszuschreibung, wonach sich die Zeichen eines Textes nicht zu einem fest strukturierten Ganzen ordnen, sondern sich gegenseitig in Bewegung bringen; Textelemente verbinden sich und stoßen sich wieder voneinander ab. 3. Auflösung eines eindeutigen Sinnzusammenhangs durch dekonstruktive Lektüren, indem aufgezeigt wird, „daß der Text selbst den Schein einer einheitlichen Aussage unterminiert.“ 4. Negation des Autors als verbindlicher Instanz im Auslegungsgeschehen, da die Intertextualität solcherart Priviligierung ausschließt. 5. Nachweis vielfältiger Diskurse, die den literarischen Text durchziehen und so die Autorintention überlagern.
All diesen Textmodalitäten verleiht Spinner nun für sämtliche Literatur Geltung,150 was nicht zuletzt durch die Wahl seiner Beispiele untermauert wird. Ausführlich exemplifiziert Spinner die o.g. Prämissen in der Analyse verschiedener Grimmscher Märchen. Dabei zeigt er, dass sich gegenläufige Diskurse an den Märchen ablesen lassen:151 mythische/animistische contra aufklärerische Diskurse, ästhetische contra moralische Diskurse, die Vorstellung von kindlicher Reinheit vs. das Bild vom Kind als kleinem zivilisatorisch korrumpierten Erwachsenen, die „Ent-Erotisierung zugunsten von Triebkontrolle“ vs. die Re-Erotisierung durch subtile Allusionen, das Primat der Mündlichkeit gegen das „durch Schrift geprägte Sprachbewußtsein“. Solche Widersprüchlichkeiten arbeitet Spinner heraus, ohne sie jedoch gleichsam hermeneutisch synthetisieren zu wollen:
Solche Mehrdeutigkeit in literarischen Texten ist traditionell oft mit der Vorstellung von Oberflächenund Tiefenbedeutung verbunden worden. [...] In poststrukturalistischer Sicht jedoch geht man nicht von einer solchen Hierarchie der Bedeutung aus. Es ist nicht entscheidbar, ob die Entdämonisierung, das hell Optimistische, das bürgerlich Geordnete oder das Triebgeschehen, das Dämonische usw. die mächtigere Botschaft des Märchens sind.152
Das Wesentliche dieser Lektüren besteht aber darin, die kontradiktorischen Diskurspaare nicht strukturalistisch als „zwei Welten [...], die zueinander in Opposition stehen“153, zu begreifen, sondern ihre paradoxe Gleichzeitigkeit zu verstehen. Um dies zu illustrieren, schreibt Spinner, müsse man darauf hinweisen, „daß für die Romantik sowohl das Interesse für das Furchterregende, Dämonische, Archaische als auch ein verklärendes Bild von früheren Zeiten (aus denen die Märchen stammen) typisch sind.“154
Mit dieser dekonstruktiven Radikalisierung von Diskursanalyse veranschaulicht Spinner die Auswirkungen poststrukturalistischer Theoreme für die Lesartenproduktion. Aber auch ohne den Umweg über konträre Diskurse lassen sich dekonstruktive Operationen im Unterricht durchführen, wie Spinner zeigen kann. Anhand des Eingangssatzes „Es war einmal mitten im Winter...“ (aus dem Märchen Schneewittchen), der allgemein als formelhafte Wendung, die eine fiktionale Wirklichkeit indiziert, verstanden wird, läßt sich durch syntaktische Variation bzw. durch paradigmatische Auslassung oder Ersetzung einzelner Lexeme ein Verfremdung der Satzaussage erzielen.155 Dadurch wird allerdings die Satzsemantik jenseits ihrer rhetorischen Funktion wieder offengelegt: „Die Umformulierungen rücken den Satz näher an eine Tatsachenaussage heran.“156 Das Ergebnis des Nachweises dieser zweifachen Satzbedeutung fasst Spinner folgendermaßen zusammen: „Es wird also etwas ausgesagt, aber durch die Ausdrucksweise wird das Ausgesagte zugleich in seiner Gültigkeit wiederrufen.“157 Dadurch bleiben Faktizität und Fiktionalität des Märchens in gewisser Hinsicht in der Schwebe, seine irreale Fantastik wird mithin als eine Art wahre Begebenheit präsentiert. Die Durchdringung von Realität und mythischer Sagenwelt ist somit unauflöslich geworden.
Auch der Wechsel des Erzählmediums kann befremdende Effekte hervorrufen. Wenn Märchen in unterschiedlichen situativen Kontexten mündlich vorgetragen werden (etwa in geselliger Runde oder aber ausschließlich bei Kerzenlicht), kann ein und derselbe Text ganz verschiedene Wirkungen bei den Zuhörern hervorbringen.158 Dadurch können ganz disparate Sinnangebote des Textes bewußt gemacht werden. Noch andere Kontextualisierungen hält Spinner für denkbar, um die Multivalenz eines Märchens zu zeigen. Indem weitere Fassungen eines Märchens ins Spiel gebracht werden, bildliche Illustrationen oder etwa ein psychologischer Kommentar neben den Referenztext gestellt werden,159 läßt sich die Kontextabhängigkeit bei der Deutung eines Märchens klar machen. Diese wird auch von dekonstruktiv verfahrenden Theoretikern mit allem Nachdruck behauptet.160
Überdies schlägt Spinner vor, durch das perspektivische Umarbeiten von Texten (einen neuen Schluß schreiben, Übertragung des Märchenstoffes in die moderne Welt, Kommentierung durch eine bestimmte Person/Figur) weitere Deutungs- möglichkeiten zu erschließen.161 Solche Formen der Intervention gehören auch bei Derrida zur gängigen Praxis, wenn er Einschreibungen in andere Texte vornimmt, um so bei seinen Lesern einen veränderten Blick auf den Ausgangstext zu provozieren.162 Außerdem wird hier die ‘Kategorie’ des Spiels unterrichspraktisch ernst genommen.
Albert Bremrich-Vos hat in seiner Auseinandersetzung mit der Didaktik Spinners nachzuweisen versucht, dass jener - trotz seinem Bemühen um die poststrukturalistische Grundierung seiner Unterrichtskonzeption - einem „emphatische[n] Begriff von Ich-Identiät bzw. von einem autonomen Subjekt“ verhaftet bleibt.163 Und in der Tat ist in dessen Aufsatz zur Literaturdidaktik die Rede davon, dass literarische Texte helfen können, „Neues in sich zu entdecken, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und an der eigenen Identität zu arbeiten.“164
Bremrich-Vos ist insofern beizupflichten, als von Subjektautonomie in poststrukturalistischen Theorien in keiner Weise ausgangen werden kann und Spinner an keiner Stelle erklärt, wie sich seine Didaktik damit vermitteln läßt.165 Einschränkend muß man bei diesem jedoch beachten, dass er poststrukturalistische Ansätze eben nur als ein Element in seiner didaktischen Gesamtkonzeption betrachtet. Ferner ist ihm sehr wohl bewußt, dass es im Poststrukturalismus nicht um Subjektzentrierung geht:
Deutlich wird hier auch die Abgrenzung zu gängigen rezeptionästhetischen Auffassungen: Es geht nicht um bloßes Füllen von Leerstellen und auch nicht um Vieldeutigkeit des Textes in dem Sinne, daß der Leser einfach seine subjektiven Bedeutungszuschreibungen in den Text hineinprojizieren. kann. Es geht vielmehr darum, daß durch das Aufeinanderprallen von Zeichen (von Wörtern, von Aussagen ...) im Text selbst Brüche, Widersprüche, Ambivalenzen entstehen [...].166
Dennoch drängt sich an dieser Stelle die Frage auf, ob die radikale Zurückweisung von Subjektautonomie und Ich-Identität im Poststrukturalismus überhaupt auf pädagogische Modelle übertragen werden kann - zumal wenn sie einem emanzipatorischem Ethos verpflichtet sind.
In einem Aufsatz, der mit einem fragmentarischen Schlegelzitat überschrieben ist,167 hat Karlheinz Fingerhut auf ein Dilemma des emanzipatorischen Literaturunterrichts hingewiesen:
Unterricht ist eine „soziale Interaktion zwischen wissens- und entwicklungsmäßig ungleichen Kommunika- tionspartnern“, deren Ziel, durch den Vollzug literarischer Kommunikation gerade autoritäre Formen von Kommunikation in Frage zu stellen, die eigenen institutionellen Rahmenbedingungen negiert. Das „hand- lungsrelevante literarische Wissen“, das der Lehrer „für sozialisatorische Interaktionen [...]“ erworben hat und einsetzt, dient schließlich dazu, SchülerInnen in den Stand zu setzen, die schulische Kommunikation über li- terarische Texte und die literarische Lektüre selbst als durch und durch selbstwidersprüchliche Einübung in ein gesellschaftlich postuliertes, wenn auch keineswegs immer erwünschtes „kritisches Weltverständnis“ zu erfahren. / Besonders augenfällig wird diese strukturelle Widersprüchlichkeit in den leistungsbezogenen Schul-Operationen an literarischen Texten - Korrektur des Spontanverstehens durch dessen analytische Kontrolle, bewerteter Interpretationsaufsatz, gesprächsweise rezensierte produktive Schreibreaktion auf eine Leseerfahrung -, in denen spontane subjektive und ichbezogene Lektüren durch die „literarisch gebildete“, literaturwissenschaftlich legitimierte und historisch aufgeklärte Lektüre abgelöst wird.168
Einen Ausweg aus diesem Dilemma sieht Fingerhut darin, „die zweite Lektüre, die Differenzierung und Korrektur des Spontanverstehens, [...] mit Erfolgserlebnissen zu verbinden und sie gleichzeitig so weit als möglich aus ihrem institutionellen Rahmen zu befreien [...], wenn ‘erlebt’ werden kann, daß mehr und besser verstehen, mit der möglichen sinnkritischen Dimension literarischer Texte umgehen zu können, ein Zugewinn an Selbständigkeit auch gegenüber den Instanzen bedeutet, die in dieses Verstehen einüben.“169 Um Emanzipation und Kritikfähigkeit der Schüler auch gegenüber der Institution Schule zu fördern, plädiert Fingerhut dafür, Dekonstruktion ins Repertoire des Literaturunterrichts aufzunehmen. Damit geht er in gewissem Sinne durchaus mit einer Ansicht/Absicht Derridas konform:170
Was etwas voreilig Dekonstruktion genannt wird, besteht nicht, wenn sie überhaupt eine Wirkung haben soll, in einer spezifischen Reihe diskursiver Prozeduren und erst recht nicht in Regeln einer neuen hermeneutischen Methode, die im Schutz gegebener und fester Institutionen Texte [...] be- arbeitet. Sie ist zumindest auch eine Weise, Stellung zu beziehen, in ihrer Arbeit der Analyse, in be- zug auf die politischen und institutionellen Strukturen, die unsere Praxis, unsere Kompetenz, unsere Performanz ermöglichen und beherrschen. [...] Die Dekonstruktion ist weder eine methodologische Reform, welche die jeweils gültige Organisation stärken soll, noch das Aufblühen einer unverantwortlichen und unverantwortlich machenden Dekonstruktion, deren einzig sicherer Effekt darin bestünde alles so zu lassen, wie es ist [...].171
Obwohl Fingerhut den institutionskritischen Impetus der Dekonstruktion herausstellt, sieht er in ihr dennoch eine Art neuer hermeneutischer Methode, wenn er „dekonstruktive Textoperationen“ darunter versteht. Diesen unterstellt er eine „heimliche[ ] Affinität zum literarischen Text“172, und er verdeutlicht diese These anhand der (Liebes-)Lyrik Heinrich Heines: Indem bei Heine ironische und ernsthafte Lektüren ineinander umschlagen und offenbleibt, was „sentimentale Maske [und] was gerade Abkehr von der Romantik ist“,173 werden dem Leser zwei kontrastive Lesarten ermöglicht. Fingerhut kann nachweisen, dass bei „Heine, der schon in seiner frühen Lyrik Goethe-Reminiszenzen in ironischer Absicht einbezog, [...] die idealistische Sicht auf eine erlebnisbegründete Liebesbeziehung“174 dekonstruiert wird. Eine solche „dekonstruktive Haltung Heines gegenüber den Gotheschen Liebesgedichten“ signalisiert für Fingerhut einen „Epochenumbruch“.175 Damit argumentiert er allerdings eher literarhistorisch als dekonstruktiv. Überdies führt Fingerhut das hermeneutische Modell von Oberflächen- und Tiefenbedeutung176 - immerhin in seiner gegensätzlichen Zuspitzung - wieder ein:
Das Ergebnis der dekonstruktiven Analyse lautet: Beide Gedichte haben eine Oberfläche und eine durch Irritationspunkte erreichbare „andere Seite“. Auf der einen Ebene sprechen sie von Liebe und Liebesleid, von romantischer Todessehnsucht, von den emotionalen Deformationen der Philister [...] [etc.] Auf der anderen Seite negieren sie ihre eigene Rede.177
Er arbeitet mit der Unterscheidung von vordergründigem und hintergründigem Sinn, die eine „Erfahrung der doppelten Lektüre“ herausstellen kann, wobei die zweite Lesart „mehr mit der Wirklichkeit, die der literarische Text verarbeitet, zu tun hat als die erste.“178 Fingerhut priviligiert also eindeutig die Lesart, welche eine Art von „Realitätsprinzip“179 durchscheinen lässt und sich zudem gegen eine verklärende Affirmation der scheinbar offensichtlichen Textaussagen wendet.
Der Sinn der schulischen Arbeit an Literatur [ist] in deren sinnkritischer Dekonstruktion von positiven Sinn-Aussagen zu sehen und ist als zeitgemäße Version des „kritischen Lesens“ mit dekonstruktiven Lektüreverfahren der neueren Literaturwissenschaft vereinbar.180
Dies bedeutet für Fingerhut auch die Inkaufnahme des Verlustes von utopischen Momenten in der Lektüre.181 Trotz diese Nachteils erkennt Fingerhut auch die Vorzüge für die Schüler:
Zunächst einmal machen sie die Erfahrung, daß Texte, nicht nur literarische, sondern alle, die Wert- zuschreibungen vornehmen, mehrere Lektüren verlangen, von denen sie eine an die Oberfläche he- ben und stützen. Die gegenläufigen, aber auch möglichen werden unterdrückt, machen sich aber an Irritationen, Widersprüchen und Doppeldeutigkeiten bemerkbar. Die subversiven Lektüren auszuarbeiten, macht das intellektuelle Vergnügen der de(kon)struktiven Textarbeit aus.182
Während das „Erlebnis-Schema in der Lektüre“ zunächst den subjektiven Bedürfnissen des Rezipienten folgt, führen ihn die dekonstruktiven Irritationen zu einer „Korrektur der eigenen Spontanreaktion“.183 Das intellektuelle Vergnügen für die Schüler besteht also in einer (selbst-)bewußten Desillusionierung verbunden mit der spielerischen Subversion bornierter Primärrezeption, frei nach dem Motto: „Während andere Leser hier fremde Erlebnisse nachempfinden möchten, erkenne ich, daß es sich um eine Täuschung und Irreführung dieses Begehrens handelt.“184 Ein solches Lesevergnügen stellt sich dabei keineswegs selbstverständlich ein, wie auch Fingerhut einräumt. Voraussetzung dafür ist, „daß eine Unterscheidung von Ich und Anderem vorgenommen wird.“185 Die diffuse Identifikation soll durch die quasi- aufklärerische Leistung einer überlegten und überlegenen Distanzierung überwunden werden. Wie sich allerdings eine solche Strategie rückhaltloser Desilllusionierung auf Schüler auswirken könnte, die in diesem Erkennnisprozess keine aktive Rolle übernehmen, diese Frage wird von Fingerhut nicht beantwortet.
In einem weiteren Aufsatz setzt sich Fingerhut mit verschieden Erzählungen Kafkas als Unterrichtsgegenstand auseinander und erprobt daran produktive, heuristische und dekonstruktive Lektürespiele, wie es in der Überschrift heißt. Nachdem er die gängigen Diskursmuster zum Werk Kafkas dargestellt hat, erklärt er sein didaktisches Programm:
Wir möchten Wege aufzeigen, wie man im Unterricht textgenaue Lektüre mit Formen subjektiver und produktiver Lektüre verbinden kann, ohne Kafka auf eine dieser Bedeutungen festzulegen. Es geht um eine Form der Kommentierung, die für Weiterdenken und Weiterphantasieren offen ist.186
Im Rahmen dieser allgemeinen Zielorientierung entwirft Fingerhut auch seine Didaktik bezüglich Möglichkeiten dekonstruktiver Lektüre im Unterricht. Hierzu skizziert er zunächst einmal grundsätzlich, was er unter Dekonstruktion versteht:
Die dekonstruktive Suche geht von den Grundgedanken aus, daß sprachliche Zeichen in literari- schen Texten Bezugsnetze untereinander bilden, die nicht mit der semantischen Lektüre überein- stimmen. / Auch assoziative, auf sprachlichen Ähnlichkeiten beruhende Verbindungen stiften Bedeu- tung. Wortspiele, Reime, Assonanzen, Minimalpaare, Paronomasien bilden die Ausgangspunkte sekundärer Lektüren. Dadurch entstehen einander widersprechende Mehrfachbedeutungen im Text. Hinzu kommen die [...] Doppeldenotate von einzelnen Begriffen, die unterschiedliche Sinnpotentiale erschließen.187
Aus dieser Definition des dekonstruktiven Textverständnisses ergibt sich für Fingerhut eine Reihe von Konsequenzen, die er an vielfältigen Textbeispielen illustriert, welche hier nur z.T. angeführt werden können. So lässt sich das Wort „Verhaftung“ im Roman Der Prozess zum einen als juristischen Vorgang und zum anderen im Sinne eines Fixiert-Seins (durch oder auf etwas) lesen. Die „Jesus“- Interjektion einer Hausangestellten in der Erzählung Das Urteil, als sie sieht, wie der Protagonist Georg Bendemann an ihr vorbeieilt, um sich nachfolgend von der Brücke zu stürzen, kann einmal als Ausdruck des Erschreckens verstanden werden oder aber als Hinweis, Bendemann sei eine Art ‘Jesusfigur’.188 Ist das „Ungeziefer“ Gregor Samsa aus der Erzählung Die Verwandlung metaphorisch, als fiktionale Wirklichkeit oder als Phantasma der Figur zu fassen bzw. ist diese allegorisch oder symbolisch zu lesen ?189 Lassen sich in den metaphorisch autobiographischen Kommentaren Kafkas zu seiner Existenz als Schriftsteller Indizien finden, die auf eine bildliche Thematisierung derselben in der Erzählung schließen lassen ?190
Solche Möglichkeiten des ‘Gegen-den-Strich-Lesens’ entwickelt Fingerhut, indem er die „sich in der Germanistik herausstellende Kontingenz zwischen Text und Textsinn nutz[t], um [...] [den] Schülern ihren Teil an dieser Freiheit zu verschaffen.“191 Er ergänzt solche und weitere „Deutungspiele“192, durch produktive Verfahren der Umarbeitung, der Fortführung, der Kommentierung als Formen des heuristischen Schreibens, in denen die Schüler zur Hypothesenbildung außerhalb eines feststehenden Bedeutungsrahmens herausgefordert werden. Fingerhut wertet seine Bestrebungen folgendermaßen:
Eines steht fest: Die freien und produktiven Rezeptionsformen lassen Raum für analytische, dekon- struktive oder strukturale Text-Beobachtungen. Sie ermöglichen abweichende Ideen zu entfalten. Aber sie schützen auch nicht davor, daß Urteile wohlwollend aufgenommen werden, die dem Lehrer banal erscheinen. Die hermeneutische Interpretation als streng geleitetes Erschließungsgespräch hingegen hat für derartig subjektive Formen der Bearbeitung wenig oder keinen Platz. Ist das gut?193
Auch bei Fingerhut steht der Schüler in seiner individuellen Subjektivität im Mittelpunkt seiner didaktischen Konzeption. Dekonstruktive „Text-Beobachtungen“ werden in diesem Zusammenhang nur benutzt, um ungewöhnliche Rezeptionen jenseits etablierter Lesarten/Diskurse anzustoßen. Durch ihre spielerische Funktion soll es den Schülern ermöglicht werden, aus den gängigen Deutungsmustern auzuscheren, um so eigene Deutungen zu (er-)finden.
Rolf Selbmann - obwohl einer Einbindung dekonstruktiver Lektüren in den Literaturunterricht nicht abgeneigt - warnt davor, Dekonstruktion zum neuen Leitdiskurs der Literaturdidaktik zu erheben:
Die Versuchung liegt nahe, daß sich die Literaturdidaktik [...] auf das schon länger durch die Litera- wissenschaft und -theorie galoppierende Pferd der Dekonstruktion aufschwingt, um mit ihm aus dem Hegemonialdiskurs der Hermeneutik in die Freiheit eines neuen, wilden Denkens des „any- thing goes“ auszubrechen; erlaubt ist was gefällt. Am Ende der Galoppstrecke steht dann, man kennt es, „ der Text als Feind “ und mit ihm die selbst wieder zum Ritual gewordene Gegenlesung, Zerlesung und Zerstörung desTextes, die genauso unbefriedigt zurückl äß t wie die zwanghafte Sinn- Sinnsuche („Was will uns der Dichter damit sagen?“) der tradierten Interpretation als Kunst.194
Mit dieser kritischen Anmerkung Selbmanns ist eine Problem benannt, das vielfach gegen einen de(kon)struktiven Umgang mit Texten im Deutschunterricht eingewandt wurde: Durch eine Entfremdung des Lesers vom Text bleiben affektividentifikatorische Momente der Textwahrnehmung unberücksichtigt.195 Der Schüler erfährt eine Zerstörung seiner Sinnapplikationen geradezu als Krise des Lesens und wendet sich enttäuscht von der Literatur ab.
Die Überzeugungskraft eines solchen Gegenargumentes hängt zweifelsohne davon ab, ob dekonstruktive Lektüren das Bedürfnis nach Sinn und Identifikation entwerten. Für Clemens Kammler besteht darin durchaus ein Risiko, sofern man allein auf das intellektuelle Vergnügen der Desillusionierung setzt.196 Diese Gefahr läßt sich - laut Kammler - jedoch verringern, wenn man „andere (spontane, kreative) Lektüreformen in ihrem Recht beläßt.“197 Überdies sei es überhaupt nicht gewiss, dass die Schüler an eine reflexiv-kritischen Auseinandersetzung mit Texten kein Interesse hätten:
Jeder der einmal mit Schülern Theater gespielt hat, weiß, daß die Begeisterung beim ersten Lesen oder Erspielen eines Stückes, die erste (vielleicht „naive“) Identifikation mit einer Figur keineswegs die Bereitschaft ausschließt, sich in weiteren Lektüren und Proben ein völlig neues Bild dieser Figur zu erarbeiten. Im Gegenteil: die lustvolle Erstlektüre ist oft sogar Voraussetzung einer weiteren Beschäftigung mit dem Text.198
Demzufolge sind Schüler durchaus bereit, ihre gewohnten Rezeptionsmuster zu verändern bzw. zu ergänzen. Dabei werden die primären Lesarten nicht einfach zunichte gemacht, sondern als Anknüpfungspunkte für eine nachfolgende Diskursivierung begriffen. Eine solche ist allerdings notwendig, wenn Literatur nicht als „bloße Ideologie, Ort des Verkennens, der Kompensation eigener Belanglosigkeit als Subjekt“199 dienen soll. Um dieser reduzierten Funktion schlichter ‘Weltflucht’ zu entgehen, kann es nützlich sein, ein neues Konzept der Kritik (nach der ideologiekritischen Didaktik) namens Dekonstruktion in den Unterricht einzuführen. Diese soll helfen, eine differnenziertere Wahrnehmung der Schüler zu fördern und den binären Schematismus einer eindeutigen Zuordnung von „gut und böse, schön und häßlich, Realität und Fiktion“ als allzu simplifiziert erscheinen lassen.200 Das Ziel eines poststrukturalistischen Literaturunterrichts, in dem die Schüler zu „ sinnkritische[n] Dekonstrukteure[n] “ 201 werden, formuliert Kammler, wie folgt:
Die besondere pädagogische Bedeutung des Literaturunterrichts - sein entscheidender „Nutzen für das Leben“ - bestünde demnach in der exemplarischen Bewußtmachung des Anderen, Gegenläufi- gen, das sich dem eigenen Sinnprojekt nicht unterordnen läßt und in der Erkenntnis der prinzipiellen
Relativität fremder wie eigener Geltungsansprüche bzw. Sinnzuweisungen. Diese Erfahrung könnte eine entscheidende Voraussetzung für die Toleranz gegenüber heterogenen Bewußtseins- und Lebensformen sein [...].202
Damit handelt sich ein solcher Unterricht aber den Vorwurf ein, er befördere den ethischen Relativismus. Kammler gesteht im Anschluß an Fingerhut zu, dass dekonstruktive Lektüren gerade nicht zu festlegbaren Perspektiven oder Werthaltungen führen203 - jedenfalls nicht unmittelbar. Deshalb mahnt er an, dass postrukturalistische Literaturdidaktik ihr sinnkritisches Projekt nicht verabsolutieren darf; es darf nicht vergessen werden, dass es „Werthaltungen von Schülern und Lehrern“ gibt, „die im Erziehungsprozess nicht prinzipiell hinterfragt werden können“.204 Zu Recht verweist Kammler darauf, dass eine solche Verabsolutierung auch einer Theorie der Dekonstruktion widerspräche.205
Kammler referiert auch ein Ergebnis der empirischen Leseforschung, wonach es für Schüler von Bedeutung sei, dass Literatur einen Beitrag zur Bewältigung des eigenen Lebens leiste.206 Gemäß dieser Vorgabe ist es ratsam, auf eine dekonstruktive tabula rasa zu verzichten und stattdessen die Schüler in ihrem Orientierungsbedürfnis ernst zu nehmen. Da dieses schwerlich durch „moralische Unterweisung in vorgefertigte Ideale und Werte“207 geschehen kann, müssen sich die Schüler im Literaturunterricht mit „Werthaltungen in Texten“208 (nicht von Texten) auseinandersetzen. Was man den Schülern hierbei zumuten kann, hängt wesentlich von ihrem literarischen und moralischen Entwicklungsstand ab,209 differenziert Kammler:
Je älter die Schüler [...] werden, desto mehr tritt das Konzept des poststrukturalistischen Literatur- unterrichts auch aus der Sicht der Werteerziehung in sein Recht. Denn spätestens in der Sekundar- stufe II, also beim Übertritt der Schüler von der Stufe konventioneller Moral zu postkonventioneller (vgl. Kohlberg 1974) setzt jene eigenständige ethische Reflexion ein, die die Verallgemeinerungsfä- higkeit moralischer Normen unabhängig von vorgegebenen Regeln, Gesetzen und Autoritäten hin- terfragt.210
Auf den Literaturunterricht bezogen bedeutet dies, dass Schüler mit zunehmenden geistigem Entwicklungsstand immer mehr in der Lage sind, reflexiv und diskursiv mit am Text identifizierten Haltungen von literarischen Figuren umzugehen. Dazu bedarf es erst einmal der Interpretation, die einen notwendigen Bestandteil auch des poststrukturalistischen Literaturunterrichts bildet.211 Wenn dieses aber geleistet wurde, dann läßt sich im kritischen Hinterfragen solcher Wertemuster auch eine je eigene Werthaltung von den Schülern finden. Diese ist oft dadurch gekennzeichnet, dass sie eine (ethische) Position gerade aus der Abgrenzung oder Zurückweisung anderer Werte gewinnt.212 Das Verdienst eines mit dekonstruktiven Lektüren arbeitenden Literaturunterrichts für die „Entwicklung von Selbstorientierung und Eigennormativität “213 besteht für Kammler insbesondere in der Vermeidung einer vorzeitigen Festlegung der eigenen Identität und die damit verbundene Flexibilität des eigenen Lebensentwurfs im Bezug auf neue Perspektiven.214
In einem Vortrag, der auf dem Germanistentag 1997 in Bonn gehalten wurde, beschäftigt sich Kammler mit der Frage, ob Dekonstruktion zum neuen Paradigma in der Literaturdidaktik avancieren sollte.215 Hierzu skizziert er zunächst, was er als ‘Programm’ von Dekonstruktion versteht:
Das Projekt der Dekonstruktivisten ist ein anti-autoritäres. Es besteht - grob gesagt - darin, etablierte Lesarten von Texten zu attakieren, scheinbar Marginales, das von früheren Interpreten oder im Text selbst an den Rand gedrängt wurde, in den Vordergrund zu rücken, um die „logozentrische“ Unterscheidung zwischen Zentralem und Marginalem, Wesentlichem und Unwesentlichem in einem zweiten Schritt grundsätzlich in Frage zu stellen.216
Auch die kontroversen Standpunkte von Hermeneutik und Dekonstruktion stellt Kammler überblicksartig dar, um auf deren teilweise unvereinbare ‘Prämissen’ hinzuweisen.217 Im Spannungsfeld dieser Debatte entwickelt er schließlich seine didaktische Position, die Elemente beider Theoriestränge enthält. So argumentiert er - mit Gadamer -, dass die „Sinn- und Einheits- und Wahrheitserwartung des Lesers“ als „positives Vorurteil“ für die Ermöglichung eines Textverständnisses bei den Schülern von Bedeutung ist.218 Da diesen in der heutigen ‘Erlebnisgesellschaft’ zunehmend solche Erwartungen ausgetrieben werden, sollte der Literaturunterricht dieser Tendenz nicht noch Vorschub leisten, sondern sich vielmehr dagegen zur Wehr setzen, mahnt Kammler an.219 Gleichzeitig warnt er davor, eine solche Erwartungshaltung zum ontologischen Moment jedweden Verstehensaktes zu hypostasieren,220 um darin alle Differenzen und Irritationen in der Auseinandersetzung mit Texten aufheben221 zu können. Er plädiert für einen Respekt für die Differenz, der nicht auf ‘Horizontverschmelzung’ im „Medium einer alles vermittelnden Vernunft [...] der (Wirkungs-)Geschichte“ angelegt ist, sondern auf das „Herausarbeiten jener sich widersprechenden Bedeutungselemente, die nicht erneut zu einer Einheit zusammengefasst werden können“.222 Entgegen dem „universalen Autoritätsanspruch der Tradition“223 bei Gadamer, soll den Schülern die Einsicht vermittelt werden, „daß Geschichte kein objektiv verlaufender Prozeß, daß ‘Tradition’ nicht eine einzige ist, daß eine Vermittlung von Eigenem und Fremden durch kein dialektisches Versöhnungsprogramm garantiert ist.“224
Ferner möchte Kammler unter Beweis stellen, dass Dekonstruktion im Unterricht dazu beitragen kann, ein kritisches Wertebewußtsein bei Schülern hervorzurufen:
[Dekonstruktionen] können [...] einen Beitrag zu jenen Erziehungszielen leisten, die in den Lehrplä- nen unter dem Oberbegriff „soziale Verantwortung“ verankert sind. Einen solchen Beitrag leisten sicher auch „positive Wertevermittlung“ und Lernen durch Identifikation, aber ebenso gehört dazu ein kritisches Instrumentarium, das die Infragestellung verfestigter Denk-, Interpretations- und Wertungsmuster ermöglicht [...]. Dessen Einsatz läßt sich nicht werkimmanent, sondern nur aus der begrenzten historisch-politischen Perspektive der jeweiligen Gegenwart begründen.225
Der gleichsam strategische Einsatz der Dekonstruktion soll insb. dann erfolgen, wenn Lesarten nurmehr ein Voruteil oder Klischee widerspiegeln, das die Schüler unkritisch aus den gegenwärtigen „Alltagsdiskursen“ übernehmen und so „das Aussagepotential des [...] Textes auf ganz bestimmte Weise reduzier[en]“.226 An Büchners Woyzeck macht Kammler die Notwendigkeit deutlich, die gängige - auch von Schülern häufig vorgebrachte - Lesart, „die der untreuen Marie die Schuld am Untergang des Protagonisten gibt“, zu dekonstruieren:227
Diese Reduktion - oder um einen Ausdruck Foucaults zu benutzen: diese Form der „Diskursver- knappung“ [...] - durch einen (hier: männlich-chauvinistischen Typus des Kommentars hat etwas mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu tun. Die Dekonstruktion erfolgt in der Absicht, in die Verhältnisse einzugreifen, sie erfolgt im Hinblick auf das Erziehungsziel, den fairen gleichberechtigten Umgang zwischen den Geschlechtern zu fördern.228
Diese ethisch-politische Dimension von Dekonstruktion stellt Kammler ins Zentrum seines Entwurfs einer mithin dekonstruktiven Unterrichtskonzeption. Der herrschende Diskurs soll von den Schülern kritisch reflektiert oder in Frage gestellt werden. Dies gelingt - wie Kammler am Beispiel einer intertextuellen/-medialen Analyse zum „Ausschwitz-Diskurs“229 aufzuzeigen versucht - „in der Regel erst über den Umweg einer anderen Perspektive, die sich als Perspektive und die gleichzeitig den perspektivischen Charakter jeglicher Bedeutungszuweisung hinterfragt.“230 Indem die Schüler durch einen zusätzlichen Text (oder auch eine weitere Filmsequenz) irritiert werden, werden sie zu einer „zweiten Lektüre“ angeregt,231 die die gewohnte einsinnige Lesart konterkariert und so zur Entwicklung eines kritischen Bewusstseins bei den Schülern beiträgt.
Obwohl Kammler das kritische Potential von Dekonstruktion als ihren spezifischen Nutzen für den Literaturunterricht hervorhebt, möchte er sie dennoch nicht zum neuen Paradigma des Literaturunterrichts erheben. Er plädiert lediglich dafür, sie in dieser besonderen Qualität zu erkennen und sie neben anderen Elementen für den Unterricht fruchtbar zu machen.232
Fasst man die skizzierten literaturdidaktischen Konzeptionen, die eine Integration dekonstruktiver Lektüren in den Deutschunterricht fordern, zusammen, dann lassen sich im wesentlichen zwei Ziele ausmachen: 1. Dekonstruktive Lektüren lassen die (paradoxale) Mehrdeutigkeit von Texten und die Bedeutung von Kontextfaktoren für die Sinngenese erkennbar werden. 2. Durch dekonstruktive Lesarten wird ein kritischer Umgang mit (Primär-)Texten und etablierten Interpretationen gefördert. Auf diese beiden Absichten lassen sich die o.g. didaktischen Positionen bringen. Gemeinsam ist ihnen dabei, dass Dekonstruktion gerade dann zum Einsatz kommen soll, wenn herkömmliche Leseweisen, die das Primat einer hegemonialen Deutung beinhalten, als autoritative Setzungen herausgestellt werden sollen, die die eigentliche Komplexität des literarischen Textes unterschlagen. Das setzt allerdings voraus, dass zunächst einmal eine traditionelle Textanalyse bzw. -interpretation erfolgen muss, damit in einem weiteren Schritt von den Schülern die gewiss sehr anspruchsvolle Arbeit des Dekonstruierens geleistet werden kann.233 Die Problematik, die sich hier abzeichnet, besteht - wie Bremrich-Vos schreibt - in der „Zumutung“ an die Schüler, nicht nur Texte und ihre gängigen Lesarten resp. Interpretationen verstehen zu müssen, sondern ebenso deren Dekonstruktionen.234 Ob diese doppelte oder sogar dreifache Aufgabe von den Schülern bewältigt werden kann, müsste sich in der Praxis erweisen.
Schwierig ist der Einbezug dekonstruktiver Lektüren noch aus einem anderen Grund. Wenn das selbstbestimmte Arbeiten - zur individuellen Kompetenzerweiterung - gefördert werden soll, dann muss es den Schülern auch möglich sein, sich selbst an dekonstruktiven Lektüren zu versuchen. Wie soll aber ein dekonstruktives anything goes in der Auseinandersetzung mit literarischen Texten verhindert werden, ohne die Selbstbestimmtheit der Schüler zu beschneiden und dem Lehrer ein Mehr an Deutungsmacht zuzugestehen ?
Folgenschwerer sind noch die Konsequenzen, die sich aus der institutionellen Notwendigkeit von Notengebung in der Schule ergeben. Wie lassen sich nämlich Leistungen differenziert benoten, wenn keine Textdeutung länger als zutreffender anzusehen ist, bzw. die Unterscheidung von oberflächlicher Bedeutung und subtilem Sinn eines Textes hinfällig ist und verschiedenste Deutungsmöglichkeiten im Prinzip Gleichrangigkeit beanspruchen können ? Nur der Nachweis einer möglichst komplexen Textwahrnehmung könnte bestenfalls als Meßlatte einer Benotung herangezogen werden. Oder sollte der Lehrer die Kreativität/Ungewöhnlichkeit von Deutungen und assoziativen Verknüpfungen zum Bewertungskriterium erheben ? Welche externen Maßstäbe könnte er anlegen, um über die Plausibilität von fragmentarischen Lesarten zu entscheiden ? Ist jedwede Form eines dekonstruktiv- kritischen Umgangs mit Literatur gleichwertig und überdies höherwertig als die Anwendung traditioneller Textbearbeitungsmethoden ?
Auf solche kritischen unterrichtspraktischen Überlegungen geht letztlich keiner der angeführten Didaktiker ein. Wahrscheinlich erscheinen ihnen solche Folgeprobleme auch als eher randständig, da Dekonstruktion ja nur unter vordefinierten Bedingungen im Unterricht erlaubt/erwünscht sein soll. Überdies kann ja im Zweifelsfall auf andere Elemente des literaturdidaktischen Repertoires zurückgegriffen werden, etwa wenn es um evaluative Einschätzungen der Schülerleistungen geht. Mit einer Reduktion auf die pädagogisch gebotene Entwicklung der Kritikfähigkeit von Schülern allein kann aber Dekonstruktion im Unterricht nicht legitimiert werden. Bedenkt man die theoretischen Einsichten, die der Möglichkeit zur Dekonstruktion allererst zugrundeliegen, dann wird eine ‘Einhegung’ derselben, wie sie die genannten Literaturdidaktiker vornehmen, ad absurdum geführt.
So meinen diese z.B., dass lediglich die literarischen Texte dekonstruiert zu werden brauchen; die Revision der Unterscheidung von Metadiskurs und Literatur indes wird von ihnen wohlweislich außer acht gelassen. Denn das hätte die höchst problematische Einsicht zur Folge, dass ein Sprechen oder Schreiben über Literatur ebensowenig transparent und objektivierbar zu machen wäre wie der literarische Referenztext. Vielmehr müsste auch von sog. metasprachlichen Äußerungen behauptet werden, dass sie in einem gewissen Sinne genauso mißverständlich und mehrdeutig sind wie der tendentiell opake Bezugstext und die in der Textdeutung vermutete Intention eines Schülers eine ebensolche Konstruktion seitens des Lehrers darstellt wie die Schüler ihrerseits Interpretations hypothesen dem literarischen Text applizieren, ohne deren Richtigkeit beweisen zu können. Dieses Dilemma läßt sich schwerlich auflösen. Wenn der Lehrer nicht umhin kann, misreadings von Schüleraufsätzen zu vollziehen und es keine Sicherung des richtigen Verstehens mündlicher Schülerbeiträge gibt, dann kann es keinen Maßstab geben, nach welchem die (sachliche) Qualität einer Schüleräußerung festgestellt werden kann. Ferner wird dem Argument, es ließe sich immernoch über die Stringenz und logische Kohärenz von Schüleräußerungen entscheiden, die Grundlage entzogen, wenn man - gemäß einer Theorie der Dekonstruktion - davon ausgehen muss, dass im Text je schon konfligierende, mithin paradoxe Deutungsmuster einbegriffen sind, die diesen dem diskontinuierlich verlaufenden Spiel der Sinnpluralität unterwerfen. Wenn Textauslegungen von Schülern keine innere Konsistenz aufweisen, dann könnte das ja auch daran liegen, dass sie nur die alogische Heterogenität des Textes nachvollziehen, anstatt diese durch eine gewaltsame Totalisierung einer bestimmten ‘Sinnebene’ des Textes zu unterdrücken versuchen.
Vor dem Hintergrund einer derart radikalen Infragestellung gängiger schulischer Praxis qua Dekonstruktion ist es verständlich, warum sich einige der o.g. Literaturdidaktiker nicht (vorbehaltlos) auf die Theorien Derridas oder de Mans beziehen mögen, da dies unweigerlich zu einer Problematisierung der gesamten Unterrichtspraxis führen würde. Bei einer derartigen Differenz zwischen literaturwissenschaftlicher bzw. philosophischer Theorie und einer Didaktik mit reformerischem Gestus ist es allerdings fragwürdig, ob ein Anknüpfen an theoretische Positionen zur Dekonstruktion überhaupt noch gerechtfertigt erscheint. Es läßt sich darin eine Indienstnahme einer momentan im literaturwissenschaftlichen
Diskurs reüssierenden Theorie für die Zwecke eines letztlich pädagogischen Projekts erkennen. Der Lehrer als Initiator von Lernprozessen kann sich nach wie vor als Lebens- und Emanzipationshelfer, als Aufklärer, als Identitäts- oder Sinnstifter gerieren.235 Die unhintergehbare Hierarchie von Lehrendem und Lernendem wird auch von Entwürfen zu einer Didaktik mit dekonstruktiven Elementen nicht erschüttert. Diese Asymmetrie in der pädagogischen Beziehung wirkt sich aber auf die Deutungsmacht der Beteiligten aus, was zur Folge hat, dass den Schülern eine umfassende Emanzipation versagt bleibt. Die Ermöglichung von kritischen Operationen ist vom regulativen Eingreifen des Lehrers abhängig. Auch wenn die Schüler anscheinend eigenständig Texte dekonstruieren können, geschieht dies doch immer unter der Ägide des Lehrers, welcher die Erreichung ganz bestimmter vordefinierter Lernziele damit bezweckt.
Ohne die Dilemmata, die sich aus Versuchen einer Didaktisierung der Dekonstruktion ergeben, im einzelnen darlegen zu können, muss konstatiert werden, dass sich der Anspruch, den eine Theorie der Dekonstruktion erhebt, nicht ohne erhebliche Einschränkungen und Substanzverlust auf pädagogische Konzeptionen übertragen läßt. Dennoch bleiben einige Anregungen, die Literaturdidaktiker aus der fachwissenschaftlichen Debatte über Dekonstruktion abgeleitet haben, durchaus bedenkenswert. Die kritische Funktion, die dekonstruktiven Lektüren hinsichtlich der Einsicht in die Kontext- und Perspektivenabhängigkeit von Deutungen zukommt, sowie die Erkenntnis in die Unabschließbarkeit und Relativität von Interpretationen kann ein wichtiger Bestandteil zum Hinterfagen autoritärer Setzungen sein. Damit können die Schüler ein Stück Selbständigkeit und Souveränität gegenüber den hegemonialen Diskursmustern gewinnen.
Ein abschließendes Urteil über die Relevanz und Praktikabilität von dekonstruktiven Lesarten soll an dieser Stelle nicht abgegeben werden, da sich erst im konkreten Einzelfall die didaktische Sinnhaftigkeit solch unkonventioneller Lektüreformen herausstellen kann. Nur in der Praxis wird sich zeigen, ob sich der Einsatz solcher Lektüren bewährt. Das Ziel dieser Arbeit besteht lediglich darin, einen kleinen Einund Überblick in eine neuere literaturdidaktische Diskussion zu geben, die um die brisanten Theoreme zur Dekonstruktion kreist.
Anmerkungen:
X. Paul Celan, Der Meridian, Rede anläßlich der Verleihung des Georg-Büchner- Preises; in: ders., Ausgewählte Gedichte, hrsg. v. Beda Allemann, 1. Aufl., Frankfurt 1968. Celan zitiert und kommentiert einen Satz(teil) aus dem Lenz -Fragment Büchners. Seine kühne (Be-)Deutung bringt das Unausgesprochene zur Sprache und ist ebenso interpretationsbedürftig wie das Büchnerzitat. Die Mehrdeutigkeit der Wörter bzw. Metaphern „Himmel“ und „Abgrund“ eröffnen einen Auslegungshorizont, der dem Ausgangstext eine ungeahnte Deutungsvariante im wahrsten Sinne des Wortes zu-schreibt(/spicht).
Y. Friedrich Schiller, Spruch des Konfuzius 2; in: ders., Sämtliche Werke in fünf Bänden, Bd. III, München 1968, S. 158.
Um die Brücke buchstäblich über den „Abgrund“ zur Dekonstruktion zu schlagen, sei auf den Aufsatz von Christian Kohlross Dekonstruktion oder die Frage nach dem Grund (s. Anm. 102) verwiesen, in dem die Metaphern vom Bodenlosen resp. Abgrund imText durchgängig zur Charakterisierung der dekonstruktiven Ar- gumentationsperspektive gebraucht werden. Auch der Begriff „Wahrheit“ taucht mehrfach im Text auf; er wird jedoch kontrastierend zum Bild vom „Abgrund“ ver- wendet, ohne dass er dabei direkt als Opposition gekennzeichnet wäre. - Die (scheinbar) aporetische Spannung des Zitats von Schiller läßt sich damit aber intertextuell konnotativ stützen.
Jonathan Culler entgegnet überdies den Kritikern der Dekonstruktion: „Es heißt, das Verfahren der Dekonstruktion bestehe darin, ‘den Ast abzusägen, auf dem man sitzt’. Vielleicht ist das tatsächlich eine passende Beschreibung dieser Akti- vität [...]. Auch wenn ‘den Ast absägen, auf dem man sitzt’ dem gesunden Men- schenverstand als Narrheit erscheint, für Nietzsche [...] und Derrida ist es das gewiss nicht; diese hegen nämlich den Verdacht, daß es keinen ‘ Grund ’ gibt auf den man aufschlagen könnte, falls man fallen sollte, und daß die klarsichtigste Handlung vielleicht tatsächlich ein unbekümmertes Sägen ist, eine kalkulierte Zer- legung oder Dekonstruktion der großen kathedralengleichen Bäume, in denen der Mensch seit Jahrtausenden Zuflucht sucht.“ (s. Literaturangabe unter Anm. 6, S. 165f. - Kursivierungen vom Verfasser dieser Arbeit)
Z. Friedrich Nietzsche, Ü ber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn, in: ders. Werke in drei Bänden, Bd. III, hrsg. v. Karl Schlechta München 1956, S. 314. Im Gegensatz zu dieser These Nietzsches steht die gesamte Geschichte der metaphysischen Philosophie. „Eine Geschichte, die den Ursprung der Wahrheit im allgemeinen von jeher dem Logos zugewiesen hat. Die Geschichte der Wahr- heit, der Wahrheit der Wahrheit ist, bis auf die verschwindende, aber entschei- dende Differenz einer metaphorischen Ablenkung, immer schon Erniedrigung der Schrift gewesen, Verdrängung der Schrift aus dem ‘erfüllten’ gesprochenen Wort“ (Derrida, Grammatologie, S. 12; s. Anm. 7).
Literatur:
Eingangs sei erwähnt, dass die verwendeten Texte von Derrida und de Man nur in der deut- schen Übersetzung angeführt sind, da in der vorliegenden Arbeit durchgängig diese anstelle der französischen bzw. englischen Originale zitiert sind . Um letztere und auch die weiteren Schriften der beiden Theoretiker zu finden, sei auf die Bibliographien in den einschlägigen Einführungen verwiesen (deren aktuellste bei Culler (s.u.) aufgeführt sein dürfte).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Desweiteren ist im Internet unter dem Titel Erweiterter Textbegriff - Dekonstruktion eine ‘Textcollage’ (als work in progress zu einer Diplomarbeit im Hypertextformat) erschienen, die z.T. interessante Zitate (verschiedener Theoretiker) zu einem dekonstruktiven Textver- ständnis enthält. Sie ist unter folgender Adresse abrufbar: http://h2hobel.phl.univie.ac.at/ ~ ibini/texttext.html (Stand: 22.11.’99).
[...]
1. Siehe hierzu: Helmut Brackert / Jörn Stückrath (Hrsg.), Literaturwissenschaft - Ein Grundkurs, Reinbek bei Hamburg 1992.
2. Elisabeth K. Paefgen weist in ihrer Einführung in die Literaturdidaltik (Stuttgart - Weimar 1999) auf zwei Arbeitsbücher für die Oberstufe hin, in denen bemerkt wird, „daß heute alle [i.w.S. interpretativen]Verfahren gleichermaßen Berechtigung hätten“, wodurch „ein Nebeneinander unterschiedlicher Interpretatzionsansätze“ akzentuiert werde (ebd., S. 120).
3. Der Einbezug von Diskurspartikeln und theoretischen Versatzstücken läßt sich an- hand der neuen Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wis- senschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe II (Düsseldorf 1999) beispielhaft machen: Obschon sich um terminologische Neutralität bemüht wird, lassen sich die zugrundeliegenden Dis- kurse letztlich nicht verschleiern. Die Herkunft der im Hintergrund stehenden Denkmodelle lassen sich dennoch teils anhand des Vokabulars, teils anhand der argumentativen Zusammenhänge identifizieren. Die Autoren der Richtlinien taten allerdings gut daran, die Diskursfragmente möglichst wenig als solche kenntlich zu machen, da deren Synthese sonst zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Der Versuch, die divergenten Theoreme miteinander zu verschmelzen kann als Beleg dafür gelten, dass das viel zitierte „Ende der großen Erzählungen“ (Lyotard) auch über die Deutschdidaktik hereingebrochen ist; denn wie sonst ließen sich Lehrplä- ne plausibilisieren, in denen das Vereinheitlichende einer überwölbenden Rah- menkonstruktion (zumindest bei genauerem Hinsehen) aufgegeben ist. Ein detaillierter Nachweis dieser These kann freilich an dieser Stelle nicht geführt werden.
4. So verfährt bspw. Günter Waldmann in: ders., Produktiver Umgang mit Literatur im Unterricht, Grundriss einer produktiven Hermeneutik: Theorien - Didaktik - Verfahren - Modelle, erschienen in der Reihe: Deutschdidaktik aktuell, 2. korr. Aufl., Baltmannsweiler 1999.
5. Hans-Ulrich Gumbrecht führt in seinem Aufsatz Who is afraid of deconstruction? (bezogen auf die Theoriedebatte über Dekonstruktion in Westdeutschland) dazu aus: „[D]as damals noch Fremde ist entweder gar nicht diskutiert worden oder (mit geradezu ‘subkulturellem’ Gestus) unter Ausschluß der ‘offiziellen’ akademischen Öffentlichkeit oder mittels Überblendung geschichtsphilosophischer Perspektive.“ (In: Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, hrsg. v. Jürgen Fohrmann und Har- ro Müller, Frankfurt a. M. 1988, S. 95). - Gumbrecht versucht, die Inkompatibilität des im deutschen Sprachraum vorherrschenden Diskurses gegenüber den im Französischen bzw. Anglomamerikanischen betriebenen Diskursen aus der ge- schichtlich gewachsenen Divergenz dieser Diskurssysteme zu erklären. Er rekur- riert dabei im wesentlichen auf das an geistesgeschichtlichen Traditionen orien- tierte Sebstverständnis der akademischen Zunft und liefert nur vage Hinweise auf die eigentlich theoriebildenden (Dis-)Positionen in der Auseinandersetzung mit De- konstruktion. Wo er direkt auf Derrida oder amerikanische Theoretiker verweist, erscheint seine Argumentation ebenso historisierend wie entstellend.
6. Jonathan Culler, Dekonstruktion - Derrida und die poststrukturalistische Literaturtheo- rie, Neuausgabe,Reinbek bei Hamburg 1999, S. 95.
7. So läßt sich etwa die überwiegende Zahl der Literaturtheorien nicht ohne sprach- philosophische oder erkenntnistheoretische Voraussetzungen denken. Derrida weist z.B. in der Grammatologie nach, dass selbst die Texte de Saussu- res, welche die Grundlage des (sprachwissenschaftlichen) Strukturalismus bilden, ohne direkten Bezug zur philosophischen Tradition, dennoch unterschwellig von den gleichen Grundannahmen wie die abendländische Metaphysik ausgehen (Jacques Derrida, Grammatologie, 6. Aufl., Frankfurt a. M. 1996 (erstmals: 1974).
8. Dietrich Naumann, Wissenschaftstheoretische Voraussetzungen der Texterschlie-ß ung; in: Literaturwissenschaft - Ein Grundkurs, hrsg. v. Helmut Brackert und Jörn Stückrath, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 466 (Kursivierungen und Einfügungen vom Verfasser dieser Arbeit).
9. Sicherlich vollzieht sich wissenschaftlicher Fortschritt häufig, indem versucht wird, die inkommensurablen Phänomene durch eine Korrektur (mithin auch revolutio- näre Veränderung) der theoretischen Grund lagen zu integrieren. Allerdings stehen die Theorien immer unter dem Anspruch das Allgemeine im Besonderen zu erken- nen - und nicht umgekehrt. Dies hat zur Folge, dass am Einzelfall wahrgenom- mene Irritationen zumeist so in den Diskurs eingepasst oder aber marginalisiert werden, dass ihr subversives Potential gebunden wird, bzw. diese schlicht unter- schlagen werden, um die Stringenz der eigenen Arbeit möglichst nicht zu gefähr- den.
10. Peter V. Zima, Die Dekonstruktion - Einführung und Kritik, Tübingen - Basel 1994, z.B. S. 34 / passim.
11. S. ebd. oder auch: David Martyn, Dekonstruktion; in: Literaturwissenschaft - Ein Grundkurs, hrsg. v. Helmut Brackert und Jörn Stückrath, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 664 (und ff.) bzw. Katharina Mai, Artikel zu Jacques Derrida, in: Metz- ler Philosphen Lexikon, hrsg. v. Bernd Lutz , 2. erw. Aufl., Stuttgart - Weimar 1995, S. 205.
12. Das Paradox Bertrand Russells von der Unmöglichkeit der „Mengen aller Men- gen, die sich nicht selber als Elemente enthalten“ (Culler, a.a.O., S. 224), wäre mit der ausweglosen Situation einer als Text dargestellten Texttheorie, die ihre eigene Textualität erklären soll, vergleichbar. Nur indem man den Referenzbe- reich der Texttheorie eingrenzt, etwa indem man Texte nach bestimmten als ty- pologisch angenommenen Merkmalen klassifiziert, läßt sich diese Aporie einiger- maßen auflösen.
13. S. hierzu: Naumann, a.a.O., S. 471.
14. Eine ausführliche Nachzeichnung der Argumentation Derridas findet sich bei: David E. Wellbery, Retrait/Re-entry - Zur poststrukturalistischen Metapherndiskus- sion; in: Poststrukturalismus - Herausforderung für die Literaturwissenschaft, hrsg. v. Gerhard Neumann, Stuttgart - Weimar 1997, insb. Teil II,S. 198-204. Sowohl die „These von der Omnipräsenz metaphorischer Bezeichnungen“ (ebd., S. 198), als auch die Komplikationen dieser These bezogen auf die Abgrenzbarkeit von Ob- jekt- und Metasprache werden dort erläutert.
15. Derrida, Der E n t z u g der Metapher; in: Die paradoxe Metapher, hrsg. v. An- selm Haverkamp, Frankfurt a. M. 1998, S. 199.
16. Ebd., S. 209 (Derrida zitiert aus seiner Schrift La Mythologie blanche).
17. Derrida, Marges - de la philosophie, zit. nach Culler, a.a.O., S. 164.
18. Paul de Man erläutert: „Der Widerstand gegen die Theorie ist ein Widerstand gegen den Gebrauch von Sprache über Sprache. Es ist daher ein Widerstand gegen die Sprache selbst oder gegen die Möglichkeit, daß Sprache Faktoren oder Funktionen enthält, die nicht auf Intuition reduziert werden können. Doch wir scheinen allzu bereitwillig anzunehmen, daß wir wissen worüber wir spre- chen, wenn wir uns auf etwas das ‘Sprache’ genannt wird beziehen [...].“ (Ders., Der Widerstand gegen die Theorie; in: Texte zur Literaturtheorie der Gegen- wart, hrsg. v. Dorothee Kimmlich et al., Stuttgart 1996,S. 322) „Der Zusammen- hang zwischen Theorie und Phänomenalismus wird vom System selbst be- hauptet und bewahrt. Schwierigkeiten treten nur auf, wenn es nicht mehr länger möglich ist, die erkenntnistheoretische Stoßkraft der rhetorischen Dimension des Diskurses zu ignorieren, das heißt, wenn es nicht mehr möglich ist, diese als bloßen Zusatz, als reines Ornament innerhalb der semantischen Funktion zu betrachten.“ (Ebd., S. 323)
19. Damit soll nicht die Möglichkeit einer Unterscheidung generell geleugnet werden. Die Klassifizierung könnte aber nicht mehr mit der Opposition begrifflicher Text vs. rhetorischer Text arbeiten. Vielmehr müsste man zwischen mindestens zwei divergenten Arten von Schreib stil zu unterscheiden versuchen oder aber die differierende gesellschaftliche Funktionalisierung von Texten (qua Konvention) zur Einordnung bestimmter Texte in ein solches Schema heranziehen. Axel Spree argumentiert in diesem Zusammenhang, dass selbst ‘Dekonstrukti- visten’ an der - wenn auch nur - „ institutionelle[n] Trennung von Primär- und Se- kundärtexten“ festhalten müssten. Denn obschon die Deklaration dekonstruktiv verfasster Lektüretexte als Primärtexte dem vorherrschenden wissenschaftlichen Usus zuwiderläuft, bedarf es eben jener Grenzziehung, um derartige dekonstruk- tive „Grenzgänge“ überhaupt durchführen zu können. (Vgl. ders., Kritik der Inter- pretation - Analytische Untersuchungen zu interpretationskritischen Literaturtheorien, Paderborn - München - Wien - Zürich 1995, S. 142/166f.) Es stellt sich allerdings die Frage, ob mit diesem Einwand auch die strategische Absicht solcher Entdif- ferenzierung zureichend erfasst wird. Durch die Zurückweisung einer generellen Unterscheidungsnotwendigkeit wird nämlich auch die Revision der hierarchi- schen Struktur von interpretablen und interpretierendem, von analysiertem und analysierendem (etc.) Text vollzogen. Paul de Man merkt hierzu an: „Die Dekonstruktion ist nichts, was wir dem Text hinzugefügt hätten, sondern sie ist es die den Text allererst konstituiert. [...] Dichtung ist die avancierteste und verfeinertste Form der Dekonstruktion; sie mag sich von kritischen oder diskursiven Texten nach der Ökonomie ihrer Artiku- lation unterscheiden, aber nicht ihrer Art nach.“ (Ders., Allegorien des Lesens, Frankfurt a. M. 1988, S. 48)
20. Naumann, a.a.O., S. 471.
Mit dieser Bezugnahme auf den Pragmatismus soll nicht behauptet werden, dass dekonstruktive Ein- oder besser Ansichten lediglich die Spielart einer solchen philosophischen Position seien. Culler hat deutlich gemacht, dass der pragmatis- tische Konventionalismus auf der Ausschließung devianter Erkenntnisse vom ‘allgemeinen’ Konsens besteht, also Produkt sozialer Prozesse ist. Da dies aber eine Form von Priviligierung der Mehrheitsmeinung in Bezug auf die Definitions- macht über den Wahrheitsbegriff bedeutet, ist der Vernunftdiskurs auf anderer Ebene restituiert. Pragmatische Vernunft wäre demnach abhängig von der mehr- heitlichen Übereinstimmung. Diese Diskursherrschaft würde allerdings zulasten derjenigen ausfallen, welche eine exzentrische oder periphere gesellschaftliche Position innehätten bzw. exkommuniziert wären. Aufgabe von Dekonstruktionen wäre es - und dies ist die politische Seite -, diese Machtgefälle aufzuzeigen und die jeweiligen mehrheitlich geteilten Wahrheitspostulate mit denjenigen der so- zialen Auß en seiter (wie z.B. auch Dichter) zu konfrontieren, um die Relativität ersterer herauszustellen. (S. ausführlicher: Culler, a.a.O., S. 169 ff.)
21. Derrida bezeichnet Dekonstruktion auch als „De-Sedimentierung“ (ders., Gram- matologie, a.a.O., S. 23).
22. Im Das Bedeuten im Text betitelten Abschnitt des Aufsatzes Die Form und das Bedeuten (in: Jacques Derrida, Randgänge der Philosophie, Frankfurt - Berlin - Wien 1976, S. 161ff.) stellt Derrida in einer Husserl-Lektüre das Problematische des Schicht-Begriffs bezogen insb. auf kulturelle und wissenschaftliche Texte heraus. Anstelle der Metapher des Stratums setzt er die des Gewebes, dessen Verflechtungen sprachliche und vor-sprachliche Schichten ineinander verwoben haben. „Diese Textur ist umso unentwirrbarer als sie insgesamt bezeichnend ist: die nicht-ausdrücklichen Fäden sind nicht ohne Bezeichnung.“ (Ebd., S. 163) Diese Ersetzung wird notwendig, da die Schichtungsmetapher, einer Abtragung des sprachlichen Stratums ermöglichen würde: „Hätte die Schicht des Logos ein- fach eine Grundlage, könnte man sie wegnehmen und unter ihr die darunterlie- gende Schicht von nicht-ausdrücklichen Vorgängen und Inhalten erscheinen las- sen.“ (ebd., S. 162) Weil aber „diese Supra-Struktur eine wesentliche und ent- scheidende Rückwirkung auf die Unterschicht* hat“ (ebd.) lässt sie sich nicht ex- trapolieren, um so zum Inhaltlichen selbst vorzustoßen.
23. Zur Metapher des Grundes siehe auch Anm. Y.
Die philosophische Besetzung des ‘Begriffes’ Grund findet sich bspw. bei Heidegger (Siehe hierzu: Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 44).
24. Die Kursivierung „ ü ber sehen“ deutet die eingenommene Metaperspektive an. Das Verbum soll in seiner widersprüchlichen Zweideutigkeit erkannt werden: Einerseits deutet es auf eine souveräne Position hin, die einen/den Überblick gewährleistet; andererseits bedeutet es, dass wesentliche der in den Blick genommenen Phänomene gar nicht erkannt - eben übersehen - werden.
25. Heinz Kimmerle, Jacques Derrida - zur Einführung, 4. erw. Aufl., Hamburg 1997, S. 24.
26. Wenn hier von Behandlung die Rede ist, dann ist damit nicht nur eine Themati- sierung gemeint, sondern auch und vor allem ein „ Eingriff “ (siehe hierzu: Derrida, Randgänge der Philosophie, zit. n. Culler, a.a.O., S. 156 f.).
27. Culler, a.a.O., S. 150.
28. Ebd., S. 172.
29. Bettine Menke, Dekonstruktion. Lesen, Schrift, Figur, Performanz; in: Einführung in die Literaturwissenschaft, hrsg. v. Miltos Pechlivanos et al., Stuttgart - Weimar 1995, S. 117.
30. Ebd.
31. Ebd., S. 121.
32. Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 24.
33. Menke ‘95, a.a.O., S. 121.
34. „ Schrift wird hier schon verwendet als der Name für den Text, der nicht von ei- nem Autor kontrolliert wird und nicht einem, von diesem intendierten, Sinn unter- steht.“ (Bettine Menke, Dekonstruktion - Lektüre: Derrida literaturtheoretisch; in: Neue Literaturtheorien - eine Einführung, hrsg. v. Klaus-Michael Bogdal, Opladen 1990,S. 243) „Da die Schrift das Subjekt konstituiert und zugleich disloziert, ist die Schrift nichts anderes als das Subjekt, wie immer man das auch verstehen mag. Sie wird niemals unter der Kategorie des Subjekts zu fassen sein; denn wie man sie auch modifiziert, bewußt oder unbewußt affiziert - der ganze Verlauf ihrer Geschichte verweist auf die Substantialität einer von Zufälligkeiten unberührten Präsenz oder auf die Identität des Eigenen in der Präsenz des Selbstbezugs.“ (Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 119)
35. Culler, a.a.O., S. 112. Derrida schreibt im „Gespräch mit Julia Kristeva“: „Die Schrift sollte zurücktreten vor der Überfülle eines lebendigen Wortes, das aufgrund der Durchsichtigkeit seiner Notation vortrefflich dargestellt würde und das dem sprechenden Subjekt sowie jenem, das den Sinn, den Inhalt, den Wert empfängt, unmittelbar gegenwärtig wäre.“ (Derrida, Semiologie und Grammatologie - Gespräch mit Julia Kristeva; in: Postmoderne und Dekonstruktion - Texte französischer Philosophen der Gegenwart, hrsg. v. Peter Engelmann, Stuttgart 1990, S. 149)
36. Zit. n. Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 54.
37. Zit. ebd., S. 55.
38. Ebd., S. 55f.
39. Diese etwas spielerische Wortwahl ist als Anspielung auf die Tradition des onto- theologischen Denkens (Attribut v. Derrida) in der abendländischen metaphy- sisch geprägten Geistesgeschichte zu begreifen, die auch in den Texten Saussu- res fortwirkt. - Zudem kommt durch das Wort „Zweifaltigkeit“ die duale Einheit einigermaßen adäquat zum Ausdruck.
40. Vgl. Jürgen Link, Literatursemiotik; in: Literaturwissenschaft - Ein Grundkurs, hrsg. v. Helmut Brackert und Jörn Stückrath, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 16. Mit „materiellem Zeichenträger“ ist hier v.a. die sog. ‘Lautsubstanz’ (Stimme) ge- meint. In einem Seitenhieb auf die - noch zu entfaltende - Problematisierung dieses Zeichenbegriffs durch Derrida formuliert Link: „Bei dieser Kritik handelt es sich um einen philosophischen ‘Overkill’, weil Sassure mit dem Signifikat gar keine platonische Idee, sondern ein ikonisches oder quasi-ikonisches (bildliches) ‘Kon- zept’, d.h. eine ‘Vorstellung’ meinte, die letztlich ebenfalls ihre Materialität besitzt, so daß es letztlich um die Kombination zwei verschiedener Materialitäten geht.“ (Ebd.) Link bezieht sich in der entsprechenden Fußnote auf die Grammatologie. Zum einen ist diese Verkürzung, die platonische Ideenlehre werde ungerechtfer- tigterweise auf die Saussureschen Semiologie übertragen, m.E. so nicht haltbar. Derrida ist in erster Linie bemüht, die theoretische Parallele einer Inferiorisierung der Schrift sichtbar zu machen, sowie die ‘Sprachphilosophie’ Saussures in die Tradition der abendländischen Metaphysik zu stellen. Zum anderen muß sich Link fragen lassen, wie denn diese zweite ‘Materialität’ des Signifikats in sinnvol- ler Weise in Abgrenzung zum Referenten (von dem sich Saussure ja bekanntlich sprachtheoretisch verabschiedet hat - was auch Link anmerkt) zu denken ist. Würde der (quasi-)ikonische Charakter des Signifikats nicht gerade die repräsen- tationale ‘Geste’ eines referenten Zeichens (wenn auch in verallgemeinernder ‘Abstraktion’) wiederholen ? Zudem wären interne Umstrukturierungen des Zei- chensystems - wie Link sie am Beispiel der frühkindlichen Sprachentwicklung aufzeigt (s. ebd., S. 17) - mit einer Art von Ikonizität nur schwer zu vereinbaren.
41. S. z.B. Menke ‘90, a.a.O., S. 246ff.; oder auch: Terry Eagleton, Der Poststruktu- ralismus; in: ders., Einführung in die Literaturtheorie, Stuttgart 1988, S. 110ff.
42. S. hierzu die Ausführungen Derridas in: ders., Die Struktur das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen; in: Texte zur Literaturtheo- rie Gegenwart, hrsg. v. Dorothee Kimmlich et al., Stuttgart 1996, S. 301-13.
43. Eagleton, a.a.O., S. 111.
44. Menke ‘90, a.a.O., S. 248. Culler erläuert die Position Derridas, indem er den Vorurteilen vornehmlich seiner Kritiker begegnet: „[Sie] führt wohl zu einem Skeptizismus in bezug auf die Mög- lichkeit, den Fluß der Bedeutungen anzuhalten und einen Sinn zu finden, der außerhalb des Spiels der Zeichen liegt und diese beherrscht, bedeutet aber nicht [...] [die] Nichtrechtfertigbarkeit, eine Bedeutung einer anderen vorzuziehen. [...] Die Tatsache, daß jedes Signifikat sich auch in der Position des Signifikanten be- findet, bedeutet nicht, daß es keine Gründe gäbe, einen Signifikanten gerade mit diesem Signifikat und nicht mit einem anderen zu verbinden; noch weniger wird dadurch eine absolute Priorität des Signifikanten nahegelegt oder der Text als Signifikantengalaxie definiert [...]. Die strukturale Verdoppelung jedes Signifikats in einen interpretierbaren Signifikanten weist darauf hin, daß der Bereich des Si- gnifikanten eine gewisse Autonomie beansprucht, heißt aber nicht, daß Signifi- kanten keine Signifikate hätten, sondern nur, daß die Signifikate keine Geschlos- senheit erzeugen können.“ (Culler, a.a.O., S. 210) Hinter Derridas Strategie ließe sich also eher die Dementierung jeglicher Sinn-Totalität vermuten als die Postu- lierung der reinen Oberfläche, des Äußerlichen schlechthin.
45. Zima, a.a.O., S. 34.
46. S. ders., a.a.O., S. 39.
47. Saussure, zit. n. Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 91 (Man beachte auch die umfangreichen Fußnoten).
48. Derrida, Grammatologie, a.a.O., 92.
49. Die Belege, die Derrida zur Stützung seiner Thesen in der Grammatologie an- führt, sind vielfältig. Er zeigt Inkonsistenzen/Inkonsequenzen in einer Fülle von philosophischen, linguistischen, anthropologischen und ethnologischen Texten auf.
50. Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 33f.
51. Das Adjektiv ‘disseminal’ ist eine Derridasche Wortschöpfung, die sich vom No- men ‘Dissemination’ herleitet, die Menke, wie folgt, erklärt: „Die Produktivität der Schrift [...], eine ‘primäre’ uneinholbare Zerstreuung, eine ‘erste’ Befruchtung und Verausgabung, heißt auch dissémination. Die Dissémination ist eine irreduzible Polysemie [...]; die nicht wieder anzueignende semantische différance ist als dis- sémination bejaht.“ (Menke ‘95, a.a.O., S. 124 - Zum ‘Nichtbegriff’ der différance: s.u.)
52. Nähere Ausführungen z.B. bei Kimmerle ‘97, a.a.O., Kp. II, S. 31ff.
53. Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 97.
54. Sarah Kofman, zit. n. Menke ‘90, S. 248f. Mai ergänzt: „Der kon-struktive Zug der Dekonstruktion besteht nicht nur darin, eine reduktive Begrifflichkeit wieder zu vervollständigen, sondern darüber hinaus darin, eine neue, nichthierarchische Begrifflichkeit zu entwickeln, die Opposition zur Differenz [hin] zu erweitern.“ (Dies., a.a.O., S. 207)
55. „Es gilt also die Idee des Zeichens [insb. bei Saussure] durch eine Betrachtung der Schrift zu dekonstruieren, einer Betrachtung, die notwendigerweise zusam- mengeht mit einer Sollizitation der Onto-Theologie, indem sie diese in ihrer To- talität gewissenhaft wiederholt und so ihre unangefochtensten Evidenzen er- schüttert.“ (Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 128)
56. Das „Exkommunizierte“ erhält eine Entsprechung in einer Platon-Lektüre Derri- das. In La pharmacie de Platon geht dieser von der Bezeichnung der Schrift als pharmakon, was Heilmittel und Gift bedeutet, aus und reiht es in eine ‘Wortfami- lie’ zusammen mit pharmakeus (Zauberer, Hexer, Gefangener) und pharmakos (der von der städtischen Gemeinschaft ausgeschlossene ‘ Sündenbock ’) ein. - Culler resümiert Derridas Gedankenspiel: „Der Ausschluß des pharmakos reinigt die Stadt, so wie der Ausschluß der Schrift die Ordnung der Rede und des Den- kens reinigen soll.“ (S. hierzu: Culler, a.a.O., S. 157 ff., Zit. S. 159)
57. Die Kursivierung ist als diskrete Anspielung auf die Metapher des Zuges (frz. trait) zu verstehen, die Derrida in wortspielerischem Zusammenhang mit Wörtern wie trait é (Ab-/Behandlung - s. Anm. 24), retrait (Entzug/doppelter Zug), se traite (sich traktieren), der ‘Wortfamilie’ Ziehen im Deutschen (Zug, Bezug, Gezüge, durch-/entziehen ...) usw. im Aufsatz Der Entzug der Metapher setzt (a.a.O.). Richard Rorty schreibt über solche (para-)wissenschaftlichen ‘Obszönitäten’: „Das Schockierendste an Derridas Arbeit ist seine Verwendung mehrsprachiger Wortspiele, scherzhafter Etymologien, aller möglichen Anspielungen und phoni- scher und typographischer Tricks“ (Philosophy as a Kind of Writing, zit. n. Culler, a.a.O., S. 159). Und Culler kommentiert Rorty, wie folgt: „[Diese Tricks] sind schockierend für eine Perspektive, welche die Möglichkeit als selbstverständlich voraussetzt, daß man auf einer festen Basis zwischen authentischen philosophi- schen Verfahrensweisen und Tricks [...], zwischen ‘Show’ und Substanz, zwi- schen kontingenten linguistischen oder textuellen Konfigurationen und der Logik und dem Denken selbst unterscheiden kann. Der Skandal von Derridas Schrei- ben wäre demnach der Versuch ‘zufälligen’ Ähnlichkeiten oder Verbindungen ei- nen philosophischen Status zu verleihen.“ (Kursivierung v. Verf. dieser Arbeit) (Culler, a.a.O., S. 159f.)
58. Jacques Derrida, Die différance; in: ders., Randgänge der Philosophie, Frankfurt - Berlin - Wien 1976, S. 29.
59. Kimmerle hebt hervor, dass gerade dem A als Anfang sbuchstaben der ‘Schrift- ordnung’ Alphabet besondere Bedeutung zukommt. Ferner schlägt er - mit Ha- bermas - den Bogen zur jüdischen Mystik. Gemäß der Auffassung einiger Kab- balisten sei im vieldeutigen Aleph - das im engeren Sinne gar keinen Buchstaben verkörpere - die gesamte Fülle göttlicher Offenbarung versammelt. (Kimmerle‘97, a.a.O., S. 77f.) Somit wäre eine Art Symbolik des Ursprungs (arche) und der Po- lysemie in diese besondere Differenz eingeschrieben. Allerdings hätte sich - wenn man dieser Assoziation folgen will - auch der Bezug zum Transzendentalen in das ‘Schriftwort’ différance eingeschlichen, wie etwa Jürgen Fohrmann be- merkt (S. ders., Ü ber Autor, Werk, Leser aus poststrukturalistischer Sicht; in: Dis- kussion Deutsch, 1990, Heft Nr. 116, S. 584); interessanterweise - und dies wäre dann die ironische Pointe - jedoch nicht durch die Veränderung der mündlichen Artikulation (also in Fortführung der metaphysischen Priviligierung des gespro- chenen Wortes), sondern als schlichte graphische Manipulation.
60. Derrida, Die différance, a.a.O., S. 30.
61. Vgl. Kimmerle ‘97, a.a.O., S. 79.
62. Vgl. Derrida, Die différance, a.a.O., S. 34.
63. Ebd.
64. S. Ebd.
65. Ebd, S. 37 (Kursive Hervorhebung vom Verfasser dieser Arbeit)
66. Ebd. Auf die „Konfrontation zweier unterschiedlicher Gedächnisfigurationen (mneme und hypomnesis)“ bei Platon „ - einerseits Wachstafel, andererseits Magazin -“ hat Manfred Weinberg hingewiesen (Ders., Das Gedächtnis der Dekonstruktion; in: Poststrukturalismus - Herausforderung für die Literaturwissenschaft, hrsg. v. Ger- hard Neumann, Stuttgart - Weimar 1997, S. 27). Auf die Metapher der Wachsta- fel - einschließlich seiner Konsequenzen für die Memoria - nimmt Derrida an dieser Stelle Bezug. - Über dessen Gedächniskonzeption schreibt Weinberg: „So liegt die Sprengkraft des Derridaschen Gedächnisses eher in einem (unmö- glichen) ‘Zugleich’ [...] von der die Zeitlichkeit des Erinnerns reflektierenden, auf Ursprung, Ganzheit und Einheit setzenden Anamnesis und der auf die Zeichen- haftigkeit des Gedächnisses in Erinnerung rufenden Memoria.“ (Ebd., S. 33)
67. Derrida setzt an die Stelle des einfachen Ursprungs im Sinne eines transzenden- talen Signifikats die sog. „Urschrift“ (archi-écriture), welche er als „Bewegung der *Differenz“ (=différance) versteht (Derrida, Grammatologie, S. 105). „Urschrift wäre ein Name für diese Vielfältigkeit (complicité) der Ursprünge. Und was in ihr verloren geht, ist der Mythos von der Einfältigkeit (simplicité) des Ursprungs. Ein Mythos, der an den Begriff des Ursprungs selbst gebunden ist: an das Wort, welches den Ursprung hersagt, an den Mythos des Ursprungs und nicht nur an die Ursprungsmythen.“ (Ebd., S. 167f.)
68. Vgl. Derrida, Die différance, a.a.O., S. 44.
69. Derrida, Grammatologie, S. 169.
70. Vgl. ebd., S. 149.
71. Menke ‘90, S. 252. (Kursive Hervorhebung vom Verfasser dieser Arbeit)
72. Das Verb wirken indiziert hier nicht nur ein Moment der Beeinflussung i.w.S. oder einen kausalen Zusammenhang (im Sinne von: Wirkung tun, bewirken, sich aus- wirken, fort-/nachwirken usw.), sondern trägt potentiell auch die Spur von wirken eines Gewebes im Sinne von erzeugen einer Textur. Wenn man das Gewebe als Metapher versteht, die dem Text-Begriff allererst zugrunde liegt (vgl. Anm. 20), dann wird deutlich, wie das „‘Wirken’ der Spur“ den Text durchzieht. In de Mans Lektüre von Kleists Aufsatz Ü ber das Marionettentheater findet sich ein interessantes Beispiel für das ‘Wirken’ von Spuren im Text: „Wenn es in den abschließenden Zeilen des Kleistschen Textes von K heißt, er sei ‘ein wenig zer- streut’*, dann sind wir im Zuge alles dessen, was vorangeht, gehalten, zerstreut * nicht bloß als geistesabwesend, sondern auch als auseinandergeworfen, zer- teilt und zergliedert zu lesen. Die Ambiguität zerreißt die flüssige Kontinuität jeder der vorangegangenen Erzählungen. Und wenn am Ende der Geschichte das Wort Fall * so überdeterminiert ist, daß es sich vom Sündenfall über den Fall des toten Pendels der Puppenglieder bis zum Fall der Deklination von Nomen und Pronomen erstreckt, dann hat jedes Kompositum, das Fall * einschließt - Beifall*, Sündenfall*, Rückfall* oder Einfall* - eine disjunktive Vielzahl von Bedeutungen angenommen. [...] Wie wir aus einem anderen erzählenden Texten Kleists wis- sen, erscheinen die denkwürdigen Tropen, die den größten Beifall finden, als bloße Einfälle in dem Moment, in dem der Autor jede Kontrolle über ihre Bedeu- tung aufgegeben hat und zurückgefallen ist in die extreme Formalisierung und mechanische Ablesbarkeit grammatikalischer Fälle. / Aber Fälle * liegt im Deut- schen sehr nah bei Falle - und die Falle dürfte das letzte und äußerste Textmo- dell dieses und jenes Textes sein, [...] die letzte Falle, ebenso unausweichlich wie tödlich.“ (De Man, Allegorien des Lesens, a.a.O., S. 230f.) Culler kommentiert diese ‘riskante’ Praxis der Dekonstruktion: „Wenn sie [die De- konstruktion] sämtliche Bedeutungen zitiert, die in einem Wörterbuch für ein Wort eingetragen sind oder durch morphologische oder etymologische Bezüge in ihm verbunden sind, dann nur, um durch diese kontingenten Assoziationen Verbindungen zu dramatisieren, die sich in unterschiedlicher Aufmachung wie- derholen und zu einer paradoxen Logik ihren Beitrag leisten. [...] [Der ‘Dekon- strukteur’] spielt nicht mit Worten, er setzt sie ein, verwendet sie strategisch im Hinblick auf größere Ziele. [...] Andererseits aber [ ] stellt die Bezugnahme auf textuelle und linguistische Konfigurationen [...] die Möglichkeit in Frage zwischen Sprach- oder Textstrukturen und Denkstrukturen, zwischen dem Kontingenten und Wesentlichen eindeutig unterscheiden zu können.“ (Ders., a.a.O., S. 162)
73. Derrida, Die Struktur, das Zeichen und das Spiel ..., a.a.O., S. 312. Das Attribut ‘seminal’ wird in diesem Zusammenhang in (s)einer übertragenen Bedeutung verwendet, wonach es in Opposition zum Adjektiv ‘disseminal’ als ‘bedeutungsgenerierend’ verstanden werden kann (S. auch Anm. 49).
74. Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 123. (Siehe auch Culler, a.a.O., S. 213)
75. „Aber kann man sich nicht eine Gegenwart und Selbstgegenwart des Subjekts vor seinem Sprechen oder seinem Zeichen, eine Selbst-Gegenwart des Subjekts in einem schweigenden und intuitiven Bewußtsein denken“, fragt Derrida und er- klärt: „Eine solche Frage setzt voraus, daß vor dem Zeichen oder außer ihm, un- ter Ausschluß jeglicher Spur und jeglicher différance, so etwas wie Bewußsein möglich ist. Und daß Bewußtsein, noch bevor es seine Zeichen über Raum und Welt verstreut, sich in seiner Anwesenheit zu fassen vermag.“ (Ders., Die diffé- rance, a.a.O., S. 42) Eine solche Präexistenz des Bewusstseins wird von Derrida jedoch negiert, denn „das Subjekt wird nur bedeutend (generell durch Sprechen oder andere Zeichen), wenn es sich in das System von Differenzen einschreibt. In diesem Sinne wäre das [...] Subjekt ohne das Spiel der [...] différance sich selbst als Sprechendem oder Bedeutendem nicht gegenwärtig.“ (Ebd., S. 41f.) „[A]ber es besteht keine Möglichkeit, daß der Vertretene selbst irgendwo ‘exis- tiert’, gegenwärtig ist, und noch weniger, daß er bewußt wird.“ (Ebd., S. 46) Eagleton führt die quasi-psychologische Konsequenz dieses Denkens näher aus: „[D]a Sprache etwas ist, woraus ich bestehe, und nicht so sehr ein bequemes Werkzeug, das ich benutze, muß auch der ganze Gedanke, daß ich eine stabile, einheitliche Entität bin, Fiktion sein. Nicht nur, daß ich niemals für einen anderen völlig gegewärtig sein kann; ich kann es auch mir selbst gegenüber nicht. Auch wenn ich meine eigenen Gedanken sehe oder meine Seele durchforsche, brau- che ich Zeichen, und das heißt, daß ich niemals die Erfahrung einer ‘vollkom- menen Kommunikation’ mit mir selbst machen kann. Es ist nicht so, daß ich eine reine, unbefleckte Bedeutung, Intention oder Erfahrung haben könnte, die dann durch das makelbehaftete Medium Sprache verzerrt und gebrochen wird: da die Sprache die Luft ist, die ich atme, kann ich eine reine, unbefleckte Bedeutung oder Erfahrung gar nicht erst haben.“ (Eagleton, a.a.O., S. 113 - Kursivierung vom Verfasser dieser Arbeit) S. ferner die Ausführungen de Mans in seinem Aufsatz Hypogramm und Inschrift; in: Die paradoxe Metapher, hrsg. v. Anselm Haverkamp, Frankfurt a. M. 1998, S. 410f. (Ausgehend von Descartes’ Diktum cogito ergo sum, entwickelt de Man ungeachtet dessen daraus gezogenen Kon- sequenzen, die Hypothese von einem bloß halluzinatorischen Bewußtsein.)
76. Das Wort Sinn wird in verschiedenen Kontexten unterschiedlich verwendet: Der Sinn von Texten gründet in der hermeneutischen Tradition in der Intention des (wie auch immer gearteten) Autors, sich verständlich zu machen. Vom In- terpreten eines Textes muß diese Implikation mit einem ‘Verstehen-Wollen’ be- antwortet werden. Das Ergebnis dieses Sich-Einlassens auf eine gegebene Sinn- haftigkeit eines Textes ist die ‘Wiederentdeckung’ seines Sinns in der textgerech- ten Interpretation. Hans-Georg Gadamer schreibt hierzu: „Jede Rückgang auf den Text - ob es sich um einen wirklichen, schriftlich fixierten Text oder um die bloße Wiederholung des im Gespräch Geäußerten handelt, gilt gleichviel - meint die ‘Urkunde’, das ursprünglich Gekündete oder Verkündete, das als sinnhaft Identisches gelten soll. Was allen schriftlichen Fixierungen ihre Aufgabe vor- schreibt, ist eben, daß diese ‘Kunde’ verstanden werden soll. Der fixierte Text soll die ursprüngliche Kundgabe so fixieren, daß ihr Sinn eindeutig verständlich wird. Hier entspricht der Aufgabe des Schreibenden die Aufgabe des Lesenden, Adressaten, Interpreten, zu solchem Verständnis zu gelangen, d.h. den fixierten Text wieder sprechen zu lassen. Insofern bedeutet Lesen und Verstehen, daß die Kunde auf ihre ursprüngliche Authentizität zurückgeführt wird. Die Aufgabe der Interpretation stellt sich immer dann, wenn der Sinngehalt des Fixierten strit- tig ist und es gilt, daß richtige Verständnis der ‘Kunde’ zu gewinnen. ‘Kunde’ aber ist nicht, was der Sprechende bzw. Schreibende ursprünglich gesagt hat, son- dern was er hat sagen wollen, wenn ich sein ursprünglicher Gesprächspartner gewesen wäre.“ (Gadamer, Text und Interpretation; in: Forget, Philippe (Hrsg.), Text und Interpretation, München 1984, S. 39) Einer der Begründer der analytischen Philosophie, Gottlob Frege, differenziert zwischen den Begriffen ‘Sinn’, ‘Bedeutung’ und ‘Vorstellung’: Während die ‘Vor- stellung’ ein individuelles/subjektives inneres Bild bezeichnet, das eine mit Ge- fühlen behaftete Erinnerung darstellt (im Unterschied zu Saussure), ist die ‘Be- deutung’ an die konkreten Gegenstände gebunden (in modernerer Terminologie ließe sich vom Referenten sprechen), welche „Wahrheitswert“ besitzt. Der ‘Sinn’ ist schließlich die Summe an Gedanken zu einem Wort oder Satz, wobei zu be- rücksichtigen ist, dass diese Gedanken ein intersubjektives Gemeingut sein kön- nen. Darüberhinaus unterscheidet Frege zwischen gewöhnlicher Bedeutung und ‘ ungerader ’ Bedeutung, sowie zwischen gewöhnlichem und ‘ ungeradem ’ Sinn. Die sog. ‘ungerade’ Bedeutung bildet für ihn aber einen gewöhnlichen Sinn. (S. Gottlob Frege, Ü ber Sinn und Bedeutung; in: ders., Kleine Schriften, hrsg. v. Ignacio Angelelli, Darmstadt 1967, S. 143-162) - In dieser Unterscheidung Fre- ges wird in einem Zeichen eine primäre Bedeutung vorausgesetzt (vgl. S. 147), die letztlich unabhängig vom Sinn besteht (linguistisch könnte man von Denota- tion sprechen). Der Sinn wäre bereits eine Kontextualisierung von Zeichen(fol- gen), die einerseits konventioneller, intersubjektiver Art ist (gewöhnlicher Sinn), andererseits aber auch subjektiv gefärbt sein kann (‘ungerader’ Sinn). An dieser Distinktion zwischen zwei unterschiedlichen Arten Sinn (bei Frege) läßt sich die Differenz von Hermeneutik und Dekonstruktion klarmachen. Während Hermeneutik dem intersubjektiven Einvernehmen über Sinn den Vorrang ein- räumt, ist dekonstruktiv arbeitenden Theoretikern dieses angebliche Einverneh- men suspekt, weshalb sie gerade ungewöhnliche oder extravagante Lesarten produzieren (denen -mit Frege gesprochen- ein ‘ungerader’ Sinn zugrunde liegt). Obwohl Frege die traditionelle Hierarchisierung von eigentlichem und unei- gentlichem Sinn vornimmt und damit der Hermeneutik relativ nahe zu kommen scheint, so gibt es dennoch bei ihm eine gewisse Skepsis gegenüber der Re kon- struktion von Sinn zumindest in dichterischen Texten (S. Frege, a.a.O., S. 147). Freges Modell steht aber letztlich in Opposition zu beiden Positionen. Denn für ihn gibt es Bedeutung jenseits eines (Sinn-) Zusammenhang s, was sowohl Her- meneutiker wie auch ‘Dekonstrukteure’ bestreiten würden; bei ersteren ist dieser in Form eines Verstehenshorizontes relativ festgelegt, bei letzteren sind die Kon- textualisierungsmöglichkeiten potentiell unendlich (Vgl. Horst Steinmetz, Sinn- festlegung und Auslegungsvielfalt; in: Literaturwissenschaft - Ein Grundkurs, hrsg. v. Helmut Brackert und Jörn Stückrath, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 477f. / S. auch die Ausführungen von Culler, a.a.O., S. 137). Für die konstitutive Abhängigkeit der Bedeutung vom Sinnzusammenhang in her- meneutischer Perspektive liefert Gadamer ein beinahe satirisch anmutendes Beispiel. Von Journalisten gebeten, den ‘Begriff’ „Jugend“ zu kommentieren, for- muliert Gadamer folgendes: „Gerechtigkeit - Olympiade. Leider muß ich Sie ent- täuschen. Ich kann mir kein Wort auch nur im Traume vorstellen, wenn dasselbe nicht in einem Sinnzusammenhang eine Bedeutung bekommt. Beim besten Wil- len erkläre ich mich als unfähig.“ (Die Zeit, Nr. 1, 29.12.1999, Beilage Leben, S. 20 -- Kursivierung vom Verfasser dieser Arbeit)
77. „[T]oute thèse est une prothèse“ (Derrida, Glas, zit. n. Culler, a.a.O., S. 151).
78. Culler, a.a.O., S. 243.(Kursive Hervorhebung vom Verfasser dieser Arbeit)
79. Harro Müller, Zur Kritik herkömmlicher Hermeneutikkonzeptionen in der Postmo- derne; in: Diskussion Deutsch, 1990, Heft Nr. 116, S. 593.
80. S. Culler, .a.a.O., S. 150f.
81. Harro Müller, Hermeneutik oder Dekonstruktion ? Zum Widerstreit zweier Interpre- tationsweisen. In: Ä sthetik und Rhetorik - Lektüren zu Paul de Man, hrsg. v. Karl Heinz Bohrer, Frankfurt a. M. 1993, S. 108.
82. Unter traditioneller Hermeneutik soll hier die Tradionslinie „von Friedrich Schleier- macher über Wilhelm Dilthey [...] bis hin zu Hans-Georg Gadamer“ gerechnet werden (Müller ‘93, a.a.O., S. 98). Das es auch andere Konzeptionen (literatur-) wissenschaftlicher Hermeneutik gibt, darauf hat Joachim Jacob hingewiesen (ders., Exkurs: Literarische Hermeneutik; in: Einführung in die Literaturwissen- schaft, hrsg. v. Miltos Pechlivanos et al., Stuttgart - Weimar 1995, S. 337ff.).
83. Müller ‘93, a.a.O., S. 98f. (Kursivierungen vom Verfasser dieser Arbeit)
84. Listen solcher Gegensatzpaare finden sich bei Müller (ders. ‘90, a.a.O., S. 590) oder Kimmerle (ders., Gadamer, Derrida und kein Ende; in: Allgemeine Zeit- schrift für Philosophie, Jg. 16, 1991, Nr. 3, S. 66). Beide Autoren kritisieren je- doch diese von anderen Theoretikern angeführten (Denk-)Schemata. So gibt Müller zu bedenken, dass der (dort zitierte) Typologisierungsversuch Hassans - welcher allerdings auf die sog. ‘Postmoderne’ in toto angewendet wird - das Modell binärer Oppositionen, den Schematismus der Moderne, nur wiederholt. Überdies werde - so Müller - in diesem Zusammenhang bei Hassan eine Art Epochenunterscheidung getroffen, die historisch nicht markiert werden könne. Kimmerle verweist auf den dialektischen Zug solcher dichotomen Gegenüberstellungen und konstatiert: „Dies ist ein Denktypus, den beide Kontrahenten hinter sich gelassen haben.“(Ebd.)
85. Müller ‘93, a.a.O., S. 111.
86. Derrida, Die Struktur das Zeichen und das Spiel..., a.a.O., S. 305. Wie Weinberg anführt, gelte es für Derrida zwar, sich der Sprache der Metaphy- sik zu entledigen, aber Derrida schreibt auch von der Unmöglichkeit dieses Un- terfangens: „Nicht aber versuchen, sich ihrer zu entledigen, weil das unmöglich ohne das Vergessen unserer Geschichte geht, sondern man muß davon träu- men. Nicht versuchen sich ihrer zu entledigen, was sinnlos wäre und uns um das Licht des Sinns bringen würde, sondern ihr so weit wie möglich zu widerstehen.“ (Derrida, Die Schrift und die Differenz, zit. n. Weinberg, a.a.O., S. 26, Anm. 13) In der metaphorischen Wendung „Licht des Sinns“ scheint ein illuminatives Mo- ment der ‘Sinnfiktion’ auf. Der konventionalisierte Bildbereich von Licht hat in epi- stemologischer Verwendung zumeist Konnotationen wie erhellend, oder empha- tischer: erleuchtend. Diese positiv besetzten Be-Deutungen scheinen Derrida be- wußt zu sein, wenn er vom „Licht des Sinns“ in Anlehnung zum Phrasem „Licht der Erkenntnis“ schreibt. Es ist offensichtlich, dass Derrida nicht ‘Sinn’ generell suspendieren möchte, sondern lediglich bestrebt ist, ihn als kontingenten Faktor im Erkenntnisprozess zu begreifen. (S. auch Anm. 76)
87. S. Philippe Forget, Text und Interpretation, München 1984. Eine nachträgliche Auseinandersetzung mit der von Forget als „unwahrscheinliche Debatte“ bezeichneten Begegnung von Gadamer und Derrida findet sich bei: Kimmerle ‘91, a.a.O. Während Gadamer von der ‘Macht des Guten Willens’ zum Verstehen des an- deren (d.h. auch des Textes) als Axiom eines geglückten Dialogs (auch mit dem Text - was auch immer damit gemeint sein soll) ausgeht, spricht Derrida von des- sen ‘gutem Willen zur Macht’ und meint damit, das zwar ethisch als positiv zu be- wertende Bemühen Gadamers um ein solches Verstehen, was aber letztlich in seiner tatsächlichen Auswirkung den Gestus der diskursiven Machtergreifung re- installiert. Im Gegensatz dazu ist Derrida folgender Ansicht: „Ich bin nun meiner- seits nicht sicher, ob wir eben diese Erfahrung überhaupt machen, die Professor Gadamer meint, nämlich daß im Dialog ‘Einvernehmen’ oder erfolgsbestätigende Zustimmung zustandekommt.“ (Text und Interpretation, a.a.O., S. 58) Gadamer polemisiert gegen diese ‘Einstellung’: „Wird er [Derrida] enttäuscht sein, daß wir uns nicht verständigen können? Aber nein, das wäre in seinen Augen ein Rück- fall in die Metaphysik. Er wird also befriedigt sein, weil er in der privaten Erfah- rung der Enttäuschung seine Metaphysik bestätigt sieht. Doch vermag ich nicht zu sehen, daß er damit auch nur für sich selbst recht hat und mit sich selbst im Einverständnis ist. Daß er sich dabei auf Nietzsche beruft, verstehe ich sehr gut. Aber eben, weil sie beide gegen sich selbst unrecht haben: Sie reden und schrei- ben, um verstanden zu werden.“ (Ebd., S. 60f.) - Gadamer muß sich allerdings nachsagen lassen, dass er selbst hinter seiner Forderung, „den anderen so stark wie möglich zu machen, so daß seine Aussage etwas Einleuchtendes bekommt“ (ebd., S. 59), zurückbleibt, indem er Derrida geradezu systematisch missver- steht. Ein Beispiel für diese - hermeneutisch gesprochen - Fehlinterpretation der Texte Derridas findet sich in Gadamers Aufsatz Destruktion und Dekonstruktion (in: ders., Gesammelte Werke: Hermeneutik II, Tübingen 1986, S. 361-72). Dort gibt Gadamer eine ungenaue Auslegung Derridascher Schriften, die sich mit dessen komplexer Argumentation kaum auseindersetzt, sondern vielmehr die einmal gewonnene Vorurteilsstruktur repliziert. Eine detaillierte Kritik des Aufsatzes würde an dieser Stelle zu weit führen.
88. Manfred Frank, Die Grenzen der Beherrschbarkeit der Sprache; in: Text und In- terpretation, a.a.O., S. 181.
89. Ebd., S. 197. (Kusivierungen vom Verfasser dieser Arbeit) Franks Position verbindet eine aus der deutschen Romantik hergeleitete und an Schleiermacher orientierte Hermeneutik mit einem (neo-)strukturalistischen Zei- chenmodell im Anschluß an Saussure und Lacan. Sie ist relativistischer als der Standpunkt Gadamers, aber auch intersubjektivistischer und gleichwohl eher am Subjekt ausgerichtet als Derridas dekonstruktiver Ansatz. Zwei kurze Zitate sol- len Franks Auffasssung kennzeichnen: „Nicht die Auslegung verfehlt also [...] den ursprünglichen Sinn der Textäußerung; der Text selbst besitzt Sinn nur dià hypóthesin, nur vermutungsweise.“(Ebd., S. 202) „Da alle Deutung schöpferisch und alle Schöpfung ein factum ex improviso ist, vermittelt jede divinatorische Lektüre wie jedes eigentliche (Zu)hören ein Erlebnis von Freiheit.“(Ebd., S. 212)
90. S. hierzu: Hans-Georg Gadamer, Wirkungsgeschichte und Applikation; in: Re- zeptionsästhetik - Theorie und Praxi s, hrsg. v. Rainer Warning, München 1975, S. 113-25.
91. Derrida, Grammatologie, a.a.O., S. 152.
92. Gadamer, Text und Interpretation, im gleichnamigen Sammelband, a.a.O., S. 35.
93. De Man, Allegorien des Lesens, a.a.O., S. 111.
Menke führt dazu aus: „Lesen ist ‘etwas’ lesen; dies kann aber nur im (arbiträren) Akt der Setzung konstituiert werden, Möglichkeit und Unmöglichkeit zu lesen zu- gleich: Darum bringt Lesen stets erneut Allegorien hervor, und seien es die sei- ner selbst, und darum kann die Herausforderung der ‘Inkonsistenz’, ‘etwas’ sa- gen zu wollen, nur stets wieder gelesen werden.“ (Dies., De Mans ‘ Prosopopöie ’ der Lektüre. Die Entleerung des Monuments; in: Ä sthetik und Rhetorik - Lektüren zu Paul de Man, hrsg. v. Karl Heinz Bohrer, Frankfurt a. M. 1993, S. 55)
94. Zima, a.a.O., S. 93.
95. Menke ‘95, a.a.O., S. 127.
96. De Man, Allegorien des Lesens, a.a.O., S. 110.
97. Ebd., S. 39. (Kursivierung v. Verfasser dieser Arbeit)
98. S. Zima, a.a.O., S. 97ff.
99. S. De Man, Allegorien des Lesens, a.a.O., S. 37f.
100. Ebd., S. 40.
101. In der dt. Teilübersetzung seines Buches, unter dem Titel Allegorien des Les- ens (a.a.O.) erschienen, setzt sich de Man u.a. mit Texten von Proust, Nietz- sche, Rilke und Kleist auseinander.
102. Jürgen Fohrmann resümiert das Ergebnis dieser Lesartenproduktion folgender- maßen: „Zwei Lesarten, eine literale und eine figurale, ständen im grammati- schen und im logischen Sinne gleichberechtigt nebeneinander, auch wenn ihre jeweils zugeordneten Bedeutungen vollständig kontrovers sein mögen.“ (Ders., Misreadings revisited. Eine Kritik des Konzepts von Paul de Man; in: Ä sthetik und Rhetorik - Lektüren zu Paul de Man, hrsg. v. Karl Heinz Bohrer, Frankfurt a. M. 1993, S. 82) Dies führt ihn dann zu dem Fehlschluss, de Man gehe von der „Annahme einer reinen Analyse von Figuration“ (ebd., S. 87) aus. Eine grundsätzliche Trennung von literaler und figuraler Bedeutung wird von de Man - entgegen der Ansicht Fohrmanns - allerdings fundamental bezweifelt: „Die Abhängigkeit der Rede von der Figur ergibt sich noch aus einer viel grund- sätzlicheren Beobachtung heraus: Tropen sind weder ästhetisch, als Ornamen- te, noch semantisch, als figurative Bedeutungen, die sich von buchstäblichen Benennungen herleiten, zu verstehen. Eher ist das Umgekehrte der Fall. Die Trope ist keine abgeleitete, marginale oder anormale Form der Sprache, son- dern das linguistische Paradigma par exellence. Die figurative Struktur ist nicht Sprachmodus unter anderen, sondern zeichnet die Sprache insgesamt aus.“ (De Man, Allegorien des Lesens, a.a.O., S. 148) Durch diese Generalisierung des rhetorischen Prinzips erklärt de Man gerade die Unmöglichkeit, zwischen literaler und rhetorischer Bedeutung unterscheiden zu können (Vgl. auch Zit. zur Fußnote 97 /S. auch de Man Hypogramm und Inschrift (a.a.O.), wo sich de Man kritisch mit den Schriften des rhetorisch argumentierenden Literaturtheore- tikers Michael Riffaterre auseinandersetzt). Was de Man allerdings einander gegenüberstellt, ist die Rhetorik und die Grammatik eines Textes, um daran zu zeigen, dass es die grammatikalische Struktur nicht vermag, die Rhetorizität des Textes zu determinieren. Christian Kohlross schreibt hierzu: „Durch ein solches Verfahren [(die Dekonstruktion Paul de Mans)] soll gezeigt werden, in welch hohem Maße Grammatik rhetorische und Rhetorik ihrerseits grammati- sche Züge aufweist - und eben deshalb Rhetorik und Grammatik einander nicht kontradiktorisch entgegengesetzt werden dürfen.“ (Ders., Dekonstruktion und die Frage nach dem Grund, Einigeüberlegungen im Anschluß an den imfiniten Be- gründungsregreß bei Paul de Man; in: Deutsche Vierteljahresschrift für Literatur- wissenschaft und Geistesgeschichte, Jg. 69, 1995, Nr.2, S. 372) Kohlross’ wei- tere Kennzeichnung des de Manschen Vorgehens als Selbsreferentialisierung seines dekonstruktiven Textes und dessen Ende in der Unentscheidbarkeit ist durchaus als eine nachvollziehbare Lesart zu bezeichnen. Sein Verweis auf eine Art infiniten Begründungsregress, der die Verstetigung dieser Selbstrefe- rentialisierung bedeuten soll (eine Analogie fände sich etwa im Konzept der un- abschließbaren Selbstreflexion beim ‘frühen’ Fichte), ist jedoch in de Mans Text „Semiologie und Rhetorik“ (Allegorien des Lesens, a.a.O., S. 31-51), auf den sich Kohlross weitestgehend bezieht, nicht zu finden. De Man beläßt es nämlich bei der Unentschiedenheit in der doppelten, grammatischen und rhetorischen Struktur der Texte (einschließlich seines eigenen). So kann er schließlich kon- statieren, die Differenz zwischen Literatur und Literaturwissenschaft sei Trug (vgl. ebd.,S. 50).
103. Jörg Lau, Der Jargon der Uneigentlichkeit; in: Merkur (Sonderheft: Postmo- derne), Jg. 52, 1998, Heft 9/10, S. 949.
104. Titel des Essays von Lau (s. Anm. 103).
105. Vgl. ebd., S. 951.
106. Ebd.
107. Der literarisch-kryptische Charakter der Texte Derridas läßt sich exemplarisch mit dem Text Che cos' è la poesia? - Was ist Dichtung? (in: ders., Auslassungs- punkte - Gespräch e, hrsg. v. Peter Engelmann, Wien 1998, S. 299ff.) veran- schaulichen. Auf der Website der philosophischen Fakultät der Universität Wien findet sich ein ’Textcluster’ in dem solche Schreibweisen von poststrukturalisti- schen Theoretikern mit bestimmten romantischen Texten verglichen werden. Sie werden - freilich recht plakativ - folgendermaßen charakterisiert: „Ueber- schneidungen also ueberall. Unentscheidbarkeiten, Unlesbarkeiten. Der herme- tische Text, der sich mannigfaltig aus-legen, nicht FEST-legen laeßt, der sich aufdraengt und verweigert, der sich entzieht und laestigfaellt, der sich ‘seiner’ Hermeneutik ohne Muehe verwehrt.“ (im Internet unter folgender Adresse: http://h2hobel.phl.univie.ac.at/ ~ ibini/texttext.html. Stand: 22.11.’99)
108. Vgl. de Man, Allegorien des Lesens, a.a.O., S. 50 / bzw. Anm. 102 (unten).
109. Eine ähnliche Vorgehensweise führt Albert Bremrich-Vos vor: Ders., Herme- neutik, Dekonstruktivismus und produktionsorientierte Verfahren - Anmerkungen zu einer Kontroverse in der Literaturdidaktik; in: Literarisches Verstehen - Litera- risches Schreiben, hrsg. v. Jürgen Belgrad / Hartmut Melenk, Baltmannsweiler 1996, S. 25-49.
110. Waldmann, a.a.O., S. 10-13 (Zit. S. 12).
111. Ebd.; siehe auch Bremrich-Vos, a.a.O., S. 31.
112. Waldmann, a.a.O., S. 11f. (Kursive Hervorhebungen v. Verfasser dieser Arbeit)
113. Derrida schreibt: „Wenn sich die Totalisierung alsdann als sinnlos herausstellt, so nicht, weil sich die Unendlichkeit eines Feldes nicht mit einem Blick oder einem endlichen Diskurs erfassen läßt, sondern weil die Beschaffenheit dieses Feldes - eine Sprache, und zwar eine endliche Sprache - die Totalisierung aus- schließt: dieses Feld ist in der Tat das eines Spiels, das heißt unendlicher Substitutionen in der Abgeschlossenheit (cl ô ture) eines begrenzten Gan- zen. Dieses Feld erlaubt die unendlichen Substitutionen nur deswegen, weil es endlich ist, weil ihm im Gegensatz zum unauschöpfbaren, allzu großen Feld der klassischen Hypothese etwas fehlt: ein Zentrum, das das Spiel der Substitutio- nen aufhält und begründet. [...] Die Bewegung des Bezeichnens fügt etwas hin- zu, so daß immer ein Mehr vorhanden ist; diese Zutataberbleibt flottierend, weil sie die Funktion der Stellvertretung, der Supplementierung eines Mangels auf seiten des Signifikats erfüllt.“ (Ders., Die Struktur das Zei- chen und das Spiel ..., a.a.O., S. 310f. - Hervorhebungen durch gesperrten Druck vom Verfasser dieser Arbeit)
114. Vgl. ebd., S. 10. (Zu möglichen Ähnlichkeiten zwischen der hermeneutischen Theorie bei Schleiermacher und der Theorie Derridas müßte man in Texten Franks recherchieren, laut Culler (a.a.O., S. 329) empfiehlt sich insb. Manfred Frank, Das Sagbare und das Unsagbare: Studien zur neuesten französischen Hermeneutik und Texttheorie, Frankfurt a.M. 1980.)
115. Untertitel seines Buches: Waldmann, a.a.O. (S. Anm. 4)
116. S. Frank, a.a.O. /Vgl. Anm. 89. Eine gewisse Skepsis hingegen wird gegenüber der hermeneutischen Theorie Diltheys und Gadamers von Waldmann im Unterkapitel 1.7 (Ders., a.a.O., S. 21-26) artikuliert. Er kritisiert dort die genialistische Hypostasierung des Interpreten in der Hermeneutik Diltheys, deren Konsequenz die Unmöglichkeit methodischer Vermittlung bedeutet. An Gadamers Position erscheint ihm die dogmatische Autorisierung der Überlieferungsgeschichte als Richtschnur für adäquates Textverstehen problematisch.
117. Waldmann, a.a.O., S. 14.
118. Waldmann, a.a.O., S. 14f. (Zit. S. 15)
119. Ebd., S. 15.
120. Ebd.
121. Jürgen Förster, Subjekt - Geschichte - Sinn . Postmoderne, Literatur und Lektüre; in: Der Deutschunterricht (Stuttgart), 1991, Heft 4, S. 59.
122. Ebd., S. 64.
123. Ebd., S. 69.
124. Ebd., S. 70.
125. Ebd., S. 74.
126. Siehe ebd., S. 71.
127. „Dabei soll es weder um eine explizite literaturwissenschaftliche Interpretation dieses Textes noch um eine Auseinandersetzung mit dem OEuvre des Autors gehen. Vielmehr soll der Text lediglich als Folie dienen, um einige der ange- sprochenen Phänomene zu entfalten und zu veranschaulichen [...].“(Förster ‘91, a.a.O., S. 60)
128. Siehe Förster, a.a.O., S. 70, Anm. 24 (Zit. ebd.).
129. Ebd., S. 77.
130. So ist etwa die Existenz eines dekonstruktiven Moments - laut Paul de Man - für alle (literarische) Sprache konstitutiv (Vgl. de Man, Allegorien des Lesens, a.a.O., S. 48f.). De Man dekonstruiert Texte Prousts genauso wie Texte Kleists. David Martyn versucht sich z.B. an der Dekonstruktion des Goethe-Gedichts Ein gleiches (ders., a.a.O., S. 672-75). Letzteres ist allerdings etwas problema- tisch: Unter Einbezug traditioneller Interpretationen konstruiert Martyn Wider- sprüche in das Gedicht, obwohl er doch nur die fragwürdigen Deutungen ihrer paradoxen Argumentation überführen kann. Indem er aber argumentiert, jene Interpretationen wiederholten nur das im Text Gegebene (ebd., S. 675), ‘stiehlt er sich aus der Affaire’, ohne jedoch am Text selbst interne Aporien nachweisen zu können. Die von Martyn unterstellte Paradoxie, das im Text thematisierte Schweigen werde im Gedicht gewissermaßen hörbar, ist nur unter der Voraussetzung, das Gedicht impliziere seinen mündlichen Vortrag, haltbar. Macht man diese Prämisse jedoch nicht und reiht den Text - wie unter Dekonstrukteuren üblich - unter die Kategorie schriftliche Artefakte ein, dann läßt sich dieser Widerspruch nicht aufrechterhalten. Man könnte sodann behaupten, der Text widersetze sich seiner Dekonstruktion.
131. Siehe ebd., S. 78.
132. Siehe ebd.
133. Ebd.
134. Ebd., S. 79 (Kursivierungen vom Verfasser dieser Arbeit)
135. Ebd. (Kursivierungen vom Verfasser dieser Arbeit)
136. Paefgen, a.a.O., S. 123.
137. Siehe ebd. Distanzierung vom Text bedeutet in diesem Zusammenhang ein Abstand-Neh- men von subjektiver Betroffenheit oder emotionaler Involviertheit.
138. Die Ähnlichkeit de Manscher Lektüren zum Verfahren des close reading (im New Critisism - s. hierzu: Eagleton, a.a.O., S. 59ff.) wird u.a. von Spree aufge- zeigt (ders., a.a.O., S. 176f.). Er stellt jedoch heraus, dass de Man noch näher am Text operiert und dadurch die Totalisierungsversuche des New Critisism subvertieren kann. - Für diese ‘distanzierte Nähe’ zum literarischen Text ist de Mans Lektüre auf die multidimensionale Analyse desselben angewiesen.
139. Förster ‘91, a.a.O., S. 78.
140. Siehe Jürgen Förster, Literatur und Lesen im Wandel - Möglichkeiten einer ande- ren Literaturrezeption in der Schule; in: Der Deutschunterricht (Stuttgart), 1995, Heft 6, S. 8 (Zit. ebd.).
141. Ebd.
142. Kaspar H. Spinner, Literaturdidaktik der 90er Jahre; in: Handlungsfeld Deutsch- unterricht im Kontext, Festschrift für Hubert Ivo, hrsg. v. Albert Bremrich-Vos, Frankfurt a. M. 1993, S. 23.
143. Vgl. ebd.,
144. Diese wird ausführlich dargestellt im Aufsatz Historische Diskursanalyse - Fou- cault und die Folgen von Clemens Kammler (in: Literaturwissenschaft - Ein Grund- kurs, hrsg. v. Helmut Brackert und Jörn Stückrath, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 630-39).
145. Siehe Spinner ‘93, a.a.O., S. 31f.
146. Siehe ebd. (Zit. S. 32)
147. Vgl. ebd., S. 32.
148. Ebd.
149. Vgl.Kaspar H. Spinner, Poststrukturalistische Lektüre im Unterricht - am Bei- spiel der Grimmschen Märchen; in: Der Deutschunterricht (Stuttgart), 1995, Heft 6, S.9ff.
150. Siehe ebd., S. 10.
151. Ebd., S. 12f.
152. Ebd., S. 13. Die analytische Unterscheidung zwischen Oberflächen- und Tiefenbedeutung läßt sich im didaktischen Modell zur Tiefenhermeneutik von Jürgen Belgrad erkennen (ders., Detektivische Spurensuche und archäologische Sinnrekon- struktion - die tiefenhermeneutische Textinterpretation als literaturdidaktisches Ver- fahren; in: Literarisches Verstehen - Literarisches Schreiben, hrsg. v. Jürgen Belgrad / Hartmut Melenk, Baltmannsweiler 1996, S. 133-48). Ausgehend von der Freudschen Differenzierung zwischen manifestem und latentem Sinn, ent- wickelt Belgrad (im Rekurs auf Alfred Lorenzer) eine Konzeption, die zwischen der „Ebene der Paraphrasierung von Aussagen“ und der „Schicht der Konnota- tionen“ unterscheidet (ebd., S. 137). Solche Ebenen sind aber - wie dieser ein- gestehen muß - nicht eindeutig zuzuordnen: „Wir wissen aber nicht per se, ob gerade eine zweite manifeste Schicht oder ob eine darunterliegende latente Schicht freigelegt wurde. [...] ‘Manifest’ und ‘latent’ markieren [also] zunächst nur Richtungen der Interpretation, nicht unbedingt dichotomische Ebenen. Wahrscheinlich wäre es genauer, von manifesteren und latenteren Sinnschich- ten zu sprechen. / Zweitens produzieren Text-Leser-Verhältnisse unterschied- liche Lesarten und damit unterschiedliche manifeste und latente Inhalte.“(Ebd., S. 137f.) Diese grundlegende Relativierung führt Belgrad zu der Frage, ob sich „Sinn- Rekonstruktionen “ damit erübrigen, da es laut Poststrukturalisten angeb- lich „beliebig viele Sinn- Konstruktionen “ gebe (vgl., ebd., S. 138). Und er beant- wortet sie „theoretisch mit ‘ja’, aber praktisch eher mit ‘nein’ “ (ebd.). Denn aus pragmatischen Gründen, sei es sinnvoll auf eine hinreichende „ Konsensfähig- keit von Interpretationen“ zu achten: „Es geht zum einen um die Wahrschein- lichkeit einer Lesart und zum anderen um die Einbettung der Interpretation in gängige und akzeptierte Schemata und Praktiken der Argumentation über Lite- ratur.“ (Ebd. - s. dazu auch: Anm. 20) Der sog. commmon sense entscheidet über die Triftigkeit der Interpretationen und darüber, ob diese bloß ‘oberfläch- lich’ (also: manifest) oder aber ‘tiefgründig’ (also: latent) sind. Anhand eigener Unterrichtserfahrungen belegt Belgrad, dass sein Verfahren des Indiziensammelns und anschließender gemeinsamer Plausibilisierung von Deutungsvarianten auch dazu führen kann, dass mehrere Interpretationen gleichermaßen zutreffen können (s. ebd., S. 145ff.). Er schreibt hierzu: „Das mag manche Eindeutigkeitsfetischisten beunruhigen, bewahrt aber Schüler und Lehrer vor der falschen Hoffnung, Texte, vor allem Märchentexte, ließen sich einfach auf eine eindeutige Rezeption bzw. Interpretation festlegen.“(Ebd., S. 147) - Wenn er im Ergebnis durchaus mit Spinner übereinkommt, wozu bedarf es dann noch seiner Hierarchie von latentem und manifestem Sinn ? Bzw. füh- ren nicht gerade die latentesten Sinnschichten am wenigsten zur intersubjekti- ven Übereinstimmung ? Bzw. wenn Belgrads tiefenhermeneutisches Verfahren ebenso auf eine Nichtentscheidbarkeit über die ‘Wahrscheinlichkeit’ von Inter- pretationsvarianten hinausläuft, warum beruft er sich dann nicht auf eine gene- relle Diversität von Sinnangeboten im Text ?
153. Spinner ‘95, a.a.O., S. 14.
154. Ebd.
155. Siehe ebd.
156. Ebd.
157. Ebd. (Kursivierung vom Verfasser dieser Arbeit)
158. Siehe ebd., S. 15.
159. Siehe ebd., S. 16ff.
160. Siehe unter Anm. 76. Derridas Diktum „il n’y a pas de hors de texte, il n’y a pas dehors de contexte“ (zit. z.B. bei Müller ‘90, a.a.O., S. 591) läßt sich als emphatisches ‘Motto’ für die Unhintergehbarkeit kontextueller Wirkungen verstehen. Denn wenn es nichts außer Text und Kontext gibt, dann ist jeder Text immer schon kontextuell eingebunden und jeder Text gleichzeitig Kontext eines anderen. Da es in einem solchen textuellen Kosmos aber kein ordnendes Zentrum gibt (s. Anm. 113), kann nicht zwischen Text und dessen zugehörigem Kontext unterschieden werden. Die Kontexte werden potentiell unendlich.
161. Siehe Spinner ‘95, a.a.O., S. 16f.
162. Siehe hierzu insb. Culler, a.a.O., Teil II, Kp. 3 „Aufpfropfungen“, S. 149-73.
163. Siehe Bremrich-Vos, a.a.O., S. 34ff.
164. Spinner ‘93, a.a.O., S. 30.
165. Vgl. Bremrich-Vos, a.a.O., S. 36. Bremrich-Vos vertritt den Standpunkt: „Wer im literaturdidaktischen Kontext darauf setzt, daß literarische Lektüre Fremdverstehen befördert und zur Ausbildung von Ich-Identität beiträgt, vertraut auf einen Begriff von Ich-Identität, der dem Dekonstruktivismus gerade suspekt ist. Deshalb ist es m.E. widersprüchlich, wie Kaspar Spinner sowohl auf Dekon- struktion als auch auf ein Konzept von Ich-Identität zu setzen.“ (Ebd., S. 42) Eine ausführliche Entfaltung der Negation autonomer Subjekte in der Theorie Derridas siehe ebd., S. 41.
166. Spinner ‘95, a.a.O., S. 11. (Kursive Hervorhebung vom Verfasser dieser Arbeit)
167. Karlheinz Fingerhut, „ Auf den Flügeln der Reflexion in der Mitte schweben “ - Desillusionierung und Dekonstruktion. Heines Ironische Brechung der klassisch- romantischen Erlebnislyrik und eine postmoderne „ doppelte Lektüre “; in: Der Deutschunterricht (Stuttgart), 1995, Heft 6, S. 40-55. Das bruchstückhafte Zitat ist dem bekannten Athenäumsfragment Nr. 116 von Friedrich Schlegel entnommen, im Satzzusammenhang heißt es dort: „Und doch kann auch [die Poesie] am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer Reihe von endlosen Spiegeln vervielfachen.“ (Kriti- sche Friedrich-Schlegel-Ausgabe, hrsg. v. Ernst Behler et al., München - Paderborn - Wien -Zürich 1967, Bd. II, S. 182) Da im Aufsatz Fingerhuts keine Auseinandersetzung mit Schlegel stattfindet, erscheint die Anspielung auf dessen kryptisches Fragment etwas dekorativ.
168. Fingerhut ‘95, a.a.O., S. 40f.
169. Ebd., S. 41.
170. Obwohl sich Fingerhut gegen eine Bezugnahme auf dekonstrutiv arbeitende Theoretiker verwahrt, wird hier implizit eine gewisse Nähe zu einem Standpunkt Derridas deutlich. Ansonsten ist Fingerhut gegenüber der Einbeziehung von be- stimmten dekonstruktiven Theoremen in didaktische Modelle durchaus skep- tisch: „Eine Übernahme der theoretischen Umwertungen der gesamten wissen- schaftstheoretischen, sprachtheoretischen und literaturtheoretischen Prämis- sen, mit denen Derrida oder Jonathan Culler operieren, ist [...] nicht erforderlich. Auch die rigorose Negationsbeziehung zwischen erster und zweiter Bedeutung, von der Paul de Man ausgeht, ist für die Integration der dekonstruktiven Lektü- repraxis eher hinderlich als befördernd. Es geht [lediglich] um die Schärfung der Textwahrnehmung für unterschwellige und gegenläufige Bedeutungen, an de- ren Konstruktion der Leser selbst einen angemessenen Anteil hat. [...] John R. Searle hat schon 1983 [...] in seiner Kritik an Culler und Derrida herausgestellt, daß, wenn es keine exakte und eindeutige Methode zur Bestimmung von Autor- intention und ‘Bedeutung’ eines Textes gibt, daraus keineswegs geschlossen werden darf, daß es sich überhaupt nur um Fiktion und Metaphorik handelt, wenn von ‘Textsinn’ die Rede ist. Die postmoderne Ineinssetzung von Realität und Textualität hält Searle dementsprechend für eine unzulässige Übergenera- lisierung [...]. Für die hier erörterte literaturdidaktische Frage heißt das: Auch wenn die Arbeit an literarischen Texten im Unterricht nicht zu feststellbaren Per- spektiven (Werthaltungen) der Werke führt, wenn Leser sich selbst als Sinn- Konstrukteure erleben, ist dies kein Grund, der literarischen Bildung eine Absa- ge zu erteilen.“ (Fingerhut ‘95, a.a.O., S. 46) Fingerhut grenzt die didaktische Relevanz dekonstruktiver Theorieansätze auf eine spezifische Lektürepraxis ein, denn diese lässt sich einigermaßen pro- blemlos ins Unterrichtsgeschehen integrieren. Die Radikalität mit der die ge- nanntenTheoretiker der Dekonstruktion die generelle Fiktionalität und vielfältige Bedeutung von Texten postulieren, steht nämlich im Konflikt mit seinem Verständnis von der „Realitätshaltigkeit“ von Texten (ebd., S. 45).
171. Derrida, The Conflict of Faculties, zit. n. Culler, a.a.O., S. 173.
172. Fingerhut ‘95, a.a.O., S. 41.
173. Vgl. ebd., S. 42.
174. Ebd.
175. Ebd., S. 43.
176. Siehe das Zitat zur Fußnote 152, sowie die Anm. dazu.
177. Fingerhut ‘95, a.a.O., S. 46.
178. Ebd., S. 45.
179. Ebd., S. 55.
180. Ebd., S. 46.
181. Siehe ebd., S. 44.
182. Ebd., S. 52.
183. Vgl. ebd. S. 54f.
184. Ebd., S. 55.
185. Ebd.
186. Karlheinz Fingerhut, Produktive, heuristische und dekonstruktive Lektürespiele; in: Deutschunterricht (Berlin), 1998, Nr. 12, S. 563.
187. Ebd., S. 565.
188. Vgl. ebd., S. 565f.
189. Siehe ebd., S. 569-74 passim.
190. Siehe ebd., S. 572f.
191. Ebd., S. 568.
192. Ebd., S. 570(ff.)
193. Ebd., S. 568. Am Beispiel Kafka kann Fingerhut zeigen, wie hermeneutische Sinnfindungs- prozesse ins Leere laufen können: „Die Desorientierung seiner gewohnten Re- zeptionsmuster verführt den Leser zu einem detektivischen Nachdenken, zu ständig scheiternden Versuchen, erklärende Deutungshypothesen zu verfol- gen.“(Ebd., S. 565f.) „Durch die Verwirrung am Anfang der ‘kleinen Geschichte’ zwingt Kafka seine Leser, die Dekonstruktion ihres Sprach- und Wirklichkeits- modells, [...] mit massiven Rekonstruktionen zu beantworten. Diese Rekon- struktionen können als Deutungsspiele definiert werden.“(Ebd., S. 570) Die Rede von einem „detektivischen Nachdenken“ bzw. von „Rekonstruktionen“ können als Anspielung auf das tiefenhermeneutische Modell Belgrads gelesen werden; dieser beschreibt das Interpretationsverfahren als „[d]etektivische Spu- rensuche und archäologische Sinnrekonstruktion“(ders., a.a.O., S. 133). Im Un- terschied zu Belgrad gelangt der Spuren lesende ‘Text-Detektiv’ bei Fingerhut allerdings nicht zur wahrscheinlichen Lösung des Falles, sondern seine spieleri- schen Rekonstruktion en bewegen sich auf der Ebene des „Mögklichkeitssinns“ (Musil).
194. Rolf Selbmann, Vom Lesen leerer Blätter - Postmoderne und Poststrukturalismus als Herausforderungen der Literaturdidaktik; in: Deutschunterricht (Berlin), 1998, Nr. 12, S. 576. (Kursive Hervorhebung vom Verfasser dieser Arbeit) Auf eine eingehende Auseinandersetzung mit dem o.g. Aufsatz soll an dieser Stelle verzichtet werden, da Selbmann darin weitestgehend eine theoretisch be- gründete „Analyse“ des Gedichts Das leere Blatt von Hans Magnus Enzensber- ger, die „zugleich als Expermiment wie als Modell gedacht“ist, vorführt (ebd.). Die didaktische Diskussion wird dabei allerdings größtenteils außer Acht gelas- sen.
195. Der Didaktiker Ulf Abraham möchte gerade einen solchen allein auf kognitive Operationen abgestellten Unterricht um Formen der subjektiv-emotionalen Text- verarbeitung bereichern, damit sich die Schüler auch mit ihren Gefühlen und in ihrer Persönlichkeit ernst genommen fühlen.(S. hierzu: Paefgen, a.a.O., S. 121ff.)
196. S. Clemens Kammler, Vom Nutzen und Nachteil der Literaturwissenschaft für das Leben - Poststrukturalistische Literaturdidaktik und Werteerziehung; in: Deutschunterricht (Berlin), 1997, Heft 4, S. 173. (Hier wird explizit auf Fingerhut (‘95) Bezug genommen.)
197. Ebd.
198. Ebd.
199. Ebd., S. 171.
200. Vgl. ebd., S. 172.
201. Ebd.
202. Ebd., S. 173.
203. Vgl. ebd., S. 174.
204. Ebd.
205. Vgl. ebd.
206. Vgl. ebd.
207. Ebd.
208. Vgl. ebd., S. 175.
209. Vgl. ebd., S. 174.
210. Ebd., S. 175
211. Vgl. ebd.
212. Vgl. ebd.
213. Ebd., S. 176.
214. Vgl. ebd., S. 175f.
215. Clemens Kammler, Dekonstruktion -Ein neues Paradigma für die Literaturdidak- tik?,Manuskript (Ausg. letzter Hand) eines Vortrags, der auf dem Germanisten- tag 1997 in Bonn gehalten wurde.
216. Ebd., S. 1.
217. Siehe ebd., S. 2ff. Neben den Differenzen arbeitet Kammler auch mögliche Übereinstimmungen heraus. Er bezieht sich explizit auf den Aufsatz von Bremrich-Vos (a.a.O.) und gibt diesem in zwei Punkten Recht (vgl. Kammler ‘97, a.a.O., S. 2f.): 1. Die de- konstruktive Lektüre setzt eine erste hermeneutische Lesart, welche auf das Verstehen des Textganzen ausgerichtet ist, voraus. 2. Die Unabschließbarkeit des Prozesses der Bedeutungskonstitution (unendliche Semiose) ist hermeneu- tisches Gemeingut.
218. Vgl. ebd., S. 3
219. Vgl. ebd.
220. Vgl. ebd.
221. Das Verb „aufheben“ zeigt an, dass Gadamer sich in gewisser Hinsicht in der Tradition Hegels befindet (s. auch Kammler ‘97, S. 4).
222. Siehe Kammler ‘97, a.a.O., S. 3f.
223. Ebd., S. 4.
224. Ebd., S. 5.
(Siehe auch unter den Fußnoten 90 und 91)
225. Ebd., S. 5.
226. Vgl. ebd.
227. Ebd.
228. Ebd.
229. Ebd., S. 6. Kammler macht folgenden unterrichtspraktischen Vorschlag (ebd., S. 7ff.): Die Schüler sollen zunächst eine Szene aus dem oscarprämierten Hollywood- film Schindlers Liste (Regie: Steven Spielberg) anschauen, in der Schindler den humanen Befehl gibt, den in Viehwaggons zusammengepferchten Juden Wasser zu geben, damit diese nicht verdursten müssen. Im Zentrum dieser Se- quenz steht das menschliche Handeln des Protagonisten, der sich sichtlich be- troffen zum beherzten Eingreifen entschließt. Kammler rechnet mit der nachvoll- ziehbaren Reaktion der Schüler, dass sie sich mit dem emotional-ergriffenen ‘Helden’ identifizieren und dessen Perspektive der Abscheu vor der Grausam- keit einnehmen. Diese rein affektive Betroffenheit stellt sich bei den Schülern auf folgende Weise ein: „Der ‘Sieg’ des Helden [über die Unmenschlichkeit] in dieser Situation löst bei vielen Schülern kathartische Effekte aus.“ (Ebd., S. 7) Danach werden die Schüler mit einem Auszug aus Ruth Klügers Roman weiter leben konfrontiert, der die o.g. Filmszene gewissermaßen kommentiert. Dort heißt es: „In Filmen oder Büchern über solche Transporte [...] steht der Held nachdenklich am Fenster oder vielmehr an der Luke und hebt ein Kind zur Lu- ke, oder einer der draußen ist, sieht einen Häftling an der Luke stehen. Aber in Wirklichkeit konnte nur einer da stehen, und der hat den Platz nicht so leicht aufgegeben und war von vornherein einer mit Ellenbogen.“ (Zit. ebd., S. 8) Zum einen dekonstruiert Klüger durch den Perspektivenwechsel ins Innere den Platz des Helden, zum anderen wird dieses Heldenbild von den Erinnerungen einer Überlebenden unterminiert, wenn Klüger die reale Rücksichtslosigkeit der an den Luken stehenden Gefangenen gegenüber ihren Leidensgenossen be- hauptet. Diese Kontrastierung gegenüber Spielbergs Film könnte helfen, „die andere Seite des Helden und die Opfer in ihrer Gesamtheit“, welche in Schind- lers Liste marginalisiert werden, im Unterricht zu thematisieren. Darüberhinaus schlägt Kammler eine weitere Irritation der Schüler vor, eine Auseinanderset- zung mit dem Roman eines Schicksalslosen von Imre Kertesz. Darin wird ver- schiedentlich die vermeintliche ‘Banalität’ des Grauenhaften durch euphemisti- sche Wendungen und einen geradezu bagatellisierenden Stil heraufbeschwo- ren. Die „Qualität dieses Buches als Erziehungsroman“ wird von Kammler, wie folgt, erläutert: „Indem der Erzähler dieses autobiographischen Romans darauf besteht, die Täter- oder besser Mitläuferperspektive einzunehmen und der Text diese Perspektive dennoch ständig unterminiert, wird die übliche Rollenvertei- lung Täter und Opfer aufgehoben. Das ist es wodurch dieses Buch verletzt. Seine Leser - vorausgesetzt sie haben überhaupt schon etwas über Ausschwitz begriffen - werden in ein Wahrnehmungsschema hineingezogen, das sie in der Regel als ‘das Andere’ ausgegrenzt haben: Immer schon standen sie auf der Seite der Opfer und des Widerstandes. Das Entscheidende ist [...] die Aufhe- bung der Täter/Opfer-Hierarchie, innerhalb derer sie sich bislang problemlos der moralisch überlegenen Seite zuschlagen konnten. Indem der Unterricht die primäre Lesart dekonstruiert, schafft er die Voraussetzung für das Hinterfragen dieser Rollenverteilung. Die Frage ‘ Was Ausschwitz bedeutet ’ kann so auf einem neuen Niveau gestellt werden. Dieses Niveau zeichnet sich entscheidend durch die bessere Einsicht in die Begrenzheit der eigenen Perspektive und des Verstehens als solchen aus.“ (Ebd., S. 10) Die Gefahr einer Relativierung oder Verharmlosung von Ausschwitz wird dabei von Kammler für denkbar gehalten. Deshalb gibt er folgende Vorsichtsmaßre- gel: „Auch diesen Text kann man mit Schülern nicht voraussetzungslos lesen und dekonstruieren. Nur diejenigen, die bereits begriffen und emotional vollzo- gen haben, daß Ausschwitz der Ausdruck äußerster Barbarei war, werden überhaupt wahrnehmen können, daß sich eine zweite Lektüre geradezu auf- drängt.“ (Ebd., S. 9) Nur im Wissen um die beispiellose Grausamkeit dieser Massenvernichtung kann es gelingen, diese vom Text marginalisierte Tatsache gegen den oftmals geradezu zynischen Erzählgestus ins Spiel zu bringen. Wie ein Einvernehmen darüber aber definitiv gewährleistet werden soll, ohne dass ein Risiko der Verharmlosung besteht, dazu macht Kammler keinerlei Aussage. Allerdings kann die kritische Auseinandersetzung mit einem solchen (ethisch) diffizilen Text auch dazu beitragen, dass die Schüler aufmerksamer werden für die subtilen Formen des Relativismus.
230. Kammler ‘97, a.a.O., S. 8f.
231. Vgl. ebd., S. 8.
232. Siehe ebd., S. 10f.
233. Vgl. Bremrich-Vos, a.a.O., S. 47.
234. Vgl. ebd.
235. Vgl. Hans Kügler, Die bevormundete Literatur - Zur Entwicklung und Kritik der Lite- raturdidaktik; in: Literarisches Verstehen - Literarisches Schreiben, hrsg. v. Jür- gen Belgrad / Hartmut Melenk, Baltmannsweiler 1996, S. 11.
- Arbeit zitieren
- Norbert Frank Kempen (Autor:in), 1999, Die Widerspenstigkeit der Texte - Über das Problem der Literaturdidaktik mit einer Theorie der Dekonstruktion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105617
Kostenlos Autor werden








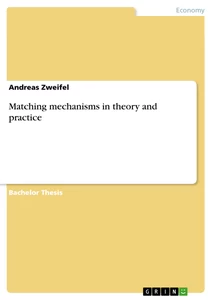
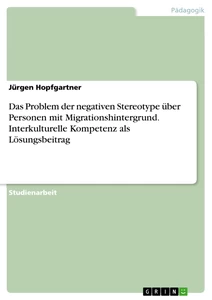

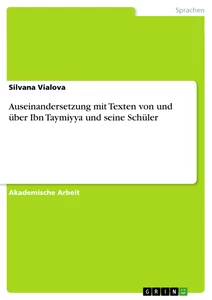

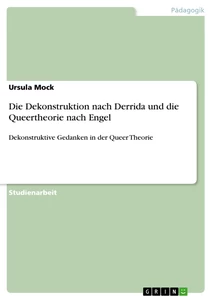

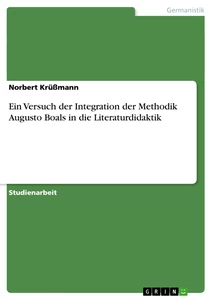




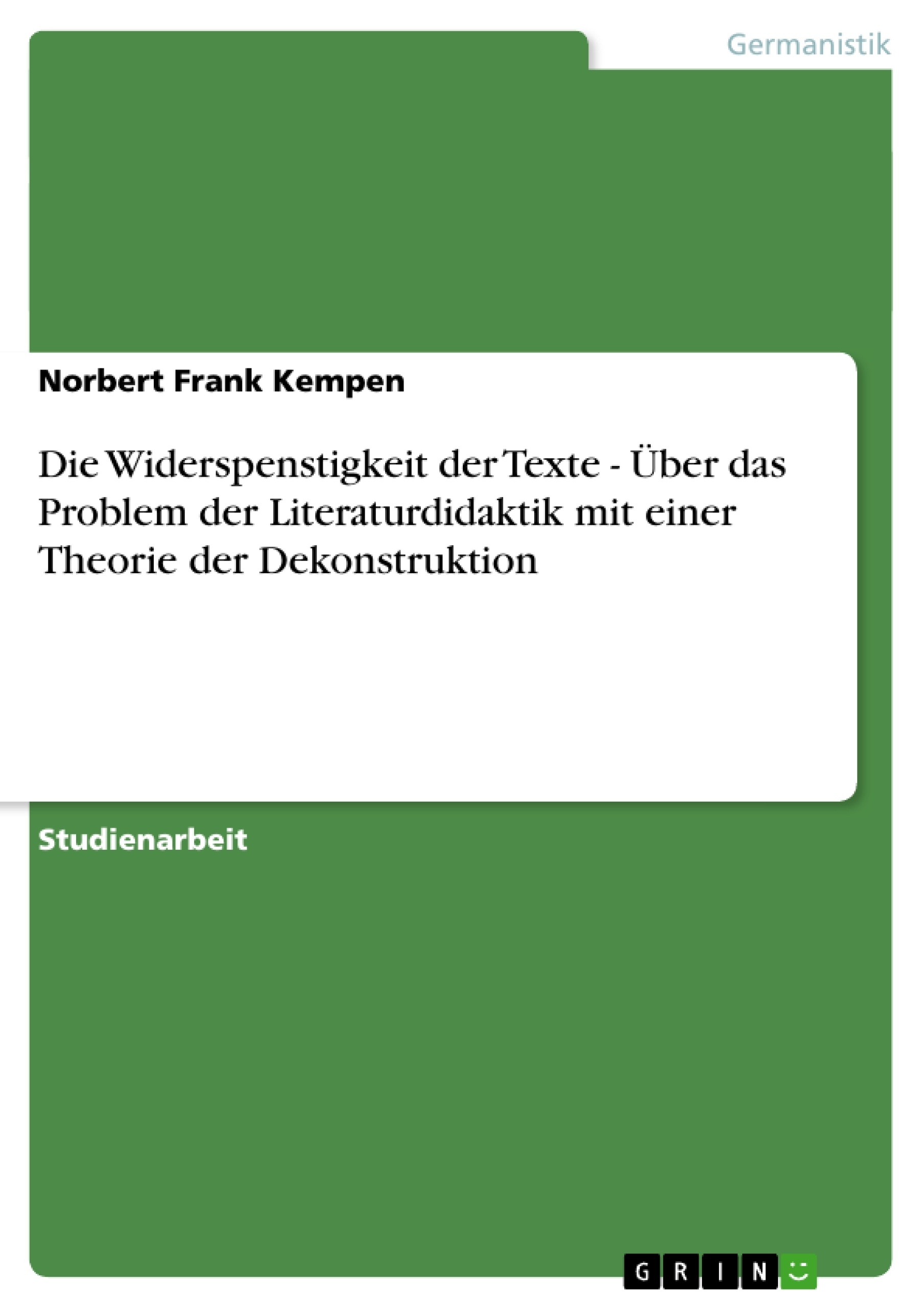

Kommentare