Leseprobe
Inhalt
Einleitung
1. Lernbiologische Grundlagen der Sprachentwicklung
1.1. Ist Sprachfähigkeit angeboren?
1.2. Das mentale Lexikon
1.2. Bedeutung der Gehirnentwicklung für den Zweit- und Fremdspracherwerb
Exkurs 1: Zur Lokalisation der Sprachzentren
2. Gedächtnis und Lernen
2.1. Das Gedächtnis ist stufenförmig organisiert
2.2. Implizites und explizites Gedächtnis
Exkurs 2: Die suche nach Ged ä chtnisfunktionen
2.3.Wie geht das Gedächtnis mit Grammatik um?
2.4.Das limbische System - Emotionen und Lernen
3. Didaktische Folgerungen
3.1. Konsequenzen aus der Lernbiologie
3.1.1. Berücksichtigung des Entwicklungstandes
3.1.2. Folgerungen aus dem Stufenmodell
3.1.3. Berücksichtigung der Gedächtnisformen
3.1.4. Berücksichtigung der emotionalen Ebene
3.2. Das Spiel als Strategie für einen gehirngerechten Unterricht
3.2.1. Spielen hilft Verstehen
3.2.2. Der Witz aus lernbiologischer Sicht
Abschließende Gedanken
Literaturverzeichnis
„ Noch in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts war man sich allgemein einig, dass Sprache keine anatomischen Korrelate besitzt, dass sie bei anderen Arten nicht existiert und dass die Sprachevolution beim Menschen nicht untersucht werden kann Die Entdeckungen der letzten 15 Jahre haben jedoch bewiesen, dass jede der oben genannten Grundvorstellungen falsch war. Auf diese Weise haben sie uns völlig neue Forschungswege eröffnet“ (Damasio, 1984).
Einleitung
Aus den bislang ältesten medizinischen Aufzeichnungen geht hervor, dass sich die Menschen seit mindestens 4700 Jahren mit der wissenschaftlichen Frage nach der Funktion des Gehirns beschäftigen.
Obwohl die neurophysiologische Forschung gerade in den letzten Jahren in vielen Bereichen enorme Fortschritte gemacht hat, ist ein wirklich genaues Verständnis von den physiologischen Vorgängen im Bereich der Sprache noch nicht vorhanden.
Die Forschung bezüglich der Neurolinguistik gestaltet sich schwierig. Während bei der Untersuchung anderer neurologischer Vorgänge, wie z.B. dem Sehen, Tierversuche viele Erkenntnisse bringen konnten, sind Untersuchungen bezüglich der Sprachvorgänge nur am Menschen in adäquater Weise durchführbar. Die meisten Einsichten wurden durch Untersuchungen an Patienten mit Sprachstörungen (Aphasie) gewonnen.
In dieser Arbeit soll der bisherige Stand der Forschung dargelegt und in den Kontext der Zweit- und Fremdsprachendidaktik gebracht werden. Es soll der Frage nachgegangen werden, welche didaktischen Konsequenzen zu ziehen sind und welche Methoden für einen gehirngerechten Unterricht geeignet sind.
1. Lernbiologische Grundlagen
1.1. Ist Sprachfähigkeit angeboren?
Noam Chomsky vertritt die Hypothese, dass Menschen ein angeborenes Spracherwerbsprogramm besitzen. Seiner Ansicht nach erlernt ein Kleinkind den Umgang mit der Sprache durch ständigen Abgleich dessen, was es täglich hört, mit einem genetisch festgelegtem Regelsystem, der Universalgrammatik. Kinder besitzen demnach eine angeborene Fähigkeit, Sprache in ihrer Umwelt zu erkennen und zu erlernen.
Es sind immer wieder identische Abläufe im Spracherwerb der Kinder zu beobachten. So schreiten alle Kinder dieser Welt vom plappern zur Ein-Wort- Sprache, von da zur Zwei-Wort-Sprache und entwickeln dann eine komplexere Sprache. Einige Kinder durchlaufen diese Phasen schneller als andere, doch ist das Durchschnittsalter für jedes Sprachstadium in allen Kulturen gleich.
Man vermutet, dass sich die allen Sprachen gemeinsamen universellen Eigenschaften zumindest teilweise aus der Struktur der Cortexgebiete ableiten, in denen die Sprachfunktion lokalisiert ist (Kandel 1996).
Die Rolle des Alters in dem eine Sprache erlernt wird widerspiegelt sich in dem interessanten Phänomen der Pidgin- und Kreolsprachen. Pidginsprachen entstehen, wenn Menschen verschiedener sprachlicher Herkunft miteinander kommunizieren müssen, ohne des anderen Sprache richtig zu erlernen. Eine Pidginsprache hat ein stark reduziertes Vokabular und eine simplifizierte Grammatik. Pidginsprachen werden von niemanden als Muttersprache gesprochen. Ist dies jedoch der Fall, spricht man von einer Kreolsprache. (Kratzner 1995, Todd 1990).
Um die Jahrhundertwende mussten Kinder auf Zuckerrohrplantagen auf Hawaii arbeiten. Sie wurden zu Teil von Aufsehern betreut, die nur Pidgin- Englisch mit ihnen sprachen (Pinker 1994). Diese Kinder entwickelten spontan eine komplexe Sprache nicht nur im Hinblick auf den Wortschatz, sondern auch im Hinblick auf die grammatischen Strukturen. Erwachsene sind zu solcher Leistung nicht im Stande, sie bleiben bei der Pidginsprache.
Bezüglich des Spracherwerbs des Kindes bedeutet dies, dass das bei der Geburt noch nicht vollständig entwickelte (vernetzte) Frontalhirn nicht Hindernis, sondern Voraussetzung für die enorme Lernleistung ist.
1.2. Das Mentale Lexikon
In den ersten Lebensmonaten treten gehäuft sog. brain spurts (Gehirnspurts) auf. Damit sind Phasen einer beschleunigten Gehirnentwicklung gemeint, die sich nach dem zweiten Lebensjahr in einem drei- bis vierjährigen Abstand wiederholen. Die Zeitpunkte der enormen brain spurts kurz vor Abschluss des zweiten Lebensjahres stimmen überein mit einer hochaktiven Phase der sprachlichen Entwicklung, in der es vor allem zu einem deutlichen Anstieg des Vokabulars kommt und die mit dem Schlagwort des vocabulary spurt benannt wird (Zangel 1998). Vor diesem Wortschatzspurt hat sich das Kind von seinem etwa 10. bis 18. Lebensmonat ein kleines Lexikon von ca. 50 Wörtern aufgebaut. Diese erste Phase des Wortschatzerwerbs ist durch extreme Langsamkeit gekennzeichnet. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass das Kind nicht nur neue Wörter lernen muss, sondern vorher die Fähigkeit erreichen muss, konkrete Laute zu bilden, um damit die neuen Wörter in immer wieder gleicher, für die Mitmenschen wiedererkennbarer Weise auszusprechen (Rothweiler/Meibauer 1999).
Die Zeit der ersten Wortäußerungen wird zudem charakterisiert durch Ein- Wort-Äußerungen, wobei dem Kind die Aussprache noch erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Das sprachliche Vorbild der Erwachsenen kann noch nicht exakt reproduziert werden und somit benutzt das Kind Varianten, die leichter auszusprechen sind, was dazu führt, dass der Sinn des Wortes für Zuhörer nicht immer eindeutig erkennbar wird. Das Verhältnis von Wörtern mit exakter Aussprache gegenüber solchen mit nur annähernder Aussprache verändert sich innerhalb einer Zeit von acht Monaten seit der ersten Ein-Wort- Äußerung zugunsten der exakten Aussprache.
Aufgrund der Tatsache, dass das Kind in dieser Phase des Lexikonerwerbs in kurzer Zeit eine große Anzahl neuer Wörter lernt, muss es sich einer Strategie bedienen, um die neuen Informationen verarbeiten zu können. Wörter werden schon nach ein- oder zweimaligem Hören in den passiven Wortschatz aufgenommen. Das Kind nimmt jedoch das Wort zunächst noch nicht in seiner vollständigen semantischen Dimension und seiner korrekten phonologischen Realisation auf. Da alles sehr schnell gehen muss, reduziert das kindliche Gehirn das neue Wort in kürzester Zeit auf ein Grundgerüst. Dieses enthält gerade noch die allerwichtigsten semantischen und phonologischen Informationen, damit es dem Kind ermöglicht wird, das Wort später wiederzuerkennen. Da davon ausgegangen werden kann, dass das Kind den Inhalt des Wortes verstanden hat, bedeutet dies, dass zuerst ein Konzept im Lexikon verankert wird, das langsam mit weiteren Informationen zu Semantik, Grammatik und Phonologie gefüllt wird. Dieser erste Prozess der Wortaneignung, der das spontane Abbilden des Wortes im mentalen Lexikon beschreibt, wird gemeinhin all fast mapping bezeichnet (Carey 1978).
Für das fast mapping ist zudem wichtig, dass das neue Wort noch nicht aktiv verwendet wird. Es bedarf noch weiterer Präsentationen, damit sich das Kind zusätzliche Informationen aneignen kann, um schließlich in der Lage zu sein, das Wort aktiv zu produzieren. Da die Gedächtnisspanne von Klein- und Vorschulkindern noch relativ begrenzt ist, muss eine erneute Präsentation schon bald nach der ersten erfolgen. Finden zusätzliche Präsentationen nicht statt, wird der schwache erste Eindruck des Wortes bald wieder aus dem Gedächtnis gelöscht (Rothweiler 1999). Dies gilt jedoch auch noch für die Kinder in der Primarstufe, obwohl ihre Gedächtnisspanne schon viel weiter ist, was sie dazu befähigt größere „Einheiten“ zu internalisieren (siehe Kap. 3.). Ein Mangel an neuen Präsentationen verhindert eine weitreichende Vernetzung. Bis zum zehnten Lebensjahr entwickeln sich die neuronalen Vernetzungen noch sehr schnell und intensiv, d.h. es gibt noch sehr viele Phasen des fast mappings.
1.3. Die Bedeutung der Gehirnentwicklung für den Zweit- und Fremdsprachenerwerb
Bei der Beschäftigung mit dem doppelten Erstspracherwerb drängt sich nun die Frage auf, ob und inwiefern sich der Erwerb von zwei Sprachen von dem einer einzigen Sprache unterscheidet. Es ist eine grundlegende Überlegung herauszufinden, wie sich das gelernte Sprachmaterial im Gehirn organisiert, d.h. ob die beiden Sprachen in einem einzigen System oder in zwei Systemen repräsentiert werden. Joy Hirsch und seine Kollegen untersuchten in einer Studie zwei Gruppen von Testpersonen, die alle jeweils zwei unterschiedliche Sprachen beherrschten. Die Teilnehmer der ersten Gruppe waren zweisprachig aufgewachsen, die anderen hatten die Fremdsprache erst als Erwachsene erworben. Während die Probanden Sprachtests absolvierten, ermittelten die Forscher deren Hirnaktivität mittels PET.
Exkurs 1.:
Zur Lokalisation der Sprachzentren
Viele Erkenntnisse über die Lokalisation der Sprachzentren wurden schon im 19. Jahrhundert aus Untersuchungen an Patienten mit Aphasie gewonnen. Pierre Paul Borca beschrieb im Jahre 1861 den Fall eines Patienten, der Sprache verstehen aber nur einzelne Worte aussprechen konnte. Er war weder fähig grammatisch korrekt in ganzen Sätzen zu sprechen noch sich schriftlich zu äußern. Bei der Obduktion wurde eine Läsion im hinteren Bereich des Stirnlappens entdeckt. Dieses Areal wird heute als Borca-Sprachzentrum (Abbildung) bezeichnet. Der Neurologe Carl Wernicke veröffentlichte 1876 seinen Aufsatz „Der Symptomenkomplex der Aphasie - Eine psychologische Untersuchung auf anatomischer Basis“. Hier beschrieb er den Fall eines Patienten, der unter einer rezeptiven Fehlfunktion, also einer Beeinträchtigung des Sprachverständnisses litt. Während Borcas Patienten verstehen aber nicht sprechen konnten, vermochten Wernikes Patienten zu sprechen aber nicht zu verstehen. Wernicke fand heraus, dass eine Läsion an einer anderen als der von Borca beschriebenen Stelle Grund der Fehlfunktion war. Dieses Areal liegt im hinteren Teil des Schläfenlappens und wird heute als Wernicke- Sprachzentrum bezeichnet.
Bis vor wenigen Jahren wurden fast alle Erkenntnisse über die anatomische Organisation der Sprache durch die Untersuchung an Patienten mit Gehirnläsionen gewonnen. Die von Michael Posner und Markus Raichle entwickelte Positronen-Emmisions-Tomographie (PET) machte es möglich die Forschung auch auf gesunde Testpersonen auszudehnen. PET ist ein bildgebendes Verfahren, dass lokale Veränderungen der Gehirndurchblutung und des Gehirnstoffwechsels sichtbar macht. Mit Hilfe dieses Verfahrens untersuchten Posner und Raichle, wie Wörter codiert werden.
Sie fanden heraus, dass das Wernicke-Sprachzentrum aktiv ist, wenn Wörter gehört werden. Werden Wörter gesehen bzw. gelesen, wird die visuelle Information direkt zum Borca-Sprachzentrum geleitet, ohne zuerst im hinteren Teil des Schläfenlappens in eine auditorische Repräsentation umgewandelt zu werden.
Hieraus schlossen Posner und seine Kollegen, dass bei der Wortwahrnehmung verschiedene Gehhirnbahnen benutzt werden, je nachdem, ob sie optisch oder akustisch präsentiert werden. Weiterhin nahmen sie an, dass diese Bahnen unabh ä ngigen Zugang zu übergeordneten Bereichen haben, die bei der Bedeutungszuordnung und bei der Sprachartikulation eine Rolle spielen. Nicht nur aktives Lesen und Hören werden getrennt verarbeitet. Wenn jemand nur über ein Wort nachdenkt, werden weitere Areale aktiviert (Abbildung).
Sprache wird sowohl seriell als auch parallel verarbeitet. (vgl. Kandel/Schwartz/Jessel 1996).
Folgendes Beispiel der Verarbeitung einer Frage soll das Zusammenspiel der Hirnregionen veranschaulichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Lern- und gedächtnispsychologische Aspekte, Brandl 1997
Die Frage wird in der Hörrinde (1) akustisch wahrgenommen, die visuelle Komponente dagegen in der Sehrinde (2) , im Schläfenlappen (3) werden Seh- und Hörinformation integriert, schließlich wird das „Lexikon“ der Inhaltswörter (4) nach geeigneten Wörtern abgesucht, die mögliche Antwort grammatikalisch unter Hinzufügung der Funktionswörter in Form (5) und über den motorischen Cortex (6) schließlich zur Artikulation gebracht.
Hirsch und seine Kollegen stellten fest, dass sich die Bilder des Borca- Zentrums derjenigen Versuchspersonen, die als Erwachsenne die zweite Sprache gelernt haben, von denen der zweisprachig aufgewachsenen unterschieden. Keine Auffälligkeiten fanden die Forscher in der Wernicke- Region.
Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass der Unterschied in der Anwendung der Funktionswörter, also der inneren Grammatik liegt. Sind erst die meisten Phasen des fast mappings abgeschlossen, kann die neue Sprache nicht mehr in der Weise gelernt werden, wie es in früheren Entwicklungsphasen der Fall ist. Die Fähigkeit Semantik, Grammatik und Phonologie ganzheitlich zu erwerben verschwindet. Das oben genannte Phänomen der Kreol-Sprachen unterstützt ebenfalls folgende die These:
Die Entwicklungsphase des Gehirns bestimmt die f ü r den Lerner geeignete Lernstrategie.
Nun stellt sich die Frage, welche Lernstrategie für welche Entwicklungsphase am geeignetsten ist. Die Altersspanne von sechs bis zehn Jahren ist besonders für den phonologischen Bereich - Aussprache, Intonation und Prosodie - prädestiniert. Im präpubertären Alter werden morphologisch- syntaktische Phänomene am besten erworben, wohingegen Sprachenlernen unter Zuhilfenahme erklärender Regeln erst dann gelingt, wenn das muttersprachliche Regelsystem dem Lernenden bekannt ist (vgl. Götze 2000).
Es gibt also für den Spracherwerb eine kritische Zeitperiode (ein Zeitfenster). Dieses Fenster erstreckt sich vom dritten Lebensjahr bis zur Pubertät. Nach der Pubertät verringert sich die Sprachkapazität (gemessen an der Fähigkeit eine Zweitsprache zu erlernen) dramatisch. Kinder, die ohne Kontakt zu Menschen aufgewachsen sind („Kaspar-Hauser-Kinder“), können nach der Pubertät nicht mehr sprechen lernen, und selbst wenn sie vor einsetzen der Pubertät mit anderen Menschen in Kontakt kommen, fällt es ihnen schwer Sprache zu erlernen.
Nach einsetzten der Pubert ä t spielt das Alter, in dem eine Sprache erlernt wird, keine Rolle mehr (Kandel 1996).
Man darf nun nicht davon ausgehen, dass die Bildung neuer Vernetzungen von Neuronen im Erwachsenenalter nicht mehr möglich ist, wie es manche Ansätze suggerieren. Schon die Entwicklung dieses „Extra-Speichers“ widerlegt diese Auffassung. Die Art und Intensität, dieser Vernetzungen stattfinden ist jedoch stark vom Alter abhängig.
2. Gedächtnis und Lernen
2.1. Das Gedächtnis ist stufenförmig organisiert.
Unser Gehirn speichert die Informationen in drei Speicherschritten: Zuerst wird die Information vom Ultrakurzzeit-Gedächtnis in Form einer elektrischen Repräsentation aufgenommen. Wenn diese Information innerhalb von etwa zwanzig Sekunden bewusst abgerufen wird, gelangt sie ins stoffliche Kurzzeit- Gedächtnis, ansonsten wird sie für immer ausgelöscht. Die Information, die sich nun in dem festeren Kurzzeit-Gedächtnis befindet und sich in die Gehirnzellen eingeprägt hat, kann ebenfalls verloren gehen, wenn sie nicht den letzten Schritt zum Langzeit-Gedächtnis vollzieht, in der die Information für immer gespeichert wird. Der zeitliche Unterschied vom Kurzzeit- und Langzeit-Gedächtnis beträgt etwa zwanzig Minuten. Solch ein Schritt kann z.B. durch ein Schockerlebnis innerhalb dieser Zeitspanne verhindert werden. Wenn wir noch einmal das Ultrakurzzeit-Gedächtnis betrachten, sehen wir, dass es als erstes Filter für Wahrnehmungen dient. Wenn die ankommenden Wahrnehmungen nicht mit bereits vorhandenen, im Gehirn kreisenden Informationen verknüpft werden, wenn also die Assoziationsmöglichkeit fehlt, klingt diese nach wenigen Sekunden ab. Genau dies ist auch der Fall, wenn z.B. der Lehrer den Stoff innerhalb weniger Sekunden in mehreren Erklärungsmustern wiederholt. Das Gehirn hat in diesem Fall keine Zeit die kreisenden Informationen des Lehrers abzurufen, mit vorhandenen Assoziationen zu verknüpfen und an diese zu verankern, ehe das Gehirn mit anderen, ähnlichen Erklärungsmustern ,,überfallen" wird. Das Gleiche kann auch bei mangelndem Interesse geschehen. Solch ein Filter schützt den Menschen vor einer allzu starken Belastung. Durch willentliches Assoziieren kann so eine Information im Kurzzeit-Gedächtnis gespeichert werden. Das Speichern im Kurzzeit-Gedächtnis geschieht in Form eines RNA-Abdruckes, dass heißt aber nicht, dass die Information dort für immer gespeichert wird.
Die bewusst aufgenommene Information und damit der RNA-Abdruck muss ,,in einem etwa in Zwanzig-Minuten-Abstand hinterherziehenden Erinnerungsfilm“ in die Langzeitspeicherung übergehen. Die Langzeitspeicherung geschieht in Form einer Eiweißsynthese, genauer gesagt, anhand der RNA-Matrize werden Aminosäuremoleküle zu einem Proteinmolekül verknüpft, das als materieller Informationsspeicher für immer eingelagert wird und von dort später wieder abgerufen (erinnert) werden kann. Diese Proteinsynthese kann durch einen starken Schock (z.B. Unfallschock) unterbrochen und gehemmt werden. Damit würden alle Informationen, deren RNA-Abdruck noch nicht zu einem Proteinmolekül verknüpft worden sind, nach etwa zwanzig Minuten zusammen mit dem Zerfall des RNA-Abdruckes gelöscht werden. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch erklären, warum sich alte Menschen an ihre Jugend sehr gut erinnern können, aber sich an das, was vor einer kurzen Zeit (z.B. gestern) geschehen ist, nicht mehr erinnern können: Es ist ein Ausdruck der im Alter nachlassenden Proteinsynthese. Damit lassen sich auch zwei Arten von Vergessen erklären: Erstens das unwiderrufliche Vergessen (Information gelangte nie in die Langzeitspeicherung), zweitens ,,das Nicht-Wiederfinden von im Grunde irgendwo gespeicherten, aber zugeschütteten oder durch blockierte Schalter abgeschnittenen Informationen“. Zurück zum Lernen: Beim Lernen kommt es uns nun darauf an, dass die gelernte Information leicht wieder abrufbar ist. Ein Stoff ist leichter abrufbar, wenn dabei mehrere Synapsen und damit Assoziationen gleichzeitig aktiviert werden. Deshalb sollten Informationen durch mehrere Eingangskanäle (Vester 1976) - wie Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen und Anfassen- aufgenommen werden, damit mehr Synapsenverknüpfungen und passende Assoziationen das Langzeit-gedächtnis stärken. Wie wir schon wissen, wird die Information, die vom Ultrakurzzeit- und Kurzzeit-Gedächtnis aufgenommen wird, gefiltert, d.h. es findet eine enorme Reduzierung der aufgenommenen Informationen statt. Dabei muss entschieden werden, welche Information wichtig ist, und welche nicht. Dieser ,,Entscheid" wird durch das lymbische System vorgenommen. Diese individuelle Auswahl ermöglicht ,,eine Vielfalt der Blickwinkel und damit eine reichhaltigere Erfassung der Realität“.
Die Wiederholung von Informationen sorgt für eine Ausprägung der Synapsengewichte, zunächst schwache Verbindungsstellen werden von mal zu mal verfestigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2. Implizites und explizites Gedächtnis
Exkurs 2:
Suche nach Gedächtnisfunktionen - Der Fall H.M.
Wie schon geschildert konnten Broca und Wernicke durch Untersuchungen an Patienten mit Gehirnläsionen einige Gedächtnisfunktionen bestimmten Gehirnregionen zuordnen.
Der Fall des Fließbandarbeiters Henry M. eröffnete weitere Einsichten in die Arbeitsweise des Gedächtnisses. Der Patient litt über zehn Jahre an nicht behandelbaren epileptischen Anfällen. Schließlich wurden in einer Operation Epilepsieherde in beiden Temporallappen entfernt, wodurch die Anfallsrate deutlich sank. Nach der Operation litt der Patient jedoch an einem schwerwiegenden Gedächtnisverlust. Es handelte sich um eine anterograden, also nach vorne gerichteten Amnesie. Er konnte sich an Dinge erinnern, die vor der Operation lagen, nicht jedoch an Dinge, die nach der Operation passierten. Er hatte die Fähigkeit verloren, neue Gedächtnisinhalte langfristig zu speichern. H.M. zeigte eine tadellose Sprachbeherrschung, sein Vokabular und sein Intelligenzquotient waren so gut, wie vor der Operation. Jedoch verfügte er nicht mehr über die Fähigkeit neu Gelerntes in das Langzeitgedächtnis zu übertragen. Nannte man ihm Zahlen, so konnte er diese nicht länger als eine Minute behalten. Personen, die er nach der Operation kennen gelernt hatte, mussten sich jedes Mal wenn sie ihm begegneten neu vorstellen, er hatte sie vergessen.
Brenda Milner beschäftigte sich mit dem Fall und nahm zunächst an, dass sich die Läsionen der Temporallappen auf alle Formen des Lernens auswirken. Sie stellte jedoch bald fest, dass bestimmte Formen des Lernens noch genauso gut funktionieren, wie bei gesunden Personen. So war H.M. in der Lage motorische Fähigkeiten zu erlernen. Er erlernte z.B. die Umrisse eines Sterns nachzuzeichnen, während er den Stern und seine eigene Hand nur in einem Spiegel sah. Nach einigen Trainingstagen konnte er die Aufgabe fehlerfrei bewältigen. Untersuchungen an weiteren Patienten mit beidseitiger Temporallappenläsion ergaben, dass sie zu verschiedenen Arten einfachen Lernens noch fähig waren. Alle Aufgaben, die diese Patienten noch erlernen konnten, hatten zwei Gemeinsamkeiten: Sie beinhalten einen automatischen Aspekt und verlangen keine bewusste Erinnerung (vgl. Kandel, 1996).
Anhand des Falles H.M. und weiterer Untersuchungen ist man auf zwei grundlegende Formen des Lernens gestoßen. Wir lernen etwas über die Welt - Wissen über Menschen, Orte, Dinge, das was wir in unserem Bewusstsein ständig verfügbar halten - mit einer Gedächtnisform, die allgemein als explizites Ged ä chtnis bezeichnet wird (vgl. Kupfermann/Kandel 1996). Explizite Gedächtnisinhalte können durch den Bewussten Akt des „Sich-an- etwas-Erinnerns“ zurückgeholt werden, hierzu war H.M. völlig außerstande. Explizites Wissen wird auch als episodisches bzw. deklaratives Wissen bezeichnet - wissen, dass... (vgl. Spitzer, 2000). So ist das erwähnte mentale Lexikon als explizites Wissen zu sehen.
Oder wir lernen, wie etwas zu tun ist, und zwar ohne dass dies ein bewusster Vorgang ist. Dieser Erwerb von motorischen oder Wahrnehmungsbezogenen Fähigkeiten wird durch das sogenannte implizite Ged ä chtnis vermittelt - wissen, wie... Implizites Gedächtnis ist eher reflexiver und automatischer Natur, und sowohl seine Bildung als auch der Abruf sind nicht unbedingt an bewusste Aufmerksamkeit oder kognitive Vorgänge gebunden (Kandel 1996). Diese Form des Gedächtnisses bildet sich langsam, durch viele Wiederholungen und äußert sich hauptsächlich in verbesserter Leistung bei verschiedenen Aufgaben. Seine Inhalte können nicht einfach in Worte gefasst werden.
Die weiteren Untersuchungen ergaben: Explizites und implizites Gedächtnis sind wahrscheinlich in voneinander verschiedenen neuronalen Schaltkreisen untergebracht. Die Speicherung expliziter Gedächtnisinhalte bedarf des Temporallappensystems. Implizites Gedächtnis ist an das Cerebellum und die Amygdala gebunden (Kandel, 1996).
2.4. Wie geht das Gedächtnis mit Grammatik um?
Der Fall H.M. hat gezeigt, dass Lernvorgänge im Gehirn getrennt voneinander ablaufen können, motorischen Fähigkeiten wurden allein durch das implizite Gedächtnis gelernt. Interessant für den Sprachunterricht ist die Frage, wie das Gedächtnis mit einem so komplexen System wie der Grammatik umgeht. In welchem Verhältnis stehen hier explizites und implizites Gedächtnis, wie spielen sie zusammen?
Eine Möglichkeit ist nun, dass eine Bewusstheit über die grammatischen Prinzipien Voraussetzung für das Lernen ist. Regeln werden bewusst gelernt und angewendet und auf diese Weise automatisiert. Tschirner (1997) spricht hier deshalb von der Automatisierungshypothes e, deklaratives Wissen wird in prozedurales Können umgewandelt. Demzufolge müssten Regeln erst im Temporallappensystem (explizites Gedächtnis) gelernt werden und dann langsam in die Bereiche des impliziten Gedächtnisses (Cerebellum und Amygdala) transferiert werden. Das explizites Wissen wäre also Vorsaussetzung für die Bildung impliziten Wissens. Vorraussetzung für diese Hypothese ist auch, dass die Regeln in den Köpfen identisch mit den Regeln in den Grammatikbüchern sind. Es müsste erst mal ein grammatisches Lexikon vorliegen. Diese Hypothese widerspiegelt sich oftmals in der Zweit- und Fremdsprachendidaktik, der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung grammatischer Bewusstheit (Schmidt 1992).
Eine andere Möglichkeit stellt die Andersartigkeitshypothese oder auch die Grundsätzliche-Unterschieds-Hypothese (Tschirner 1997) dar. Explizites und implizites Gedächtnis werden hier getrennt gesehen. Sharwood Smith z.B. geht davon aus, dass Sprachgebrauch auf einem System von Wissensstrukturen basiert, das Sprachlerner unbewusst, rein auf der Basis von Input aufbauen. Wie Jackendoff trennt Sharwood Smith streng zwischen den dem Bewusstsein unzugänglichen Prozessen, die Gedanken produzieren, und den Gedanken selbst. Er geht davon aus, dass alle Gehirnaktivität unbewusst abläuft. Das Gehirn setzt die verschiedensten Prozesse und Berechnungen in Gang, bewusst wahrgenommen wird allerdings nur das Ergebnis dieser Prozesse und Berechnungen. Zu diesen unbewusst ablaufenden Prozessen zählt Sharwood Smith auch die Anwendung grammatischer Regeln. Diese Regeln existieren darüber hinaus nur im Kopf und nicht in der Sprache.
Sprachlerner ziehen keine Regeln aus dem Schallstrom oder der Abfolge der Schriftzeichen auf dem Papier, sondern internalisieren Sprachdaten, die dazu benutzt werden, ein Regelsystem aufzubauen, das in der Lage ist, diese Sprachdaten genauso oder zumindest so ähnlich wie möglich hervorzubringen. Sowohl das Regelsystem selbst als auch der Aufbau dieses Regelsystems ist unbewusst. Das Produkt dieses Regelsystems, der Schallstrom oder die Zeichen auf dem Papier sind dem Bewusstsein natürlich zugänglich und können metasprachlich erfasst werden. Dieses metasprachliche Bewusstsein oder Grammatikwissen unterscheidet sich jedoch grundsätzlich von dem vom Sprachenlerner nachgebauten grammatischen Regelsystem oder dem Grammatikkönnen.
Da die implizite Grammatik der Beobachtung nicht frei zugänglich ist, sind explizite Grammatiken niemals Abbildungen der impliziten Grammatik, sondern allenfalls Modelle (Belke, 2000).
Tschirner berichtet von Forschungen, die einen interessanten Schluss bezüglich der Bildung von implizitem Wissen zulassen: Muttersprachliche Sprecher wissen, welche Sätze [korrekt, J.K.] und idiomatisch sind, weil sie Hunderttausende von lexikalischen Phrasen, Sätzen und Teilsätzen komplett gespeichert haben und komplett abrufen können. Sprecher generieren also im spontanen Sprechen zu größten Teil ihre Sätze nicht neu, sondern greifen auf Satzteile und Teilsätze zurück, die im Laufe von vielen Jahren [...] als Ganzes gespeichert wurden und die dann mit leichten Variationen neu zusammengestellt werden (vgl. Smith, 1993). Dieser Gedanke ist zum einen auf die Bildung des mentalen Lexikons übertragbar - wir sind also keine Vokabelmaschine die einzelne Wörter aneinander reiht, mit steigender Kapazität des Gedächtnisses werden immer komplexere Phrasen abgespeichert. Zum anderen lässt sich Bildung eines impliziten Gedächtnisses erklären. Die grammatischen Strukturen der Phrasen und Syntagmen werden ganzheitlich gespeichert. Das Wissen [...] über grammatische Regularitäten wird über eine implizite und automatisch stattfindende Analyse solcher Wortfolgen aufgebaut, d.h. über ein Wissen darüber, welche Wörter in welchen Wortzusammenstellungen und Wortfolgen auftauchen können (Tschirner, 1997).
2.5. Das limbische System - Emotionen und Lernen
Das limbische System - so genannt wegen seiner Lage am Limbus, der Grenze zwischen dem Vorderhirn und den entwicklungsgeschichtlich älteren und einfacher strukturierten tieferen Bereichen - stellt eine empfindliche Nahtstelle zwischen vegetativ-körperlichen und seelisch-affektiven Vorgängen dar. Es ist eine Art emotionales Schiedsgericht, das darüber befindet, welche Informationen und Reize für uns wichtig und wertvoll sind. Findet es sie aus irgendwelchen Gründen wichtig, färbt es sie hormonal lustvoll ein, so dass sie leichter in unser Gehirn Eingang finden; findet es sie unwichtig, dann wehrt es sich dagegen, indem es uns unlustvoll stimmt. Solche Informationen haben es schwer, Eingang in unser Gedächtnis zu finden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Lernen und Gedächtnis
Das limbische System verarbeitet alle Sinneseindrücke und verteilt sie auf die Speicherplätze.
Spracherwerb findet nach Krashen in einer affektiv positiven, d.h. in einer freundlichen, aufgeräumten, menschlichen Unterrichtsatmosphäre am besten statt. Jegliches Lernen findet in einer affektiv positiven Atmosphäre besser statt als in einer negativen. Das sollte eigentlich nichts Neues sein. Es steckt jedoch noch etwas mehr hinter dieser Hypothese. Zum einen scheint Spracherwerb nur dann stattzufinden, wenn sich Lerner aktiv und mit persönlichem Interesse mit gehörter oder gelesener Sprache auseinandersetzen, um ihr ihre Inhalte zu entlocken. Wenn Grammatikerwerb nicht bewusst gesteuert werden kann, sondern nur stattfindet, wenn Lerner den Schallwellen oder den Zeichen auf dem Papier ihre Botschaft, ihren Inhalt entnehmen wollen, müssen diese Inhalte so interessant sein oder so interessant aufbereitet werden, dass das Interesse der Lerner nicht erlahmt und damit der Spracherwerbsprozess beeinträchtigt wird.
Gleichzeitig muss vermieden werden, dass Lerner aus Angst davor, Fehler zu machen und lächerlich zu klingen, vermeiden, neue Konstruktionen, neue Wörter auszuprobieren. Nur im Ausprobieren wird der Erwerbsprozess, der im Rezeptiven begonnen hat, weitergeführt ins Produktive und damit ins Detailliertere und ins Präzisere.
3. Didaktische Folgerungen
3.1. Konsequenzen aus der Lernbiologie
Aus den Kapiteln 1. und 2. sind vier Punkte hervorgegangen, die von der Sprachdidaktik zu berücksichtigen sind:
- Der Entwicklungsstand des Gehirns ist von großer Bedeutung, da sich die Schwerpunkte der Eingangskanäle verschieben.
- Das Gedächtnis ist stufenförmig organisiert.
- Explizites und implizites Gedächtnis sind voneinander getrennt zu sehen.
- Emotionen haben grundsätzlich Auswirkungen auf das Lernen.
3.1.1. Berücksichtigung des Entwicklungsstandes
Wie aus Kapitel 1 hervorgegangen, ist Berücksichtigung des jeweiligen Entwicklungsstandes von enormer Bedeutung. Es ist einzusehen, dass man in der Primarstufe nicht die gleichen Unterrichtsmethoden wie in der Sekundarstufe verwenden darf. In 1.3. wurde festgestellt, dass die Gehirnentwicklung im Alter von 6 bis 10 Jahren besonders für Aussprache, Intonation und Prosodie prädestiniert ist. Für einen gehirngerechten Unterricht muss diese Tatsache berücksichtigt werden. Besonders für den Zweit- und Fremdsprachenunterricht gibt es bisher wenig geeignetes Material, da die meisten Ansätze noch davon ausgehen, dass die semantischen Ebene, wie beim Unterricht in höheren Klassen, im Vordergrund stehen muss, es wird Wert auf das bewusste Wahrnehmen grammatischer Prinzipien gelegt (vgl. Tschirner, 1997). Bei den meisten dieser Ansätze bleibt der bei den Grundschulkindern besonders ausgeprägter Eingangskanal der Phonologie unberücksichtigt.
3.1.2. Folgerungen aus dem Stufenmodell
In 2.2. wurden die drei Stufen des Gedächtnisses beschrieben. Es ist deutlich geworden, dass die Wiederholung von Informationen für die Aufnahme in den Langzeitspeicher unabdingbar ist. Für die Didaktik bedeutet dies, Methoden zu finden, die möglichst viele Wiederholungen zulassen, ohne jedoch in Langeweile abzugleiten.
3.1.3. Berücksichtigung der Gedächtnisformen
Wie in 2.3. beschrieben, sind explizites und implizites Gedächtnis voneinander getrennt zu sehen. Das explizite Wissen über eine Grammatik ist modellhaft und setzt ein implizites Können voraus. Die Voraussetzungen von Schülern mit DaM, DaZ, DaF unterscheiden sich durch den Grad der Internalisierung der impliziten Grammatik (Belke, 2000). Es ist also daran, Methoden zu finden, die implizites Können bei den Zweitsprachenlernern fördern. Das Anbieten von möglichst vielen lexikalischen Phrasen und deren Wiederholung kann helfen.
3.1.4. Berücksichtigung der emotionalen Ebene
Wenn wir Lerninhalte mit Freude, Erfolgserlebnis, Verliebtsein, Neugier, Spaß [...] verbinden, setzen wir [...] Lernhilfen ein, denen ganz konkrete biologische Mechanismen zugrunde liegen (Vester, 1989). Der Effekt ist sogar ein Doppelter: beim späteren Abrufen werden die gleichen Emotionen wieder mit abgerufen und erleichtern die Weiterverarbeitung der Informationen.
In multilingualen Klassen ist die Angst vor Fehlern bei den Zweitsprachenlernern sicher mehr ausgeprägt als bei den Muttersprachlern. Es ist daran eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, in der Fehler nicht als lächerlich und peinlich gesehen werden.
In den oben genannten Punkten ist die Wichtigkeit der Wiederholung von Informationen mehrfach unterstrichen worden. Hier besteht jedoch die große Gefahr der Langeweile, den bereits bekannten Informationen wird weniger Beachtung geschenkt. Es gilt also den Input immer wieder neu aufzubereiten und neu zu variieren.
3.2. Das Spiel als Strategie für einen gehirngerechten Unterricht
3.2.1. Spielen hilft Verstehen
Wie können nun Methoden aussehen, die allen oben genannten Punkten gerecht werden? Eine Möglichkeit ist das Sprachspiel im handlungsorientierten Unterricht. Sprachspiele, wie z.B. Abzählreime, sind durch besondere Prosodie gekennzeichnet. Dem bei den Kindern der Grundschule im Vordergrund stehenden phonologischen Eingangskanal wird so Rechnung getragen.
Bei Reimen und Witzen haben die Kinder großen Spaß an der Wiederholung. Die gleichen Witze werden oft immer und immer wieder wiederholt. Vor dem Hintergrund der ganzheitlichen Phrasenspeicherung (vgl. Tschirner, 1997) wird die didaktische Bedeutung von Sprachspielen weiterhin deutlich. Im Sprachspiel ist es möglich den Lernern viele dieser Phrasen zu präsentieren. Die Variabilität vieler Sprachspiele macht es möglich die feinen grammatischen Unterschiede, wie bei den Flexionen zu internalisieren. Wie geschildert ist die Wiederholung Voraussetzung für den Aufbau eines impliziten Gedächtnisses. In Sprachspielen kann der selbe Input mit leichten Variationen immer wieder neu dargeboten werden ohne in Langeweile zu versinken.
Die Flexionsformen des Deutschen stellen für Kinder z.B. türkischer Herkunft ein völlig neues Problem dar, da Türkisch eine agglutinierende Sprache ist, d.h. es kommen überhaupt keine Flexionen vor. Die richtigen Flexionen des Deutschen sind nicht durch logisches Überlegen zu finden, sie müssen mehr oder weniger auswendig gelernt werden. Das Anbieten möglichst vieler Phrasen, aus denen die unterschiedlichen Flexionen hervorgehen kann helfen ein implizites Grammatikkönnen aufzubauen.
Aus der Beschreibung des limbischen Systems (siehe 2.5.) ist die Bedeutung der emotionalen Ebene hervorgegangen. Produktives Lernen ist nur in einer entspannten und angenehmen Atmosphäre möglich. Ängste, wie z.B. die Angst sich durch Fehler zu blamieren, können das Lernen blockieren. Diese Unsicherheit ist wie gesagt bei Ausländerkindern in der Grundschule oft weit mehr ausgeprägt als bei den deutschen Kindern. Die Hemmschwelle sich am Unterricht zu beteiligen ist dementsprechend groß. Das Spiel lässt diese Hemmschwelle verschwinden, alle Kinder sind von vorn herein beteiligt. Das spielerische Lernen bietet die Möglichkeit Ängste zu vergessen und die heitere Atmosphäre sorgt für eine dem Lernen zuträgliche Hormonlage.
Eine gibt für die Didaktik eine zentrale Frage: Was lernen die Kinder im Umgang mit der Sprache von selbst und was muss ihnen die Schule beibringen (vgl. Belke 2001). Wie wir gesehen haben, scheint die Fähigkeit der Kinder eigenständig durch die Interaktion mit ihrer Umwelt zu lernen, viel größer zu sein als vielleicht angenommen. Es ist daran den Kindern ständig Input anzubieten, den sie dann von allein produktiv und unbewusst internalisieren können. Eine weitere Aufgabe ist es die Atmosphäre in der sich die Lerner befinden so positiv wie möglich zu gestalten. Das Lernen im Sprachspiel ist m.E. die beste Möglichkeit um all den oben genannten Punkten gerecht zu werden. Für Kinder, die in der Primarstufe Deutsch als Zweitsprache lernen ist hiermit eine entwicklungsgemäße Förderung der eigenen Fähigkeiten gegeben.
Spitzer formuliert im Kontext der Evolution: Da man davon ausgehen kann, dass die Spezies Mensch am lernfähigsten ist, ist sie notwendigerweise nicht nur am spielfähigsten, sondern hat das Spielen auch am dringendsten nötig!
5. Der Kinderwitz aus lernbiologischer Sicht.
Der Witz enthält einige für das Lernen vorteilhafte Eigenschaften. Zum ersten ist einfache Struktur eines Witzes zu betrachten. Lernen geht viel einfacher und rascher vor sich, wenn man zunächst einfache Sprachmuster lernt, die entsprechenden Regeln internalisiert und dann zunehmend komplexere Strukturen bearbeitet - Komplexes kann auf dem Rücken von Einfachem (vgl. Spitzer, 2000) gelernt werden, wozu in der alltäglichen Umwelt der Kinder kaum Gelegenheit besteht.
Die bei vielen Kinderwitzen festgefügte, knappe Form erleichtert das Behalten unabhängig vom Verständnis und ermöglicht somit die schnelle Teilnahme an der Kommunikation in der deutschen Mehrheitsgesellschaft (Belke, 2001). Die Struktur dieser Texte ist in verschiedenen Kinderkulturen sehr ähnlich (Belke, 2001), was evtl. ein weiterer Hinweis auf elementare Gemeinsamkeiten im Spracherwerb sein kann.
Wie in Kap.1 beschrieben, ist die Altersspanne vom sechsten bis zehnten Lebensjahr prädestiniert für Aussprache, Intonation und Prosodie. Oft haben die Witze eine regelmäßige Form, wie z.B. bei Frage-Antwort-Witzen. Aussprache und Intonation sind für den Erzähler wichtig, um den Witz auf eine interessante „witzige“ Art herüberzubringen.
Kinderwitze werden in der kindlichen Subkultur oft immer und immer wieder wiederholt. Obwohl alle Gesprächsteilnehmer einen Witz schon kennen und oft gehört haben, ist bei jeder Wiederholung ein Lustgewinn zu beobachten. Durch diese ständige Wiederholung gehen die im Witz enthaltenen Informationen, wie Grammatik, Syntax oder Flexionen, in das implizite Gedächtnis über und dies geschieht unterbewusst. Die Witze bestehen aus Phrasen, die ganzheitlich gelernt werden.
Das Verständnis eines Witzes ist für den Übergang in das implizite Gedächtnis nicht zwangsläufig notwendig, da schon allein die ständige lustvolle Wiederholung hierfür ausreicht. Jedoch sind beim Hören und Verstehen eines Witzes besondere Gehirnaktivitäten vorteilhaft für das Lernen. Frederic Vester hat schon 1975 hierauf hingewiesen:
Jeder Witz lässt zunächst einmal eine Erwartungshaltung entstehen, eine Leistung in der linken Hemisphäre. Dieser Erwartung wird dann aber mit der überraschenden Pointe des Witzes der Boden entzogen. Der erste Schritt, der Sinn für den Überraschungseffekt, verbleibt damit in der linken Hirnhälfte. Diese ist jedoch völlig außer Stande, den entstehenden Widerspruch durch eine neue, erheiternde Sinnstiftung aufzulösen, so dass - ob man will oder nicht - die rechte Hemisphäre in Aktion treten muss. Ihre Leistung besteht nun darin, die Pointe auf einer höheren Ebene mit dem vorher Gehörten unter Lustgewinn zu vereinen. Die positive Hormonlage und das damit verbundene Erfolgserlebnis halten nun ihrerseits die Aufmerksamkeit und das kreative denken weiter in Aktion (Vester 1975).
Abschließende Gedanken
Erst während ich diese Arbeit schrieb, wurde mir die Komplexität dieses Themas wirklich bewusst und ich musste meine Konzepte mehrmals überdenken. Ursprünglich sollten weitere Aspekte, wie z.B. der Schriftspracherwerb bei Zweitsprachenlernern mit in diese Arbeit einfließen, doch dies hätte hier sicher den Rahmen gesprengt. So habe ich den Schwerpunkt auf den Grammatikerwerb gelegt und hoffe mit dieser Arbeit ist so ein kleiner Einblick in die Lernbiologie der Sprache gelungen. Es wird in den nächsten Jahren sicher noch viele neue Erkenntnisse in diesem Bereich geben. Es wäre wünschenswert, wenn sich Lehrkräfte über diese Entwicklungen informieren, dass sie versuchen Grundlagen der Lernbiologie zu erfassen und diese in ihren Unterrichtskonzepten berücksichtigen.
Die Auffassung Körper und Geist getrennt voneinander zu sehen ist anachornistisch. Die verschiedensten Forschungsgebiete überschneiden sich beim Versuch den Geheimnissen des Gehirns auf den Grund zu gehen.
Literaturverzeichnis
BELKE, Gerlind (2001); Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht; Baltmannsweiler: Schneider-Verlag. Hohengehren.
DAMASIO, Antonio R. (1997); Descartes Irrtum - F ü hlen, Denken und das menschliche Gehirn; München: dtv.
GÖTZE, Lutz (1995); Vom Nutzen der Hirnforschung f ü r den Zweitspracherwerb; In: Linguistics with a human face. Festschrift für Norman Denison - Graz, S. 113-126.
GÖTZE, Lutz (1997); Hirnprozesse und die Rolle des Ged ä chtnisses beim Lesen von Texten - Materialien Deutsch als Fremdsprache 46, S. 85-94.
KANDEL, Eric (1996); Zellul ä re Grundlagen von Lernen und Ged ä chtnis; Berlin, Oxford: Spektrum, Akad. Verlag.
KUPFERMANN, Irving / KANDEL, Eric (1996); Lernen und Ged ä chtnis; Berlin, Oxford: Spektrum, Akad. Verlag.
MÜLLER, H.M.; WEISS, S.; RICKHEIT, G. (1997). Experimentelle Neurolinguistik, In: Bielefelder Linguistik (Hrsg.) - Bielefeld: Aistheseis-Verlag, pp 125-128.
PINKER, S. (1994); The language instinkt. How the mind creates language; New York: William Morrow and company.
ROTHWEILER, M. (Hrsg.) / MEIBAUER, J. (1999); Das Lexikon im Spracherwerb; Tübingen: A. Franke Verlag.
SCHACTER, Daniel L. (2001); Wir sind Erinnerung - Ged ä chtnis und Pers ö nlichkeit; Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag.
SPITZER, Manfred (2000); Geist im Netz - Modelle f ü r Lernen, Denken und Handeln; Heidelberg, Berlin: Spektrum, Akad. Verlag.
TODD, L. (1990); Pidgin and creols, 2nd edition - London: Routledge.
TSCHIRNER, E. (1997); Wissen und Bewusstheit im Erwerb m ü ndlicher fremdsprachlicher Kompetenz. In: S. Demme & G. Henrici (Hrsg.), Dem Fremdsprachenerwerb auf der Spur: Dokumentation des Forschungskolloquiums „Fremd- und Zweitsprachenerwerbsforschung.“ Jena: Universitätsdruck, S. 101-113.
VESTER, F. / BEYER, G. / HIRSCHFELD, M. (1996); Aufmerksamkeitstraining in der Schule; Wiesbaden: Quelle und Meyer GmbH &Co.
VESTER, Frederic (1979); Denken-Lernen-Vergessen; München: dtv.
VESTER, Frederic (1997); Leitmotiv vernetztes Denken; München: Wilhelm Heyne Verlag.
ZANGL, Renate (1998); Dynamische Muster in der sprachlichen Ontogenese; Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Arbeit zitieren
- Jens Koert (Autor:in), 2001, Lernbiologische Aspekte des Zweitsprachenerwerbs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105611
Kostenlos Autor werden














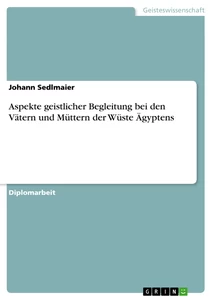
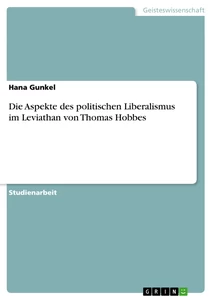
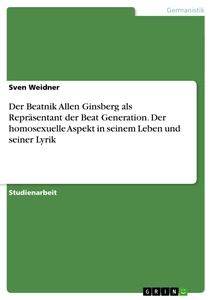





Kommentare
brauchbar mit kleinen Mängeln.
Hausarbeit ist sehr brauchbar- leider fehlen bei diversen Quellenbelegen die Seitenangaben.
Kurze Anmerkung: Das Gehirnzentrum, in dem die New Yorker Forscher die Planung von Aussprache und Grammatik vermuten heißt BROCA-Areal und nicht Borca.