Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Wissen im Unternehmen
1.1 Knowledge–Management
1.2 Software
1.3 Integration
1.4 Zielsetzung dieser Arbeit
2 Elemente einer Wissensdatenbank
2.1 Unterscheidung: Daten, Informationen und Wissen
2.2 Wissensmanagement
2.2.1 Kernprozesse
2.2.2 Technische Unterstützung
2.2.3 Forderungen der Praxis: Pragmatisch, einfach, nutzbar
2.3 Ansätze von KM–Tools
2.3.1 Datenspeicher
2.3.2 Kataloge
2.3.3 Volltextsuche
2.3.4 Groupware
2.3.5 Nutzung von Intranettechnologie
2.3.6 Vernetzung der Wissensobjekte
2.3.7 Sicherheit durch Berechtigungskonzepte
2.3.8 Zukunftssichere Dateiformate
3 Die Wissensdatenbank
3.1 Ist–Analyse
3.2 Defnition
3.3 WisNet
3.3.1 Genutzte Technik
3.3.2 Formatierungen in Wiki
3.3.3 Navigation
3.3.4 Mehrbenutzerzugriff
3.3.5 Anpassungen
3.4 Intranet–Suche
3.4.1 Genutzte Technik
3.4.2 Indexierung
3.4.3 Abfrage
3.4.4 Anpassungen
4 Nutzung und Ausblick
4.1 WisNet
4.1.1 Supportdatenbank für das BSC
4.1.2 Ausbildungsweb
4.1.3 Umläufe im Hause
4.1.4 Einführung der Rolle des Redakteurs“
4.2 Intranet–Suchmaschine . . . . . ”
4.3 Abschließende Betrachtung
A WisNet
B Intranet–Suche
Abbildungsverzeichnis
2.1 Die Beziehungen zwischen den Ebenen der Begriffshierarchien; aus [Probst et al., 1999, S. 36]
2.2 Die Kernprozesse des Wissensmanagements; aus [Probst et al., 1999, S. 53]
3.1 WikiWord mit (links) und ohne (rechts) existierendes Thema .
3.2 Navigationsleiste in WisNet
4.1 Einstiegsseite ins Intranet mit Suchformular
4.2 Erweiterte Suche
A.1 StartSeite im Web BSC
A.2 Bearbeiten eines Beitrags in WisNet
A.3 Der bearbeitete Beitrag in WisNet
A.4 Thema mit angefügter Datei
A.5 A¨ nderungen im BSC-Web
A.6 WebStatistics im BSC-Web
A.7 StartSeite im Web Ausb
A.8 Liste der Praxisarbeiten
A.9 Eine Praxisarbeit
A.10 Suche im WisNet
B.1 Einfache Suche nach dem Begriff Intranet“
B.2 Ergebnis der Suche nach Intranet“ ”
B.3 Erweiterte Suche . . . . ”
B.4 Ergebnis der erweiterte Suche
B.5 Erweiterte Suche nach einem Text mit Umlauten
B.6 Interpretation der Umlaute
Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kapitel 1 Wissen im Unternehmen
1.1 Knowledge–Management
Die gegenwärtige Situation vieler Unternehmen ist aus Sicht der Informati- onsversorgung durch eine steigende Datenflut bei einem gleichzeitigen Infor- mationsdefizit gekennzeichnet. Die Unternehmen sind zwar im Besitz einer Vielzahl an Daten, sie sind jedoch nicht in der Lage, diese zur Steigerung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit sinnvoll zu nutzen.1 Ein aktueller Ansatz, der diesem Umstand entgegenwirkt, stellt das Knowledge–Management (KM) dar.
Als eine von vielen Definitionen für den Begriff KM unterteilt IT–Research diesen in die folgenden zwei Aspekte:2
- Erstens beschreibt KM den Prozeß, die Wissensbasis eines Unterneh- mens zu suchen, zu identifizieren, zu erfassen, aufzubereiten und zu verteilen. Dies geschieht hauptsächlich durch den Einsatz der entspre- chenden Informationstechnologie.
- Zweitens kommt es auf die Umwandlung von Informationen in Wissen an. Knowledge–Management soll einen Prozeß lenken, der es der Orga- nisation ermöglicht, neues Wissen zu erzeugen, um Unternehmensziele zu unterstützen.
Wissen oder neudeutsch auch Knowledge wird in unserer Dienstleistungs- gesellschaft zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Unternehmen, die Informatio- nen nicht unmittelbar und allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen können, werden im Wettbewerb langsamer agieren, Marktanteile verlieren und ihre
Existenz gefährden. Knowledge–Management ist deshalb auch keine kurzlebi- ge Management–Lehre, sondern sichert den Produktionsfaktor der Zukunft: das Wissen.3
Während das Management klassischer Produktionsfaktoren ausgereizt zu sein scheint, hat das Management des Wissens seine Zukunft noch vor sich. Wissen ist die einzige Ressource, welche sich durch Gebrauch vermehrt.4 Hier-
zu bietet die moderne Informationstechnik eine Vielzahl von Möglichkeiten.
1.2 Software
Den Markt für Wissensmanagement–Anwendungen haben inzwischen zahl- reiche Softwarehäuser entdeckt. So tummeln sich in der Fachpresse Artikel, in denen immer neue Produkte vorgestellt werden. Neben den traditionellen An- bietern von Dokumenten–Management–Systemen (DMS)5 haben inzwischen auch Größen wie Lotus mit Raven“6, Oracle mitiFS“7 und Microsoft mit ” Tahoe“8 Produkte in den ” ¨Startlochern.
1.3 Integration
Ein Hauptproblem des Wissensmanagements besteht in der Verteilung der dazu benötigten Informationen. Man unterscheidet:9
- Implizites Wissen ist in den Köpfen der Mitarbeiter gespeichert und läßt sich nur schwer formalisieren und übertragen.
- Explizites Wissen ist bereits kommuniziert und kann auf verschiedenen Medien gespeichert sein — es ist also leichter zugänglich als implizites Wissen, jedoch aus IT–Sicht eventuell auf verschiedene Anwendungen verteilt, die sich nur schwer verknüpfen lassen.
Zudem läßt sich eine weitere Unterscheidung treffen:10
- Strukturiertes Wissen liegt in verschiedenen Datenquellen, beispiels- weise Datenbanken oder Data Warehouses vor.
- Unstrukturiertes Wissen können Textdokumente und E–Mails, Audio– und Video–Präsentationen sowie das implizite Wissen der Mitarbeiter sein.
Eine große Aufgabe besteht somit bei der Einführung eines Knowledge– Management–Systems in der Zusammenführung bestehender Systeme, An- wendungen und Daten. Das aktuelle Schlagwort hierzu lautet EAI: Enterprise Application Integration. Als Oberfläche“ für den Anwender hat sich in den letzten Jahren das Internet bzw. ” Intranet herausgebildet, welches aufgrund
seiner Plattformunabhängigkeit und systemübergreifenden Verfügbarkeit be- stens geeignet ist11.
1.4 Zielsetzung dieser Arbeit
In meiner Diplomarbeit soll nicht ein weiteres mal die wirtschaftliche Bedeu- tung von Wissen erörtert werden — dieser fast schon philosophische Aspekt wurde schon in zahlreichen Arbeiten aufgezeigt und wird im Allgemeinen auch nicht von Managern angezweifelt. Ebenso soll keine Anleitung zum Management von Wissen gegeben werden. In meiner Arbeit will ich eine technische Grundlage in Form einer Wissensdatenbank mit Intranettechno- logie schaffen, die meinem Ausbildungsbetrieb, dem Badischen Gemeinde– Versicherungs–Verband (BGV) in Karlsruhe, erste gezielte Schritte im Wis- sensmanagement ermöglicht.
Im Zuge eines kleinen Pilotprojektes ist dies auch geschehen: Im Benutzer– Service–Center (BSC) des BGV entsteht gerade eine Support–Datenbank auf Basis meiner Arbeit. Für die Zukunft ist auch eine Nutzung für die hausweite Verteilung von Aktenvermerken geplant.
Zunächst werde ich auf die Grundlagen von KM–Systemen eingehen. Dar- auf folgt eine Beschreibung der für meine Arbeit verwendeten Tools, deren Eigenschaften, Installation und Anpassung. Anschließend werde ich anhand von Beispielen die Nutzung im BGV aufzeigen. Im Anhang finden sich schließ- lich noch Screenshots der Anwendungen.
Kapitel 2 Elemente einer Wissensdatenbank
Bestimmte Begriffe tauchen im Zusammenhang mit Wissensmanagement im- mer wieder auf. Da diese jedoch häufig ganz unterschiedlich verwendet wer- den, ist es notwenig, sie zunächst einmal zu definieren.
2.1 Unterscheidung:
Daten, Informationen und Wissen
Daten sind nach DIN 44300 Zeichen oder kontinuierliche Funktionen, die aufgrund von bekannten oder unterstellten Abmachungen und zum Zweck
der Verarbeitung Informationen darstellen.12 Es sind also Zeichen, die für den Betrachter Bedeutung haben.
Informationen werden von W. Wittman als an Zwecken ausgerichtetes Wissen oder auch als zweckorientiertes Wissen festgelegt, d.h. als Kenntnisse
über Sachverhalte oder Vorgänge.13 Diese Definition stützt sich wiederum auf den Begriff Wissen“, den W. Wittman als immatiriellen Produktionsfaktor versteht. Fu” die weitere Verwendung im Wissensmanagement ist dies allei- ne nicht ausreichend. Informationen werden deshalb als interpretierte Daten angesehen. Den Kontext zur Interpretation liefert hierzu der Verwendungs- zweck.
Die Vernetzung von Informationen ermöglicht deren Nutzung in einem bestimmten Handlungsfeld, welches als Wissen bezeichnet werden kann.14
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.1: Die Beziehungen zwischen den Ebenen der Begriffshierarchi- en; aus [Probst et al., 1999, S. 36]
Das Handeln der Mitarbeiter in einem Unternehmen wird von ihrem Wis- sen beeinflußt — Informationen alleine reichen hierzu nicht aus. Deshalb ist es wichtig, den Mitarbeitern eine möglichst große Wissensbasis zur Verfügung zu stellen und sie zu deren Nutzung und Erweiterung zu motivieren.
2.2 Wissensmanagement
2.2.1 Kernprozesse
Als Kernprozesse des Wissensmanagement ergeben sich die folgenden:15
- Wissensidentifikation — Wie schaffe ich Transparenz über intern und extern vorhandenes Wissen?
- Wissenserwerb — Welche Fähigkeiten kaufe ich mir extern ein?
- Wissensentwicklung — Wie baue ich neues Wissen auf?
- Wissens(ver)teilung — Wie bringe ich das Wissen an den richtigen Ort?
- Wissensnutzung — Wie stelle ich die Anwendung sicher?
- Wissenbewahrung — Wie schütze ich mich vor Wissensverlusten?
All diese Prozesse stehen in direktem Zusammenhang miteinander, wie in Abbildung 2.2 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.2: Die Kernprozesse des Wissensmanagements; aus [Probst et al., 1999, S. 53]
2.2.2 Technische Unterstützung
Ziel eines jeden KM–Tools sollte es nun sein, die genannten Kernprozesse des Wissensmanagements zu unterstützen. Leider verläuft aber auch hier die Einführung einer neuen Technik oft nach der Methode ” Geld reinstecken und hoffen“16 — Prozesse der Zieldefinition müssen jedoch den Anfang bilden.17
Häufig wird KM benutzt, um die Unzulänglichkeiten von hierarchischen File–Management–Systemen auszugleichen: Der vorhandene Informations- pool wird durch Suchmaschinen und Verteilungssysteme zugänglich gemacht. Besonders begeistert hat die Dokumenten–Management–Branche den Begriff Knowledge–Management aufgegriffen. Das neue Schlagwort bot die Chance, aus den doch sehr trockenen“ und eng abgegrenzten Bereichen Archivierung,
Workflow und ” hes Dokumenten–Management auszubrechen. Dieser klassisc
Ansatz geht jedoch davon aus, daß das Wissen in den Informationsbasen
vorhanden ist und nur mit geeigneten Mitteln Anwendern zur Verfügung ge- stellt werden muß.18 Es berücksichtigt also im Grunde nur die Prozesse der Wissensbewahrung und Wissens(ver)teilung, die Wissensnutzung wird dem
Anwender ein wenig erleichtert.
Tatsächlich erfordert KM jedoch mehr, denn Wissen ist nicht einfach vor- handene Information, sondern stellt das Ergebnis von Prozessen, Erfahrungen und Ad–hoc–Assoziationen dar.19 Und gerade auch der Prozeß der Wissens-
entwicklung muß unterstützt werden, denn in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt veralten Informationen schnell.
2.2.3 Forderungen der Praxis: Pragmatisch, einfach, nutzbar
Ein pragmatisches Wissensmanagement–Konzept muß Unternehmensproble- me in Wissensprobleme übersetzen, Pauschallösungen vermeiden, sich stets an konkreten Problemen orientieren, sich an existierende Systeme anschließen und bestehende Lösungsansätze integrieren. Zudem muß es in einer verständ- lichen Sprache formuliert sein, welche im Unternehmensalltag vermittelbar ist.20
Die Akzeptanz des Systems ist ausschlaggebend für seinen Erfolg. Mit umständlicher Technik und schlechten Oberflächen zu operieren, ist gefähr- lich. Ein KM–System soll und muß täglich benutzt werden, eine logische und verständliche Bedienerführung sollte (nicht nur hier) selbstverständlich sein. Altgediente Mitarbeiter begegnen einem neuen System oftmals skeptisch. Sie verbinden damit die Sorge, daß sie mit ihrem Wissen möglicherweise auch
ihren Arbeitsplatz preisgeben. Bei Jüngeren hingegen ist oft Enthusiasmus festzustellen; das Besitzstandsdenken ist noch unterentwickelt.21
Bei der Einführung lassen sich zwei Strategien unterscheiden: die punk- tuelle — etwa Fachgebiet nach Fachgebiet oder Abteilung nach Abteilung — und die unternehmensweite Einführung. Der Ort eines Pilotprojektes sollte sorgfältig gewählt sein. Wird das System in einem Schlüsselbereich einge- setzt, wo der Nutzen schnell und direkt zu erkennen ist, hat dies unmittelbare
Rückwirkung auf die Akzeptanz der Benutzer.22
2.3 Ansätze von KM–Tools
2.3.1 Datenspeicher
Zur Wissenbewahrung werden die Daten in Datenbanken oder als Dateien in einem Filesystem abgelegt. Dies ist ein notwendiger, jedoch bei weitem nicht hinreichender Schritt. Denn laut einer europaweiten Marktanalyse desMarktforschungsunternehmens The Survey Shop“ verlieren zwischen 11 und 13 Prozent der europäischen ” häftsführer zuweilen wichtige Dokumente Gesc
oder legen sie so falsch ab, daß sie nie wieder gefunden werden23.
Auch die Marktführer auf diesen Gebieten haben den Handlungsbedarf er- kannt und bieten zunehmend Recherchemöglichkeiten auf die Datenbestände an. Jedoch handelt es sich hierbei meist wieder um ein proprietäres System, welches eine Integration verschiedener Informationsquellen im Unternehmen
erschwert.24 Eine löbliche Ausnahme, die sich an offenen Standards orientiert
und diese zahlreich unterstützt, dürfte wohl Oracle mit iFS anbieten. Dessen Hardwareanforderungen sind jedoch gewaltig.25
2.3.2 Kataloge
Um den Zugriff zu den gespeicherten Daten zu erleichtern, werden Zugangs- portale26 geschaffen. Diese sind nicht mehr auf einen hierarchischen Zugriffs-
pfad beschränkt, wie ein Filesystem, sondern erlauben den thematisch ge- gliederten Einstieg. Dazu ist eine Kategorisierung, Gliederung und/oder Ver- schlagwortung der Inhalte nötig.
In der Praxis erweist sich dies jedoch meist als wenig geeignet: Mitarbei- ter können eine gemeinsam vereinbarte Schlagwortstruktur schnell nicht mehr nutzen. Bereits nach wenigen Wochen steigt die Quote der nicht verschlag- worteten Dokumente auf 30 %. Keines der Dokumente wird dann mit mehr als zwei Schlagworten gekennzeichnet. Für den Anwender bedeutet die Ka- tegorisierung bei der Ablage seines Dokuments einen zusätzlichen Aufwand in einer Phase, in der er sowieso mit Motivationsproblemen zu kämpfen hat. Häufig führt dies dazu, daß er auf das Hinterlegen von Dokumenten ganz verzichtet. Ein weiteres Problem ist in der geringen Flexibilität einer solchen Kategorisierung zu sehen. Eine wohlstrukturierte Dokumentendatenbank be- dingt einen hohen Verwaltungsaufwand. Kategorien, Sachgruppen und Stich- worte ändern sich permanent. Jemand muß den zu Grunde liegenden Doku- mentenbestand ständig an diese Veränderungen anpassen — mit wachsender Anzahl der Dokumente eine Sisyphusaufgabe. Bei einem Bestand von 5000 Dokumenten müßte jedes Dokument im Durchschnitt zweimal im Jahr neu
kategorisiert und verschlagwortet werden. Das sind 50 neue Zuordnungen pro Tag.27
Einer automatischen Verschlagwortung steht eines im Wege: Die Sprache. Für die elektronische Verarbeitung von geschriebenen und gesprochenen Tex- ten bedarf es einer exakten Kenntnis der Sprache, ihres Vokabulars und ihrer
Regeln.28 Bisher ist jedoch noch keine intelligente Informationserschließung durch den Rechner möglich, da die dazu notwendigen Erschließungstechniken
wie Mustererkennung (Pattern Recognition) noch nicht weit genug auf dem Gebiet der Sprache entwickelt sind.29
2.3.3 Volltextsuche
Eine Alternative zur effzienten Erschließung von Dokumenten bietet die Volltextsuche. Die Anfrage läßt sich mittels numerischen oder boolschen Verknüpfungen (AND, OR, NOT ...) beziehungsweise Abstandsoperatoren (SENTENCE, NEAR ...) verfeinern und ist heute die verbreitetste Metho- de. Daneben lassen sich Worte abschneiden und die ausgelassenen Wortteile durch Wildcards ersetzen.30 Ein sehr mächtiges Werkzeug bildet das Prinzip der regulären Ausdrücke, das seit Ende der 70er Jahren Bestandteil vieler Standard–Tools von Unix ist.31
Ein hohes Maß an Recherchekompetenz ist unabdingbare Voraussetzung, um bei spezifischen Themen mit der Kenntnis von Vieldeutigkeiten, Hom- onymen und Synonymen das Richtige zu finden. Den Anspruch, spezifische Inhalte von Dokumenten exakt aufspüren zu können, kann das boolsche Re- trieval allein nicht überzeugend erfüllen, da Worte als Zeichenketten ohne Bezug der Syntax und Semantik betrachtet werden.32
Erste Verbesserungen bei den Suchergebnissen erzeugen Stopwortlisten. Hierin werden Worte mit zu häufigem Auftreten gespeichert, die bei einer Suche zu viele Treffer erzeugen würden und somit als Eingrenzung nicht dienen können. Im Englischen gibt es ungefähr 250 solcher Wörter — es ist relativ einfach, sie in einem Wörterbuch zu sammeln33.
Durch Wortstammreduktion (engl. stemming) lassen sich Begriffe un- abhängig von verschiedenen Wortformen auf ihren Stamm reduzieren. Solch linguistische Verfahren verwenden heuristisches Wissen über die Verwendung der Sprache. So gibt es zum Beispiel Regelwerke für die Erkennung von Ei- gennamen.34
Eine weitere Möglichkeit, Wörter nach ihrer Bedeutung zu strukturie- ren, liegt in der Verwendung von Thesauri, in denen der Wortschatz nach verschiedenen Relationen (Oberbegriffe, Unteraspekte, verwandte Begriffe)
organisiert ist. So werden etwa bei der Suche nach Anfahrtsskizze“ auch Dokumente gefunden, in denen von Wegbesc ” hreibung“ die Rede ist.35
Fachgebietsspezifische Thesauri manuell zu erstellen ist allerdings sehr
aufwendig. Heute existiert eine Vielzahl verschiedener Methoden, die The- sauruskonstruktion zu automatisieren. Jedoch weisen automatisch erstellte Thesauri bei weitem nicht die strukturelle Dichte manuell erstellter auf. Der Pflegeaufwand, der für den Erhalt der Funktionalität bei den linguistischen
Verfahren aufzubringen ist, wächst überproportional zur Größe der Daten- bank an.36
Bei der Volltextsuche werden aus Gründen des schnelleren Zugriffs und der geringeren Last gerne Indizes erzeugt und verwendet. Da neue Suchanfra- gen nur noch mit diesem Index verglichen werden, ist zu beachten, daß somit an zwei Stellen die genannten Erweiterungen möglich sind: Sowohl bei der In- dexerstellung als auch bei der Abfrage. Durch Fuzzy–Technik, Rechtschreib- korrekturen oder gar phonetischer Suche lassen sich die Anfragen nochmals
benutzerfreundlicher gestalten37. Denn eine erfolglose Suche aufgrund eines vertauschten Buchstabens wirkt sehr demotivierend auf den Anwender — und dies ließe sich umgehen.
2.3.4 Groupware
Erfahrungsgemäß bestehen in größeren Organisationen die Hauptprobleme in drei Bereichen: Ineffzienz innerbetrieblicher Kommunikation, eingeschränk- te Kommunikationsmöglichkeiten sowohl innerhalb der Organisation als auch nach außen, sowie unzulängliche Informationstechnik. Unter Ineffzienz ver- stehen wir in diesem Zusammenhang Arbeitsverluste, welche durch Koordi- nationsprobleme, Mangel an Erinnerung, Informationsüberlastung sowie un- vollständige Informationsauswertung und Aufgabenanalyse entstehen. Aber auch die Dominanz weniger Personen innerhalb einer Organisation kann mit dieser Ineffzienz in Verbindung gebracht werden, da bei wenigen Ansprech- partnern diese ständig
überlastet sind, während sonstige Kapazitäten un- genutzt bleiben. Eine Einschränkung der Kommunikationsmöglichkeiten in- nerhalb der Organisation ergibt sich oft aus sehr abgegrenzten Kompetenz- bereichen, welche eine zu starke Betonung vertikaler Kommunikation zu la- sten horizontaler Kommunikation bewirkt. Da bei einer solchen Struktur der Großteil der Kommunikation über den Vorgesetzten läuft, entstehen einer- seits oft Zeitverluste, andererseits auch Informationsverluste. Im Bereich der
Informationstechnik ist bei der Lokalisierung von Informationen oft zu beob- achten, daß sie zwar theoretisch vorhanden wäre, aber die Verwaltung dersel- ben meist auf den Benutzer übertragen wird, so daß bei ungünstiger Ablage kein Zugriff möglich ist. Daraus ergeben sich vor allem wirtschaftliche und
technische Gründe für die Förderung von Gruppen und deren Unterstützung durch Rechner.38
Funktion von Groupware ist somit in erster Linie die Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten. Neben dem reinen Nachrichtenaustausch ist hierzu auch die Förderung von Diskussionen und Ermöglichung von Kon- ferenzen zu zählen. Hinzu kommt die Arbeit an gemeinsamen Dokumenten und deren Versionsverwaltung sowie Benachrichtigungen bei A¨ nderungen Letztlich bietet sich noch die gemeinsame Verwaltung von Terminen und Ressourcen an.39
2.3.5 Nutzung von Intranettechnologie
Das Internet bietet eine Reihe von Diensten, die auch in den firmeninternen Netzen gerne Verwendung finden. Zudem erleichtert es die Administration, da auf den Clients im Allgemeinen die einzig benötigte Software, der Web- browser, schon eingerichtet ist. Dadurch können die Kosten für die Software- verteilung und –wartung und damit auch die Total Cost of Ownership (TCO) reduziert werden40. Die wichtigsten dieser Dienste und ihre Bedeutung für das Wissensmanagement sind im folgenden kurz aufgeführt.
World Wide Web Schon bei der Entwicklung des World Wide Web (WWW) dachten die Pioniere des CERN in Genf, dem Europäischen Institut für Partikel- physik, in erster Linie an die Schaffung eines Systems, welches es den eigenen Mitarbeitern ermöglicht, auf bequeme Weise eine große Anzahl von Informationen gemeinsam zu benutzen.41
Da sich das WWW so leicht bedienen läßt, hat es sich in vielen Be- reichen des Internet durchgesetzt. Es wird oft (fälschlicherweise!) mit dem Internet gleichgesetzt.42 Es ist als Hypertext aufgebaut, d.h. es ist nicht linear eine feste Reihenfolge vorgegeben, sondern der Benutzer kann anhand von Verknüpfungen innerhalb des Textes die Informatio- nen abrufen.43
Das WWW eignet sich hervorragend für intuitive und somit leicht be- dienbare Oberflächen. Auch deren Erstellung wird durch die Hyper- text Markup Language“ (HTML44) zu einer eher angenehmen ”Aufga- be. Das WWW erleichtert auch das Wiedergeben und Einbinden von Dateien verschiedener Formate, da diese häufig dem Browser durch MIME–Typen45 bekannt sind.
E–Mail
Das elektronische Postsystem (E–Mail) ist das bisher erfolgreichste Sy- stem für CSCW46; für manche stellt es auch das bisher einzig erfolgrei- che CSCW–System dar47.
Der Hauptvorteil gegenüber herkömmlicher (Haus–)Post dürfte in der schnellen und unkomplizierten Verteilung durch das Simple Mail Trans- fer Protocol (SMTP) der Nachrichten liegen. Zudem lassen sich die digitalen Briefe besser mit Vermerken weiterleiten oder archivieren.48
Auch hier hat die Unterstützung verschiedener Formate durch MIME zu einer noch schnelleren Verbreitung beigetragen.49
News
Schwarzen Bretter“ (auch Neben der elektronischen Post sind die ” als USENET News bzw. Newsgroups bezeichnet) eine der wichtigsten Komponenten für die Arbeit in einer Gruppe. Eigentlich handelt es sich hierbei um den Grundstein für die vor der Verbreitung des Internet exi- stierenden Computer Bulletin Board Systems. Die Schwarzen Bretter arbeiten ähnlich wie die elektronische Post, nur daß die Nachrichten in verschiedenen Kategorien thematisch gegliedert werden. Die Nachrich- ten sind in diesen Kategorien öffentlich und können von jedem gelesen werden. Dabei kann jeder auch seinen eigenen Beitrag (Artikel) zu den Themen abliefern. So ist schließlich der Grundstein für die Foren zu einer Diskussion einer unbegrenzten Anzahl von Personen gelegt.50
[...]
1[Biethahn et al., 1997, 234]
2Vgl. [o. V., 2000a]
3[Clasen, 1998, S. 66]
4[Probst et al., 1999, S. 17]
5Vgl. [o. V., 1999] und [Kneuse, 2000]
6Vgl. [Weber, 2000]
7Vgl. [Mesaric, 2000]
8Vgl. [o. V., 2000b]
9[o. V., 2000a]
10[o. V., 2000a]
11Vgl. [Bach et al., 1999, S. 106]
12[Biethahn et al., 1994, S. 4]
13Vgl. [Biethahn et al., 1994, S. 6]
14[Probst et al., 1999, S. 36]
15[Probst et al., 1999, S. 54 f]
16[Piechota, 2000]
17Vgl. [Probst et al., 1999, S. 66]
18Vgl. [Kampffmeyer, 1999, S. 73 f]
19[Kampffmeyer, 1999, S. 74]
20Vgl. [Probst et al., 1999, S. 51 f]
21[Versteegen, 2000]
22[Versteegen, 2000]
23[Storp, 2000]
24Vgl. Microsofts ” Gemenge aus HTML und XML–Inseln“ in Office 10; [o. V., 2000b]
25Vgl. [Mesaric, 2000]
26Vgl. [o. V., 2000c, S. 26]
27[Gerick, 2000b, S. 124 f]
28[Lenders/Will´ee, 1998, S. 42]
29Vgl. [Kampffmeyer, 1999]
30[Gerick, 2000b, S. 125]
31Vgl. [Florian, 1997, S. 184 f]
32[Gerick, 2000a]
33[Salton, 1987, S. 77]
34[Gerick, 2000a]
35[Gerick, 2000b, S. 126]
36[Gerick, 2000a]
37Vgl. [Salton, 1987, S. 447 ff] und [Bager, 1996, S. 160 ?]
38[Borghoff/Schlichter, 1995, S. 79]
39Vgl. [Borghoff/Schlichter, 1995, S. 78 ff]
40Vgl. [Bach et al., 1999, S. 106]
41[Knut, 1997, S. 23]
42Eine unsaubere Verwendung findet sich beispielsweise auch in [Knut, 1997, S. 121 ff]
43Vgl. [Borghoff/Schlichter, 1995, S. 127]
44Siehe [Deep/Holfelder, 1997, S. 13 ff] und [Maurer, 1996, S. 5 ?]
45Vgl. [Knut, 1997, S. 129 ff]
46Computer Supported Cooperative Work, vgl. [Borgho?/Schlichter, 1995, S. 80]
47[Borgho?/Schlichter, 1995, S. 164]
48Vgl. [Knut, 1997, S. 26, 158 ff]
49Vgl. [Knut, 1997, S. 127 ff]
50[Knut, 1997, S. 161]
- Arbeit zitieren
- Michael Springmann (Autor:in), 2001, Definition und Aufbau einer Wissensdatenbank mit Intranettechnolgie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105499
Kostenlos Autor werden











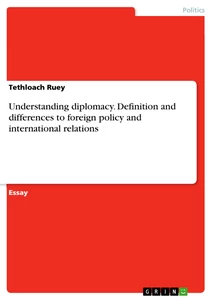



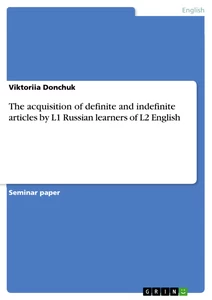


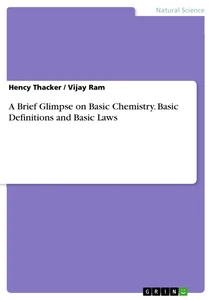

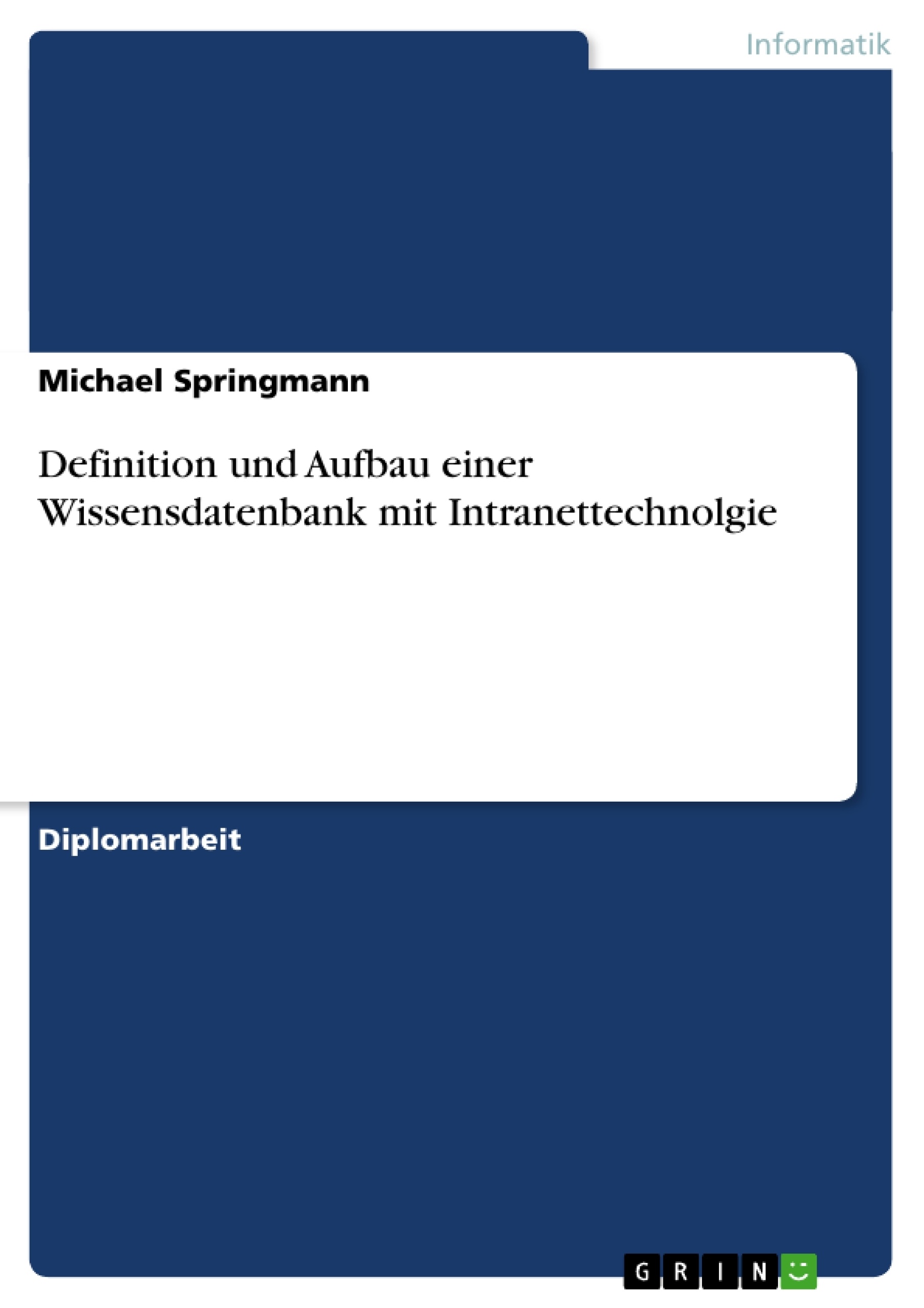

Kommentare