Leseprobe
Inhalt
Einleitung
Methodologische Vorbemerkung
SUBJEKT
Modernisierung
Wirtschaftliche Entwicklung
Domestizierung
Reflexive Moderne
Modernisierung der Kommunikation
Individualisierung sozialer Ungleichheit
Enttraditionalisierung industriegesellschaftlichen Lebensformen
Staffel
Wie die Stadt den Blick auf sich formiert
Entstehung einer Großstadtsoziologie
Durkheim
Tönnies
Paradoxie der Wahrnehmung
Das Ornament der Masse
Houellebecq
Die soziale Person
Simmel
Subjektivität
Houellebecq
Auflösung der Subjekte
Welches Subjekt löst sich auf?
Staffel
STADT
Medialität der Stadt
Der Text der Stadt
Die Stadt als Text
Die saussuresche Analogie von Stadt und Sprache
Stadttext und Virtualität
Die Mittelalterliche Stadt
Wandel zur Moderne: Verdammung zum Anachronismus?
Coupland
Houellebecq
„Urba oecomomica“
Coupland
Mimesis der Stadt
Du sollst Dir kein Bild von mir machen
Zentrum/Peripherie
Staffel
Zentren und periphere Blicke
Houellebecq
Eurozentristische Peripherie
Erfahrbarkeit und Erfassbarkeit der Stadt
Darf man Romane zur Untersuchung von Städten heranziehen?
Bildet der Text über die Stadt ab, oder produziert er?
Inszenierung der Stadt
MEDIEN
Medial Turn
Verschiebungen
Die Welt als Medienpoesis
Basistheorien für den „Medial Turn“
Medienkultureller Konstruktivismus (Schmidt)
Autopoietische Systemtheorie (Luhmann)
Mediatoren (Lischka)
Wirklichkeit
Wahrheit und Simulation
Medienkultur
Der Konstruktivismus
Kognition
Kognition und Realität
Kultur
Kommunikation
Luhmann
Schmidt
Medien
Houellebecq
Staffel
Realität der Medien
Mediale Realität und reale Realität
DeLillo
Komunisierung der Massenmedien und die Gefahren für die Demokratie
Goetz
Özdamar
Bürgerliches Subjekt und ‚neue Medien’
Die Zeit der Weltkommunikation
Isolation der Weltgesellschaft
Goetz
Anarchie der Information
Die Exkommunikation des Bürgers
Goetz
Schlussbemerkungen
Primärtexte
Sekundärtexte
Einleitung.
Im Zuge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Großstadtliteratur wurde in den letzten Jahrzehnten immer mehr eine Krise der Darstellbarkeit von Städten beobachtet. Man stellte in den Fiktionen oftmals ein Aufbrechen der Stadteinheit fest. Dieser Prozess bringt einen Funktionswandel der Stadt mit sich, oder besser einen Funktionsverlust, denn diese Funktionen werden von anderen gesellschaftlichen Bereichen übernommen, und lassen in der Stadt eine Leerstelle zurück.
Dieses Aufbrechen des Stadtganzen korrespondierte mit der Auflösung einer subjek- tiven Einheit. Es scheint also eine enge Parallelität zwischen Stadt und Subjekt zu bestehen.
Um sich mit dieser Frage ernsthaft auseinander setzen zu können, schien es mir sinnvoll, zunächst sich dem Verhältnis von Subjekt und Stadt methodologisch und theoretisch zu nähern. Die Metaphorisierung der Stadt als Text bietet sich dabei an, das Verhältnis von Zeichensystem, medialer Vermittlung und Leser aber auch das von Funktion und Bedeutung zu untersuchen. Diese Metaphorisierung ist aber nicht unproblematisch: Spricht man etwa Texten Virtualität zu, so ist diese Virtualität auch in der Textmetapher der Stadt mitzudenken. Misst man aber der Stadt Virtualität bei, so stellt sich die Frage nach der Realität der Stadt. Eine Realität, die vielleicht nur noch im Individuum, im Subjekt re-kombinierbar ist.
Wie sich im Verlauf der Arbeit zeigen wird, ist die Stadt kein ‚unverfälschter’ Text, und der Leser kein leeres Blatt Papier. So sind Stadt wie Subjekt vielen Einflüssen, aber auch Inszenierungen und Maskierungen unterworfen. Wie sich in der Arbeit zeigen wird, werden diese Inszenierungen, Simulationen und Fiktionen hauptsächlich von Massenmedien geleistet. In gewisser Weise kann man behaupten, dass Medien unsere neue Stadt sind. Aber diese ‚neue Stadt’ hat globale Strukturen und unterliegt somit auch global operierender Interessensgruppen; hinter diesen Tatsachen verber- gen sich nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch Risiken. Das vieldiskutierte „Verschwinden des Subjekts“ könnte ein Symptom dieser Medienkultur sein.
Und so kann man die Parallele zum Individuum ziehen, und eine Verschiebung von Simmels Konzept der Sozialen Person hin zu einer medialen Person unterstellen. Diese Prozesse gehen nicht spurlos an der Befindlichkeit von Subjekten vorbei. Die ‚mediale Person’ ist von einem Vakuum an zwischenmenschlicher Wärme gekenn- zeichnet. Die Möglichkeit zu interagieren, seinen persönlichen Problemen einen Na- men zu geben, scheint in den meisten Fällen nicht gegeben. Die Reaktionen auf die persönlichen Lebenssituationen scheinen allesamt eine ablehnende Haltung zu artikulieren. Mord, Selbstmord und psychische Erkrankung sowie eine Gefühl des Scheiterns sind die menschlichen Symptome einer globalen Kultur. Flucht scheint die einzige Alternative, dennoch gelingt sie nur in den seltensten Fällen. Es sind Symptome einer in irgendeiner WeisetraumatisiertenGesellschaft. Betrachtet man die Geschichte dieses Begriffes Trauma, so lässt sich diese mit historischen ‚Katast- rophen’ parallelisieren. Der erste Weltkrieg, Auschwitz und Vietnam um hier nur einige Beispiele zu nennen. Nur lässt sich für die in dieser Arbeit festgestellten Pro- zesse, die ich oben provisorisch traumatisch genannt habe, kein bestimmtes Ereignis bestimmen. Es scheinen vielmehr leise Entwicklungen zu sein, deren Veränderungen erst nach einer Latenzphase zutage treten, zudem weichen auch die Symptome vom ‚klassischen’ Krankheitsbild ab. Ich kann leider im Rahmen dieser Arbeit nicht wei- ter auf diesen Bereich eingehen, doch scheint mir der Begriff des Traumas am besten geeignet, die Befindlichkeit der literarischen Subjekte der letzten Jahre zusammenzu- fassen.
Das Bild einer Gesellschaft, die das Individuum überholt und dabei von der Fahrbahn abdrängt, drängt sich auf. Doch spielt sich dieses Überholmanöver nur zum Teil auf der Straße ab, denn in der Hauptsache ist es ein innerpsychischer Vorgang. Vielleicht kann man diese Vorgänge mit der Intention Ernst Jüngers vergleichen, der laut Alb- recht Koschorke mit seinem Essay „Über den Schmerz“ (1934) den Leser mit den Beschreibungen von Kriegsgrausamkeiten zu traumatisieren trachtet: „Was die inne- re Form dieser Untersuchung betrifft, so beabsichtigen wir die Wirkung eines Ge- schosses mit Verzögerung, und wir versprechen dem Leser, der uns aufmerksam folgt, dass er nicht geschont werden soll“ (E. Jünger, zit. nach Koschorke 213)1.
Doch wird diese virtuelle Traumatisierung in der Mehrzahl heute nicht mehr durch Text, sondern durch elektronische Medien geleistet.
Methodologische Vorbemerkung
Die folgende Arbeit verfolgt nicht das vorrangige Ziel, vollständige Analysen von Primärtexten zu erarbeiten. Daher werde ich keine Figurenkonstellationen oder Formalia der verwandten Romane gesondert darstellen und analysieren. Ich habe versucht die Auswahl und Analyse der Passagen, obwohl sie mehr oder weniger krude aus dem Gesamtzusammenhang gerissen wurden, so zu gestalten, dass die Interpretationsspielräume, die die Erzählungen bieten, nicht verletzt werden.
Mir schien es in Anbetracht des Themas angeraten, zunächst auf theoretischer Ebene zu prüfen, ob und welche Zusammenhänge zwischen den Bereichen Großstadt, Subjekt und Medien bestehen.
Die Romane, auf die ich mich im Verlauf der Arbeit beziehen werde sind vor allem Tim Staffel: Terrordrom; Michel Houellebecq: Ausweitung der Kampfzone. Außer- dem verwende ich Rainald Goetz: Rave und Dekonspiratione; Sevine Özdamar: Die Brücke vom Goldenen Horn; Don DeLillo: Unterwelt und Douglas Coupland: Sham- poo Planet. Die Kapitel, die mit den Namen der Autoren benannt sind stellen keine gesonderten Kapitel dar, sondern dienen der Übersichtlichkeit. Zudem soll so ein schneller Zugriff auf literarische Analysen ermöglicht werden; unter diesen Ü- berschriften werden theoretische Aspekte des vorangegangene Kapitels auf die Ro- mane angelegt. So sollen bestimmte Diskussionselemente illustriert und veranschau- licht werden. Doch soll durch den Vergleich mit den Romanen mehr geleistet wer- den, als lediglich einen bestimmten Aspekt besser greifbar zu machen oder zu illust- rieren: Die Erzählungen dienen als Prüfsteine für die Theoriedebatten, an ihnen soll Plausibilität und Richtigkeit der theoretischen Diskurse erörtert werden. Es ist also eine metatheoretische Arbeit, die nicht die Literatur an der Theorie, sondern die The- orie an der Literatur zu messen versucht.
Obwohl die Germanistik vorrangig deutsche Literatur untersucht, ist die Auswahl der Autoren für diese Arbeit international. Dies lässt sich zum einen mit einem rezepti onsästhetischen Standpunkt argumentieren; zum anderen sind die der Untersuchung zugrunde liegenden Prozesse global. Globalisierung gewisser Architekturstile, Glo- balisierung von Kommunikation und somit Globalisierung gewisser Subjektkonzep- tionen und Staatsformen, sowie die Globalisierung gewisser Praktiken innerhalb die- ser Staatsformen. In gewisser Weise ist die Auswahl der Romane auch Beleg für eben diese globalen Tendenzen. Doch ist Globalität nicht das zentrale Thema dieser Arbeit.
Die Auswahl der Sekundärtexte fand nicht nur unter literaturwissenschaftlichen As- pekten statt, die Thematik und nicht die Disziplin stand im Vordergrund. So erklärt es sich, dass Texte aus vielen verschiednen wissenschaftlichen Bereichen herangezo- gen wurden. So sind vor allem (Großstadt)-Soziologie und reflexive Sozialpsycholo- gie im Themenkomplex Subjekt verwendet worden. Linguistik, Literaturwissenschaft und Architektur im Bereich Stadt. Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Systemtheorie dienten als Grundlagen für das Kapitel Medien. Vielleicht lässt sich über die Rekombination der Teildisziplinen die oft kritisierte Segmentierung des Erkenntnisobjekts kompensieren. Die Arbeit kann dennoch als germanistisch gelten, da Erzählungen als zentraler
„Danke.“
„Wie?“
„Es reicht.“
„Du hast also genug?“ „Ja.“
„Du bist also einverstanden?“ „Nein. Aufhören.“
„Du kannst jederzeit gehen.“ „Kann ich nicht.“
„Du brauchst nur ja zu sagen.“ „Aua.“
„Also einverstanden?“ „Nein.“
„Der hat genug.“
„Du hast mich tot geschlagen.“
„Nein wir schlagen nur dein Hirn zu Brei.“ „Mörder.“
„Der nächste bitte.“
Rainald Goetz, Dekonspiratione.
SUBJEKT
Modernisierung
„Die Seele ist das Gefängnis des Körpers“. Eine der großen Bewegungen der Moder- ne ist von außen nach innen. Hatte man - beispielsweise im Mittelalter - vor allem am Körper angesetzt, um sich die Menschen nach ‚seinem Bild’ zu schaffen und zu kontrollieren, so setzen Beherrschungsmechanismen mit fortschreitender Moderni- sierung immer mehr an der Psyche des Menschen an. Dem Körper, etwa des Bauern, wurde in feudalen Gesellschaftssystemen wenig Achtung und Wertschätzung entge- gengebracht. Sein Körper war es, an dem alle Machtmechanismen sich kulminierten, und so hatte er auch zu funktionieren. Die Kirche sprach ihm eine unsterbliche Seele, die nach dem Tode frei sein würde zu. Ansonsten war ‚hinter’ dem Körper nichts zu holen. Mit der Modernisierung kam die Psyche des Menschen in den Brennpunkt; ein staatlich zugesichertes Recht auf unversehrten Leib und Gemüt. Nun dient nicht mehr der Körper als Reflexionsfläche einer übergeordneten Macht, sondern die ge- sellschaftliche Ordnung wird verinnerlicht und ist Teil einer bürgerlichen Identifika- tion.
Das bürgerliche Subjekt strebt im Regelfall selbst nach Anpassung. Doch was ge- schieht, wenn die Pastoralmacht, wie Foucault sie nennt, keinen allumfassenden Schutz mehr bietet? Wenn gesellschaftliche Rituale ausgehöhlt sind und ihre Bedeu- tung nur noch in sich selbst tragen? Was passiert, wenn Gesellschafts- und Subjekt- utopien sich gegen Gesellschaft und Subjekt wenden, wenn, erreicht man den U- Topos, keine Versprechen erfüllt werden? So bleibt die Achtung vor dem Körper, aber das Gemüt treibt man unter unmenschlichen Bedingungen zur ‚Feldarbeit’. So wie in Kriegen Körper vernichtet wurden und immer noch werden, so werden heute Subjekte produziert. Die Herstellung eines intendierten Subjekts kann aber die Aus- löschung eines ‚natürlichen’ Menschen bedeuten. Wird im Fernsehen ein Mord ge- zeigt, so hört kein ‚Körper’ auf zu existieren.
Ist die Psyche, die vielleicht großartigste Erfindung der Moderne, einmal ihrer Unantastbarkeit beraubt, wird auch bald der Körper nicht mehr unantastbar sein. In den folgenden Kapiteln möchte ich nun kurz die Entwicklung einer bürgerlichen Subjektivität skizzieren.
Wirtschaftliche Entwicklung
Im Italien des 14. Jahrhunderts setzte eine Veränderung der Produktionsweise ein, eine Veränderung, auf der auch heute noch unsere Gesellschaft basiert. Es ist dies der Übergang von einer feudalen Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die von einer kapitalistischen Funktionsweise geprägt ist. Diese Entwicklung war innerhalb Euro- pas von großen regionalen Unterschieden geprägt. In Deutschland, das erst seit 1871 eine Nation ist, ging dieser Prozess schleppender vor sich als z.B. in Holland. Kleine Herzogtümer, zersplitterte Gebiete und uneinheitliche Regierungen verlangsamten die Entwicklung des Bürgertums, hielten sie aber nicht auf. Ziel dieses Abschnitts ist keine exakte historische Analyse dieser Entwicklungen; ich möchte vielmehr die Parallelen zwischen wirtschaftlichen Entwicklungen und der Herausbildung be- stimmter psychischer und sozialer Strukturen im Subjekt und letztlich das Entstehen der neuzeitlichen Subjektivität in unserem Kulturkreis nachzeichnen.
Das folgende Zitat fasst denkbar klar die Situation des Individuums in der Feudalgesellschaft zusammen:
In der Feudalgesellschaft war das Mitglied eines Standes vollständig bestimmt durch die sozialen Lebensbedingungen des Standes. Mit der Geburt war bereits die spätere Lebenstätigkeit vorgezeichnet. Die beginnende soziale Mobilität zwischen den Ständen zerreißt die Konzeption solcher außenbestimmten sozia- len Identität. (Meschnig 24)2
Meschnig sieht in der radikalen Umwälzung der bestehenden Ordnung gegen Ende des 18. Jahrhunderts den entscheidenden Punkt für unsere „heutige Selbstinterpreta- tion“ (Meschnig 25). Dieser Prozess der Durchsetzung des kapitalistischen Systems kann somit unter anderem auch als Konstituierungsprozess einer bürgerlichen Ge- sellschaft gelten. Diese Umwälzung stellte natürlich auch neue und komplexere An- forderungen an die individuellen und psychischen Strukturen der Menschen. Wel- ches die entscheidende Kraft dieser Veränderung war, ist nicht entscheidend; den- noch wird der ökonomische Prozess, der wiederum eine soziale Veränderung nach sich zog, von technologischen und wissenschaftlichen Entwicklungen mitgetragen und ermöglicht. Es scheint mir aber unmöglich, einen originären Punkt auszuma chen, der die Kapitalisierung auslöste oder entschieden voran trieb, vielmehr verstärkten sich die einzelnen Entwicklungen gegenseitig. So ist die Erfindung der Dampfmaschine 1735 von James Watt zwar ein entscheidender Schritt auf die Industrialisierung, dennoch waren hunderte anderer Entwicklungen ebenso notwendig. Ihre ersten Impulse erhielt sie bereits Jahrhunderte vorher. Marx nennt einen entscheidendes Moment in der Modernisierung:
Der Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen [...] Unter Produktivkräften ist der Entwicklungsstand der Naturbeherrschung gemeint. [...] Produktionsverhältnisse sind jene sozialen Verhältnisse, die Menschen in der Produktion des materiellen Lebens miteinander eingehen. (Marx, zit. nach Meschnig, 26 f)
Ab einem gewissen Punkt in der Entwicklung der Produktivkräfte - damit sind alle vorhandenen Technologien, Wissensstände, Rohmaterialien usw. gemeint - überholen diese die angestammten Arbeitsverhältnisse. Es kommt zu einem Konflikt: „Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein“ (Meschnig 27). Das Aufbrechen der feudalen Ordnung und damit auch das Aufbrechen der Ständegesellschaft kann durchaus als eine soziale Revolution betrachtet werden.
Bleiben wir noch ein wenig bei der Analyse der Kapitalisierung von Marx. Er macht drei entscheidende Bedingungen aus, die er unter dem Terminus „ursprüngliche Ak- kumulation“ zusammenfasst. Die erste ist die Trennung des Arbeiters von seinen Produktionsmitteln. Ein Bauer, der sein Feld bestellt und dann seine Produkte selbst konsumiert kann schwerlich in einen umfassenden Warenaustausch eingebunden werden. Norbert Elias nennt diese Form des Wirtschaftens Naturalwirtschaft. Dabei kommt es nur im geringen Maße zu einer Trennung von Produzenten und Konsu- menten, die Produkte legen keine großen räumlichen Distanzen zurück, werden mehr oder weniger vor Ort konsumiert es entstehen kaum bzw. wenig komplexe Interde- pendenzketten. „Diese Ketten differenzieren und verlängern sich allmählich. Erzeu- gung und Verbrauch fallen immer mehr auseinander, größere Gebiete werden mit- einander verflochten, begeleitet von „einer Expansion des Geldumlaufes“ (Meschnig 29). Nach Elias ist für diese Entwicklung eine starke Zentralgewalt mit großer terri- torialer Ausdehnung nötig. Als solche Zentralgewalten können Fürstentümer gelten. Nationalstaaten bieten, aufgrund größerer territorialer Ausdehnung und größerer Sta- bilität und mit einer gemeinsamen Währung einen geeigneteren Nährboden für die mit der Kapitalisierung gekoppelte Modernisierung. Auch dieser Prozess ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Doch zurück zu Marx:
Der zweite Punkt ist ein Resultat der obigen Voraussetzung: Der von den Produkti- onsmitteln getrennte Arbeiter der Naturalwirtschaft wird laut Marx „doppelt frei“. Zum einen frei von eben den Produktionsmitteln, andererseits aber auch ‚frei’, seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt anzubieten. Doch ‚frei’ heißt hier: Der Arbeiter muss außerhalb der Sicherheiten der Naturalwirtschaft seine Kraft auf dem Arbeits- markt anbieten. Der dritte Punkt ist die Akkumulation von Kapital: Je weiter Produ- zent und Konsument auseinander liegen, desto mehr Kapital wird als Platzhalter für Naturalien nötig.
Im Gegensatz zur naturalwirtschaftlichen Produktionsweise der feudalistischen Welt, in der noch der Großteil der Güter für die Befriedigung der eigenen Be- dürfnisse produziert wird, erzeugt die industrielle Produktion eine tendenzielle Umwandlung aller Dinge in Waren. Hier ist der vorherrschende Zweck der Herstellung der und Verteilung von Gütern nicht mehr ihr konkreter Nutzen für die menschliche Bedürfnisbefriedigung sondern ihr allgemeiner Tauschwert. Alles ist käuflich alles wird verkäuflich: Erde, Produktionsmittel, Arbeitskraft. (Meschnig 28)
Eine Entwicklung, die bis heute noch nicht ihren Abschluss gefunden hat. Diese Entwicklung führt z.T. soweit, dass neue Bereiche, Bedürfnisdimensionen erst erschaffen werden, um sie merkantil abzuschöpfen.
Gesellschaften ohne stabiles Gewaltmonopol sind immer zugleich Gesellschaf- ten, in denen die Funktionsteilung relativ gering und die Handlungsketten, die den Einzelnen binden, verhältnismäßig kurz sind. Umgekehrt: Gesellschaften mit stabileren Gewaltmonopolen, verkörpert zunächst stets durch einen größe- ren Fürsten- oder Königshof, sind Gesellschaften, in denen die Funktionsteilung mehr oder weniger weit gediehen ist, in denen die Handlungsketten, die den Einzelnen binden, länger und die funktionellen Abhängigkeiten des einen Men- schen von anderen größer sind. (Meschnig 33)
Diese Aussage lässt sich beispielsweise durch die Tatsache stützen, dass die Kapita- lisierung in Deutschland viel später einsetzte als etwa in England, was mit der territo- rialen Zersplitterung Deutschlands durch kleine Fürstentümer zu erklären ist. Die oben beschriebenen Prozesse zeigen die paradoxe Entwicklungsstruktur der Mo- derne: Die Bevölkerung der unteren Schichten bekommt in einer Hinsicht höhere Freiheitsgrade zugesprochen, wie etwa aufbrechende Ständeverordnungen. Doch werden individuelle Berufswahlmöglichkeiten, um nur ein Beispiel zu nennen, von anderen Vorgaben beschränkt. Diese Bewegung: Das Frei-Werden aus einer Struk tur, um dann unter eine andere gefügt zu werden besteht in vielerlei Hinsicht bis heute. Dies ist, was man als paradox der Moderne bezeichnet. Man wird freigesetzt, diese Freisetzung mündet aber wieder in einer neuen Strukturvorgabe.
Domestizierung
Was aber haben diese genannten wirtschaftlich/wissenschaftlich/technisch/sozialen Entwicklungen mit der Entwicklung einer neuen Subjektivität zu tun? Die im Vorangegangenen genannten ‚längeren’ Handlungsketten und ‚komplexeren’ Interdependenzen der neuen wirtschaftlichen Beziehungen fordern von den Menschen neue Fähigkeiten. Sie schaffen neue Berufe und neue Schichten. Zum einen hatten die Menschen zum ersten mal die Chance sich selbst zu definieren, auf der anderen Seite standen sie auch in der Pflicht dies zu tun.
Norbert Elias verortet den Ursprung vieler Verhaltensformen im Adel des 17./18. Jahrhunderts:
In dieser höfischen Gesellschaft wird der Grundstock vieler Verhaltens- und Verkehrsformen ausgeprägt, die dann durchtränkt von anderen und je nach La- ge der tragenden Schichten verwandelt, mit dem Zwang zur Langsicht zu im- mer weiteren Funktionskreisen wandern. Ihre besondere Situation macht die Menschen der höfischen, guten Gesellschaft stärker als irgendeine andere a- bendländische Gruppe im Zuge dieser Bewegung zu Spezialisten für die Durch- formung und Modellierung des Verhaltens im gesellschaftlichen Verkehr, denn zum Unterschied von allen folgenden Gruppen in der Lage einer Oberschicht haben sie zwar eine gesellschaftliche Funktion aber keinen Beruf. (Meschnig 34)
Die Menschen der entstehenden bürgerlichen Schicht haben einen Beruf. Damit wächst auch der Druck auf den Einzelnen, sich und seine Geschäftspartner gleichbe- rechtigt zu reflektieren. Die gegenseitige Abhängigkeit untereinander nimmt zu und so auch der Zwang zum Selbstzwang. Emotionen, triebhaftes Verhalten und Affekte müssen immer stärker verborgen und unterdrückt werden. Eben diese Affekte wer- den aber auch immer mehr zur Zielscheibe der Selbstanalyse: Nur wer sich selbst versteht, kann auch erahnen, was das Gegenüber plant. Dennoch fällt dieser neue Mensch nicht vom Himmel, er hat hart an sich zu arbeiten, er muss mit „Arbeit am Selbst erst geschaffen werden“ (Meschnig 35).
Norbert Elias nennt diesen Schritt Domestizierung. Auf dieses Themengebiet möchte ich im Folgenden noch weiter eingehen.
Seit Anbeginn seiner Geschichte hat der Mensch versucht, sich der Hinfälligkeiten seines Körpers mit technischen Hilfsmitteln zu entziehen. Im Zuge der kulturellen Entwicklung wurde der Körper und die Umwelt immer stärker vom Menschen beherrscht und sozial besetzt. „Die Zähmung der natürlichen und biologischen Kräfte und damit das Optimieren der Möglichkeiten, welche Natur und Körper bieten, umschreiben wir als Domestizierung“ (Loo/van Rejien 196)3.
Das ursprüngliche Verhältnis von Mensch und Natur hat sich in der modernen Ge- sellschaft immer stärker verändert. So lebt der Mensch immer mehr in einer künstli- chen, vom Menschen geschaffenen Umgebung. Das macht eine Unterscheidung von Kultur/Natur immer schwieriger. Durch den technischen Fortschritt wird der Mensch immer mehr aus dem ursprünglichen Abhängigkeitsverhältnis zur Natur herausge- löst.
Großausgelegte Gebäudekomplexe und urbane Infrastrukturen führten darüber hinaus zu Umgebungen die ihrer natürlichen Elemente, zum Beispiel klimatische Unterschiede [...] entkleidet wurden. (Loo/van Rejien 196)4
Eine weitere der unzählbaren Folgen der Modernisierung und der Entwicklungen im Bereich der Hygiene ist die Verlängerung der Lebenserwartung. Der Begriff der Domestizierung darf aber nicht nur im Sinne einer Befreiung des Menschen aus dem angestammten Abhängigkeitsverhältnis begriffen werden, auch ist er nicht völlig von seiner Natur befreit.
Die Abhängigkeit von der Natur ist durch das Verschwinden des unmittelbaren Kontakts mit den verschieden Naturkräften nur weniger direkt spürbar geworden. Man verlor sie so leichter aus dem Auge. (Loo/van Rejien 196)
Die Domestizierung bringt es auch mit sich, dass der Mensch in neue Abhängigkei- ten gerät. Dadurch ergibt sich eine paradoxe Situation, zum einen wird der Mensch aus alten Abhängigkeiten befreit, gerät aber in eine Neue Abhängigkeit der Substitu- te der alten Abhängigkeit. War man zum Beispiel in alten Tagen als Bauer von kli matischen Bedingungen abhängig, so ist man heute abhängig von gewissen Produkten, wie etwa Düngemitteln.
Dennoch, die technologische Entwicklung bringt nicht nur neue Abhängigkeiten und Beherrschungsmuster hervor, erzeugt nicht nur neue Beziehungen der Menschen untereinander, sie erfordert nicht nur eine neue Form der Eigenkontrolle, „sondern ließ auch neue Denkmuster entstehen“ (Loo/van Rejien 198). Letztlich verändert der Mensch im Gebrauch seiner Artefakte sich selbst, und das sowohl psychologisch wie auch physiologisch.
Mit der zunehmenden Domestizierung gewinnen die technischen Beherrschungsmöglichkeiten auch eine neue Qualität: Zunächst sollte Technik lediglich als Kompensation eines menschlichen Defizits dienen, im Laufe der Entwicklungen trat der eigentliche Nutzwert der Produkte jedoch immer mehr in den Hintergrund. Entscheidend ist nicht Nutzen, sondern alleine der Tauschwert. Das alleine bringt aber noch keinen neuen Menschen hervor:
Die moderne Technologie verändert aber nicht nur die Natur sondern auch den Menschen selbst als geistiges und soziales Wesen. [...] Äußerst produktive, dynamische und mit großer Präzision und Intensität arbeitende technische Apparate verlangen auch sehr produktive, dynamische, intensiv und produktiv funktionierende Menschen! (Loo/van Rejien 198)
Entscheidend für den Prozess der Modernisierung ist dieVerinnerlichungvon „for- malisierten Verhaltensstandards“ (Hohl 31)5. Hohl stellt fest, dass es in den letzten Jahrzehnten zu scheinbaren Verletzungen bestimmter Verhaltensstandards gekom- men ist. So sind beispielsweise gewisse Verhaltensregeln aufgelockert. Ein gutes Beispiel sind die sprichwörtlichen ‚Naggad´n’ im Englischen Garten. Zunächst könn- te man annehmen, dass hier bestimmte ‚Errungenschaften’ der Zivilisation über Bord gehen, doch dieser Prozess der Informalisierung widerspricht dem der großangeleg- ten Programm der Modernisierung nur scheinbar. So kommt es unterm Monopterus keineswegs zu archaischen Paarungsorgien. Diese Informalisierungsprozesse bleiben in einem gewissen Rahmen. Stephen Menell spricht von einer „highly controlled decontrolling of emotional controls“ (Hohl 32). In gewisser Weise scheinen solche Informalisierungen Voraussetzung eines zivilisatorischen Prozesses zu sein. Denn hätte sich - damals unvorstellbar - die Ständegesellschaft nicht aufgelöst, gäbe es auch unsere heutige Gesellschaft nicht in dieser Form.
Werden nun die den Menschen von außen auferlegte Kontrollen schwächer, so werden diese - ein gegebenes Zivilisationsniveau vorausgesetzt - darauf mit einer Verstärkung ihrer Selbstkontrollstruktur reagieren; denn den normativen Halt und damit die soziale Orientierung, die zuvor von außen kamen, müssen sie nun selbst produzieren. (Hohl 33)
Denn auch der Prozess der Verinnerlichung des gesellschaftlichen Zwangs hat sich über die Generationen vererbt und ‚verinnerlicht’. Dennoch ist hier Meschnigs Darstellungsweise in gewisser Weise idealisiert, er relativiert seine Ausführungen; was eigentlich für die Menschen der Phase der Industrialisierung gelten sollte, hat auch heute noch - wie ich finde - seine Gültigkeit.
Für einen Großteil der Menschen war die Möglichkeit einer freien Thematisie- rung des Selbst nicht gegeben. Sie wurden mehr oder weniger funktionierende Teile einer Maschinerie, die ihnen ihre neuen Selbst- und Fremdbilder auf- zwang. Zwar stellten sich [...] Probleme der Integration und der Verarbeitung der neuen Anforderungen an die Gesellschaft, doch im allgemeinen disziplinierte die ökonomische Produktion verlässlich in Richtung auf den rastlosen, nach Erwerb strebenden Menschen. Die Unterordnung der Arbeiter unter die Logik einer Maschinerie, die die Geschwindigkeit und den Ablauf der Handlungen bestimmte, führte zu ganz neuen Erfahrungen der Entfremdung: zur Herrschaft von Sachen oder Dingen, die die Herrschaft von Menschen über Menschen ablöste und verschleierte. (Meschnig 36)
Das Privileg der Möglichkeit der Selbstthematisierung ist nach wie vor einer kleinen Schicht vorbehalten.
Unsere gegenwärtige Kultur hält viele wunderbare Errungenschaften für ihre Kinder bereit. Pressefreiheit, Menschenrechte, medizinische Versorgung, Freiheit in der Be- rufswahl, um nur einige zu nennen. Ein wichtiger Punkt ist unter anderem das recht auf freie Meinungsbildung. In der Festung der bürgerlichen Wertegemeinschaft schien diese gesichert. Doch scheint diese Wertegemeinschaft mehr und mehr aus den Fugen zu geraten. Der Bürger, oder das bürgerliche Subjekt findet in seiner Kul- tur vielschichtige Möglichkeiten der Identifikation, was den Notstand an bestehenden Werten zu kompensieren scheint.
Reflexive Moderne
Ulrich Beck stellt in seinem Werk „Risikogesellschaft“ einen Wandel innerhalb der Moderne fest: In Analogie zu der ‚industriellen’ Auflösung der Ständegesellschaft sieht er nun eine Auflösung der Konturen der Industriegesellschaft durch eine andere Form der Modernisierung.
Im 19. Jahrhundert wurden die traditionellen Wertesysteme religiöser wie gesell- schaftlicher Art von der aufkommenden Industriegesellschaft und der damit ver- knüpften ‚Rationalisierung’ „entzaubert“ (Beck 14)6, so wenden sich die Produkte der fortschreitenden gesellschaftlichen Entwicklung nun gegen die Industrialisierung. Mit dem Wissen um die Gefahren wächst das Misstrauen in die Technologie.
Modernisierung in den Bahnen der Industrialisierung wird ersetzt durch eine Modernisierung der Prämissen der Industriegesellschaft, die in keinem der bis heute gebräuchlichen theoretischen Regie- und politischen Rezeptbücher des 19. Jahrhunderts vorgesehen war. Es ist dieser aufbrechende Gegensatz von Moderne und Industriegesellschaft [...], der uns, die wir bis ins Mark hinein gewöhnt sind, die Moderne in den Kategorien der Industriegesellschaft zu denken, heute das Koordinatensystem verschwimmen lässt. (Beck 14)
Beck unterscheidet folglich zwischen „einfacher und reflexiver Modernisierung“ (Beck 14). Die ursprünglichen Koordinaten oder Prämissen für eine adäquate Beur- teilung der Modernisierung, oder einfach der gesellschaftlichen Entwicklung fallen weg; das Gegensatzpaar traditionell/modern hat in dem komplexen z.T. selbstreferentiellen Gesellschaftssystem keine Geltung mehr. Der Prozess der Modernisierung bezieht sich nicht mehr auf vormoderne Strukturen, sondern bereits auf Resultate der Modernisierung. Die Annahme Becks steht nur scheinbar in einem gewissen Widerspruch mit der von mir gemachten Behauptung der typischen Bewegung der Modernisierung, dass die Menschen aus traditionalen Strukturen herausgelöst werden, um dann durch neue Strukturen begrenzt zu werden. Die von mir festgestellte typische Bewegung der Moderne kann sich auch auf bereits in weiteres Charakteristikum der reflexiven Moderne ist, dass Risiken vor allem durch Wissen bzw. Nichtwissen bestimmt sind. „In Klassenlagen bestimmt das Sein das Bewusstsein, in Risikolagen umgekehrt das Bewusstsein (Wissen) das Sein“ (Beck 70). Wie aber wird dann in Risikolagen das Bewusstsein bestimmt? Durch
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Medien. Dafür ist eine von Beck so genannte „Eigenerfahrungslosigkeit“ (Beck 70) nötig. Es entsteht ein gewisses Definitionsvakuum. So können wiederum zentrale Definitionsmächte die zumeist unsichtbaren Risiken der modernen Gesellschaft defi- nieren; (vgl. Radioaktivität). Beck rechnet diese Definitionshoheit der Naturwissen- schaft zu, der in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zufällt, wie z.B. das Festlegen von bedenklichen Konzentrationen bestimmter Gifte. Dennoch glaube ich, dass trotz quantitativer Messmethoden für bestimmte Grenzwerte z.B. und den Hin- weisen auf Gefahren für den Menschen, diese Schlüsselrolle eigentlich nicht der Wissenschaft zufällt, sondern den Instanzen, die für die Wissensdistribution zustän- dig sind. Diese Instanzen für die Wissensdistribution sind nicht zuletzt die Massen- medien.
Aus diesen oben genannten Verallgemeinerungen der Risikoverteilung schließt Beck: „Das Ende der Gegenüberstellung von Natur und Gesellschaft“ (Beck 107). Dies sei aber keine Folge der Medialisierung, sondern der Globalisierung der Ge- fährdungen. Da beide Bereiche (Natur/Gesellschaft) derart ineinander verstrickt sind, können sie nicht mehr getrennt von einander betrachtet werden. Die industriellen Gefährdungen bedrohen, wegen ihrer globalen Wirkungen, indirekt über die Natur wiederum den Menschen. Zudem sei die industrielle Gesellschaft ohne natürliche, ausbeutbare Ressourcen nicht vorstellbar. Die Naturzerstörung wird sozusagen Be- standteil der industriellen Produktion. Aber nur so ist es möglich, dass der Raubbau an der Natur gesellschaftliche Folgen - und zwar weltweit - hat.
Die zentrale Konsequenz: Gesellschaft mit all ihren Teilsystemen Wirtschaft, Politik, Familie, Kultur lässt sich gerade in der fortgeschrittenen Moderne nicht mehr ‚naturautonom’ begreifen. Umweltprobleme sind [...] gesellschaftliche Probleme, Probleme des Menschen. (Beck 108) Beck sieht in dieser globalen Gefährdung die gesellschaftliche Herausforderung, die den Begriff der Risikogesellschaft rechtfertigt.
Modernisierung der Kommunikation
Faßler hat besonderes Augenmerk auf die Modernisierung der Kommunikation ge- legt. Der Bürger entstand im urbanen Umfeld in Abgrenzung zu Adel, Klerus und Bauerntum. Erst durch die Verbindung von Besitz und Bildung konnte das Bürgertum an der Kommunikation teilnehmen.
Die Verschmelzung von Protestantismus und Ökonomie war ein entscheidendes Moment. Sie ermöglichte eine Ehrfurcht vor dem Schaffen, nicht der Schöpfung. Sozusagen ein kirchlich genehmigter Industrialisierungsprozess. „Religion und Industrie feierten im neunzehnten Jahrhundert Hochzeit“ (Faßler 102)7. „Zugleich ging das regulative Denken von der Ehrfurcht vor der Schöpfung zur Furcht vor dem Schaffen von Konkurrenzen über“ (Faßler 102). Dennoch blieb die Natur vor der Sozialgeschichte das beherrschende Moment.
Die Bürgerliche Gesellschaft als System der Bedürfnisse [scheint sich] auf den natürlichen Willen der Selbsterhaltung und den natürlichen Bereich der Bedürfnisbefriedigung allein zu gründen. Die Naturtheorie, die die bürgerliche Gesellschaft von sich selbst entwirft, spiegelt zutreffend die geschichtslose Natur der modernen Gesellschaft. (Faßler 102)
Der Bürger erlebt das‚Goldene Zeitalter’, Zucht, Ordnung und ein festes Wertesystem werden verinnerlicht, werden zu bürgerlichen Tugenden, wie mit Hohl im vorangegangenen Kapitel gezeigt werden konnte.
Grundlage seines Universalitätsanspruches [des Bürgers] ist Text, jenes große System der Fernsteuerung, das durch die Religionssysteme als Lern- und Kommunikationsmodul längst durchgesetzt war. (Faßler 103)
Solange die gesellschaftliche Kommunikation sich auf Text gründete, war sie rationaler Kontrolle unterworfen. Botschaften waren als solche zu erkennen, und schriftlich festgelegt. Diese Kontrollmöglichkeiten fallen mehr und mehr weg, schlicht aus dem einen Grunde, dass Textualität mehr und mehr von bildhaften Medien verdrängt werden. Dadurch nimmt Textualität nicht nur ein geringeres Zeitfenster in unserer Gesellschaft ein, sondern verliert auch mehr und mehr an Bedeutung, was für das Bürgertum weitreichende Folgen hat:
Das Bürgertum, als Weltbürgertum [...] entwickelte sich als intelligenter Parasit einer viel früher etablierten eben klassischen Textverarbeitungsmaschinerie. Seine Intelligenz bestand darin, die vormodernen Anwendungskulturen zu ü- berwinden, sich aus diesen herauszuwinden. Sie blieb aber in allem klassische Textverarbeitung. (Faßler 103)
„Die Freiheitsräume, die das Bürgerliche erzeugte, waren Markt, Gesellschaft und Literatur“ (Faßler 104). Nicht ohne immer wieder auch in totalitäre Konzepte zurückzufallen. Wie es Engelmann nennt:
[...] adäquate Formen der Gesellschaftlichkeit freier Individuen sind bis heute noch nicht zweifelsfrei durchgesetzt. Der Grund dafür liegt in der Ambivalenz des Modernisierungsprozesses. (Engelmann 9)8.
Worin besteht aber diesmal die Gefahr für das Bürgertum, was ist heute die antimoderne Strömung, das totalitäre Konzept?
[...] Dass es diese entfernte ökonomische Welt ist, die das zwingende Ideal monolithischer Medien zerreibt - nämlich das der syntaktisch und semantisch kontrollierbaren Textualität und das des nationalökonomischen Geldflusses und der steuerlichen Hoheit. (Faßler 104)
Faßler sieht die humanen Ideale unserer Gesellschaft mit dem bürgerlichen Subjekt aufs Engste verwoben. Und zwar mit einem Subjekt, das Bürger eines demokrati- schen Nationalstaates ist. Diese Voraussetzungen sieht er durch die neuen Medien, und globale Geldflüsse gefährdet, denn diese entziehen sich mehr und mehr der Kon- trolle sozialstaatlicher Regulierung. Er macht deutlich, dass er zwischen bürgerlichen Medien, die er monolithisch nennt, vermutlich Medien wie die FAZ, TAZ und SZ, und den neuen Medien des privaten Fernsehens unterscheidet. Die ‚konservativen’ Medien entstammen aus einem bürgerlichen Umfeld, das sich zu erhalten trachtet. Infotainment, Politainment und ‚neue Medien’ scheinen gerade dazu angehalten, die semantische Kontrollierbarkeit der Textualität auszumerzen, und dem Bürgerlichen sozusagen die Grundlage zu entziehen. Faßler glaubt eine epochale Wende feststellen zu können.
So könnte man Faßler folgendermaßen zusammenfassen: Von sensationistischen elektronischen Medien geht eine erhebliche Gefahr für das Bürgertum, im Sinne von einer demokratischen Gemeinschaft freier Individuen aus. Ein Kapitel der deutschen Geschichte kann dafür Zeugnis geben:
Bilder haben als Medien zur Vermittlung von Werten und Ideologien grund- sätzlich eine ungleich stärkere suggestive Kraft als Texte. Sie vermitteln keine abstrakten Konzepte, sondern ermöglichen unmittelbare Perzeptionen. Zu sprachlichen Konzepten besteht ein größerer emotionaler Abstand, eine gewis- sermaßen „sichere“ kritische Distanz. Bildhaft vermittelte Ideologien werden jedoch in der Regel unbewusster aufgenommen, insbesondere dann, wenn sie nicht selbst thematisiert werden, sondern gleichsam nur den Hintergrund einer Geschichte bilden. [...] Diese [politische Potenz] haben sich bekanntermaßen bereits die Chefideologen des Dritten Reichs ganz bewusst zunutze gemacht. Hitler und Goebbels setzten selbst mitten im Krieg mit der massenhaften Pro- duktion von unverfänglichen, reinen Unterhaltungsfilmen („Hurra ich bin Papa“ [...]) ganz bewusst auf die Kraft der „latenten Propaganda“, die sie für ungleich wirkungsvoller hielten als jede Form der direkten Beeinflussung. (Mühlen Achs 14f)9.
Mühlen Achs macht für das Themengebiet der medial vermittelten Kommunikation zwei interessante Feststellungen: Eine kritischere Distanz des Rezipienten, die durch Textualität gewährleistet wird, und die eben durch unreflektiert perzipierte Bilder umgangene Rationalität. Und auf der anderen Seite der suggestive Transport über ‚Hintergrundbilder’ von bestimmten Botschaften.
Und in gewisser Weise werden Bilder in neuen Medien in vergleichbarer Weise ein- gesetzt.
Individualisierung sozialer Ungleichheit.
Enttraditionalisierung industriegesellschaftlichen Lebensformen.
Nach dem 2. Weltkrieg hat sich ein drastischer gesellschaftlicher Individualisierungsschub ereignet: Die Menschen wurden aus den traditionellen „Klassenbedingungen und Versorgungsbezügen der Familie herausgelöst und verstärkt auf sich selbst und ihr individuelles Arbeitsmarktschicksal mit allen Risiken, Chancen und Widersprüchen verwiesen“ (Beck 116).
Diese Freisetzung war bislang ein Privileg der führenden Schichten. Diese Ein- schränkung fällt mehr und mehr weg. Diese Entwicklung ist nicht widerspruchsfrei:
Diese Individualisierungsschübe konkurrieren mit Erfahrungen des Kollektiv- schicksals am Arbeitsmarkt (Massenarbeitslosigkeit, Dequalifizierung usw.).
Sie führen aber unter sozialstaatlichen Bedingungen, wie sie sich in der Bun- desrepublik entwickelt haben, zur Freisetzung des Individuums aus sozialen Klassenbildungen und aus Geschlechtslagen von Männern und Frauen. (Beck 117)
Die Bindung an eine soziale Klasse verliert mehr und mehr an Bedeutung für die Handlungen der Menschen. Dagegen entstehen individuelle Existenzgrundlangen.
Es entstehen der Tendenz nach individualisierte Existenzformen und Existenz- lagen, die die Menschen dazu zwingen, sich selbst - und um des eigenen Über- lebens willen - zum Zentrum ihrer eigenen Lebensplanungen und Lebensfüh- rung zu machen. Individualisierung läuft in diesem Sinne auf die Aufhebung der lebensweltlichen Grundlagen eines Denkens in traditionalen Kategorien von Großgruppengesellschaften hinaus - also sozialen Klassen, Ständen oder Schichten. (Beck 117)
Dies ist vielleicht Becks zentralste These: Die Pluralität der Gesellschaft, jenseits von Klassen und Ständen. An dieser Stelle wird Becks Überlegung am angreifbars- ten:
Beck argumentiert nun weiter, dass der Klassengegensatz ein für alle mal mit dem industriellen Kapitalismus verknüpft ist. Das bedeutet für Beck, dass entweder der Kapitalismus sich von der Weltbühne verabschiedet, oder: Der Klassenkampf geht weiter! Für Beck ereignet sich nun das Unvorstellbare: Kapitalismus ohne Klassen, verbunden mit den Problemen sozialen Ungleichheit.
Diese Klassenlosigkeit zeigt sich an der Verteilung der Arbeitslosigkeit.
Verschärfung und Individualisierung sozialer Ungleichheiten greifen ineinander. In der Konsequenz werden Systemprobleme in persönliches Versagen abgewandelt und politisch abgebaut. (Beck 117 f)
Die Folge daraus ist, dass gesellschaftliche Probleme nicht mehr als solche wahrgenommen werden können. Gesellschaftsprobleme werden also Individualisiert. Das bedeutet, dass z.B. Folgen politischer Fehlentscheidungen nicht mehr von den Entscheidungsträgern zu verantworten sind, sondern von Schichten, die auf die Entscheidungen höchstens minimalen Einfluss hatten.
Staffel
Die Individualisierung von gesellschaftlichen Risiken ist auch Thema in einem der untersuchten Romane.
Eine Passage aus den Briefen V´ s in Staffels „Terrordrom“ klagt derlei Zustände an:
EINE GEWALTTAT IST IMMER AUCH EIN UNFALL. DIE FRAGE IST; WARUM DIE GEWALTTAT IMMER AUF DEN EINZELNEN BEZOGEN WIRD ODER AUCH EINE GRUPPIERUNG; DIE SICH VON DER MEHR- HEIT UNTERSCHEIDET DURCH EBENDIESE GEWALTTAT. DENN DIESE GESELLSCHAFT IST NICHT GEWALTTÄTIG. DIE MENSCHEN HABEN GELERNT, DIE ROLLE DES OPFERS ZU ÜBERNEHMEN, UND AUF DER SUCHE NACH DEN TÄTERN ERMITTELN SIE DIE MINDER- HEITEN. UND WIRD DIE MINDERHEIT OPFER EINES UNFALLS, SO HAT SIE IHN NATÜRLICH SELBST VERURSACHT. DIE VERANT- WORTLICHKEIT EINES „ANDERSARTIGEN“ IST SEHR VIEL HÖHER ANGESETZT ALS DIE DER MEHRHEIT.[...] WENN ALSO DIE BREMSE AN DEINEM AUTO VERSAGT, ODER DAS AUTO IN DIE LUFT FLIEGT, KÖNNTE ES SEIN, DASS DEIN MANDAT DER MEHRHEIT VERLO- RENGEHT. V. (Staffel 40f)
Lars verfasst unter dem ‚Künstlernamen’ V demagogische Schriften, in denen er Drohungen ausspricht und mehr oder weniger offen zum Widerstand aufruft. Im obi- gen Aufruf, stellt Lars fest, dass Risiken der Gesellschaft immer zuerst am Indivi- duum ansetzen. Das ist zunächst natürlich, da Gesellschaft immer auf dem Paradox gründet, dass es eine Gesellschaft ist, die aber aus Individuen besteht. Das bedeutet, dass gesellschaftliche Risiken, zunächst individuelle Risiken sein müssen. Lars be- hauptet, dass, sobald man Opfer eines Risikos ist, „das Mandat der Mehrheit ver- liert“. Diese Sentenz kann in zweierlei Hinsicht interpretiert werden: Zum einen, dass man sich nun der Minderheit der Opfer zuzuzählen hat; zum Anderen, dass wenn man durch einen Unfall zu schaden gekommen ist, sozusagen aus der Gesellschaft herausfällt. Wird man etwa Opfer einer Psychose, wird man in die Psychiatrie ver- wiesen, um ein hinkendes Beispiel zu benennen. Nur so kann eine Gesellschaft als nicht gewalttätig gelten, eben, dass nicht nur die Opfer in der Minderheit sind, son- dern auch die Täter eine Minderheit darstellen. So kann die Gesellschaft als unan- tastbar gelten.
Wie die Stadt den Blick auf sich formiert
Entstehung einer Großstadtsoziologie
Durkheim
Um die Jahrhundertwende entwickelt Emile Durkheim als einer der ersten eine So- ziologie der Stadt. Welcher Umstand macht die Metropole als Untersuchungsgegens- tand attraktiv? Durkheim sieht in der Großstadt quasi eine demoskopische Lupe, in der sich alle gesellschaftlichen Entwicklungen der Moderne besonders deutlich und mit einem gewissen zeitlichen Vorsprung gegenüber ländlicher Regionen beobachten lassen. In der urbanen Umgebung entwickeln sich gesellschaftliche Impulse am schnellsten und deutlichsten.
Die neue urbane „Gesellschaft“ ist nur lose über komplexe Arbeitsteilung in der Stadt verbunden. Nicht mehr die Zugehörigkeit zu einem Stand oder einer Gruppie- rung ist für die Identifikation der Klassen entscheidend10. Identifikation für die Indi- viduen sind nun formale Muster der Gesellschaft, unter die sie sich einordnen. Die großstädtische Pluralität trägt für Durkheim zu einer toleranten Grundstimmung bei.
Tönnies
Tönnies stimmt mit Durkheim soweit überein, dass er die Stadt als einen Spiegel der Gesellschaft betrachtet. Er allerdings sieht die Individuen nicht in einer plural gesinnten Gemeinschaftlichkeit, sondern sieht die Individuen lediglich über materielles Streben verbunden. So macht Srubar die „Subsumierung einer anonymisierten Massengesellschaft unter das Gesetz des Marktes“ (Srubar 39f)11als gemeinsamen Nenner der Stadtgesellschaft aus. Eine Folge dieser Subsumierung: Der Großstadtmensch wird gleichgültig gegenüber Individuellem und beginnt sich an allgemeinen Merkmalen zu orientieren. Der Städter ist gleichsam gezwungen, die Komplexität der Wahrnehmung in irgendeiner Weise zu reduzieren, um sich nicht völlig in seinen Wahrnehmungen zu verlieren. Und so wird der Städter etwas früher
Wahrnehmungen zu verlieren. Und so wird der Städter etwas früher als sein ländli- cher Kollege die Regeln des Geldverkehrs zur Orientierung seiner Handlungsabläufe machen.
Paradoxie der Wahrnehmung
So verwundert es wenig, dass der Stadtmensch sich in erster Linie auf „objektivier- bare Attitüden“ (Srubar 40) konzentriert. Auf diese Weise kommt es zur einer Seg- mentierung des Individuums: „Mitmenschen begegnen ihm nicht als ganze Individu- en, sondern lediglich als wiederum segmentierbare Segmente, die er als Beobachter nur aufgrund nichtindividueller Merkmale zu interpretieren weiß“ (Srubar 40). Der städtische Blick verweigert sich also dem Individuellen und versucht „allgemeine“ Muster zu erkennen. Diese segmentierte Wahrnehmung fördert auf der anderen Seite den Selbstdarsteller:
Die subjektive Freiheit der Individuen ist zugleich der Grund dafür, dass sie sich als gegenseitige Beobachter, auf typische Merkmale ihres Verhaltens redu- zieren, die sie als Glieder eines mehr oder minder anonymen Kollektivs aus- weisen. (Srubar 40)
In gewisser Weise handelt es sich hier um eine weitere Paradoxie der Moderne: Die aus traditionalen Strukturen, wie etwa der Stände und Klassen freigesetzten Indivi- duen werden nicht in die ‚Freiheit’ entlassen; der neugewonnene Freiraum wird durch eine andere Struktur kompensiert. Im obigen Fall ‚bezahlt’ das Individuum seine Individualität damit, dass es nicht mehr als ein Individuum wahrgenommen wird.
Da die Individualität frei, d.h. willkürlich ist, ist das Großstadtindividuum ge- gen nur Individuelles gleichgültig. Um so empfänglicher ist es für das ‚Orna- ment der Masse’ - es orientiert sich an ‚objektivierbaren’ überindividuellen Regelmäßigkeiten und Erwartungen, die sich am Verhalten der Menge ablesen lassen. (Srubar 44)
So hat der Großstadtflaneur ähnliche Rechte und Pflichten wie der moderne Arbeiter: Er hat das Recht zu wählen, aber auch die Pflicht etwas zu wählen. Der in die Stadt abgewanderte Bauernsohn kann und darf seine Arbeitskraft auf dem freien Arbeits markt zur Verfügung stellen. Um seine Existenz weiterhin zu sichern, muss er das aber auch. In einem vergleichbaren Verhältnis ist der Stadtflaneur zu betrachten. Er ist frei, um ein Beispiel zu bemühen, sich zu kleiden wie er will, er muss dies aber, will er zu einer bestimmten Gruppe gerechnet werden, nach den Maßgaben eben dieser Gruppe tun. Damit gibt er seine neu gewonnene individuelle Freiheit wieder auf, um ein Glied des „anonymen Kollektivs“ zu sein.
In den Dreißigern stellte man eine Art „Neue Ordnung“ fest, die aus der „Vervielfa- chung des Individuellen“ (Srubar 40) resultierte. So interpretiert Walter Benjamin den „Flaneur“ von Baudelaire: Er ist von der Menge angezogen und fasziniert; als Gegenpol zur Masse erfährt das Subjekt aber auch eine Amplifikation des „Ich- Bewußtsein“ (Srubar 43) des Beobachters. Die Segmentierung des Subjekts bewirkt zunächst also nicht zwangsläufig die Auflösung des Subjekts, sondern kann auch eine Amplifikation bewirken.
Das Ornament der Masse
Krakauer erarbeitet das so genannte Konzept der „Ornamente der Masse“ (Srubar 43):
a) Die Muster - die Ornamente - sind nur an Menschen als Massengliedern, nicht an solchen als Individuen erkennbar.
b) Sie stellen, wie die sie hervorbringende Warenproduktion auch, einen Selbstzweck dar, d.h. sie dienen ihrer eigenen Erhaltung.
c) Sie werden von ihren Trägern nicht mitgedacht, sie sind nicht intendiert.
d) Sie folgen einer von ihren Trägern abgelösten Rationalität.
e) In ihrer „Denaturierung“ zu Teilchen des Ornamentzusammenhang lässt sich das soziale Wesen der Träger erkennen. (Srubar 43)
Srubar stellt die Sichtweise der frühen Soziologie der Großstadtwahrnehmung heraus: Die Großstadt steht für Gesellschaft im Gegensatz zur Gemeinschaft und die Pluralität im städtischen Raum.
Das Erscheinungsbild der Großstadt wird wahrgenommen als eine Pluralität von Verhaltensweisen, Moden, Bedürfnissen und Produkten zu ihrer Befriedi- gung, die auf die Lebensführung mannigfacher, arbeitsteilig ausdifferenzierter, heterogener sozialer Gruppierungen zurückgeht. Ihre Mitglieder sind durch den Mechanismus des Marktes, der Warenproduktion und der Arbeitsteilung auf einander bezogen, aber auch durch ein Netz von Wechselwirkungen, in wel chem sie sich allerdings in einer typisierten Gestalt begegnen. Die daraus resultierende Anonymität lässt die Großstadtmenschen trotz aller Vielfalt und individuellen Freiheit als Masse auftreten. Die subjektive Freiheit ist an die kollektive Anonymität gebunden. (Srubar 44)
Innerhalb dieser Massen und im Übergang von der Klassen zur Massengesellschaft lauert auch der Übergang zu einer manipulierbaren Öffentlichkeit, die einige Jahrzehnte später in der Öffentlichkeit des 3. Reiches kulminiert.
Houellebecq
„Reflektierter Abstand und Distanz“ (Srubar 44) und ein Klassifizieren nach segmen- tierten ‚objektiven’ Merkmalen sind die charakteristischen Wahrnehmungsmuster des Großstadtmenschen. Srubar weist auf die Haltung der Soziologie hin, die sich ein vergleichbares Wahrnehmungsmuster für die Erfassung von Individuen zu eigen ge- macht hat.
In dem in Deutschland 1999 erstmals erschienenen Werk des Franzosen Michel Ho- uellebecq „Ausweitung der Kampfzone“ kann man im Ansatz eine derartige Distanz belegen. Der förmliche Umgang der Protagonisten wird aber durch heftige Gefühls- regungen unterwandert. Der reflektierte Abstand, den man noch in der Großstadtlite- ratur zu Beginn des Jahrhunderts feststellen konnte, ist umgeschlagen in eine forma- lisierte Distanz der Figuren untereinander. Auch verringert sich der Abstand der Cha- raktere zueinander. Der Raum zwischen den Personen scheint geringer geworden zu sein. So als lechzten die Figuren, die durchwegs als völligst vereinsamt dargestellt werden12nach menschlicher Nähe. Diese Nähe können sie aber nicht in geordneten Beziehungen zueinander bekommen. Deshalb wird beinahe jedes Gegenübertreten dazu benutzt Nähe auszutauschen.
„Ich stellte mir vor, wie sie in den Galeries Lafayette einen brasilianischen Tanga aus roten Spitzen auswählte; ich fühlte eine Welle schmerzlichen Mitleids“ (Houellebecq 47)13. Das schmerzliche Mitleid, das der Ich-Erzähler des Romans empfindet, kann schwerlich als emotionale Distanz angesehen werden. Und das obwohl Chaterine Lechardoy für ihn als Frau nicht im geringsten interessant ist, und die Frau ebenfalls nicht an ihm: „Ich bin sicher, dass sie nicht im Traum daran denkt, mit irgend einem Typen etwas anzufangen“ (Houellebecq 29).
Chaterine Lechardoy und ich standen uns jetzt gegenüber. Ein vernehmliches Schweigen trat ein. Dann hatte sie einen Ausweg gefunden und begann von der Harmonisierung der Arbeitsabläufe zwischen der Dienstleistungsfirma und dem Ministerium zu reden, also zwischen uns beiden. Sie hatte sich mir noch ein Stück genähert - unsere Körper waren durch maximal dreißig Zentimetern Lee- re voneinander getrennt. Einmal drückte sie mit einer zweifellos unbeabsichtig- ten Geste ganz leicht das Revers meines Sakkos zwischen ihren Fingern. Ich fühlte mich zu Chaterine Lechardoy keineswegs hingezogen und hatte nicht die geringste Lust, sie zu vernaschen. (Houellebecq 47)
Die formale Vorgabe der Situation wird von beiden Figuren strikt eingehalten. Dies kann auch die weiter oben beschriebene Verinnerlichung sozialen Zwangs gelesen werden.14Die Annäherung von Chaterine Lechardoy wird unter der Vorgabe von Geschäftsabläufen geleistet, einem Bereich, der eigentlich von der Funktionalität menschlichen Zusammenwirkens gekennzeichnet ist. Dennoch wird in dem obigen Abschnitt beinahe distanzlose Nähe geschildert.
Als der Held den Diebstahl seines Wagens melden will, ergibt sich eine vergleichbare Situation. Der Polizeibeamte will nach dem Amtsvorgang ebenfalls weiterkommunizieren. „Ich glaube, er wollte noch weiterreden; aber es gab sonst nichts zu sagen“ (Houellebecq 24).
Eine weitere Szene kann als Beleg für die neue Distanzlosigkeit dienen. Bei einer Versammlung mit mehreren Personen, erscheint sporadisch eine weitere Person, die in Windeseile die Konferenz erstürmt, und sie ebenso schnell auch wieder verlässt.
Er legt seine Hand auf meine Schulter und spricht mit sanfter Stimme. Er sagt, es tue ihm leid, dass er mich letzthin umsonst habe warten lassen. Ich setzt ein Madonnenlächeln auf und sage, das sei nicht so schlimm, ich könne ihn gut verstehen [...] Ich bin ehrlich. Es ist ein sehr zärtlicher Augenblick; er beugt sich zu mir, nur zu mir; man könnte uns für zwei Liebende halten, die das Le- ben nach einer langen Trennung wieder zusammengeführt hat. (Houellebecq 37f)
Diese Vereinigung nach langer Trennung findet statt, obwohl sich die Figuren zum ersten mal gegenüberstehen.
Man ist scheinbar immer mehr in der Lage eine „ad hoc - Beziehung“ aufzubauen. Die reflektierte Distanz die Srubar feststellt, ist einer spontanen Nähe gewichen.
Die soziale Person
Jene ‚Ornamente’ sind es, auf die die einzelnen Individuen ihre Wahrnehmung und Identifikationsmuster und -leistungen hin ausrichten. Das Erkennen des Individuellen der einzelnen Individuen kann und darf für den Stadtrezipienten nicht geleistet wer- den, um nicht in der Reizüberflutung zerrieben zu werden. So bildet sich die Wahr- nehmung des Großstädters heraus: Er versucht nicht die Singularität des Einzelnen zu erfassen, sondern kategorisiert gleichsam das Gesehene; er sieht nur, was er auch kategorisieren kann, um so der übermächtigen Eindrücke Herr zu werden. Diese Sichtweise wirkt - wie oben angedeutet - wiederum auf den Beobachter zurück, der als Teil der Stadt versucht, in irgend einer Weise dieser Perspektive gerecht zu wer- den, sei dies nun bewusst oder unbewusst.
Um diese Umstände besser beschreiben zu können, bildete sich in der soziologischen Forschung das Konzept der sozialen Person heraus. Diese ‚Person’ setzt sich aus Bezügen von Innen- und Außenwahrnehmung zusammen. Dem eigentlich wahrneh- mendenIch15wird an der intersubjektiven Oberfläche ein Stellvertreter-Ich vorge- schoben, das nach Möglichkeit das Subjekt nach den oben genannten Mustern der Masse vertritt oder darstellt.
In der Außenwahrnehmung dieses beobachtenden Vorpostens erscheinen die anderen jedoch als Verkörperung typischer Merkmale, d.h. ihr Verhalten und ihre Erscheinung sind Bestandteile eines überindividuellen Musters, dessen Träger sie, bzw. die gerade in Erscheinung tretenden Segmente ihrer Person, sind. Diese beiden nach dem Subjekt und nach dem alter ego ausgerichteten Perspektiven werden in dem Konzept der sozialen Person zu einem Modell zu- sammengefasst: Das in einen Ich-Kern und eine in der Welt agierende Person geteilte Individuum tritt mit verschiedenen Segmenten der sozialen Welt in Wechselwirkung, durch die es verschieden Handlungsmuster annimmt. Die verschiedenen Eindrücke, die aus diesen Aktivitätssegmenten resultieren, sedi- mentieren sich zu sozialen Teilperson, zu den verschiedenen Schichten der „Gesamtpersönlichkeit“. So entsteht die Sozialperson als eine Einheit der Akte des Subjekts, die aber wesentlich soziale, d.h. durch überindividuelle Faktoren in der Wechselwirkung geprägte Akte sind. (Srubar 47)
Dieses Modell ist nicht nur Ausgangspunkt eines Kataloges verschiedener Typen, sondern wird die Grundlage für viele Untersuchungen der Identität und der Sozialisa- tion bilden. Was ich oben als paradoxe Struktur für die Wahrnehmung von Indivi- dualität festgestellt habe, wird durch das Konzept der sozialen Person bestätigt und ergänzt: Dieses Modell, wie es Srubar darstellt, stellt die Individualität an sich in Frage, denn das eigentliche Ich wird nicht mehr wahrgenommen, das Stellvertreter- Ich wird nach den Maßgaben der sozialen Umwelt konstruiert, und nicht, oder nur teilweise, durch das Beobachter-Ich. Das Subjekt wird also durch sich selbst ver- schüttet. Genauer: Die soziale Person verdeckt das eigentliche Ich.16Die Auswirkungen dieses Modells gehen noch weiter: Der wissenschaftliche Beob- achter kann nun eigentlich keine Beobachtungen mehr auf Subjektebene machen. Die Beobachtungen müssen auf der Ebene der Typik, der verallgemeinerbaren oben be- schriebenen Muster der Individuen gemacht werden. Nun drängt sich die Frage auf, inwieweit diese Typik mit dem eigentlichen Subjekt verbunden ist. Die Ausbildung gewisser Merkmale der Stellvertreter-Person können völlig kontingent sein, und viel- leicht keinerlei Rückschlüsse auf empirische Subjekte mehr zulassen, daher bleibt Max Webers Typenbegriff auch nicht unumstritten.
Die Annahme der typenvermittelten Emergenz der sozialen Realität wird in dem Maße berechtigter, je präziser unsere Kenntnisse der Genese von Typisie- rungen in den konkreten Wechselwirkungen des sozialen Handelns werden. (Srubar 49)
Simmel
Simmel ist wohl im deutschsprachigen Raum der prominenteste Vertreter der Stadtsoziologie. Er stimmt mit den oben beschriebenen Ergebnissen Durkheims und Tönnies weitestgehend überein. Susanne Hauser hat die Voraussetzungen für Simmels Argumentation festgehalten.
Um diese Beobachtung machen zu können, muss man wie Simmel voraussetzen, „dass es nicht-bewusste psychische Prozesse gibt, die sich historisch verändern“ (Hauser 8)17. Weiter nimmt er an, dass es ein bestimmtes Quantum von Bewusstsein gibt. Den Umgang mit Sinnlichkeit sieht er in Abhängigkeit von der Umgebung des Individuums, so kann auch die Umwelt auf unbewusste Ebenen des Subjekts vor dringen. Da die äußeren Bedingungen immer für größere Gruppen relevant sind, „können kollektive Normen des Umgangs mit Sinnlichkeit identifiziert werden“ (Hauser 8).
Die psychologische Grundlage, auf der der Typus großstädtischer Individualität sich erhebt, ist die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht. Der Mensch ist ein Unterschiedswesen, d.h. sein Bewusstsein wird durch den Un- terschied des augenblicklichen Eindrucks gegen den vorhergehenden angeregt; beherrschende Eindrücke, Geringfügigkeit ihrer Differenzen, gewohnte Regel- mäßigkeit ihres Ablaufs und ihrer Gegensätze verbrauchen sozusagen weniger Bewusstsein, als die rasche Zusammendrängung wechselnder Bilder, der schroffe Abstand innerhalb dessen, was man mit einem Blick umfasst, die Un- erwartetheit sich aufdrängender Impressionen. Indem die Großstadt gerade die- se psychologischen Bedingungen schafft - mit jedem Gang über die Straße, mit dem Tempo und den Mannigfaltigkeiten des wirtschaftlichen, beruflichen, ge- sellschaftlichen Lebens - stiftet sie schon in den sinnlichen Fundamenten des Seelenlebens in dem Bewusstseinsquantum, das sie uns wegen unserer Organi- sation als Unterschiedswesen abfordert, einen tiefen Gegensatz gegen die Kleinstadt und das Landleben, mit den langsameren, gewohnteren, gleichmäßi- ger fließenden Rhythmus ihres sinnlich-geistigen Lebensbildes. (Simmel 1903/1984, 192f)18
Was Simmel als Verstandesmäßigkeit bezeichnet19, die er als charakteristisch für die Wahrnehmung des Großstädters feststellt, hat dieselbe Schlagrichtung wie das oben erwähnte Ornament der Masse. Das Festhalten der Aufmerksamkeit an allgemeinen Merkmalen führt zu einer „Abstumpfung gegen die Unterschiede der Dinge“ (Sim- mel 196). Den Rückzug auf diese reservierte Wahrnehmung nennt Simmel die „Bla- siertheit“ des Großstädters.
Parallel zu den Modellen Tönnies und Durkheim wirkt sich diese neu gewonnene Perspektive formierend auf das Subjekt aus: „Der Entindividualisierung und Entob- jektivierung von Dingen und anderen Menschen entspricht die Entindividualisierung der städtischen Bevölkerung“ (Hauser 9). Den Voraussetzungen, die Hauser Simmel im Rahmen seiner Beobachtung der urbanen Wahrnehmung unterstellt, ist daher eine weitere hinzuzufügen: Die Gesichtspunkte, unter denen interindividuelle Beobach- tungen gemacht werden, werden von den Beobachtern auf sich selbst projiziert. Simmel sieht die Stadt als wenig geeigneten Nährboden für die Sinnlichkeit des Menschen, da sie seiner Meinung nach die Sinne mehr abstumpft und abnutzt als der ländliche Raum, der durch den „langsameren, gewohnteren, gleichmäßiger fließenden Rhythmus“ (Simmel 193) den Sinnen mehr Freiraum lässt.
Simmels Betrachtung ist aber auch für eine semiotische Untersuchung der Stadt relevant: Er nennt den Menschen ein Unterschiedswesen: Ich glaube nicht, dass Simmel hier auf den Wechsel von markierten und unmarkierten Raum zielt20.
Besitzen obige soziologischen Modelle heute noch Aktualität, oder sind die beschriebenen Veränderungen längst obsolet? Ich denke, dass die gemachten Beobachtungen z.T. auch heute noch von Bedeutung sind. Z.B. Woran richtet sich heute die Typisierung der Individuen aus.
Diese wissenschaftlich gesicherte Terrain kann für Untersuchungen unserer heutigen Gesellschaft als Folie dienen. Mit dem Kapitel: „Welt als Medienpoesis“ werde ich unter anderem versuchen der Frage nachzugehen, ob die Stadt nach wie vor als Büh- ne für den simmelschen Selbstdarsteller gelten kann, oder ob wir uns nicht mittler- weile eine neue urbane Bühne für den Auftritt des Selbstdarstellers in der Gesell- schaft geschaffen haben.
Subjektivität
Die Schwierigkeiten, dieses Thema zu bearbeiten, beginnen damit, welcher der drei Punkte des Themas der vorliegenden Arbeit am stärksten zu gewichten ist. Ist das Subjekt der zentrale Punkt? In der Wahrnehmung laufen alle Phänomene zusammen, die Wahrnehmung ist sozusagen der Kulminationspunkt der erfahrbaren Welt. Doch kann man nicht von einem reinen Subjekt sprechen. Genauso wenig klar wie die Sa- che ist der Begriff des Subjekts. In fast allen Bereichen menschlicher Wissenschaft gibt es eine Unzahl von Definitionen und Konzepten. Ich will keinesfalls den Ver- such unternehmen, in irgendeiner Weise dieser Vielzahl gerecht zu werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Meiner Meinung nach sind bewusste‚ psychische Phänomene, die Grundvoraussetzung für Subjektivität.
Franz Brentano war wohl einer der ersten, der sich darum bemühte, eine Definition für psychische, also im weitesten Sinne subjektive Zustände zu geben. Dazu versucht er ein exklusives Merkmal von psychischen Phänomenen zu treffen.21Dieses Merkmal beschreibt er in seinem Werk „Psychologie vom empirischen Standpunkt“ in der unter dem Namen „Intentionalitätspassage” berühmt gewordenen Stelle:
Jedes psychische Phänomen, ist dadurch gekennzeichnet, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale Inexistenz (wohl auch mentale) eines Gegens- tandes genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt, (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist) oder die immanente Gegen- ständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als ein Objekt in sich, obwohl jedes nicht in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile ist etwas anerkannt in der Liebe geliebt in dem Hasse gehasst. Kein physisches Phänomen zeigt etwas vergleichbares. (Brentano 124)22.
Diese Passage ist, wie Barry Smith23gezeigt hat, nur auf der Folie der aristotelischen Ontologie zu verstehen24. Ich möchte nicht zu detailliert auf dieses Problem einge- hen. Nur so viel: Die menschliche Psyche ist, solange sie keine Form hat, genau wie die aristotelische erste Materie ohne Zahl, Eigenschaft und Ausdehnung25. Solange psychische Zustände also nichts zum Inhalt haben, existieren sie nicht in einer uns bekannten Weise, sondern eben nur so, wie die Form, etwa eines Hauses nicht ohne materielle Manifestation existiert. Das bedeutet also für unsere Untersuchung, dass diejenigen Dinge, die sich der menschlichen Wahrnehmung präsentieren, für psychi- sche Phänomene essentiell sind, und sozusagen, das Sein der Psyche mitbestimmen. Für die Bestimmung eines Subjekts ist aber eine Definition für psychische Zustände, denke ich, Voraussetzung aber keine ausreichende Definition. Ich möchte unter an- derem die gegenseitige Beeinflussung von Medium, Subjekt und Stadt untersuchen: Gibt es überhaupt einen Zusammenhang, können gesellschaftliche Entwicklungen wie z.B. die Herausbildung einer neuzeitlichen Subjektivität mit städtischer Entwick- lung parallelisiert werden? Oder konstituieren sie sich gerade im Zusammenwirken? Haben Medien Einfluss auf die Wahrnehmung der Stadt? Haben die Medien Funkti onen der Stadt übernommen? Sind die Diskurse vom Verschwinden des Subjekts sinnvoll? Scherpe und Fischer haben jeweils die Auflösung von Subjekten in der Literatur der Moderne und Postmoderne festgestellt. Um diese Aussage analysieren zu können, müsste man zunächst feststellen, von welchem Subjektbegriff man dabei ausgeht. Dabei scheint sich herauszustellen, dass man vor allem die Einheit der Wahrnehmung in der Auflösung begriffen sieht. Ich denke, dass derartiger Umgang dem Begriff nur zum Teil gerecht wird.
Als einer der prominentesten ‚Sterbehelfer’ des Subjekts kann wohl M. Foucault dienen. Sein Plädieren „auf den Primat des Subjekts zu verzichten“ (Bürger 15)26, kann nur richtig gedeutet werden, wenn man seinen ‚gespaltenen Subjektbegriff’ berücksichtigt. Für ihn ist das moderne Subjekt ein Produkt einer Individualisie- rungsmatrix, einer Reihe von Institutionen und Machtverhältnissen, die das Subjekt formen. Dem steht aber ein ‚ursprüngliches’ Subjekt gegenüber, das nicht kulturell geformt ist, das „Andere“.
Man hat zu sich nicht dasselbe Verhältnis, wenn man sich als politisches Subjekt konstituiert, das wählen geht oder in einer Versammlung das Wort ergreift, als wenn man sein Begehren in einer sexuellen Beziehung zu befriedigen versucht. Zweifellos gibt es Beziehungen und Interferenzen zwischen diesen verschiedenen Formen des Subjekts, aber man steht nicht dem selben Subjekttypus gegenüber. In jedem dieser Fälle spielt man mit, erreicht man verschiedene Formen der Beziehung zu sich selbst. (Foucault 1985, 18)27
Das ‚kulturell Sichtbare’ Subjekt ist für Foucault also eben nur das Produkt einer ebensolchen Kultur, die das Subjekt nach ihren Bedürfnissen geformt hat. Das von Foucault geforderte Sterben des Subjekts bezieht sich auf die oben genannte kulturel- le Überformung des Subjekts. Die Auflösung des Subjekts soll das eigentliche menschliche Ich freilegen und es so seiner eigentlichen Existenzform zuführen. Das Subjekt muss also erst überwunden werden bevor wir darüber verfügen können.
Anders als Foucault sieht Oelmüller die Formen moderner Subjektivität zunächst nicht als Festlegung, und Überschreibung, sondern als ‚Freiheitsmöglichkeit’.
Mit dem Begriff des Subjekts bezeichnet man seit dem Ende des 18. Jahrhun- derts die Einheit der vor allem neu entwickelten wirtschaftlichen, sozialen, poli tischen, rechtlichen, sittlichen, ästhetischen, geistigen und religiösen Freiheitsmöglichkeiten des modernen Menschen (Oelmüller 29)28
Diese Definition Oelmüllers ist höchst anfechtbar. Oelmüller sieht den Diskurs des ‚Verschwinden des Subjekts’ in einer unbefriedigten Aufklärung entsprungen. Was aber soll eine unbefriedigte Aufklärung bedeuten? Vielleicht spielt Oelmüller auf die Forderung Lyotards an, die Grundgedanken der Moderne wieder aufzunehmen und das Programm der Moderne fortzusetzen.29Die Ausrufung des Subjekts betrifft sei- ner Meinung nach nicht nur theoretische oder wissenschaftliche Fragen, sondern:
Erstes Ziel der Proklamation des Subjekts ist die Forderung nach öffentlicher Anerkennung des Subjekts, die Neubegründung moderner Institutionen, die Su- che nach neuen Lebensformen, die diese neuen Freiheitsmöglichkeiten sichern. Aufklärung fordert nach der bekannten Formel: Den Ausgang des Menschen aus seiner selbst bzw. fremdverschuldeten Unmündigkeit und Unfreiheit. (Oel- müller , 43)
Ein Beispiel moderner offizieller Subjektkonzeptionen ist die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung.
Subjektkonzeptionen finden aber nicht nur auf staatlicher Ebene statt. Neben utopi- schen Subjekten, wie sie z.B. im Grundgesetz der BRD niedergelegt sind, gibt es noch ‚empirische’ Subjekte, die sich durch spezifische Befindlichkeiten, Sehnsüchte und Bedürfnissen auszeichnen. Wodurch charakterisieren sich die Subjekte unserer Tage? Oelmüller:
Schöner Wohnen, Ästhetisierung der Lebenswelt, das sind heute weit wirksame Versprechungen und Wünsche von Subjekten, angesichts der Bedrohung unse- rer Lebenswelt am Rande der Wirklichkeit, oder durch Ausstieg wenigstens für kurze Zeit einmal besser, angenehmer, lustvoller leben zu können. (Oelmüller , 46)
Die Suche nach der Erlebnisgesellschaft ist nicht ohne Risiken. Sie ist zudem Ausdruck einer Frustration von Subjekten, da diese Lebensentwürfe dazu dienen sollen, einer Realität den Rücken zu kehren. Oelmüllers Rede von den Subjekten ohne Identität weist in die Richtung der Annahmen Bolz und Faßlers, die in dem Rauschen der Weltkommunikation die auflösende Kraft der Bürgerlichkeit vermuten.
Oelmüller gibt im Zuge seiner Argumentation eine konzise und dennoch nach seinen eigenen Worten unvollständige Definition der Identität von Subjekten. Denn Subjek- ten kommen Erfahrungen und Erlebnisse zu, die keine Wissenschaft je wird erfassen können30. Ich möchte kurz auf den von Oelmüller genannten Zusammenhang von Mensch und Gott, die er in gewisser Weise gleichsetzt, anhand einer literarischen Analyse eingehen.31
Houellebecq
In Michel Houellebecqs Roman „Ausweitung der Kampfzone“ wird die Beziehung von Subjekt und Gott ebenfalls thematisiert: „Er rät mir, zu Gott zurückzukehren oder eine Psychoanalyse zu machen; die Nähe der beiden Begriffe lässt mich zu- sammenfahren“ (Houellebecq 33). Dieser Sequenz geht ein Dialog über die vitale Erschöpfung durch die modernen Lebensumstände voraus: „Du musst deine göttliche Natur akzeptieren“ (Houellebecq 33). Die Rückkehr zu Gott wird von dem Theolo- gen als „einzig wahre Quelle des Glücks“ (Houellebecq 33) propagiert. Die Peinlich- keit, die durch das laute Ausrufen „Du musst deine göttliche Natur akzeptieren“ in dem Lokal entsteht, ist ein Beleg für die gesellschaftliche Tabuisierung ‚göttlicher’ Gesprächsthemen.
Seiner Meinung nach ist das angebliche Interesse unsrer Gesellschaft für die Erotik (in Werbung, Zeitschriften, überhaupt in den Massenmedien) völlig ge- künstelt. In Wirklichkeit langweilt das Thema die meisten Leute sehr bald; doch sie behaupten das Gegenteil - eine bizarre, umgekehrte Heuchelei. Er kommt nun zu seiner These. Unsere Zivilisation, sagt er, leidet an vitaler Er- schöpfung. Im Jahrhundert Ludwigs XIV., als der Lebenshunger groß war, leg- te die offizielle Kultur den Akzent auf die Verleugnung der Lüste und des Flei- sches. Sie erinnerte unablässig daran, dass das irdische Leben nur unvollkom- mene Freuden biete und Gott die einzig wahre Quell des Glücks sei. Ein solcher Diskurs, versicherte er mir, würde heute nicht mehr akzeptiert. Wir brauchen Abenteuer und Erotik, denn wir müssen uns ständig einreden, das Leben sei wunderbar und erregend; und natürlich haben wir genau daran so unsere Zwei- fel. (Houellebecq 32f)
Diese Stelle ist, meines Erachtens nicht nur für den Roman Houellebecqs zentral. Der Pfarrer aus Vitry stellt ein vorherrschendes Charakteristikum unserer modernen Medienkultur, - die ja implizit als die ‚offizielle Kultur’ unserer Tage benannt wird - dar: Die Konzentration auf den so genannten schnellen Kitzel, der angeblich so viel Lebenslust vermittle. Dennoch bleibt bei den Menschen ein Sinnvakuum zurück, das sie mit der ‚offiziellen Kultur’ nicht zu kompensieren im Stande sind. Beide Gesprächspartner bestätigen ein gewisses Gefühl der Leere.
Um etwas zu sagen, wendetet ich ein, dass heutzutage jedermann zwangsläufig irgendwann in seinem Leben glaubt, gescheitert zu sein. In diesem Punkt sind wir der selben Meinung. (Houellebecq 33)
Nach meiner Meinung müsste die offizielle Kultur eben auch alternative Lebensent- würfe aufzeigen können. Eine Kultur darf eben keine Leerstelle in der menschlichen Existenz hinterlassen, um eine ‚artgerechte’ Haltung zu garantieren. Denn der Ter- minus Kultur ist, in meinem Verständnis konstitutiv für die Identität von Subjekten. Eine Kultur, die Grundbedürfnisse des Menschen ausblendet oder überblendet und somit auslöscht, wird irgendwann zum Problem. Sei es, dass sich Individuen von dieser Kultur abwenden, einer neuen zu, oder, dass eben Subjekte sich selbst ent- fremdet gegenüberstehen.
Dem Menschen kommen zudem noch gesellschaftliche Identitäten zu.
Zur Identität von Subjekten gehören elementare identitätsstiftende Bestände, die in der Regel vorausgesetzt werden können, wenn diese Subjekte z.B. durch eine sogenannte Identitätsdiffusion medizinisch-pathologisch krank sind. Men- schen haben z.B. ihre Gene eine einmalige, nicht verwandelbare sogenannte na- türliche Identität. Sie haben eine durch Interaktionsprozesse und durch Verstri- ckungen in Geschichten entstandene einmalige, aber wandelbare sogenannte psychische und soziale Identität. Sie haben eine Identitätskarte, einen Pass, der zeigt, wer sie sind im Unterschied zu anderen. Sie verwenden, wenn sie spre- chen, die Worte Ich - Du - Es und können sich dadurch von anderen unter- scheiden. Die Rede vom Subjekt ‚ohne Identität’ bestreitet nicht diese und an- dere elementaren identitätsstiftenden Bestände des Menschen. (Oelmüller 1994, 47)
Was aber sind Subjekte ohne Identität? Oelmüller geht bei der obigen Definition von biologischen und sozialen, - auch der Sprache, die sowohl biologisch als auch sozial ist - Identitätsparametern aus. Er erkennt aber auch, dass eine derartige Definition wenig über das bewusste Empfinden der Menschen aussagt.
Ein Subjekt ‚ohne Identität’ schafft sich nicht vom Sein oder vom Selbstbe- wusstsein aus durch Selbsterhaltungshandlungen und -strategien eine Identität und kreist um diese. Es schreibt nicht den Unterschied zum Anderen, ja die Entgegensetzung zum Fremden, zum Ausländer, zum Feind fest. Ein Subjekt ‚ohne Identität’ kritisiert, ja sprengt vielmehr solche Selbsterhaltungsidentitäten von der Nähe und Distanz, von dem Antlitz des Anderen aus, des anderen Mit- menschen sowie des räumlich und zeitlich abwesenden Anderen, Gottes. Von einer Identität des Subjekts ‚ohne Identität’ - wenn man so sprechen will - kann in einer radikalen Weise nur von dem so gedachten anderen Mitmenschen bzw. von dem so gedachten Gott aus gesprochen werden. (Oelmüller 1994, 48)
Die neuen ‚identitätslosen’ Subjekte sollten also nach Meinung Oelmüllers unter anderem die Grenze zwischen sich und den anderen Subjekten aufheben und spren- gen.
Ein Subjekt ‚ohne Identität’ sucht nicht als Ergänzung oder Kompensation zum verwissenschaftlichten Selbst- und Weltverhältnis eine neue Identität durch äs- thetische Reflexionen und Lebensformen, durch ein ästhetisches Verhältnis zu Menschen und zur Natur oder, nach dem ‚Tod’ Gottes und der Metaphysik, wie Nietzsche eine ästhetische Rechtfertigung der Welt und des Daseins, ja eine ‚Erlösung’ der Erkennenden, Handelnden, Leidenden in der sinnleeren, sinnlo- sen Welt durch Kunst. Ein Subjekt ‚ohne Identität’ kritisiert und sprengt viel- mehr ein einer radikalen Weise vom Anderen her solche durch Ästhetik gesuch- ten neuen Identitäten. (Oelmüller 1994, 49)
Oelmüllers Ansatz von Subjekten ‚ohne Identität’, die keiner ästhetischen Festlegung ihrer Identität versuchen gerecht zu werden, scheint ein idealisierter Ansatz zu sein. In gewisser Weise widerspricht diese in den Zitaten gemachte Aussage über die Sub- jekte ‚ohne Identität’ den ‚zeitgenössischen’ Subjekten, die er weiter oben be- schreibt. Denn ein Subjekt, das sein Heil und seine Bestimmung in den Freuden der Erlebnisgesellschaft sucht, kann schwerlich als Subjekt gedacht werden, das traditio- nelle ästhetische Gesichtspunkte ‚sprengt’, sondern genau das Gegenteil ist der Fall: Die Subjekte der Erlebnisgesellschaft gründen sich auf reiner Ästhetik im Sinne von Wahrnehmung; d.h. einer unreflektierten Wahrnehmung.32Wer oder was leistet diese Wahrnehmungsgegenstände? Dieses Mehr an psychischen Phänomen können nur elektronische Medien leisten.
Ein Subjekt, - nehmen wir Simmels Voraussetzung, dass bestimmte nicht-bewusste Prozesse historisch wandelbar sind, als gegeben an33, - das sich auf unreflektierte Wahrnehmung stützt, wird unbewusst oder bewusst von diesen Wahrnehmungen beeinflusst. Diese Beeinflussung bleibt aber nicht nur auf die Ebene der Meinungs- bildung beschränkt. Die Beeinflussung führt sozusagen zu einer teilweisen neuen Konstitution des Subjekts. Ich behaupte keine Kausalitäten, denn es liegen keine wirklichen Gesetzmäßigkeiten vor. Dadurch wird der Sachverhalt der ‚Neuschöp- fung’ durch Beeinflussung schwer beobachtbar, deshalb auch begrifflich schwer greifbar. Über den Zusammenhang von Subjekt, Wahrnehmung und Kommunikation werden ich in dem KapitelMedienkulturnäher eingehen.
Oelmüllers Subjektkonzeption lässt darauf schließen, dass er Subjekte erst durch ihr Gegenüber definiert sieht. Sein ‚Modell’ zeigt Parallelen zum Konzept der sozialen Person, ohne die Zweiteilung in die Stellvertreterpersönlichkeit und dem eigentlichenIchexplizit mit zu vollziehen.
Wie ich die obigen Zitate verstehe, kann man von einer Auflösung eines Subjektes erst dann sprechen, wenn es durch ein anderes Subjekt gespiegelt worden ist. Diese Beobachtungssituation erst macht es möglich, „von dem Antlitz des Anderen aus“ eine derartige Beobachtung zu machen. Welche Folge hat das für die Beobachtung literarischer Subjekte? Thematisiert nicht ein Erzähler, willentlich oder nicht, einen subjektiven Standpunkt, ohne die Beobachtung - der Leser sei hier ausgenommen - eines alter egos? Bezieht man aber den Leser als erkennendes Subjekt mit ein, so ist die Beobachtung Oelmüllers stichhaltig.34Oelmüllers Subjektkonzeptionen zeigen, dass Subjekte erst durch ihr Gegenüber konstituiert werden, diese Konstitution kann sich, wie mir scheint, nur auf soziale Identitäten beziehen. Durch diese Konstitution des Subjekts scheint es wahrscheinlich, dass sich Subjekte dann umgekehrt auch nur innerhalb dieser sozialen Spiegelung auflösen können.
Auflösung der Subjekte
Welches Subjekt löst sich auf?
Seit dem Expressionismus sieht man das Subjekt in Auflösung begriffen. In der Ly- rik des Ersten Weltkrieges dissoziierte die subjektive Einheit. Anschließend wurde es im wirtschaftlichen Funktionalismus zerrieben. Foucault proklamiert sich als Sterbe- helfer des durch die Macht vorgestellten Subjekts, um es seiner wahren Natur zufüh- ren zu können. Es gibt also eine Reihe von Denkern in verschiedenen Disziplinen, die seit nun beinahe 100 Jahren das Sterben des Subjekts beobachten. Besonders in den Literaturwissenschaften ist dieser Todeskampf ein beliebtes Sujet. Aus dieser Tatsache wird ersichtlich, dass dem Begriff ‚Subjekt’ eine Vielzahl von Definitionen und Aspekten zukommt.
Baumgartner versucht in seinem Artikel: „Welches Subjekt ist verschwunden?“ verschiedene Aspekte des Begriffs Subjektivität festzulegen, die nicht auslöschbar sind. Er tut dies in der Absicht, die „dringliche Frage: Welches Subjekt ist verschwunden?“ (Baumgartner 20)35besser beantworten zu können. Ich möchte die fünf Aspekte der Subjektivität, die Baumgartner anführt, im Folgenden kurz referieren und wo möglich kritisieren. Anzumerken bleibt, dass Baumgartner in seiner Auflistung sich auf philosophisch/grammatische Subjektivitätsaspekte beschränkt. Er will damit die Herausstreichung erreichen, von welchen Aspekten wir nach wie vor sprechen können und welche seiner Meinung nach obsolet geworden sind.
Hier hege ich meinen ersten Einwand: Ich glaube nicht, dass mit diesen fünf Aspekten alle Gesichtspunkte der Subjektivität abgedeckt sind, und besonders derjenigen nicht, die eine Rede vom Sterben des Subjektes überhaupt sinnvoll machen. Und daran anschließend stellt sich für mich die Frage, ob man anhand einer unvollständigen Auflistung die Punkte auszumachen in der Lage ist, um eine adäquate Annäherung an das Sujet leisten zu können.
Er erkennt drei Richtungen, die er an den Denkern Heidegger, Adorno und Nietzsche festmacht. Heidegger sieht den Subjektivitätsbegriff in der neuzeitlichen Metaphysik begründet. Dieser sei „in Wahrheit Ausdruck von Herrschafts-Attitüden“ (Baumgart- ner 20). Diese Perspektive stellt eine Abkehr von der Aufhebung der Subjektivität dar. „Die Rede von der Aufhebung des Subjekts wird also gegen die angeblich in der Metaphysik gründende Herrschaft des Subjekts geführt“ (Baumgartner 20 f).
Adornos ‚Dialektik der Aufklärung’ liest Baumgartner als Widerstreit gesellschaftlicher Verblendung des Menschen. Adorno benennt den Umschlag von Naturbeherrschung in die Herrschaft über die Subjekte, und dass die „Herrschaft des Objektiven sich in der Menschenwelt gesellschaftlich vermittelt und zur Verdinglichung des Subjekts führt“ (Baumgartner 21).
Es soll der Mensch in seinem Konsumverhalten und der Herrschaft der Konsumgüter analysiert werden und so aus dieser Verstrickung gelöst werden. Adorno wie Baum- gartner haben sozusagen als wissenschaftliche Utopie „die Idee der Menschheit, der Einheit von Subjektivität und Objektivität, eine Idee des Seins“ (Baumgartner 21). Der Standpunkt Nietzsches leitet sich aus dessen Nihilismus ab:
Mit dem Tod Gottes stirbt auch das Subjekt, alle identitätsstiftenden Unterschiede heben sich auf, und von all dem bleibt allenfalls [...] der reine Unterschied, die Schrift und die Grammatik. (Baumgartner 21)
Oelmüller interpretiert Nietzsche an dieser Stelle anders: Der Tod des Menschen symbolisiert für ihn das Ende aller „entwickelten Aussagen über die besondere Wür- de des Menschen“ (Oelmüller 45). Was Baumgartner als Gemeinsamkeit der oben umrissenen Perspektiven ausmacht, ist „jeweils eine totalisierende Rede überdie Gegenwart, überdasSubjekt, überdieSubjektivität“ (Baumgartner 22f). Die ‚Totali- tät’ des Subjekts sieht Baumgartner in keiner Hinsicht gewährleistet. Am wenigsten sieht er die subjektive Perspektive als totalitäre Perspektive für die Beobachtung der Welt.
Der größte und gröbste Fehler jedoch liegt in der totalisierenden Übertragung der Ich-Struktur auf die Welt im ganzen, auf Natur und Geschichte, und hierfür sind Schelling und Hegel Gewährsleute [...]. Wer sich vergegenwärtigt, wie die Struktur des Selbstbewusstseins als das Ineinander von zwei Tätigkeiten ge- dacht und instrumentalisiert wird: zur Bestimmung der Natur, insofern die Na- tur vom menschlichen Subjekt erkannt werden kann, und umgekehrt, zur Be- stimmung des Selbstbewusstseins als ein erkennendes Subjekt, insofern dieses eine objektive Natur vor sich hat, aus der es hervorgegangen ist; der wird zu- nächst zwar zögern bei der Frage, weshalb denn eine solche Übertragung nicht stattfinden dürfe. (Baumgartner 25f)
Welche Struktur darf nicht vom Menschen auf die Struktur der Natur übertragen werden? Es ist die scheinbare Totalität, die die subjektive Perspektive kennzeichnet. Wir dürfen also nicht die Abgeschlossenheit, die wir für und bei uns wahrnehmen auf die Welt und die Dinge darin übertragen. Die scheinbare Systemgrenze, die uns Menschen von der Umwelt abhebt; wir neigen dazu, unsere systemische Geschlossenheit ebenfalls auf Gegenstände zu übertragen.36
Im Folgenden möchte ich Baumgartners Rettungsversuch der Subjekte teilweise dar- stellen. Baumgartner überprüft einige Aspekte der Subjektivität auf ihre Auslösch- barkeit hin:
Der Blick auf die, von Tugendhat, Russell und Nagel geführte Diskussion, bezeuge die Unauslöschbarkeit der Personalpronomina „ich“, „du“, „er“, „sie“ und „es“, da sie „eine unverzichtbare Funktion haben“ (Baumgartner 22). Eine Funktion für die Kommunikation, was auch durch die Kommunikationsphilosophie von Apel, Beck und Habermas gestützt wird, ist: Jede Kommunikation bedarf notwendigerweise einer Differenz zwischen dem Standpunkt des Akteurs und des Teilnehmers, und insoweit ist die Funktion des Personalpronomen unaufhebbar. Baumgartner setzt den Fortbestand der Kommunikation scheinbar voraus. Solange Kommunikation stattfindet, gibt es dann auch das grammatikalische Ich.
Ich denke, dass eine Kommunikation vorstellbar ist, die ohne jegliche Personalpronomina auskommt. Der Rückbezug auf Kommunikation stellt für mich keine Rettung des Subjekts dar.
Die obige Annahme setzt ein Kommunikationsmodell voraus, das die Anwesenheit von Bewusstsein voraussetzt. Was für Baumgartner eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, ist nicht in jedem Kommunikationsmodell der Fall. So unterscheidet etwa Luhmann gerade zwischen Kommunikation und Bewusstsein.37
„Kants Konzeption des ‚Ich denke, [das] alle meine Vorstellungen [muss] begleiten können“ (Baumgartner 21) nennt Baumgartner als zweites unauslöschliches Moment des Subjektbegriffs. Dieses ‚ich denke’ benennt keine Substanz, sondern lediglich „dass eine Identität des Wissens festgehalten werden muss“ (Baumgartner 22) es hat lediglich Identitäts- und Synthesisfunktion. Dieser Aspekt bleibt gemäss Baumgart- ner unauslöschbar.
Weiter mit Kant: Personalität gewinnt der Mensch durch die Unterwerfung unter eine unbedingt geltende Norm. Dabei unterscheidet Kant drei ‚Unterwerfungen’:
Die Anlage für dieThierheitdes Menschen, als eines lebenden; 2) Für dieMenschheitdesselben, als eines lebenden und zugleichvernünftigen3) Für seinePersönlichkeit, als eines vernünftigen, und zugleich der Zurechnung fähigen Wesens. (Baumgartner 23) Für Baumgartner ist das wichtigste Moment in dieser Aufzählung der Akt der bewussten Handlung, die wir uns und anderen zurechnen, denn: „Schließlich muss auch die Theorie bzw. die Rede vom verschwundenen Subjekt zugerechnet und verantwortet werden können“ (Baumgartner 23).
Das Subjekt, - so der vierte Punkt - im intersubjektiven Diskurs sprachlicher Kommunikationen sind ohne Subjekte, die je nach Sprechersituation jeweils ego oder alter in der Kommunikation sind, für Baumgartner nicht denkbar38.
Staffel
Der Charakter Annas in Staffels Roman ‚Terrordrom’ ist ein literarisches Beispiel für die Auslöschung eines Subjekts von ganz anderer Provenienz. Die im Kapitel Mo- dernisierung und Domestizierung beschriebenen Bestimmungen des modernen Men- schen, die ich hier kurz mit Selbstdressur benennen möchte, sind anscheinend stärker als die Auslöschung eines Subjekts. Die Figur Annas funktioniert - im Roman als Gastgeberin - , trotzdem sie auf gewisse Weise zu existieren aufgehört hat. Die Stadt und somit die gesamte Handlung des Romans wird über subjektive Perspektiven er- zählt. Die Handlung wird immer in einer Art auktorialen Erzählperspektive erzählt. Dieses Erzählverfahren ist an anderer Stelle in dieser Arbeit beschrieben. Diese Form gewährleistet immer einen Rückgriff auf die Befindlichkeit der einzelnen Charaktere, vergewissern den Leser der ‚Existenz’ der Figuren.
ANNA Olli kümmert sich rührend. Ich will das nicht. Ich weiß nicht, was ich getan habe, warum ich mich verstecke, warum alles hinter mir und nichts vor mir liegt. Felix mein kleiner, er tötet, für mich und Tom der Mörder. Ich schreie und fühle nichts mehr. [...] Ich habe mich ausgeklinkt. Wie Olli gesagt hat. Und ich habe aufgehört zu existieren. [...] Die Begleiterscheinung, der er nicht traut. Nicht wirklich. Ich passe nicht ins Bild. Die Andere Berührung. Die Gefangene. Freiwillig. Er sorgt für den Wodka. Damit ich still halte. Er hat eine Aufgabe. Ich sehe zu. Ich weiß von nichts. Er sagt: - Geduld. Während er mich berührt. Ich spüre Nichts. Nur mich, die nicht mehr kann. (Staffel 169)
Dies ist Annas letzte Sequenz im Roman. Sie ist in einer traumatischen Situation gefangen, sie kann weder vor noch zurück. Alles liegt hinter ihr, nichts vor ihr, wie sie sagt. Der letzte Satz beinhaltet eine Verdoppelung, bzw. Spaltung der Person. Das letzte, was sie spürt ist eine Person, die nicht mehr kann. Quasi eine Ablösung der emotionalen Wahrnehmung von der persönlichen Einheit des Charakters, der Person, die durch diese verdoppelte Wahrnehmung gekennzeichnet ist.
Felix’ Besuch zuhause belegt diese Auflösung. Sie ist nicht mehr bei ihrem Liebha- ber, sondern zu Tom zurückgekehrt. Ihr Fluchtversuch ist gescheitert, die Alternative Olli hat sich als Sackgasse herausgestellt. Das Verhalten ihrem Sohn gegenüber ist sehr unpersönlich.
„FELIX [...] Anna benimmt sich, als wären wir ihre Dinnergäste, und schwätzt irgendwas vor sich hin, während sie unsere Drinks mixt. - [...] Anna, komm runter, bitte. Ich bin es, Felix, kapiert?“ (Staffel 204)
Annas subjektive Perspektive, die Versicherung ihrer Existenz kommt nun nicht mehr zum Vorschein. Ihre Wahrnehmung und subjektive Perspektive ist aufgehoben. Lediglich ihre Funktion als Ehefrau und Gastgeberin bleibt erhalten. Dieser Sachver- halt lässt sich auf zweierlei Arten auslegen. Die soziale Person bedarf nach Staffels Konzeption keiner Subjektivität, bei der, wie ich oben gesagt habe, Bewusstsein vor- handen sein muss. Zweitens: Die Rolle der Ehefrau ist reifiziert, wird wie von einer Maschine erfüllt.
Um es mit Coupland zu sagen: „Er ist ein Hülsenmensch geworden: funktionsfähig, aber ohne Seele“ (Coupland 66)39.
Mit dieser von Staffel beschriebenen Subjektauflösung kann man auch gegen Becks Annahme, der Auflösung von Geschlechterrollen argumentieren. Die Einspeisung Annas in die Rolle als Hausfrau geht so weit, dass sie sozusagen als Mensch dabei getötet wird. ‚Tom der Mörder’. Es ist dies eine Rolle und Stellung in der Gesell- schaft, die nicht Annas Grundbedürfnisse befriedigt, sondern Anna hat bis zur Selbstauflösung ihrer von Tom zugedachten Rolle zu entsprechen. Tom ist aber ein Repräsentant der Medienmacht im Roman. Was er auf familiärer Ebene leistet, näm- lich, die Auslöschung des ursprünglich menschlichen (Annas subjektive Perspekti- ve), und die Besetzung des freigewordenen innerpsychischen Raumes mit neuen Mustern, - die Versklavung des Menschen in eine soziale Rolle - leistet er auch in seiner Funktion als Fernsehpersönlichkeit. Dennoch untersteht auch er einer Macht: Paul. Toms eigenmächtiger Vorstoß bei einer Sendung bringt für ihn das Aus. Felix sieht mit seinem Freund Button die Sendung an.
FELIX [...] Tom räkelt sich in seinem Sessel, dreht seine Fratze in die Kamera und fragt sich, wie man von Kontrolle sprechen kann, wenn bereits ganze Stadtteile evakuiert werden müssen, nur damit ein paar Scheinasylanten sich gegenseitig massakrieren können, und ob das vielleicht eine neue Methode ist, dem Asylantenproblem entgegenzuwirken. (Staffel 36)
Die Sendung beschert dem Sender zwar hohe Einschaltquoten, doch scheint das nicht das alleinige Interesse Pauls, der offenbar den Sender leitet, zu sein. Er beschließt zwar nicht auf Tom zu verzichten, doch die Sendung abzusetzen.
PAUL [...] Ich sage ihm, dass er solange die Geschäfte führen soll. Ich bitte ihn zu gehen. Er klopft mir auf die Schulter. Sobald er draußen ist, überlege ich, wie ich die Sendung möglichst spektakulär kippen kann. (Staffel 42)
Tom unterliegt also ebenfalls einer Rolle, die er einzuhalten hat. Seine Grenzüber- schreitung hat für ihn die persönliche Folge, dass seine Sendung abgesetzt wird. Dennoch hat seine soziale Rolle für Tom nicht die gleichen Folgen, wie für Anna. Seine subjektive Sicht wird nicht ausgelöscht. Es ist also fraglich, ob die Zwänge der Ehefrauenrolle Annas zu ihrer Auslöschung führten, oder ob sie trotz ihres ‚Todes’ in der Lage ist diese wahrzunehmen. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass sie zwar perfekte Hausfrau ist, aber keinerlei mütterliche Gefühle gegenüber ihrem Sohn hegt. Sie ist Ehefrau nicht Mutter, die soziale Rolle ist in diesem Fall also stärker als der mütterliche Instinkt. Die Gesellschaft hat also Macht über die menschliche Natur.
Wir gleiten mit etwa der gleichen Geschwindigkeit dahin wie die Autos auf den anderen Spuren: mal etwas schneller, dann wieder etwas langsamer. Die klei- nen Vorsprünge, die sich durch gelegentliches Überholen ergeben, sind nach wenigen Sekunden wieder dahingeschmolzen. Nesbitt braucht nicht viel zu tun, nur hin und wieder ein Taste zu berühren oder die Fahrtrichtung geringfügig zu korrigieren. Von Reibung ist nichts zu spüren, weder unerwartete Brems- noch Ausweichmanöver sind nötig. Nesbitt braucht keine riskanten Spurwechsel vor- zunehmen, ist nie gezwungen, Vollgas zu geben. Die Landschaft am Rand des Verkehrsstroms ist geprägt von einer nicht endenden Folge flacher Gebäude, von blassgelben und schmutzigweißen Mauern, Reklametafeln und Schildern, die auf Motels hinweisen. Hinter keinem der Elemente diese Bildes steckt eine Storry, bei keinem von ihnen liegt eine tiefere Bedeutung unter der an der O- berfläche erkennbaren.
Andrea De Carlo, Yucatan
STADT
Medialität der Stadt
Der Text der Stadt
Die Frage nach der Sprache der Stadt und wie man sie spricht kann man mit der Fra- ge nach der Sprache eines Romans vergleichen: Was ist die Sprache des Romans „Der Zauberberg“? Und wie spricht man sie? Indem man das Buch liest. Ähnliches trifft auch auf die Stadt aufgefasst als Text zu: Indem ich den Text der Stadt lese, schreibe ich ihn. Mir scheint, dass in dieser Tatsache das eigentliche Erkenntnisprob- lem liegt: Denn man ist Autor und Leser zugleich, geht man durch die Sätze einer Stadt. Wandelt man aber durch die Gassen eines Romans? Sind wir dann nicht auch
- jetzt zunächst Leser - und dann Autor des Romans, den wir im Geiste nachzeich- nen?
Michel Butor beschreibt den Prozess, den er durchläuft, bevor er eine Stadt betritt. Er rezipiert eine Reihe verschiedenster Texte. Diese helfen ihm, seine Reisen vorzubereiten. Diese Texte helfen ihm sich zu orientieren, bestimmte Sachverhalte zu ergänzen. Dennoch ist für ihn der ‚Text der Stadt’ etwas grundlegend anderes:
Unter Text der Stadt verstehe ich zunächst die Unmenge an Aufschriften, mit denen sie überzogen ist. Gehe ich durch die Straßen einer modernen Großstadt, erwarten und bestürmen mich überall Wörter: nicht nur, dass die Leute, denen ich begegne, miteinander sprechen, sondern vor allem die Schilder an den Ge- bäuden, an den Stationen der Untergrundbahnen, der Bushaltestellen, durch die ich, falls ich in der Lage bin, sie zu lesen, feststellen kann, wo ich mich befinde, wie ich zu einer anderen Station gelange. Bin ich in dieser Hinsicht Analphabet, bin ich verloren, machtlos, einem nicht kontrollierbaren Führer ausgeliefert; ich falle in eine triste Unmündigkeit zurück. (Butor, 8f)40.
Diese Analyse Butors enthält mehr, als es zunächst den Anschein hat. Butor sieht den wie er sagt „offenkundigen Text“ (Butor, 9) ergänzt durch einen „Halbtext“ (Butor, 9); wie etwa die Farben Rot und Grün an der Ampel. Die größte textuelle Bedeutung der Stadt sieht Butor als Speichermedium von Text. Diese „nichtsichtbare Textuali- tät“ (Butor, 10) nennt er konstitutiv für das Bestehen der Stadt. Diese Aussage stützt in gewisser Weise die Annahme Choays, die einen Übergang von „reinen“ zu „hypo- signifikanten“41Stadtsystemen feststellt, sobald die vorherrschende Feudalstruktur aufbricht, und nicht mehr zentrale Referenz des Stadtbildes sein kann, auch aus dem Grund, dass der urbane Raum im Zuge gesellschaftlicher Entwicklung immer kom- plexer wird, und deshalb eines zusätzlichen Orientierungssystems bedarf.
Butor stellt fest, dass in der Geschichte Großstädte zusammen mit der Schrift ent- standen sind. Daher glaubt er den Umkehrschluss machen zu können: Die Menschen haben nicht, weil sie sich in einem Punkt konzentrierten, Texte herausgebildet, son- dern weil Text sich an einer Stelle konzentrierte, siedelten sich die Menschen an. So ist für ihn das eigentliche Oberhaupt der Gesellschaft nicht die Obrigkeit, sondern das Archiv.
Butor lässt dabei meines Erachtens einige Aspekte außer Acht. Mir scheint es sinn- voller, im Falle der Entwicklung Stadt/Text eine gegenseitige Wechselbeziehung anzunehmen. Ab einem gewissen Komplexitätsgrad einer Siedlung wird irgendwann ein Zeichensystem zur Verwaltung notwendig. Dieses System ermöglicht dann wei- tere Ausdehnungen, produziert aber auf der anderen Seite wiederum Text. So bedin- gen sich die Komplexität, die sich zwangsläufig ab einer bestimmten Bevölkerungs- konzentration ergibt, und das Schrifttum gegenseitig. Es liegt keine einseitige Verur- sachung vor.
Butor stellt einen weiteren Berührungspunkt von Stadt und Text fest: Die Stadt literarisiert sich gerne über große Namen der Literatur, wie die Goethe Straße, und so geraten wir in eine Fülle von gelenkten Evokationen:
Die Stadt als literarische Gattung lässt sich mit dem Roman vergleichen. Der große Romancier ist jemand, dem es gelingt, die Stimme seiner Personen hören zu lassen, er gibt jeder einen besonderen Stil, sein eigener Stil ist eigentlich ein Superstil, die Integration all dieser Stilerscheinungen, was ausreichte, ihn einen Orator oder einen lyrischen Dichter zu nennen. Auf die gleiche Weise integriert der Stil einer Großstadt eine ungeheuere Menge an Unter-Stilen, die ihrer ne- beneinander liegenden oder auch ineinander verschachtelten Dörfer. (Butor 16)
Nach Butor ist es also eine Stilfrage - auf metaphorischer Ebene - was die verschieden Städte bzw. Stadtteile kennzeichnet.
Aber welcher gigantische Roman könnte mit solchen verbalen Ensembles in Wettstreit treten? Zumindest versucht man, ihre Vielfaltigkeit nachzuahmen. Der neuzeitliche Roman, mindestens seit dem 18. Jahrhundert, ist wesentlich Stadtroman, Beschreibung der Stadt, die sich in einer anderen Stadt ausbreitet, in ihr wirksam ist oder in Beziehung zu ihr handelt. (Butor, 17)
Butor sieht die literarische Umsetzung der Stadt in gewisser Weise als mangelhaft gegenüber dem „Original“ an. Bedenkt man die Annahme Butors, dass Text für eine Stadt konstitutiv ist, so kann das auch für den literarischen Text der Stadt gelten. Nun ist es fraglich, inwieweit die literarische Erfassung einer Stadt konstitutiv für die Stadt als solche ist. Kehren wir zum Anfang von Butors Essay „Die Stadt als Text“ zurück; hier berichtet er, wie er sich auf Städtereisen vorbereitet: Indem er sich Bü- cher über das Reiseziel beschafft.
Die Wahl der Bücher ist entscheidend für den Verlauf der Reise. Nicht nur dass verschiedene Reiseführer bestimmte Ziele anders werten, und so die Route durch die Stadt beeinflussen. Ich glaube, dass das zuvor vermittelte Bild der Stadt in Führern oder Werken über die Stadt wesentlich das Erleben in der Stadt bestimmt.
Die Stadt als Text
Die saussuresche Analogie von Stadt und Sprache
Vermutlich war Ferdinand de Saussure einer ersten, die eine Analogie von Sprache und Stadt vorschlug. Jürgen Trabant führt Manfredo Tafuri an, der die saussuresche Analogie auf Algier anwendet: Das alte Algier wird in eine „neue Redestruktur“ ge- stellt, die aber die Stadt nicht völlig neu errichtet, sondern nur Gegebenes neu arran- giert.
Tafuri fährt fort, dass dieser neue Gebrauch des sprachlichen Materials den ganzen Kontext verändere und das ganze territoriale System beeinflusse. Wenn wir Tafuri richtig verstehen, bedeute dies, dass die „neue Redestruktur“, die pa- role, zwischen den Elementen des „ererbten Sprachmaterials“ neue Beziehun- gen herstellt, die zu einem neuen System, zu einer neuen urbanistischen langu- age führen. (Trabant, 80)42.
So überträgt man in dem Analogon auch die - in meinen Augen - problematische Unterscheidung von langue und parole, die eigentlich von verschiedenen Linguistiken behandelt werden müssten. Und obwohl die parole die langue verändert, und auf Objektebene unentwirrbar mit einander verwoben sind beide „zwei absolut unterschiedene Dinge“ (Trabant 81). So müssten wir bei einer Linguistik der Stadt, - genau wie bei der Untersuchung der Sprache - synchron und diachron unterscheiden. Wie aber erhält das sprachliche/städtische Zeichen seine Identität, das in der parole schier unendlichen Modifikationen unterworfen ist?
Beim Mechanismus der Sprache dreht sich alles um Gleichheiten und Ver- schiedenheiten, wobei die letzteren nur das Gegenstück der ersteren sind. Das Problem der Identitäten findet man also überall wieder; andererseits aber ver- mischt es sich teilweise mit den Problem der Größen und Einheiten, von dem es nur eine im übrigen fruchtbare Komplikation ist. Diese Eigenschaft wird gut deutlich beim Vergleich mit einigen von außerhalb der Sprache genommenen Fakten. So sprechen wir von Identität bei zwei Schnellzügen, ‚Genf-Paris’ acht Uhr 45 abends’, die im Abstand von 24 Stunden verkehren. In unseren Augen ist das derselbe Schnellzug, und dennoch ist wahrscheinlich alles: Lokomotive, Waggons, Personal verschieden. Oder aber wenn eine Straße abgerissen, dann wieder aufgebaut wird, dann sagen wir, dass es dieselbe Straße ist, obwohl ma- teriell vielleicht nichts mehr von der früheren Straße überdauert. Warum kann man eine Straße von Grund auf neu aufbauen, ohne dass sie aufhörte, die selbe
zu sein? Weil die Größe, die sie darstellt, nicht rein materiell ist; sie ist auf be- stimmte Bedingungen gegründet, denen ihre zufällige Materie fremd ist, z.B. ihre Lage in bezug auf andere; ebenso ist das, was den Zug ausmacht, seine Ab- fahrtszeit, seine Strecke und im allgemeinen alle Umstände, die ihn von den anderen Zügen unterscheiden. Jedes Mal wenn dieselben Bedingungen vorhan- den sind, erhält man dieselben Größen. Und doch sind diese Größen nicht abs- trakt, da eine Straße oder ein Zug nicht außerhalb der materiellen Realisierung gedacht werden können. (De Saussure 129)43.
Eine Straße gewinnt für Saussure ihre Identität also durch ihre Lage und Funktion in der Stadt. Nicht die materielle Konstanz (Kontinuität), sondern formale Konstanz ist also entscheidend für die ‚Bedeutung’ einer Straße. Trabant stellt der abstrakten I- dentität der Straße die rein materielle gegenüber, die er Ipsität nennt. Es ist also nicht die Ipsität einer Straße, sondern die Stellung im System. Das bedeutet aber auch, dass die Straße für sich genommen keine Bedeutung haben kann, sondern die Straße muss immer einem komplexeren System untergeordnet sein. Sei dies eine Stadt oder eine Gesellschaft oder Kultur. Dies wiederum verunmöglicht eine synchrone Untersuchung der Stadt zu einem einzelnen Zeitpunkt.
Mit den Termini der Klausschen Semiotik: die durch ihren Stellenwert im Sys- tem definierte Zeichengestalt (signifiant), nicht das konkrete Zeichenexemplar, (signifié), nicht das konkrete bezeichnete Objekt, andererseits machen die Iden- tität der Sprache aus. [...] Die Ipsität der Straße, das konkrete So-Sein und Sich- materiell-identisch bleiben, d.h. die Architektur der Straße, ist für die Bestim- mung der Einheit Straße irrelevant. So wie das im konkreten Sprechakt ertö- nende Lautphänomen (parole) unerheblich ist für die Identität der Sprache (lan- gue), so ist auch die architektonische Realisierung einer Stadt für deren Identi- tät belanglos. Die Stadt reduziert sich damit auf ein formales Geflecht von Ver- kehrslinien, auf den Grundriss, auf den Stadtplan. (Trabant 83)
Überträgt man also die saussuresche Unterscheidung von, sagen wir gelebter Stadt (parole) gegen abstrakte Architektur (langue) treten die Grenzen dieses Vergleichs schnell auf. Saussure glaubt, dass eine Straße nicht außerhalb ihrer materiellen Mani- festation gedacht werden kann, dennoch folgert daraus nicht, dass es eine bestimmte Straße sein muss, die materielle Gestalt der Straße ist also zufällig, wichtig ist alleine ihre Existenz.44
Und so kommt Trabant zu der folgenden Aussage:
Alle Argumente sprechen, so glauben wir, für die Interpretation, dass die saus- suresche Analogie der ‚amerikanischen’ Indifferenz von Urbanistik und Archi tektur entspricht: Eine feste urbane Form gibt den Rahmen für eine völlig freie architektonische Substanz. (Trabant 84)
Stadttext und Virtualität
Jaques Derrida hat die Metapher der ‚Textualisierung der Welt’ vorgeschlagen und damit eine Reihe von Debatten ausgelöst.
Diese Metapher schließt unter anderem die Frage nach Simulation und Realität ein. Die Frage nach der Virtualität der Stadt, die Frage nach Virtualität von Textualität.
Auch in Jean Baudrillards semiotischen Konzept der Simulation, in dem nicht mehr das Reale, sondern das Imaginäre als Referent der Wahrnehmung fun- giert, ist die Stadt kein reales Objekt der Darstellung mehr. Vielmehr wird die Stadt in Baudrillards Begriffsnetz als Konstrukt des Zeichensystems begriffen. (Nelting 165)45
In der Moderne war die vorherrschende Metaphorisierung der Stadt die Maschine, in Zeiten des Postmodernismus ist es nun der Text. Diese Veränderung von Maschine zu Text beinhaltet, dass früher die Realität der Stadt von dem realen Raum, den die Metropole einnimmt, gekennzeichnet war, und dass heute diese Realität von einer Art Cyberspace, von virtueller Realität gekennzeichnet ist, einem virtuellen Raum des lediglich informationellen kybernetischen Systems, das in den wirklichen Raum der Stadt hineininstalliert ist, und diesen teilweise verdrängt, oder gewisse Teile ein- nimmt.
Nelting stellt eine Veränderung der städtischen Metaphorisierung fest: vom realen Stadtraum der Moderne, der noch die Wahrnehmung der Stadt bestimmt, hin zur Virtualisierung, der Entkoppelung von Realität und Imagination bzw. Simulation. Diese Virtualisierung wird durch die Textualisierung geleistet. In der Metapher ‚Stadt als Text’ sieht Nelting bereits den Grundstock für die Simulation gelegt. Somit begreift Nelting ‚Text’ als etwas Virtuelles. Neltings Annahme der Virtualität von Text ist berechtigt, dennoch scheinen neue Medien eine andere Art von Virtualität hervorzubringen. Flusser vergleicht prähistorische Höhlenmalerei mit den Bildern der neuen Medien:
Es gibt die Tendenz, den Empfang der Schirmbilder mit jenem der Höhlenbil- der zu verwechseln: als stießen uns die neuen Bilder in eine prähistorische, weil unkritische Lage zurück und als seien sie deshalb entpolitisierend. Und es gibt die andere Tendenz, diesen Empfang mit jenem der ausgestellten Bilder zu verwechseln: als seien die neuen Bilder noch immer Sendungen von ästhetisch und politisch Engagierten, nur nicht mehr kaufbare Originale, sondern jetzt all- gemein zugängliche Multiplen. Jede dieser Tendenzen führt zu einer anderen Beurteilung der Lage, die erste zu einer pessimistischen, die zweite zu einer op- timistischen. Beide sind Irrtum. Wir müssen die gegenwärtige Lage nach ihren eigenen Charakteristiken zu beurteilen versuchen. [...] So wie Bilder gegenwär- tig transportiert werden [...]: Sie müssen ihre Empfänger in Objekte verwan- deln, und das ist auch die Absicht hinter diesem Transportieren. Aber die ge- genwärtige Transportmethode entspricht nicht notwendigerweise der Technik der neuen Medien, sondern eben nur der Absicht hinter ihr. (Flusser 1997, 87)46.
Virtualität ist dennoch ein Terminus, den man eigentlich mehr und mehr für elektronische Medien gebraucht. Diese Sichtweise widerspricht in gewisser Weise Faßlers Überlegungen, der in Textualität einen Gegenpol zur Virtualität sieht, vorausgesetzt, dass die ‚neuen Medien’ tatsächlich ‚Virtualität’ hervorbringen.
Choay nimmt die ‚Textualisierung’ der Stadt viel früher an als Nelting.
Zunächst möchte ich aber einige weitere Positionen zum Diskurs der Stadt als Text festhalten.
Choay stellt zur Diskussion, ob die Stadt mit sprachwissenschaftlichen Methoden untersucht werden kann und welche Perspektiven eine solche Untersuchung liefern könnte. „Kann sie als ein nichtverbales System signifikanter Elemente betrachtet werden, dessen Strukturen mit den Strukturen der anderen gesellschaftlichen Produkte und Handlungen in Zusammenhang stehen?” (Choay 43)47.
„Der Raum des Menschen ist schon immer von Bedeutung erfüllt gewesen“ (Barthes 34)48. Die Objektivierung des Stadtbildes durch verschiedene wissenschaftliche Dis- ziplinen sieht Barthes als Verwischung der Bedeutung der Stadt, zugunsten einer Objektivierung. Wobei Barthes ähnlich wie Borges49‚Objektivität’ als eine „Form des Imaginären unter anderen“ (Barthes 34) sieht. Vergleicht man nun die Frage Choays mit der Meinung Barthes, dass eine wissenschaftliche Segmentierung durch die verschiedenen Disziplinen, die Bedeutung verwischt, so drängt sich die Frage auf, ob nicht auch durch eine semiotische oder ‚linguistische’ Untersuchung der Stadt, der Zugang zum eigentlichen Erkenntnisobjekt verstellt wird. Wie zum Bei- spiel Igenschay annimmt, dass die Schrift die Stadt nicht erreichen kann.50
Die Mittelalterliche Stadt.
Ihr System wird vor allem von der Einfriedung definiert (als Innenraum der sie umgebenden Mauer) und vom Spiel der differentiellen Beziehungen zwischen zwei Arten von Elementen: zellenartige kleine Grundelemente (Einzelhäuser) und Großelemente mit semantischem Gewicht (Kathedrale, Kirche, Paläste, Plätze). (Choay 43)
Dieses System repräsentiert das Feudalsystem und regelt so über gemeinsame Inte- ressen, Bedürfnisse und Stellung im Raum, das Zusammenleben in der Stadt. Choay nennt dieses Stadtbild ‘rein’. Die Signifikanz entsteht aus der Stadtstruktur selbst und erfolgt ohne Rückgriff auf Metasignifikanzsystemen, wie etwa der Schrift. Dennoch stehen diese signifikanten Systeme der mittelalterlichen Stadt im Zusam- menhang mit einer Vielzahl anderer Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen. In einem derartigen systematischen Zusammenhang gibt es laut Choay keinen ‘leeren Raum’, auch freier, nichtbebauter Raum ist nicht nichtsignifikant. Ihrer Meinung nach bestehen reine semiotische Systeme nur aus Orten, (Choay 49) nicht Räumen.
Wandel zur Moderne: Verdammung zum Anachronismus?
Die starre mittelalterliche Stadtstruktur bricht in der Moderne zusehend auf. Das Aufbrechen bestehender Strukturen ist innerhalb der ‚Modernisierung’ nicht nur auf urbane Räume zu beschränken: Moderne Prozesse, wie die Auflösung der Ständege- sellschaft, finden in der Stadt ihren Niederschlag. Dennoch würde ich keine einseiti ge Verursachung annehmen; denn der Wandel der Städte trägt einen Teil zum gesell- schaftlichen Wandel bei: Gesellschaftliche Veränderungen schreiben den Text der Stadt um, der neue Text bietet wiederum einen Nährboden für neue Entwicklungen. Choay kennzeichnet urbane Strukturen als „offene Systeme mit schneller Entwick- lung“ (Choay 49). Der große Unterschied ist, dass die modernen Städte „‘hypo- singnifikant’ sind, dass sie ihre Reinheit verloren haben, indem sie den Rückgriff auf äußere Codes verbaler und graphischer Art implizieren.” (Choay 49). Die modernen Städte kommen also ohne weitere Kennzeichnung nicht mehr aus. Sie brauchen ei- nen zusätzlichen Text um sich zu organisieren. Dieses hyposignifikante System der Stadt beschreibt Butor.51
Coupland
Tyler, der Ich-Erzähler aus Couplands Roman Shampoo Planet schreibt von seiner Europareise, die ihn durch verschiedene Städte führt, eine Postkarte in seine Heimat. Coupland beschreibt und bedauert die Unwandelbarkeit europäischer Städte.
Europa ermangelt es an Möglichkeit für eine Metamorphose [...]. Europa ist wie ein hübsches Baby mit absolut unverwechselbaren Gesichtszügen, das aber nicht nur schön, sondern auch irgendwie deprimierend ist, weil man genau weiß, wie das Kind mit zwanzig, vierzig und neunundsechzig aussehen wird. Kein Mysterium. (Coupland 99)
Im weiteren Verlauf des Romans stellt die Europäerin Steffi, die der Ich-Erzähler Tyler Johnson in Paris kennen gelernt hatte, und nun mit ihm durch Amerika fährt, in einem peripheren Blick ein Kalifornisches Subjektkonzept vor. Diese Konzeption weist Parallelen zu den europäischen Städten im obigen Zitat auf. Die Differenz zwischen Europa und Amerika besteht in der Unveränderlichkeit. So wie die Städte Europas, um es mit den Worten Choays zu sagen, zum Anachronismus verdammt scheinen, so sind es auch die europäischen Subjekte.
‚Wenn sich in Kalifornien Leute, die sich zwei Jahre lang nicht gesehen haben, wiedertreffen’, beginnt sie auf der Rückfahrt von Venice, ‚sagen sie zueinan- der: „Wie heißt du jetzt? Welche neue Religion hast du jetzt? Was für eine Diät machst du? Wie heißt deine Frau? In was für einen Haus wohnst du? In welche Stadt bist du umgezogen? An welche neuen Ideen glaubst du?“ Und wenn du nicht ein vollständig neuer Mensch geworden bist, sind deine Freunde ent- täuscht.’ [...] ‚Findest du diese ständigen Veränderungen normal?’ (Coupland 238)
So scheint sich in der Differenz zwischen Europa und Amerika eine Parallelität zwi- schen Stadt und Subjekt abzuzeichnen. In gewisser Weise spricht das für Choays Annahme, dass alte Bauwerke Neuerungen entgegenstehen, dennoch sehe ich gerade durch diese Rückbezüge auf Altes und Bestehendes die Möglichkeit für Bedeutung gewährleistet. Der ständige Wechsel der Lebensumwelt, das Bekenntnis zu einer Religion, oder der Glaube an Ideale, wird so zur Farce. Wendet man sich nach kurzer Zeit wieder neuen Lebenszielen zu, so wird es überflüssig, nach den Gerade aktuel- len Lebensentwurf zu leben. Durch diese Lebenswechsel, steht also genauso wie in dem Beispiel aus Houellebecqs Roman „Ausweitung der Kampfzone“, die Bedeu- tung Stadt, die somit als Orientierungsmuster aufgehoben ist, auch die Bedeutung des Subjekts auf dem Spiel.
Choay sieht in der materiellen Manifestation der Stadtgebäude und deren Unverän- derlichkeit eine Verdammung zum Anachronismus, und sieht so die Fähigkeit zur Signifikanz gefährdet, die nur über „das Verschmelzen vergangener Syntagmen mit neuen Syntagmen” (Choay 54) kompensiert werden kann. Aber der Begriff der Hy- posignifikanz bedeutet nicht automatisch Bedeutungslosigkeit: „Das was wir nur zu oft als Un-Sinn in den heutigen Großstädten und Siedlungen interpretieren, ist nur die Monotonie einer zu beschränkten Botschaft“ (Choay 54). Was aber ist die Bot- schaft der Modernen Stadt für Choay:
Im wesentlichen liegt er in der neuen technologisch-ökonomischen Produkti- onsweise. Diese Produktionsweise wird im 19. Jahrhundert für die Teilung der Industriestädte in zwei Bereiche bestimmend, und zwar in einem für die öko- nomische Funktion der Produktion und für die Klasse der Produzenten und ei- nen anderen für die ökonomische Funktion des Konsums und für die soziale Klasse der Konsumenten. Der Urbane Raum bezieht sich damit praktisch nur noch auf den ökonomischen Sektor sozialen Handelns. (Choay 54)
Nimmt man, wie ich es oben getan habe, gegenseitige Beeinflussung von Stadt und Gesellschaft an, ist es nicht nachvollziehbar, ob die Ursache der Metasemiotisierung der Stadt in der oben genannten monotonen Referenz der Stadt auf ökonomische Strukturen zu suchen ist, oder ob es dafür weitere Gründe gibt. Sie ist aber sicherlich ein Grund dafür. Diese von Choay festgestellte Monosemie des städtischen Raumes, stellt sicherlich eine Ursache für die Krise der „erzählten Stadt“ dar. Fraglich ist nur, ob sich Choays These der Monosemik aufrecherhalten lässt.
Kuhnle verwendet eine wertendere Terminologie für die Feststellung der gleichen Tatsachen. Er scheut nicht den Vergleich der Stadt mit der Hure Babylon. Er geht von Nietzsches Zarathustra aus; dieser sei bereits Teil der großen Stadt, und unfähig in den Wäldern zu leben. Dennoch geht von der Stadt Gefahr für Leib und Leben aus, und vielleicht gerade deshalb übt sie eine derartig starke Faszination aus. „Die große Stadt ist eine Verführerin“ (Kuhnle 144)52.
Dass Paris jedoch zur Hauptstadt des 19 Jahrhunderts avanciert, verdankt es nicht zuletzt einer Stadtplanung, die mit einer spezifischen Durchgestaltung des urbanen Lebensraums diesen zur Heimstätte der vorbildlichen Inszenierung von Waren macht. Die ganze Stadt wird schließlich vom Fetischcharakter der Wa- ren durchzogen (Kuhnle 145)
So schreibt auch Benjamin über das Paris im 19. Jahrhundert, laut Kuhnle, dass be- stimmte Bedürfnisse des Menschen in der Welt der Waren unmöglich geworden sind.
„Hier habe das dialektische Denken als „Organ des geschichtlichen Aufwachens“ anzusetzen und den Schein zu entlarven [...]. Die „große Hure verheißt eine Natur, die vorgibt, sich gefügig nach den Erfordernissen des Lustwillens umgestaltet zu haben“ (Kuhnle 145).
Kuhnles Feststellung oder ‚Umschreibung’ der starken Ausrichtung der Städte auf wirtschaftliches Handeln soll hier zeigen, dass mehr auf dem Spiel steht als die ‚Bedeutung’ einer Stadt, nämlich, wie er mit Benjamin zeigen konnte, dass die Stadt als Lebensraum gefährdet ist, und das ist meines Erachtens die erste und wichtigste Funktion der Stadt, ob man diese nun Bedeutung oder Referenz nennen will sei hier zur Disposition gestellt. Aber ich denke es entspricht dem Prozedere abendländischer Wissenschaft, zunächst einmal zu trennen, was zusammengehört, um anschließend wieder einen großen Zusammenhang herstellen zu können.
Houellebecq
Ein Blick in die Houellebecqs „Ausweitung der Kampfzone“ bestätigt Choays Be- merkungen über die Monosemik der ökonomisch ausgerichteten Städte. Houellebecq zeigt zudem die Gefahren auf, die mit dieser Gleichförmigkeit zusammenhängen.
Ich habe das ganze Stadtviertel abgesucht, aber der Wagen blieb unauffindbar. Ich erinnerte mich nicht im geringsten, wo ich ihn abgestellt hatte; alle Straßen schienen mir gleichermaßen in Frage zu kommen. Die Rue Marcel Sembat, Marcel Dasault ... alles Marcel. Rechteckige Wohnhäuser, in denen die Leute wohnen. Ein heftiges Gefühl von Gleichförmigkeit. Aber wo war mein Wagen? (Houellebecq 10)53.
Das hyposignifikante Bedeutungssystem der Stadt, die Straßennamen, brechen zusammen. Die Namensgebung ist ähnlich gleichförmig wie die bauliche Struktur, und führt soweit, dass der Ich-Erzähler seinen Wagen unauffindbar in dem Viertel verliert. Die materielle Stadt ist als Zeichensystem nicht relevant. Auf diese Weise kann man Choay ein Stück weit widerlegen, die durch architektonische Atavismen den Bedeutungsraum der Stadt gefährdet sieht. Gerade das neue, die Bauten des postmodernen Funktionalismus, wie Welsch es nennt, und deren Hyposignifikatssystem, laufen Gefahr ‚bedeutungslos’ zu werden, laufen Gefahr, die eigentliche Hauptbedeutung der Stadt, nämlich als Lebensraum einzubüssen.
Dennoch kann der Ich-Erzähler in Houellebecqs Roman vor seinen sozialen Kontakten nicht zugeben, dass er die Orientierung in der Stadt verloren hat. Obwohl die Unübersichtlichkeit der Stadt nicht das Verschulden der Hauptfigur ist, wird die Verantwortung auf das Individuum übertragen, wie ich das im Kapitel „Individualisierung sozialer Ungleichheit“ mit Beck zu zeigen versucht habe. Gesellschaftliche Probleme werden individualisiert.
Der Lösungsweg, den die Figur einschlägt, ist ein Verbrechen. Es wird das Verbre- chen des Diebstahls des Wagens fingiert, um nicht die peinliche Wahrheit bekannt geben zu müssen. Mit dieser kleinen Lüge wird er aber selbst zum Verbrecher, zum Versicherungsbetrüger, dennoch ist das besser als sich dem Spott und der Schande auszuliefern. Daran kann man das Motiv für die in den Kapiteln Modernisierung und Domestizierung beschriebenen Selbstkontrollen der Menschen ersehen: Es ist der soziale Druck, und die damit verbundene gegenseitige Kontrolle der einzelnen Indi- viduen. Sozusagen eine Stasi ohne Institution. Diese wacht auch nicht über einen Staatsapparat, sondern über ein bürgerliches Ideal. Der Kontrollmechanismus eines bestimmten Verhaltenskodex ist in den Köpfen der Individuen, ein festgeschriebenes Programm, das genau festlegt, was man darf, kann, muss oder nicht darf.
„Urba oecomomica“
Barthes kennzeichnet einen Wandel von der Antike zu unserer Epoche, nämlich, dass in der Antike lediglich eine bedeutungsbezogene Auffassung der Stadt vorherrschte, nicht wie heute eine Unterteilung der Stadt in Funktionen und Nutzungen. Auch hier soll eine wissenschaftliche Parallele mehr Klarheit verschaffen: Ähnlich wie Barthes die Stadt in ihrer Bedeutung dadurch gefährdet sieht, dass man sie auf ihre Funktio- nen und verschiedenen Bereiche beschränkt und zerlegt, sieht auch M. Foucault den Menschen eben durch seine Erforschung und Segmentierung durch die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen gefährdet. Dennoch bestehen auch heute noch semantisier- te Stadträume. Ein besonders starkes Beispiel ist das von Barthes angeführte Rom. Hier treten semantisierte Relikte der Geschichte in Konflikt mit der funktionalen Bauweise und Nutzung der Stadt. Dieser Konflikt aber ist es, der den Städten ihr Gesicht verleiht. Dadurch entsteht ein Konflikt zwischen Vernunft und Bedeutung. Mit ‚Vernunft’ meint Barthes meines Erachtens reine Funktionalität. Eine Ausrich- tung, die man im Bereich des Subjektes als „Homo oeconomicus“ bezeichnen würde, einem Menschen, der in allem seinen ökonomischen Handelungen eine absolut ratio- nale, eben durch und durch vernünftige Entscheidung trifft und sich in keiner Weise von Emotionen leiten lässt. Dieser Mensch ist eine wirtschaftswissenschaftliche Uto- pie. Eine derartige Ausrichtung wirft, wie bereits gesagt Choay modernen Städten vor, indem er eine Monosemie auf „technologisch-ökonomischen Produktionsweise“ (Choay 54) feststellt.
Folgte man nur den ‚vernünftigen’ Stadtplänen, so sähen alle Städte mehr oder weni- ger gleich aus. Das, wodurch Choay die Städte zum Anachronismus verdammt sieht, erhält schließlich eine Bedeutung der Stadt, auch jenseits eines hyposignifikanten Systems. Ich sehe das weniger als eine Verdammung zum Anachronismus als eine Verdammung zur Menschlichkeit und gerade dadurch ergibt sich die Fähigkeit zur Signifikanz.
Die unterschiedliche Gewichtung der Interessensschwerpunkte der Forschung Mensch und seine Residentien wird auf begrifflicher Ebene ersichtlich: Im Falle des Menschen gibt es den Begriff des Homo oeconomicus als „Ideal“; für eine durch und durch rationale Stadt gibt es keinen derartigen Begriff. Vielleicht ist hier der Richtige Ort, um einen solchen vorzuschlagen: „Urbs oecomomicus“. Doch wird auch diese „Urbs oecomomicus“, wie ihr subjektives Korrelat Utopie bleiben:
Coupland
Das folgende Zitat aus Couplands „Shampoo Planet“ bringt mein Argument, dass die von mir getaufte „Urbs oecomomicus“ utopisch bleibt, ins Wanken.
Ich sollte erklären was eine Zukunftsstadt ist. Zukunftsstädte liegen in den Randbezirken der Stadt, in der du lebst, gerade eben außer Reichweite des wü- tenden, fackelschwingende Mobs, der aus der Innenstadt heraus hier einfallen könnte. Du sollst Zukunftsstädte gar nicht bemerken - sie sind im Prinzip un- sichtbar: Niedrige, flache Gebäude, die aussehen, als hätte man sie gerade ei- nem Laserdrucker entnommen; fetischistische Landschaftsgestaltung; aus- schließlich neue Autos auf den Angestelltenparkplätzen; kleine von hinten be- leuchtete Plexiglas-Totems auf der Außenfront kennzeichnen die merkwürdi- gen, allen möglichen Sprachen entspringenden Namen der Unternehmen, die sie behausen: Cray. Hoechst. Dow. [...]. Die Zukunftsstädte in Europa sind die gleichen wie die in Kalifornien. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf dem gan- zen Planeten gleich sind. Zukunftsstädte sind wie eigenständige kleine Länder, die man anderen Ländern aufgepfropft hat. (Coupland 219)54
In diesem Zitat wird zum einen die Globalität, und die quasi computergenaue, dem Laserdrucker entnommene Architektur, also die Reproduzierbarkeit des Städtischen Raumes benannt. Eine Globalität, die wie im Kapitel Isolation der Weltgesellschaft gezeigt werden wird, Nationalstaaten zu unterwandern im Stande ist. Dieser Neue Raum entspricht zu hundert Prozent dem, was Choay mit Monosemie auf Ökonomie meint. Um sich dem Volkszorn zu entziehen, wird das Zentrum der Stadt gemieden, wird dieser Raum für die Öffentlichkeit unbegehbar55, und durch diese Unbegehbar keit bekommt die Globalisierung der so genannten Zukunftsstadt imperialen Charak- ter. Hier also ein weiterer Hinweis, auf totalitäre Konzepte aus der Privatwirtschaft. Die Gebäue erhalten ihre Bedeutung und scheinbare Funktion alleine aus den Fir- menlogos56:
Es wird hingegen immer deutlicher, dass eine Stadt nicht ein Gewebe aus gleichwertigen Elementen ist, deren Funktionen sich inventarisieren lassen, sondern ein Gewebe aus starken und neutralen Elementen oder wie die Linguis- ten sagen aus markierten und unmarkierten Elementen. (Barthes 36)
Der Konflikt geht weiter: Nicht nur zwischen markierten und unmarkierten Räumen, sondern auch auf der Ebene der Schrift: Barthes liest ein Kapitel des „Glöckner von Notre Dame“ als Gegensatz zwischen der Schrift, die auf Papier geschrieben steht und der Schrift, die in Stein gesetzt ist. Die eine werde die andere auslöschen (Celui- ca tuera celui-la).
Ich glaube nicht, dass die Schrift auf ‘Papier’ in der Lage ist die steinernen Lettern der Stadt auszulöschen, oder umgekehrt. Vielmehr scheint hier eine gegenseitige Überschreibung, oder besser gegenseitige Einschreibung stattzufinden, wie Choay und vor allem Butor, mit den verschiedenen Texten der Stadt feststellen. Der Urbanist Kevin Lynch57hat laut Roland Barthes festgestellt, dass jede Stadt, sobald sie vom Menschen bewohnt wird, diesen Rhythmus von markierten und nichtmarkierten Elementen hat. Folgt man Choay, so kann dieser Rhythmus nur in hyposignifikanten Stadtsystemen auftreten, denn in reinen Stadtsystemen, also in Orten, besteht kein unsemiotisierter Raum. Diese Bedeutung kann auch im krassen Gegensatz zum objektiven Sachverhalt der Stadt stehen. Eine Aussage Stierles kann vielleicht diesen Rhythmus näher spezifizieren: „Die große Stadt ist jener semioti- sche Raum, wo keine Materialität unsemiotisiert bleibt“ (Stierle 14)58. Stierle veran- kert auf jeden Fall die Semiotik der Stadt in der baulichen Materie, ob er damit dem nichtbebauten Raum Bedeutung abspricht, glaube ich nicht behaupten zu können.59
Die Stadt ist eine Mitteilung, und diese Mitteilung ist echt Sprache: die Stadt spricht zu ihren Bewohnern, wir sprechen unsere Stadt, die Stadt in der wir uns befinden; wir sprechen sie ganz einfach, indem wir sie bewohnen, in ihr herum- laufen, sie betrachten. Dabei besteht das Problem allerdings darin, einen Aus- druck wie „Sprache der Stadt“ über das rein metaphorische Stadium hinauszu- heben. [...] Der eigentliche wissenschaftliche Sprung ist erst dann geschafft, wenn man von der Sprache der Stadt ohne Metapher sprechen kann. [...] Wie kommen wir von der Metapher zur Analyse, wenn wir von der Sprache der Stadt sprechen? (Barthes 37)
Dies sei bei Freud geschehen, der als erster „die Sprache der Träume“ von ihrem metaphorischen Ballast befreit hat, um mit ihr eine reale Sprache zu sprechen. So ist die Diskussion um die Stadt als Text einem Bild entsprungen. Dieses Bild hat sich zur Wissenschaftlichen Fragestellung ‚hochgearbeitet’.
Die Art und Weise wie Barthes die Sprache der Stadt charakterisiert - entlastet man den Ausspruch für kurze Zeit seines metaphorischen Gehhalts - impliziert für mein Verständnis die ‚Natürlichkeit der Zeichen der Stadt’. Eine Stadt sagt: Hier bin ich, wie ein Baum sagt „Baum“. Die Stadt, - genau wie der Rauch des brennenden Baumes Zeichen für Feuer ist - ist Symbol und Referenz zugleich. Die Bauwerke einer Stadt sagen: Hier ist eine Stadt, genau wie der Text einer Stadt sagt: hier ist eine Stadt. Mit der Frage nach der Sprache der Stadt stellt sich auch die Frage nach der Form (der Sprache) der Stadt. Vielleicht kann die Folgenden Sequenz in die Frage nach der Form/Sprache der Stadt etwas Licht hineinbringen:
Indem wir diesen Fall verallgemeinern, könnten wir den Schluss ziehen, dass alle Formen ihre Kraft in sich selber tragen und nicht einen mutmaßlichen ‚In- halt’. Das stände im Einklang mit der These Benedetto Croces; schon Pater be- tonte im Jahre 1877, dass alle Künste den Zustand der Musik erstreben, die nichts als Form ist. Die Musik, die Zustände des Glücks, die Mythologie, die von der Zeit gewirkten Gesichter, gewisse Dämmerungen und gewisse Orte wollen uns etwas sagen oder haben uns etwas gesagt, was wir nicht hätten ver- lieren dürfen, oder schicken sich an, uns etwas zu sagen; dieses Bevorstehen ei- ner Offenbarung, zu der es nicht kommt, ist vielleicht der ästhetische Vorgang. (Borges 14)60.
Aber die Stadt ist weit davon entfernt, reine Form zu sein. Allein durch die Stellung in der Stadt, also in der Syntax der Stadt, können heute die Bauwerke ihren semioti tlich keinen unmarkierten Raum, da der unmarkierte Raum im Gegensatz zum markierten seinen Wert negativ über den festgelegten Wert des markierten Raumes bekommt. Vgl: Calculus of Indication/Crossing. George Spencer Brown: Laws of Form, London 1969.).
schen Wert nicht mehr aufrechterhalten, wie gezeigt werden konnte61. Sie erhalten ihren semantischen Gehalt nicht mehr nur durch die Stellung in der Stadt. Andere Orientierungssysteme wurden nötig; die hyposignifikanten Systeme haben die bauliche Struktur abgelöst und z.T. ersetzt. Eine Orientierung in modernen Städten ohne Schrift, d.h. Straßenschildern ist kaum vorstellbar.
In ihrer Funktion sozialer Integration sind sie durch neue Systeme wie den Buchdruck und die Telekommunikation abgelöst worden, deren Entwicklung zugleich Ursache und Folge des Verhaltens gebauter Systeme ist. Wo das gebaute System nicht mehr globaler Referent für das Individuum ist; setzt der Ü- bergang vom Ort zum Raum ein. (Choay 51)
Damit wiederspricht Choay der saussureschen Analogie von Sprache und Stadt, der die Bedeutung einer Straße in ihrer Funktion begründet sieht62. Choay erkennt die konstitutive Bedeutung medialer Systeme, wie Buchdruck, Print- und anderer Me- dien für die Stadt. Ich glaube sagen zu können, dass sich die Stadt unserer Tage zu einem Großteil der Medien bedient, um überhaupt noch als sinnvolle Einheit begrif- fen werden zu können. Und so erklärt sich vielleicht auch die vielbeschworene These der Literaturwissenschaft, dass sich die Stadterzählung in der Krise befindet. Stadt- beschreibungen sind vielleicht heute so interessant wie die Beschreibung einer Lese- erfahrung eines Groschenromans. Fiktion lebt ja von Übertragung von einer Ebene in einer andere, - etwa der ‚Realität’ in Text im Falle des Romans - . Im Falle der Groß- stadt kann diese Übertragung oft nicht mehr geleistet werden. Denn was ist die Ab- bildung von Text in Text? Der Krise des Erzählens folgt die Krise des Lesens. So kann man in der Großstadtliteratur neueren Datums auch eine Verschiebung feststel- len: Die Stadt tritt als ‚Protagonist’ meist nicht mehr in Aktion. Die Handlungen spielen zwar meistens innerhalb von Großstädten, doch spielt das urbane Umfeld keine Rolle mehr, greift nicht gestaltend in die Fiktionen ein. Entweder man meidet die Stadt, flieht aus ihr, wie Judith Herrmanns Stadtflüchtlinge. Oder Räume werden gegeneinander austauschbar, es spielt plötzlich keine Rolle mehr wo man ist. Alle diese Beobachtungen widersprechen einer ‚Erzählbarkeit’ der Stadt63. Mit der zu- nehmenden Urbanisierung unserer Welt gerät nicht nur die Großstadtliteratur in die Krise, sondern reißt alle anderen Literaturgattungen auch mit sich.
Führt man sich nun Choays Fragestellung noch einmal vor Augen:
Kann sie [die Stadt] als ein nichtverbales System signifikanter Elemente be- trachtet werden, dessen Strukturen mit den Strukturen der anderen gesellschaft- lichen Produkte und Handlungen in Zusammenhang stehen? (Choay 43)
Dann bleibt festzustellen, dass man die Stadt, will man sie als Ganzes betrachten, schwerlich als nonverbales System signifikanter Elemente gesehen werden kann. Vielmehr treten in der Stadt eine Reihe von signifikanten Systemen zusammen, unter anderem auch eben verbale Systeme, und vor allem mediale Systeme. Durch den Rückbezug der Bedeutungsfindung der Stadt auf Medien wird auch die Frage Cho- ays, ob die Stadt durch die alten Bauelemente zu einem Anachronismus verdammt ist, irrelevant. Denn wie ich auch in den Kapiteln über Medienkultur und dem Kapi- tel ‚Inszenierung der Stadt’ zu zeigen versuche, ist die Realität der Stadt extrem von den Diskursen über sie abhängig.
Es scheint also zwei Lager von Stadtsemiotikern zu geben: Die einen, wie Saussure, scheinen in der Stadt ein rein syntaktisches System zu sehen. Saussure betrachtet die Straße einer Stadt abhängig von den Relationen, in der sie sich befindet. Andere wie Butor sehen in der Stadt auch eine gewisse Semantik, nicht zuletzt über andere syn- taktische Systeme gewährleistet. Damit ist sowohl Text über als auch in der Stadt gemeint.
Wie gezeigt werden konnte, ist aber die Stadt kein ausschließlich syntaktisches System. Die Stadt ist vor allem auch durch Semantik gekennzeichnet. Die Stadt muss sozusagen auch inhaltliche Aussagen machen64, nicht zuletzt auch, um die Syntax der Stadt aufrechtzuerhalten.
Mimesis der Stadt
Zieht man die Diskurse über die Stadt und die Literarisierungen, die nach der Mei- nung Igenschays wiederum neue städtische Fakten schaffen zur Gesamtansicht der Stadt hinzu, so wird ein rein nonverbales Signifikanzsystem immer unwahrscheinlicher. Inszenierte Stadtimages können außerdem auf rein verbalen Signifikanzsystemen, also auf Sprache basieren. Dennoch kann man die Notwendigkeit von nonverbalen Signifikanzsystemen nicht wegleugnen.
Du sollst Dir kein Bild von mir machen
Die Analogie von „urban landscapes“ und „literary composition“ und die „dekonstruktivistische“ Überblendung von Stadt-Text und der literarischen Ausarbeitung des Stadttextes bringen laut Hassauer eben so viele Interpretationen hervor, wie sie Leser haben. (Hassauer 72)65.
„Metropolis unterliegt dem Bezeichnungs- und Benennungsverbot“ (Hassauer 72). Die Stadt hat scheinbar ein Bilderverbot:
„Alles der Funktion fürs Subjekt [unterworfen] - aber gegen die empirischen Subjek- te“ (Hassauer 72) gerichtet, erschafft die Neue Sachlichkeit so „kollektive Weltein- richtung [...] gegen jeden unmittelbaren Subjektausdruck“ (Bolz: 1992, 74f)66.
Dass das vielzitierte „Palimpsest“(Sharpe/Wallock: 1987) des ‘Stadttextes’ trotz hektischer Signifizierungspraktiken und wuchernder Interpretationen ge- rade keine Sinn-Bilder von urbanen Identitätsmodellen mehr liefert und nicht mehr von emphatisch begriffenen Leser-Subjekten begriffen werden kann. (Hassauer 72)
Eine nicht repräsentationale Semiotisierung der Stadt: Vielfalt der Codes, Einfalt des Textes?
Ob Bilderflut oder Bildersturm über die Stadt, ob ikonophile oder ikonophobe Wahrnehmungs- und Deutungsmuster - die Absage an die Mimesis- Vorstellungen von ‘Abbildung’ und ‘Repräsentation’ einer ‘Realität’ der Stadt im Text ist in jedem Fall auch ohne die pansemiotische Vereinheitlichung ver- schiedenster Wahrnehmungscodes unter der Zentralmetapher der Schrift auf die ‘Stadt’ als Text oder gar unter der Zentralmetapher des neuzeitlichen ästheti- schen Einsatzes von Schrift auf die ‘Stadt als literarischer’ Text argumentierbar. (Hassauer 73)
Trotz der Auslöschung des Individuellen behält das Argument der städtischen Metaphorisierung der Stadt als Text seine Berechtigung. Hassauer stellt auch für eine simulierte, virtuelle Stadt67die Abbildbarkeit in Frage, und das, obwohl die textualisierte Stadt gerade Abbild zu sein scheint68. So kann auch eine Simulierung keine Stadteinheit rekomponieren.
Valérys Einsicht, dass die Stadt die Struktur des Bewusstseins hat, führt ihren Urheber, wie Stierle gezeigt hat, zu der Unschuld eines Verständnisses, demzu- folge Stadt noch direkt intellegibel ist und demzufolge dem Bewusstsein [...] die Stadt als Bewusstsein unmittelbar antwortet, demzufolge Stadt noch direkt intellegibel ist und demzufolge das Bewusstsein nicht des Umweges der Zei- chen bedarf. Für alle anderen ist jedoch nach dem Sündenfall der Semiotisie- rung die Große Stadt [...] jener semiotische Raum, wo keine Materialität unse- miotisiert bleibt. (Hassauer 74)
Diese Semiotisierung der Stadt kann auch außerhalb der „Alleinherrschaft der Text- metapher“ (Hassauer 74) gedacht werden. Man muss auch nicht die Lesbarkeit der Welt fordern.
Angesichts des längst etablierten Reflexionspotentials über Medialisierung und Historisierung des Textstatus nach dem Ende der Gutenberg - Galaxis wird die systematische Fortschreibung der historischen Denkform der wechselseitigen Erhellung des ‘Buchs der Welt’ durch das ‘Buch der Bücher’, wird die Genera- lisierung der degeneralisierten Gleichung von Weltsinn und Schriftsinn, von ‘Sinn’ und ‘Text’, von ‘Sinn bilden’ und ‘lesen’ obsolet. (Hassauer 74)
Hassauer will im obigem Zitat das latent konnotierte Missverständnis ausräumen, dass es sich in einer textualisierten Umwelt lebt wie in einem Buch. Sie will vermutlich darlegen, dass im Falle der Textualisierung der Stadt, die Stadt nicht lesbar wird wie ein Buch, keinen vergleichbaren Sinngehalt wie ein abgeschlossener Text hat. Die Metapher des „Text der Stadt“ meint daher nicht die Lesbarkeit, sondern die Virtualität der Stadt. Die Interpretation einer Stadt, ist genau wie die Interpretation eines Textes dem subjektivem Verständnis und den kognitiven Strukturen des Interpretanten, oder besser Lesers unterworfen.
So schleppt gerade die Leitmetapher ‘Palimpsest’ in exemplarischer Weise gänzlich unkontrolliert diese schriftkulturelle Folgelast mit und zusätzlich noch die spezifische Folgelast der Manuskriptschriftlichkeit mit ihren nicht auf ande- re Epochen analogisierbaren Implikationen für Schriftbesitz, Schriftkompetenz und Schriftwürdigkeit. Ist der Zugriff auf Realität aus erkenntnistheoretischen Gründen also immer nur über bereits codierte Wahrnehmung, über unterschied- lichste Formen der Semiotisierung, als Konstruktion von Wirklichkeit möglich, so greift Großstadtliteratur als Sonderfall textueller Semiotisierung unter ästhe- tischen Bedingungen [...] auf einen Sonderfundus, den Fundus intertextueller Codierungen zurück. [...] Rückgriff hingegen in großen Maßstab auf Wahrneh- mungen von Wahrnehmung von Stadt; Beobachtungen zweiter Ordnung, Beo- bachtung imaginärer Realität, Referenz nicht auf die Städte, sondern auf die Städtebilder. (Hassauer 74 f)
Ich denke, dass es nicht möglich ist, Zugriff auf die Realität der Stadt ohne bereits codierte Wahrnehmung zurück greifen zu müssen. Was Hassauer als ‚Sonderfall’ bezeichnet, glaube ich, ist der Regelfall. Dieses Zitat impliziert in gewisser Weise die Thesen des radikalen Konstruktivismus. Er stellt eine Beeinflussung etwa der visuel- len Wahrnehmung, durch vorgängiges Wissen fest. Wir machen also nie ‚unschuldi- ge’ Wahrnehmungen, sondern unser Erkennen muss als Erkennen auf einen kulturel- len Körper hin gedacht werden.
Diese Metaebene der Referenz gilt laut Hassauer nicht nur für künstlerischen, sondern auch für Wissenschaftliche Großstadtdiskurse.
Problematisch sind diese, eigentlich einleuchtende Annahmen Hassauers, in der Hinsicht, wie sie eingangs erwähnt, dass dieser referentielle Rückbezug auf bereits codierte Wahrnehmungen für jede empirische Wahrnehmung und nicht nur für Stadtwahrnehmungen gilt.
Will man also tatsächlich die Realität der Stadt erkennen, steht man vor ähnlichen Problemen wie bei der Frage: Was ist der Mensch, oder was hält die Welt in ihrem Innersten zusammen. Ist die Realitätserfahrung einer Stadt authentischer, wenn sie die eines Anderen ist?
Zentrum/Peripherie.
Mehr oder weniger mündliche Viertel, mehr oder weniger schriftliche; das Zentrum bildet einen Gegensatz zu den Vorstädten, doch dieser Gegensatz ist nur die Verlagerung nach innen des anderen grundsätzlichen Gegensatzes zwischen Stadt und Land. (Butor, 19)
Butor leitet aus dem Gegensatz von Stadt und Land unter anderem eine Metaphori- sierung von Oralität und Schriftlichkeit ab. Parallel dazu wird der Gegensatz Sakra les und Profanes gedacht. Im Tempel sieht Butor die erste Anhäufung von Text69. So bekommt die Textualität der Stadt bei Butor eine theologische Komponente. Ein Einwand gegen Butor: In keltischen Kulturen war Sakrales von strikter Oralität ge- kennzeichnet. Der Schamane gab sein Wissen nur oral weiter, es war zu heilig, als dass man es der Schrift überlassen hätte dürfen. Denn das hieße, die Kontrolle über den Träger des Wissens herzugeben. Aus der Perspektive der schriftliche Kultur ist seine Behauptung sicherlich richtig; dennoch: Butors Sichtweise muss sich den Vor- wurf des Eurozentrismus, im Sinne einer schriftlichen Kultur, gefallen lassen.
Solange Polytheismus herrscht, das heißt solange die Stadt in ihrem Schoß die Vertretungen anderer gleichwertiger Zentren akzeptiert, ihrer Sprachen und Sti- le, die sich Götter-Ideogrammen einschreiben, kann es Gleichgewicht und Frie- den geben, doch wenn der Gott unduldsam und „eifersüchtig“ wird, wenn er neben seinem Tempel keinen anderen mehr duldet, wird er ihn auch in der Fer- ne nicht mehr dulden, führt das zwangsläufig zu einem Imperialismus. Man muss den Weg über ihn gehen: Es ist der Weg, der einzige Weg.70(Butor 21)
Butor verknüpft, wie in dem obigen Zitat ersichtlich, Theologisches mit Machtstruk- turen. Man kann den Polytheismus im Zitat aber auch nicht nur als Religionsvielfalt betrachten, sondern als Metapher für eine pluralistische Gesellschaft. Butors Überlegungen erfahren in Tim Staffels Roman „Terrordrom“ eine erstaunli- che literarische Manifestation. Gerade die Bildhaft für Herrschaftsverhältnisse ange- sprochene Zentrum der Stadt. Die Unbegehbarkeit des Zentrums verweist für Butor auf imperialistische Herrschaftsstrukturen. Dabei kommt der Stadt mehr zu, als blo- ßes Konglomerat von Wohnungen zu sein: sie fungiert hier - wie so oft - als Spiegel der Gesellschaft.
Staffel
Staffel ‚baut’ eine Fiktion, die auf erschreckende Art und Weise Butors Überlegun- gen widerspiegelt. „Der Verlag, die Festung unmittelbar vor der Mauer. Die Mauer klammert aus“ (Staffel 211)71. Bemerkenswert an Staffels Terrordrom ist, dass die Versiegelung des Zentrums der Neuen Hauptstadt Deutschlands von einem privaten Fernsehsender veranlasst wird. Diese Isolation des Zentrums kann man wiederum als Metapher betrachten. Zentrale Referenz der Gesellschaft, das neue Zentrum der BRD sind keine demokratischen Institutionen mehr, sondern es ist der Markt der neuen Medien: Scheinbare Bedürfnisse der Bevölkerung werden in V.´s Terrordrom scheinbar befriedigt.
Interessant, dass die „Festung“ des Senders eine weitere Festung im Inneren bekommt: Im Zentrum der Stadt. Dies kann als Machtübernahme des „Senders“ über die politischen Strukturen der BRD gesehen werden. Bemühen wir noch ein mal Butors unbegehbares Zentrum der Stadt; er sieht eine derartige städtische Struktur als Symptom einer imperialistischen Gesellschaft. So kann man vielleicht Staffels Fiktion als Aussage über imperialistische Strukturen in unserer „pluralen“ Gesellschaft lesen. Diese imperialen Strukturen werden aber nicht von politisch agierenden Gruppen geleistet, sondern kommen aus der privaten Wirtschaft.
Das begehbare Zentrum der Stadt, die hier als Metapher der Gesellschaft dienen kann, ist wiederum Sinnbild für eine demokratische Gesellschaft, das Zentrum ist von jedermann zu betreten, das impliziert in gewisser Weise ein gewisses Maß an Mitbestimmung:
Die höchste Autorität kann dann das Zentrum verlassen, wie es in Frankreich im 17. Jahrhundert geschehen ist, als Versailles geschaffen wurde, um dem Pa- riser Tumult zu entgehen, ein Beispiel, dem viele andere Nationen gefolgt sind. Damit hat sich eine Umkehrung vollzogen: um die Autorität zu konsultieren, begibt man sich nicht mehr ins Zentrum der Stadt, man verlässt es. (Butor, 24)
In einer ähnlichen Situation wie der französische Adel im 17. Jahrhundert befindet sich auch die demokratische Regierung; wobei Staffel in seinem Roman explizit kei- ne Staatsform nennt, die der urbanen Gesellschaft seines Buches zugrunde liegt. An die Stelle des neuen Bundestages tritt die vermeintliche Selbstschau der Terror- Reality-Show. Die Eskalation ist unter Kontrolle gebracht. Die Verteidigung über- nehmen Berufssoldaten aus dem Bundesministerium für Verteidigung. Somit ist die „öffentliche“ Ordnung, die zunächst durch das Chaos der Stadt und korrupte Beamte unterminiert wurde, wieder hergestellt. Durch die Verwaltung des Terrordroms ist der Widerstand der Bevölkerung ‚verstummt’: „Aller Widerstand zusammengefasst. Im Terrordrom“ (Staffel 209). Der Widerstand ist kein Widerstand mehr. Was zu- nächst ein Befreiungsversuch der Bevölkerung sein soll, wird umgemünzt in ein neu es Kontrollmoment. Eine architektonische wie ideologische Manifestation einer „Technologie“, an der sich Hass und Frustration der Bevölkerung entladen soll: Ein demokratischer Blitzableiter.
Das Zentrum der Stadt erscheint in den butorschen Überlegungen auch als Zentrum der Staatsmacht. Verlässt diese das Zentrum, wird die Semiotik der Stadt unrein, bedarf es eines „hyposignifikanten Systems“ um die Bedeutung oder Lesbarkeit der Stadt aufrecht zu erhalten. In modernen Gesellschaften wird dieses zusätzliche Signi- fikanzsystem immer mehr - vor allem von elektronischen - Medien übernommen und geleistet. Mehnert ist in Staffels Roman Repräsentant dieser Medien. Er wird aber als Kollaborateur dargestellt. Er ist mehr Manipulateur und Verschleierer als ein verant- wortungsvoller Journalist, der aufklärt. Eine erstaunliche Parallele zum Terrordrom kann man Beispielsweise bei den Schlachten um den Castortransport beobachten. Auch hier konzentriert sich der Widerstand der Atomgegner, zeitlich wie räumlich, an einem Ort. Und zugleich ist eine Legion von Sicherheitsbeamten vor Ort, um den Widerstand einzudämmen. Der einzige Unterschied von Gorleben und dem staffel- schen Berlin ist, dass Gorleben Peripherie ist und nicht Zentrum.
Zentren und periphere Blicke
„Henri Lefébvre sucht das Städtische (als virtuelles Objekt) im Wechselspiel von Isotopien, Utopien und Heterotopien zu fassen und bezeichnet dabei die Stadt als „differenziellen Raum“, in welchem prinzipiell Peripheres und Zentrales gleichwertig werden. Das sich durchsetzende Bewusstsein von der Unzulänglichkeit der wortwörtlichen Stadtsymbolik bringt gerade die Lesbarkeit des innerstädtischen Zentrums in die Krise und generiert damit jene Ästhetik des Randgebiets.
Im Zeichen solcher Randgebietsästhetik erfahren jene städtischen Räume eine Auf- wertung, „die die sonderbare Eigenschaft haben, sich auf alle anderen Platzierungen zu beziehen, aber so, dass sie die von diesen bezeichneten oder reflektierten Verhält- nisse suspendieren, neutralisieren oder umkehren“ (Leenhardt 3872, zit. nach Igen- schay, 11), also jene Räume, die Michel Foucault als „Heterotopien“73bezeichnet Die Stadtbeschreibungen, die von einer peripheren Perspektive ausgehen, neutralisieren nach Meinung Igenschays die Unsemiotisierbarkeit des „innerurbanen Raums“ (Igenschay, 11)74.
Der Blick aus der Peripherie übernimmt sozusagen die Perspektive des archimedischen Punktes, die Schau von oben (vgl. Scherpe75/Fischer76)77. Die Stadt ist von ihrem Zentrum alleine nicht mehr beschreibbar. Diesen peripheren Blick macht Igenschay vor allem in Retrospektiven und Erinnerungen aus. In dem Rückerinnern wird eine Heimatlosigkeit beschrieben.
Ein anderes Stilmittel für die Stadterzählung ist der Blick des Fremden. Um dem Autor eine eigene Sicht auf die Stadt zu ermöglichen, wird in Romanen gerne der Protagonist mit dem frischen Blick eingeführt. Franz Biberkopf kommt aus dem Ge- fängnis und verfügt somit über das, was Igenschay den peripheren Blick 1 nennt. In Özdamars Roman „Die Brücke vom Goldenen Horn“ hat die Erzählerin in zweifa- cher Hinsicht einen peripheren Blick: 1. Sie kommt neu in die Stadt Berlin, 2. Sie spricht nicht die Sprache der Stadt, Deutsch: So zeigt die Autorin auf eindrucksvolle Weise, wie eng Sprache und Stadt verwoben sind. In einem parallelen Prozess er- kundet die Heldin Berlin und die deutsche Sprache. Dabei kommt der Medialität der Stadt eine ganz zentrale Rolle zu. Sie lernt unter anderem anhand dessen, was wir als echten Text der Stadt, als die ‚Medialität’ der Stadt bezeichnen würden: Den Schlag- zeilen der Zeitungskästen die Sprache. So lernt die Heldin mit der Stadt die Sprache kennen.
Die Entwicklung der Stadt ist zugleich die Entwicklung der Hinsichten auf sie.
Die topographische, topologische Erfassung beschränkt sich ja nie auf „Reales“, „Objektives“, sondern ruft unmittelbar ein Metaphernnetz auf den Plan: in Hugos Paris wiederholt die Ablösung von Stein durch Eisen den Paradigmenwechsel des Buchdrucks. (Igenschay, S. 10)
Aber auch im Falle des städtischen Neulings, - betrachten wir das obige Zitat - ist es nicht möglich eine phänomenologische, also unvoreingenommene Sicht auf die Stadt zu gewinnen. Als zeigt sich in Igenschays Zitat, was Hassauer auch behauptet: Der Blick auf die Stadt ist immer ‚vorbelastet’. Vorkonstruiert von Klischees und ‚Mythen’ der Stadt, die sich nicht zuletzt auch auf die Wahrnehmung auswirken.
Houellebecq
Der Held in „Ausweitung der Kampfzone“ kommt aus beruflichen Gründen in die französische Provinzstadt Rouen. Sein peripherer Blick ist der eines Fremden, der durch die Straßen schlendert. Butor schreibt, dass das Zentrum der Stadt mit ihren Randbezirken, eine Abbildung im Binnenbereich der Stadt, der Spannung von Stadt und Provinz ist.
Der Ich-Erzähler zeichnet diese Spannung nach, er stammt eigentlich aus Paris, dem Sinnbild für ein städtisches Zentrum, und betritt den alten Markt, das Zentrum der Stadt Rouen.
Ohne zu zögern, gehe ich auf den Alten Markt. Das ist ein ziemlich großer, ringsum von Cafés, Restaurants und Luxusgeschäften gesäumter Platz. Hier wurde vor mehr als fünfhundert Jahren Jeanne d´Arc verbrannt. Zum Gedenken an das Ereignis hat man eine Anhäufung von bizarr gekrümmten Betonplatten errichtet, die aus dem Boden ragen und sich bei genauerem Hinsehen als Kirche erweisen. (Houellebecq 70)
Um in das Zentrum der Stadt zu gelangen muss sich der Protagonist in die Provinz begeben, wo nicht alle Straßen Marcel heißen. Paris war nicht semiotisierbar, wie es heißt. Erst im Zusammenspiel mit ‚Anachronismen’ wie es Choay sagen würde ge- lingt es, ein Zentrum auszumachen. Also, auch hier ein Gegenargument gegen Cho- ays These, dass alte Bausubstanz die Stadt zur Bedeutungslosigkeit verbannt, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Durch den Rückgriff auf die Historie, in diesem Fall mit dem Denkmal der Jeanne D´Arc und der alten Stadtstruktur, bekommt der Platz Sinn und ist mehr als ein funktioneller Raum. Erstaunlicherweise steht in der Mitte des Platzes das Symbol einer Kirche. Dies könnte ein Hinweis auf das zentrale Wer- tesystem der provinzurbanen Stadtbevölkerung sein. Doch das Treiben auf dem Platz zeigt, dass die Bevölkerung mehr auf Konsum ausgerichtet ist. Dennoch scheinen sie zufrieden. (Houellebecq 70f).
Aber auch der Periphere Blick des Erzählers kann keine adäquate Sicht der Dinge erreichen.
Entschlossen, mir Klarheit zu verschaffen, setze ich mich auf eine der Betonplatten. Es wäre durchaus denkbar, dass dieser Platz das Herz, der Mittelpunkt der Stadt ist. Was wird hier eigentlich gespielt? (Houellebecq 70)
Wie Simmel seine Großstadtsoziologie damit begründet, dass die Stadt in besonderer Weise geeignet ist, Beobachtungen der Gesellschaft als solcher anzustellen, kann vielleicht auch an dieser Stelle, die Stadt als Metapher für die Gesellschaft dienen. Houellebecq analysiert die Passanten auf dem Platz:
Ich beobachte zuerst, dass sich Leute meist in Banden oder kleinen Gruppen von zwei bis sechs Personen fortbewegen. Keine Gruppe scheint der anderen zu gleichen. Offenbar sind sie einander ähnlich, sie ähneln einander sogar beträchtlich, aber diese Ähnlichkeit kann man nicht als Gleichheit bezeichnen. Es ist, als ginge es ihnen darum, den Antagonismus zu veranschaulichen, der notwendigerweise mit jeder Art von Individuation verbunden ist: kleine Unter- schiede der Körperhaltung, der Bewegungsweise und der Art, wie man dem an- dern begegnet. (Houellebecq 70)
Auffällig an der obigen Sequenz, ist, dass keine Einzelpersonen auf dem Platz auftre- ten. Dies könnte ein Hinweis auf Krakauers Konzept des Ornaments der Masse sein. Aber nicht der Beobachter erkennt Muster in der Masse, sondern die Individuen ge- ben sozusagen ihre Individualität auf, um sich in kleine Gruppen zusammenzuschlie- ßen. Der Modus des Beobachtens der Masse und die damit verbundene Komplexi- tätsreduktion, ist kein Beobachtungsmodus mehr, sondern wird zum Zielpunkt der Ausrichtung sozialen Handelns. Diese Handlung wird nur vom Beobachter als Prob- lem empfunden.
Dann stellte ich fest, dass alle diese Leute zufrieden mit sich und der Welt sind; das ist erstaunlich, sogar ein wenig erschreckend. [...] Einige von den Jüngeren tragen Lederjacken mit wüsten Hard-Rock-Motiven; man kann darauf Sätze le- sen wie „Kill them all!“ oder „Fuck and destroy!“ Aber alle verbindet die Ge- wissheit, einen angenehmen, hauptsächlich dem Konsum gewidmeten Nachmit- tag zu verbringen und so zur Festigung ihres Daseins beizutragen. (Houellebecq 70f)
Dies alles spielt sich wie gesagt im Zentrum, im Herzen der Stadt ab. Obwohl das Zentrum unter anderem durch ein Symbol einer Kirche gekennzeichnet ist, hat die Gesellschaft neben dieses Symbol noch ein anderes gesetzt. „Ebenfalls in der Mitte des Platzes, unter einer Art Betonkuppel, befinden sich Geschäfte, und daneben ein Gebäude, das wie eine Autobushaltestelle aussieht“ (Houellebecq 70). Dennoch ste- hen beide quasi als Alternativen nebeneinander. Doch hat sich die Gesellschaft an- ders entschieden. Das eigentliche Wertezentrum ist durch ein Symbol ersetzt, der reale Raum wird von Geschäften unter einer Betonkuppel eingenommen. Das gemeinsame Element der Gesellschaft ist Konsum. So rückt das Wertesystem in weite Ferne, und das neue Zentrum der Stadt ist wie Choay sagt die Monosemie auf ökonomisches Handeln. Dies tritt um so deutlicher zu Tage, als dieses Zentrum von einer polisemischen Peripherie umgeben ist:
Trotzdem, es gibt hier sehr schöne Reste aus dem Mittelalter, alte Häuser mit echtem Charme. Vor fünf oder sechs Jahrhunderten muss Rouen eine der schönsten Städte Frankreichs gewesen sein; aber jetzt ist alles im Eimer. (Ho- uellebecq 69)
Anstatt sich der bürgerlichen Herkunft zu besinnen, und die Schätze der Vergangenheit zu erhalten, setzt man auf eine äußerst volatile Industrie, die nicht nur neue gesellschaftliche Strukturen hervorbringt, sondern eben auch neue Menschen. Doch wie kommt es zu solchen Missständen?
Kittler sieht die Ursache für den Topozentrismus der Stadt, der Hauptstadt, aus dem Kopfe des Monarchen erwachsen, dem Aristos, der der urbanen Gemeinschaft vorsteht und sie gleichzeitig repräsentiert und verkörpert (Kittler 1995, 229). Es scheint, dass die Stadt ebenso durch ihre Führung repräsentiert werden kann et vice versa78. Wenn die Stadt als Metapher für Gesellschaft dienen kann, so kann der Führer der Stadt auch zum Führer der Gesellschaft übertragen werden:
„Ich weiß nicht, wer der Bürgermeister ist, aber zehn Minuten Spaziergang durch die Altstadt genügen, um festzustellen, dass er vollkommen unfähig oder korrupt ist“ (Houellebecq 69).
So kann der periphere Blick des Beobachters zwar nicht Paris, das eigentliche Zentrum erfassen, doch kann er als Fremder zwar nicht in der Stadt, doch als Außenseiter in der Gesellschaft, zumindest sein Anderssein feststellen:
„Ich stelle fest, dass ich mich anders fühle, ohne jedoch die Natur dieses Andersseins genauer bestimmen zu können“ (Houellebecq 71).
Dennoch bleibt der Eindruck auf Gefühle beschränkt, dem Helden ist es nicht mög- lich seinen Eindruck zu kommunizieren. Er flieht: „Am Ende flüchte ich, ermüdet von dieser auswegslosen Beobachtungstätigkeit, in ein Café. Wieder ein Fehler“ (Houellebecq 71). Die Flucht aus dieser auswegslosen Situation gelingt jedoch nicht.
Eurozentristische Peripherie
Igenschay denkt eine weitere Zentrum/Peripherie-Achse. Diese Achse ordnet Europa durch seine Errungenschaften und Kultur zentral, und die Entwicklungsländer als Peripherie.
Das sozialwissenschaftliche Denkmodell der Dependencia-Theorie, des Brasilianers Cardoso, versucht dieser Ordnung ein neues Denkmuster gegenüber zu stellen: Die Entwicklung in Europa ist von den Entwicklungsländern nicht nachvollziehbar, und vielleicht auch gar nicht erstrebenswert. Nichteuropäische oder besser nicht euro- zentristische Literaturkonzepte ermöglichen für Igenschay eine neue Sicht auf euro- päische Städte. Carlos Fuentes Roman: „terra nostra“ hat Paris, das städtische Zent- rum als Objekt des peripheren Blicks, und macht so eine Rückgewinnung des städti- schen Raums aus der Peripherie möglich.
Doch diese Rückgewinnung findet auch auf quasi ontologischer Ebene statt:
Die in Lateinamerika, Asien und Afrika emporschnellenden Bevölkerungsmassierungen, werden in europäischer Sicht als Großstädte angesehen.
Unter Beibehaltung ihrer alten Großstadtdefinitionen akzeptieren [die Europä- er] auch die außereuropäischen Bevölkerungsmassierungen als Metropolen die- ser Welt, sofern sie sich arbeitsteilig, neue Funktionen zuordnen ließen. (..) Je- de außereuropäische Metropole trägt dabei ein bestimmtes Kennzeichen. (..) Kalkutta ist die Großstadt des Elends: ein einziger Slum, eine Stätte himmel- schreiender Agonie, (..) Limas Spezialität soll die ‚Verländlichung’ der Stadt sein, Los Angeles (..) gilt als das Gemeinwesen, in dem die Verbindungswege wichtiger sind als die Wohn- und Arbeitsstätten, die sie verknüpfen. (Igen- schay, S. 14)
Erfahrbarkeit und Erfassbarkeit der Stadt
Darf man Romane zur Untersuchung von Städten heranziehen?
Igenschay macht in den wissenschaftlichen Diskursen über die Stadt und in ihren literarischen Beschreibungen einen starken Zusammenhang aus.
In keinem anderen Sujet konfluieren Lebenswirklichkeiten und Literarisierun- gen derart wie in der Großstadt; und nirgendwo sonst wird die ontologische Differenz von ästhetischem Artefakt und empirischer Kontingenz so missachtet. (Igenschay, S. 7)
Igenschay stellt am Beispiel Richard Sennets EssayThe Consciousnes of the Eye -the Design and social Life of Cities79fest, dass zur empirischen Untersuchung mo- derner Städte gerade fiktionale Texte herangezogen werden. Das ist ein Stück weit plausibel, Denn Stadtromane sagen etwas aus, sagen etwas über die Städte, die sie thematisieren. Sie sagen soviel immerhin aus, dass ihre kalkulierten fiktionalen Konstrukte, nur weil sie ein Stück Nichtfiktion mitverarbeiten, pragmatisch verwendbar sind. (Igenschay, S. 7)
Mir scheinen gerade Romane besonders geeignet subjektive Befindlichkeiten, wie etwa die Wahrnehmung für die wissenschaftliche Untersuchung heran zu ziehen; selten wird anderswo dezidierter über die Verhältnisse des Subjekts zu seiner Um- welt gesprochen als in Romanen. Zudem ist in ihnen etwas unwandelbar niederge- legt, sie sind in einen literarischen Zusammenhang einzuordnen und es steht zu ihrer Untersuchung ein wissenschaftliches Instrumentarium bereit. Wie man am Ende des Kapitels vielleicht wird sehen könne, scheinen gerade Romane das Erleben einer Stadt auch mitzuverändern.
Ohne literaturtheoretische Untersuchungsmuster wie beispielsweise den Struktura- lismus bemühen zu wollen, glaube ich, dass die reale Lebenswelt Einfluss auf die Literatur ausübt, dort Strukturen abbildet und deshalb auch ihren Niederschlag in Romanen findet.
Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass in unserer Kultur Gruppen vorstellbar sind, die sich überhaupt nicht literarisch artikulieren, bzw. artikulieren können. Quantitati- ve Erhebungen, die beschreiben, welche Schicht durch welchen Roman repräsentiert wird, oder ein Schlüssel, der aufzeigt: Pro 100 Asylbewerbern 0,23 Romane pro Jahr, oder pro 100 Vorstände, 3,6 Romane, (ohne Autobiographien 0,01) usw., gehören der Seltenheit an. Das Problem der Unbeobachtbarkeit unserer Gesellschaft, das sich mit zunehmender Komplexität verschärft, kann auch durch die Lupe der Literatur nicht umgangen werden. Was also eine „empirische“ Erforschung der städtischen Lebenswelt durch die Literatur nicht leisten kann, ist, wirklich repräsentativ für alle Schichten, die es nach Meinung von U. Beck nicht mehr gibt, daher besser ‚Gruppen’, Empfindungen und Befindlichkeiten zu belichten.
Die Germanistik muss sich oft den Vorwurf gefallen lassen, nur die Perlen der Lite- ratur zu untersuchen, wie z.B. Thomas Mann. Dadurch ergibt sich eine gewisse Ver- zerrung. Eine ebensolche Verzerrung ergibt sich bei Vorhaben unserer Art: Dadurch, dass man hier nur gesellschaftliche Bereiche untersuchen kann, die in irgendeiner Weise Gegenstand der Literatur sind. Alle anderen Gruppen bleiben im Dunklen. Der literaturhistorische Begriff der Fallhöhe kann als Indiz für diese Verschiebung gelten.
Bildet der Text über die Stadt ab, oder produziert er?
Stierle sieht im Text über die Stadt eine Ergänzung zur realweltlichen Stadt. Im Text über die Stadt treten Welt und Buch zusammen zu einem „Ganzen der Erfahrbarkeit“ (Stierle 14). Dies könnte bedeuten, dass der Text wichtige Erfahrungen, die empi- risch in der Stadt nicht gemacht werden können, ergänzt werden. Eine andere Lesart wäre, dass der Text der Stadt etwas hinzufügt, sie in ihrem ontologischen Status ver- ändert.
Hans Blumenbergs Metapher von der Lesbarkeit der Welt, wird aber dennoch von Stierle nur bedingt auf die Stadt übertragen. Was verwundert, denn die ‚Lesbarkeit der Welt’ und die ‚Lesbarkeit der Stadt’ haben eines gemeinsam: beide sind nicht im Sinne einer feststehenden Nomenklatur zu Übersetzten, wie ja das Lesen eines Tex- tes auch nicht in jedem kognitiven System gleich prozessiert wird. Blumenberg spricht von einem „Ideal einer endgültigen Terminologie“ (Blumenberg 1985b, 286)80wenn also alle Begriffe klar sind. Ich glaube kaum, das dieser Zustand seit der Abgabe dieser Arbeit eingetreten ist. Die Sprache ist also ein vorläufiges Konstrukt und kann von daher die Welt nur bedingt abbilden und beschreiben.
Die Komplexität der Großstadt ist sicherlich mit verantwortlich für das Wuchern der Lesarten.
Ein endloses Arsenal von Diskursen kann jede Stadt hervorrufen, und jeder ein- zelne ist Ergebnis einer eigenen, von anderen Parametern als denen der Stadt abhängigen Komplexitätsreduktion. Diese nicht neue Erkenntnis kann freilich weder die intime Relation zwischen der Stadt und ihrer Literatur noch die so merkwürdig leichtfertig vorgenommene, zugelassene Inszenierung von Kunst und Leben erklären. (Igenschay 8)
Igenschay sieht diese Gleichsetzung von Fiktion und Empirie problematischer als zum Beispiel Freuds Ödipuskomplex, in dem auch Fiktion auf die Empirie projiziert wird.
Weil die Gefahr, die realweltliche Vorgabe und die konzeptualisierte Literari- sierung nicht getrennt zu halten, im Fall der Stadt größer ist, weil die Stadt und ihr Diskurs gerade dazu einladen, beides zu verwischen und zu vermischen. Dazu trägt die Tatsache bei, dass auch die realweltliche Stadt allein in Konzep- tualisierungen erfahrbar und erfassbar ist: Auch Architektur, Stadtsoziologie und -Anthropologie und Stadtplanung kommen nicht umhin, sich die Empirie der Großstadt mit den Netzen ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Konzepte an- zuverwandeln. Diese Konzepte ihrerseits können wiederum von der literari- schen Praxis wie von der Literaturtheorie benutzt (usurpiert) werden. Von daher sind die Überschneidungen zwischen den literarischen und den wissenschaftli- chen Annäherungsformen hier so umfangreich, so unvermeidlich und einerseits so fruchtbar. Andererseits hat diese intrikate Verbindung Irrtümer hervorgeru- fen und Irrwege geöffnet. Sie hat eine „Eins-zu-Eins-Relation“ postuliert zwi- schen der Stadt und „ihrer“ Literatur und den Glauben genährt, eine immanente Poesie der Städte könne eine adäquate Beschreibbarkeit garantieren. (Igen- schay, S. 8)
„Die Stadt ist nur fassbar als Formation von Hinsichten auf sie“ (Igenschay, S. 8). Igenschay bemerkt, dass die Städte der Renaissance gerne zu geistesgeschichtlichen Gesamtzusammenhängen stilisiert wurden (Igenschay 8). Die verschiedenen Sichtweisen finden allein in den Diskursen über die Stadt ihren Niederschlag. Und das gilt für Igenschay nicht nur für literarische Umsetzungen.
Er gibt hier zu erkennen, dass er an eine Korrelation von Diskurs und erfahrbarer Stadt nicht glaubt. So ist die Stadt eine zumindest in schriftlichen Universen nichterfahrbare Welt, und der Diskurs über die Stadt schafft eine neue Stadt. Demnach bleibt für ihn die Stadt in der Schrift nicht erreichbar.
Ebenso wie Igenschay, behauptet auch Hassauer die Unmöglichkeit der Darstellung der tatsächlichen Realität der Stadt.
Ob Bilderflut oder Bildersturm über die Stadt, ob ikonophile oder ikonophobe Wahrnehmungs- und Deutungsmuster - die Absage an die Mimesis- Vorstellungen von ‘Abbildung’ und ‘Repräsentation’ einer ‘Realität’ der Stadt im Text, ist in jedem Fall auch ohne die pansemiotische Vereinheitlichung ver- schiedenster Wahrnehmungscodes unter der Zentralmetapher der Schrift auf die ‘Stadt’ als Text oder gar unter der Zentralmetapher des neuzeitlichen ästheti- schen Einsatzes von Schrift auf die ‘Stadt als literarischer’ Text argumentierbar. (Hassauer 73)
Dieser Absatz Hassauers impliziert einen interessanten Zusammenhang oder besser eine Parallele zwischen Stadt (als Text) und der Sprache (als Text). Wenn wir uns die Frage stellen, was ist die Sprache, denken wir sofort an sämtliche dekonstruktivisti- schen Diskussionen, die über den Wahrheitsgehalt der Sprache geführt wurden. Nietzsche, in seinem Essay: „Über Wahrheit und Lüge im außermoralischem Sinn“ war einer der frühsten Artikel. Um alle Diskurse der Dekonstruktion angemessen darzustellen, könnte man Bibliotheken mit wenig erhellenden Magisterarbeiten fül- len. Mir reicht eine. Deshalb möchte ich dieses Thema nur am Rande berühren. Nur so viel: Die Sprache bildet natürlich nicht die Realität eins zu eins ab.
Sprechen wir von der Stadt als Text, und wollen sozusagen die Stadt mit linguistischen Mitteln untersuchen, so ist zu vermuten, dass der Text der Stadt ebenso wie alle anderen Texte, die Realität nicht als solche abbildet. Wen oder was aber bildet die Stadt, oder der Text der Stadt ab?
Denkt man aber ‚Simulation’ und die Realität der Stadt als Medienpoesis, so scheint auf den ersten Blick eine Erforschung der Hinsichten auf eine empirische Stadt un- möglich.
Es ließe sich nun behaupten, dass man ja die reale Stadt in den Diskursen die über sie existieren erforschen kann. Aber auch das scheint dem tatsächlichen Erkenntnisob- jekt nicht gerecht zu werden, da ja auch eine Stadt jenseits des Diskurses vorhanden sein muss. Ich schlage nun vor, beide Ebenen, sowohl die reale Stadt als solche, dass auch die Stadt der Literarisierungen und der Diskurse, die ja scheinbar immer auch ein Stück weit die Realität der Stadt beeinflussen, zur Betrachtung der Stadt heranzu- ziehen.
Inszenierung der Stadt
Choay sieht in der von der Malerei beeinflussten Stadt der Renaissance eine erste Etappe der Entwicklung einer Inszenierung. Durch die Malerei entsteht so etwas wie eine Inszenierung. Dadurch beginnt man die Stadt mit einer gewissen Distanz wahr- zunehmen. Es ließe sich hier formulieren, dass man in der Renaissance begonnen hat, einen Mythos der Stadt, auf fiktionaler Ebene ein Idealbild, eine Stadtfiktion zu ent- wickeln.
Vielleicht könnte man eine parallele Entwicklung aufzeigen: Den Anfangspunkt die- ser Transformation mit dem Spaziergang Petrarcas81bezeichnen, der den Beginn einer neuen Wahrnehmungsentwicklung kennzeichnete, der die Voraussetzungen lieferte, für eine Wahrnehmung, die die Außenwelt auch als relevant und beachtens- wert empfand.
Wie die Entwicklung der Moderne von einer kleinen Schicht Privilegierter ihre Impulse bekommen hat, so wurde auch die klassische Stadt zunächst von der Ober schicht als Schauspiel wahrgenommen.82
Wie bereits angedeutet, rechnet Choay den Medien, die sozusagen außerhalb der Stadt, die Stadt vermitteln, großes Gewicht zu. Ich möchte alle Printmedien, Radio und Fernsehen sowie Internet, also alle Medien, die in irgend einer Weise Stadt the- matisieren, hinzurechnen und diese indirekte Stadtmedien nennen. Im Gegensatz zu direkten Stadtmedien: den butorschen Halbtext der Stadt, dem Text der Stadt und die Stadt.
In den indirekten Stadtmedien erfährt die Stadt eine Inszenierung, sei dies nun im Lokalteil einer Zeitung. Sei dies in Werbung im touristischen Bereich. Dennoch geht der Prozess der Inszenierung weiter.
Um Produkte besser verkaufen zu könne, werden sie beworben. Ob Shampoo, Kin- derschokolade, Autos oder Reisen. Dass die Werbung für die Ansehung der Waren, also die Einschätzung die Konsumenten dem Produkt gegenüber, sozusagen, die sub- jektive Realität des Produktes nicht ohne Folge bleibt, verwundert wenig. Doch wel- che Auswirkungen hat es, wenn eine Stadt beworben wird. Verändert sich hier eben- falls nur die ‚subjektive Realität’ der Stadt, oder besteht zwischen Inszenierung und Realität kein Zusammenhang? Was aber wenn Subjekte beworben werden? In vielen Werbespots soll nicht in erster Linie ein bestimmtes Produkt beworben werden, son- dern es soll in einen lebenswirklichen Zusammenhang gestellt werden. Somit wird nicht direkt das Produkt beworben, sondern ein bestimmter Typ in einem attraktiven Umfeld, der das beworbene Produkt verwendet. Somit setzt Werbung nicht an einem Produkt an, sondern Werbung ‚produziert’ einen bestimmten Menschentyp. Das empirische Individuum kann dann auf ein solches Produkt zurückgreifen: Mit dem Shampoo wird gleich der Typ mitgeliefert.
Masken tragen ist das Mittel, mit dem in allen Kulturen die Menschen in eine andere Haut schlüpfen. Kramer sieht in der Maskierung immer auch eine Typisierung mit- gedacht. Ob altbayerische Faschingslarven, japanische No-Theater-Masken. Immer werden mit Masken bestimmte Typen bekleidet: „Ist die Standardisierung, die Sub- mission unter einen spezifischen Typus das Ziel des Wunsches zur Verwandlung des Subjekts?“ (Kramer 59)83.
Er zieht eine interessante Parallele zu den Typen im modernen Werbespot, zu den heute üblichen Schönheitsklischees; diese Typisierung deutet in die gleiche Richtung. Kramer stellt diese Überlegungen im Zuge einer Tourismuskritik an. Es ist eine Überlegung, die Authentizität der in der Werbung der Tourismusindustrie ‚maskierten’ Orte thematisiert. Lässt sich der Tourist reinlegen, oder will er geleitet werden? Kramers These ist die folgende:
Im ‚postmodernen’ Denken verwischt sich der Unterschied zwischen der Maske und dem was dahinter ist. Nicht mehr der Wunsch nach Beseitigung aller Zu- stände, die den Menschen Masken aufzwingen, steht im Vordergrund (wie noch in Bertolt Brechts ‚Gutem Mensch von Sezuan’) sondern es wird akzeptiert, dass die Menschen nicht mehr ohne Maske auskommen. (Kramer 60)
Wie ich oben vermutet habe ist die Ursache dafür in unserem neuen Alltag, den Medien zu suchen. Das Tragen von Masken im Alltag wird aber nicht ausschließlich negativ bewertet.
Auch ich schreibe, um meine Maske von mir abzuschaben. Eine schabe ich ab und finde eine andere, ich häute mich von Rolle zu Rolle. Erst lege ich die all- gemeinen ab, dann die eigentümlicheren. Peer Gynt, der darüber betrübt ist, dass er bloß eine Zwiebel ist und sich vergeblich schält, findet im Innersten keinen massiven Kern, dolmetscht den hegelianischen Schmerz seines Autors. Als gäbe es Erscheinung und Wesen extra. Wer das Wesen im Munde führt, hat mit ziemlicher Sicherheit eine schlechte Meinung von den Masken und missbil ligt sie moralisch. Was mich betrifft, so sähe ich es nicht gerne, wenn man mein Wesen von meinen Erscheinungen trennte. Nimmt man diese Operation ernst, so braucht man dazu eine Gewehrkugel. [...] Als Tatsache gibt es nur die Maske, das Gesicht existiert nur als Utopie. (Kramer 60)
Kramers Überlegungen bezüglich der touristischen Orte und das obige Zitat reihen sich ein in die Thesen der Medienkultur Schmidts und den in seiner Schrift „Wo- nach?“ erläuterten Überlegungen Flussers84. Nicht mehr der ‚utopische’ Inhalt eines Objekts, sei es ein Subjekt oder ein Artefakt, oder eine Stadt, sondern die Art und Weise wie er uns in unserem medialen Umfeld erscheint, als die Form, die Erschei- nung wird als ‚Wirklichkeit’ begriffen, und als beachtenswert empfunden. Im Fol- genden möchte ich in einem Exkurs auf das Verhältnis zwischen Inszenierung und Verhalten eingehen. Den Rekurs auf den Themenkomplex Stadt möchte ich an dieser Stelle über Subjekte leisten, und hier auf die starke gegenseitige Abhängigkeit der beiden Komplexe verweisen.
Ein Artikel in der SZ kann zum Teil die oben genannte Verschiebung belegen, zeigt aber auch die Beeinflussung von Handlungen alleine durch die Anwesenheit von Beobachtern, in diesem Falle Medien.
Wenn schon nicht über die Klima-Katastrophe nicht anschaulich-dramatisch berichtet werden kann, so die pragmatisch praktische Rechnung, dann wenigs- tens über den Protest dagegen. Vergangene Woche standen einige Leute mit blauen und roten Küchensieben auf dem Kopf in der Altstadt [Genua] herum: Sie probten den Kampf an der Absperrung auf seine Medientauglichkeit hin. „Wollten früher die Studenten 1968 noch die Fernsehnachrichten sehen um daran zu überprüfen, ob ihre Botschaft auch richtig wiedergegeben waren, um sich letztlich im Manipulationsverdacht, den sie gegen die Medien hegten, bes- tätigt zu sehen“, schreibt der Medienwissenschaftler Knut Hickenthier „so ist heute das Interesse der Demonstrierenden and den eigenen Fernsehbildern an- ders motiviert: Man überprüft, ob man sich auch richtig dargestellt, also me- dienadäquat verhalten85hat. (Rühle)86
Das ursprüngliche Misstrauen, von in diesem Fall Demonstranten, in die Medien, ist einer Art Geltungssucht gewichen. Zumindest stellenweise wird auf diese Art argu- mentiert, um die Position der Globalisierungsgegner zu entkräften. Vielleicht haben diese Demonstranten aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, und gehen nun mit Medien ebenso professionell um, wie Politiker und Wirtschaftsunternehmen, die sich ja für die Durchsetzung ihrer Ziele und Interessen genauso medienadäquat verhalten. Ich glaube auch nicht, dass damit die Demonstrierenden den Manipulationsverdacht der Medien aufgegeben haben; sie haben einfach gelernt damit umzugehen. Doch zeigt sich hier ein deutliches Zeichen für die im Kapitel Medienkultur genannte Ar- gumentation Schmidts. Es zeigt sich an diesem Beispiel aber auch, wie machtlos die Interessensgruppen wie die der Globalisierungsgegner gegenüber der Maskierung - in diesem Falle als Gruppe sensationslustiger Chaoten - durch Medien sind.
Zurück zur Inszenierung von touristischen Orten. Was kommt aber dem Hotel auf Djerba an ‚Realität’ zu, das im Katalog des Reiseveranstalters als Perle des Orients angekündigt wird, in Wirklichkeit aber eine Hotelburg mit dem Charme der Kantine der Bahnhofsmission ist?
Interessant sind die Überlegungen Kramers auch im Hinblick auf den Cyberspace87. Er nennt den industrialisierten Tourismus die tariflich abgesicherten „Kleinen Fluch- ten in die andere Welt, in deren Zusammenhang man von Realfiktionen sprechen kann“ (Kramer 61). Realität und Inszenierung verweben sich untrennbar miteinander. Kramers These:
Indem die Fiktion über die Realität siegt, gewinnt sie gerade dadurch materiale Gestalt. In hohem Maße wird die Inszenierung durch den Tourismus zu einer neuen sozialen und kulturellen Umwelt. Und es könnte sein, dass es für den Ge- samtkomplex des Tourismus völlig unerheblich ist, ob das was er produziert, als Fiktion, als Realfiktion oder was auch immer empfunden wird, und es auch unerheblich ist, ob es als vorgetäuschte Authentizität kritisierbar ist. Maßgeb- lich ist vielmehr, dass neue materielle Wirklichkeiten entstehen. (Kramer 61)
Wahrheit. [...] Sie sehen kein Fernsehen mehr, das Fernsehen schaut ihnen (beim Leben) zu“ (Baudrillard 1978, zit. nach Radermacher 45).
Dazu gibt Kramer ein Beispiel: Für die Pariser Weltausstellung plant der Maler Gio- vanni Segatini in einer riesigen Halle ein Panorama des Engadins. Dem Besucher dieses Panoramas soll der Eindruck vermittelt werden, mitten in der Gebirgsland- schaft zu sein. Dieses Projekt scheiterte jedoch an verschieden Faktoren. Ein weiteres interessantes Beispiel, das Kramer anführt ist die Anekdote des Baron R. aus dem frühen 19. Jahrhundert, der um die ganze Welt reiste, um verschiedene Panoramen zu sammeln. Um den optischen Eindruck zu verstärken, ließ er angeblich Hügel abtra- gen, Bäume abholzen und dergleichen mehr, lediglich, um ein einziges Mal den Aus- blick zu genießen.
Die genannten neu geschaffenen Realitäten sind in gewisser Weise Vorboten der Veränderung der Realität durch den Tourismus. Diese beiden unterscheiden sich in einem Punkt maßgeblich: Im Falle des Panoramas Segatinis wird der Eindruck einer Realität erweckt. Im Zweiten Falle wird die Realität als solche verändert, um einem Image oder ein gewissen Vorstellung zu entsprechen. Aber es gibt für beide Fälle Entsprechungen in der heutigen Zeit: Disneyland ist ein Beispiel. Ein anderes sind zum Beispiel sind touristisch gestylte Stadt-Images:
Nicht nur im Bade- und Ferntourismus werden die Destinationen marktschlüpf- rig gestylt, auch im Städtetourismus. Wie kommt was am wirkungsvollsten an? Wie können wir unser Stadt-Image so stylen, dass es den augenblicklichen Inte- ressen entspricht? Am besten wäre es, wenn die europäischen Großstädte auf dem US-Markt sich gemeinsam präsentieren würden: Berlin, Paris und London im Benetton-Stil als united destinations dargestellt. (Kramer 64)
Aber das Image einer Stadt ist auch Teil der Realität der Stadt. Das Erleben einer Stadt ist stark davon abhängig, was der Besucher von ihr erwartet. Also werden mit den Images einer Stadt auch die Realität der Stadt verändert. Um den Ansehungen der Stadt noch weiter zu entsprechen wird die Stadt auch ‚materialiter’ verändert.
Markteroberungsfeldzüge versuchen ganz gezielt, das Publikum zu konditionieren und die Bedürfnisentwicklung zu beeinflussen. Risiken werden durch Marktstudien weitgehend zu vermeiden gesucht. (Kramer 65)
Es findet in zweifacher Hinsicht eine Realitätsveränderung statt: Zum einen wird die Landschaft verändert, zum anderen die Wahrnehmung der Menschen, so wie durch Werbung die Ansehung der Konsumgüter bei den Konsumenten verändert wird. Diesen Prozess kann ich leider im Rahmen dieser Arbeit nicht erläutern.
Dabei wird jedoch dem Konsumenten glaubhaft vermittelt, dass er allein über seine Entscheidungsgewalt verfügt. Kramer macht im Tourismus einen Paradigmenwech- sel aus: Die Verschiebung findet, allgemein formuliert, dahingehend statt, dass nicht mehr kulturelle Interessen im Vordergrund stehen, sondern merkantile Wertschöp- fung. Waren es früher hauptsächlich religiöse Interessen, die Menschen zum Reisen bewegten, so sind es heute ökonomische. Doch diese ökonomischen Interessen ent- sprechen nur zum Teil den Bedürfnissen der Menschen. Zitat Kramer:
Der Trend, Touristen in kompakten synthetischen Großanlagen zusammenzu- fassen, folgt ökonomischen Kalkül. Ein auf den kleinsten gemeinsamen Nenner konzentriertes synthetisches Erholungs- und Beschäftigungsangebot wird ganz- jährlich kontinuierlich bereitgehalten und garantiert hohe Auslastung mit ra- scher Amortisation [...]. Nicht den Bedürfnissen der Touristen, sondern den Verwertungsstrategien des Kapitals folgt dieser Trend. Die Souveränität der Konsumenten wird durch die Koordinierung mit Hilfe von Marketing- Strategien unterlaufen. (Kramer 67)
Die von Choay festgestellte monosemische Struktur der Städte in ihrer Referenz auf die Ökonomie, kann also auch für touristische Inszenierungen gelten. Doch nicht die ökonomische Verwertungsstrategie wird den Städten als Maske aufgesetzt, sondern dieses Programm wird gerade maskiert. Den bestehenden Bedürfnissen werden neue Strukturen gegenübergestellt, die für die Industrie die bekannten ökonomischen Voraussetzungen erfüllen. Reisen bildet; eben das sieht Kramer durch die Inszenierung gefährdet. Denn die Inszenierung bedient das vorfabrizierte Bild:
Damit besteht keine Chance mehr, dass ich mir mein eigenes Bild durch Erfahrung und Aneignung entwickle. Die Chance zum bildungswirksamen und realitätshaltigen Erleben wird zerstört durch das Angebot von vorgefertigten Kunstwelten. (Kramer 63)88
Es werden, wenn ich Kramer richtig verstehe, bestehende Bedürfnisse in gewisser Weise kanalisiert. Bedürfnisse werden modifiziert und in bestimmte Richtungen ge- lenkt und zwar in der Art und Weise, dass sie am besten befriedigt werden können.
Kramer sieht vor allem die Inszenierung der Wirklichkeit als ‚Hauptproblem’ des modernen Tourismus. Die Kolonialisierung durch die Tourismusindustrie findet aber nicht nur an den Stränden der türkischen Riviera statt. Auch die Ansehung und Er- wartungen welche die Touristen mitbringen werden kolonialisiert. Um es verschärft zu formulieren: Der Mensch an sich wird verändert. Diese zweite Kolonialisierung findet natürlich im Inneren des Menschen statt. Nur in der Wechselwirkung mit psy- chischen Systemen ist eine solche Inszenierung überhaupt erst möglich.89Dennoch kommt Kramer zu dem Schluss, dass diese fiktionalisierte und inszenierte Realität kein Wolkenkuckucksheim ist, vielmehr: „Sie ist materielle Realität für alle Betrof- fenen“ (Kramer 70). Dieser Schluss legt nun wiederum nahe, von den Vokabeln Fik- tion und Inszenierung Abstand zu nehmen.
Die touristische Inszenierung passt in die formationsspezifische Struktur unse- rer Marktgesellschaft. Sie kann interpretiert werden als reale Unterwerfung nicht nur von Teilen der materiellen Außenwelt, sondern der kulturellen Welt- erfahrungsmuster der Menschen unter die Zwecke der Tourismusindustrie. (Kramer 70)
Das Resultat dieses Realitätsprozesses könnte man vielleicht treffend mit S. J. Schmidts Konzept der Medienkultur parallelisieren. Dazu im Kapitel Medienkultur mehr.
Betrachten wir die Veränderungen, die Kramer durch die Inszenierung der Wirklich- keit entstehen sieht und ebenso die Folgen für die Realität der touristischen Zentren. Meine Frage, die ich an Kramers Beobachtungen anschließen möchte: Kann man die Prozesse der Inszenierung und der Veränderung der Realität und Wahrnehmung durch die Reiseindustrie auch auf andere Bereiche der Industrie anlegen. Könnte man nicht auch diese Beobachtungen auf ein beworbenes Subjekt extrapolieren? Inszenie- rungen finden in den Medien allenthalben statt. Ob in Werbefilmen, Soaps oder Talkshows. Leider nennt Kramer keine Methoden, wie die Kolonialisierung des Psy- chischen im speziellen vor sich geht. Es ist aber zu vermuten, dass diese Inszenie- rung auf der psychischen Seite über Medien vonstatten geht. Diese neue, inszenierte Realität kommt ohne die alte nicht aus und ist mit ihr auf vielfache Weise verbunden. Die fiktive Realität ist sozusagen ein Epiphänomen der nichtinszenierten Realität. Stadtinszenierungen gibt es laut Choay seit der Renaissance. Die Tatsache der Insze- nierung gibt es also schon länger; dennoch glaube ich, dass die Inszenierungen unse- rer Tage eine neue Qualität gewonnen haben. Dies kann auch an den technologischen Vorraussetzungen liegen90, aber es scheint heute so zu sein, dass die ‚Simulation’ den realen Ort bei weitem überwiegt. Die Maske ist eben wichtiger als das Gesicht. Dieses Problem verweist wiederum auf die Frage, ob es jemals so etwas wie eine nichtinszenierte, authentische Realität gegeben hat.91
Mit der Frage nach der Realität der Stadt stellt sich auch die Frage nach der Stadt als Heimat.
Ina-Maria Greverus, die sich über längere Zeit hinweg von einem anthropologi- schen-vergleichenden Ansatz aus mit dem Heimatbegriff auseinander gesetzt hat, definiert ihren Untersuchungsgegenstand als einen dem Menschen notwen- digen Satisfaktionsraum, in dem seine Bedürfnisse nach Identität, Sicherheit, Aktivität und Stimulation erfüllt werden. Das historische und kulturspezifische Konzept ‘Heimat’ wird im Rahmen eines Entwurfs von menschlicher Territori- alität analysiert. Im alten Streit, ob Heimat statisch als räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen oder dynamisch als soziologische Tatsache, die sich räumlich formt, zu betrachten sei, kann Greverus wohl mit guten Gründen eine vermittelnde Position einnehmen. (Ecker 302f)92.
Greverus’ Ergebnisse lassen sich unter dem Begriff des ‘Territorialen Imperativs’ subsumieren.
Greverus bezeichnet damit ein Grundrecht, das aus einem Wesenszug der bio- logischen Art Mensch abzuleiten ist, und das in ein Gebot für jene Instanzen umgesetzt wird, die das kulturfähige und -abhängige Wesen Mensch mit immer neuen Angeboten und Verboten belegen, ihm die Befriedigung seiner Bedürf- nissen in einem und an einen Raum zu gewährleisten. Wir wissen aus Erfah- rung, dass moderne Industriegesellschaften, kapitalistische wie sozialistische, der Norm des ‘territorialen Imperativs’ nicht entsprechen. Sie nehmen dem Bürgern in zunehmenden Maß die Möglichkeit, sich ihre Lebenswelt individu- ell und kreativ anzueignen. Die zentralen Fragen der Identität - Wer bin ich? Wohin gehöre ich? - werden erst im Milieu der arbeitsteiligen, heterogenen und anonymen Industrie- und Massengesellschaft zum Problem, vielleicht sogar erst dort bewusst wie manche Forscher meinen. (Ecker 302f)
Überträgt man den territorialen Imperativ auf Heimatliteratur, die eine Kompensation des menschlichen Grundbedürfnisses nach ‘Heimat’ darstellt, zeigt sich, dass sich das Subjekt auf eine illusorische Vergangenheit rückbezieht, um das ‘Heimatbedürf- nis’ zu stillen. So könnte man schließen, dass eine reale moderne Gesellschaft nicht in der Lage ist, ein zentrales menschliches Bedürfnis zu stillen, dass Heimat im Zeitalter der Massenkommunikation nicht mehr möglich ist. Dieses reale Bedürfnis wird durch eine idealisierte Heimatfiktion ersetzt. Eckert stellt sich die Frage, ob diese Reaktion tatsächlich eine subjektive ist, oder, ob diese Kompensation nicht von „bestimmten gesellschaftlichen Institutionen“ (Ecker 303) geleistet wird.
„Wir haben Markenartikel gekauft!“ verkündete Mark stolz, als ich die Tür in einem Anfall von Begeisterung öffnete. „Alles völlig sicher und andauernd in der Werbung zu sehen.“
Douglas Coupland, Shampoo Planet
MEDIEN
Medial Turn
Verschiebungen
Flusser merkt an, dass irgend etwas sich radikal verändert, er aber nicht genau weiß, was es ist. Was sich aber im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte verändert hat, ist sicherlich das immer größere Gewicht, das die Medien in unserer Kultur spielen. Vielleicht sind die Veränderungen, die Flusser ahnt, Resultate dieser Umgewichtung zu elektronischen Medien, oder Resultate aus dem Wirken dieser Medien. Um die Veränderungen, die unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten durchlebt hat, Rechnung zu tragen, beschäftigt man sich mehr und mehr in geistes- und sozial- wissenschaftlichen Disziplinen mit dem Thema Medien. Nach dem Linguistic Turn, der vor allem die Sprache und Grammatik als Erkenntnisinteresse hatte, setzt nun nach Radermacher eine Wende zu den Medien ein.
Auf der Objektebene wendet man sich den Medien als dem ‚Ort’ der Gesellschaft zu, an dem die ‚Realität’ unserer Kultur konstruiert wird. Die grundlegende Hypothese ist, dass nicht mehr primär die Sprache und das Gehirn der privilegierte Ort der Kon- struktionkognitiv-sozialerWirklichkeiten darstellt, sondern, dass es die Medien sind.
Diese Annahme stützt sich nicht zuletzt auch auf die Überlegungen, die im Rahmen des Kulturalismus gemacht werden (Wahr ist es, weil es für uns wahr ist). Der Kultu- ralismus geht davon aus, dass die Welt in der wir leben, eine kulturelle ‚Konstrukti- on’ ist, die ihre Richtigkeit an der ‚Viabilität’ von Problemlösungskonzepten misst. Der Kulturalismus, vor allem vertreten durch Dirk Hartmann und Peter Janich, wi- derspricht nicht den Annahmen, die Schmidt in Zuge zu den Überlegungen der Me- dienkultur macht. Beide nehmen die Konstruiertheit der menschlichen ‚Wahrheiten’ an. Kulturalismus, Medienkultur und soziale Systemtheorie rechnet Radermacher dem Medial Turn zu.
Die Welt als Medienpoesis Die mediale Welt ist immer lediglich eine Denklogik, theoretisch wie empirisch. (Weber 7)93. Basistheorien für den „Medial Turn“ Weber listet einige Überlegungen auf, in denen er das Programm des Medial Turns glaubt feststellen zu können. Ich möchte davon eine Auswahl darstellen, und den sogenannten medienkulturellen Konstruktivismus eingehender bearbeiten, denn er scheint mir, bei allen Problemen, die Schmidts Argumentation mit sich bringt, das Verhältnis von Medien, Subjekt und Realität am besten klarzumachen.
Medienkultureller Konstruktivismus (Schmidt)
Siegfried J. Schmidt untersucht die kognitiv-soziale Konstruktion von Wirklichkeit. Konstruktion im Sinne des Konstruktivismus meint immer sowohl kognitives wie soziales Operieren.
Aus diesem Dualismus leitet sich die Frage ab: Wie ist die strukturelle Kopplung von Kognition (individueller kognitiver Autonomie) und Kommunikation (sozial- reflexivem Verhalten) möglich?
Die Antwort: indem Kommunikation und Kognition in ein Kulturprogramm eingebettet und durch Medienangebote gekoppelt werden: Medien und Kultur leisten einen fundamentalen Beitrag zur Konstruktion kognitiver wie sozialer Wirklichkeiten. Diese Überlegungen haben zu dem Begriff der „Medienkulturgemeinschaft“ geführt, die in erster Linie von einer Pluralisierung und zunehmenden Kontingenz der Beobachterperspektive gekennzeichnet ist. Auf Schmidts Überlegungen werde ich im Kapitel Medienkultur detaillierter eingehen.
Autopoietische Systemtheorie (Luhmann)
Luhmann versteht die Autopoietische Systemtheorie als Supertheorie des Sozialen, eine Gesellschaftstheorie der Moderne:
Die soziale Ordnung der Moderne entstand nach Luhmann durch den Übergang der Gesellschaft von hierarchisch-stratifikatorischen zu einer funktionalen Differenzie- rung.
Einzelne Funktionssysteme haben sich dabei ausgegliedert, selbstorganisiert, ausdif- ferenziert, autonomisiert, und haben schließlich eine exklusive Funktion für die Ge- sellschaft angenommen: Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Religion, Kunst und Mas- senmedien. Diese bestünden jetzt nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikatio- nen: „Es“ kommuniziert. Menschen verweisen sowohl auf psychische wie auch bio- logische Systeme. Den Massenmedien kommt in dieser Gesellschafts-Konzeption die Exklusiv-Funktion zu, die Selbstbeobachtung der Gesellschaft im Spiegel einer Rea- lität zweiter Ordnung zu leisten.
Das Autologieproblem (Beobachten des Beobachten, das Nachdenken über das Nachdenken) kann durch die Hereinnahme des Beobachters in den Beobachtungsgegenstand gelöst werden.
Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für unsere Kenntnis der Gesellschaft und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur. (Luhmann 1996, 9)94.
Mediatoren (Lischka)
Lischka trifft die Unterscheidung von Form und Medium; diese Überlegung führt zu dem Ergebnis, dass wir mittlerweile alle Mediatoren geworden sind, und sich uns die Realität nur noch über die Schnittstelle Medium (= mediatisiert) zeigt. Die Frage nach einer Realität „Jenseits der Medien“ (Waibel 1998, nach Weber 7) ist obsolet.95Die oben genannten Theorien, auf theoretischer Ebene, ermöglichen eine „strikt anti- realistische und postontologische Beobachtung der Medialisierung der Welt“ (Weber
7). Wirklichkeit
In einem Punkt scheinen sich zumindest Bolz, Schmidt, Flusser und Haussauer einig zu sein: Mediale Kommunikation bildet ein weltweites Netz. Einen empfindlichen Punkt spricht Schmidt im Zitat weiter unten an: Die Reflexivität der Medien. Zum einen betrachtet Schmidt Reflexivität der Wahrnehmung als Voraussetzung von Kommunikation: So kann der Mensch, was er sieht, auch fühlen usw., gleichzeitig kann der Mensch so sein eigenes Handeln wahrnehmen. So wird der Weg frei für ein weniger instinktgelenktes Handeln, hin zu reflexivem und somit variablem Handeln, „also zur Ausbildung von Symbolen“ (Schmidt 1994, 60)96. Reflexivität der Medien bedeutet, dass Inhalte in Subsystemen andere mediale Subsysteme ‚anregen’, zu den gleichen Inhalten veranlassen: Die öffentlich geführte Diskussion über das Halten von Kampfhunden ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel: Die Zahl von Unfällen bei der Bahn ist rückläufig, die Zahl der Veröffentlichungen und Berichte über dieses Thema ist aber mit Eschede sprunghaft angestiegen.
[...] dass wir in einer Mediengesellschaft globalen Ausmaßes leben, in der tradi- tionelle kulturelle Ordnungen und Tätigkeiten allmählich in eine Medienkultur transformiert werden. Individuelle wie soziale Konstruktionen von Wirklich- keit, sozialer Wandel und die fortschreitende Umwandlung normativer Orien tierungen vollziehen sich im wesentlichen im Rahmen mediengestützter Kommunikationen, wobei die Mediensysteme zunehmend vernetzt und reflexiv werden. (Schmidt 1994 a, 173)97.
Dies korrespondiert mit der soziologischen Analyse, die einen Übergang von einer funktionalen zu einer informationellen Differenzierung der Gesellschaft beobachten, wie dies Thiedeke 1997 festhielt.
Die Konzeption von Medien als neues Leitsystem der Gesellschaft widerspricht je- doch orthodox-systemtheoretischen Annahmen von der polyzentristischen Gesell- schaft mit gleichberechtigten autopoietischen Funktionssystemen, wie Beck sie un- terstellt.
Wahrheit und Simulation
Margreiter liest Bolz in bezug auf die Medienwirklichkeit folgendermaßen:
Sie führe uns vor Augen, dass jede Art von Erkenntnis und orientierendem Weltbezug nur als Selbstbespiegelung des menschlichen Geistes zu werten sei. Von einer medienunabhängigen Realität zu reden ergebe keinen Sinn, denn niemand könne zwischen Sein und Schein, Wahrheit und Täuschung unter- scheiden. Da die Realität als universale und undurchdringliche mediale Projek- tion zu werten sei, sei auch die Option auf Wahrheit nicht mehr aufrecht zu er- halten. Eben dieser Anspruch auf Wahrheit aber sei traditionell der Lebensnerv der Philosophie gewesen, und seine Zerstörung treffe somit das ‘Projekt Philo- sophie’ selbst. (Margreiter 10)98
Weiter:
Eine ruhige und distanzierte Betrachtung der Dinge [...] sei, behauptet Bolz, unmöglich geworden. Die Neuen Medien seien ‘die Wirklichkeit selbst’, und sie begegneten nur im Modus der distanzlosen ‘Nähe’. Es gäbe keine Möglich- keit einer (Ideologie)-Kritik mehr, wohl aber noch die Möglichkeit der - nicht näher charakterisierten, aber per definitionem nicht-kritischen, nicht objektiven, nicht philosophischen - ‘Analyse’ [...] Etwas anderes als willkürliche Beschrei- bung und Interpretation kann damit aber wohl kaum gemeint sein. (Margreiter 10)
Margreiter kritisiert Bolz´ scheinbare Aktualität: seit der ‘postanalytischen Wende’ kann man im Sinne Bolz´ nicht mehr von ‘Der Wahrheit’ oder von ‘Der Wirklich- keit’ ausgehen. Er glaubt dennoch, dass die Simulakrumthese ernst zu nehmen ist. Ich möchte im Zusammenhang mit dieser Arbeit den schwierigen Begriff der Wahr- heit unangetastet lassen. Mich interessiert aber der Begriff der Realität: Bolz unter- stellt scheinbar, dass eine medienunabhängige Realität nicht mehr auszumachen ist, dass man zwischen Sein und Schein nicht mehr unterscheiden kann. Bolz zieht aus der Beobachtung der neuen Medien den obigen Schluss: Denn sie führen uns vor Augen, dass jede Erkenntnis nur Selbstspiegelung ist. So ist es also möglich, dass dieses Phänomen bereits vor den neuen Medien zu beobachten war.
Da es nun scheinbar keinen Sinn mehr macht, überhaupt noch von Wahrheit zu spre- chen, und Wahrheit, wie Margreiter meint, ein, wenn nicht der zentrale Punkt der Philosophie ist, oder war, dann könnte man aus dieser Tatsache schließen, dass das „Projekt Philosophie“ (Margreiter 10) gescheitert ist. Ich teile diese Auffassung nicht. Es hätte dann von der ersten Stunde der Philosophie an, als sich abzeichnete, dass ‚Die eine Wahrheit’ wohl für den Menschen wohl vielleicht zu finden sei, aber der Mensch keine Möglichkeit hat, zu prüfen, ob er tatsächlich im Besitz der Wahr- heit ist, das Projekt Philosophie als gescheitert betrachtet werden müssen. Inzwi- schen hat die Philosophie, trotz allem, den einen oder anderen Erfolg feiern dürfen.
Medienkultur
Schmidts Überlegungen rechnen sich dem radikalen Konstruktivismus, oder dem Konstruktivismus zu. Er nennt unsere Kultur Medienkultur. Er geht von der Kon- struiertheit der menschlichen Wahrnehmung aus. Er sieht Kognition, Kommunikati- on, Kultur und Medien in gegenseitiger Abhängigkeit und - in systemtheoretischer Terminologie gesprochen - strukturell gekoppelt. Was bewirkt aber dieser von Schmidt unterstellte Zusammenhang? Im Zusammenwirken diese vier Bereiche un- serer Gesellschaft emergiert so Realität, oder Wirklichkeit. Der Terminus Medien- kultur ergibt sich aus dem großen Gewicht, das die Medien in unseren Kommunika- tionsgewohnheiten einnehmen. Und so sind es die Medien, die seiner Meinung nach die Realität, in der wir leben, hauptsächlich nicht nur beeinflussen, sondern tatsächlich herstellen und bestimmen.
Beck nennt die „Eigenerfahrungslosigkeit“ (Beck 1986, 70) kennzeichnend für unsere Kultur. Fallen weitab in einem arabischen Emirat Bomben, so bin ich auf die Kommunikation der Medien angewiesen, will ich mich über die Vorfälle informieren. Es entsteht also, wie Beck sagt, ein Informationsvakuum, das durch die Medien angefüllt werden muss. Nun ist für meine Bewertung des Konfliktes entscheidend, wer z.B. als Aggressor dargestellt wird. Wird mir das glaubhaft vermittelt, so werde ich fortan die betreffende Partei als Aggressor wahrnehmen. In meiner subjektiven Realität ist dann die eine oder andere Partei der Aggressor. Diese Sichtweise manifestiert sich dann in großen Teilen der Bevölkerung. Die Medien haben somit eine reale Sichtweise, die ja auch falsch sein kann, etabliert.
Dass Medien die Macht besitzen, Ereignisse und Erfahrungen nicht zu publizieren, kann an Toms Erlebnis der Schießerei zwischen Vietnamesen belegt werden (Staffel 25f). Es zeigt inwieweit der Presse die Definitionsmacht zufällt, was sie als berichtenswert erachtet oder nicht. Das Ereignis wird nicht in der Presse dokumentiert. „TOM [...] Ich blättere in den Lokalnachrichten, um etwas über das Massaker zu erfahren, ohne Erfolg“ (Staffel 40).
Es ist klar, dass nicht jedes Ereignis, den Weg in die Veröffentlichung nehmen kann. Dennoch besteht, wie Beck es nennt ein Definitionsvakuum. Die obige Stelle kann vielleicht dokumentieren, dass Ereignisse somit zum Nichtereignis werden, indem einfach keine Berichterstattung darüber stattfindet.
Der Konstruktivismus
Der umgangssprachliche Ausdruck „Konstruktion“ legt ein intendiertes Handeln nahe. Dabei bleibt im Dunklen, dass viele Bedingungen sich der aktiven bzw. bewussten Kontrolle entziehen. „Wirklichkeitskonstruktion widerfährt uns mehr, als dass wir darüber verfügen“ (Schmidt 1994b, S. 595)99.
Der Konstruktivismus ist eher eine Theorie des Beobachters zweiter Ordnung.
Die primäre Frage ist nicht mehr, was wird beobachtet; etwa: was wird in einer Subjekt/Objekt Beobachtung wahrgenommen und inwiefern stimmt diese Beobachtung mit der Ontologie überein. Die Frage, die zu stellen ist: wie wird beobachtet. Der Focus richtet sich also auf die Beobachterperspektive, erster und n+1 Ordnung. Sozusagen eine Beobachtung der Beobachtung.
Wirklichkeitskonstruktion wird hier näher bestimmt als ein empirisch hoch konditionierter sozialer Prozess, in dem sich Modelle für ökologisch valide Er- fahrungswirklichkeiten/ Umwelten im sozialisierten Individuum als empiri- schem Ort der Sinnproduktion herausbilden. Das Attribut ´sozial ´ verweist da- bei auf die überindividuellen Bedingungen dieses Prozesses, wie sie durch So- zialstruktur und Kultur gegeben sind.(Schmidt 1994b, S. 596)
Der Konstruktivismus stellt sich - laut Schmidt - damit gegen traditionelle Modelle, die Wahrnehmung/Erkennen als eine (mehr oder weniger richtige) Abbildung der Wirklichkeit beschreiben. Er ist für Schmidt als Perspektive zu verstehen. Hierbei geht Schmidt von der „Selbstverpflichtung“ (Schmidt 1994 a, 41) der Beobachterperspektive aus und damit sei die Systemabhängigkeit der menschlichen Handlungen und Wahrnehmungen mit zu berücksichtigen.
Dabei versteht Schmidt das „Wahrnehmen“ einerseits als Realitätsgewissheit, ande- rerseits als aktiven Prozess, indem das Wahrgenommene nach den Maßgaben des kognitiven Systems verarbeitet wird, und nicht nach den Maßgaben der Umwelt. Siegfried J. Schmidt untersucht die kognitiv-soziale Konstruktion von Wirklichkeit.
Kognition
Schmidts zentraler Ausgangspunkt ist die Konstruiertheit des menschlichen Wissens über die Natur. Diese nimmt unter anderem ihren Ausgangspunkt in den biologi- schen Voraussetzungen der menschlichen Wahrnehmung. Kognition wird als Aktivi- tät eines operational geschlossenen Systemen angesehen (Luhmann). Sie sind durch die Funktionen unseres Körpers biologisch bedingt, banaler Weise im Gehirn und dessen neuronalen Netzen. Unsere Sinne liefern Daten an unser Gehirn. Diese Daten werden nun nicht nach den Hierarchien der Umwelt verarbeitet, sondern von Maßga ben des neuronalen Netzes.100Das Gehirn zwingt sozusagen die Welt der Erfahrung in seine Bahnen.
Deshalb spricht man auch von Konstruktion und nicht von einer Repräsentation, da alle Verarbeitungsstrukturen im kognitiven System erzeugt werden und nicht in der Umwelt. Die Umwelt weiß nicht, was für das kognitive System sinnvoll ist. Alles was wir erleben ist - mehr oder weniger - sinnvoll kognizierte Wirklichkeit. Was wir als Wirklichkeit erfahren, ist ökologisch valides Wissen, das wir mit anderen teilen. Dieses Teilen des Wissens mit anderen wird in den Kapiteln Kommunikation, Kultur und Medien thematisiert werden.
Das bedeutet, dass Wirklichkeit immer von einem Beobachter abhängig ist: von der Wirklichkeit des Beobachters. Deshalb sollte auch Wirklichkeit immer als systemrelativer Begriff verwendet werden. Diese Wirklichkeit des Beobachters unterliegt sozialen und biografischen Modifikationen.
Kognition und Realität
Das macht zudem eine Unterteilung des Begriffes der Wirklichkeit sinnvoll. In eine ontologische, erfahrungsjenseitige Realität und in eine kognitive Realität, konstruier- te Realität (Schmidt 1992, 431)101. Diese beiden Realitäten sind überschneidungs- freie Bereiche102.
Wahr ist in diesem Zusammenhang nicht was ontologisch wahr ist, sondern was als sinnvoll Kogniziertes angesehen wird, und sich in Anschlusshandlungen als viabel, bzw. erfolgreich erweist. Eine weitere Instanz für Wirklichkeit und Kontrolle der Wirklichkeit ist die soziale Übereinkunft, in kulturellen und kommunikativen Prozessen eine Wirklichkeit fest zu legen.
Der Begriff Konstruktion konnotiert eine intentionalisierte Handlung. Die meisten dieser unhintergehbaren, neuronalen Prozesse laufen hingegen, wie oben erwähnt, unbewusst ab. Deshalb scheint für Schmidt der Begriff der Emergenz geeigneter.
Zurück zu der Beobachterperspektive: Jede ist von einem „Blinden Fleck“ gekenn- zeichnet, in dem das Beobachten nicht auf sich selbst angewendet werden kann. Dennoch sind die Selektionen, die das Gehirn macht nicht willkürlich. Jeder Beobachter ist Resultat einer phylogenetischen wie ontogenetischer Entwick- lung.
Das heißt: er ist Gattungswesen und als Gattungswesen bestimmt er die Entwicklung der Gesamtpopulation mit. Er ist aber andererseits mitbestimmt von den biologischen und sozialen Entwicklungen. Weiter ist die Biographie des Individuums ausschlaggebend für die Konditionierung der Beobachterperspektive.
Diese ist zum grossteil durch die soziale Umwelt bestimmt. In dem sozialen System werden auch die Möglichkeiten der Interaktion und die Mitgliedschaft in einer Wis- sensgemeinschaft ermöglicht. Dieses Wissen ist ebenso maßgeblich für die Perspek- tive der Beobachterperspektive. Mit Weizsäcker führt Schmidt an, wir können nur wahrnehmen, was wir wissen. Jedes Wahrnehmen ist somit ein „wahrnehmen als“.
Kultur
Kultur ist ein System kollektiven Wissens, dessen wichtigstes Medium die Sprache ist, die wiederum Verhalten beeinflusst. Die Umsetzung von Gegebenheiten in Symbole ist kein natürliches Produkt sinnlicher Anschauung.
„Wahrnehmung, Erkennen und Sprechen operieren mit Unterscheidungen, die kom- munikativ zugänglich (gemacht) werden“ (Schmidt 1994 b, 599). Gemeinschaften müssen über ein System kollektiven Wissens verfügen, das den Be- zugspunkt sozialen Handelns bildet. Dieser Bezugspunkt kann mit dem Wirklich- keitsmodell einer Gesellschaft gleichgesetzt werden.103Denkt man Medien als insti- tutionalisierte Kommunikation, ergibt sich in Schmidts Definition ein zirkulärerer Bezug: Kognition und Kommunikation sind dann über Kommunikation gekoppelt. Soziale Systeme sind ohne Kultur nicht denkbar et vice versa, das heißt, sie setzen sich gegenseitig voraus.
Kultur reproduziert erarbeitete Problemlösungsstrategien über die bekannten Agen- ten, wie Wissenschaft, Wissensschatz, Sprache, Bildung usw. Innerhalb dieses kol- lektiven Wissens, werden nun Kognition und Kommunikation gekoppelt. Aber wie?
Kultur ko-orientiert Kognition über kollektives Wissen, das allerdings im Indi- viduum als empirischen Ort der Sinnproduktion immer neu geschaffen werden muss, wobei individuelle Varianten der Programmanwendung zur kulturellen Dynamik beitragen. Dieses kulturelle Wissen wird beobachtbar und beschreib- bar in Form symbolischer Ordnungen (wie zum Beispiel Schemata, Grammati- ken, Erzählmuster, Diskurse, Stilistiken), in geprägten Ereignissen (Riten, Ze- remonien), in Objekten (Kunstwerken, Gerätschaften), in Mythen, Religionen, Theorien usw. Über dieses kollektive Wissen, das die Produktion und Rezepti- on von Medienangeboten reguliert und in der Kommunikation selbst themati- siert werden kann (=Selbstbeobachtung einer Kultur), koppelt Kultur Kognition und Kommunikation über Medienangebote. Daraus folgt: Je bedeutsamer me- dienvermittelte Kommunikation in einer Gesellschaft wird, desto größer wird der Einfluss von Medien und Kommunikation auf die Anwendung und Interpre- tation des Programms Kultur - weshalb wir heute wohl zurecht davon ausgehen können, in einer Medienkultur zu leben. (Schmidt 1994 b, 600f)
Durch die Beobachtbarkeit der verschiedenen Kulturprogramme wird auch die Kontingenz jeder kulturellen Problemlösung beobachtbar.
Kommunikation
Luhmann
Luhmann konzipiert Kommunikation ohne Menschen; „es“ kommuniziert, die Kommunikation kommuniziert. Luhmann beschreibt Kommunikation mittels drei Selektionen: Information, Mitteilung und Verstehen.
Daraus folgt für Luhmann, dass der Mensch nicht kommunizieren kann, sondern die Kommunikation kommuniziert. Wie kommt Luhmann zu diesem Schluss? Luhmann führt eine Trennung von Bewusstsein und Kommunikation ein. „Das Be- wusstsein hat seine für die Kommunikation unerreichbare Eigenart in der Wahrneh mung, bzw. in der Imagination“ (Luhmann 1990, 24)104. Kommunikation ist laut Luhmann nur über Bewusstsein mit der Systemumwelt verbunden et vice versa. Wahrnehmung selbst ist nicht kommunizierbar.105Bewusstsein ist ein geschlossenes kognitives System, das seine eigenen Operationen nie direkt an die Operationen anderer Systeme anschließen kann. Denken bleibt sozial ohne Wirkung, wenn es nicht kommuniziert wird. Individuell bewusstes Wissen kann nicht isoliert auf die Ressourcen einzelner Bewusstheiten gesehen werden. Deshalb wird Wissen nicht auf Bewusstsein referiert, sondern auf soziale Systemreferenz.
Alle Begriffe, mit denen Kommunikation beschrieben wird, müssen daher aus jeder psychischen Systemreferenz herausgelöst und lediglich auf den selbstrefe- rentiellen Prozess der Erzeugung von Kommunikation bezogen werden. (Luh- mann 1990, 24)
In interaktiven Kommunikationsprozessen wirken Kommunikation und Bewusstsein zusammen.
Um die drei Selektionen, Information, Mitteilung und Verstehen der luhmannschen Kommunikation plausibel erscheinen zu lassen schließt Luhmann das Bewusstsein nicht völlig aus:
„Keine Kommunikation ohne Bewusstsein, aber auch keine Evolution von Bewusstsein ohne Kommunikation“ (Luhmann 1990, 38). Dennoch gehören beide Begriffe verschieden Systemen an. Sie stehen in keinem kausalen Verhältnis, da sie verschiedene Arbeitsweisen zugrundegelegt haben.
Wahrscheinliche Ursache für diese Formulierung ist dabei sicherlich der Definitionsnotstand bei dem unklaren Begriff Bewusstsein. Erstens ist somit eine höchst anfechtbare Ist gleich Relation umgangen (Bewusstsein = Kommunikation, Bewusstsein = Verhaltensdisposition, usw.), so kann das Bewusstsein für sich stehen und wird lediglich seinen Wechselwirkungen festgelegt, womit man ja noch nicht in die Schuld kommt, den Begriff explizit ontologisch zu definieren. Dieser Einwand gerät ein wenig ins Wanken, wenn man folgendes Zitat betrachtet:
Man könnte geradezu sagen, dass das gesamte kommunikative Geschehen durch eine Beschreibung der beteiligten Mentalzustände beschrieben werden könnte - mit der einzigen Ausnahme der Autopoiesis der Kommunikation selber. (Luhmann 1990, 38)
Kommunikation besteht für Luhmann bereits vor dem Spracherwerb etwa mit Säuglingen, das bedeutet, dass Luhmann seinen Kommunikationsbegriff nicht auf sprachliche Kommunikation beschränkt.
Verstehen ist demnach selbstreferentielles Beobachten des sendenden Systems, wobei es unerheblich ist, ob der Empfänger versteht oder nicht. In der Kommunikation wird ja nicht ständig überprüft ob verstanden wurde oder nicht. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist, ob die Kommunikation fortbesteht. Deshalb ist die Kommunikation nicht unbedingt als Austausch von Informationen anzusehen. Da die kommunizierenden Systeme immer mehr Informationen prozessieren können, als in der Kommunikation weitergeleitet werden. So besteht, wie in medialer Kommunikation, ein Definitionsvakuum: Was wird mitgeteilt und was nicht.106
Durch den Agenten der Mitteilung wird es im Kommunikationsprozess sinnvoll ein alter ego zu unterstellen, seine Erwartungen am Anderen auszurichten: So sind soziale Strukturen, im Sinne von Kommunikationsstrukturen, nichts als Erwartungsstrukturen; damit ist Kommunikation im sozialen System anzusiedeln und nicht im psychischen System. Das bedeutet, dass vom Bewusstsein lediglich sozialisierte Komponenten kommunizierbar sind.
Schmidt
Schmidt sieht einen engen Zusammenhang zwischen Kognition und Kommunikation. Dennoch gehören beide verschiedenen Systemen an. Bereits Luhmann führt diese Trennung von Bewusstsein und Kommunikation ein.
Schmidt übernimmt die systematische Gliederung Luhmanns von psychischen und sozialen Systemen. Dennoch kommen die beiden „theoretisch scharf von einander getrennten Dimensionen Kognition und Kommunikation“ (Schmidt 1994 a, 89) nicht ohne einander aus. So kann es keine Kommunikation ohne Bewusstsein geben und umgekehrt.
Schmidt versucht nun dem Problem Herr zu werden, indem er den von Maturana geprägten Begriff der strukturellen Kopplung übernimmt, der „primär ein Verhältnis der Gleichzeitigkeit, nicht der Kausalität bezeichnen“ (Schmidt 1994 a, 90) soll. Denn Kognition und Bewusstsein laufen synchron, aber in verschiedenen Systemen. Ein kausales Verhältnis wird nicht notwendig angenommen, dennoch kann in der strukturellen Kopplung ein solches vorliegen. Dies verweist „auf die Ko-Evolution von Kommunikation und Bewusstsein“ (Schmidt 1994 a, 91).
Fazit: Bewusstsein und Kommunikation sind durch eine gewisse zeitliche Parallelität der betreffenden Systeme gekennzeichnet.
Medien
Nimmt man wie Schmidt an, dass Kognition und Kommunikation über Medienange- bote strukturell gekoppelt sind, so müssen auch Veränderungen in den Medien Ver- änderungen in diesen Bereichen mit sich führen. So haben technische Neuerungen einen nachvollziehbaren Effekt auf die Evolution des betreffenden sozialen Systems. Diese Veränderungen sind aber in Qualität und Quantität nur bedingt vorher be- stimmbar.
Schmidt teilt Medien jeweils als ein Instrument der Wirklichkeitskonstruktion und der Sozialisation ein. Medien haben also nachvollziehbare Effekte auf diese Ebenen. Diese nun im Einzelnen darzustellen, ist nicht möglich. Auch Schmidt nennt keine konkreten Beispiele, besser kann keine Beispiele nennen, denn ‚Veränderungen’ können viele Ursachen haben. So bleibt er leider Belege schuldig, so muss auch ich Belege schuldig bleiben. Ich glaube, dass auch in unseren Romanen auf dieses Problem keine Antwort gefunden werden kann.
In ihrer Funktion als Instrument der Wirklichkeitskonstruktion haben Medien die Macht, selbst die basalsten gesellschaftlich konventionalisierten Dichotomien zu modifizieren (z.B. +/- wirklich). Zudem stellt Schmidt fest, dass die technische Ent- wicklung mit der modernen Bürgerlichkeit koevolviert. Besonderes Augenmerk sei hierbei auf die audiovisuellen Medien, und dabei am stärksten natürlich das Fernse- hen gerichtet.
Gesicherte Daten deuten darauf hin, dass Medien in der Tat durch ihr bloßes Vorhandensein Verhaltensänderungen hervorrufen vermögen: Menschen ver- halten sich anders, teilen sich ihren Tagesablauf anders ein, je nachdem, ob ein Fernsehgerät, ein Kabelanschluss etc. bereitsteht. (Schmidt 1994 a, 265)
Aber die Auswirkungen der Medien gehen noch weiter, schenkt man der Aussage Carpenters Glauben, die Schmidt anführt. „Media are really environments, with all the effects geographers & biologists associate with environments. We live inside our media. We are their content“ (Schmidt 1994 a, 265)
Aussagen über die Medialisierung unserer Umwelt gibt es häufiger. Man scheint gewisse Tendenzen festzustellen. Interessant daher die Annahme, dass Menschen der Inhalt einer Umgebung sind. Und dass die Medien bereits eine derartige Materialität besitzen, um uns einen Lebensraum zu schaffen, wenn man diese Aussage wörtlich nimmt.
Noch keine Macht der Welt hätte laut Carpenter so viel Einfluss und Macht besessen, wie die Medien. „Exept, that there is no single person in charge of it“ (Schmidt 1994 a, 265) Diese Aussage Carpenters mag sicherlich zutreffen: Niemand kontrolliert alle Medien, noch weiß jemand um alle Reaktionen, die sie hervorrufen. Dennoch kon- trollieren einzelne Personen ganze Märkte, wie am Beispiel Leo Kirch sehr leicht zu zeigen ist.
Der Schluss, den Schmidt aus diesen Passagen nahe legt, ist der, dass in unserer mo- dernen Zeit, Sozialisation in der Hauptsache eine Mediensozialisation ist. „Als Er- werb von Kompetenzen im aktiven und passiven Umgang mit Medienangeboten“ (Schmidt 1994 a, 266). Analog der Setzung Schmidts, dass wir in einer Medienkultur leben.
Houellebecq
Als literarisches Beispiel der Umweltbildung durch Medien kann der Charakter J. -
Y. Fréhaut in Houellebecqs „Ausweitung der Kampfzone“ herangezogen werden.
Er bewohnte eine Einzimmerwohnung im 15. Arrondisment. Die Heizung war in den Betriebskosten enthalten. Er hielt sich fast nur zum Schlafen dort auf, denn er arbeitete viel - und las außerhalb der Arbeitsstunden meist eine Zeit- schrift namens Mircro-Systemés. Die berühmten Freiheitsgrade beschränkten sich, was ihn betraf, auf die Wahl seines Abendessens per Minitel (er hatte ein Abonnement auf eine damals noch neue Dienstleistung, die Zustellung warmer Speisen zu einem genauen Zeitpunkt mit relativ kurzer Lieferzeit) Abends sah ich gern zu, wie er sein Menü zusammenstellte und dabei das Minitel bediente, das sich in der linke Ecke seines Schreibtisches befand. Ich hänselte ihn wegen der Erothek; aber in Wirklichkeit bin ich überzeugt, dass er noch Jungfrau war. (Houellebecq 41f) J. -Y. Fréhaut, ist neben seiner Arbeit, die einen großen Teil seines Lebens ein- nimmt, beinahe nur noch über Medien mit der Lebenswelt verbunden. Von der E- rothek, die soziale und sexuelle Bedürfnisse stillen soll, über medial vermitteltes A- bendessen, bis hin zur Computerzeitschrift, die man schon als Metadiskurs über Me- dien, in diesem Falle Informationsverarbeitung, betrachten kann. Diese mediale In- formationsverarbeitung stellt ja schließlich seine Arbeit dar. Also sind sowohl Brot- erwerb als auch Freizeit von Medien im weitesten Sinne eingekreist107. Carpenters These von der Umwelt durch Medien scheint also in diesem Falle zutreffend zu sein. Doch bleibt diese Umzingelung nicht ohne Folgen für das Subjekt.
In gewisser Weise war er ein glücklicher Mensch. Er fühlte sich, nicht zu Unrecht, als Akteur der telematischen Revolution. Er empfand tatsächlich jede Erweiterung der Macht der Informatik, jeden Schritt hin auf die Globalisierung des Netzes als persönlichen Sieg. (Houellebecq 42)
Die in der obigen Textstelle angedeutet Identifikation J. -Y. Fréhaut´s mit den technologischen Entwicklung lässt eine Überblendung von „ich“ und medialer Umwelt erahnen. Die Identifikation J. -Y. Fréhauts, seine Identität gewinnt er nicht als Bürger einer Nation oder einer beispielsweise als Mitglied einer religiösen Vereinigung, sondern eben über seine mediale Umwelt. So kann diese Textstelle nicht nur Carpenters These stützen, sondern auch Bolz´ Überlegungen zu der Weltgemeinschaft der Kommunikation (vgl.: Bolz 2000, 85)
Staffel
LARS Filmende. Ich verlasse das Kino. ‚Hass’ von Mathieu Kassowitz. Ich laufe die Treppen runter und rieche schon den Schnee von draußen. Ich starre auf die Haare der Fresse, die eben noch vor mir saß. Sie sind nass, obwohl er noch keinen Fuß vor die Tür gesetzt hat. (Staffel 7)
Lars verlässt zu Beginn des Romans „Terrordrom“ das Kino: von draußen weht der Geruch von Schnee herein, und ein anderer Kinobesucher hat bereits nasse Haare, bevor er das Gebäude verlässt. Dies kann als Ineinandergreifen der beiden Räume, Kino/Medialität und Stadt interpretiert werden. Die Grenzen verwischen. Die Räume dringen in einander. Auf der Folie der schmidtschen Konzeption kann man Staffel hier folgendermaßen lesen: Wir leben nicht nur in einer Medienkultur, sondern in einer Medienrealität. Die Stadt ist nicht länger nur Stadt, sie ist, wie alles andere der Medienpoesis unterworfen. D.h. die Stadt ist ein Stück weit Medium, Medien sind ein Stück weit Stadt, und beide Bereiche haben keine festen Grenzen mehr.
Realität der Medien
Durch die bisherigen Ausführungen schimmert eine Frage hindurch: gibt es eine Realität jenseits der Medien? Mit Boenkmann führt Schmidt108an: dass vor allem Kinder und Jugendliche oft nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können. Dass Medien das Wirklichkeitsbild verzerren und die Mediennutzer der Möglichkeit von eigenen Erfahrungen berauben.
Im obigen Falle müssen wir annehmen, dass wie im Falle der Wahrnehmung, bei der Schmidt von verschiedenen Realitäten spricht, - nämlich von erfahrungsdiesseitiger und erfahrungsjenseitiger - , wir hier ebenso eine medienunabhängige, und einer me- dienabhängige Realität zu unterscheiden haben. Die Veränderungen der Realität durch die Medien, sind meiner Meinung nach in der erfahrungsabhängigen Realität zu suchen, nicht in der erfahrungsjenseitigen. Und ebenso wie die erfahrungsunab- hängige Welt für uns nicht erreichbar ist, ist für uns heute, die medienunabhängige Welt zu erfahren. Wir treffen immer wieder auf vorgefertigte Erfahrungen, und Bil- der.
Mediale Realität und reale Realität
Derlei Feststellungen müsste eigentlich eine klare Unterscheidung von Medienwirk- lichkeit und Realität vorausgehen. Boenkmann meint allerdings eine soziale Wirk lichkeit. Dennoch ist die mediale Wirklichkeit, oder besser gesagt Fiktion bereits unentwirrbar mit der sozialen verwoben, und eine solche Trennung lässt sich nicht mehr durchführen. Denn ein mediales Angebot muss sich ja immer schon auf einen Kommunikationszusammenhang stützen, um Anschlusshandlungen zu provozieren. Mir scheint das Problem dergestalt, dass je stärker und nachhaltiger der Einfluss der Medien auf unsere Gesellschaft ist, desto mehr treten andere kulturelle Einflüsse zurück. Es ist also nur eine Frage der Zeit, und der Entwicklung der Medien natür- lich, dass in unserer Gesellschaft der Sozialisationsprozess ausschließlich über au- diovisuelle Medien bewerkstelligt wird109.
Wobei in einigen Subkulturen unsere Gesellschaft, oder wie Schmidt sagen würde: funktional ausdifferenzierte Subsysteme, die aber für die Öffentlichkeit kaum beobachtbar sind, durchaus Gegenbewegungen entwickeln können.
Ebenfalls interessant scheint mir die Frage nach der kognizierten Realität der Objek- te. Geht der Einfluss der Medien so weit, dass er nicht nur die Wahrnehmung, son- dern tatsächlich die Realität von Dingen beeinflusst, sozusagen das kantische Ding an sich? Über den Umweg von Wissensständen und Einstellungen110, die Massenme- dien sehr leicht beeinflussen können ist eine Beeinflussung der erfahrungsjenseitigen Welt durchaus denkbar. Über den direkten Einfluss der Medien auf die Kognition, und somit auch der Kommunikation und Kultur, wenn wir Schmidt folgen, haben Medien direkten Einfluss auf die ‚Dinge an sich’, dadurch, dass sie den menschli- chen Handlungen unterworfen sind.
Um so plausibler scheint nach dieser Überlegung die Aussage Carpenters zu sein, der Medien tatsächlich als Umwelt betrachtet.
DeLillo
Eine Stelle in Don DeLillos „Unterwelt“ kann den Zusammenhang von Medialität und Realität anhand der Gegenüberstellung der Produkte und der Werbung für eben diese gut illustrieren:
Er fuhr in den spuckenden Qualm von Riesenflächen verschmorter Lkw-Reifen, die Flugzeuge rauschten herunter, die Schwenkkräne standen in Reihen an den Docks, und er sah Werbetafeln für Hertz und Avis und Chevy Blazer, für Marl- boro, Continental und Goodyear, und ihm wurde klar, dass alle Dinge um ihn her, die startenden und landenden Flugzeuge, die rasenden Autos, die Reifen an diesen Autos, die Zigaretten, die die Fahrer dieser Autos in ihren Aschenbe- chern ausdrückten - sie alle befanden sich auf den Werbetafeln ringsum, sys- tematisch in einer selbstbezüglichen Beziehung verbunden, die etwas neuro- tisch Verkrampftes hatte, etwas Unentrinnbares, als würden die Plakatwände Wirklichkeit hervorbringen [...]. (DeLillo 216)111.
Es scheint so, als ob eine Art Verdoppelung oder besser eine Teilung der Realität stattfindet: Auf der einen Seite die Waren, auf der anderen Seite die Werbung für diese Produkte. Doch DeLillo beschreibt eine andere Empfindung. Es scheint als würden die Plakatwände Wirklichkeit hervorbringen: Die Produkte scheinen den Werbeflächen zu entspringen. Die Realitäten der beiden Bereiche scheinen eng miteinander verwoben, gehen in einander über. Aber die Werbetafeln propagieren eine andere Wirklichkeit, als die, die sie tatsächlich hervorbringen.
Als er am Flughafen Newark vorbeifuhr, merkte er, dass er alle Abzweige und die damit verbundenen Möglichkeiten verpasst hatte. Er suchte nach einer freundlichen Ausfahrt, lastwagenfrei und ländlich, und war kurze Zeit später auf einer zweispurigen AsphaltStraße, die unentschieden durch Teichkolben- sümpfe führte. Er spürte einen leicht beißenden Salzwasserhauch in der Luft, und die Straße machte einen Knick und endete zwischen Kies und Unkraut. Er stieg aus und erklomm einen Erdwall. Der Wind war so steif, dass ihm die Trä- nen in die Augen traten, und er schaute über einen schmalen Wasserarm zu ei- ner terrassierten Erhebung auf der anderen Seite. Sie war rötlichbraun, oben ab- geflacht, und monumental, der Sonnenuntergang brannte am Himmel, und Bri- an glaubte schon an eine Halluzination, einen typischen Restberg Arizonas. Aber das war echt und menschengemacht, umschwirrt von kreisenden Möwen, und er wusste, es konnte nur eins sein - die Fresh-Kills-Aufschüttung auf Sta- ten Island. (DeLillo 217)
Die tatsächliche Realität ist der Müllberg. Nicht Freiheit auf dem Pferderücken, wie Marlboro das propagiert, sondern riesige Müllhalden. Auffallend ist, dass der Müllberg in der Erzählung irrealer erscheint, als die von den Werbetafeln verbreiteten Produktinformationen, und ihre realweltlichen Manifestationen. Der die Sicht trübende Wind, die untergehende Sonne verleihen dem Moment etwas Visionäres, und erscheinen deshalb auch etwas weniger real als die Marken.
An dieser Textstelle lässt sich außerdem eine empfundene Ausweglosigkeit belegen, „er hatte alle Möglichkeiten verpasst“. Die Vermüllung scheint unausweichlich.
Durch die Stelle wird zudem verdeutlicht, dass auf der einen Seite durch die Werbung eine virtuelle, aber dennoch reale Realität hervorgebracht wird, auf der anderen Seite aber andere Realitätsaspekte, wie der Müllberg auf Staten Island vor der Öffentlichkeit ausgeblendet werden. Was sich an der verkehrsarmen Lage des Müllbergs belegen lässt. Welche Ebene aber ist realer?
Er will, dass ich in den Zoo gehe, weil Tiere etwas Reales sind. Ich habe ihm gesagt, das sind Zootiere. Tiere, die in der Bronx leben. Im Fernsehen kann ich Tiere im Regenwald oder in der Wüste sehen. Also bitte, was ist echt und was ist falsch, da musste er lachen. (DeLillo 243)
Im Grunde stützt dieser Ausschnitt Kramers Überlegungen112zum Tourismusutopia, wenn man den Aspekt des Tourismus aus seinen Überlegungen herausnimmt und verallgemeinert. Auch er behauptet, die Inszenierung ist nichts virtuelles, sondern manifeste Realität.
Komunisierung der Massenmedien und die Gefahren für die Demokratie
Merten stellt die Behauptung auf, dass die Massenmedien keine Kommunisierung auf der Achse Kommunikant/Rezipient bewirken, wohl aber zwischen den Rezipien- ten. In den Massenmedien wird ein virtuelles soziales System hergestellt. Beide, in- teraktive sowie Massenkommunikation, stehen dennoch in einem engen Bezug zu- einander. „Man spricht über das Fernsehen, und das Fernsehen spricht worüber man spricht. (Schmidt 1994 a, 65).
Goetz
In Goetz´ „Rave“ kann man einen Beleg für diese Kommunisierung finden.
„Erwarten Sie - jetzt keine Wunder - aber etwas Wunderschönes!“ Anne liest aus der ‚Petra’ eine Anzeige von ‚Philips’ vor. Es geht um Cellulite. „oder sagt man Cellulitis?, wie Harald Schmidt jetzt sagen würde“ sagt Anne. (Goetz 1998, 112f)
Anne, die einen Artikel aus einem Lifestylemagazin vorliest, ist selbst publizistisch tätig. Ihr Kommentar zu dem Artikel ist durch massenmediale Einflüsse geprägt. Sie bezieht sich auf die Harald Schmidt Show, und damit ist auch der Medienschaffende von der kommunisierende Wirkung der Medien betroffen.
Bedenklich in diesem Zusammenhang finde ich, dass der graue Alltag eines Jeden Eingang in die Boulevardmagazine der privaten Fernsehsender findet; je grauer desto besser. Man erinnere sich an „Maschendrahtzaun“. Oder an die „Real - live“ - Soap Big Brother. Aber was ist an dieser Entwicklung so besorgniserregend? Derlei Sen- dungen enthalten keinerlei problematischen Inhalt: So enthalten solche Sendungen überhaupt keinen politischen Inhalt. Und das ist die politische Aussage dieser Forma- te. Der Transport völlig a-politischer Subjektkonzeptions-Vorbilder. Auf diese Weise wird eine a-politische Haltung kommunisiert, um in der Terminologie Schmidts zu bleiben. Darin liegt auch die Problematik, wie dies in den folgenden Kapiteln „Isola- tion der Weltgesellschaft“ und „Exkommunikation des Bürgers“ noch weiter thema- tisiert werden wird.
Wir leben - zu unserem großen Glück - in einer pluralen, demokratischen Gesellschaft, und das soll auch so bleiben. Wenn man aber den Begriff wörtlich nimmt, und also das Volk herrschen soll, so bedarf es des politischen Engagement jedes Einzelnen. Wird nun aber die Masse der Bevölkerung zu einer unpolitischen Haltung angeregt, so steht das demokratische Prinzip in Zukunft in Frage.
Denn, besteht für politische Entscheidungen in der Masse kein Interesse, so werden sich diese Diskussionen mehr und mehr der Kontrolle einer breiten Öffentlichkeit entziehen, zu Verwaltungsakten werden, und andere Interessengruppen werden stärker ihre Interessen durchsetzen können.
Diese Gefahren für Demokratie und Bürgertum sehen in vergleichbarer Weise auch Nelting, Faßler und Bolz. Sie fürchten eine Entdemokratisierung, eine Exkommuni- kation des Bürgers, eine Auflösung der Instanz des Bürgerlichen, eben gerade durch das ‚Rauschen’ der neuen Medien. Doch wie Flusser angemerkt hat, findet diese Ex- kommunikation nicht alleine durch die Anwesenheit oder die technischen Vorausset- zungen statt. Er sieht eine Absicht hinter den Medien. Diese Absicht ist es, nicht die
Medien selbst, die zu den später genannten Prozessen führen. Daran knüpft sich die Frage, welches politische Ziel mit der intendierten Medienpoesis verfolgt wird.
Özdamar
Die Özdamar zeigt in einem umgekehrten peripheren Blick113, nämlich von Deutschland aus in die Türkei, die Radikalisierung und Spaltung der türkischen Bevölkerung, die durch die Zeitungen bewirkt wird, und dadurch belegt werden kann. Nehmen wir an, dass z.B. die Islamisten und die Grauen Wölfe durch Zeitungen radikalisiert wurden, so kann man anhand von Özdamars Bild zeigen, dass die Massenmedien eben doch kommunisierende Wirkung haben.
Die faschistische Gruppe ‚Graue Wölfe’ liefen durch die Straßen, ich hörte ihre Stimmen aus dem Schulfenster, während ich Zeitung las. Sie schrien: ‚Die Tür- kei wird der Friedhof der Kommunisten.’ In der Zeitung stand der Bürgermeis- ter von Istanbul hat den Minirock verboten, und die religiöse Gruppe sagten: ‚Die Milch der Kuh ist besser als die Milch einer ungläubigen Frau. Wenn man eine Mutter sucht, muss man eine gläubige Frau suchen. Es lebe unser Militär! Unser Ziel ist der Islam. (Özdamar 254)114
Der periphere Blick aus deutscher Perspektive ist in zweierlei Hinsicht nützlich: Zum einen sind die hiesigen Positionen nicht derart deutlich von einander getrennt. Zum anderen verstellt im obigen Beispiel kein subjektiver Standpunkt eine objektive Sicht der Dinge. Die Kommunalisierung der einzelnen Gruppen sieht Özdamar derart grundlegend, dass diese gleichsam in verschieden ‚Sprachen’ geschieht:
An den Zeitungskiosken hingen die linken, faschistischen und religiösen Zei- tungen nebeneinander, alle in Türkisch, aber es war wie drei Fremdsprachen. (Fessmann)115
Dieses Bild der verschieden Sprachen verdeutlicht, wie tief der gesellschaftliche Ein- schnitt gehen kann. Die Heldin war lange Zeit nicht den Meldungen der türkischen Zeitungen ausgesetzt und hat daher Verständnisprobleme. So könnte man an diesem
Beispiel argumentieren, dass verschiedene publizistische Strömungen nicht nur zur Gruppenbildung anregen, sondern auch eine art ‚Ideolekt’ ausbilden und so noch stärker die Gruppen voneinander abtrennen. Die Aussprüche der Grauen Wölfe und der Islamisten können da - in ihrer Unterschiedenheit - als Beispiel dienen.
Bürgerliches Subjekt und‚neue Medien’
Die Zeit der Weltkommunikation
Bolz versucht dem Problem, dass unsere Welt immer unbeobachtbarer wird, mit ei- ner neuen Methode Herr zu werden: „Der Blick auf die Welt kann heute nur konkre- ter werden, wenn man stärker abstrahiert“ (Bolz, 81). Wer solches annimmt, kann nicht auf den Begriff der Gesellschaft verzichten. Gesellschaftliche Phänomene sind scheinbar bereits so komplex, dass man - nach der Annahme Bolz´ - nur noch mit den Mitteln extremer Komplexitätsreduktion arbeiten kann. Diese methodische Not- lage gab es bereits in der sich entwickelnden Großstadtsoziologie der Jahrhundert- wende; man hatte plötzlich eine Vielzahl verschiedenster Individuen zu beschreiben. Man begegnete dem Problem mit den Modellen der Typik und der sozialen Person. Nun stehen wir laut Bolz vor einem ähnlichen Problem: Bolz´ Lösungsvorschlag ist es, die Weltbevölkerung unter der Prämisse der Weltkommunikation zu betrachten. Implizit unterstellt er, dass audiovisuelle Medien global vernetzt sind; dass diese Medien weltweit gleiche Aussagen machen. Andernfalls wären diese Medien nicht in der Lage, die Teilnehmer zu der von Bolz und Luhmann behaupteten Weltgesell- schaft zu kommunisieren.
In gewohnter Wortgewalt, aber wenig stringent - wie gewohnt - macht Bolz einige sehr interessante Überlegungen über den Zusammenhang von Bürgerlichkeit und neuen Medien. Bürgerlichkeit im Sinne von selbstbestimmten Subjekten und Bür- gern eines demokratischen Staates. Ganz besonders wichtig scheint ihm die Globali- tät der Kommunikation zu sein. Er schließt daran an, dass es sich auch um eine Weltgesellschaft116handelt. Bolz´ Ausführungen stützen die schmidtschen Überlegungen einer Medienkultur. Bolz nimmt an, dass im Sinne der Weltgesellschaft nur noch von Kommunikation die Rede sein kann. Wobei bei Bolz die Begriffe Kommunikation und Medien ineinander fließen, die Schmidt einzeln betrachtet, obwohl sich beide gegenseitig bedingen. Faßler spricht von der Exkommunikation des Bürgers. Seine Ausführungen gehen in gleiche Richtung wie die von Bolz.
Niklas Luhmann hat unterstellt, dass es nur noch einen möglichen Begriff der Gesellschaft gibt, den der Weltgesellschaft.
In der Welt der Kommunikation werden Wirkungen durch Unterschiede, statt durch materialenergetische Ursachen erzeugt. Wir leben in einer Welt der Bits. Er [Luhmann] nennt das die „Symphysis der Weltgesellschaft“ Information ist „any difference, that makes a difference“. (Bolz 2000, 82f)117
Bolz scheint hier den medialen Auslösemechanismen mehr Kraft und Bedeutung zuzumessen als tatsächlichen Ereignissen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird hierauf noch eingegangen werden.
Diese Argumentation hat für die Untersuchung der Weltkommunikationsgesellschaft weitreichende Folgen: Technische Details, etwa computergestützte Kommunikation über das WWW ist für das Verständnis ihrer „Systemischen Funktion“ (Bolz 2000, 82) nicht maßgebend. Dennoch verändern diese neuen technischen Voraussetzungen die Struktur von Kommunikation.
Bolz behauptet, im Gegensatz zu Kittler118, dass die technischen Voraussetzungen bestimmter Medien zunächst keinen Einfluss auf Inhalte haben. Dennoch bleiben sie auf lange Sicht nicht ohne Wirkung für die Kommunikation. Seine Behauptung: „Die Operation des Kommunizierens hat mit der Materialität des Kommunizierens nichts zu tun“ (Bolz 2000, 81).
So konnte Jäger nachweisen, dass sich z.B. durch das Internet der Prozess der wis- senschaftlichen Kommunikation zwar vorläufig nicht Inhaltlich verändert, dennoch die Wege für Publikationen, z.B. durch Open-Peer-Commentary erheblich verkürzt werden. Nun lässt sich darüber streiten, ob die erhöhte Geschwindigkeit der Kom- munikation auch tatsächlich den Inhalt derselben verändert, aber es ist doch ein di- rekter Einfluss auf die Kommunikation, durch die technischen Voraussetzungen.
Isolation der Weltgesellschaft
Die Gesellschaft kann - laut Bolz - nur noch unter dem Aspekt der Kommunikation betrachtet werden.
Gesellschaft ist Weltgesellschaft. Sie ist das was sich ergibt, wenn die Welt durch Kommunikation verletzt wird und über Differenzen rekonstruiert werden muss. [...] Die Kommunikation teilt die Welt nicht mit, sie teilt sie ein in das, was sie mitteilt, und das, was sie nicht mitteilt. (Bolz 2000, 82)
Mit der Kommunikation wird die Grenze zwischen Individuum und Umwelt aufrechterhalten. Mit dem Schema Natur wird die Außenwelt bezeichnet, mit dem Individuum das Innerpsychische. Diese Einteilung nennt Bolz die apriorischen Umweltprobleme der Weltgesellschaft.
Die bolzschen Beobachtungen lassen sich auch mit dem Übergang von Klassenlage zu Risikolagen beschreiben: „In Klassenlagen bestimmt das Sein das Bewusstsein, in Risikolagen umgekehrt das Bewusstsein (Wissen) das Sein“ (Beck 70). Die Beobachtungen, die Beck für die Risikogesellschaft macht, lassen sich auch auf das Verteilen von Informationen und Kommunikationen parallelisieren.
Man kann die Welt nicht von außen betrachten, sondern muss sie von innen „verletzen“. Mit dieser Einsicht macht die Theorie den spezifisch modernen Schritt von den vielen möglichen Welten zur Welt der vielen Möglichkeiten. Welt ist nun die virtual reality, die gewissermaßen auf die Beobachtungsoperationen und Informationsverarbeitungsprozesse wartet; jede Unterscheidung wird dann zum Zentrum der Welt. (Bolz 2000, 82)
Der Prozess, den Bolz hier beschreibt, bedeutet die absolute Individualisierung, ein gesellschaftlicher Rückzug auf das wahrnehmende Subjekt. Eine postmoderne Inner- lichkeit sozusagen. „In der Umwelt der Weltgesellschaft kann nichts Soziales mehr vorkommen“ (Bolz 2000, 83). Demnach ist auch Flussers Sichtweise der Medien- konsumenten, die er amphitheatral (wie in einem Amphiteater um die Bühne herum) um die Medien versammelt sieht, und somit eine Parallele zum Lagerfeuer der Stein- zeit mit den Medien zieht, aufgebrochen. Vielmehr scheinen sich bei Bolz die Me- dienangebote amphitheatral um das Subjekt zu scharen und es so zu isolieren. Folgt man der obigen Aussage, dann ist es nicht die Kommunikation, die die Grenze zur Umwelt aufrecht erhält, sondern die Grenzen zur Umwelt werden von der medienvermittelten Kommunikation neu definiert, und zwar in eine System, das aus Sender und Empfänger besteht, und der Umwelt, die dieses System ausgrenzt. Also ein ‚medial environment’119, wie Schmidt mit Carpenter argumentiert hat. Diese Sender/Empfängersysteme bilden die neue virtuelle Realität. Denkt man nun an Schmitds medienkulturellen Zusammenhang, so stellt sich die Frage, ob und wann diese Virtualität tatsächlich in Realität umschlägt.
Bolz stellt nun eine Hierarchie von zugrundeliegenden gesellschaftlichen Teilsyste- men auf.
Zuerst kommen die Interaktionen, dann die Institutionen, dann automome aber nicht autarke Teilsysteme der Gesellschaft. Interaktion bedarf aber der Anwesenheit der Interagierenden. Die Gesellschaft wird aber immer mehr von Interaktionen abge- drängt.120
„Aber die Bürgerschaft will heute Öffentlichkeit ohne Organisation. Für die Gesell- schaft dagegen genügt kommunikative Erreichbarkeit“ (Bolz 2000, 83). So steuern wir auf eine Gesellschaft ohne Bürger zu, die immer weniger durch Interaktion ge- kennzeichnet ist.
Bolz folgert nun das Aufbrechen staatlicher Grenzen. Auch religiöse Gemeinschaften zerbröckeln. Raum und Territorialität taugen immer weniger zur Symbolisierung von Gesellschaften. An ihre Stelle tritt die Gemeinschaft der Weltkommunikation.
Funktionale Differenzierung, die auf Universalismus und Spezifikation angelegt ist, löst Raumgrenzen auf. Man kann prinzipiell sagen: Je stärker ein System innen differenziert ist, desto problematischer wird die Definition seiner Außengrenzen. (Bolz 2000, 83)
„Der Bedeutungsschwund des Raumes zeigt sich auch daran, dass sich die Kommunikationsnetze immer mehr von den Verkehrsnetzen emanzipieren“ (Bolz 2000, 84).Bolz bringt hierzu einige Beispiele
1. Individuen orientieren sich nicht mehr an nationaler Identität, sondern am An- spruch auf Selbstverwirklichung.1212. Die DDR sieht Westfernsehen. „Die Politik hat ihre Führungsrolle in der Evolution der Gesellschaft verloren“, daher meint die Weltgesellschaft gerade keine politische Einheit der Welt; „Die Weltge- sellschaft hat kein Kollektivsubjekt und kein geschichtsphilosophisches Projekt“ (Bolz 2000, 84). Die Weltgesellschaft hat gerade ein Kollektivsubjekt und hat wohl auch ein geschichtsphilosophisches Projekt. Allerdings, so scheint es, lediglich nega- tiv. Aus der Perspektive Bolz´ kann diese Projekt aber nicht als produktive Utopie dienen. Denn das Projekt der Weltgesellschaft ist gerade die Auslöschung jenes Kol- lektivsubjekts, das Bolz im Sinn hatte und das sich vielleicht am besten mit ‚bürger- lich’ umschreiben lässt.
Die Weltgesellschaft besteht aus vielen kleinen Gruppen, die kollektiv einem Subjektentwurf nachsehnen. Solche Gruppen lassen sich z.B. gut in Goetz Romanen „Dekonspiratione“ und „Rave“ belegen. In „Rave“ gibt es eine Sozietät von Partyhungrigen Drogenabhängigen, die über Staatsgrenzen und Regionen hinweg gemeinsame Interessen verfolgen, nämlich: Party machen.
Die Globalisierung öffnet die Grenzen für Geld Information und Bildung Terror. Das schwächt natürlich auch die Regierungen der Nationalstaaten bei der Bekämpfung von Problemen, wie ökologischen und menschenrechten usw.
„Die Weltgesellschaft honoriert Lernbereitschaft, also kognitive Erwartungsstile“ (Bolz 2000, 85). Die Wirtschaft ist generell lernbereiter, als dies Regierungen sind.
Jeder kann mit normalen Lernleistungen als Fremder unter Fremden eigenen Zielen nachgehen. Aber wir haben ja schon den Vorbehalt gemacht: Interakti- on, die zwar Gesellschaft fundiert, führt nicht mehr zur Gesellschaft. Der genia- le Erving Goffman hatte in allem recht - aber eben keinen Gesellschaftsbegriff. Deshalb kann man zwar auf der Interaktionsebene Evidenzen für den Befund Weltgesellschaft finden. Um ihn zu begründen, muss man aber höher abstrahie ren, nämlich auf die Ebene von ökonomischer Globalisierung, politischer ranationalisierung und massenmedialer Weltkommunikation. (Bolz 2000, 85)
Gründe hierfür sind: Die Globalisierung setzt nicht am Ganzen an, sondern nur an einzelnen Funktionssystemen Wirtschaft, Wissenschaft und Massenmedien; daher auch die so genannten „Abweichungsverstärkungen: je größer die globalen Interdependenzen, desto größer die regionalen Differenzen“ (Bolz 2000, 86).
Die medientechnologische inszenierte One-World provoziert die spezifisch postmoderne Kompensation eines Pluralismus der Lebensstile. M.a.W., Identitätsdiskurse kursieren als Kompensation für den Universalismus der Weltkommunikation. (Bolz 2000, 86)
Wolfgang Welsch stellt die Frage: „Wundersam ist allerdings, dass der Funktiona- lismus zu einem Einheitsstil führte. [...] Warum ist der Funktionalismus122trotz der Unterschiedlichkeit der Funktionen so uniform?“ (Welsch 95) Vielleicht können wir mit Bolz die Antwort geben: „Funktionalismus ist ein Etikett“ (Welsch 95) und viel- leicht folgte die Architektur nicht wirklich den Funktionen der einzelnen Lebensli- nien und deren Erfordernissen, sondern ist der Funktion des Universalismus der Weltkommunikation unterworfen. Gerwin Zohlen beschreibt die Auswirkungen die- ser Uniformität: „Hier sieht´s aus wie in Singapur“ (Zohlen 23)123.
Da es nicht mehr wichtig ist, wo man fernsieht, zieht Bolz den Schluss, dass es nicht mehr sinnvoll ist, von einer Öffentlichkeit zu sprechen, sondern von einer Weltkommunikation zu sprechen.
Die städtische Bausituation spiegelt die viel behauptete Pluralität der Postmoderne wieder, für die sich immer weniger Belege finden lassen. Die Städte sind Symptom und Beleg der Universalität der Weltkommunikation. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die Weltwahrnehmung von der Kommunikationswahrnehmung gekennzeichnet ist. Medien liefern also „instantane kommunikative Integration der Weltgesellschaft“ (Bolz 2000, 87).
Das funktioniert nun weniger über Informationen als durch moralische Stan- dards. Massenmedien besorgen die soziale Koordination moralischer Perspekti- ven. Nun ist Moral aber ein Nahorgan und steht damit in unaufhebbarer Span- nung zur Weltweite der Telekommunikation. M. a. W.: Weltkommunikation er- zwingt eine Fernoptik in der Ethik und das macht die Menschen unsicher. Kann die Weltgesellschaft eine Fernethik ausbilden? Eine Frage für Philosophen. (Bolz 2000, 87)124
Zentraler Punkt ist auch, dass der Weltgesellschaft kein konkretes Handeln mehr entgegensteht. „So inszeniert die Weltkommunikation Fernsolidaritäten und Stellvertreternegationen“ (Bolz 2000, 87).
Goetz
In Goetz’ Roman „Rave“ versucht Schütte nach einer geplatzten Drogenübergabe einen gewissen Marc in Ibiza am Handy zu erreichen.
Schütte steht im Flughafen an einem offenen Telefon, von der Muschel aus aus Plexiglas rund umfasst. Schütte hat die Leitung unterbrochen und wählt aus dem Kopf die nächste Nummer. Das angerufene Handy gehört Marc und liegt auf einem der Couchtische in der Villa in Ibiza. Der Tisch schaut aus wie die bekannte Skulptur von Damien Hirst mit dem Titel: I WANT TO SPEND THE REST OF MY LIVE EVERYWHERE; WITH EVERYONE; ONE TO ONE; ALWAYS; FOREVER; NOW. Zwischen leeren Gläsern und vollen Aschenbe- chern, zerrissenen Zigarettenschachteln und einer Kreditkarte, einer Telefonkar- te, einem eingerollten Geldschein, Bierdosen, leeren weißen Briefchen und ei- ner Zellophantüte mit Kraut darin: liegt das Handy. Keine Musik, leises Stimmengemurmel. Doch das Handy rührt sich nicht. Schütte wartet, lauscht. Man hört die Ansage: ‚the number you have reached is momentary not avail- able.’ Schütte hängt ein. (Goetz 1998, 193f)125.
Durch das Telefonat wird scheinbar die räumliche Trennung zwischen dem Flugha- fen und dem Couchtisch in Ibiza aufgehoben. Goetz blendet die Räume übereinan- der, die Entfernung wie die Staatsgrenzen werden übergangen. Totale Erreichbarkeit, und dennoch findet keine Kommunikation statt. Über die letzte Barriere zwischen den Menschen kann keine Brücke geschlagen werden. So ermöglicht das Handy Kommunikation, bewirkt auf der anderen Seite aber auch deren Unmöglichkeit. Der neue zu erschließende Raum dämmert herauf, bleibt aber unerfüllte Utopie.
Das ‚Glück der Anschließbarkeit’126ist der Herrschaft der Technologie unterworfen, dabei befindet sich das Handy inmitten von Partymüll, es wird wie leere Bierdosen auf einer Kippe enden, wie alle Versprechungen der Mediapoiesis. Die Kommunika- tion wird wieder hergestellt, als man sich einen Tag später am Flughafen gegenüber steht.
Am nächsten Tag. Wieder Ankunft International im Frankfurter Flughafen. Wir passieren ungehindert den Zoll. Schütte erwartet uns schon. Marc hat ihm unse- re Verspätung zu spät angekündigt. Entschuldigung. Kein Problem. (Goetz 1998, 294)
An dieser Passage kann man eine Verschiebung auf der Erzählerebene feststellen: Das erzählte Ich macht eine gefährliche Drogenübergabe, passiert dabei die Zollkon- trolle. Erzählt wird aber die kommunikative Situation, nicht die Spannungen inner- halb des Ichs. Ob das Handy nun klingelt oder nicht, scheint wichtiger als der eigent- liche Grund für den Anruf. So kann man an dieser Stelle - auf fiktionaler Ebene - vielleicht schon das prophezeite ‚Weiße Rauschen’ Mc Luhans erkennen.
Anarchie der Information
Wichtiger als Inhalte von Kommunikation ist die Teilnahme an Kommunikation. „Das protestantische Reden wir miteinander“ (Bolz 2000, 87). Das Glück der An- schließbarkeit.
In Zeiten der Weltkommunikation ist Freiheit der Inbegriff von Kommunikati- onschancen. Und alle machen mit. Doch können einen Logik und Geschichte belehren: Keine Inklusion ohne Exklusion, kein Thema ohne Anathema. (Bolz 2000, 87f)
Welche Möglichkeiten grenzt die Weltgesellschaft aus? Die Weltgesellschaft grenzt alles aus, was nicht Kommunikation ist. Jenseits der Gesellschaftsgrenze ist die Sprachlosigkeit127. „Keine Musik, leises Stimmengemurmel“ (Goetz 1998, 193). Welt ist nichts als der Rahmen der kommunikativen Erreichbarkeit. Technologisches Symbol ist das Handy. So verbindet das Handy zwar die Gruppe der Handynutzer, sperrt aber gleichzeitig alle diejenigen aus, die nicht an der Handy- nutzung partizipieren. Auf der Ebene der Interaktionen spielt also die Richtigkeit der Kommunikationen, keine Rolle mehr. Wichtig ist also nicht mehr der Inhalt von Kommunikationen sondern die Tatsache, dass kommuniziert wird. Insofern wird auch Schmidts Kommunikationsbegriff plausibel, der Kommunikationen primär als soziale Handlungen beobachtet.128
Die Exkommunikation des Bürgers
Die Bürgerliche Gemeinschaft bricht in Zeiten der Medialisierung auf. Die Mediamorphosis „übernimmt jede Kultur ins Rauschen“ (Faßler 89). Faßler spezifiziert dieses Rauschen nicht näher; es ist fraglich, ob er damit auf Marshall McLuhans weißes Rauschen der Medien anspielt: Jenem Punkt der Entwicklung der Medien, an dem keinerlei Forminhalt über die Medien verbreitet wird, und so die Medien selbst zu ihrem eigenen Inhalt werden.
In Realitätsmomenten, die nie ganz Bild, nie ganz Subjekt, nie ganz Allgemeinheit, nie nur Code, nie nur Interface sind. Diese Hybride entziehen sich der Schwerkraft überlieferter Geist- und Institutionskonzepte. Kommunikation im Sinne vorausgesetzter (semantischer, symbolischer, repräsentationistischer) Communio ist dies nicht mehr, auch nicht im Sinne einer zu erreichenden Vergemeinschaftung. [...] Communio liegt nicht fertig im Kulturlager; Kommunikation kann sie auch nicht mehr herstellen. (Faßler 89)
Wichtigstes Merkmal der neuen Mediengesellschaft ist das ‚nicht mehr Dabeisein’ wie es Faßler nennt. Auch Beck erkennt derartige Mechanismen, er nennt sie „Eigenerfahrungslosigkeit“ (Beck 70).
Nicht Geschichte sitzt mit am Tisch, sondern Geschwindigkeit, nicht Überzeit- liches, sondern die Erfindungen des Zahlensinns. Optionen sind vielleicht der Rest dessen, was man Subjektivität nennen könnte. Nur, dass Medienmorphose nichts Optionales aufweist, es sei denn in geschützte, isolierter Infozelle. (Faß- ler 90)
Die computervermittelte Kommunikation schlägt das Bürgertum mit den eigenen Waffen. Denn die ehemaligen Qualitäten des Bürgerlichen: Bildung, Wissen, Information und Kommunikation wurden ökonomisiert.
Immaterielle (genauer körperlose) Güter beherrschen die Weltmärkte und Nati- onalökonomien. Das Angesicht verschwindet aus einer zunehmend technologi- schen Umgebung, und zugleich intensiviert sich die Konkurrenz um die Bedeu- tung des Virtuellen, alias Geistigen. [...] Die Frage nach dem Bürgerlichen, gar dem Weltbürgerlichen, ist weniger die Frage nach früherer Identität. Es ist die Frage nach den Chancen, globale Prozesse noch in irgendeiner Weise kulturell einhegen zu können, ganz gleich wie man das Ergebnis nennt. Aber den Namen Bürger oder Hacker wird das zivilisatorische Gebilde nicht tragen können: Bür- ger nicht, weil die ihm eigene Verallgemeinerung weltweit verstanden werden, auch ohne die zugehörige Klassengeschichte, nämlich als Individualitätsrechte; Hacker nicht, weil dies fern jeglicher auch noch so kleinen Allgemeinheit ist. (Faßler 91)
Die Frage ist also: Was ist an medialen Netzwerken bürgerlich? Gibt es künstliches bürgerliches Brauchtum? Denkbar wäre, dass sich „Die Architekturen medialer anthropologischer Räume evolutionär von den bisherigen sozialen und kulturellen Formaten der Menschheit lösen [...]“ (Faßler 92).
Welt und Kommunikation sind mittlerweile von - in erster Linie technologischer - Beständigkeit gekennzeichnet. Kann deshalb das Bürgerliche weiterhin als Interpretant für das „multimediale Multiversum“ dienen? „Das Bürgerliche kann nicht als Herkunftsutopie dienen“ (Faßler 92). Sondern das Bürgerliche ist die Herkunft. Um Faßler zu widersprechen: das Bürgerliche kann nicht mehr als Herkunftsutopie dienen und auch keine Identifikationsmuster liefern.
Faßler stellt einen Wandel fest vom Selbstentwurf hin zur Normierung der Herkunft, in diesem Prozess werden die Ereignisse in die Unbeobachtbarkeit getrieben. Dem stellt Fassler - in bester germanistischer Terminologie - das Eigenrecht der Gegen- wart gegenüber, ich vermute, dass damit so etwas wie eine reine, eigene Wahrneh- mung gemeint sein muss.
Künstliche Welten sind für Faßler neue Orte der in Frage gestellten Bürgerlichkeit:
Das Wissen und die Erinnerungen entstammen immer reichhaltiger diesen Welten [multimediale Multiversen]. Sie sind nur dort lokalisierbar. Und ‚dort’, in den Knoten und Kanälen, in Speichern und Interfaces, verliert sich das festgeschnürte bürgerliche Ich im empfunden Haltlosen. Rückgriffe und Rückschritte stehen dann, das heißt auch jetzt, auf der Tagesordnung, eben Behauptungen, alte Gesichter, alte Namen. (Faßler 94f)
Goetz
Goetz macht eine Aufzählung der einzelner Organe, die der sogenannten „K-Presse“ zuzuordnen sind.
Die „K“ - Presse also zum Beispiel: ‚Marie Clair’, ‚Allegra’, ‚Maxi’, ‚Max’, Frauen Magazin’, ‚Cosmopolitan’, ‚Prima Carina’, ‚Für Sie’, ‚Men´s Health’, ‚Haar Schaft’, ‚Madame’, ‚Vouge’, ‚Coupé’, ‚Bellevue’, ‚Brigitte’, ‚Tina’, ‚Y- oyo’, ‚Annabelle’, ‚Emanuelle’, ‚Isabelle’, ‚Elle’, ‚Praline’, ‚Anne’. (Goetz 1998, 113)
Mit dieser Aufzählung und Klassifizierung will Goetz meines Erachtens zeigen, dass Anne, die für Petra schreibt, selbst sozusagen „K“ - Presse ist. Dass sie ihren Livestyle selbst aus den aufgelisteten Magazinen entleiht und ihn sich zu eigen macht. Sie ist ihr eigenes Livestylemagazin. Ein magazinisiertes Subjekt sozusagen. Dadurch steht Anne in einem gewissermaßen doppelt reflexivem Verhältnis zu den Medien: Sie ist Produkt der Medien und produziert auf der anderen Seite selbst Medien. Sie kann als Personifizierung der im Kapitel Wirklichkeit beschriebenen Reflexivität der Medien gelesen werden. Die oben beschriebene Anne aus Goetz Roman „Rave“ ist nicht nur zufällig weiblich. Gitta Mühlen Achs untersuchte die verschiedenen Charakteristiken von Frauen- und Männerzeitschriften.
Während die große Masse sogenannter Frauenzeitschriften unisono darauf ab- zuzielen scheint, Frauen das gängige Weiblichkeits- und Beziehungsideal an- schaulich vor Augen zu führen und sie auf dieses gleichsam einzuschwören, wird jungen Männern nichts dergleichen angeboten. Ihnen wird vielmehr ein äußerst umfangreicher und gut sortierter Markt von Fun- und Sachzeitschriften zur Verfügung gestellt, der ganz andere - auch ausgefallenste - Bedürfnisse und Interessen bedient (Comics, brutale Action, Sex, Informationen über Autos, Motorräder, Sport, Computer, Musik, etc). Es gibt keine einzige - den Mädchen und Frauenzeitschriften vergleichbare - Jungen- oder Männerzeitschrift, die es als ihre primäre Aufgabe betrachtet, ihren Lesern explizit „Männlichkeit“ bei- bringen (sic!), sie bezüglich der Phantasien und Wunschträume des anderen Geschlechts auf dem laufenden zu halten und ihnen Tipps zu geben, wie sie ih- re heterosexuelle Anziehungskraft verstärken und erhalten könnten. (Mühlen Achs 13)
Zeitschriften für Männer scheinen also nach Mühlen Achs inhaltliche Interessen zu befriedigen, hingegen Frauenmagazine tatsächlich mehr die Rolle der Frau an sich zu thematisieren. Mühlen Achs konnte ein Grundmuster der vermittelten Frauen- und Mädchenbilder destillieren.
Sie zeigten auf, dass insofern ein Doppelstandard etabliert wird, als Aktivität einseitig nur den Jungen zugewiesen bzw. zugestanden wird, während die Mäd- chen auf Passivität und Verantwortung verpflichtet werden. Allenthalben stie ßen sie auf das traditionelle Rollenklischee von der passiven Frau, deren höchs- tes Glück darin liegt, sich einem aktiven Mann ‚hinzugeben’. (Mühlen Achs 13)
So könnte man vielleicht behaupten, dass die neuen Medien hauptsächlich ‘weiblich’ sind. In Staffels „Terrordrom“ kann zwar kein Hinweis auf Sozialisation durch Printmedien für die Person Annas gefunden werden, doch ist das Rollenverhalten traditionell, im Sinne des obigen Zitates. Mühlen Achs Erkenntnisse, auf den Annahmen von Schmidts Medienkultur gelesen, sowie Staffels und Goetz Figuren Anna und Anne zeigen, dass die Richtigkeit von Becks Vermutung, nämlich des Aufbrechens der Geschlechterrollen, der „Geschlechtslagen“ (Beck 117f) immer unwahrscheinlicher wird129, ja sogar als falsch angesehen werden kann.
Nach Faßler hat das Bürgertum alles erreicht, zunächst in Koalitionen mit dem Adel, dem Kaiser, mit der Reichswehr, mit den Faschisten, schließlich das bürgerliche Ge- setzbuch, bürgerliche Parteien. Nach 1949 schwenkt das Koalieren in eine plurale Demokratie um. Diese Pluralität wurde in den Volksparteien eingefangen. „oder, wie es im US-amerikanischen direkter heißt: durch ‚catch all parties’“ (Faßler 95). In dieser pluralen Gesellschaft musste sich das bürgerliche Subjekt aus Zwängen der Dressur befreien, „ein sich riskierendes Ich und Selbst zu sein“ (Faßler 95). Ob sich das Ich tatsächlich aus den Zwängen der Dressur befreien konnte, oder ob sich die Bewegung der Modernisierung nicht einfach fortgesetzt hat, sei an dieser Stelle da- hin gestellt. Für mich scheint eher das letztere der Fall zu sein. Das „sich riskierende Ich“ der Nachkriegszeit - wie es Faßler nennt, kann genauso gut als wiederum verin- nerlichter Zwang erlebt werden. Für mich stellt diese Entwicklung nur einen weite- ren Schritt in der Domestizierung des Menschen dar. In gewisser Weise stellt die Entwicklung nach 1945 eine Befreiung von Zwängen dar. Hohl nimmt für den Fall der Auflockerung bestimmter Zwänge eine „Verstärkung der Selbstkontrolle“ der Individuen an. Wir sind nun frei uns selbst zu bestimmen, haben aber auf der anderen Seite die Pflicht dazu.
Wissen orientiert sich nicht an Territorien. Dieser neue befreite Bürger sieht sich nun natürlich ganz neuen Ereignissen gegenüber.
Durch die endlosen Bilder und Kommunikationen erzeugt die Konsumentenkultur Druck auf das westliche Denken. Weltweit bilden sich Hybride westlicher Kultur und gehen ihren eigenen Weg. Die Hybridisierung beschränkt sich aber nicht auf das „crossing of culture. (Faßler 98)
Wenn aber die Unterschiede verwischen, dann verlieren auch nationale Protektio- nismen an Bedeutung. Wenn man die Welt nicht mehr territorial beschreiben kann, dann muss man neue Relationen untersuchen. Ein erneuter Blick auf Oelmüllers Ü- berlegungen:
Ein Subjekt ‚ohne Identität’ kritisiert, ja sprengt vielmehr solche Selbsterhal- tungsidentitäten von der Nähe und Distanz, von dem Antlitz des Anderen aus, des anderen Mitmenschen sowie des räumlich und zeitlich abwesenden Ande- ren, Gottes. Von einer Identität des Subjekts ‚ohne Identität’ - wenn man so sprechen will - kann in einer radikalen Weise nur von dem so gedachten ande- ren Mitmenschen bzw. von dem so gedachten Gott aus gesprochen werden. (Oelmüller 48)
Vielleicht, wenn wir Oelmüllers Aussagen positiv bewerten wollen, könnte man das identitätslose Individuum als Utopie verstehen, das sich vom Ballast der Communio befreit sieht, und keinen (bürgerlichen) Werten mehr verpflichtet, und auf diese Weise die Chance hat, zu sich selbst zu finden. Ich glaube nicht.
Und die Idee des Weltbürgers? Einfach vergessen, überlesen? Ja, wäre es denn so einfach! Die hauptsächliche Konfliktlage besteht derzeit darin, dass die Wir- kungstiefen der nationalen, territorialen, protektiven Codierungen von Identität, Zugehörigkeit und Anwesenheit unklar sind oder aufgefrischt werden. Es sind dies Codierungen, die Beständiges, Überzeitliches, Ursprüngliches, Eigentli- ches fixieren, jenseits von Technik, Medialität, interkulturellen oder transitori- schen Beziehungen. (Faßler 99)
Die Frage nach dem neuen Menschenformat ist also nach wie vor ungeklärt und da- mit auch, ob wir zukünftig noch von Individuen und von Subjekten werden sprechen können (Baumgartners unauslöschbare Subjektivitätsaspekte ausgeschlossen).
„Das Bürgertum hat alles erreicht - eben auch sein Ende. Oder doch nicht?“ (Faßler 96).
Schlussbemerkungen
Die Einheit der Stadt kann erst im innerpsychischen geleistet werden, daher ist die Realität der Stadt von den Diskursen über sie abhängig. Realitätsproduktion wird bis zu einem gewissen Maß durch Medien geleistet. Der Sinnzusammenhang der Stadt wird erst im kognitiven System geleistet; die Sinnproduktion ist ebenso abhängig von der Ansehung wie die Wahrnehmung. Wahrnehmen ist immer ‚wahrnehmen als’. Durch mediale Diskurse ist diese Ansehung sehr leicht zu beeinflussen. Das bedeu- tet, dass die Realität der Stadt im wahrnehmenden Subjekt über verschiedene Diskur- se beeinflusst wird, zumal die Einheit Stadt immer mehr von hyposignifikanten Sys- temen konstituiert wird. Diese Beeinflussung gab es aber auch schon vor den neuen Medien. Die neuen Medien schaffen im Falle der Realität der wahrgenommenen Stadt, oder des Images einer Stadt, also nichts grundlegend neues; lediglich die Qua- lität der ‚Maskierung’ also der Schaffung von Stadtansichten oder Stadtansehungen hat sich verändert. Anders beim Subjekt: Die neuen Medien bilden scheinbar eine neue Art von Umwelt für die Menschen, insbesondere der Städter. Die Stadt ist also in gewisser Hinsicht selbst Medium130geworden. Ein Trägermedium wiederum für andere Medien. Ein Medium für Medien. Der Mensch ist, obwohl er sich räumlich im Binnenbereich der Stadt befindet, tatsächlich aus der Stadt als solcher herausge- löst. So erklärt sich vielleicht, dass in den meisten Romanen, die Stadt selbst nicht mehr thematisiert wir. Die neuen Medien sind quasi eine Interjektion, ein Einschub zwischen Mensch und Stadt, so wie die Stadt eine Interjektion zwischen Mensch und Natur ist. So büßt die Stadt ihre Bedeutung alsLebensraumund Ort der Interaktion ein und wird, wiederum zum Speichermedium131. Nicht für Text wie bei Butor, son- dern für eine besondere Programmeinheit, die für die Produktion nötig ist: Dem so- zialen Subsystem Individuum. Damit ist ein Endpunkt in der Stadtentwicklung er- reicht. Ein Punkt in der Entwicklung, an dem sich schwerlich ein nächster Schritt denken lässt: Ein Mensch ist reifizierbar, ein Ding nicht. Man könnte vielleicht wie- der die geeigneten Bioeinheiten re-homofizieren, aber das ist zum Glück noch Uto- pie. Was aber ist die Lagerstätte der Programmschnittstelle Homo, Version 1,0? Ein U-Topos, im wahrsten Sinne des Wortes: Ein Un-Ort.
So sind die neuen Medien nicht per se in der Lage, die Realität der Stadt zu verän- dern, aber Absichten hinter den Medien sind es. Die neuen Medien sind in der Lage Umwelt zu simulieren, und eben auch so neue Subjekte zu schaffen. Subjekte sind die Bedeutung und gleichzeitig Interpretanten der Stadt. Löscht man diese Bedeu- tung, diesen einzigen Bezugspunkt der Stadt, löscht man die Interpretation der Stadt aus, so löscht man die Stadt aus, auch wenn diese materiell fortbesteht. Trotz der Probleme, die Saussures Analogie von Sprache und Straße mit sich bringt, zeigt sie, dass die Bedeutung der Straße in ihrer Funktion begründet ist und nicht in der Mate- rialität.
Welche Reaktionen ergeben sich aus den verschiedenen Medialisierungsprozessen? Welche Möglichkeiten der Selbstvergewisserung hat das Subjekt innerhalb dieser interaktionslosen Kultur? Die gesellschaftliche Struktur ist in den untersuchten Romanen so beschaffen, dass ein Ausbrechen aus der Gesellschaft nur über Verbrechen, und sei es ein Selbstmord möglich scheinen. Eine Ausnahe stellt Felix mit seinem Freund Sinan in Staffels „Terrordrom“ dar. Er hat tatsächlich die Möglichkeit zur Flucht und kann sie auch nutzen: „Sinan startet den Mustang, und wir fahren los. Keine Ahnung wohin wir fahren. Der Tank ist voll“ (Staffel 220). Dennoch bleibt im Roman offen, ob die Flucht scheitert oder glückt.
Der Charakter J. -Y. Fréhaut in „Ausweitung der Kampfzone“ stellt ebenso eine Ausnahme dar. Er scheint sich mit seiner Umwelt zu identifizieren und ist glücklich dabei.
Ein Stelle in DeLillos „Unterwelt“ kann ein extreme Gegenreaktion, die aber direkt auf mediale Prozesse zurückzuführen ist, belegen. Ein Mörder erschießt aus dem Auto heraus Menschen in fahrenden PKW’ s. Diese scheinbar zunächst sinnlose Mordserie hat für den Täter einen Kulminationspunkt.
Er spricht mit der Journalistin, die einen Bericht über die Morde moderiert. Erst in diesem Moment wird er wieder ganz er selbst. Einer seiner Morde wurde von einem Kind auf einer Videokamera festgehalten und so zum Medienspektakel. Dadurch, dass der Mörder, repräsentiert durch seine Taten zum öffentlichen Thema wird, er- mächtigt er sich eines Stückes von persönlichem Freiraum, dadurch wird er Teil der Mediengesellschaft, mitwirkender in einer Kultur, er stellt ein gewisses Maß an In- teraktion her. Wie schon bei Houellebecq ist auch seine Situation nur durch ein Verbrechen zu lösen. Es wird in diesem Fall kein Verbrechen simuliert, sondern tat- sächlich begangen. Dennoch ist das Verbrechen selbst nicht der Zweck der Taten.
Die Prozesse der ausgeblendeten Interaktion, der ‚Exkommunikation des Bürgers’, die kapitalisierte und medialisierte Selbstvorgabe und Selbstvergewisserung, die Re- kombination der einzelnen Segmente des Menschen werden über die Moderatorin in einer Art Rückkopplung über das Fernsehen geleistet. Er tritt quasi in persönlichen Kontakt mit dem, was ihn trennt um zu verbinden132, mit der Frau im TV. Zudem ist eine Herauslösung aus dem realen Raum an dem er sich befindet zu beobachten133. Und so kommt es, dass das Fernsehen ihn tatsächlich beobachtet, und nicht er das Fernsehen.
Er rief an und schaltete den Fernseher ein, oder umgekehrt ohne Ton, seine Hand in ein zusammengelegtes Taschentuch gewickelt, und noch nie war ein Gespräch für ihn so mühelos gewesen, sei es am Telefon oder vis - à - vis oder von Mann zu Frau wie an jenem Tag mit Sue Ann. Er betrachtete sie da drüben und redetet hier mit ihr. Er sah ihre stumme Lippenbewegung in einem Teil des Zimmers, während ihre Worte weich und warm in die Windungen seines ge- heimen Ohrs drangen. Er sprach zu ihr am Telefon und nahm Blickkontakt mit dem Fernseher auf. Da erwachte in ihm das Wissen, dass er existierte. Diese Frau mit den Augen eines Aliens, deren phantastisches Haar irgend etwas aus- strahlte, das sein Herz erstaunte. Je weiter die Zeit voranschritt, desto selbstbe- wusster sprach er. Er wurde allmählich er selbst, scheu, aber auch ohne Scham, sogar ein bisschen eitel und ehrlich und gewitzt, ausweichend, wenn nötig, während er da in einem fremden Wohnzimmer stand, neben einer Lampe ohne Schirm, und sie hörte zu und stellte Fragen und sah ihn von dem drei Meter ent- fernten Bildschirm an. Sie hatte eine solche Ausstrahlung, dass sie ihn existie- ren lassen konnte. (DeLillo 317)
Wenn Medien die Macht besitzen, Menschen existieren lassen zu können, haben sie auch die Macht Menschen nicht existieren lassen zu können. Sie besitzen dann auch die Macht Menschen unter bestimmten Bedingungen existieren lassen zu können, oder sie haben die Macht die Existenz von Menschen zu beenden. Wenn Medien tatsächlich Realitäten hervorbringen, wie Schmidt es behauptet, dann bringen sie eine - in jedem Falle - inszenierte Realität hervor. Diese Realität entspringt dann nicht mehr, wie in prä-medialen Zeitaltern, unmittelbaren Wahrnehmungen, sondern diese Realitäten entstammen ein und derselben Medienpoiesis. Inszenierungen haben immer eine, wie auch immer geartete Intention hinter sich. Das bedeutet Realitäts- vorstellungen können zentralisiert werden. Dass es nicht nur bei der Option bleibt, sondern, dass man von dieser Möglichkeit auch tatsächlich Gebrauch macht, lässt sich sehr eindrucksvoll am Beispiel der Berichterstattung während des Golfkrieges nachvollziehen. Die Nachrichten liefen alle über militärische Zentralen. In gewisser Weise wurde sozusagen das Medienverbundssystem zentralisiert, schlicht auf die Weise, dass man nur Zugang zu bestimmten Meldungen und Bildmaterial hatte.
Der Krieg erfuhr so eine radikale Maskierung, mit dem Ergebnis, im ‚Volk’ eine breite Zustimmung zu der Militäraktion zu erreichen. Ein Fernsehkrieg.
Die medienwirksamen Terroranschläge vom 11.09.2001 werden vielleicht auch ei- nen medienwirksamen Gegenschlag provozieren. Fall es dazu kommen sollte, wird sich die Berichterstattung nicht wesentlich von der im Golfkrieg unterscheiden. Viel- leicht wird dadurch auch das Vertrauen der Bürger in „einstmals“ ihre Medien mehr und mehr schwinden. Bis dahin werden aber die eifersüchtigen Bildflächen, die scheinbar neben sich nichts mehr dulden, ihren Tribut in Menschenleben fordern134.
Primärtexte
Borges, Jorge Luis: Inquisitionen. Essays. Fischer, Frankfurt am Main, 1992. Coupland, Douglas: Shampoo Planet. Roman. Aufbau-Verlag, Berlin, 1994. De Carlo, Andrea: Yucatan. Roman. Diogenes Verlag, Zürich, 1988. DeLillo, Don: Unterwelt. Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1998. Goetz, Rainald: Rave. Erzählung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998.
Goetz, Rainald: Dekonspiratione. Erzählung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2000.
Houellebecq, Michel: Ausweitung der Kampfzone. Roman. Klaus Wagenbach, Berlin, 1999.
Özdamar, Emine Sevgi: Die Brücke vom Goldenen Horn. Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1998.
Staffel, Tim: Terrordrom. Roman. Ullstein, Berlin, 1999.
Sekundärtexte
Adorján Johanna: Frisch auf den Tisch. Leben ohne Goetz: Warum die Welt ohne das Internet-Tagebuch „Abfall für alle“ ärmer ist. In: Süddeutsche Zei- tung, 23. Januar 1999, Feuilleton.
Barthes, Roland: Semiotik und Urbanismus. In: Die Stadt als Text. Konzept 3. Carlini/Schneider (Hrsg.). Wasmuth, Tübingen, 1976.
Baumgartner, Hans Michael: Welches Subjekt ist verschwunden? Einige Dis- tinktionen zum Begriff der Subjektivität. In: Das Verschwinden des Sub- jekts. Schröter, Hermann (Hrsg.). Königshausen & Neumann, Würzburg, 1994.
Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine Andere Moderne. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986.
Becker/ Keim: Urbanität und blockierte Erfahrung. In: Urbanistik: Neue As- pekte der Stadtentwicklung. Glaser, Hermann (Hrsg.). C. H. Beck, Mün- chen, 1974.
Bingham, Richard [et al.]: Beyond Egde Cities. Garland Publishing, New York and London, 1997.
Blumenberg, Hans: Paradigmen zu einer Metaphorologie. In: Theorie der Me- tapher. Haverkamp, Anselm (Hrsg.). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1985. (b)
Blumenberg, Hans: Die Genesis der Kopernikanischen Welt. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1985. (a)
Bolz, Norbert: Die Zeit der Weltkommunikation. In: Weltbürgertum und Glo- balisierung. Bolz/Kittler/Zons (Hrsg.). Wilhelm Fink Verlag, München, 2000.
Bolz, Norbert: Theologie der Großstadt. In: Die Großstadt als „Text“. Smuda, Manfred (Hrsg.). Wilhelm Fink Verlag, München, 1992.
Bolz/Kittler/Zons (Hrsg.): Weltbürgertum und Globalisierung. Wilhelm Fink Verlag, München, 2000.
Brentano, Franz: Psychologie vom empirischen Standpunkt. Erster Band (Psy- chologie 1), Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1924/1973.
126
Brock, Bazon: Zivilisationsraum und Kulturghetto. In: Mythos Metropole. Fuchs/Moltmann/Prigge (Hrsg.). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
Bürger, Peter: Das Verschwinden des Subjekts: Eine Geschichte der Subjekti- vität von Montaigne bis Barthes. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998.
Burckhardt, Martin: Unter Strom. Der Autor und die elektromagnetische Schrift. In: Medien, Computer, Realität: Wirklichkeitsvorstellungen und neue Medien. Krämer, Sibille (Hrsg. ). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998.
Buschmann/Ingenschay (Hrsg.): Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Per- spektive des peripheren Blicks. Königshausen und Neumann, Würzburg, 2000.
Buschmann, Albrecht: Peripherie ohne Zentrum? Vom Funktionswandes der Metropolendarstellung bei Martín-Santos und Pasolini, Lodoli und Umbral. In: Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks. Buschmann/Ingenschay (Hrsg.). Königshausen und Neumann, Würzburg, 2000.
Butor, Michel: Die Stadt als Text. Literaturverlag Droschl, Graz, 1992.
Carlini/Schneider (Hrsg.): Die Stadt als Text. Konzept 3. Wasmuth, Tübingen, 1976.
Chervel, Thierry: Die Teilchen und das Ganze. Literaturstreit: Michel Houelle- becq spaltet die Pariser Szene. In: Süddeutsche Zeitung, 16. Februar 1999, Feuillton.
Choay, Francoise: Semiotik und Urbanismus. In: Die Stadt als Text. Konzept
3. Carlini/Schneider (Hrsg.), Wasmuth, Tübingen, 1976.
De Saussure, Ferdinand: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Walter de Gruyter, Berlin, 1967.
Eckel, Eva Maria: Individuum und Stadtraum: Öffentliches Verhalten im Wan- del. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden, 1998.
Ecker, Hans-Peter: Region und Regionalismus. Bezugspunkte für Literatur o- der Kategorien für Literaturwissenschaft? In: DVjs, 63. Jahrgang, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1989.
Engel, Lorenz: Das Gespenst der Simulation. Ein Beitrag zur Überwindung der „Medientheorie“ durch Analyse ihrer Logik und Ästhetik. Verlag und Da- tenbank für Geisteswissenschaften. Weimar, 1994.
Engelmann, Peter: Einführung in die Postmoderne und Dekonstruktion. Zwei Stichwörter zur Zeitgenössischen Philosophie. In: Postmoderne und De-
127
konstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart. Ders. Philipp Reclam, Stuttart, 1990.
Faßler, Manfred: Die Exkommunikation des Bürgers. In: Weltbürgertum und Globalisierung. Bolz/Kittler/Zons (Hrsg.). Wilhelm Fink Verlag, München, 2000.
Fessmann, Meike: Europäerin aus Anatolien. Emine Sevgi Özdamars Roman vom Erlernen verschiedener Sprachen und Weltanschauungen. In: Süddeut- sche Zeitung, Samstag, 23. Mai 1998, Literatur.
Fischer, Philip: City Matters: City Minds. Die Poetik der Großstadt in der mo- dernen Literatur. In: Die Unwirklichkeit der Städte. Großstadtdarstellungen zwischen Moderne und Postmoderne. Ders. (Hrsg.). Reinbeck, Hamburg, 1988.
Flusser, Vilém: Wonach? In: Nach der Postmoderne. Steffens, Andreas (Hrsg.). Bollmann Verlag, Düsseldorf, 1992.
Flusser, Vilém: Medienkultur. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main, 1997.
Foucault, Michel: Freiheit und Selbstsorge. Materialis, Frankfurt, 1985.
Foucault, Michel: Warum ich die Macht untersuche. In: Der Foucault-Reader. Diskurs und Medien. Engelmann, Jan (Hrsg.). Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1999.
Frey, Christoph: Das Subjekt als Objekt der Darstellung. Untersuchungen zur Bewusstseinsgestaltung fiktionalen Erzählens. Akademischer Verlag Hans- Dieter Heinz, Stuttgart, 1983.
Fuchs/Moltmann: Mythen der Stadt. In: Mythos Metropole. Fuchs/Moltmann/Prigge (Hrsg.). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
Groh/Groh: Kulturelle Muster und Naturerfahrung. In: Ästhetik und Naturer- fahrung. exempla aesthetica. Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1996.
Grossklaus, Götz: Nähe und Ferne. Wahrnehmungswandel im Übergang zum Elektronischen Zeitalter. In: Literatur in einer Industriellen Kultur. Grossklaus, Götz (Hrsg.). J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger GmbH. Stuttgart, 1989.
Hassauer, Frederike: Stadtersatz Berlin 1930. Jean Giraudoux: Rues et Visages de Berlin. In: Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des peri- pheren Blicks. Buschmann/Ingenschay (Hrsg.)Königshausen und Neumann, Würzburg, 2000.
Hauser, Susanne: Der Blick auf die Stadt. Semiotische Untersuchungen zur li- terarischen Wahrnehmung bis 1910. Berlin, Reimer, 1990.
Helle, Horst J. : Der urbanisierte Mensch? In: Urbanistik: Neue Aspekte der Stadtentwicklung. Glaser Hermann (Hrsg.). C. H. Beck, München, 1974.
Hillier/Leaman: Das Mensch-Umweltparadigma und seine Paradoxien. In: Die Stadt als Text. Konzept 3. Carlini/Schneider (Hrsg.). Wasmuth, Tübingen, 1976.
Hoffmann-Axthelm, Dieter: Das Einkaufszentrum. In: Mythos Metropole. Fuchs/Moltmann/Prigge (Hrsg.). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
Hohl, Joachim: Die zivilisatorische Zähmung des Subjekts. Der Beitrag von Norbert Elias zu einer historischen Sozialpsychologie. In: Zugänge zum Subjekt. Perspektiven einer reflexiven Sozialpsychologie. Keupp, Heiner (Hrsg.). Suhrkamp, Frankfurt am Main. 1998.
Honderich, Ted: The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press, Oxford/New York, 1995.
Igenschay, Dieter: Großstadtaneignung in der Perspektive des peripheren Blicks. In: Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des periphe- ren Blicks. Buschmann/Ingenschay (Hrsg.). Königshausen und Neumann, Würzburg 2000.
Kittler, Friedrich: Die Stadt ist ein Medium. In: Mythos Metropole. Fuchs/ Moltmann/Prigge (Hrsg.). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
Kittler, Friedrich: Die Welt des Symbolischen - eine Welt der Maschine. In: Li- teratur in einer Industriellen Kultur. Grossklaus (Hrsg.), J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger GmbH. Stuttgart, 1989.
Klagenfurt, Kurt: Technologische Zivilisation und transklassische Logik. Eine Einführung in die Technikphilosophie Gotthard Günthers. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995.
Klotz, Volker: Die erzählte Stadt. Ein Sujet als Herausforderung des Romans von Lesage bis Döblin. Carl Hanser Verlag, München, 1969.
Koschorke, Albrecht: Der Traumatiker als Faschist. Ernst Jüngers Essay „Über den Schmerz“. In: Modernität und Trauma. Beiträge zum Zeitenbruch des Ersten Weltkrieges. Mülder-Bach, Inka (Hrsg.). WUV-Universitätsverlag, Wien 2000.
Kramer, Dieter: Die vollendete Inszenierung im synthetischen Tourismus- Utopia. In: Das Verschwinden des Subjekts. Schröter, Hermann (Hrsg.). Königshausen & Neumann, Würzburg, 1994.
Krämer, Sibille (Hrsg.): Medien, Computer, Realität: Wirklichkeitsvorstellun- gen und neue Medien. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998.
Kuhlmann, Andreas: Kultur und Krise. Zur Inflation der Erlebnisse. In: Mythos Metropole. Fuchs/Moltmann/Prigge (Hrsg.). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
Kuhnle, Till: Ekelhafte Stadtansichten. In: Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks. Buschmann/Ingenschay. Königshau- sen und Neumann, Würzburg, 2000.
Kunisch Hans-Peter: Schatz, mach dich nackig! Der Begriff des Kunstwerks impliziert den des Gelingens: Rainald Goetz’ Erzählung „Rave“ Süddeut- sche Zeitung 2. April, 1998.
Langer, Beatrix: Schreiben tut weh. Vereiste Verhältnisse: Tim Staffels Debüt- roman „Terrordrom“. In: Süddeutsche Zeitung, 7. Juli, 1998.
Leenhardt, Jaques: Eine Ästhetik des Randgebietes. In: Die Großstadt als „Text“. Smuda, Manfred (Hrsg.). Fink, München, 1992.
Loo, Hans van der/van Rejien, Willem: Modernisierung. Projekt und Paradox. Deutscher Taschenbuchverlag. München, 1992.
Luhmann, Niklas: Die Wissenschaft der Gesellschaft. Suhrkamp. Frankfurt am Main, 1990.
Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. Westdeutscher Verlag, Opladen, 1996.
Maak, Niklas: Der Wille zur Nacht. Der französische Skandalautor Michel Ho- uellebecq und sein gefeierter Debütroman „Ausweitung der Kampfzone“. In: Süddeutsche Zeitung, 20. Februar, 1999. Feuilleton.
Margreiter, Reinhard: Realität und Medialität. Zur Philosophie des ‚Medial Turn’ In: Medien Journal 1/1999. 23. Jahrgang. Medial Turn, die Mediali- sierung der Welt.
Mensching Alexander: „Die Seele: Gefängnis des Körpers“. Die Beherrschung der Seele durch die Psychologie. Centaurus, Pfaffenweiler, 1993.
Mühlen Achs, Gitta: Schön brav warten auf den Richtigen? Die Inszenierung heterosexueller Romanzen in der Jugendzeitschrift BRAVO. In: Schaulust. Erotik und Pornographie in den Medien. Lennsen/Stolzenburg (Hrsg.). Leske + Budrich, Opladen, 1997.
Mülder-Bach, Inka (Hrsg.): Modernität und Trauma. Beiträge zum Zeitenbruch des Ersten Weltkrieges. WUV-Universitätsverlag, Wien 2000.
Merten/Schmidt/Weischenberg (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994.
130
Nelting, David: Alain Robbe-Grillet und der Blick auf New York. In: Die an- dere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks. Buschmann/Ingenschay (Hrsg.). Königshausen und Neumann, Würzburg, 2000.
Nöth, Winfried: Handbuch der Semiotik. Metzler, Stuttgart, 1985.
Oelmüller, Willi: Subjekt aus der Perspektive der Philosophie der unbefriedig- ten Aufklärung. In: Das Verschwinden des Subjekts. Schröter, Hermann (Hrsg.). Königshausen & Neumann, Würzburg, 1994.
Öhrlein, Stephan: Die zwei Seiten des Ich. Zu den Begriffen des Ich in den Werken Meads und Lacan. Saarbrücken, 1988. In: Recenso Texte zur Kunst und Philosophie. URL: http://members.tripod.com/recenso/mead1a.htm.
Prigge, Walter: Mythos Architektur. Zur Sprache des Städtischen. In: Mythos Metropole. Fuchs/Moltmann/Prigge (Hrsg.). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
Radermacher, Lars: Inzenierte Identitäten. Zur Kopplung von Medienbildern und Kognition. In: Medien Journal 1/1999-23. Jahrgang. Medial Turn. Die Medialisierung der Welt.
Rasch, William: Weltkommunikation und Weltschweigen. In: Weltbürgertum und Globalisierung. Bolz/Kittler/Zons (Hrsg.). Wilhelm Fink Verlag, Mün- chen, 2000.
Reljic, Dusan Killing Screens. Medien in Zeiten von Konflikten. Eine Studie des Europäischen Medieninstituts mit Unterstützung der Europäischen Kul- turstiftung Amsterdam. Droste Verlag, Düsseldorf, 1998.
Röd, Wolfgang: Empirisches Ich und Ich der Philosophen. In: Aktuelle Prob- leme der Subjektivität. Radermacher, Hans (Hrsg). Lang, Frankfurt am Main, 1983.
Rüb, Mathias: Das Subjekt und sein Anderes. Zur Konzeption von Subjektivi- tät beim Frühen Foucault. In: Ethos der Morderne. Foucaults Kritik der Aufklärung. Erdmann, Eva (Hrsg.) [et al.]. Campus, Frankfurt, 1990.
Rühle, Alexander: Ihr G8, wir 6 000 000 000. Stehen sich in Genua die Bösen und die Guten gegenüber? In: SZ: Mittwoch, 18. Juli, 2001. S. 13.
Scherpe, Klaus R.: Ausdruck Funktion Medium. In: Literatur in einer Indus- triellen Kultur. Grossklaus, Goetz, (Hrsg.), J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart, 1989.
Scherpe, Klaus R.: Nonstop nach Nowhere City. Wandlung der Symbolisie- rung, Wahrnehmung und Semiotik der Stadt in der Literatur der Moderne. In: Die Unwirklichkeit der Städte. Großstadtdarstellungen zwischen Moder- ne und Postmoderne. Ders. (Hrsg.). Reinbeck, Hamburg, 1988.
Schmidt, Siegfried J.: Medien, Kultur: Medienkultur. Ein konstruktivistisches Gesprächsangebot. In: Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radika- len Konstruktivismus 2. Ders. (Hrsg.). Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992.
Schmidt, Siegfried J.: Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Kon- struktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kom- munikation, Medien und Kultur. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1994 (a).
Schmidt, Siegfried J.: Konstruktivismus in der Medienforschung: Konzepte, Kritiken, Konsequenzen. In: Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Merten [et al] (Hrsg.). Opladen: West- deutscher Verlag, 1994 (b).
Schmidt, Siegfried J.: Modernisierung, Kontingenz, Medien: Hybride Beobachtungen. In: Medien - Welten - Wirklichkeiten. Vattimo/Welsch (Hrsg.). Wilhelm Fink Verlag, München, 1998.
Smith, Barry: Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano. Open Court Publishing. Chicago, 1994.
Schneider, Bernhard: Die Stadt als Text. In: Die Stadt als Text. Konzept 3. Carlini/Schneider (Hrsg.). Wasmuth, Tübingen, 1976.
Schubert, Elke: Nicht alles ist Fake. Tim Staffels Roman „Heimweh“. In Süd- deutsche Zeitung, 22. März, 2000, Literatur.
Sennet, Richard: Civitas - Die Großstadt und die Kultur des Unterschieds. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991.
Simmel, Georg: Die Großstadt und das Geistesleben. In: Das Individuum und die Freiheit. Essais. Ders. Wagenbach, Berlin, 1903/1984.
Srubar, Ilja: Zur Formierung des soziologischen Blickes durch die Großstadt- wahrnehmung. In: Die Großstadt als „Text“. Smuda, Manfred (Hrsg.). Fink, München, 1992.
Steffens, Andreas (Hrsg.): Nach der Postmoderne. Bollmann Verlag, Düssel- dorf, 1992.
Stierle, Karl: Der Mythos von Paris - Zeichen und Bewusstsein der Stadt. Han- ser, München, 1993.
Trabant, Jürgen: Die Stadt und die Sprache: eine Saussuresche Analogie. In: Die Stadt als Text. Konzept 3. Carlini/Schneider (Hrsg.). Wasmuth, Tübin- gen, 1976.
Vietta/Kemper: Expressionismus. Reihe UTB. Wilhelm Fink Verlag. Mün- chen, 1990.
132
Wackwitz, Stephan: Welche Revolution will schon ins Reservat? Aus der Ge- schichte der B-Seiten in Musik und Kunst: Westbam, Townshend, Theo Waigel. In: Süddeutsche Zeitung, 14. Juni, 1997, Literatur.
Weber, Stefan: die Welt als Medienpoesis. Basistheorem für den ‚Medial Turn’. In: Medien Journal 1/1999-23. Jahrgang. Medial Turn, die Mediali- sierung der Welt.
Welsch, Wolfgang: Unserer Postmoderne Moderne. Akademie Verlag, Berlin, 1993.
Winkler, Willi: Ich Mail für dich. Rainald Goetz schreibt wieder kein Buch. In: Süddeutsche Zeitung, 1. April, 2000, Literatur.
Zohlen, Gerwin: Metropole als Metapher. In: Mythos Metropole. FuchsMolt- mann/Prigge (Hrsg.). Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
ERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich, Martin Schindler, geboren am 31.03.1973 in GarmischPartenkirchen, dass ich vorliegende Arbeit eigenständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benützt habe.
München, den Martin Schindler
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei Dr. Andreas Schumann für sein reges Interesse, seine wertvollen Ratschläge und Anregungen bedanken. Darüber hinaus ließ er mir alle Freiheit, meine Argumente zu entwickeln.
Herrn Andreas Wolf möchte ich für kritische Anmerkungen danken. Unserer Nach- barin Nadin fürs Babysitten. Und nicht zuletzt möchte ich mich bei meiner Frau Bir- git bedanken, die es trotz der gemeinsamen Sorge um unseren Sohn mit erheblichen persönlichen Einsatz möglich gemacht hat, diese Arbeit zu erstellen. Linus für Inspi- ration.
Medien, Stadt, Subjekt. Veränderung von Großstadtwahrnehmung in der Lite- ratur der Literatur der Neunziger
[...]
1 Koschorke, Albrecht: Der Traumatiker als Faschist. Ernst Jüngers Essay „Über den Schmerz“. In: Modernität und Trauma. Beiträge zum Zeitenbruch des Ersten Weltkrieges. Mülder-Bach, Inka (Hrsg.). WUV-Universitätsverlag, Wien 2000.
2 Mensching Alexander: Die Seele: Gefängnis des Körpers. Die Beherrschung der Seele durch die Psychologie. Centaurus, Pfaffenweiler, 1993.
3Loo, Hans van der/van Rejien, Willem: Modernisierung. Projekt und Paradox. Deutscher Taschenbuchverlag. München, 1992.
4 Über neue ‚Umwelten’ des menschlichen Existenzraumes mehr im Verlauf der Arbeit.
5 Hohl, Joachim: Die zivilisatorische Zähmung des Subjekts. Der Beitrag von Norbert Elias zu einer historischen Sozialpsychologie. In: Zugänge zum Subjekt. Perspektiven einer reflexiven Sozialpsychologie. Keupp, Heiner (Hrsg.). Suhrkamp, Frankfurt am Main. 1998.
6 Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine Andere Moderne. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986.
7 Faßler, Manfred: Die Exkommunikation des Bürgers. In: Weltbürgertum und Globalisierung. Bolz/Kittler/Zons (Hrsg.). Wilhelm Fink Verlag, München 2000.
8 Engelmann, Peter: Einführung in die Postmoderne und Dekonstruktion. Zwei Stichwörter zur Zeitgenössischen Philosophie. In: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart. Ders. Philipp Reclam, Stuttgart, 1990.
9 Mühlen Achs, Gitta: Schön brav warten auf den Richtigen? Die Inszenierung heterosexueller Romanzen in der Jugendzeitschrift BRAVO. In: Schaulust. Erotik und Pornographie in den Medien. Lennsen/Stolzenburg (Hrsg.). Leske + Budrich, Opladen, 1997.
10Vgl. Srubar 38.
11Srubar, Ilja: Zur Formierung des soziologischen Blickes durch die Großstadtwahrnehmung. In: Die Großstadt als „Text“. Smuda, Manfred (Hrsg.). Fink, München, 1992.
12„Ich bin allein, viel zu sehr allein“ (Houellebecq 33).
13 Houellebecq, Michel: Ausweitung der Kampfzone. Roman. Klaus Wagenbach, Berlin, 1999.
14 Vgl.: Hohl.
15 Vgl Meads Konzept des „I“ und „Me“ wobei das „Me“ das Subjekt in seinem sozialen Zusammenhang meint. „I“ das eigentliche ‚Ich’.
16Vgl. Michel Foucault. /: F. unterstellt ebenfalls ein Trennung des Subjekts in diejenigen subjektiven Strukturen, die die Macht im Individuum verankert, und dem nicht näher zu bezeichnenden „Anderen“. Zu diesem Begriff siehe: Rüb: Das Subjekt und sein Anderes.
17 Hauser, Susanne: Der Blick auf die Stadt, semiotische Untersuchungen zur literarischen Wahrnehmung bis 1910. Berlin, Reimer, 1990.
18Simmel, Georg: Die Großstadt und das Geistesleben. In: Das Individuum und die Freiheit. Essais. Ders. Wagenbach, Berlin, 1903/1984.
19 Simmel spricht an anderer Stelle von einem Präservativ, das der Großstädter sich über seine Wahrnehmung stülpt. (Simmel 196, zit. nach Becker).
20 Vgl. Kap. Stadt als Text.
21Sein eigentliches Ziel ist es, die Psychologie auf die gleiche wissenschaftliche Stufe wie die Mathematik zu stellen.
22Brentano, Franz: Psychologie vom empirischen Standpunkt. Erster Band (Psychologie 1). Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1924/1973.
23Smith, Barry: Austrian Philosophy. The Legacy of Franz Brentano. Open Court Publishing. Chica- go, 1994.
24Der Terminus Intentionalität bedeutet daher auch nicht Gerichtetheit der Psyche, sondern ‚Aboutnes’, also, dass ein psychischer Zustand immer etwas zum Inhalt haben muss.
25 Nec quid, nec quale, nec quantum.
26Bürger, Peter: Das Verschwinden des Subjekts: Eine Geschichte der Subjektivität von Montaigne bis Barthes. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998.
27 Foucault, Michel: Freiheit und Selbstsorge. Materialis, Frankfurt, 1985.
28Oelmüller, Willi: Subjekt aus der Perspektive der Philosophie der unbefriedigten Aufklärung. In: Das Verschwinden des Subjekts. Schröter, Hermann (Hrsg.). Königshausen & Neumann, Würzburg 1994.
29 Vgl. Engelmann 12f.
30Vgl. Kap.: Kommunikation/Luhmann.
31 Ebenso nimmt der mittelalterlichen Mystiker Meister Eckhard eine Identität von Gott und Mensch an.
32Vgl. Mühlen Achs.
33 Vgl. Kap.: Simmel.
34 Zu dem Thema implizites/explizites literarisches ich siehe C. Frey.
35 Baumgartner, Hans Michael: Welches Subjekt ist verschwunden? Einige Distinktionen zum Begriff der Subjektivität. In: Das Verschwinden des Subjekts. Schröter, Hermann (Hrsg.). Königshausen & Neumann, Würzburg 1994.
36 Betrachten wir das obige Zitat, so scheint in diesem Falle eine Auflösung der Subjektstruktur im Sinne einer extrapolierten Perspektive wünschenswert.
37Vgl.: Kapitel Kommunikation/Luhmann.
38 Vgl. Kapitel: Kommunikation/Luhmann.
39 Coupland Douglas: Shampoo Planet. Roman. Aufbau-Verlag, Berlin, 1994.
40Butor, Michel: Die Stadt als Text. Literaturverlag Droschl, Graz, 1992.
41 Der Terminus „hyposignifikant“ schließt den sog. „Halbtext“ der Stadt mit ein.
42 Trabant, Jürgen: Die Stadt und die Sprache: eine Saussursche Analogie. In: Die Stadt als Text. Konzept 3, Carlini/Schneider (Hrsg.). Wasmuth, Tübingen 1976.
43De Saussure, Ferdinand, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Walter de Gruyter, Berlin, 1967.
44 Vgl. Aristotelische Ontologie.
45 Nelting, David: Alain Robbe-Grillet und der Blick auf New York. In: Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks. Buschmann/Ingenschay. (Hrsg.). Königshausen und Neumann, Würzburg, 2000.
46Flusser, Vilém: Medienkultur. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main, 1997.
47Choay, Francoise: Semiotik und Urbanismus. In: Die Stadt als Text. Konzept 3, Carlini/Schneider (Hrsg.), Wasmuth, Tübingen 1976.
48Barthes, Roland: Semiotik und Urbanismus. In: Carlini/Schneider (Hrsg.) Die Stadt als Text. Konzept 3, Wasmuth, Tübingen 1976.
49 Metaphysik überlebt als phantastischer Zweig der Literatur. Borges sieht ontologische Modelle als Fiktion. (Vgl. Hans Radermacher: Kant, Swedenborg, Borges).
50 Vgl. Kap.: Erfahrbarkeit und Erfassbarkeit der Stadt.
51 Vgl. Kap.: Der Text der Stadt.
52 Kuhnle, Till: Ekelhafte Stadtansichten. In: Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks. Buschmann/Ingenschay. Königshausen und Neumann, Würzburg, 2000.
53 Houellebecq, Michel: Ausweitung der Kampfzone. Roman. Klaus Wagenbach, Berlin, 1999.
54Einige Seiten vorher beschreibt Coupland „Städte, die so groß und tot sind, dass sie ihre vollständig eigene Kosmologie fürs Jenseits haben“ (Coupland 218). Diese Städte sind aufgelassene Industrieanlagen an den Stadträndern, die für Horrorszenarien die Kulisse bieten. Es ist zu fraglich, ob Coupland mit den Zukunftsstädten eine Alternative zu den alten Industrieanlagen darstellen will, oder ob er diesen Zukunftsstädten die gleiche Zukunft voraussagt wie den Industrieanlagen.
55 Vgl.: Kap.: Zentrum/Peripherie. Der Umzug nach Versailles des französischen Adels.
56 Auch Eva Eckel stellt in ihrer soziologischen Arbeit eine funktionelle, dreiteilige Unterteilung des Stadtraumes fest. Ebenso Becker.
57Lynch versucht die Stadt nach den Selben Mustern zu erfassen, wie das menschliche Bewusstsein es wahrnimmt. (Barthes 35).
58Stierle, Karl: Der Mythos von Paris - Zeichen und Bewusstsein der Stadt. Hanser, München, 1993.
59 Vgl. „Der Akt der Unterscheidung hat eine Doppelnatur. Erstens wird eine Unterscheidung getrof- fen: Etwas ist verschieden von einem anderen Etwas. Zweitens wird einer dieser Zustände oder Ob- jekte markiert, mit einem Namen belegt, bezeichnet. Spencer Brown verwendet für Interpretations- zwecke [...] eine räumliche Metapher: Im Unterscheidungsakt wird ein bisher homogener Raum in zwei Teile zerlegt. Es wird eine Grenze gezogen und ein Teil ausgezeichnet Markiert“ (Klagenfurt 45). Sobald man also ein Subjekt als Beobachter einführt und eine Unterscheidung trifft, gibt es eigen-
60 Borges, Jorge Luis: Inquisitionen. Essays. Fischer, Frankfurt am Main, 1992.
61Vgl.: Kap.: Der Text der Stadt .
62Vgl. Kap.: Die Saussursche Analogie von Stadt und Sprache.
63 Vgl.: Kap.: Wandel zur Moderne: Verdammung zum Anachronismus?: Zit. Houellebeqcq.
64 Vgl.: Kap.: Der Text der Stadt. Die von Butor festgestellte Textualität der Stadt ist ein Beleg für ‚Semantik’ der Stadt. Reine Syntax würde das fehlen von semantischen Aussagen implizieren. So ist vielleicht das Zitat Borges’, dass Musik ihre Form in sich selbst trägt, die stichhaltigste Metaphorisie- rung, die man auf die Stadt leisten kann. Doch das würde bedeuten, dass wiederum kein ‚Inhalt vor- handen ist, was nicht zutrifft.
65Hassauer, Frederike: Stadtersatz Berlin 1930. Jean Giraudoux: Rues et Visages de Berlin. In: Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks. Buschmann./Ingenschay. (Hrsg.). Königshausen und Neumann, Würzburg 2000.
66 Bolz, Norbert: Theologie der Großstadt. In: Die Großstadt als „Text“. Smuda, Manfred (Hrsg.). Fink, München, 1992.
67Vgl. Kramer.
68 Vgl. Nelting.
69Vgl. Butor 19f.
70Butor schließt für Imperialistische Systeme scheinbar Alternativen aus; es bleibt die Möglichkeit sich zu verweigern, keinen Weg zu gehen.
71 Staffel, Tim: Terrordrom. Roman. Ullstein, Berlin, 1999.
72Leenhardt, Jaques: Eine Ästhetik des Randgebietes. In: Die Großstadt als „Text“. Smuda, Manfred (Hrsg.). Fink, München, 1992.
73 Ich möchte in dieser Arbeit nicht auf diesen Begriff eingehen.
74Igenschay, Dieter: Großstadtaneignung in der Perspektive des peripheren Blicks. In: Die andere Stadt: Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks. Buschmann /Ingenschay (Hrsg.). Königshausen und Neumann, Würzburg 2000.
75Scherpe, Klaus R.: Ausdruck Funktion Medium. In: Literatur in einer Industriellen Kultur. Grossklaus (Hrsg.). J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart 1989.
76Fischer, Philip: City Matters: City Minds. Die Poetik der Großstadt in der modernen Literatur. In: Die Unwirklichkeit der Städte. Großstadtdarstellungen zwischen Moderne und Postmoderne. Ders. Reinbeck, Hamburg, 1988.
77 Fischer spricht von einem „Archimedischen Punkt”. (Fischer, S. 107).
78 Vgl.: Butor, Kap.: Zentrum/Peripherie.
79 Sennet, Richard: Civitas - Die Großstadt und die Kultur des Unterschieds. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991.
80 Blumenberg, Hans: Paradigmen zu einer Metaphorologie. In: Theorie der Metapher. Haverkamp, Anselm (Hrsg.). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1985.
81Zu der Abwendung von der Betrachtung der Seele und dem Neugierdeverbot, des „Voluptas Oculo- rum“ hin zur einer offenen Wahrnehmung, die Gott in seiner Schöpfung vertreten sieht, siehe Groh, 1996.
82 Vgl.: Choay 51.
83 Kramer, Dieter: Die vollendete Inszenierung im synthetischen Tourismus-Utopia. In: Das Vers- chwinden des Subjekts. Schröter, Hermann (Hrsg.). Königshausen & Neumann, Würzburg 1994.
84Flusser stellt, im Zuge einer Überlegung, was denn nun endlich die Postmoderne ausmacht, fest, dass, ganz im Geiste des ‚everything goes’ nun nicht mehr das Material entscheidend sei, sondern die Form (Flusser 1992).
85 S. J. Schmidt und P. Virilio schauen vom Bild auf den Betrachter: Auf die Synthetisierung des Bil- des folgt die Synthetisierung der Wahrnehmung und des Sehens in einer „Aufspaltung des Blickpunktes“. (Radermacher 42) Radermacher glaubt, mit Virilio anhand dieser Aussagen die Auflösung der Bild/Rezipienten-Relation festmachen zu können, und spricht von der hohen Auflösung des Bildes (Werbeplakat, dass sich dem Betrachter aufzwängt), womit die hohe Zersetzungskraft gemeint ist. Trotz aller von mir gemachten Einwände scheinen hier Bilder eine ‚zersetzende’ Wirkung zu haben, oder besser konstitutiv, da sie ein bestimmtes Handeln hervorrufen. Baudrillard hat ein Fernsehexperiment mit der Familie Loud untersucht: sie haben sich dreihundert Stunden lang ungeschminkt und ohne Drehbuch filmen lassen. Das Ziel war ein Höchstmaß an Authentizität. Die Familie verhielt sich aber nicht wie eine Familie, sondern so wie sie glaubten, dass man von ihnen erwarten würde, „indem sie ihr Vorwissen über Abläufe und Handlungsschemata fiktionaler Fernsehserien auf ihren persönlichen Umgang transferierten: Das TV ist tatsächlich die Wahrheit der Louds, es ist und schafft die Wahrheit. [...] Sie sehen kein Fernsehen mehr, das
86Rühle, Alexander: Ihr G8, wir 6 000 000 000. Stehen sich in Genua die Bösen und die Guten gegenüber? In: SZ: Mittwoch, 18. Juli, 2001. S. 13.
87 Der Cyberspace als Raum reiner Inszenierung bleibt dennoch realer Raum, obwohl er doch nichts anderes ist als reine Inszenierung.
88 Veränderte man ein Menschen körperlich, beispielsweise man trennte ihm einen Finger von seiner Hand, würde das sofort als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet und geahndet. Beeinflusst und verändert man aber die Psyche, die ja wie der Finger in dem Beispiel auch ein Teil des Körpers ist, wird man nicht auf die gleiche Weise reagieren.
89 Vgl.: Kap.: Du sollst Dir kein Bild von mir machen
90Wie Flusser anmerkt, ist dies nicht eine natürliche Folge der Kommunikationsmöglichkeiten, sondern einer bestimmten Absicht, die mit diesen Kommunikationen verfolgt wird.
91Vgl.: Engl: Das Gespenst der Simulation.
92 Ecker, Hans-Peter: Region und Regionalismus. Bezugspunkte für Literatur oder Kategorien für Literaturwissenschaft? In: DVjs, 63. Jahrgang, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1989.
93 Weber, Stefan: die Welt als Medienpoesis. Basistheorem für den ‚Medial Turn’. In: Medien Journal 1/1999-23. Jahrgang. Medial Turn, die Medialisierung der Welt.
94 Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. Westdeutscher Verlag, Opladen, 1996.
95Josef Mitterer verfoltg einen Nicht-dualisierenden Ansatz: Dualismus von realer und medialer Realität; vgl. Weber S. 7.
96 Schmidt, Siegfried J. Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Suhrkamp, Frankfurt am Main. 1994.
97Schmidt, Siegfried J.: Modernisierung, Kontingenz, Medien: Hybride Beobachtungen. In: MedienWelten - Wirklichkeiten. Vattimo/Welsch (Hrsg.). Wilhelm Fink Verlag, München 1998.
98 Margreiter, Reinhard: Realität und Medialität. Zur Philosophie des ‚Medial Turn’ In: Medien Journal 1/1999-23. Jahrgang. Medial Turn, die Medialisierung der Welt.
99 Schmidt, Siegfried J.: Konstruktivismus in der Medienforschung: Konzepte, Kritiken, Konsequenzen. In: Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikations-wissenschaft. Merten [et al]. Oppladen: Westdeuscher Verlag 1994 (b).
100Diese Verarbeitung findet im hauptsächlich im limbischen System Das bedeutet, dass ein Großteil der Verarbeitung emotional gesteuert wird. Das hat ebenfalls zur Folge, dass was als rationale Entscheidung eingestuft wird ebenfalls einer emotionalen Steuerung unterliegt.
101Schmidt, Siegfried J.: Medien, Kultur: Medienkultur. Ein konstruktivistisches Gesprächsangebot. In: Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2. Ders. (Hrsg.). Suhrkamp, Frankfurt am Main. 1992.
102 Vgl.: Kant, Immanuel: KrV.
103 Schmidt spezifiziert den Bezugspunkt der Sprache unter dem Begriff Common sense.
104Luhmann, Niklas: Die Wissenschaft der Gesellschaft. Suhrkamp. Frankfurt am Main 1990.
105 Vgl.: Das Problem der Qualia in der analytischen Philosophie des Geistes. Wie ich die Farbe Rot wahrnehme entzieht sich der Beschreibbarkeit.
106 Ein Kommunikationstheoretiker, dessen Name mir leider entfallen ist, hat die Definition aufgestellt, dass es sich dann um Kommunikation handelt, wenn man die Möglichkeit zu Lügen hat.
107 Vgl.: Kap.: Isolation der Weltgesellschaft.
108 Schmidt 1994 a, 260f.
109 Vgl. Kap.: Reflexive Moderne. Beck nennt die Moderne, die nicht mehr mit traditionellen Strukturen zu kämpfen hat, sondern sich auf die Resultate der modernen Entwicklung bezieht reflexiv. Vielleicht können wir auch eines Tages von einer reflexiven Medialisierung sprechen.
110 Vgl. Schmidt 1994a, 239.
111 DeLillo, Don: Unterwelt. Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1998.
112 Vgl. Kap.: Inszenierung der Stadt.
113Vgl. Igenschay, Kap: Zentren und Peripherien.
114Özdamar, Emine Sevgi: Die Brücke vom Goldenen Horn. Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1998.
115 Fessmann, Meike: Europäerin aus Anatolien. Emine Sevgi Özdamars Roman vom Erlernen vers- chiedener Sprachen und Weltanschauungen. In: Süddeutsche Zeitung, Samstag, 23. Mai 1998, Litera- tur.
116Im Gegensatz zu einer Weltgemeinschaft.
117 Bolz, Norbert: Die Zeit der Weltkommunikation. In: Weltbürgertum und Globalisierung. Bolz/Kittler/Zons (Hrsg.). Wilhelm Fink Verlag, München 2000.
118 Vgl. Kittler, Friedrich: Aufschreibesysteme 1800/1900. München, 1987.
119Dieses herauslösen aus der natürlichen Umwelt, wird in der Schlussszene des Romans „Ausweitung der Kampfzone“ beschrieben. Erst diese totale Herauslösung aus dem natürlichen Zusammenhang wird vom dem Icherzähler als echtes Gescheitert-Sein empfunden.
120 Vgl. Staffel: Lars interagiert anonym.
121 Vgl. Reljic, Dusan Killing Screens: Medien in Zeiten von Konflikten. Eine Studien über die Rolle der Medien im Jugoslawien. Er hat an diesem Konkreten Beispiel gezeigt, dass Medien sehr wohl in der Lage sind gerade nationalistische Tendenzen in der Bevölkerung zu schüren. Die Kommunisie- rung findet auf eine nationale Gemeinschaft hin statt, über einen inneren oder äußeren Feind. So wird jeder Krieg, der auf diese (mediale) Weise entfacht wurde und wird zum virtuellen Ereignis. Was aber kann man daraus für die obige Diskussion schließen? Um noch einmal auf Flusser zurückzukommen: Wirkungen, die aus Kommunikationen der neuen Medien herrühren sind keine direkten Folgen der neuen Medien an sich. Die Kommunisierung auf einen Nationalstaat hin, oder die kommunikative Herauslösung aus eben solchen Gebilden sind Wirkungen der dahinterstehenden Absichten. Man kann Bolz zugute halten, dass er Prozesse in unserem Kulturkreis analysiert, und so zu seinen Ergebnissen kommt. Sein Fehler liegt aber in seinem Globalitätsanspruch; er überträgt seine Beobachtung auf die gesamte Welt, und im Falle von Ex-Jugoslawien treffen diese nicht zu. Dass die Bürger dennoch im- mer mehr von Interaktion untereinander abgedrängt werden, kann ebenso durch das obige Beispiel aus Ex-Jugoslawien belegt werden. Durch die Medienpoiesis wird der einstige Nachtbar und Freund zu erbittersten Feind.
122Funktionalismus als architektonisches Programm.
123 Zohlen, Gerwin: Metropole als Metapher. In: Mythos Metropole. Fuchs [et al.]. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995.
124An anderer Stelle fragt sich Bolz, ob das ‘Projekt Philosophie’ nicht als gescheitert zu betrachten ist. Implizit scheint er hier die Frage zu verneinen, indem er den Philosophen ein Arbeitsfeld zus- pricht.
125Goetz, Rainald: Rave. Erzählung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1998.
126 Vgl. Kap.: Anarchie der Information.
127 Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Der frühe Wittgenstein hat ebenfalls die Grenze der Sprache mit den Grenzen der Welt gleichgesetzt.
128 Vgl. Schmidt 1994, S. 117.
129 Vgl. Kap.: Individualisierung sozialer Ungleichheit.
130Nicht im Sinne Kittlers. Vgl.: Die Stadt ist ein Medium.
131 Die Medien, die die ‚neue Stadt’ bilden sind vor allem durch die Abwesenheit von Interaktion gekennzeichnet. Bzw. Interaktion findet in bestimmten, vorgefertigten Kanälen statt.
132Ein weiteres Paradox der Moderne: Medien verbinden aber sie trennen auch.
133Zur Auflösung von Raum und Zeit durch elektronische Medien: Burckhardt, Martin: Unter Strom. S. 36f.
134 Ich möchte an dieser Stelle noch ein mal folgendes Zitat verwenden: Solange Polytheismus herrscht, das heißt solange die Stadt in ihrem Schoß die Vertretungen anderer gleichwertiger Zentren akzeptiert, ihrer Sprachen und Stile, die sich Götter-Ideogrammen einschreiben, kann es Gleichge- wicht und Frieden geben, doch wenn der Gott unduldsam und „eifersüchtig“ wird, wenn er neben seinem Tempel keinen anderen mehr duldet, wird er ihn auch in der Ferne nicht mehr dulden, führt das zwangsläufig zu einem Imperialismus. Man muss den Weg über ihn gehen: Es ist der Weg, der einzige Weg. (Butor 21)
- Arbeit zitieren
- Martin Schindler (Autor:in), 2001, Medien, Stadt, Subjekt. Veränderung von Großstadtwahrnehmung in der Literatur der Neunziger, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105458
Kostenlos Autor werden




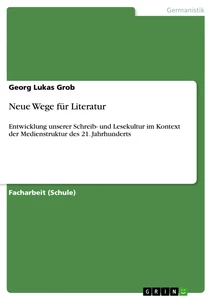




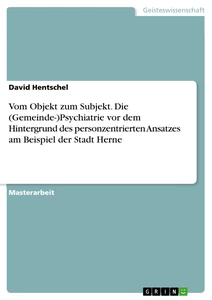




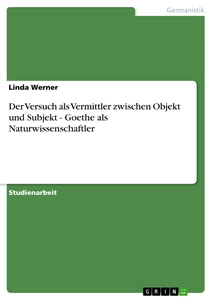







Kommentare