Leseprobe
Inhalt:
Vorwort
Die Unabhängigkeitserklärung
Das Wahlrecht
Die Legislative
Der Senat
Das Repräsentantenhaus
Die Exekutive
Der Präsident
Seine Wahl
Seine Funktion
Seine Macht
Der Vizepräsident
Das Kabinett und die Bürokratie
Das Wechselspiel zwischen Legislative und Exekutive
Der Oberste Gerichtshof
Die Demokratische und die Republikanische Partei
Ahnhang
Vorwort:
Wie nun haben die Amerikaner in ihrem politischen System ihre Vorstellungen von der Freiheit und Gleichheit der Bürger und von der Regierung auf der Basis der Zustimmung der Regierten verwirklicht? Dank der Tatsache, daß die Entwicklung der amerikanischen Republik vor unseren Augen erfolgte und jedes Entwicklungsstadium durch historische Dokumente belegt ist, sind wir in der Lage, das Werden dieses Staates bis in alle Einzelheiten hinein genau verfolgen zu können. Diese Entwicklung liegt als ein überschaubares Kontinuum1 vor uns. Obwohl alle Einwanderer, als sie ihre alte Heimat verließen, bewußt mit der Vergangenheit brachen und die Notwendigkeit, in der Neuen Welt eine neue Existenz aufzubauen, alle ihre Energie in Anspruch nahm, so daß sie zunächst kein rechtes Verhältnis zur Geschichte finden konnten, haben die dreieinhalb Jahrhunderte seit der Gründung der Plymouth-Kolonie Traditionen wachsen lassen, die dieses Volk aus der Situation der Geschichtslosigkeit befreit haben. Wie kaum ein anderes Volk feiert der heutige Amerikaner seine großen Staatsmänner ebenso wie die bedeutenden Ereignisse seiner Geschichte. Schulen und Hochschulen tragen das Ihre dazu bei, die Erinnerungen an die Vergangenheit lebendig zu erhalten.
Die Unabhängigkeitserklärung:
Die Unabhängigkeitserklärung ist die Grundlage der Demokratie wie wir sie heute kennen. Sie besagt im ersten von drei Teilen, daß „alle Menschen gleich geschaffen sind; daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; daß dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören; daß zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingerichtet werden, die ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten...“
Am 7. Juni 1776 brachte Richard Henry Lee von Virginia eine Unabhängigkeitsresolution vor den Kongreß. Nach heftigen Dikusionen auf Grund großer Meinungsverschiedenheiten, wurde eine Abstimmung über diese Frage auf den 1.Juli verschoben. Erst am 2.Juli wurde die Resolution angenommen, und dann nur durch Delegierte von neun von dreizehn Kolonien. Pennsylvania und South Carolina stimmten dagegen, die Delegation Delawares
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
konnte sich nicht einigen, und New York nahm an der Abstimmung nicht Teil. Dennoch ist der 2.Juli der eigentliche Unabhängigkeitstag, und nicht der gefeierte 4.Juli. Als Verfasser der Unabhängigkeitserklärung gilt zu Recht Thomas Jefferson von Virginia. Das Original befindet sich heute in den National Archives.
Das Wahlrecht:
Wie auch in England durften zunächst nur die wählen die genug besaßen (meistens Landbesitz), das hatte zur Folge, daß in den ersten Jahrzehnten nur zehn Prozent der Bevölkerung wahlberechtigt waren. Die Demokratisierung setzte erst mit der Eingliederung der westlichen Gebiete in die Union ein. Bereits 1821 hatten zehn Staaten des heutigen Mittleren Westens die Eigentumsqualifikationen beseitigt.
Unter dem Präsidenten Andrew Jackson (1829-1837 Demokrat) und seinen Nachfolgern wurde das allgemeine Wahlrecht auf alle Steuerzahler ausgedehnt, nicht wählen durften Frauen und Sklaven.
Als 1848 das erste Mal das Frauenwahlrecht öffentlich gefordert worden war, dauerte es 13 Jahre bis es als erstes in Wyoming eingeführt wurde. Bei Ende des Ersten Weltkrieges bestand es in 15 Staaten. 1920 wurde die Verfassung um Zusatzartikel 19 erweitert, der es allen Bürgern der Vereinigten Nationen über 21 Jahren erlaubte zu wählen. Wenige Jahre später, 1924, wurde mit dem Indian Citizenship Act auch den Indianern das Wahlrecht zugestanden. Bis 1965 wurde es dem schwarzen Teil der Bevölkerung erschwert zu wählen. Vor allem in den Südstaaten wurden sie durch Lesetests, den literacy tests, oder einer Wahlsteuer (poll-tax) vom Wählen abgehalten, bis im Jahre 1965 mit Hilfe des Voting Rights Act jegliche Behinderung der schwarzen Wähler verboten wurde. Dieser kleine Einblick in die Geschichte des Wahlrechts Amerikas macht deutlich, daß sich die Vereinigten Staaten erst langsam zu einer Demokratie entwickelt haben.
Die Legislative:
Der Kongreß ist der legislative Zweig des politischen Systems der Vereinigten Staaten. Wie das englische Parlament weist auch er zwei Kammern auf, den Senat und das Reprä- sentantenhaus.
Der Senat:
In den Senat entsendet jeder Bundesstaat zwei Abgeordnete, nicht so wie im Repräsentantenhaus, wo die Zahl der Abgeordneten auf Basis des Bevölkerungsproporzes erfolgt.
Die Senatoren werden jeweils für 6 Jahre gewählt, ein Drittel wechselt alle zwei Jahre, d.h., daß alle zwei Jahre 33 bzw. 34 Senatoren neu in den Senat kommen. Seit 1913 wählt das Volk direkt die Senatoren, davor wurden sie von den Volksvertretungen gewählt. Stirbt oder zieht sich ein Senator aus dem politischen Leben zurück, so steht es dem Gouverneur, des Staates den er vertreten hat, das Recht zu, seinen Nachfolger zu ernennen. Das Gehalt eines Senators beläuft sich auf 125100 US-$.
Das Repräsentantenhaus:
Laut Artikel 1 Absatz 2 der Verfassung muß ein Abgeordneter mindestens 25 Jahre alt, seit 7 Jahren Staatsbürger und zur Zeit seiner Wahl indem Bundesstaat wohnhaft sein indem er kandidiert. Er wird immer für 2 Jahre gewählt. Anders als bei den Senatoren muß eine Nachwahl stattfinden.
Das Repräsentantenhaus hat heute 435 Mitglieder. Die Aufschlüsselung erfolgt pro- portional zur Bevölkerung, zur Zeit entfällt auf etwa 520000 Wähler ein Abgeordneter.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Hauptaufgabe des Repräsentantenhauses ist die Gesetzgebung, es allein kann Steuer- und Finanzgesetze einbringen. Das Repräsentantenhaus kontrolliert alle Bundes- gelder, kann darüber aber nur mit Einwilligung des Senats verfügen. Im Gegensatz zu Großbritannien hat die Gesetzinitiative in großem Maße den Präsidenten und seine Büro- kratie übergehen können. Allerdings ist es den Präsidenten oft nicht gelungen, ihre im Wahlkampf vorgetragenen Absichten zu verwirklichen, da das Repräsentantenhaus seine Zustimmung verweigerte.
Die Ausführungen haben gezeigt, daß der Kongreß eine wesentliche Komponente in der Regierung durch checks and balances ist. Er erfüllt vor allem die ihm von den Gründer- vätern zugewiesene Aufgabe, die Meinung des amerikanischen Volkes zum Ausdruck zu bringen, als Legislative zu fungieren und die Exekutive zu überwachen. In diesem Sinne vertritt er die vielseitigen Interessen der Bevölkerung und ist der Ausdruck des amerikanischen Föderalismus2.
Die Exekutive:
Der Präsident:
Es ist gemeinhin üblich, von der amerikanischen Demokratie als einer Präsidialdemokratie zu sprechen, während man die englische bis vor wenigen Jahren als parlamentarische Demokratie bezeichnete.
Seine Wahl:
Der Präsident der Vereinigten Staaten wird alle 4 Jahre gewählt; er muß in den Vereinigten Staaten geboren, 35 Jahre alt sein und 17 Jahre im Land gewohnt haben. Seit dem 22. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, der seit dem 27.2.1951 in Kraft ist, kann er sich nur einmal zur Wiederwahl stellen.
Den an relativ kurze Wahlkämpfe gewöhnten europäischen Beobachter überrascht zunächst die lange Dauer des amerikanischen Wahlkampfes. Denn schon bevor die eigentlichen primaries (Vorwahlen) traditionsgemäß im Februar/März des Wahljahres in New Hampshire beginnen, finden bereits in den Vormonaten in einzelnen Staaten (z.b. Florida, Iowa und Maine) sog. caucuses statt, auf denen in den Wahlbezirken (precincts) Mitglieder der politischen Parteien die Delegierten für den Landesparteitag nominieren, auf dem dann entschieden wird, für welchen Kandidaten auf dem Bundesparteitag gestimmt werden soll. Da die eigentliche Wahl erst für November angesetzt ist, die Kandidaten jedoch schon Monate vor dem ersten caucus den Wahlkampf aufnehmen, werden die Kräfte aller beteiligten über Gebühr strapaziert. Es wurde festgestellt, daß das Interesse der Wähler sehr nachläßt, deswegen ist ein Erfolg in den Vorwahlen sehr wichtig.
Sollte ein dritter Kandidat zu den gestellt werden, was z.B. die Südstaatler gelegentlich getan haben, kann es geschehen, daß keiner die erforderliche Mehrheit (270 Stimmen) im Wahlkollegium der Parteien erhält, so stimmt das Repräsentantenhaus über den Präsidenten (jeder Staat hat dann 1 Stimme), bzw. der Kongreß über den Vize- präsidenten ab. Es kann daher vorkommen, daß der Präsident und der Vizepräsident aus verschiedenen Parteien sind, es wurde schon öfters vorgeschlagen dies abzuschaffen. Der Kongreß allerdings willigte nie ein, da dieses Wahlverfahren das Zweiparteiensystem und die Rechte der Einzelstaaten sichert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bis zu seiner Amtseinführung am 20. Januar des folgenden Jahres, seiner Inauguration, die mit seiner Vereidigung und einer Truppenparade verbunden ist, bleibt dem Präsidenten wenig Zeit sich von den Wahlstrapazen zu erholen, denn nun muß er sich Gedanken machen, wie er die Kabinetts- und Führungsposten besetzen will, davon gelten etwa 1200 als Schlüsselstellungen. Er wählt entweder Parteifreunde oder verfährt wie Kennedy, der sagte: „Was jene Schlüsselstellungen anbetrifft, interessiert es mich nicht, ob der Mann Demokrat oder Igorot (Angehöriger eines Stammes in Nordluzon) ist; ich will den besten Mann für den jeweiligen Posten haben.“
Neben der Suche nach geeigneten Mitarbeitern wird der zukünftige Präsident die Wochen bis zu seiner Amtseinführung dazu benutzen, die von ihm geplanten Gesetze vorzubereiten und über ihre Dringlichkeit entscheiden. Er wird sich dabei bereits seines Kabinetts bedienen, aber auch der Leute die er in Präsidialamte berufen will. Innerhalb dieser Präsidialkanzlei spielt heute das White House Office eine besondere Rolle. Sie beruht nicht zuletzt darauf, daß der Präsident bei der Wahl seiner engsten Mitarbeiter nicht, z.b. bei der Ernennung von Ministern und Richtern, der Zustimmung des Senats bedarf. Da diese überdies in allernächster Umgebung des Präsidenten tätig sind, haben sie ständig und sogar häufiger Zugang zum ihm als sein eigenes Kabinett. Die führenden Persönlichkeiten des White House Office wie T. C. Sorensen und Arthur M. Schlesinger Jr. unter J. F. Kennedy oder John D. Ehrlichman und H. R. Haldeman unter R. M. Nixon haben daher auch von diesem Amt aus maßgeblichen Einfluß auf die amerikanische Politik nehmen können. Während noch Woodrow Wilson die für seine Amtsführung wesentlichen Informationen selbst sammeln und auswerten und dann seine geplanten Maßnahmen mit einem oder zwei Vertrauten diskutieren konnte, war der Umfang des wichtigen Materials bei F. D. Roosevelts bereits so angewachsen, daß er sich mit einem Brain Trust, d.h. mit Fachleuten, oft Universitätsprofessoren, umgab, von denen er sich sachlich beraten lies. Heute sind die Probleme so komplex geworden, daß die Präsidenten gleich nach ihrer Wahl Sonderausschüsse, sogenannte Task Forces, bilden, die dringliche Probleme durchleuchten und Aktionsprogramme entwickeln sollen. Dieses Verfahren sichert bei der Übernahme der neuen Regierung die Mitarbeit wichtiger und erfahrener Personen. Es ist häufig zu beobachten, daß dem Präsidenten im zweiten Jahr seiner Amtszeit die Hände gebunden sind, da sich das Mehrheitsverhältnis, wenn sich alle Abgeordneten und ein Drittel der Senatoren erneut zur Wahl stellen müssen. Aus diesem Grund sind alle Präsidenten bemüht die wesentlichen Teile ihres Wahlprogrammes in den Flitterwochen, d.h. in den ersten 100 Tagen ihrer jeweiligen Amtszeit, zu verwirklichen.
Seine Funktionen:
Im Rahmen des politischen Systems Amerikas übt der Präsident folgende Funktionen aus:
1. Als Oberhaupt des Staates ist der Präsident Repräsentant seiner Nation. Wie der Bundespräsident oder der Monarch in England gibt er Staatsempfänge für die Potentaten aus aller Welt. Da die Amerikaner ihren Präsidenten als lebendes Symbol ihres Staates empfinden, wird jeder seiner Schritte wie auch die seiner Familie genauestens beobachtet.
2. Der Präsident besitzt zwar keine Gesetzesinitiative wie der englische Premierminister, aber er hat dennoch Teil an der Gesetzgebung. Er kann nämlich jederzeit durch ihm nahestehende Senatoren oder Abgeordnete Gesetzentwürfe einbringen lassen und auch ihm vom Kongreß zugeleitete Gesetzesanträge durch ein Veto verhindern.
Der Präsident kann sich aber auch mit seinen Plänen direkt an das Volk wenden. F. D. Roosevelt hat diesen Weg häufig gewählt und dazu seine „Kamingespräche“ benutzt. Seit der Erfindung des Fernsehers tragen amerikanische Präsidenten auch auf diesem Wege viele ihrer Pläne direkt dem Volk vor.
3. Als Repräsentant der Exekutive seines Landes überwacht der Präsident die Ausführung des Gesetzes. Da die Mitglieder des amerikanischen Kabinetts nicht die
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Selbständigkeit der englischen Minister besitzen, verkörpert der Präsident praktisch allein die Exekutive. Kommt es zu Konflikten zwischen dem Präsidenten und dem Kongreß und kann ein Kompromiß nicht herbeigeführt werden, dann kann eine Entscheidung durch den Obersten Gerichtshof erzielt werden.
4. Über die wichtige Funktion des Präsidenten, auf Anraten und mit Zustimmung des Senats alle höheren Beamten ( Botschafter, Bundesrichter, usw. ) zu ernennen, wurde bereits im Zusammenhang mit der Ämterpatronage gesprochen.
5. Laut Verfassung hat der amerikanische Präsident den Oberbefehl über die Bundestruppen, wenn sie zum aktiven Dienst einberufen sind. Wenn auch der Kongreß allein Kriege erklären kann, so vermag es der Präsident seine Nation so zu führen, daß ein Krieg unausweichlich ist. Um zu verhindern, daß ein Präsident unter Ausnutzung seiner Funktion als oberster Militärbefehlshaber eigenwillig die Nation in militärische Konflikte verwickelt, hat der Kongreß, auf dem Hintergrund der Ereignisse in Indochina, jetzt gesetzlich festgelegt, daß kein Präsident ohne Zustimmung der Legislative Truppen im Ausland für mehr als 60 Tage einsetzen darf (War Powers Act, 1973).
6. Da der Präsident Verträge mit ausländischen Mächten Vorbereiten kann, die allerdings, wie gezeigt, der Ratifizierung durch den Senat bedürfen, übt er einen großen Einfluß auf die internationalen Beziehungen seines Landes aus. In welchen Ausmaßen er selbst daran Tätig ist hängt von seinem politischen Interesse ab. Als Hauptinstrument ihrer Eigeninitiative dienen dem Präsidenten sogenannte executive agreements, die nicht der Genehmigung des Senates bedürfen. Selbstverständlich arbeitet jeder Präsident in außenpolitischen Fragen mit seinem Auswärtigen Amt (State Department) und solchen Organisationen wie dem Verteidigungsrat (National Security Council) und der Abwehr (Central Intelligence Agency) zusammen.
7. Im Gegensatz zum englischen Premierminister kann der amerikanische Präsidenten den Kongreß nicht auflösen; er kann also gezwungen sein, mit einem Kongreß zu regieren, indem seine Partei nicht über die Stimmenmehrheit verfügt, aber er ist auch nicht, wie der englische Premierminister, vom Vertrauen der Mehrheit abhängig. Während die Mitglieder seines Kabinetts nicht zum Kongreß sprechen dürfen, kann er selbst es so oft er will tun. Meistens begnügt er sich allerdings damit, Botschaften an den Kongreß zu richten.
8. Schließlich besitzt der Präsident das Begnadigungsrecht, außer in Fällen öffentlicher Anklage gegen Minister.
Seine Macht:
Die politische Stellung des amerikanischen Präsidenten ist ausgesprochen persönlicher und individueller Natur. Wenn darauf verwiesen wurde, daß es starke und schwache Präsidenten gegeben hat, so haben diese Ausführungen gezeigt, daß er nie, außer vielleicht in Krisen- oder Kriegszeiten, die Macht eines Diktators hat. Denn alle Maßnahmen des Präsidenten unterliegen ständig der Kontrolle der öffentlichen Meinung. Kein Präsident kann sich daher zu weit von ihr entfernen, ohne entweder seine Wiederwahl und/oder die Chancen seiner Partei bei der nächsten Wahl zu gefährden. Sicherlich muß er außer auf die öffentliche und auf die politischen Traditionen seines Landes auch auf die Legislative und richterliche Gewalt Rücksicht nehmen. In den letzten Jahren hat das weltpolitische Engagement der Vereinigten Staaten außerdem bewirkt, daß jeder Präsident in seine politischen Überlegungen auch die Wünsche seiner Verbündeten mit einbeziehen muß.
Dennoch hat sich sein Machtbereich ständig erweitert. Zwar sind auch schon in der Vergangenheit wichtige Entscheidungen manchmal ohne vorherige Beratung mit dem Kongreß getroffen worden, z.b. der Ankauf Louisianas durch Thomas Jefferson im Jahre 1803, aber im 20. Jahrhundert beginnen sich solch eigenmächtige Handlungen der Präsidenten zu häufen. Erinnert man sich an F. D. Roosevelts Zerstörer-Stützpunkt- Handel, der praktisch das Ende der amerikanischen Neutralität im 2. Weltkrieg
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
bedeutete, an den Abwurf der ersten Atombombe über Hiroshima unter H. s. Truman, an die Luftbrücke Berlin und an den Einsatz amerikanischer Truppen in Korea und Kuba unter Truman und Kennedy sowie an die von R. M. Nixon und R. Reagan angeordneten Bombenangriffe auf Kambodscha bzw. Libyen. In allen Fällen lag die Entscheidung und die letzte Verantwortung allein beim Präsidenten, und der Kongreß wurde vor vollendete Tatsachen gestellt.
Heute gibt es in Amerika bedeutende Politologen und Publizisten, die die Ansicht vertreten, daß die Befugnisse des Präsidenten noch erweitert werden müßten. Diese Auffassung vertraten sie sogar gegenüber dem Kongreß, den sie, im Gegensatz zum Präsidenten, auch noch für zu abhängig von der Volksmeinung hielten. In der Öffentlichkeit fanden diese Vorstellungen jedoch nur wenig Echo, weil sie, nachdem deutlich wurde, daß Präsidenten beider Parteien immer häufiger bei Umgehung des Kongresses unter Ausnutzung von executive agreements eigenmächtig handelten, über den Machthunger ihrer Präsidenten zunehmend unruhiger wurde. Die Auseinandersetzungen um die Machtverteilung zwischen dem Präsidenten und dem Kongreß erreichten ihren Höhepunkt jedoch erst während der Präsidentschaft R. M. Nixons. Sein unbeugsamer Wille, um jeden Preis die Wiederwahl zu erzwingen, ließen ihn und seine Mitarbeiter zu Mitteln greifen, die außerhalb der Legalität lagen. Neben den äußert zweifelhaften Machenschaften des republikanischen Wahlkampfausschusses im Zusammenhang mit der Wahlkampffinanzierung, war es vor allem der Einbruch der sog. plumbers (Klempner) in das Wahlkampfbüro der Demokratischen Partei im Watergate-Gebäude am 17.6.1972, die die Situation zum Siedepunkt brachte. Während der monatelangen Untersuchungen dieser Affäre kamen weitere Unregelmäßigkeiten und Verbrechen an den Tag, daß zum zweiten Mal in der amerikanischen Geschichte ein Impeachment-Verfahren gegen einen Präsidenten eingeleitet wurde. Von der in der Verfassung, Artikel II, Abschnitt 4 recht vage formulierten Möglichkeit, Staatsdiener wegen Mißbrauch ihres Amtes anzuklagen, sie zu verurteilen und ihres Amtes zu entheben, ist im Laufe der Geschichte nur zwölf Mal Gebrauch gemacht worden. In vier Fällen wurden die Angeklagten ihres Amtes enthoben, nachdem sie, wie die Verfassung es vorschreibt, vom Repräsentantenhaus angeklagt (Artikel I, Abschnitt 2) und vom Senat verurteilt (Artikel I, Abschnitt 3) worden waren.
Der Vizepräsident:
Gleichzeitig mit den Kandidaten für das Amt des Präsidenten nominieren die Delegierten der Parteikonvente auch die Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. Bei ihrer Auswahl, die meist allein dem Präsidentschaftskandidaten vorbehalten bleibt, jedoch von den Delegierten des Parteitages bestätigt werden muß, spielen taktische Überlegungen eine große Rolle. Um allen im Lande vertretenen regionalen und Gruppeninteressen möglichst gerecht zu werden, wird der Mitkandidat (running-mate) gewöhnlich eine andere Region vertreten als der Bewerber für das höchste Amt.
Tritt der Fall ein, daß der Vizepräsident das erste Amt im Staat übernehmen muß, dann vollzieht sich die Übertragung der Macht reibungslos, selbst wenn sich inzwischen herausgestellt haben sollte, daß der Vizepräsident nur wenige Voraussetzungen für das verantwortungsvolle Amt mitbringt. Daß die amerikanische Demokratie auch für das Amt weniger geeignete Präsidenten übersteht, zeigt der Fall Andrew Johnson, der nach der Ermordung Abraham Lincolns dessen Nachfolge antrat. Gegen ihn wurde im Laufe seiner Amtszeit Klage wegen Amtsmißbrauch erhoben.
Obwohl der Vizepräsident meistens des Präsidentschaftskandidaten eigene Wahl ist, haben die Inhaber dieses Amtes nur selten ein zufriedenstellendes Verhältnis zu ihren Präsidenten gehabt, nicht zuletzt, weil er bei seinen Überlegungen oft regionale und parteiinterne Gesichtspunkte hat berücksichtigen müssen.
Meist tritt der Vizepräsident in den Hintergrund, selbst wenn er ein eigenes politisches Profil besitzt oder gar selbst das höchste Amt des Staates anstrebt. Nach wie vor hat der Vizepräsident den Vorsitz im Senat. Ähnlich wie der speaker im englischen Unterhaus ist er dort, allerdings auch nur im Falle einer unentschiedenen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abstimmung, stimmberechtigt. Doch sollte man seinen Einfluß im Senat nicht unterschätzen, in kritischen Debatten vermag er dadurch großen Einfluß auszuüben, daß er das Wort erteilen, aber auch verweigern kann. Schließlich sollte man auch erwähnen, daß der Vizepräsident an allen Kabinettssitzungen und an den Besprechungen des Verteidigungsrates amtlich teilnimmt, also gerade in den Gremien sitzt, in denen über die wichtigsten Regierungsmaßnahmen entschieden wird.
Das Kabinett und die Bürokratie:
Die machtvolle Position des amerikanischen Präsidenten als Chef der Executive wird durch die Tatsache unterstrichen, daß er keine gleichberechtigten Minister neben sich hat. Im englischen Kabinett dagegen fühlte sich der Premierminister aus Tradition bisher meist nur als Erster unter Ranggleichen.
Als in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts der englische Premierminister eine Entscheidung über das Korngesetz herbeiführen wollte, sagte er „Es ist ganz gleich, was wir sagen; aber wir müssen alle das selbe sagen.“ Als Abraham Lincoln einige Jahrzehnte später eine Abstimmung im Kabinett vornahm, soll er kurz und bündig gesagt haben: „Sieben Nein-Stimmen, eine Ja-Stimme (seine Eigene), der Antrag ist angenommen.“ Damit ist klar zum Ausdruck gebracht, daß ein amerikanischer Präsident sich nicht um die Meinung seiner Minister zu kümmern braucht, während im englischen Kabinett - wenigstens bis vor kurzem - so lange verhandelt wird, bis ein allen annehmbarer Kompromiß erzielt ist. Rein äußerlich wird die untergeordnete Stellung der amerikanischen Kabinettsmitglieder dadurch deutlich das ihr offizieller Titel Secretary ist. Ein weiterer äußerlicher Unterschied zwischen dem englischen und dem amerikanischen Kabinett besteht darin, daß das amerikanische kleiner ist. Zu Zeiten Lincolns gab es 7, heute gibt es 14 Mitglieder. In England hat das Kabinett im Durchschnitt 20 Mitglieder. Die Geschichte des Kabinetts spiegelt Wandlungen in der Gesellschaft wider; neue Bedürfnisse und soziale und wirtschaftliche Veränderungen haben zur Einrichtung neuer wie zur Abschaffung überflüssig gewordener Departments geführt. In Verfolgung seines Great Society-Programms erkannte z.b. L. B. Johnson die Wichtigkeit des sozialen Wohnungsbaues und der Neuordnung der Städte durch die Schaffung des Department of Housing and Urban Renewal (1966) an. Im gleichen Jahr wurde ferner ein Department of Transportation eingerichtet.
Der Präsident ist nicht verpflichtet, einen Minister im Amt zu halten, der öffentlicher Kritik unterliegt. Umgekehrt kann er an einer umstrittenen Persönlichkeit festhalten. Es spricht für die Großzügigkeit des amerikanischen Systems, daß man einem Präsidenten zugesteht, Angehörige der Oppositionspartei in sein Kabinett zu berufen. Sicherlich ist es auch einmalig in der Welt, daß ein politisches Amt von der Bedeutung des State Department einem im Ausland Geborenen (Henry Kissinger) übertragen wurde. Ein weiterer Unterschied zwischen dem englischen und dem amerikanischen Kabinett besteht darin, daß in England besonders großer Wert darauf gelegt wird, daß ein Minister ein guter Verhandlungsführer (Chairman) ist, ohne dabei zugleich Experte sein zu müssen. Dies ist möglich, da er sich, was das Sachwissen anbetrifft, auf seine Ständigen Staatssekretäre (Permanent Undersecretaries) verlassen kann. In den Vereinigten Staaten sind dagegen die Minister oft selbst Experten.
Aus der Gruppe der Kabinettsmitglieder ragen der Außenminister (Secretary of State), der Finanzminister (Secretary of the Treasury) und der Verteidigungsminister (Secretary of Defense)etwas heraus. Besonders vom Außenminister ist gesagt worden, daß er sehr einflußreich sein kann, wenn er ein fähiger Mann mit guten Ruf beim Kongreß und Präsidenten ist.
Daß das amerikanische Kabinett nicht die gleiche Rolle spielt wie das englische, ist auch daraus zu entnehmen, daß sich nur selten alle Minister beim Präsidenten einfinden. Nur für den Notfall gibt es in Amerika interministrielle Ausschüsse, an deren Sitzungen die Minister gewöhnlich nicht teilnehmen, sondern sich durch Beamten vertreten lassen. Außerdem sind Aufgaben, die keinem Department unterstehen, sog. Executive Agencies übertragen, von denen es etwa 50 gibt. Sie werden gewöhnlich sofort zur Übernahme
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
bestimmter Aufgaben gebildet, werden dann aber häufig zu Dauereinrichtungen wie die National Aeronautics and Space Administration (NASA) oder der US Information Service (USIS), dem als Informationsorganisationen der USA im Ausland z.b. die Amerikahäuser unterstehen.
Das Bundeskriminalamt (FBI) wurde im Jahre 1908 als Abteilung des Justizministeriums eingerichtet und befaßt sich u.a. mit der Aufdeckung von Verschwörungen und Landesverrat sowie wie mit der Verfolgung von staatsfeindlichen und kriminellen Gruppen. Nach dem Tode John Edgar Hoover beginnt jetzt allmählich bekannt zu werden, welch bedeutende Rolle er als Direktor des FBI in den fast 50 Jahren (1924-1972) seiner Tätigkeit gespielt hat.
Die Central Intelligence Agency und der National Security Council wurden im Rahmen des National Security Act im Jahre 1947 geschaffen; die CIA mit dem Auftrag, Auslandsaufklärung zu betreiben, der NSC, dem neben dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der Außenminister, der Verteidigungsminister und der Director of Emergency Planning angehören, zur Planung und Koordinierung der Außen- und Verteidigungspolitik.
Das Wechselspiel zwischen Legislative und Executive: Was eine amerikanische Regierung erreicht, hängt in großem Maße von der reibungslosen Zusammenarbeit zwischen Legislative und Executive ab.
Die Geschichte liefert genügend Beispiele dafür, daß das System des Wechselspiels der Kräfte nicht immer ohne Schwierigkeiten abläuft. Von der Persönlichkeit des Präsidenten und von der Zusammensetzung des Kongresses hängt es ab, ob Legislative und Executive harmonisch zusammenarbeiten oder sich bei der Erfüllung der ihnen von der Verfassung übertragenen Pflichten behindern.
Obwohl Kennedy in beiden Häusern eine unbeträchtliche Mehrheit verfügte, blieben wichtige Teile seines New Frontiers-Programms unerledigt, einfach weil der fehlende Fraktionszwang es den Demokraten der Südstaaten erlaubte, mit den Republikanern gegen Kennedy zu stimmen. Dennoch war Kennedy, wie Meinungsbefragungen ergaben, im zweiten Jahr seiner Amtszeit populärer als vor seiner Wahl.
Das Verhalten des Kongresses läßt ferner erkennen, wie hinderlich für einen tatkräftigen Politiker die Tatsache sein kann, daß sich die Kongreßmitglieder zu oft als Vertreter ihrer Wahlbezirke sehen und deshalb nationale Belange aus den Augen verlieren. In den letzten Jahrzehnten sind manche Präsidenten an der Verwirklichung ihrer Pläne gehindert worden, weil ihre Partei im Kongreß nicht über die Mehrheit der Stimmen verfügte. Während der vergangenen 60 Jahre verfügten die Demokraten 50 Jahre lang im Repräsentantenhaus bzw. Senat über eine Mehrheit.
Einen lästigen Hemmschuh für eine weit vorausschauende, fortschrittliche Politik stellt heute auch oft die Verwaltungsbürokratie dar. Ihre Neigung, an eingelaufene Verfahren festzuhalten, erschwert es der Executive und der Legislative, Neuerungen durchzusetzen, und ihre zunehmende Unabhängigkeit ermöglicht es den Beamten, Initiativen des Präsidenten zu ignorieren. Politologen bezeichnen deswegen die Bürokratie bereits schon als vierte Regierungsgewalt.
James Madisons Grundprinzip, daß in der amerikanischen Republik ein Interesse vom anderen ausbalanciert und ein Zweig der Regierung von den übrigen kontrolliert werden müsse, galt nicht nur in der Vergangenheit, sondern bestimmt auch heute noch das politische Leben der Vereinigten Staaten.
Der Oberste Gerichtshof:
Der Artikel III, Abschnitt 2 der amerikanischen Verfassung bestimmt: „Die richterliche Gewalt der Vereinigten Staaten wird einem Obersten Gerichtshof und solchen niederen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gerichten anvertraut, welche der Kongreß von Zeit zu Zeit anordnen und errichten kann.“ Damit erhielt das amerikanische politische System, das auf dem Prinzip der Gewaltenteilung, der Regierung durch Kontrolle und Gleichgewicht aufgebaut sein sollte. Schon die Verfassung des Staates Massachusetts, ein Vorläufer der Bundesverfassung, hatte gefordert, eine Regierung auf der Basis des Gesetzes und nicht des Menschen zu errichten.
Mit der Schaffung eines Obersten Gerichtshofes entsprachen die Väter der amerikanischen Verfassung aber nicht nur dem Prinzip der Gewaltenteilung und rechtsstaatlichen Idee, sie trugen auch einem praktischen Erfordernis Rechnung, das sich daraus ergab, daß die Vereinigten Staaten ein Bundesstaat sind und aufgrund einer geschriebenen Verfassung regiert werden.
Es muß daher in diesem Land eine Instanz geben, die Streitigkeiten zwischen den einzelnen Staaten oder zwischen einem oder mehreren Einzelstaaten und der Bundesregierung schlichtet und die die Bundesverfassung auslegt. Da das Bundesrecht das Recht der Einzelstaaten bricht, besitzt der Oberste Gerichtshof die Macht, Gesetze der Bundesstaaten für nichtig zu erklären.
Wichtiger noch als die Überwachung der einzelstaatlichen Gesetzgebung ist die interpretatorische Tätigkeit des Obersten Gerichtshofes. Sie erlaubt es, die Verfassung ewig jung zu halten, indem sie ihren Geist wahrt, ihre Bestimmung aber den Gegebenheiten der Zeit anpaßt.
Da der Oberste Gerichtshof gleichberechtigt neben dem Kongreß und dem Präsidenten, daß heißt neben Legislative und Exekutive steht, kann er auch in die Gesetzgebung eingreifen. Allerdings nicht in beratener Funktion, sondern wird er erst aktiv, wenn ein Gesetz von der Exekutive und Legislative in Kraft gesetzt wurde und wenn ein oder mehrere Bürger Klage dagegen erhoben haben. Erst dann greift das Gericht ein und macht möglicherweise von seinem Recht Gebrauch, Gesetze als unvereinbar mit der amerikanischen Verfassung zu erklären. Bis zum amerikanischen Bürgerkrieg ist das kaum vorgekommen. Der berühmteste Fall war bis zu dieser Zeit der Dred Scott Case (1857), in dem es um die Bürgerrechte eines Sklaven ging. Seitdem hat das Oberste Gericht in etwa 80 Fällen Bundesgesetze und in 660 Fällen einzelstaatliche Gesetze als Ganzes oder in Teilen für verfassungswidrig erklärt.
Wegen dieser Machtbefugnisse haben Rechtswissenschaftler den Obersten Gerichtshof nicht zu Unrecht als eine Dritte Kammer bezeichnet, wohl besonders deshalb, weil es in der neueren Zeit immer häufiger vorkommen ist, daß der Gerichtshof Gesetze aufgrund von politischen Argumenten zurück gewiesen hat.
Neben den genannten Funktionen kann der Oberste Gerichtshof auch die letzte richterliche Instanz bei Klagen einzelner amerikanischer Bürger sein. Einer der bekanntesten Fälle, bei denen ein Bürger seine Klage bis zum Obersten Gericht trug, war der Rechtsstreit West Virginia State Board of Education v. Barnette aus dem Jahre 1943. Die Barnettes, eine Familie, die der religiösen Sekte der Zeugen Jehovas angehörte, hatten ihren Kindern die von der Schulbehörde verlangte Ehrenbezeugung der amerikanischen Flagge verboten. Dieser Flaggengruß ist in vielen Staaten mit dem von den Schülern gesprochenen Treueid verbunden. Wegen der Verweigerung dieses Flaggengrußes waren die Kinder von der Schulbehörde aus der Schule ausgeschlossen worden. Der Oberste Gerichtshof bestätigte den Bürgern der Vereinigten Staaten das Recht, diese Ehrenbezeugung zu verweigern. Erstaunlicher weise war es ausgerechnet ein Angehöriger einer anderen Minderheit, Felix Frankfurter, ein Jude, der sich nicht der Auffassung seiner Kollegen anschloß.
Dieser berühmte Fall zeigt übrigens, daß der Oberste Gerichtshof nicht wie die englischen Geschworenengerichte zu einer einstimmigen Entscheidung kommen muß. Die überstimmten Richter können den Urteilsgründen sogar ihre Auffassung (minority opinion) anfügen (das Gleiche gilt übrigens auch für unser Bundesverfassungsgericht). Solche Minderheiten-Voten sind häufig bedeutungsvoll: wenn zu einem späteren Zeitpunkt ähnliche Fälle anstehen, wird oft auf sie Bezug genommen und gelegentlich ein früheres Urteil revidiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eines der Hauptgebiete, auf dem Supreme Court seit Jahrzehnten über die Wahrung der in der Verfassung verbrieften Rechte der amerikanischen Bürger wacht, ist die Trennung von Staat und Kirche. Seit der Virginia Bill of Rights (1776) haben die Amerikaner alle aus der Kolonialzeit stammenden Ansätze zur Bildung einer Staatskirche, d. h. einer Established Church nach dem Vorbild der Kirche von England, beseitigt und auch verhindert, daß irgendeine andere religiöse Gruppe für sich die Rechte einer Staatskirche in Anspruch nahm. Sie wollten auf diese Weise die Rechtsgleichheit aller sichern und feudalistische Ansätze von ihrem Land fernhalten. So hat der Oberste Gerichtshof weder zugelassen, daß religiöse Gruppen, wie die Zeugen Jehovas, dem Staat gegenüber verpflichtet wurden, noch, daß der Staat sich in religiöse Angelegenheiten einmischt.
In diesem Zusammenhang ist eine weitere Entscheidung des Obersten Gerichtshofes von Grundlegender Bedeutung: Der Staat New York hatte 1958 seinen Schulen zur Pflicht gemacht, den Schultag mit einem, wie er glaubte, für alle Schüler aller Bekenntnisse annehmbaren, von der Erziehungsbehörde bereits 1951 verfaßten Gebet zu beginnen. Es lautete: „Allmächtiger Gott, wir bekennen, daß wir von dir abhängig sind, und wir bitten dich, uns, unsere Eltern, unsere Lehrer und unser Land zu segnen.“ Mit einer 6:1-Entscheidung (ein Richter war krank und einer noch nicht ernannt) gab der Oberste Gerichtshof den klagenden Eltern, einer Gruppe von Unitariern, Juden und Agnostikern, recht und erklärte, daß das Gebet gegen die Verfassung verstoße: „In unserem Land“, verkündete Richter Black, „ist es nicht Aufgabe der Regierung, offizielle Gebete für irgendeine Gruppe des amerikanischen Volkes zu formulieren. Es ist der Sinn des 1. Amendment, daß jedermanns Gebet in einer Schule aus eigener Seele kommen soll.“ Der einzige Richter, der gegen die Entscheidung stimmte, machte geltend, daß auch andere amerikanische Institutionen, der Surpreme Court eingeschlossen, ihre Sitzungen mit einem Gebet beginnen. Das von den Richtern gesprochene Gebet lautet: „Gott schütze die Vereinigten Staaten und diesen ehrenwerten Gerichtshof.“
Obwohl sich das Oberste Gericht bei allen seinen Entscheidungen stets auf die Verfassung, vor allem auf die Bill of Rights, beruft, ist die Rechtsprechung nicht erstarrt. Gerade die Entscheidungen der letzten Jahre (Aufhebung der Rassentrennung, Neuverteilung der Kongreßsitze) machen deutlich, daß der Oberste Gerichtshof notwendige Reformen erzwungen hat, die im Kongreß, meist am Widerstand der Südstaatler und anderer Konservativer Kräfte, gescheitert oder steckengeblieben waren. Der Überblick zeigt, daß der Oberste Gerichtshof im Laufe der Zeit der amerikanischen Geschichte zum allgemein respektierten Wächter über die Verfassung geworden ist. Er hat zweifellos seinen Auftrag, die bürgerlichen Recht, sehr ernst genommen. Wenn sein Prestige gelegentlich durch 5:4-Entscheidungen erschüttert wurde, weil er damit zu der allgemein gehegten Auffassung, daß es nur ein Recht gäbe, im Widerspruch zu stehen schien, so ist er doch im Gegensatz zu anderen politischen Institutionen nie in den Verdacht geraten, korrupt zu sein. Als die Richter auf dem Höhepunkt des Watergate- Skandales von R. M. Nixon die Herausgabe der ihn belastenden Tonbänder anordneten, sah die amerikanische Bevölkerung darin einen erneuten Beweis für ihre Integrität. Sie fand bestätigt, daß der Oberste Gerichtshof die Rechtsstaatlichkeit ihres Landes garantiert und seine Funktion im System der Regierung durch check and balances voll erfüllt.
Im Artikel III der Verfassung ist vorgesehen, daß der Kongreß die Einrichtung von unteren Gerichten anordnen kann. Das ist auch geschehen. Es gibt heute 91 US District Courts, die über das ganze Land verteilt sind. Ihre Zuständigkeit er streckt sich auf Rechtsfälle, die Verfassungsfragen berühren, wie auf Streitigkeiten von Bürgern aus verschiedenen Einzelstaaten, soweit der umstrittene Rechtsgegenstand die Höhe von 10000 Dollar übersteigt. Zu den bekannteren Fällen, die in den letzten Jahren von derartigen District Courts untersucht wurden, gehören z. B. die Prozesse gegen die Mörder von Robert Kennedy und gegen den Vizepräsidenten S. T. Agnew. Um den Obersten Gerichtshof weiterhin zu entlasten, wurden elf US Courts of Appeal, Appelationsgerichte, gebildet, die in vielen Fällen die letzte Instanz bilden. Es ist ein weit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
verbreiteter Irrtum, daß das Oberste Gericht allen Anträgen auf Revision stattgibt. Von ca. 2000 Rechtsfällen, die jährlich an es herangetragen werden, überprüft es etwa zehn Prozent.
Der bundesstaatliche Charakter der amerikanischen Rechtsordnung spiegelt sich in der Tatsache wider, daß der Oberste Gerichtshof die Urteilsfindung der einzelstaatlichen Gerichte revidieren kann, wenn sie Bundesfragen betrifft. In allen anderen Angelegenheiten liegt die letzte Zuständigkeit bei den Einzelstaaten. Als für das ganze Bundesgebiet von Bedeutung kann, wie gesagt, der Oberste Gerichtshof auch den Streitfall eines einzelnen Bürgers ansehen.
Die Demokratisch und die Republikanische Partei:
Die Vorgeschichte der beiden Parteien ist für einen Europäer etwas verwirrend, da sie häufig ihre Namen gewechselt haben, in ihrer heutigen Form bestehen sie etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Demokraten sehen in Thomas Jefferson ihren Gründer, die Republikaner stellen sich in die Tradition von Alexander Hamilton. Im Zeitraum von 1860 bis 1932 haben die Republikaner immer den Präsidenten, mit Ausnahme von vier Amtsperioden, gestellt, was teils auf den siegreichen Abschluß des Bürgerkriegs beruht und teils auf den die Industrialisierung begleitenden Aufschwung zurück zu führen ist. Über die heutigen Ziele der beiden großen Parteien etwas Genaueres zusagen, ist deshalb so schwierig, weil sie im europäischen Sinne keine festen Parteiprogramme besitzen. Wahrscheinlich erklärt die Größe des Landes, seine so vielfältige wirtschaftliche und ethnische Struktur, daß sich seit dem Bestehen der Parteien in den Vereinigten Staaten immer wieder neue Koalitionen innerhalb der lockeren Parteirahmens gebildet haben. Da es unmöglich ist, ein Programm aufzustellen, das den Interessen und Wünschen aller Regionen und Gruppen entspricht, bemühen sich die Parteien stets, ihr Programm so allgemein wie möglich zu halten. Es bleibt dem Geschick der Parteiführer überlassen, auf den Parteitagen ein Programm zu entwickeln, das auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner abgestimmt ist.
Vor einer Wahl muß sich die jeweilige Parteiführung daher zunächst entscheiden, auf welche Probleme sie das Schwergewicht legen will. Auf dem Parteikonvent wird sie dann ihr ganzes Geschick aufwenden, um, notfalls durch Kompromisse oder selbst durch Ausschalten aller umstrittenen Fragen, die Einheit und Geschlossenheit herzu stellen. Die Geschichte zeigt allerdings, daß die Partei, die sich zu sehr auf ein Ziel versteift, leicht auseinanderbricht. Das war z. B. im Jahre 1948 der Fall, als sich auf dem Parteitag der Demokraten die Gegner des Bürgerrechtsprogramms von ihrer Partei trennten und als Dixicrats einen eigenen Präsidentschaftskandidaten aufstellten.
Diese Eigentümlichkeit der amerikanischen Parteien bedingt, daß, wie schon erwähnt, ein Präsident sich nicht mit Sicherheit auf die Gefolgschaft seiner Partei im Kongreß verlassen kann und daß es immer wieder vorkommt, daß z. B. liberale Republikaner mit fortschrittlichen Demokraten stimmen oder sich die beiden konservativen Gruppen beider Parteien zusammenfinden. Ein Fraktionszwang, der in England durch die sog. Einpeitscher jederzeit ausgeübt wird und dessen Nichtbeachtung für den englischen Parlamentarier das Ende seiner politischen Karriere bedeuten kann, ist in den Vereinigten Staaten so gut wie unbekannt. Die fehlende Geschlossenheit der Parteivertreter im Kongreß hat in gewisser Weise ihr Gegenstück in der Einstellung der Wähler. Sie stimmen bei Wahlen selten für ein Programm, sondern meistens für eine Person, allenfalls lassen sie sich durch den Namen einer Partei oder ihre Vergangenheit bestimmen.
Während jede Partei über einen festen Stamm von Wählern verfügt, sind bei allen Wahlen, besonders aber bei den Präsidentschaftswahlen, die nicht parteigebundenen Wähler (floating vote), die auf etwa 30 Prozent der gesamten Wählerschaft geschätzt werden, entscheidend. Ein häufiges Motiv dieser Wechselwähler, auf die beide Parteien während
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ihres Wahlkampfes einen großen Teil ihrer Aufmerksamkeit richten, ist die Überzeugung, daß nach einer längeren Regierungszeit der einen Partei einmal die andere eine Chance haben müsse.
Während die Parteien Schwierigkeiten haben, ihre Gefolgschaft bei Präsidenten- und Kongreßwahlen auf Kurs zu halten, vermögen sie bei Wahlen auf lokaler Ebene dem Wählervolk das Gefühl zu vermitteln, am Geschehen beteiligt zu sein. Mit Sorgfalt achten die lokalen Parteiorganisationen darauf, daß für die Wahlämter nur solche Kandidaten nominiert werden, die populär sind und die mit Sicherheit den die Bürger direkt betreffenden Interessen dienen werden.
Im Widerspruch zu der auf lokaler Ebene sichtbaren politischen Aktivität steht die auffällig geringe Beteiligung der Amerikaner an den landesweiten Wahlen. Während zu Abraham Lincolns Zeiten 81,1 Prozent der Wahlberechtigten zu den Wahlurnen gingen, machten in unserem Jahrhundert nur selten mehr als 60 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Für die relativ geringe Beteiligung bei den Bundeswahlen werden viele Gründe genannt. Einmal wird von vielen Wählern die in den Einzelstaaten zur Ausübung des Wahlrechts geforderte verschieden lange Ortsansässigkeit nicht erfüllt, zum anderen ist ihnen das umständliche Registrierverfahren zu unbequem.
In der Außenpolitik haben beide Parteien in den letzten Jahren nach gemeinsamen Lösungen gesucht, aber aus ihrer geschichtlichen Entwicklung ergeben sich auch in diesem Bereich Differenzierung. Zunächst ist festzustellen, daß die Demokraten in dem Ruf stehen, eine Kriegspartei zu sein. Kaum ein Wahlkampf geht ins Land, ohne das die Republikaner darauf hinweisen, daß es die Demokraten waren, die die USA in Kriege verwickelten (Erster und Zweiter Weltkrieg, Korea und Vietnam) und die erste Atombombe werfen ließen. Dieser Vorwurf ist kaum zu widerlegen. Ihm steht jedoch die Tatsache entgegen, daß die Demokraten sich stets mit mehr Bereitwilligkeit als die Republikaner für internationale Zusammenarbeit eingesetzt haben.
Der Übergang von einer demokratischen zu einer republikanischen Administration im Jahre 1981 ließ bereits deutlich unterschiedliche Akzentsetzungen in der Außenpolitik erkennen: während Carter im Wahlkampf für die Fortsetzung der Entspannungspolitik und für die Ratifizierung der SALT-2-Abkommen eingesetzt hatte, beabsichtigte Reagan zu einer Politik der Stärke zurückzukehren.
Diese Gegenüberstellung der Hauptziele der beiden großen Parteien zeigt, daß sie sich tatsächlich vornehmlich durch verschiedene Akzentsetzungen und Methoden unter- scheiden. Gerade deshalb wird es kaum jemanden wundern, daß relativ viele Amerikaner ihre Stimme nicht immer der selben Partei geben. Aus einer rein praktischen Einstellung heraus wählen sie oft in erster Linie den Mann, der ihnen am meisten verspricht, und die Partei, die ihren augenblicklichen Interessen am nächsten kommt. Weil ein bedeutender Prozentsatz der amerikanischen Bevölkerung keine feste Bindung an eine Partei kennt, weil sie sich von Wahl zu Wahl neu entscheiden, haben die unabhängigen Wähler in ihrem Land einen erstaunlich großen Einfluß.
„Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, von der Absicht geleitet, unseren Bund zu vervollkommnen, die Gerechtigkeit zu verwirklichen, die Ruhe im Inneren zu sichern, für die Landesverteidigung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern und das Glück der Freiheit uns selbst und unseren Nachkommen zu bewahren, setzen und begründen diese Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika.“
(Einleitung zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. George Washington, (1798-1797) Föderalist
2. John Adams, (1797-1801) Föderalist
3. Thomas Jefferson, (1801-1809) Demokr.-Republ.
4. James Madison, (1809-1817) Demokr.-Republ.
5. James Monroe, (1817-1823) Demokr.-Republ.
6. John Quincy Adams, (1825-1829) Demokr.-Republ.
7. Andrew Jackson, (1829-1837) Demokr.
8. Martin van Buren, (1837-1841) Demokr.
9. William H. Harrison, (1841) Whig
10. John Tyler, (1842-1845) Demokr.
11. James R. Polk, (1845-1849) Demokr.
12. Zachary Taylor, (1849-1850) Whig
13. Millard Fillmore, (1850-1853) Whig
14. Franklin Pierce, (1853-1857) Demokr.
15. James Buchanan, (1857-1861) Demokr.
16. Abraham Lincoln, (1861-1865) Republ.
17. Andrew Johnson, (1865-1869) Republ.
18. Ulysses S. Grant, (1869-1877) Republ.
19. Rutherford B. Hayes, (1877-1891) Republ.
20. James A. Garfield, (1881) Republ.
21. Chester A. Arthur, (1881-1885) Republ.
22. Grover Cleveland, (1885-1889) Demokr.
23. Benjamin Harrison, (1889-1993) Republ.
24. Grover Cleveland, (1893-1897) Demokr.
25. William McKinley, (1897-1901) Republ.
26. Theodore Roosevelt, (1901- 1909) Republ.
27. William H. Taft, (1910-1913) Republ.
28. Woodrow Wilson, (1913-1921) Demokr.
29. Warren G. Harding, (1921-1923) Republ.
30. Calvin Coolidge, (1923-1929) Republ.
31. Herbert Hoover, (1929-1933) Republ.
32. Franklin D. Roosevelt, (1933-1945) Demokr.
33. Harry S. Truman, (1945-1953) Demokr.
34. Dwight D. Eisenhower, (1953-1961) Republ.
35. John F. Kennedy, (1961-1963) Demokr.
36. Lyndon B. Johnson, (1963-1969) Demokr.
37. Richard M. Nixon, (1969-1974) Republ.
38. Gerald Ford, (1974-1977) Republ.
39. Jimmy Carter, (1977-1981) Demokr.
40. Ronald Reagan, (1981-1989) Republ.
41. George Bush, (1989-1993) Republ.
42. Bill Clinton, (1993- ) Demokr.
[...]
1 Etwas lückenlos Zusammenhängendes
2 Streben nach einem Bundesstaat mit weitgehender Selbständigkeit der Einzelstaaten
- Arbeit zitieren
- Sebastian Jäger (Autor:in), 2001, Die Demokratie in Amerika, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105066
Kostenlos Autor werden




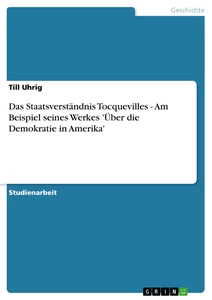











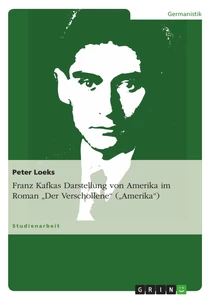





Kommentare