Leseprobe
0. Einleitung
Im Rahmen dieser Arbeit soll das Thema „Psychologie der Beziehungen“ behandelt werden. Die Wahl dieses Vertiefungsthemas begründet sich in erster Linie darin, daß ich aller Wahrscheinlichkeit nach die Wissenschaft der Psychologie im Rahmen meiner späteren Berufstätigkeit nutzen werde um das Verhalten und Erleben meiner selbst und anderer zu erklären bzw. zu verstehen, um eine möglichst hohe Handlungsfähigkeit in den Berufsfeldern der sozialen Arbeit zu erreichen. Aus diesem Grunde sind die wissenschafts-psychologischen Facetten des Faches Psychologie, die sich mit den Kernelementen des „normalen Alltages“ eines „normalen Menschen“ beschäftigen von besonderem Interesse. Diesem Gedanken folgend, habe ich mich im Rahmen der Prüfung, welche sowohl den Kontext als auch das Motiv dieser Arbeit bildet, für die beiden Teilgebiet Wohnpsychologie und Sozialpsychologie entschieden. Das Thema Psychologie der Beziehungen ist als eine Vertiefung der Sozialpsychologie, und damit des zweiten Teilgebietes der Prüfung, zu betrachten. Natürlich würden die meisten Bereiche der Psychologie auf irgendeine Weise dem oben beschriebenen Gedanken gerecht werden, doch sind die genannten Teilgebiete Wohnpsychologie und Sozialpsychologie mit expliziter Betrachtung von Dyaden meines Erachtens von besonderer Bedeutung, da das Wohnen und das Miteinander, mit besonderer Blickrichtung auf Zweierbeziehungen, in weiten Teilen die Substanz der Lebenswirklichkeit eines physisch und psychisch gesunden Menschen in unserem Kulturkreis bildet. Desweiteren vertrete ich den Standpunkt, daß in der Psychologie, und im besonderen der Sozialpsychologie, die Betrachtung von Dyaden, über die Mutter-Kind-Beziehung und die der Partnerschaft hinaus, zu wenig Beachtung findet, da diese, mal abgesehen von den Lebensphasen die durch Peergroups geprägt sind, von größerer Bedeutung für den Einzelnen sind, als das Wirken und Interagieren von Gruppe und Individuum, welches nun einmal vornehmlich Thema der Sozialpsychologie ist und dem entgegen zu wirken, möchte ich mit dieser Arbeit im kleinen Rahmen beitragen, und eventuell damit andere ermutigen sich diesem Gegenstand der Psychologie zu widmen. Darüber hinaus soll diese Arbeit die Thematik in erster Linie darstellen und durchleuchten, was Theisen im Vowort seines Buches „Wissenschaftliches Arbeiten“ auf den Punk brachte indem er W.Busch zitiert: „Setz´ Dich an des Tische Mitte, nimm´ zwei Bücher schreib das Dritte“ (THEISE, 1998, Vorwort S.VII)
Im ersten Teil dieses Skriptes werden zunächst im Sinne einer deduktiven Vorgehensweise der Begriff und das Feld der Sozialpsychologie geklärt um dann im weiteren den Beziehungsbegriff und seine Legitimation in der Wissenschaft der Psychologie zu beschreiben bzw. eine eigene Psychologie von Dyaden zu belegen.
Im zweiten dem vertiefenden Teil dieser Arbeit soll im ersten Schritt ein kurzer Exkurs in die Personenwahrnehmung unternommen werden, um die Grundlagen der Wahrnehmung eines Gegenübers zu verdeutlichen, da die Personenwahrnehmung permanent ihr Wirken im wechselseitigen Umgang mit Gruppen und Einzelnen entfaltet, und somit als eine Ergänzung zur Beziehungsthematik zu verstehen ist. Im zweiten Schritt soll zum eigentlichen Thema zurückgekehrt und explizit Beziehungstypen beschrieben werden, wobei diese einer Dreiteilung in Intrafamiliär, Peergroups und Interfamiliär vorgestellt werden.
Der dritte Teil soll ein Resümee aus dem Verfassten ziehen um das neu Erkannte zu extrahieren, sowie das Exzeptionelle des Erschlossenen hervorzuheben.
1. Begriffsdefinition
1.1. Sozialpsychologie
Die Sozialpsychologie ist als interdisziplinäre Wissenschaft zu betrachten, die sich mit den sozialen Einflüssen, vor allem mit den Einflüssen einer sozialen Gruppe, auf die Entwicklung und das Verhalten eines Individuums sowie den Rückwirkungen dieses Verhaltens auf die Gruppe befaßt. (vgl.: SCHÜLERDUDEN, 1981, S.349)
Bereits Sigmund Freud verwies 1921 auf die Notwendigkeit einer Psychologie die sich mit der Wechselwirkung zwischen dem Individuum und Anderen beschäftigt, indem er sagte: „Wenn die Psychologie, welche die Anlage, Triebregung, Motive, Absichten eines einzelnen Menschen bis zu seinen Handlungen und in die Beziehungen zu seinen nächsten verfolgt, ihre Aufgaben restlos gelöst und alle diese Zusammenhänge durchsichtig gemacht hätte, dann fände sie sich plötzlich vor einer neuen Aufgabe, die sich ungelöst vor Ihr erhebt. Sie müßte die überraschende Tatsache erklären, daß dies ihr verständlich gewordene Individuum unter einer bestimmten Bedingung ganz anders denkt, fühlt und handelt, als von ihm zu erwarten stand, und diese Bedingung ist die Einreihung in eine Menschenmenge.“ (BENESCH, 1995, S.297) Trotz des oben genannten einleitenden Defintionsversuches gibt es laut Klaudius R. Siegfried keine allgemein verbindliche Definition von Sozialpsychologie, wobei er darauf verweist, daß untheoretische beschreibende Ansätze, wie z.B. von G.W. Allport, das Feld der Sozialpsychologie zunächst ausreichend beschreiben. (vgl.: FACHLEXIKON, 1997, S.894) Allport sieht sie als das Bestreben „zu verstehen und zu erklären, wie das Denken, Fühlen und Verhalten von Individuen durch die reale, vorgestellte oder implizite Anwesenheit anderer beeinflußt wird“. (NOLTING/PAULUS, 1996, S.113)
Als bevorzugte Methoden der Sozialpsychologie sind systematische Beobachtungen und Befragungen, wie z.B. das Erstellen von Einstellungsskalen oder die Soziometrie nach J.L. Moreno, zu betrachten. Die Sozialpsychologie kommt zum Teil mit der Soziologie in Berührung, wobei sie sich dennoch durch ihren Blick auf das Individuum von dieser abgrenzen läßt. (vgl.: GOLDMANN LEXIKON, 1998, S.9152) Somit ist die Sozialpsychologie meines Erachtens nicht nur, aber auch als ein Schnittpunkt zu anderen Disziplinen zu betrachten, insbesondere natürlich zur Soziologie.
Um das Feld der modernen Sozialpsychologie abschließend deutlicher werden zu lassen, sind ihre Forschungsgebiete bzw. Unterdisziplinen wie folgt zu benennen:
- Soziale Wahrnehmung und Personenwahrnehmung · Soziale Kognition
- Einstellungsforschung
- Gruppenstrukturen und -prozesse
- Soziale Interaktion und Kommunikation · Theorie und Erforschung sozialer Rollen · Sozialisationsforschung
- Spezielle soziale Verhaltensweisen und ihre Motive · Massen- und Völkerpsychologie
- Politische Psychologie
- Sozialpsychiathrie
(vgl.: FACHLEXIKON, 1997, S.894/. GOLDMANN LEXIKON, 1998, S.9152/ NOLTING/PAULUS, 1996, S.113)
1.2. Beziehungsbegriff
Man unterscheidet zwischen funktionalen Beziehungen, die sich aus wechselseitigen Rollenerwartungen ergeben, wie z. B. zwischen Lehrern und Schülern, vor allem aber auch persönlichen Beziehungen, die sich zwischen zwei Menschen, ungeachtet ihrer sozialen Rolle, kraft ihrer Persönlichkeit entwickeln können.
Wenn das Verhalten von zwei Menschen voneinander abhängig ist, so daß jedes Verhalten des Einen eine Reaktion auf das vorangehende Verhalten des Anderen ist, stehen beide in einer sozialen Interaktion miteinander. Diese Interaktionen lassen sich durch Verhaltensketten beschreiben (z.B. VorwurfàRückzugàVorwurf...), die eine Interaktionsepisode darstellen. Verhaltensketten der Partner lassen sich durch die Häufigkeiten der Verhaltensweisen pro Zeiteinheit beschreiben, was mit Basisraten bezeichnet wird. Die relative Häufigkeit der Reaktionen auf das Verhalten des Partners werden Übergangsraten genannt. Basis- und Übergangsraten charakterisieren das Interaktionsmuster der beiden Partner, also einer Dyade, und nicht das Verhalten Einzelner. Eine solche Dyade hat genau dann eine soziale Beziehung, wenn sie mindestens ein stabiles Interaktionsmuster aufweist. Ein Interaktionsmuster ist erst dann als stabiles Interaktionsmuster zu beschreiben, wenn es sich durch eine Interaktionsgeschichte, die als ein mehrfach wiederholtes Auftreten von Interaktionsepisoden zu betrachten ist, gefestigt hat, sodaß eine gewisse Vorhersagbarkeit des Verhaltens vorliegt. Beziehungen weisen meist jedoch mehr als nur ein Interaktionsmuster auf, welche von Situationsklasse zu Situationsklasse abweichen, aber innerhalb der selben Situationsklasse Regelmäßigkeiten zeigen. Interaktionsmuster sind also situationsspezifisch. (vgl.: ASENDORPF/BANSE, 2000, S.1ff.)
Das Vorhandensein eines stabilen Interaktionsmusters ist jedoch im Sinne des alltagspsychologischen Beziehungsbegriffs nicht ausreichen. Baldwin (1992) bietet dazu ein Modell, in dem jede Person als Teil einer Beziehung ein Beziehungsschema konstruiert, welches aus einem Selbstbild, dem Bild der Bezugsperson und einem Interaktionsskript gebildet wird. Es wird also hier die zunächst behavioristische Sicht durch eine kognitivistische vervollständigt. Ein solches Beziehungsschema ist beziehungsspezifisch, das heißt die kognitive Repräsentation der eigenen Person, der anderen Person und die spezifischen Interaktionsskripte können von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich oder sogar gegensätzlich sein. Das Beziehungsschema des Einzelnen ist zusätzlich durch seine persönlichen normativen Vorstellungen und seine Zukunftsperspektiven geprägt. Darüber hinaus liegt eine korrelative Beeinflussung von Interaktionsmuster und Beziehungsschema vor, da einerseits das Beziehungsschema teilweise durch das faktisch vorhandene Interaktionsmuster, also das konkret erlebt, gebildet wird, andererseits aber wird das Interaktionsmuster partiell durch das Beziehungsschema gesteuert, da die drei Komponenten bestimmte Verhaltensweisen eines Selbst und des Anderen bzw. des Agierens innerhalb der Beziehung voraussetzt. Überdies unterliegen Beziehungsschemata einer affektierten Bewertung, so daß Beziehungen von Präferenzen und Emotionen beeinflußt werden, aus denen individuallisierte Beziehungseinstellungen folgen, welche sich allerdings nicht mit der tatsächlichen Beziehung decken, da diese Einstellungen rein dyadische Konstrukte sind. Dies erklärt sich darin, daß derartige Einstellungen zunächst gegenüber sich selbst, gegenüber dem Partner und gegenüber der Beziehung bestehen, und folglich in erster Linie dem Erleben des Einzelnen zuzuordnen sind, und somit zwar auf die Beziehung wirken, sich aber mit dieser gar nicht bzw. nur äußerst unwahrscheinlich decken können. (vgl.: ASENDORPF/BANSE, 2000, S.4ff.)
Weitere beziehungsbeeinflussende Pole zur Differenzierung von Beziehungen sind durch die Abgrenzung von persönlichen Beziehungen und Rollenbeziehungen gegeben. Reine Rollenbeziehungen weisen zwar alle oben genannten Charakteristika (stabiles Interaktionsmuster, Interaktionsskript, Selbstbild, Bild des Partners) einer sozialen Beziehung auf, entsprechen aber dennoch nicht ganz der alltagspsychologischen Auffassung von Beziehung, da diese unpersönlich sind, das heißt die Interaktionsmuster blieben bestehen selbst wenn einzelne Personen der Dyade ausgetauscht würden (z.B. bei Verhandlungspartnern zweier Firmen). Allerdings ist es bei länger dauernden sozialen Beziehungen nur unter aller größter Anstrengung möglich eine Rollenbeziehung nicht zu einer persönlichen Beziehung „wachsen“ zu lassen, was sich in bereits erwähnten Prozessen von Beziehung begründet, da sich durch und mit der Interaktionsgeschichte der Dyade Interaktionsmuster und Beziehungsschema, mit all seinen Faktoren, wechselseitig entwickeln und somit persönliche Beziehungen entstehen. Man kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr das Verhalten der beiden Interaktionspartner nur mit Rollenverhalten erklären, da es auf Grund der persönlichen Merkmale der Beziehung darüber hinaus geht, man spricht hier von dyadischen Merkmalen, welche somit als Attribut von persönlichen Beziehungen gelten. Persönliche Beziehungen sind außerdem durch die Persönlichkeit der Einzelnen, durch ihre und auch durch grundsätzliche Rollenerwartungen und durch äußere Einflüsse geprägt. (vgl.: ASENDORPF/BANSE, 2000, S.7ff.)
Beziehungen sind zwar auf dyadischer Ebene definiert, können aber aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Beziehungen durch triadische Effekte beeinflußt sein. Bei drei oder mehreren Menschen lässt sich dann von einer Gruppe sprechen. Persönliche Beziehungen lassen sich jedoch schwer in Gruppen bilden, weil sie durch Gruppeneigenschaften beeinflusst werden. Somit entstehen in Gruppen Rollenbeziehungen durch die funktionale Gruppenstruktur. Da es eine Vielfalt von sozialen Beziehungen gibt, die nebeneinander existieren und mehr oder weniger ähnliche Kriterien aufweisen, wird nach Beziehungstypen unterschieden. Neben Rollenbeziehungen und persönlichen Beziehungen gibt es eine Klassifikation zum einen (kulturell bedingt) nach Verwandtschaftstypen. Diese Beziehungen variieren in der genetischen Ähnlichkeit. Zum anderen lassen sich Beziehungen nach Altersähnlichkeit klassifizieren, wobei diese am größten bei Zwillingen ist, groß bei Peers und am geringsten zwischen Urgroßeltern und Urenkeln ist. Des weiteren werden Beziehungen oft nach der Art des vorherrschenden Interaktionsmuster oder Beziehungsschema klassifiziert. Besonders beziehen sich solche Klassifikationen auf Beziehungsmerkmale, die psychische Nähe versus Distanz aufweisen. Solche Merkmale sind z. B. Enge, Intimität, Liebe, Sexualität, Bindung und Unterstützung. Diese Merkmale weisen Ähnlichkeiten und Unterschiede auf und lassen sich deshalb gut klassifizieren. (vgl.: ASENDORPF/BANSE, 2000, S.20ff.)
1.3. Der dyadische Effekt als Kernlegitimation der Beziehungspsychologie Alleine das oben beschriebene Begriffssystem der Beziehungspsychologie, mit den darin verwobenen Darstellungen und Betrachtugsweisen von Beziehungen, legitimiert und belegt die Sinnhaftigkeit, das Vorhandensein, einer Beziehungspsychologie und das damit vebundene Betrachten von Dyaden als eine Analyseeinheit der Psychologie.
Am deutlichsten wird das Vorhandensein einer Beziehungspsychologie jedoch meines Erachtens durch den Nachwies von dyadischen Effekten. Asendorpf und Banse (2000) tun dies unter anderem anhand einer Studie von Stinson und Ickes (1992), in der 24 Dyaden auch auf die Häufigkeit des Sprechens und des Blickens untersucht wurden. Die Korrelation dieser beiden Verhaltensweisen lag bei 0,39, das heißt, je häufiger eine Person sprach, desto häufiger schaute sie auch. Bei einer individuellen Betrachtung, wozu die Psychologie eigentlich naturgemäß neigt, schließt man aus diesen Daten, daß es Menschen gibt, die kommunikativ sind, und folglich oft reden und ihre Partner anblicken und unkommunikative Menschen , welche wenig reden und wenig Bickkontakt pflegen. Betrachtet man das Ganze jedoch unter dyadischen Aspekten, kommt man zu andren Ergebnissen. Mißt man die Konsistenz der einzelnen Merkmale zwischen den Gespärchspartnern so erhält man den Wert 0,84 für Sprechen, und für Blicken 0,57. Daraus ergibt sich, wer oft redet, dessen Partner redete auch oft und wer oft anschaut wurde auch oft angeschaut. Es gab also dynamischere Gesprächspaarungen mit vielen Wortwechseln und vielen Blicken, und ruhigere Paarungen in denen lange Pausen gemacht wurden oder lange Monologe gehalten wurden, was zu weniger Wortwechseln und weniger Blickwechseln führte. Das bedeutet, daß die individuelle Korrelation mit dem Wert 0,39 rein dyadische Erklärungen haben könnte, und möglicherweise nicht individuelle, wie zunächst angenommen. Korreliert man die Merkmale über Kreuz, das heißt, das Sprechen von Partner 1 mit den Blicken von Partner 2, und das Sprechen von Partner 2 mit den Blicken von Partner 1, erhält man zwei sogenannte Kreuzkorrelationen. Da in unserem Beispiel die beiden Partner austauschbar sind, kann über Unterschiede bei den beiden individuellen Kreuzkorrelationen hinweggesehen werden, da diese ohnehin äußerst gering sind. In unserem Falle, das heißt, in der Studie von Stinson und Ickes (1992), beträgt der Kreuzkorrealationswert 0,47.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da die Paarungen in der Studie zufällig gewählt wurden ist der Kreuzkorrelationswert aus individueller Sicht erstaunlich hoch, denn wäre der Zusammenhang zwischen Sprechen und Blicken nur auf
Persönlichkeitseigenschaften hin betrachtet worden eine Nullkorrelation zu erwarten. Das heißt Unterschiede zwischen den Gesprächspartner beruhen wahrscheinlich auf unterschieden in den Dyaden und nicht ausschließlich auf Individuelle Faktoren, was bereits schon durch die Konsistenz gezeigt wurde. (ASENDORPF/BANSE, 2000, S.10ff.)
2. Vertiefung
2.1. Personenwahrnehmung
Bevor im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf die spezifischen Beziehungstypen eingegangen wird, soll ein kleiner Exkurs in die Personenwahrnehmung unternommen werden, um dem Leser einen Einblick zu verschaffen wie der Mensch überhaupt den andere Menschen wahrnimmt. Der Begriff Wahrnehmung ist an dieser Stelle irreführend, da das Feld der Personenwahrnehmung die Grenzen der reinen Wahrnehmung überschreitet und auch gedankliche, bewertende Prozesse, bzw. Attribution und das Schlussfolgern aus dem Erkannten mit einbezieht. Aufgrund dieser missverständlichen und irreführenden Begrifflichkeit ist man dazu übergegangen, von Personenkognition zu sprechen, was mir als angemessen erscheint, wohingegen Kerch/Crutchfield der Meinung sind, daß der Begriff der Personenkognition diesen Bereich auch nicht zutreffend benennt. Sie definieren Personenwahrnehmung als das Studium dessen was wir von anderen Menschen wissen, und woher wir dieses Wissen beziehen. (vgl.: NOLTING/PAULUS, 1996, S.114/ (KRECH/CRUTCHFIELD, 1992, Bd.7 S.61ff.) Die Personenkognition läßt sich in drei Gebiete aufteilen, der Beobachtung, der Eindrucksbildung und der Attribution. Die Beobachtung als Gebiet der Personenkognition befasste sich mit dem Wahrnehmen anderer in ihrem Verhalten. In diesem Rahmen wurde von vom P.Ekmann (1969) belegt das bestimmte Emotionen, nämlich Glück, Traurigkeit, Wut, Ekel und Verachtung, nur am Gesichtsausdruck weltweit für andere erkennbar sind. DieseListe wurde von Izard (1971) um die Emotionen Interesse und Scham erweitert. Desweiteren läßt sich die aussage Treffen das nonverbales Verhalten ein Indiz für die Wahrnehmung einer Person sein kann, bzw. daß nonverbales Verhalten von anderen wahrscheinlich Verstanden wird, jedoch kausal zum Kontext betrachtet werden muß, da das gleiche Verhalten (z.B. Lächeln) in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich aufgefaßt wird und aufgefaßt werden muß. Gemeint ist das Lächeln einer tröstenden Mutter als angenehm und helfend empfunden wird, wohingegen das Lächeln eines sowieso zwielichtig wirkenden Autohändlers eher mißtrauen hervorruft. (vgl.: KRECH/CRUTCHFIELD, 1992, Bd.7 S.61ff.)
Als ein zweites Gebiet der „Wahrnehmung“ von Personen, ist die Eindrucksbildung zu bezeichnen. Sie entwickelte sich zum Forschungsfocus der Personenwahrnehmung aus der Tatsache, daß es kaum gelungen war die Stimuli dieser zu identifizieren, wohingegen es umso besser gelang Beurteilungsfehler zu entdecken, und somit wandte sich die Forschung ab von den Personenwahrnehmungsreizen hin zu den Personenwahrnehmungsreaktionen.
S.Asch (1946) entwickelte die These, daß wir Menschen als einheitliches Ganzes erleben, und ein integriertes Bild von einem Menschen gestalten. Als das Kernstück der Eindrucksbildung ist die implizite Persönlichkeitstheorie zu sehen. Sie folgt zwei Grundsätzen: Erstens Beobachter machen sich ein einheitliches Bild von andern Menschen und zweitens sind diese Eindrücke stärker durch etwas „im Kopf“ bestimmt als durch äußere Reize. In der impliziten Persönlichkeitstheorie werden schon relativ wenige Informationen zu einem Gesamtbild verquickt, das heißt es wird über die Zusammengehörigkeit von Merkmalen Eigenschaften zu einem „Bild“ der Persönlichkeit in der Vorstellung des Beobachters zusammengefügt. Eine weiters Modell der Eindrucksbildung geht auf Osgood, Suci und Tannebaum (1962) zurück, in dem jeder Dimensionen heranzieht um sich ein Bild zu machen. Sie haben drei Dimensionen, nämlich die bewertende Dimension (z.B. gut/schlecht), die Potenzdimension (z.B.stark/schwach), und die Aktivitätsdimension (z.B. aktiv/passiv), identifiziert, in denen der Beobachtete „einsortiert“ wird, wobei die Dimensionen unabhängig voneinander sind. (vgl.: NOLTING/PAULUS, 1996, S.114/ KRECH/CRUTCHFIELD, 1992, Bd.7 S.69ff.)
Die Attribution bildet das Bindeglied zwischen Beobachtung und Eindrucksbildung, wobei sich der Prozeß wie folgt vollzieht. Man beobachtet das Verhalten einer Person in einer Situation und wertet dieses nach bestimmten Regeln in einem Feld, welches sich durch eine Systematik von Konsens und Besonderheit sowie Intention (Absicht und Anstrengung) und Fähigkeit beschreibt, um daraufhin persönliche Attribute oder umweltbezogene Attribute abzuleiten. Diese Attribute führen im Falle des persönlichen Attributes zu der Ableitung einer Eigenschaft mit der dann im Sinne der impliziten Persönlichkeitstheorie operiert wird. Im Falle einer umweltbezogen Attribution bildet dies eine Stabilität, in der Wirklichkeit des Beobachters. Beide Fälle sind wiederum Grundlage des Verhaltens des Beobachtenden. (vgl.: KRECH/CRUTCHFIELD, 1992, Bd.7 S.76ff.)
Schematische Darstellung des Attributionsprozesses Quelle: KRECH/CRUTCHFIELD, 1992, Bd.7 S.78
Die Begriffe Konsens, Besonderheit, Fähigkeit, Absicht und Anstrengung, sowie ihr Wirken im Attributionsprozeß ist wie folgt zu verstehen: Konsens beschreibt den Grad der Wahrscheinlichkeit eines Beobachteten Verhaltens. Liegt eine niedriger Konsens, daß heißt ein ungewöhnliches Verhalten fort, so steigt die Wahrscheinlichkeit einer pesönlichen Attribution am Ende des Prozesses.
Wie gewöhnlich oder außergewöhnlich ein bestimmtes Verhalten für eine bestimmte Person ist, wird durch den Begriff der Besonderheit ausgedrückt. Die Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Attribution am Ende des Prozesses steigt, je geringer die Besonderheit ist.
Der Begriff der Fähigkeit kennzeichnet sich durch die angenommene situationsspezifische Kompetenz der beobachtete Person. Je höher die zugemutete Fähigkeit ist, desto wahrscheinlicher ist eine persönliche Attribution. Mit welcher Energie und mit welchem Engagement der Beobachtete agiert, wird mit dem Punkt Intention oder Absicht und Anstrengung beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit einer persönlichen Attribution steigt, je mehr vermutet wird, daß sich die Beobachtete Person bemüht das beobachtete Verhalten zu praktizieren.
Grundsätzlich gilt, wer sich selbst beobachtet neigt dazu, umweltbezogene Atttributionen gegenüber persönlichen Attributionen zu bevorzugen.
Desweiteren ist anzumerken, daß man dazu neigt, das zu sehen und zu glauben, was man sehen oder glauben möchte, wenn das beobachtet Verhalten gefällt oder missfällt, wenn man selbst das Ziel des beobachteten Verhaltens ist, wenn das Verhalten von besonderer Wichtigkeit für einen selbst ist oder im Falle der Beobachtung des eigenen Verhaltens. (KRECH/CRUTCHFIELD, 1992, Bd.7 S.78ff.)
Das Feld der Personenwahrnehmung und damit verbunden die oben beschriebenen „Momente“ der Personenwahrnehmung finden in dem Beziehungschema nach Baldwin ihren Zugang zur Beziehungspsychologie. Das heißt, die Personenwahrnehmung als Feld der Sozialpsychologie ermöglicht es noch weitere Dimensionen in dem Modell von Baldwin zu eröffnen, bzw. bestehende Dimensionen differenzierter zu betrachten. Gemeint sind hier zum einen die Entstehung des Selbstbildes in der Beziehung und dem Bild der Bezugsperson, zum anderen die differenzierte Betrachtung von Interaktionsmustern, welche durch eine Abfolge von Verhaltensweisen zweier Personen charakterisiert sind. Die Verhaltensweisen des Einzelnen wiederum sind durch Attribution beeinflußt, da die Verhaltensweisen des Gegenübers über Attributionsprozesse und impiliziete Persönlichkeitstheorie beeinflußt „wahrgenommen“ werden.
2.2. Beziehungstypen
2.2.1. Intrafamiliäre Beziehungen
Als Intrafamiläre Beziehungen sind jene Beziehungen zu verstehen, die sich auf zwei Personen innerhalb der gleichen Familie beziehen, wobei Partnerwahl und Partnerschaft als „Grundsteinlegung einer Familie“ an dieser Stelle zu den intrafamiliären Beziehungen mit einbezogen werden soll. Darüber hinaus werden folgerichtig die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, sowie zwischen Geschwistern dargestellt Zunächst einmal ist zu bemerken, daß Partnerschaft und Partnerwahl aus historischer und interkultureller Sicht sehr verschieden ist. Folglich werde ich mich nur auf unseren Kulturkreis beziehen. In den letzten Jahrzehnten hat der Begriff der Partnerschaft in Deutschland einen großen Wandel vollzogen, so war er in den 60er Jahren noch fast synonym mit Ehe zu behandeln, da etwa 90% aller 34-jährigen Frauen mindestens einmal verheiratet waren, wohingegen 1996 nur 62,2% der unter 35-jährigen Frauen verheiratet sind oder waren. Desweiteren läßt sich feststellen, daß das Durchschnittsalter von Eheschließungen bei der ersten Heirat im Zeitraum von 1985 bis 1996 um etwa 3,5 Jahre zunahm. Dennoch sind, trotz dieser Trends und steigenden Scheidungsraten, die Ehe und Ehepaare auch aus statistischer Sicht noch lange nicht als gesellschaftliche Randgruppe zu beschreiben, schließlich waren 1996 fast 80% aller Deutschen wenigstens einmal verheiratet. Nichts desto trotz sind weniger Eheschließungen, spätere Eheschließungen, mehr Ehescheidungen und Geburtenrückgang als demographische Trends zu beschreiben, die sich in erster Linie durch das Starke Streben nach individueller Selbstverwirklichung des Einzelnen in allen Lebensbereichen erklären lassen. Heute kann das Erwarten von oder der Wunsch nach Kindern als der primäre Grund bzw. Motivation zur Eheschließung benannt werden, was die demographischen Signifikanzen von weniger Eheschließungen und Geburtenrückgang in einen Zusammenhang stellt. Im Bezug auf Partnerschaft ist abschließend zu bemerken, daß es einen statistischen positiven Zusammenhang zwischen einer gesellschaftlich liberalisierten Haltung im Bezug auf Scheidung und Scheidungsraten gibt, was allerdings nicht, wie man meinen könnte, zu einer höheren Ehezufriedenheit in den liberalen Gesellschaften führt. (vgl.:ASENDORPF/BANSE, 2000, S.40ff.)
„Gegensätze ziehen sich an“ versus „Gleich und Gleich gesellt sich gern“; Welche „alltagspsychologische Strömung“ hat in Bezug auf die Wahl des Partners bzw. der Partnerin recht? Bei der Partnerwahl sind deutlich positive Korrelationen in den Bereichen der ethnischen Herkunft, der sozialen Schicht, Religionszugehörigkeit, etc. zu finden, daß heißt, das Gleiche mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zueinander finden, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Zum Ersten bedingt sich dies durch die sogenannte passive Partnerwahl, das bedeutet, daß die meisten Menschen sich in Beruf, Ausbildung und Freizeit in sozialen Felder bewegen welche durch bestimmte charaktaristische Ausprägungen gekennzeichnet sind, und somit die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, einen ähnlichen Menschen zu treffen als einen Unähnlichen. Zum Zweiten werden extrem Unähnliche als unangehnehm empfunden, was zu einer Ablehnung führt, das heißt, daß nicht nach Partnern mit einer hohen Ähnlichkeit gesucht wird, sondern Menschen mit einer hohen Unähnlichkeit gemieden werden. Zum Dritten suchen alle Menschen aktiv nach dem subjektiv Attraktivsten, was zu einer mittelnden, also angleichenden Tendenz führt, da jeder deutlich Unattraktivere zurückweist, und von deutlich attraktiveren Personen zurückgewiesen wird. (vgl.:ASENDORPF/BANSE, 2000, S.44ff.)
Da die Beziehungen zwischen Eltern und Kind, das heißt, zwischen Mutter und Kind bzw. Vater und Kind umfangreiche Zuwendung durch Literatur und andere Medien erhalten, möchte ich in dieser Arbeit nur in aller Kürze, wobei Kürze in Relation zum wissenschaftlichen Stand zu sehen ist, auf diese Thematik eingehen, wobei anzumerken ist, daß die Beziehung zwischen Vater und Kind noch relativ wenig Aufmerksamkeit gefunden hat. Nichts desto trotz ist zu sagen, daß die Unterstützung des Kindes durch die Eltern wichtig ist für das Selbstwertgefühl und die Entwicklung des Kindes. Meist hat die Mutter eine nähere und intimere Beziehung zu dem Kind, da sie typischerweise mehr Zeit mit ihm verbringt als der Vater. Doch wird im Allgemeinen, auch aus der Sicht des Vaters, eine Balance zwischen Beruf und Familie angestrebt. Die Bindung des Kindes an seine Eltern entwickelt sich graduell während der ersten Monate nach der Geburt und erreicht im 2. Lebensjahr seine maximale Stärke. Im wachsenden Alter werden Kinder unabhängiger von ihren Eltern. Andere Personen, wie Lehrer oder vertraute Gleichaltrige können teilweise Bindungsfiguren sein. Im Jugendalter verlieren die Eltern etwas an emotionaler Bedeutung, da Jugendliche (Peers) an Bedeutung zunehmen. So erreichen auch Konflikte zwischen Eltern und Kindern in der Pubertät ein Maximum, doch bleibt die Beziehung im Verlauf des Jugendalters meist eng. Eltern sind wichtige Quellen der Unterstützung bis ins mittlere Erwachsenalter hinein. (vgl.: ASENDORPF/BANSE, 2000, S.69ff.)
Einleitend zur Begrifflichkeit der Geschwisterbeziehung ist zu sagen, daß laut Bundesminster für Jugend, Faruen, Familie und Gesundheit (1990) in etwa 65% aller Kinder zusammen mit Geschwistern aufwachsen. Die Intensität der Beziehung von Geschwistern verhält sich gegenläufig zur Altersdifferenz, daß heißt, je größer die Altersdifferenz, desto geringer ist die Intensität der Geschwister. Allerdings scheint sich dieser Effekt bei jungen Erwachsenen zu verlieren. Geschwister befinden sich in einem Gefüge, in dem Konflikte sehr gut und schnell eskalieren können, dies bedingt sich durch eine hohe Vertrautheit der Geschwister, welche zu einer Kenntnis der empfindlichen Stellen führt, und durch den Umstand, daß eine Unkündbarkeit, gepaart mit einer räumlichen Nähe viel Raum und Zeit für Racheakte und andere Reaktionen bietet. Andererseits führen die gleichen Gründe dazu, daß die beiden Geschwister sich wieder einigen müssen, was zu der Beschreibung führt, daß Geschwisterbeziehungen durch Nähe und Konflikte geprägt und gekennzeichnet sind. Im Laufe der Zeit nimmt, bedingt durch „normale“ biographische Punkte wie das Pflegen einer Partnerschaft oder das Bekommen und Großziehen von eigenen Kinder, die Intensität der Beziehung ab, die aber im Alter tendenziell wieder zunimmt, was mit einer Zunahme von positiven und einer Abnahme von negativen Gefühlen verbunden ist. Bei geschlechtsspezifischer Betrachtung von Geschwisterbeziehungen läßt sich feststellen, daß Beziehungen zwischen Schwestern enger sind als zwischen Brüder, was darauf zurück zuführen ist, daß Männer im Allgemeinen weniger intime und distanzierter Beziehungen haben als Frauen, und somit keine geschwistertypische Ursache zu benennen ist. (vgl.: ASENDORPF/BANSE, 2000, S.85ff.)
2.2.2. Die Peer-Beziehungen
Als Peers wird die Gruppe von Menschen verstanden, die gleichen Alters ist und nicht zur Familie gehören. Diese Gruppe spielt im Kinder und Jugendalter eine gewichtige Rolle, was sogar subjektiv von den Kinder und Jugendlichen selbst so wahrgenommen wird. Der Einfluß der Peergroup auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen ist durchaus als groß zu beziehen, so läßt sich z.B sagen, daß eine große Beliebtheit einen positiven Einfluß auf Erfolg und Zukunftspläne hat, oder eine hohe Anzahl an Freunden einhöheres Selbstwertgefühl auch im fortgeschrittenen Alter zur Folge hat. Innerhalb dieser Peergroups bilden sich unteschiedlichste Dyaden mit unterschiedlichsten Funkionen. Piaget bennnt als eine Funktion die symetrisch egalitäre Interaktion von Gleichaltrigen als eine bessere Lösungs- und Austragungsfläche kongnitver Konflikte. Darüber hinaus entwickeln Kinder und Jugendliche in dieser ihre ersten vom Elternhaus abgelösten Ansichten, Vorstellungen und Standpunkte (z.B. im Bereeich des Freundschaftbegriffes), worüber hinaus noch zu sagen ist, daß der Einfluss der Peers oftmals über den der Eltern hinaus geht. Harris (1995) geht sogar davon aus, daß alle sozialen Einflüsse der Eltern zunächst den Filter der Peergroup passieren müssen um wirksam zu werden. Dies hat allerdings in dieser radikalen nicht seine Richtigkeit, so werden z.B. religiöse und politische Einstellungen eher von den Eltern beeinfußt und profanere, z.B. bezüglich der Mode durch die Peers. (vgl.: ASENDORPF/BANSE, 2000, S.97ff.)
2.2.3. Interfamiliäre Beziehungen
Als Interfamiliäre Beziehungen sind die Beziehungen zu verstehen, die außerhalb des Familiengefüges stehen. Peer-Beziehungen würden natürlich auch in diese Definition gehören, sind aber in dieser Arbeit aufgrund ihres besonderen Merkmales (Altersgleichheit), ihrer besonderen Stellung (Prägend in der Entwicklung) und des normalerweise begrenzten Zeitraums (Kinder- und Jugendalter) hier gesondert aufgeführt. Damit deutet sich schon an, daß im Erwachsenenalter eine Altersähnlichkeit keine so große Rolle mehr spielt. Im Verlauf dieses, zumindest in dieser Arbeit, letzten Unterpunktes der Beziehungstypologie werden die Beziehungen zwischen Freunden, Arbeitskollegen und Nachbarn charakterisiert.
Der Freundschaftsbegriff wird von vielen sehr unterschiedlich aufgefasst, fest steht aber, daß fast alle Mensch glauben Freunde zu haben. Auhag (1993) gibt neun Merkmale an, die Freundschaft als Begriff bestimmen sollen: Freiwilligkeit; Dyadische und keine gruppenspezifische Bedingung; persönliche und nicht durch soziale Rollen beschrieben Beziehung; Sozialbeziehung ohne offizielle Verpflichtungen; Vorhandensein eines individuellen, emotionallen, sozialen und geistigen Wertes; Eine zeitliche Ausdehnung, in der Entstehung, Fortbestand und Auflösung freiwillig sind; subjektiv, positives Empfinden; eine nichtsexuelle Beziehung. Zu Beginn einer Freundschaft, sprich bei ihrer Entstehung, definiert sich Freundschaft durch Quantität, wobei sie sich mit zunehmender Entwicklung durch das Intimitätsniveau beschreibt. Als Gründe der Trennung von Freundschaften werden räumliche Trennung, das Ersetzen Alter durch neue Freunde, die zunehmende Abneigung gegenüber dem Freund und die Störung durch Partnerschaft und Kinder angegeben. Es sind geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen, die sich allerdings mit der Länge der Beziehungen abbauen. Es ist allerdings abschließend darauf zu verweisen, daß diese Unterschiede nicht freundschaftsspezifisch sind, sondern in allgemeinen Geschlechtsunterschieden des sozialen Interaktion begründet sind. (vgl.: (ASENDORPF/BANSE, 2000, S.119ff.)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Geschlechtstypische Freundschaften
Quelle: ASENDORPF/BANSE, 2000, S.123
Die Arbeitswelt ist neben der Freizeitwelt der zweite große Raum eines Menschen, in dem soziale Beziehungen zustande kommen. Der größte und wichtigste Unterschied von Arbeitsbeziehungen und anderen Beziehungen ist das Vorhandensein einer sozialen Organisation, das heißt, die Beziehung am ist in ihrer Entwicklung beschränkt, was leicht einen Konflikt mit den organisatorischen Anforderungen aufgrund dieser „unfreien“ Entwicklung zur Folge haben kann. Asendorpf macht dies an den Beispielen der sexuellen Belästigung, der sexuellen Beziehung und am Mobbing fest, wobei diese „Phänomene“ natürlich nicht ausschließlich darin zu begründen sind. Von besonderem wirtschaftlichem Interesse ist im Bereich der Arbeitsbeziehungen der sogenannte „Hawthrone-Effekt“. Dieser belegt, daß durch das Schenken von besonderer Aufmerksamkeit die Arbeitsmotivation, und damit die Produktivität steigt, was sich darin begründet, daß sich die Mitarbeiter zum Einen beobachtet vorkamen, und zum Anderen, weil sie sich durch die besondere Aufmerksamkeit wichtig fühlten. (vgl.: ASSENDOPF/BANSE, 2000, S.125ff.) Betrachtet man die nachbarschaftlichen Beziehungen so kann man auf ein zunächst widersprüchlichen Ergebnis. Zum Einen wird die Meinung vertreten, daß gute Nachbarschaft wichtig sei, zum Anderen sind aber die persönlichen Kontakte zu den Nachbarn eher gering. In einer deutschen Telefonumfrage gaben sogar 60% der Befragten Konflikte mit den Nachbarn an, was schon eine allererste Erklärung dieses Widerspruches darstellen könnte, da Konflikte oftmals als belastend empfunden werden und somit einerseits der Wunsch nach einer „guten Nachbarschaft“ entstehen läßt, andererseits aber eben genau diese verhindert. Persönliche Beziehungen in der Nachbarschaft werden durch zwei Faktoren entschieden begünstigt, zum einen durch den Umstand, daß die Personen ähnliche Interessen, Einstellungen und Lebensstile haben, und zum Anderen durch den Umstand, daß das Wohngebäude nicht zu groß ist, das heiß,t daß innerhalb von Hochhäusern weniger persönliche Beziehungen entstehen.
Eine weitere Erklärung für die „schlechten“ nachbarschaftlichen Verhältnisse könnte drin gefunden werden, daß durch die höhere Mobilität unserer Zeit räumliche Nähe zur Bildung sozialer Kontakte eine geringere Rolle spielt, und somit der Einzelne nicht mehr so stark auf den „guten“ Kontakt zu seinem Nachbarn angewiesen ist. Dem ist hinzuzufügen, daß Neuzugezogene Studenten in einer Berliner Studie deutlich mehr Nachbarschaftsbeziehungen pflegten, als jene die im elterlichen Haus blieben, was ebenfalls darauf hinweist, daß Notwendigkeit bzw. Angewiesenheit zur nachbarschaftlichen Beziehung als begünstigender Faktor in Frage kommt. (vgl.: ASSENDOPF/BANSE, 2000, S.136/ FLADE, 1987, S.47)
3. Resümee
In dieser Arbeit wird deutlich, daß eine Psychologie der Beziehungen gerechtfertigt ist, bzw. daß Paarbeziehungen oder Dyaden einer speziellen Sichtweise bedürfen, um ihrer Komplexität grundsätzlich und im Fluß ihrer Prozesse gerecht zu werden, um somit ein angemessenes Begriffssystem und eine daraus folgende angemessene Betrachtung und Beobachtungsweise zu schaffen. Wobei ich an dieser Stelle anmerken möchte, daß bereits 1933 von Wiese die Wichtigkeit oder den Stellenwert von Paarbeziehungen benannt hat, indem er sagte: „das Paar ist das persönlichste unter allen Gebilden; indem Individuelles auf Individuelles wirkt“ (KORTE/SCHÄFER, 1998, S.93), wobei er den Begriff Paar über die Dimension von Liebes- und Ehepaar hinaus definierte. Wichtig ist es, auch noch einmal, explizit darauf hinzuweisen, daß die Betrachtung einer Dyade nur unter dem Aspekt und der Perspektive des Aufeinandertreffens zweier Individuen nicht ausreicht, sondern durch eine dyadische Betrachtungsweise ergänzt werden muß(Wiese wußte es damals nicht besser).
Überdies bietet diese Arbeit ein Modell zur Betrachtung von Dyaden, welches sowohl einen äußerst trivialen als auch einen sehr komplexen Analysegrad zuläßt. Daß heißt, es bietet sich das Spektrum vom einfachen Zählen von Basisraten und Übergangsraten (Interaktionsmuster) bis hin zu einer differenzierten Sicht, in der alle reziproken und kausalen Wirkungen erfasst werden. Gemeint ist das Zusammenspiel zwischen Beziehungsschema und Interaktionsmuster, wobei ersteres in sich noch einmal differenziert betrachtet werden kann (Selbstbild, Bild des Gegenübers, Interaktionsskript) und überdies durch Gesetztmäßigkeiten der Personenwahrnehmung (Wahrnehmung/Beobachtung, Attribution, implizite Persönlichkeittheorie, Dimensionnemodell nach Osgood, Suci und Tannebaum) ergänzt wird, was dann alles noch in den Kontext von triadischen Effekten gestellt und in den Bezug einer Gruppe gesetzt eine weitere Komplexitätssteigerung erfährt. Ich denke, daß ein Modell mit einem derartig breiten Spektrum mit einer solchen Vielzahl von differenziellen Abstuffungsmöglichkeit, im „sozialpädagogischen Alltag“ eine hohe Tauglichkeit besitzt, da dieses Betrachtungsmodell, aufgrund seiner Flexibilität und Bandbreite, ein fallspezifisch angemessenen Komplexitätsgrad, unter Berücksichtigung von Zeit, Sinn und Ziel der Beobachtung zuläßt. Darüber hinaus wird dieses Modell durch beziehungstypische Merkmale (Beziehungstypen) ergänzt, die auch im Einzelfall, den Beobachter möglicherweise bei seiner fallbezogenen Problemanalyse in die richtige Richtung lancieren.
Literaturliste
ASENDORPF/BANSE, 2000, Psychologie der Beziehungen, Verlag Hans Huber; Bern Göttingen, Toronto, Seattle
BENESCH, 1995, dtv-Atlas zur Psychologie Band 2,Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
FACHLEXIKON ,1997, Fachlexiokon der sozialen Arbeit, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge - Eigenverlag, Frankfurt am Main
FLADE, 1987, Wohnen psychologisch betrachtet, Verlag Hans Huber; Bern Stuttgart, Toronto
GOLDMANN LEXIKON, 1998, Golmann Lexikon Band 20, Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh
KORTE/SCHÄFER (Hrsg.), 1998, Einführung in die Hauptbegriffe der Soziologie, Leske +Budrich, Germany
KRECH/CRUTCHFIELD (Hrsg.), 1992, Grundlagen der Psychologie (Studienausgabe), Beltz Verlags Union; Wehrheim
NOLTING/PAULUS, 1996, Psychologie lernen, Beltz Verlags Union; Wehrheim
SCHÜLERDUDEN, 1981, Schülerduden „Die Psychologie“, Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich
THEISEN, 1998, Wissenschaftliches Arbeiten, Verlg Franz Vahlen, München
- Arbeit zitieren
- Dominik Sauer (Autor:in), 2001, Psychologie der Beziehungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104881
Kostenlos Autor werden















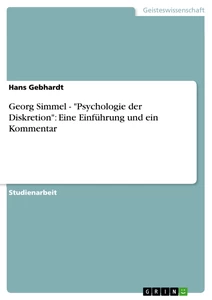
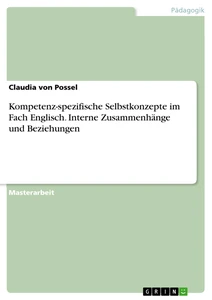





Kommentare