Excerpt
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsdefinition
3. Die Entwicklung in den USA
4. Die Entwicklung in Deutschland
5. Die Schulen der Policy-Forschung
5.1. Die sozio-ökonomische und politisch-ökonomische Schule
5.2. Die Theorie gesellschaftlicher Interessen
5.3. Die Machterwerb- und Wiederwahlinteresse-Theorie
5.4. Parteiendifferenz-Theorie
5.5. Die Theorie der Bedingungen der Politikformulierung
5.6. Die Implementations-Schule
6. Kritik an der Policy-Forschung
6.1. Kritik an den Schulen der Policy-Forschung
6.2. Kritik an der Policy-Analyse
7. Schluss
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Wenn heute wichtige Ereignisse in der Zeit von 1932 und 1990 benannt werden sollen, die mit den USA zu tun haben, dann finden sich darunter Schlagwörter wie 2. Weltkrieg, Ko- rea-Krieg, Kuba-Krise, Rassenunruhen, Vietnamkrieg, Watergate-Affäre, Golfkrieg, etc... Diese Geschehnisse sind zwar bekannt, aber viele Hintergründe, wechselseitige Beziehun- gen und Querverweise werden erst nach genauer Analyse sichtbar. Die vorliegende Haus- arbeit versucht das zu untersuchen und auf folgende mögliche Fragestellungen Antworten zu geben:
Welche Rolle spielten die einzelnen Präsidenten? Wie waren die beiden großen Parteien aufgebaut, welche Veränderungen gab es auf dem Gebiet der Parteiorganisation? Wer hatte wie lange Einfluss auf die Politik? Wie entwickelte sich das Wählerverhalten, wie reagierten die Wahlkämpfer darauf?
Die Gliederung der Hausarbeit stellt sich wie folgt dar:
Als erstes werden die Rahmenbedingungen die in dieser Zeitperiode herrschten erläutert. Darauf folgt die Betrachtung der einzelnen Präsidenten im Hinblick auf ihre Leistungen und ihre Defizite und es werden die daraus resultierenden Entwicklungen aufgezeigt. Im Anschluss daran wird ein werden die programmatischen Charakteristika des der Parteien erklärt und die Veränderungen im Imagewandel der beiden großen Parteien nachvollzogen, sowie die Organisationsstruktur der Parteien untersucht. Abschließend werden die Leistungen und Defizite dieses 5. Parteiensystems aufgezeigt.
Folgende Definition des Begriffs „Parteiensystem“ wird in der vorliegenden Hausarbeit verwendet: Ein Parteinsystem bezeichnet eine Zeitperiode, in der eine bestimmte Wähler- konstellation auftritt und diese dann über einen Zeitraum hinweg, langfristig bestehen bleibt. Ein neues Parteiensystem beginnt, wenn ein eklatanter Wechsel im Wählerverhalten zu verzeichnen ist.1
2. Rahmenbedingungen
Die Zeit bis 1990 war vom Kalten Krieg geprägt, der auf das Ende des 2. Weltkriegs folgte. Wirtschaftspolitisch reichte die Spanne von einer Weltwirtschaftskrise bis hin zu einen wirtschaftlichen Boom. Innenpolitisch war zum einen eine Verschiebung der moralischen Werte von materiellen zu immateriellen zu verfolgen und zum anderen endete die Rassendiskriminierung in den Südstaaten.1
2.1. Bevölkerungszuwachs
Die USA wurden auf 50 Staaten erweitert und die Bevölkerung wuchs von 123 Millionen (1930) auf über 246 Millionen (1980) an. Dieser Zuwachs gründet sich auf Immigration aus Mexiko und einem Anstieg der Geburtenraten. Außerdem ist eine Landflucht zu beo- bachten.2
2.2. Wanderungsbewegungen
Bis in die 50er Jahre fand eine Wanderungsbewegung Schwarzer in den industriellen Nor- den statt und in den 70er Jahren gab es eine Wanderungsbewegung vom Nordosten und Mittleren Westen in den „Neuen Süden“. Politisch bedeutete dies eine Auflockerung der Parteienloyalität der Wähler und die Demokraten verloren ihre Vorherrschaft in den Süd- staaten.3
2.3. Sozialökonomische Entwicklung
Roosevelt führte den „New Deal“ ein, der zwar mit den Wohlfahrtstaaten europäischer Prägung zu vergleichen ist, aber nie deren Ausmaße annahm. Die hohen Sozialausgaben blieben danach - bis auf ein paar Kürzungsversuche - unangetastet. Diese Tatsache führte, zusammen mit Steuerkürzungen und gestiegenen Rüstungsausgaben, zu großen Haushaltsdefiziten in den 80er Jahren.4
2.4. Anwachsen der Bundesbürokratie
Der New Deal trug entscheidend dazu bei, dass die Mitarbeiterzahlen in der Bundesverwaltung explosionsartig zunahmen. Der Bund nahm sich immer mehr Entscheidungsbefugnisse der Einzelstaaten und wurde bald zu einem mächtigen Apparat. Zwar wurde diese Größe von den Republikanern immer wieder aufs Schärfste angegriffen, aber selbst wenn sie an der Regierung waren, änderten sie kaum etwas daran.1
2.5. Überwindung der offenen Rassendiskriminierung
Diese wurde in erster Linie auf dem Gebiet des Wahlrechts vollzogen. Dabei hatte der Supreme Court einen wichtige Stellung inne, da er nach und nach alle benachteiligenden Wahlgesetze als nicht verfassungskonform verbot. Daraus resultierte zum einen eine steigende Registrierungsquote unter schwarzen Wählern und zum anderen eine steigende Wahlbeteiligung Farbiger. Nach der Auflockerung des „Demokratischen Südens“ waren Afroamerikaner oftmals das Zünglein an der Waage, das darüber entschied ob ein demokratischer oder republikanischer Kandidat gewählt wurde.2
2.6. „Reapportionment revolution“
Durch die gesteigerte Landflucht, der in der Wahlkreiseinteilung lange Zeit nicht Rech- nung getragen wurde, war die Stadtbevölkerung im Kongress unterrepräsentiert und da die Landbevölkerung konservativer eingestellt war, waren auch die konservativen Politiker im Repräsentantenhaus überrepräsentiert. Gegen den Willen der „Konservativen Koalition“ setzte der Supreme Court eine Neueinteilung der Wahlkreise an. Das führte zu einer Schwächung der parteiübergreifenden „conservative coalition“, aber auch zu einer erhöh- ten Repräsentativität des Parlaments. Insgesamt bewirkte es eine Auflockerung der Partein- landschaft.3
2.7. Vorwahlen
Ab den 70er Jahren gab es wieder eine Zunahme der bis dahin stagnierenden Vorwahlen: Zum einen wurde das unrepräsentative „winner-takes-all“-System verboten und zum ande- ren wurden wichtige Entscheidungen an die Parteibasis zurückgegeben, was die Attraktivität der Primaries wesentlich erhöhte.1
2.8. Interessengruppen
Vom „New Deal“ begünstigt stieg die Zahl der Interessengruppen stark an, was auch auf die politischen Hintergründe in den 60er und 70er Jahre zurückzuführen ist. Die mittler- weile dezentral verteilte Macht im Kongress und eine Novellierung des Parteiengesetztes schufen ein günstiges Klima für die Entwicklung der Interessengruppen. Während in den 60er Jahren die Gewerkschaften und deren Gegner zu den wichtigsten „pressure groups“ gehörten, waren es in den 80er Jahren vor allem Gruppierungen die sich moralischen Wer- ten verschrieben hatten.2Wichtig im Zusammenhang mit Interessengruppen sind die sog. „PACs“, die „Political Action Comittees“. Das sind Wahlkampfkomitees, welche die Inte- ressen der einzelnen Pressure Group unterstützen. Die PACs übernehmen „Aufgaben, die in westeuropäischen Regierungssystemen von Parteien wahrgenommen werden.“3
3. Entstehung und Entwicklung des V. Parteiensystems
3.1. Franklin D. Roosevelt (Amtsperiode 1933-45)
Mit der Wahl Roosevelts vollzog sich ein „dealignment“ der Wählerschaft, da er alle bis auf vier Staaten eroberte und die Demokraten die Mehrheit im Kongress errangen. Schon in den ersten hundert Tagen legte er ein überzeugendes Programm vor, mit dem die „Great Depression“ überwunden werden sollte. Der Sieg 1932 gründete sich vor allem auf eine Ablehnung der Wähler gegenüber den Republikanern mit ihrem Laissez-Fair-Stil in der Wirtschaftspolitik. Daraufhin wurde von konservativen Politikern die „conservative coali- tion“ gebildet. Sie formierte sich unter Roosevelt als Opposition zu dessen Opposition aus konservativen Republikanern und rassistischen Südstaatlern. Diese Koalition in konnte in Roosevelts zweiter Amtsperiode erfolgreich den „court packing plan“ des Präsidenten ver- hindern. Später wurde sie aber durch die Auflockerung des „solid south“ geschwächt und erstarkte erst wieder unter Reagan. Roosevelt agierte in den vier Jahren so erfolgreich, dass die Wiederwahl 1936 nur ein formaler Akt war. Inzwischen war aber die Gegnerschaft - aufgrund des von ihm initiierten „court-packing-plans“ - immer stärker geworden. Er er- oberte trotzdem wieder fast alle Bundesstaaten und wollte nun den dritten „New Deal“ in Angriff nehmen. Es kam ihm aber der 2.Weltkrieg dazwischen. Anfangs waren die USA noch zurückhaltend und unternahmen nichts, außer Waffenlieferungen an die europäischen Alliierten. Als aber 1941 Pearl Harbour angegriffen wurde - Roosevelt trat seine dritte Amtszeit an - musste die USA ihren Isolationismus aufgeben und in den Krieg eingreifen. Dazu rüstete der Kongress Roosevelt mit umfangreichen Machtbefugnissen aus. Seine Re- putation litt inzwischen unter dem Zickzackkurs den er den beiden großen Parteien gegen- über einschlug. 1944 trat er nochmals an, um „den Krieg gegen den Faschismus“ zu Ende zu führen. Er siegte, starb aber 1945 an einem Gehirnschlag.1
3.2. Harry S. Truman (Amtsperiode: 1945-53)
Nach dem Sieg im 2. Weltkrieg witterten die Republikaner ihre Chance. Da Truman ein Verfechter des „New Deal“ war und die G.O.P. als größte Gegnerschaft des Sozialpro- gramms die Mehrheit im Kongress besaß, konnte Truman keine eigene Politik machen, sondern nur per Veto versuchen „das Schlimmste zu verhindern“. Der von konservativen Kräften geschürte Antikommunismus nahm ausufernde Ausmaße an, z.B. wurden Journa- listen oder Politiker wegen angeblicher antiamerikanischer Umtriebe vom Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses McCarthy verhört und sogar abgeurteilt. Genauso wenig wie Truman dagegen vorgehen konnte, konnte er die Republikaner nicht daran hindern neue anti-gewerkschaftliche Gesetzte, das Gesetzt zur Beschränkung der präsidentiellen Macht und das Gesetzt zur Beschränkung der Amtszeit des Präsidenten auf volle zwei Amtsperio- den, zu beschließen. Im Wahlkampf 1948/49 sah alles danach aus, dass Truman keinesfalls gewinnen konnte, aber er erwies sich als meisterhafter Taktiker und gewann die Präsident- schaftswahl mit Hilfe einer Mischung aus Angriffen auf die G.O.P. - mit dem Slogan „do- nothing-congress“ - und einen Wahlkampfmarathon in Form einer 35tägigen Eisenbahn- fahrt quer durchs Land. In seiner zweiten Amtsperiode sah er sich allerdings massiv durch die „conservative coalition“ angegriffen. So erklärte er schon früh - auch durch die „dump- Truman“-Kampagne geschwächt - seinen Verzicht auf eine neue Kandidatur.2
3.3. Dwight D. Eisenhower (Amtsperiode 1953-61)
Er war politisch unerfahren, aber durch seine Popularität als Ex-General und Kriegsheld gelang ihm der Sieg in den Präsidentschaftswahlen 1958. Um sich die Gunst der konserva- tiven Republikaner zu sicher, holte er den ultrakonservativen Richard Nixon als Vizepräsi- dent ins Boot. Als Eisenhower den Forderungen der „conservative coalition“ nicht nach- gab, den „New Deal“ wieder rückgängig zu machen, griffen ihn die konservativen Repub- likaner wieder an. Er spielte sogar mit dem Gedanken aus den gemäßigten Flügeln der großen Parteien eine neue Partei zu gründen. Aber er verwarf den Plan als unpraktikabel. Im Wahlkampf 1957 kam dem durch eine Herzattacke geschwächten Präsidenten die Su- ezkrise und die Niederschlagung des Ungarnaufstandes durch die Soviets „zu Hilfe“. Er besiegte den „Friedensmann“ Stevenson mit großem Vorsprung. Anfang 1957 konnte unter Eisenhower ein Bürgerrechtsgesetzt verabschiedet werden, in dem Afroamerikanern das Wahlrecht garantiert wird. Doch die überparteiliche, gemäßigte Koalition zerbricht noch 1957 als es wieder ein Zerwürfnis beim Thema Rassenproblematik gab. Eisenhower konn- te kein drittes mal zur Wahl antreten.1
3.4. John F. Kennedy (Amtsperiode 1961-63)
Als Sohn eines superreichen Vaters, Medienstar und „erster Katholik im Präsidentenamt, wird er charakterisiert. Im Wahlkampf hatte er überraschend - weil professioneller im Umgang mit den Medien - gegen den eigentlichen Favoriten Nixon gewonnen. Er hatte allerdings Probleme damit, die von seinen linksliberalen Harvardberatern entwickelten Vorschläge - das „New Frontier“-Programm - durchzusetzen. Er verpasste es nämlich einerseits, sich mit den altgedienten Parteioberen gut zustellen, andererseits machte ihm die „conservative coalition“ das Leben schwer. Dann sah er sich noch zwischen Bürger- rechtlern und rechten Südstaaten Demokraten gefangen. Im Herbst 1963 wurde er in Dal- las, Texas ermordet.2
3.5. Lynden B. Johnson (Amtsperiode 1963-69)
Er war ein Vollblutpolitiker: Er war schon früh Fraktionsvorsitzender der Demokraten im Senat und für sein sicheres Verhandlungsgeschick berühmt. Ein Jahr nach seiner Amts- übernahme wurde er auch zum Kandidaten der Präsidentschaftswahlen ernannt und konnte sich gegen Barry Goldwater durchsetzten. Er war sehr erfolgreich bei der Durchführung seines „Great-Society“-Programms, aber das wurde in der Öffentlichkeit nicht sonderlich beachtet. Die Tagespolitik wurde zunehmend von Vietnamkrieg, Rassenunruhen und Demonstrationen geprägt. Gegen Ende seiner Amtsperiode hatte er es sich sowohl mit den Linksliberalen als auch mit den Konservativen im Land verspielt. Für die einen hatte er im Vietnamkrieg versagt, für die anderen war er ein Bürgerrechtler. Er verstand den Generationenkonflikt nicht als solchen, sondern sah in allen Angriffen nur Attacken auf die eigene Person. Er verzichtete auf eine erneute Kandidatur.1
3.6. Richard M. Nixon (Amtsperiode 1969-74)
In seiner ersten Amtsperiode holte er alle Soldaten aus Südvietnam und versuchte innenpo- litisch Reformen des Finanzföderalismus durchzusetzen, was ihm aber mangels Unterstüt- zung aus dem eigenen Lager misslang. Den Wahlkampf 1972 konnte er mit Hilfe des er- folgreichen Truppenabzugs aus Südvietnam und einem - vermeintlich - bevorstehenden Friedensschluss gewinnen. Zwar war die Watergate-Affäre schon im Wahlkampf aufge- deckt worden, wurde aber noch nicht thematisiert. Die Fronten zwischen Präsident und dem von Demokraten beherrschten Repräsentantenhaus waren nach Nixons zweitem Wahlsieg klar abgesteckt. So konnten die Demokraten mit ihrer Mehrheit die „Kriegsfüh- rungskompetenzen“ des Präsidenten stark einschränken. Nixon konnte zwar 1973 das Frie- densabkommen als Erfolg verbuchen, danach machte ihm aber die wiederaufflammende Diskussion um die Watergate-Affäre das Leben schwer. In dieser Affäre ging es darum, dass das Wahlkampfzentrum der Demokraten von Mittelsmännern der Republikaner heim- lich ausspioniert wurde und obwohl Nixon zwar nichts von der Durchführung wusste, aber danach informiert worden war, versuchte er bis zum Ende seiner Amtsperiode jedes Wis- sen davon zu leugnen. Der zu der Untersuchung des Falles eingesetzte Untersuchungsaus- schuss legte ihm den Rücktritt nahe, den er dann 1974 - als ein (erfolgreiches) Amtenthe- bungsverfahren drohte - widerwillig vollzog.
Diese Affäre bedeutete für die Demokratie in den USA einen schweren Schlag, weil sie zu tiefem Misstrauen der Bürger gegenüber der Politik führte.2
3.7. Gerald Ford (Amtsperiode 1974-77)
Ford war ein farbloser Politiker, der allenfalls durch seine Mittelmäßigkeit auffiel. Im Kongress hatten die Demokraten sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Ford begab sich während seiner gesamten Regierungszeit in eine defensive Rolle und begnügte sich mit Vetopolitik. Ansonsten nahm er eine eher repräsentative Position ein, was bei dem Ansehen des Präsidentenamtes nach der Watergate-Affäre auch nicht verwunderlich war.1
3.8. Jimmy E. Carter (Amtsperiode 1978-81)
Durch die Wahl Carters und die Abwahl Fords bestraften die Wähler die Republikaner noch ein letztes Mal für die Watergate-Affäre. Carter war ein Außenseiter aus dem Süden, der im Wahlkampf versprochen hatte den Sumpf in Washington trocken zu legen. Das stellte sich aber nach seinem Amtsamtritt als folgenschweres Problem dar: Er scheiterte mit seinen Vorschlägen zur Lösung von innenpolitischen Problemen wie der Ölkrise, der hohen Inflationsrate und hoher Arbeitslosigkeit an der Mehrheit der Mitglieder seiner ei- genen Demokratischen Partei. Diese sahen in ihm immer noch einen „imperialen Präsiden- ten“ wie Nixon. Carter verfügte außerdem weder über Verhandlungsgeschick noch über eine Hausmacht. Außenpolitisch schoss er bei der Behandlung der Panamaverträge und der Geiselbefreiung in Teheran Eigentore und das ließ ihn als schwachen Präsidenten dastehen. Er war der erste Präsident seit Hoover dem die Wähler eine zweite Amtszeit versagten.2
3.9. Ronald Reagan (Amtsperiode 1981-89)
Reagan machte sich den Stimmungsumschwung hin zu einem „neokonservativen“ Kurs zu Nutze und gewann die Wahl mit großem Vorsprung. Er erzielte sogar bei den Wählergrup- pen der ehemaligen „New Deal“-Koalition die Mehrheit (z.T. bei Gewerkschaftern, Juden und Katholiken). Nur die Schwarzen stimmten mit 90% für Carter. Er warb für seine „Re- agan Revolution“, einer völligen Umorientierung der amerikanischen Politik, weg vom Wohlfahrtsstaat hin zur Laissez-Fair-Politik. Er war bei der Personalpolitik seiner Admi- nistration sehr geschickt: Er wählte auch konservative Demokraten für Ämter aus und stell- te das Eignungsprinzip über parteipolitische Seilschaften. Er setzte Steuersenkungen und den Abbau des Sozialstaats - auf Kosten Unterprivilegierter - durch. Auch in seiner zwei- ten Amtszeit gelang es ihm, seiner G.O.P. ihr altes Image wiederherzustellen und den viel gelittenen Bürgern ein Gefühl des Nationalstolzes zurückzugeben. Das war nicht zuletzt auf seinen Hang zur Polit-Show zurückzuführen, die seiner Herkunft als Schauspieler ent- sprach. Zwar war das Haushaltsdefizit gestiegen und die Leute erkannten die Schattensei- ten seiner „Reagonomics“ und seine Verwicklungen in die „Iran-Contra-Affäre“ - wo er entgegen eigener Aussagen Waffen in den Iran verkauft hatte und mit diesem Geld die nationalistischen Contra-Rebellen in Nicaragua unterstützt hatte -, aber das wurde ihm nie persönlich als Fehler angerechnet. Ein weiteres Indiz für sein perfektes, mediengemachtes Image.1
3.10. George Bush (Amtsperiode 1990-94)
Bush hatte einen schmutzigen Wahlkampf gegen die Demokraten geführt, was diese ihm während seiner Amtszeit auch quittierten. Er blieb innenpolitisch farblos und beschränkte sich dort mit Vetopolitik. Der demokratisch dominierte Kongress übernahm die aktive Gestaltung der Politik und legte sich immer aufs neue mit dem Präsidenten an. Dieser voll- zog einen Zickzackkurs, da er versuchte es jedem Lager recht zu machen, das aber nicht schaffte. Außenpolitisch dagegen war er stark engagiert und konnte den gegen den Irak geführten Krieg als Erfolg verbuchen. Im Wahlkampf 1995 machte ihm die anhaltende Rezession zuschaffen und er verlor gegen den „Provinzpolitiker“ Clinton, einen Demokra- ten.2
4. Charakteristika des V. Parteiensystems
4.1 Das Parteiengefüge
Im fünften Parteiensystem spielen “Drittparteien“ nur eine untergeordnete Rolle: Sie waren häufig das Ergebnis von Parteiabspaltungen oder wurden neu gegründet, weil ein Politiker seine Ideen in einer großen Partei nicht durchsetzen konnte. Auf nationaler Ebene konnte sich keine „Drittpartei“ durchsetzen, oftmals, weil die großen Parteien es verstanden die Anliegen der kleinen Parteien aufzugreifen und sich anzueignen. Eher auf regionaler Ebene sind die „Drittparteien“ interessant - wie in New York oder Alaska. Insgesamt gleicht deren Auftreten und Scheitern den vorangegangenen Parteiensystemen.1
4.2. Auflockerung des „solid south“
„Eine faktische Monopolstellung der Demokratischen Partei in den Südstaaten existierte - grob gesprochen - zwischen 1870 und 1970.“ Es kam aber schon anfangs des V. Parteien- systems zu einer merklichen Erosion: Die Bildung der parteiübergreifenden „conservative coalition“, besserte das historisch belastete Image der G.O.P. deutlich auf. Als mit den Er- folgen der Bürgerrechtsbewegung die Aufrechterhaltung der behördlichen Rassendiskrimi- nierung und damit der weißen Vorherrschaft ein Ende gesetzt wurde, gab es für die weißen Südstaatler keinen Grund mehr an einer Einparteienlandschaft festzuhalten. Dazu kamen noch Wanderbewegungen von Schwarzen in den Norden und von nicht-rassistischen Wei- ßen in den Süden, was der Auflockerung nur dienlich war. Außerdem standen die konser- vativen Republikaner den überwiegend konservativ eingestellten Südstaatlern näher als die - auf nationaler Ebene - linksliberal dominierten Demokraten.2
4.3. Flügelbildung und innere Struktur der beiden großen Parteien
4.3.1. Der rechte Parteiflügel der Demokraten
Kern des rechten Flügels bildeten die Südstatendemokraten. Während der Zeit des „New Deal“ sahen sich sogar Gegner gezwungen aus der Partei auszutreten und eigene - rassisti- sche - Parteien zu gründen. (G. Wallace). In der Reagan-Ära arbeitete der rechte Flügel mit der republikanischen Kongressfraktion zusammen, aber der Typ des engstirnigen Süds- tatendemokraten starb aus und die Konservativen sammelten sich bei den Republikanern.3
4.3.2. Der linke Flügel der Demokraten
Er beeinflusste vor allem während der „New Deal“-Periode und unter Kennedy die Bun- despolitik. Der linke Flügel bestand aus Gewerkschaftern, sozial engagierten Intellektuel- len und Reformpolitikern, die sich vor allem in außen- und sicherheitspolitischen Fragen oft uneins waren. Auch hier spalteten sich linke Gruppierungen ab, denen z.B. die „New Deal“-Politik nicht weit genug ging oder die in Kennedys Vietnamkurs einen Fehlentwick- lung sahen. In den 80er Jahren sei noch eine Ausdifferenzierung des linken Flügels er- wähnt: Der Zwist zwischen „linksliberalen“ und „neokonservativen“ Anhängern. Während die Linksliberalen auf den „New Deal“ pochten, waren die Neokonservativen technokratisch und wirtschaftsliberal eingestellt. Verbunden waren die beiden konkurrierenden I- deenschulen allerdings durch Forderungen nach sozialer Sicherheit (garantiert durch den Staat) und durch Eintreten für Bürger- und Minderheitenrechte.1
4.3.3. Der linke Parteiflügel der Republikaner
In der Zeit des „New Deal legten die Parteilinken einen Plan vor, der abwartend-neutral auf Roosevelts Programme reagiert. Rockefeller hatte - als Parteilinker - großen Einfluss, so dass er Nixon sogar eine bürgerrechtlich-orientierte Revision des „platform“-Entwurfs diktieren konnte. Die linken Politiker gehörten auch zu den frühen Kritikern des Vietnamengagements der USA, kritisierten Nixon offen wegen Watergate und waren für eine Annäherung an den Ostblock. „Nach der innerparteilichen Machtübernahme der »New Right« ... wurde die Parteilinke nahezu bedeutungslos.“2
4.3.4. Der rechte Parteiflügel der Republikaner
Der „New Deal“ wurde von rechten Politikern insgesamt abgelehnt. Die Zeit danach war von einem schwelenden Generationenkonflikt geprägt, der ausbrach als junge Republika- ner Führungspositionen in der Partei von den „Old Guards“ überlassen haben wollten. Als Nixon 1960 die Wahl verlor, forderten die Jungen sich auf einen „reinen Republikanimus“ zu besinnen, während die Altgedienten eher auf eher auf einen breiten, alle Wählergruppen ansprechenden Republikanimus setzten. Um Wahlsiege nicht zu gefährden, wurde dieser Konflikt aber hinter verschlossenen Türen ausgetragen. Reagan gewann dann auch nicht mit Hilfe der „Young Republicans“, sondern mit Unterstützung der „neokonservativen Revolution“, bei der die „New Right“ - eine Gruppierung ultrarechter Moralideologen - eine gewichtige Rolle spielte. Aber der programmatische Kurs Reagans hinderte die „New Right“ daran ihre Forderungen zu erfüllen. Dieser „mainstream conservatism“ setzte sich auch unter Bush fort.
Zu erwähnen sei noch der Konflikt zwischen Isolationisten und Internationalisten, der wesentlich härter ausgetragen wurde, als bei den Demokraten.3
4.3.5. Unterschied zwischen Demokraten und Republikanern
Bei den Demokraten gab es kaum Konflikte beim Isolationismus, aber häufig innerparteiliche Kämpfe bis hin zu Abspaltungen.
Bei den Republikanern brach ein Generationenkonflikt aus; die Isolationisten waren sehr mächtig und ließen sich nicht so einfach ruhigstellen wie bei den Demokraten. Es gab keine Abspaltungen, sondern eher Zusammenarbeit mit rechten Vereinigungen.1
4.4. Programmatische Entwicklung und Image-Wandel der großen Par- teien
4.4.1. Die „Platform“-Inhalte der Demokraten · Außen- und Sicherheitspolitik
Während in dem Wahlprogramm von 1936 noch moderat isolationistische Töne angeschlagen wurden, wurde die „platfom“ 1940 vor dem Hintergrund des 2. Weltkriegs zunehmend interventionistisch und als sich die Blöcke formiert hatten 1952 auch antikommunistisch. Das Wahlprogramm von 1968 hatte den Schwerpunkt auf die Beendigung des Vietnamkriegs und ab dem Programm von 1972 forderten die Demokraten eine Entspannung im Ost-West-Konflikt. 1988 forderten sie eine Höhere Hürde für Auslandseinsätze US-amerikanischer Soldaten.2
- Wirtschafts-, Sozial-, Haushalts-, und Steuerpolitik
Während die Demokraten in den 30er Jahren voll auf den „New Deal“ setzten, hielten sie auch danach an einem Wohlfahrtsstaatmodell fest. Aber ab dem Ende der 80er Jahre - vor dem Hintergrund des Haushaltsdefizits - war in den „platforms“ eine Forderung nach Abschwächung des Sozialstaats enthalten.3
- Föderalismus
Mit dem „New Deal“ bricht Roosevelt 1932 die völlige Selbständigkeit der Einzelstaa- ten und nach dem 2.Weltkrieg schreiben die Demokraten ein klares Bekenntnis zu Bürgerrechten in ihre „platforms“. Zudem bejahen sie in den 60er Jahren ausdrücklich Aktionen wie „busing“ oder „affirmative action“. In den Wahlprogrammen von 1976,
1980 und 192 setzen die Demokraten sich nacheinander für Wehrdienstverweigerer, Homosexuelle uns Aids-Opfer ein.1
- Innerer Sicherheit
In den Jahren 1940/50 sind die Wahlprogramme deutlich antikommunistisch, danach vertreten sie zunehmend linksliberale Positionen (z.B.: 1984: Forderung nach eingeschränktem Waffenbesitz).2
- Reformpolitik
Im Wahlprogramm von 1968 wurde sowohl die Herabsetzung des Wahlalters auf 18, als auch das „Equal Rights Ammendment“ gefordert und 1976 schrieben die Demokraten die Forderung nach Einführung einer öffentlichen Finanzierung der KongressWahlkämpfe in ihre „platform“.3
- Generelle Unterschiede zur G.O.P.
Zum einen betonten die Demokraten das Recht der Frau auf Abtreibung, sie standen (und stehen) für die Aufrechterhaltung der Trennung von Staat und Kirche und setzten auf eine größere Gewichtung der Umweltpolitik.4
4.4.2. Die „Platform“-Inhalte der Republikaner · Außen und Sicherheitspolitik
Schon in dem Wahlprogramm von 1940 forderten die Republikaner eine stark isolatio- nistisch geprägte Außenpolitik, was auch 1952 und 1968 in den „platforms“ auftauchte, nämlich die „ehrenvolle“ Beendigung von Korea- und Vietnamkrieg. Im Jahr 1976 for- derten sie eine „moralisch orientierte Außenpolitik“ und im Zuge dieser lehnten sie den SALT-II-Vertrags (1980) und die Errichtung eines Palästinenserstaats (1988) ab.5
- Innenpolitisch
In der Nachkriegszeit waren die Programme vom Antikommunismus beherrscht. In der Nixonära - vor dem Hintergrund von Protesten und Ausschreitungen - wurde der Ruf nach Wiederherstellung von „law and order“ laut und in der Reaganära fand eine Rückbesinnung auf religiöse und moralische Werte statt (z.B.: Ablehnung von Abtrei- bung, Stärkung des Rechts auf Waffenbesitz und dem Ruf nach der Todesstrafe).1
- Wirtschafts-, Sozial-, Haushalts-, und Steuerpolitik
Generell forderten sie einen ausgeglichenen Haushalt, Steuersenkungen, Deregulierungspolitik, unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen und den Abbau von Subventionen. Sie lehnten eine Staatliche Krankenversicherung mit dem Hinweis auf die Freiwilligkeit und Subsidiarität von Sozialleistungen ab.2
- Bürgerrechtspolitik
Bis in die Nachkriegszeit waren die Republikaner - historisch bedingt - die offiziellen Vertreter der Schwarzen, aber ab den 60er Jahren übten sie Zurückhaltung auf diesem Gebiet (sie lehnten „busing“ und „affirmative action sogar ab). Mit ein Grund war, dass sie sich für weiße Südstaatler wählbar machen wollten.3
- Föderalismus
Die G.O.P. war ein Vertreter antizentralistischer Positionen und plädierten für die Einschränkung der Macht des Präsidenten.4
4.4.3. Die Image-Veränderung der Demokraten · Sozialpolitik
Roosevelt baute mit seinem „New Deal“ das Image auf, die Demokraten hätten große wirtschaftspolitische Kompetenz und könnten die anstehenden Probleme bewältigen. Unter Truman und Carter ging dieser Eindruck bei den Wählern aber wieder verloren.5
- Außenpolitik
Als Sieger über Faschismus und Nationalsozialismus standen die Demokraten gut da, aber durch die eigene Zerrissenheit boten sie während des Vietnamkriegs ein Bild absoluter Handlungsunfähigkeit. Danach traten sie für Ost-West-Entspannung und soluter Handlungsunfähigkeit. Danach traten sie für Ost-West-Entspannung und deutliche Abrüstung ein.1
- Innenpolitik
Die Straßenkämpfe während des Vietnamkrieges warfen kein gutes Licht auf die Demokraten und ließen das Bild entstehen, dass sie nicht in der Lage seien Ruhe und Ordnung wiederherzustellen.2
- Bürgerrechtspolitik
Bis in die 50er Jahre waren sie die Bremse, ab den 60er Jahren der Motor der Bürgerrechtsbewegung. Aber dieser Umstand ließ sie bei manchen als linkslastig und unrepräsentativ erscheinen.3
4.4.4. Die Image-Veränderung der Republikaner
- Außenpolitik
Anfangs noch isolationistisch eingestellt, profilierten sie sich bald als „Bastion des An- tikommunismus und als Garantin der militärischen Überlegenheit der USA“ (vor allem unter Nixon und Bush). Sie waren es dann auch, die die Ost-West-Entspannung voran- trieben.4
- Wirtschaftspolitik
Unter Eisenhower, Nixon und schließlich Reagan konnte zunehmend das Bild einer in- kompetenten Partei korrigiert werden (Reaganära: Leistungsorientierung vs. Ellenbo- genmentalität).5
- Bürgerrechtspolitik
Sie verloren ihr Image bei den Schwarzen als Anwalt ihrer Recht und versuchte durch Ablehnung der Bürgerrechtsreformen die weißen Südstaatler auf ihre Seite zu ziehen.6
- Innenpolitik
Sie galten trotz aller Affären (z.B. „Watergate“) als „law and order“-Partei und unter Reagan dann als Hort des „good old America“.1
4.5. Wähler und Anhängerschaft der beiden großen Parteien
4.5.1. Die Demokraten
Das „realignment“ von 1932 - vor dem Hintergrund der „Great Depression“ - schuf für die Demokraten die sog. „New Deal“-Wählerkoalition. Sie bestand aus gewerkschaftsorgani- sierten Industriearbeitern, Jungwählern, ethnischen Minderheiten, Immigranten und weißen Südstaatlern. Im Jahr 1936 kamen noch die vom „New Deal“ profitierenden Schwarzen hinzu. Diese Koalition sicherte den Demokraten 20 Jahre lang die Macht, bis es zu einer langsamen Erosion kam und die „Democrats“ wieder gleich auf mit den „Republicans“ lagen.
Hauptphasen der Erosion:
Ab 1946 fand aufgrund des Kalten Krieges und der Antikommunismushysterie ein Verlust konservativer Wähler statt. Dazu kam 1948 die Abwanderung linker Demokraten zur „Po- pulist Party“ und rechter Demokraten zu den „Dixiecrats“. In den Jahren 1964-68 verloren die Demokraten wiederum Wähler an eine rechte Gruppierung, diesmal war es Barry Goldwater und seine „American Independent Party“. Hinzu kam, dass die „silent majority“ sich nach Recht und Ordnung sehnte, was angesichts der Unruhen in dieser Zeit auch nicht verwunderlich war. Linke Wähler waren von dem Zickzackkurs der Demokraten ent- täuscht und wendeten sich Drittparteien zu oder gingen erst gar nicht zur Wahl. In der Ära Carter wanderten enttäuschte Mittelschichtangehörige zu den Republikanern und unter Reagan verloren die Demokraten konservative Wähler an die „konservative Revolution“. Am nachhaltigsten erschien der Verlust der weißen südstaatlichen Anhängerschaft, der aber von einem Zugewinn der durch die Emanzipationsbewegung erstarkten Frauenwäh- lerschaft gemildert wurde.2
4.5.2. Die Republikaner
Sie sammelten die enttäuschten Bürger die ehemals die Demokraten gewählt hatten bei sich. Ihre Stammwähler waren konservative und fundamentalistische Protestanten. Am deutlichsten war der Umschwung der weißen Südstaatler von den Demokraten hin zu den Republikanern.1
4.6. Die Krise der amerikanischen Parteien
Die Krise der beiden großen Parteien lässt sich sehr gut am Wählerverhalten und der Par- teiloyalität ablesen. Die Wechselwähler stiegen von 10% (1950) auf 20% (1980), gleich- zeitig stieg die Anzahl der „defectors“ - das sind Wahlberechtigte, die bei einer Umfrage vor der Wahl angeben sie würden Partei X wählen, tatsächlich wählen sie dann aber Partei Y - von 15% (1952-76) auf 21% (1978-88) und die Anzahl der „ticket-splitters“ - das sind Wähler die ihre Stimmen auf verschiedene Parteien verteilen, so geben sie z.B. ihre Stim- me dem Präsidentschaftskandidaten der Partei X, wählen aber gleichzeitig den Kandidaten für das Repräsentantenhaus der Partei Y - von 38% (1948) auf 60% (1980). Die Parteizu- gehörigkeit des Kandidaten war 1952 für 46% der Wähler wichtig, 1980 nur für 22%.
Ebenso interessant ist der Anstieg der „independents“ - das sind Wahlberechtigte die sich keiner Partei zugehörig fühlen - : Ihre Zahl erhöhte sich von 15% (1932), auf 20% (1952- 64) und dann sogar 36% (1976). Daraus kann man ablesen, das immer mehr Wähler sich vor jeder Wahl neu entscheiden, wen sie warum wählen und keiner Partei blind ihre Stim- me geben.2
5. Die Organisationsstruktur
5.1. Allgemeine Entwicklungslinien
Die noch im vierten Parteiensystem schwachen Parteizentralen wurden durch den Supreme Court indirekt aufgewertet, da dieser festlegte, dass Bundesinteressen über Einzelstaateninteressen bei der Kandidatenwahl für Bundesämter steht. Es bildeten sich starke nationale Parteizentralen, die durch gestiegene finanzielle Ressourcen großen Einfluss auf die Kandidaten, ihren Wahlkampf und dessen Unterstützung nehmen konnten.3
5.2. Organisatorische Veränderungen bei den „national conventions“
Begonnen hatte die Umwälzung bei den Demokraten, die ab 1960 eine deutliche Erhöhung der Delegiertenzahl beschloss, nämlich von 1200 Delegierten im Jahr 1932 auf 3000 Delegierte im Jahr 1972. Wichtig waren auch die McGovern-Fraser-Refomen (1969-1972) und die Reform des „National Democratic Commitee“. Die Republikaner zogen kurz darauf mit den Demokraten gleich.1
5.3. Veränderungen im Nominierungsverfahren
Die Demokraten änderten eine Reihe von traditionellen Parteistatuten:
Die aus dem Jahr 1832 stammende „2/3-Regel“ wurde 1936 abgeschafft und der Präsident- schaftskandidat benötigte nur noch die absolute Mehrheit um nominiert zu werden. Im Jahr 1968 wurde die 1832 eingeführte „Unit-Regel“ abgeschafft und durch eine Art Proprotionalsystem ersetzt. Des Weiteren entzog man dem Parteiapparat Macht, indem die Zahl der Primaries drastisch erhöht wurden. Die McGovern-Fraser-Kommission sah fol- gende, wichtige Reformen vor:
- Alle Nominierungsveranstaltungen sollen öffentlich gemacht werden
- Die garantierte Repräsentation von Minderheiten und Frauen
- Die geschlechtliche Parität bei der Besetzung aller Parteigremien.
- Mehr Mitsprache der Einzelstaaten bei der Delegiertenauswahl
Der im Juli 1972 stattfindende Demokratische Nationalkonvent unterscheidet sich nach den Reformen auffällig von allen vorangegangenen. Frauen, junge Delegierte und Schwar- ze waren plötzlich stark wie nie vertreten. Das führte zur Wahl McGoverns zum Präsident- schaftskandidaten. Nach dessen Wahldebakel wurden von den Gegnern Gegenreformen durchgesetzt, aber dennoch war die Prägung der Konvente durch die McGovern-Fraser- Kommission unverkennbar: Die Rolle der Kandidaten im Vergleich bis 1968 war gestärkt und deren Strategie war durch die Erhöhung der Anzahl der primaries und der Einführung der „Unit-Regel“ stark verändert. Bei den Republikanern war aufgrund ihrer innerparteili- chen Homogenität keine solchen Reformen zu erkennen, aber sie schloss sich den Entwicklungen in der Demokratischen Partei an.2
5.4. Innerparteiliche oder parteinahe Organisationen
Sie wurde geschaffen um spezielle Wählergruppe für sich zu gewinnen. Während anfangs der Periode vor allem Gremien gegründet wurden, um den jeweiligen ideologischen Unterbau des linken oder rechten Flügels zu stärken („Think tanks“) wurden später vor allem Organisationen für Frauen, Schwarze oder Jungwähler aufgebaut.1
5.5. Kongressfraktionen
Verschiedene Initiativen in beiden Parteien hatten zwei Ziele: Zum einen sollte die Fraktionsdisziplin und zum anderen eine Entmachtung der Ausschüsse bzw. deren Vorsitzenden eingeleitet werden.
Durch verschiedene Gremien sollte die Kontrolle auf die Fraktionsmitglieder erhöht werden, um bestimmte Gesetzte zur Abstimmung zu bringen. Mit einer Mischung aus Kontrolle und Anreizen versuchten die Parteien ihre Kongressmitglieder zu einem stärkeren Zusammenhalt zu bewegen.
Die Ausschüsse in Kongress und Senat waren traditionell von mächtigen Vorsitzenden geleitet und man versuchte die Stellung der einzelnen Ausschussmitglieder durch Reformen der Ausschussordnung zu verbessern.2
5.6. Entwicklung der Wahlkämpfe
Verschiedene Entwicklungen hatten großen Einfluss auf die Führung der Wahlkämpfe:
- Die Entwicklung der wissenschaftlichen Wahlprognose und -analyse.
- Die Durchführung und Organisation der Wahlkämpfe durch professionelle PR- Manager.
- Das Fernsehen kreierte entpolitisierte, persönlichkeitsorientierte Wahlkämpfe.
- Per Flugzeug konnten die Kandidaten jeden Staat und jede Stadt für ihren Wahl- kampf besuchen.
Diese Neuheiten ließen die Bedeutung der Parteien als Wahlkampfhelfer enorm schrump- fen.3
5.7. Finanzierung der Wahlkämpfe
Die oben genannten Neuerungen im Wahlkampf verursachten einen Kostenanstieg in dem Zeitrahmen von 1952 bis 1980 um das Achtfache. Da die Kandidaten auf private Spenden angewiesen waren, aber die Zuwendungen von Einzelpersonen per Gesetz begrenzt waren, mussten sich die Wahlkämpfer auf der einen Seite professioneller „fund-raiser“ bedienen, auf der anderen Seite das Geld über halblegale Organisationen bereitstellen.1
6. Schluss
Wenn ein Resümee über die amerikanischen Parteien von 1932 bis heute gezogen werden soll, dann fallen einige positive und einige negative Punkte auf. Die Weltwirtschaftskrise wurde erfolgreich durchstanden, was sicherlich Roosevelt und seinem „New Deal“ angerechnet werden muss. Durch die Überwindung der Rassendiskriminierung haben die großen Parteien der USA bewiesen, dass sie eine wichtige gesellschaftliche und integrative Funktion haben, genauso wie mit der Bewältigung der Watergate-Affäre. Die Umwälzungen bei der Auflockerung des „solid south“ waren sicherlich stark, letztendlich aber positiv. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts gelang den Parteien eine erfolgreiche Organisationsreform, die sie demokratischer und bürgernäher macht.
Doch diese Zeit hatte auch Schattenseiten, was die Rolle der „conservative coalition“ gut verdeutlicht. Sie war mehr als nur konservativ, war oft reaktionär und rückwärtsgewandt, was viele notwendige Reformen in den USA unnötig verzögerte. Ein anderes Kapitel sind die Wahlkämpfe oder besser -shows, die immer mehr Spektakel bieten, aber immer weni- ger Themen behandeln. Durch die inhaltliche Annäherung der beiden großen Parteien wur- de und wird eine Abgrenzung zum gegnerischen politischen Lage immer schwerer, so dass immer mehr personenbezogene und emotionalisierte Wahlkämpfe geführt werden. Gleich- zeitig verlieren die eigentlichen Parteien den Einfluss auf die Wahlkämpfe an von Einzelinteresse geleiteten Organisationen.2
7. Literaturverzeichnis
- Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Ge- genwart, Opladen 1998
- Nassmacher, H.: Parteien in Nordamerika - Apparatparteien „neuen Typs“?, aus: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Frankfurt 1992
[...]
1 Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 89
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 385ff
2Vgl.: Ebd. S. 385f
3Vgl.: Ebd. S. 386
4 Vgl.: Ebd. S. 386f
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 387
2Vgl.: Ebd. S. 387f
3 Vgl.: Ebd. S. 388ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 390
2Vgl.: Ebd. S. 390f
3 Nassmacher, H.: Parteien in Nordamerika - Apparatparteien „neuen Typs“?, aus: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Frankfurt 1992 S. 120
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 396ff
2 Vgl.: Ebd. S. 404ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 407ff
2 Vgl.: Ebd. S. 412ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 415ff
2 Vgl.: Ebd. S. 418ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 423ff
2 Vgl.: Ebd. S. 425ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 429ff
2 Vgl.: Ebd. S. 433ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 435ff
2Vgl.: Ebd. S. 437ff
3 Vgl.: Ebd. S. 440f
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 441ff
2Vgl.: Ebd. S. 449ff
3 Vgl.: Ebd. S. 445ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 450f
2Vgl.: Ebd. S. 453f
3 Vgl.: Ebd. S. 454
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 454f
2Vgl.: Ebd. S. 455
3Vgl.: Ebd. S. 455
4Vgl.: Ebd. S. 455f
5 Vgl.: Ebd. S. 456
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 456
2Vgl.: Ebd. S. 457
3Vgl.: Ebd. S. 457
4Vgl.: Ebd. S. 458
5 Vgl.: Ebd. S. 458
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 459
2Vgl.: Ebd. S. 460
3Vgl.: Ebd. S. 460
4Vgl.: Ebd. S. 460
5Vgl.: Ebd. S. 461
6 Vgl.: Ebd. S. 461
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 461f
2 Vgl.: Ebd. S. 462ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 465f
2Vgl.: Ebd. S. 468ff
3 Vgl.: Ebd. S. 472ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 475f
2 Vgl.: Ebd. S. 476ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 475f
2Vgl.: Ebd. S. 487ff
3 Vgl.: Ebd. S. 491ff
1Vgl.: Klumpjan, Helmut: Die amerikanischen Parteien: Von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Opladen 1998 S. 493ff
2 Vgl.: Ebd. S. 560ff
- Quote paper
- Johannes Görg (Author), 2000, Das 5. Parteiensystem der USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104858
Publish now - it's free

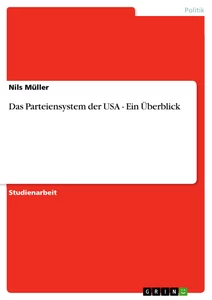







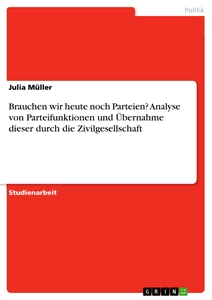










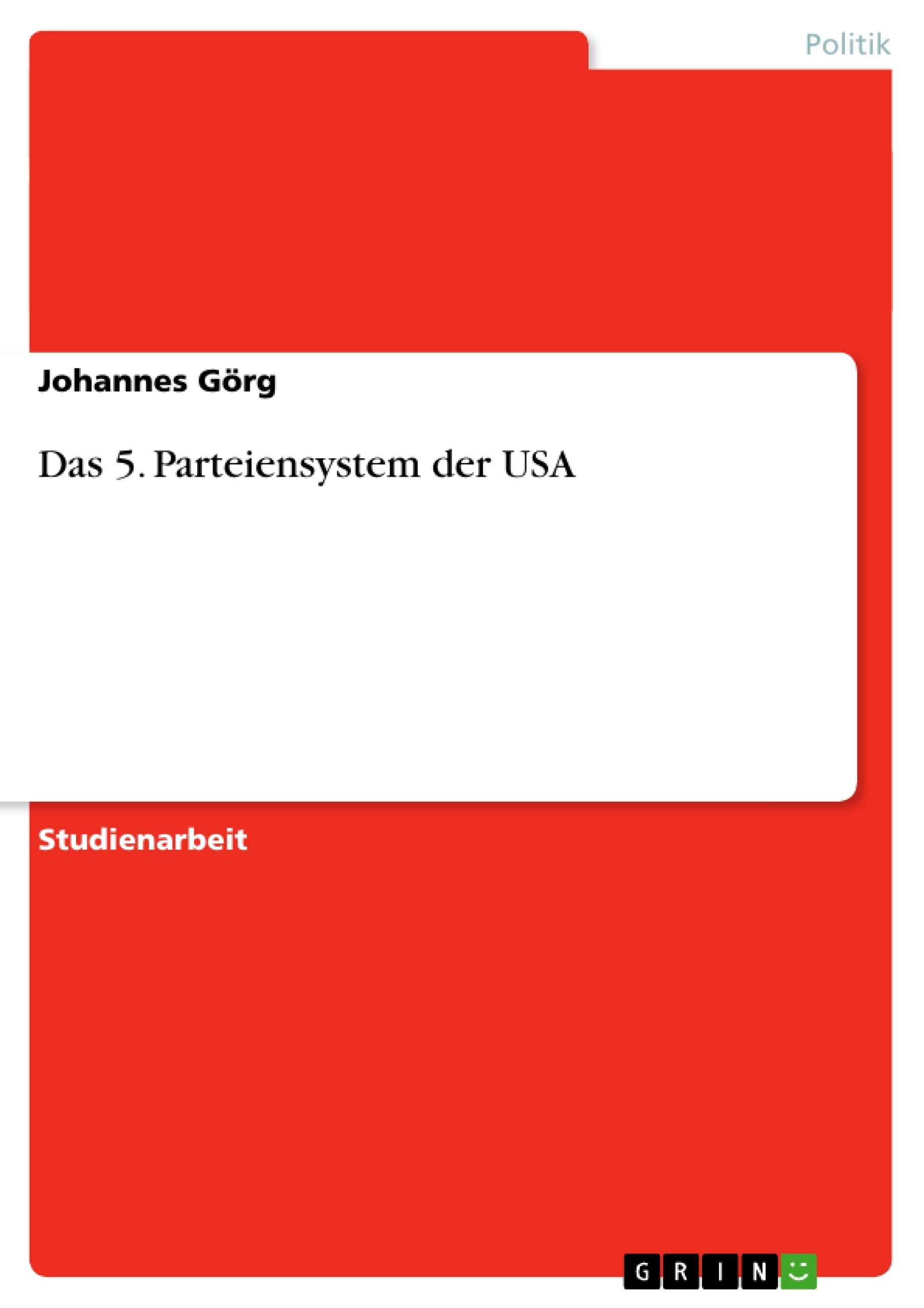

Comments
Naja.
Ist eher eine Zusammenfassung von Klumpjans Buch. Das Buch ist eher zu empfehlrn.