Leseprobe
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
Erziehender Unterricht
Mädchenschulen
Seminarausbildung der Lehrer
Kampf um das höhere Schulmonopol
Berufsausbildung in Industie und Handwerk
Pädagogik als wissenschaftliches System
Herbart
Dilthey
Nationale Verstrickung
Pädagogik zur Zeit der großen Industrie
Einleitung:
Die Macht des Adels im 19. Jahrhundert beruhte auf seinem landwirtschaftlichen Großgrundbesitz und auf den zahlreichen geschriebenen wie ungeschriebenen Standesprivilegien, die im Laufe des Jahrhunderts nur sehr allmählich abgebaut wurden.
Während sich in Frankreich auch die Bauern im August 1789 ihre Freiheit selbst erkämpft hatten, lebten sie in Deutschland weiterhin in feudaler Abhängigkeit. Erst als die preußischen Bauern im Kampf gegen das napoleonische Heer 1806 unterlagen, erkannte man, das Bauernbefreiung Voraussetzung für ein schlagkräftiges Heer sei. Doch das Ziel, ein freies und wirtschaftlich unabhängiges Bauerntum zu schaffen, wurde nicht erreicht. Die wirtschaftliche Lage des Bauernstandes war in Preußen nach der Bauernbefreiung schlechter als vorher. Die Bauern verarmten, verkauften oft den Rest ihres Landes an die Junker oder belasteten ihren Grund mit Verschuldungen. Sie wurden zu lohnabhängigen Landarbeitern ohne Land. Unter ihnen vegetierte die große Masse der bäuerlichen Unterschicht. Diese hatten ebenfalls ihre Freiheit erhalten, d.h. sie waren z.B. keinen Ehebeschränkungen mehr unterworfen. Der große preußische Bevölkerungszuwachs zwischen 1815 und 1848 von 10 auf 16 Millionen ist wesentlich ein Ergebnis der Agrarreform.
Viele der Bauern suchten Zuflucht in den Städten und dienten der aufkommenden Industrie als billige Arbeitskräfte. Ähnlich wie in Preußen polarisierten sich auch in den übrigen deutschen Ländern durch die Bauernbefreiung die Besitzverhältnisse auf dem Land.
Dort konnte die Hausindustrie, vor allem das Textilgewerbe mit den maschinell gefertigten Waren aus England nicht mehr konkurrieren. In den schlesischen Weberhütten, die Arbeits-, Wohn- und Schlafstätten zugleich waren, arbeitete die ganze Familie täglich vierzehn bis sechzehn Stunden nahezu umsonst. Das Problem der Kinderarbeit beleuchtet am krassesten das soziale Elend; die Eltern waren auf diesen zusätzlichen Erwerb angewiesen.
Erziehender Unterricht:
Bevor die Industrialisierung ganz Deutschland erreicht hatte war die soziale Stellung eines Menschen von dessen Ständezugehörigkeit abhängig (Geburtsstand, Besitz, handwerkliche sowohl kaufmännische Fähigkeiten).
Die Erziehung der Kinder beschränkte sich auf die Standeserziehung durch die Familie und die Berufserziehung beim Erlernen einer (meist handwerklichen) Tätigkeit.
Auch lebten zu Beginn des 19 Jahrhunderts noch 67% der Bevölkerung auf dem Land (in kleinen Dörfern). Dort gab es nur Regelschulen für Jungen, meist beendeten die diese bereits nach der Quarta oder der Sekunda um einen Beruf zu erlernen (s.u.).
Die eigentliche Geburtsstunde unseres heutigen Gymnasiums liegt begründet in der Tatsache, dass der Staat begann, für seine Beamten ein gewisses Grundwissen festzuschreiben. Dadurch wurde eine neue soziale Schicht geschaffen, das Bildungsbürgertum. Diese waren die Träger der Intelligenz und fühlten sich weder Adel noch den Erfolgreichen der Wirtschaft verpflichtet. Durch ihre Fachkompetenz wurden sie für ihre Untergeordneten zum Vormund, welches auch in eine Interessenvertretung ihrer „Untertanen“ gegenüber Zentral- und Provinzregierungen zur Folge hatte.
Dieser neue Beamtentyp mußte sowohl im Besitz von Fachkenntnissen als auch (durch den neuen Erlaß vom Staat) allgemeiner Gegebenheiten sein. Da gerade diese Allgemeinbildung die staatliche Laufbahn definierte, wurde sie stolz nach außen hin gezeigt. So entstand die von Humboldt abgelehnte Bildung als Statussymbol. (vgl. Blankertz, H.: Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Wetzlar, 1982, S. 157).
Diese Entwicklung drängte die Gymnasialbildung in eine Nische für sozial gehobene Schichten. Sie brachte den „sozial privilegierten Stand der Gebildeten hervor“. (S. 158)
Mit der Reichsgründung wurden die vormals privaten höheren Mädchenschulen schrittweise in das staatliche Bildungssystem eingegliedert.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet man auch eine Art genossenschaftliche Organisation der höheren Mädchenschulen. Elternvereine gründeten sich, wählten einen Ausschuß, stellen selbst Lehrer ein und regelten das Curriculum. Diese Standesschulen waren exklusiv, und eine objektive Meinungsbildung der Schülerinnen ermöglichte das System wohl kaum. Trotzdem entwickelte sich ein anspruchsvoller Unterricht, der Lehrinhalt bezog sich vor allem auf die Muttersprache und moderne Fremdsprachen, auf musische Bildung und bürgerliche Anstandserziehung. Mathematik und die Naturwissenschaften wurden meist übergangen, ebenso die alten Sprachen wie Latein und Griechisch.
Diese Fächer, so dachte man, waren eher den Jungen im späteren Berufsleben förderlich. Mädchen hingegen sollten später im Salon mitreden können (heute: smalltalk) und mit der Bildung dem Haus Ehre erweisen.
Oftmals diente die Schule auch nur dem Zweck der Beschäftigungstherapie, zugegeben einer sehr teuren.
„Von körperlicher Arbeit weitgehend freigestellt, bestand die Hauptbeschäftigung der jungen Mädchen im anmutigen Warten auf eine gute Partie, dabei war das Klavierspielen, Französisch plaudern und Romanlesen durchaus förderlich.“ (vgl. Fertig, L., Zeitgeist und Erziehungskunst, Darmstadt, 1984, S. 171) Die Trennung zwischen höherer Mädchenbildung und höherer Jungendbildung blieb während das ganzen 19. Jahrhunderts bestehen.
Seminar-Ausbildung der Lehrer:
Eine Ausbildung der Elementarlehrer entstand erst in den Seminargründungen der mitteldeutschen Staaten um 1790, die sich nach 1810 in ganz Deutschland durchgesetzt hatte.
In ihrer konkreten Gestalt waren diese Lehrerseminare stark abhängig von ihren Gründern und Direktoren, oft boten sie Pädagogik nach Diesterweg oder Harnisch. Nur in Ansätzen war der Inhalt staatlich reguliert, so dass eine konzeptionelle Vielfalt der Lehrerausbildung bestand. Trotzdem bestimmten gemeinsame Strukturen die Seminare, die bis zur Akademisierung der Ausbildung 1920 Bestand hatten: 1850 wurden erste weitergehende staatliche Regulierungen auf die geforderten Vorkenntnisse genommen. Hatte der Bewerbe diese Hürde erfolgreich überwunden, so wurden seine Kenntnisse in Moral und „intellektueller Tüchtigkeit“ ( vgl. Jeismann, K.E. und Lundgreen, P., Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band III, München, 1987, S. 253 ) überprüft. Dann folgte das Seminar ( zumeist zwei Jahre ); nun musste sich der neue Lehrer zuerst in der Schule behaupten ( ähnlich der heutigen Refrenderiatszeit ) bevor er in ein festangestelltes Verhältnis übernommen wurde.
Doch nicht selbstbestimmtes oder gar wissenschaftliches Arbeiten wurde in den Seminaren gelehrt, vielmehr war es eine rigide Schulung, die von einem strikten Tagesablauf, vom Morgenchoral bis zum Nachtgebet, in Unterricht und Freizeit die Teilnehmer kontrollierte. Der mittelalterliche Bezug der Schule zur Kirche verstärkte sich in dieser Zeit sogar wieder etwas.
Kampf um das höhere Schulmonopol:
Anfang des 19. Jahrhunderts legte die Regierung Preußens das Gymnasium als einzige, auf die Universität vorbereitend, Schulform fest.
Das allgemeine Interesse der damaligen Zeit oblag sowieso dem Gymnasium und den Elementarschulen, Mittelschulen wurde keine Zukunft zugesprochen. Doch durch wirtschaftlichen Wachstum und die steigende Bedeutung des Bürgertums wuchs kurz darauf wieder der Bedarf an einer neuen Bildungsform. Viele junge Menschen gaben sich mit dem Abschluß der Volksschule nicht mehr zufrieden. Eine neue mittlere Schulform wurde benötigt. Viele Lateinschulen erkannten diesen Wandel, legten die Konzentration auf die alte Sprache ab und nahmen neue Fächer ( Naturwissenschaften, Mathematik und moderne Sprachen ) in ihr Lehrangebot auf.
Deren Zulauf wurde immer größer, Neugründungen waren nötig. 1832 regelte die Regierung die Bestimmung der Unterrichtsfächer, Schuldauer, Inhalt der Abschlußprüfung, eine neue Schulform war geboren.
Das zuerst friedliche Nebeneinander dieser neuen Realschulen und der Gymnasien entwickelte sich Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Kampf um das höhere Schulmonopol. Vor allem die enorme Wandlung Deutschlands von einem Bauernstaat in eine Industriegesellschaft hatte dazu beigetragen. Viele polytechnische Lehranstalten ( mit Hochschulcharakter ) suchten Studenten, die mit den Naturwissenschaften vertraut waren, diese konnten besonders die Realschulen I. Ordnung, später Realgymnasien genannt, ausbilden. Um diese Entwicklung zu unterdrücken bestimmte der Staat 1859 Latein als Pflichtfach einzuführen. Die Gymnasien mussten sogar die Naturwissenschaften ganz vom Lehrplan streichen, da man Angst hatte diese könnten einen revolutionären Charakter auf die Schüler haben. Dieser Zwang begünstigte den Kampf der Schulformen, denn mit Lateinkenntnissen bekamen auch Realschulabsolventen die Möglichkeit einer universitären Ausbildung. Das Abiturmonopol begann zu bröckeln.
Um 1890 versuchte man die Realschulen II. Ordnung ( solche ohne Latein im Curriculum ) zu stärken, um damit die der I. Ordnung zu schwächen, man hoffte diese würden mit der Zeit aussterben. Das gelang jedoch nicht, im Gegenteil, durch die Stärkung waren selbst die niederen Realschulen dem Gymnasium gefährlich nahe gekommen. Sie näherten sich immer weiter aneinander an, bevor sie im Laufe der Zeit alle den Namen Gymnasium in Anspruch nahmen.
Berufsausbildung in Handwerk und Industrie:
Der Neuhumanismus und die Preußische Reform bewirkten eine Abkapslung der Erziehung von der Berufs- und Standeserziehung. Daraus entwickelte sich im 19. Jahrhundert die Trennung von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Dies hatte jedoch für einen Großteil der beruflichen Ausbildung wenig Folgen, denn diese wurde fast ausnahmslos vom Handwerk geleistet.
Mit der Stein- Hardenbergischen Reform wurde in Preußen neben Agrar- und Verwaltungsreform auch die Bindung des Handwerks an Zünfte und die Gewerbereglementierung weitestgehend aufgelöst. Spätestens mit Verkündigung der Gewerbefreiheit (1810) hatte dies eine große Bedeutung für die spätere Berufsausbildung. Mehr und mehr verzichteten die Lehrlinge auf eine Karriere zum Meister. Größere werdende Betriebe (Manufakturen) und die langsam aufkommende Akzeptanz eines Gesellentums taten ihr übriges. Dadurch zerfiel die traditionelle Lebensgemeinschaft Meister - Geselle - Lehrling. Gesellen gerieten in ein reines Lohnverhältnis, Lehrlinge verkamen zu billigen Arbeitskräften. Eine industrietypische Facharbeiterausbildung gab es noch nicht, denn zumeist wurde Kraft und Ausdauer, jedoch keine speziellen Fachkenntnisse erwartet.
Die geregelte Lehrlingsausbildung fiel mit der neuen Gewerbeordnung von 1869, welche die Gewerbefreiheit vergrößerte. 1872 hob der damalige preußische Kulturminister die „Stiehlsche Regulative“ auf. Von nun an konnte jeder ein Lehrling sein, egal ob er unentgeltlich, gegen ein Lehrgeld oder vollen Arbeitslohn arbeitete. Ebenso war es jedem möglich Lehrherr zu sein, egal ob er wirklich etwas unterrichtete oder die Kinder und Jugendliche als billige Arbeitskräfte mißbrauchte. Die industrielle Kinderarbeit nahm erschreckende Ausmaße an, zwar war sie bereits seit 1839 verboten, so fehlten doch die Möglichkeiten dies zu kontrollieren und durchzusetzen.
Es enstanden die ersten sozialistischen Strömungen. 1869 trat die Sozialdemokratische Partei Eisenacher Richtung auf, der August Bebel vorstand. Schon 1863 gründete Ferdinand Lasalle den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein.
Die Arbeiter und Handwerker entwickelten Stärke, ihre Zusammenschlüsse wurden mächtiger, besonders durch die Massen derer, die ihnen nahestanden. Dem folgte jedoch ein Bruch zwischen Handwerkern und Industriearbeitern. Die konservative Staatsführung sah die Handwerker nun als Bundesgenossen im Kampf gegen die Sozialdemokratie. „Das hatte entscheidende Auswirkungen auf die Neuordnung der Lehrlingsausbildung gegen Ende des 19. Jahrhunderts und für das sich daraus entwickelnde „duale“ oder „deutsche“ System der Berufsausbildung.“ (Blankertz H., Die Geschichte der Pädagogik, Von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Wetzlar 1982, S. 175)
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden die allgemeinen Fortbildungsschulen, der Vorgänger unserer heutigen Berufsschulen. Diese war jedoch noch nicht beruflich/fachlich orientiert, sondern eine allgemeinbildende Schule, in der vor allem das Wissen aus der Volksschule wiederholt wurde. Erst das Handwerkerschutzgesetz von 1897 verpflichtete die Lehrherren, ihre Lehrlinge in die Fortbildungsschule zu schicken. So sollte die Arbeiterschaft in den Bildungszusammenhang der Nation befördert werden.
Pädagogik als wissenschaftliches System:
Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841) gilt als Begründer der Pädagogik als wissenschaftliches System. Obwohl er in der gleichen Zeit wissenschaftliche arbeitete wie Humboldt und Schleiermacher, ging er nicht anheim mit der Pädagogik der Deutschen Klassik.
Nach seinem Studium in Jena habilitierte Herbart in Göttingen für Philosophie.
1809 wurde er als Nachfolger Kants auf den Lehrstuhl der Philosophie in Königsberg berufen. 1833 wechselte er zurück nach Göttingen.
Seiner Auffassung nach bilden Erfahrung, Umgang und Unterricht den Menschen. Erfahrung und Umgang isoliert er von der Erziehung, also konzentriert er sich auf den Unterricht. Grundlage dafür ist die Assoziationspsychologie, die meint, dass die Vorstellung des Lernenden so aufgebaut sein muß, dass sie das Wollen und somit das Handeln bestimmt. Nach Herbart wird auch der Charakter des Menschen durch seine Gedanken gesteuert, somit ist die Formung derer (durch Erziehung) in der Lage den Charakter und die Grundeinstellung des Menschen zu beeinflussen. In der Verkettung der Vorstellung sieht er die Chance dem Lernenden Informationen bereitzustellen, die dieser dann durch Ineinanderfügen aufnehmen kann. Ist ein Geflecht erkennbar, so ermöglicht es dem Lerner Fakten/Wissen auf Probleme/ Situationen etc. anzuwenden.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es einen starke allgemeine Tendenzen der Kulturkritik, immer mehr Kritiker kamen zu der Meinung, dass das gegenwärtige und zukünftige Leben der Vergangenheit geopfert werde.
Auf Schule und Erziehung angewandt, folgte daraus eine Ablehnung und Verurteilung des Herbartismus, der im Unterricht noch den Standart bildete und daher für alle Probleme und Mängel haftbar gemacht wurde. Nach Arbeiter- und Frauenbewegung trat mit der Jugend ein neuer Konflikt auf, welcher die Konzentration der Erziehung auf den Herbartismus ablehnte. Die neugewonne Originalität und die subjektive Überwindung alter Zwänge gab der Jugend das Gefühl der Befreiung, neue Ideen kamen auf. Einige verstanden die Pädagogik nicht mehr als Erziehung, sondern in der Hilfe Bedürftiger, es entstand die Sozialpädagogik.
Die ursprüngliche pädagogische Theorie wurde zusammen mit der Schule angeklagt und abgelehnt. Der Herbartismus hatte an Kraft und Bedeutung verloren.
Wilhelm Dilthey:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dilthey legte seine Begründung für eine geisteswissenschaftliche Pädagogik in den Unterschied zu den normativen und den Naturwissenschaften.
Während die Naturwissenschaften alles erklären, berechnen und überwachen wollen um daraus Dinge zu kontrollieren, sieht Dilthey die Geisteswissenschaft als Verstehen. „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“ (Dilthey, Band V, 1957, S. 143). Damit grenzt er die Geisteswissenschaft methodologisch ab. Die Hermeneutik (verstehen statt erklären) war seiner Meinung nach des Instrument aller Geisteswissenschaften, es erlaubte eine Selbständigkeit, mit der sie sich von der Ansicht, nur ein Teilgebiet der Philosophie zu sein, abgrenzen konnte.
Zuvor hatte Dilthey versucht die Wissenschaftsgebiete durch ihre Gegenstände einander abzugrenzen, dies erwies sich als schlecht, da einzelne Gegenstände in vielen verschiedenen Gebieten eine Rolle spielen. Offenbar ließen dich die Wissenschaften nur über ihre Fragestellung erklären. Die neuzeitlichen Naturwissenschaften brachten allgemeingültige Urteile hervor. Jeder, der die wissenschaftlichen Einsichten nachvollzog, kam zum gleichen Ergebnis. Natur war also eine berechenbare Größe. Doch der Mensch habe nunmal eigene Interessen und Ansichten, man kann ihn nicht pauschalisieren, Dilthey erklärte den Positivismus für gescheitert.
Anders als in den Naturwissenschaften integrierte Dilthey den Forscher der Geisteswissenschaft in die Forschung hinein. Er betrachtet diesen nicht als Störung oder Ungenauigkeit in einem Versuch, sondern als notwendigen Bestandteil.
Dilthey Verfahren ist kein lineares, welches von Einsicht zu Einsicht weiterschreitet, sondern muß als ein kreisendes verstanden werden. Das Ganze wird durch die Einzelheiten erläutert und die Einzelheiten durch das Ganze (hermeneutischer Zirkel).
Peter Petersen, zunächst Gymnasiallehrer, wurde 1923 auf den Lehrstuhl der Pädagogik an der Universität Jena berufen. Er gilt als einer der Wegbereiter der empirischen Pädagogik. Die, der Hochschule angeschlossene Übungsschule baute er zu seiner weltberühmten Jenaplan-Schule aus. Dieser Plan bezeichnet den Verzicht auf Notengebung zugunsten von Berichten, die flexible Gestaltung der Lerngruppen ( z.B. in Bezug auf das Alter ) und das Problem der schulischen Fächertrennung. Er beinhaltete von Anfang an eine wissenschaftliche Gestaltung und überprüfbare Erfolgskontrolle.
Im Gegensatz zu Dilthey’s Geisteswissenschaft, die Erziehung als einen historisch entstandenen Lebenszusammenhang sieht, ist die empirische Pädagogik als strenge Erkenntniswissenschaft definiert.
Nationale Verstrickung:
Österreich machte seine Niederlage in der Schlacht bei Königsgrätz (1866) gegen Preußen an dem Bildungswesen beider Staaten fest. Die, aus einem Zeitungsartikel entstehende Formulierung, „dass, wenn die Preußen den Österreicher schlugen, es ein Sieg der preußischen Schulmeister gewesen sey.“ wurde zu einer oft zitierten Redensart.
Mit Ausbruch des Nationalismus konzentrierte sich auch die Schule auf das Kulturgut des Vaterlandes. Ausländische Sprachen und Gepflogenheiten wurden nicht weiter unterrichtet. Allmählich wurde die Erziehung zu einem Instrument des Systems, besonders in Deutschland herrschte die Meinung, man müsse sich nicht nur gegen feindliche angreifende Nationen zur Wehr setzten, sondern das deutsche Kulturerbe verbreiten.
Wilhelm Rein, Professor der Pädagogik und Philosophie war einer der letzten bedeutenden Vertreter des Harbartismus in Deutschland. Er teilte die Ansichten der Nationalisten und dirigierte seine Pädagogik in das erwartete Schema. Die Menschen in die „richtige Gesinnung zu lenken“ und Kriegsbegeisterung zu verbreiten, war die wichtigste Aufgabe seiner Erziehungswissenschaft. Auch griff er die Fiedensresulotion von 1917 an, kurz darauf trat er der „Deutschen Volkspartei“ bei, deren Ziel es war die Kriegsmüden Deutschen neu anzuspornen. Doch deren Propaganda fiel auf mißgünstigen Boden, da ein Sieg kaum noch in Aussicht war.
Nicht alle Pädagogen teilten Reins Extrem, doch war die Richtung damaliger Pädagogik sehr nationalistisch. Auch Kerschensteiner, Nohl, Spanger, Litt und Natorp, allesamt bedeutende Erziehungswissenschaftler sahen eine große Differenz der deutschen zu anderen europäischen Kulturen. Sie alle sahen Helden und Führungspersonen als wichtige Vorbilder der Jugend.
Friedrich Wilhelm Förster war einer der wenigen Pädagogen, der mit dem System nicht konform ging, er entgegnete, Deutschland sei am Staat erkrankt und durch ihn entmenscht. Der Nationalismus und der Militarismus sei nicht das Deutschland an das wir glauben. Diese Meinung entsprang im wesentlichen Zügen aus seiner religiösen Überzeugung.
Auch noch 1914, als er den Lehrstuhl der Pädagogik an der Universität München innehatte, mißbilligte er den Krieg; seine Fakultät begann ihn zu diskriminieren. 1933 wurde er von der NS-Regierung ausgebürgert.
Benutzte Literatur:
Blankertz, H., Die Geschichte der Pädagogik, Von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Wetzlar, 1982
Fertig, L., Zeitgeist und Erziehungskunst, Darmstadt, 1984
Gudjons, H., Pädagogisches Grundwissen, Bad Heilbrunn, 1999
Jeismann, K.E. und Lundgreen, P., Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte Band III, München, 1987
Jung, M., Dilthey, Hamburg, 1996
Nicolin, F., Pädagogik als Wissenschaft, Darmstadt, 1969 Schultes, F., Abitur-Wissen Geschichte, Augsburg, 1994
Thöny, G., Philosophie und Pädagogik bei Wilhelm Dilthey und Herman Hohl, Stuttgart, 1992
- Arbeit zitieren
- Helena Stahl (Autor:in), 2000, Pädagogik zur Zeit der großen Industrie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104748
Kostenlos Autor werden


















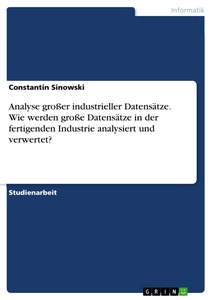

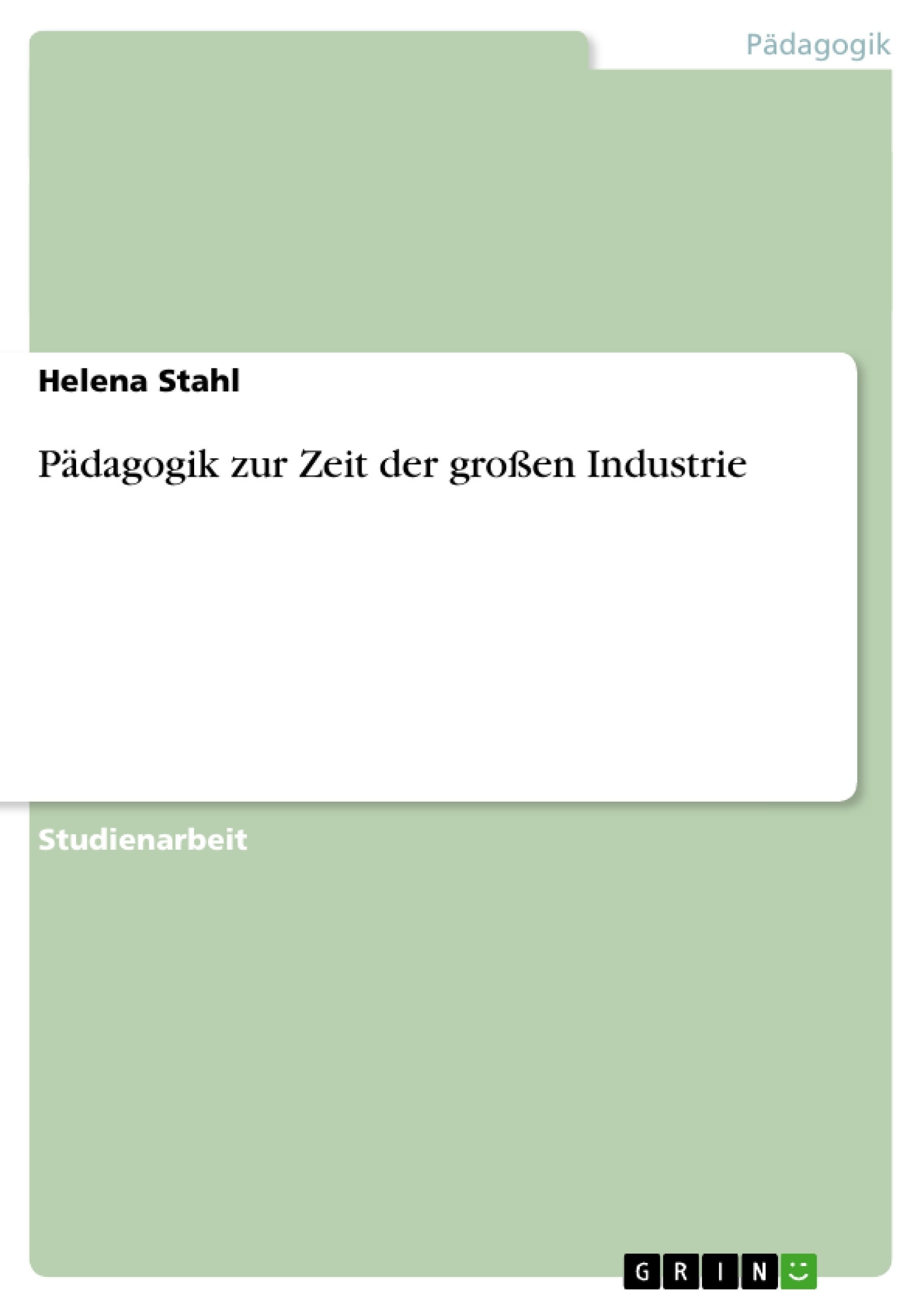

Kommentare