Leseprobe
Als „Herrschaft des Volkes, das den von Minderheiten bestimmten Mehrheitsentscheidungen gehorcht“ hat der deutsche Schriftsteller Rolf Haller die Demokratie bezeichnet. So leicht läßt sich der Demokratiebegriff leider nicht fassen, und doch trifft diese Aussage ein Kernproblem der Allgemeinen Staatslehre: die Bildung und Durchsetzung des Volkswillens. In den überschaubaren Verwaltungseinheiten der antiken griechischen Polis war es noch möglich, daß das Volk zusammenkam und direkt abstimmte. Zum „Volk“ gehörten zu jener Zeit allerdings nur die freien Männer, die eine Minorität der Einwohner bildeten. Nach unserem heutigen Verständnis kann daher nicht von einer „Herrschaft des Volkes“ gesprochen werden, sondern nur von der Herrschaft einer Minderheit.
In den modernen Flächenstaaten sind Zwischengewalten nötig, damit der Wille des Volkes vertreten werden kann. Hier stellt sich das Problem, daß es den Vertretern prinzipiell möglich ist, eine Elitenherrschaft zu bilden. In diesem Fall wird der Volkswille nicht mehr angemessen repräsentiert, und das Volk ist nicht mehr der Souverän.
Volkssouveränität bildet aber die Grundlage der Demokratie. Ist sie nicht gewährleistet, kann man nicht von einer demokratischen Regierungsform sprechen. Zu den demokratischen Haupterfordernissen gehören in der heutigen Zeit außerdem die Gewaltenteilung, die Geltung der Menschenrechte und die Möglichkeit einer Opposition mit Aussicht auf Regierungsüber- nahme. Eine genaue Definition ist schwierig, weil sich verschiedene Demokratietheorien ge- genüberstehen.
Das Problem der Bildung und Durchsetzung des Volkswillens in der Demokratie hat zwei grundlegende kontroverse Theorien hervorgebracht: die Identitäts- und die Konkurrenztheo- rie.
Der erste bedeutende Theoretiker der Identitätstheorie war der französische Philosoph JeanJacques Rousseau (1712-1778). Rousseau „wäre gern in einem Land geboren, in dem der Herrscher und das Volk ein und dasselbe Interesse haben könnten, damit alle Bewegungen der Staatsmaschinerie nur einzig und allein nach dem Allgemeinwohl streben“. Das ist nur möglich, „wenn Volk und Herrscher in derselben Person vereint sind“. Rousseau geht also davon aus, daß die Volkssouveränität nur gewährleistet ist, wenn es eine Identität von Regierenden und Regierten gibt. Die Identität der Personen ist dabei nicht so wesentlich. Die Identität liegt in den Interessen, Bestrebungen und Ansichten. Da es nach Rousseau eine Übereinstimmung zwischen Herrschern und Beherrschten gibt, übt das Volk die Staatsgewalt direkt bzw. unmittelbar selbst aus.
Seine Forderung nach der direkten Demokratie als der einzig wahren Demokratie begründet Rousseau in dem von ihm im Jahre 1762 verfaßten „Gesellschaftsvertrag“ (Le contrat social) damit, daß ein Volk, das sich repräsentieren lasse, unfrei sei. Instanzen zwischen dem Volk und staatlichen Entscheidungen führen seiner Meinung nach zu einer Beeinträchtigung der Volkssouveränität und zu einer Verfälschung des Volkswillens.
John Stuart Mill (1806-1873) ist der bedeutendste Theoretiker des englischen Liberalismus und ein früher Vertreter der Konkurrenztheorie der Demokratie. Er hält die Repräsentation für die beste Regierungsform, bei der „das Volk als ganzes oder doch zu einem beträchtlichen Teil durch periodisch gewählte Vertreter die in einem Verfassungssystem notwendige oberste Kontrollgewalt ausübt.“ Mill plädiert demnach für eine indirekte, mittelbare Herrschaftsausübung des Volkes durch Repräsentanten.
Im Gegensatz zu Rousseaus Identitätstheorie sollte die Regierung nicht den Anspruch erheben, das Volk zu sein, sondern es so zu repräsentieren, daß sich das Volk mit dem Handeln und den Entscheidungen der demokratisch legitimierten Vertreter identifizieren kann. „Das »Volk«, das die Macht ausübt, ist nicht immer dasselbe Volk, über das sie ausgeübt wird“, meint John Stuart Mill dazu.
Während J. S. Mill also die Herrschaft durch Vertreter des Volkes befürwortet, geht J.-J. Rousseau von einer Identität der Regierenden und Regierten aus.
Zu den Grundsätzen der Identitätstheorie Jean-Jacques Rousseaus gehört weiterhin, daß ein homogener Volkswille vorausgesetzt wird.
Im „Gesellschaftsvertrag“ spricht Rousseau auch von Sonderwillen (volonté particulière), die er als egoistische Einzelinteressen bezeichnet und die zusammen den auf das Privatinteresse abzielenden Gesamtwillen (volonté de tous) bilden. Diese Sonderwillen werden aber unter dem Aspekt des Allgemeininteresses herausgefiltert und zum Gemeinwillen (volonté générale) verdichtet. “Jeder [...] stellt seine Person und seine ganze Kraft gemeinschaftlich unter die oberste Leitung des allgemeinen Willens, [...] [die Gemeinschaft nimmt] jedes Mitglied in einen Körper als untrennbaren Teil des Ganzen auf.“
Die Legitimität von Interessenkonflikten wird geleugnet. Teilinteressen werden abgewehrt, denn „[w]er dem Gemeinwillen den Gehorsam verweigert, muß durch den ganzen Körper dazu gezwungen werden. Das heißt nichts anderes, als daß man ihn zwingt, frei zu sein.“
Mill setzt sich dagegen für einen legitimen Pluralismus ein. Die Konkurrenz gegensätzlicher Teilinteressen wird nicht nur akzeptiert, sondern auch befürwortet. Mill geht nicht von einer homogenen Gesellschaft aus, für ihn existiert eine Vielzahl verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, die mit- und gegeneinander um gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Macht wetteifern.
Beide Theoretiker haben demzufolge auch in diesem Punkt verschiedene Ansichten: Während Rousseau von einer homogenen Struktur des Gesellschaftssystems ausgeht, wird von Mill die Ansicht vertreten, daß es in einer Gesellschaft eine Vielfalt heterogener, miteinander rivalisierender Interessen gibt.
Rousseau folgt einem monistischen, Mill einem pluralistischen Demokratieverständnis.
Da die Identitätstheorie einen homogenen Volkswillen voraussetzt, folgert Rousseau daraus, daß es auch ein objektives, einheitliches Gemeinwohl geben muß. Dieses Gemeinwohl läßt sich von vornherein (a priori) feststellen. Demzufolge weiß die Führung - ohne die Bevölkerung zu befragen - , was das Volk will und setzt den Volkswillen in die Praxis um. Der empirisch erkennbare Volkswille findet nur insoweit Berücksichtigung, wie er sich mit dem „wahren Volkswillen“ deckt.
Für Mill ist das Gemeinwohl allenfalls das Ergebnis eines Interessenausgleiches, das Resultat eines Kompromisses, der sich innerhalb des politischen Konkurrenzkampfes ergeben hat. Das Gemeinwohl läßt sich somit erst nachträglich (a posteriori) feststellen.
Folgt man der Identitätstheorie, ist die Legitimation des Herrschaftssystems heteronom, denn das Gemeinwohl wird von der Führung vorgegeben. Die Legitimation des Herrschaftssystems ist nach der Konkurrenztheorie autonom, weil das Gemeinwohl weder objektiv erkennbar noch vorgeben ist.
Obwohl das Gemeinwohl nach der Identitätstheorie vorgegeben ist und die Führung von vornherein weiß, was das Volk will, setzt sich Rousseau für die Durchführung von Plebisziten ein. Nur bei Volksabstimmungen, so Rousseau, kommt der Volkswillen in reiner Form zum Ausdruck. Plebiszite dienen für ihn zur demokratischen Legitimierung, da sich bei ihnen der auf das Gemeinwohl abzielende Gemeinwille offenkundig zeigt.
Mill dagegen plädiert für den Parlamentarismus. Nicht das ganze Volk, sondern nur die Volksvertretung soll über wesentliche Zuständigkeiten im politischen Entscheidungsprozeß
- z.B. die Gesetzgebung, die Auswahl und Kontrolle der Regierung - verfügen.
Die staatlichen Organe werden nicht als Verkörperung eines abstrakten „Gemeinwohles“ angesehen, sondern als Repräsentanten.
Mill verteidigt also den Parlamentarismus, während Rousseau für Plebiszite als Element direkter Demokratie eintritt.
Außerdem befürwortet Rousseau das imperative Mandat. Abgeordnete werden als gebundene Delegierte betrachtet und sind jederzeit abwählbar. Das freie Mandat, bei dem der Abgeord- nete frei entscheiden kann, würde nach Rousseau zur Veräußerung der Volkssouveränität füh- ren. Außerdem würde es der Identitätstheorie widersprechen, denn die Voraussetzung des freien Mandates wäre, daß der Abgeordnete einen Sonderwillen besäße. Mills Meinung nach funktioniert das Repräsentativsystem nur mit dem freien Mandat. Der Parlamentsabgeordnete soll seine Kompetenz zeigen können. Das imperative Mandat führt aber zur Beschneidung seiner Fähigkeiten: „Wenn man einen Parlamentsabgeordneten haben will, der dem Durchschnittswähler geistig in irgendeiner Hinsicht überlegen ist, muß man damit rechnen, daß er dann und wann in seinen Auffassungen von der Mehrheit der Wähler abweicht und daß in einem solchen Fall seine Auffassung in der Regel die richtige ist. Daraus folgt, daß die Wähler schlecht beraten sind, wenn sie dem Vertreter absolute Konformität in ihren Ansichten zur Bedingung machen, sofern er seinen Sitz behalten möchte.“
Als Argument für das freie Mandat führt J. S. Mill außerdem an, daß in einer Demokratie Kontrolle und Verantwortung nur möglich sind durch freie Abgeordnete, die zur Rechenschaft gezogen werden können.
Eine weitere Diskrepanz in den Grundsätzen der beiden Theorien ergibt sich demnach aus der Mandatsregelung: Die Identitätsdemokratie befürwortet das imperative Mandat, die Konkurrenzdemokratie das freie Mandat.
Zudem sind beide Theorien durch eine unterschiedliche Schwerpunktausrichtung gekenn- zeichnet.
Die Identitätstheorie orientiert sich an Inhalten und Zielen. Begrifflichkeiten - beispielsweise der Gemeinwille - stehen bei Rousseau im Mittelpunkt. Ausführungen darüber, wie das Regierungssystem konkret aussehen soll, fehlen. Interessenkonflikte, die in der Wirklichkeit unvermeidlich sind, werden von Rousseau nicht akzeptiert.
Mit den Spielregeln eines Regierungssystems beschäftigt sich die Konkurrenztheorie. Mill folgt dem Ideal einer erfahrungswissenschaftlich fundierten Theorie und versucht, seine Demokratietheorie auf die Wirklichkeit auszurichten.
Zu diesem Punkt läßt sich zusammenfassend sagen, daß die Identitätstheorie eine finalistische, die Konkurrenztheorie eine formalistische Orientierung besitzt.
Nachdem nun die Grundsätze der Identitäts- und Konkurrenztheorie der Demokratie erörtert wurden, folgt jetzt deren Beurteilung.
Zu den Vorteilen der Konkurrenztheorie gehört die Aussicht auf politische Innovation durch mögliche Machtwechsel. Die Oppositionschance ist im Falle der Identitätstheorie gar nicht erfaßt, denn „[w]enn sich [...] bei Abschluß des Gesellschaftsvertrages Gegner ergeben, so wird durch ihre Opposition der Vertrag nicht ungültig, sie werden nur von ihm ausgeschlos- sen.“
Außerdem bietet die Konkurrenztheorie politische Stabilität, Leistungsfähigkeit, Überlebens- fähigkeit sowie eine offene und für Wähler gut nachprüfbare Machtverteilung, Zuständigkeit und Rechenschaftsfähigkeit. So hat Mill in seinen Regeln für eine ideale Repräsentativverfas- sung verankert, daß sich die Repräsentativversammlung nur auf ihre Kernfunktionen be- schränken muß und daß die Autorität besonders in der Exekutiven liegen soll. Vorteile für die Identitätstheorie zu finden, das ist äußerst schwierig. Zweifelsohne hat sie einen demokratischen Anspruch, aber sie ist zu utopisch, um in die Wirklichkeit umgesetzt zu werden, und birgt viele Gefahren in sich.
So ist die Identitätstheorie eine „totalitäre“ Demokratie. Sie eignet sich zur Rechtfertigung der Diktatur, wenn die Idee von einer Identität von Regierenden und Regierten von der Führung dazu benutzt wird, daß nur sie das Recht hat, den Volkswillen zu artikulieren. Der Versuch, die Einheit des Volkes zu erzwingen, kann ebenso in totale Herrschaft umschlagen, wenn die Führung den Gemeinwillen festlegt und die Menschen zu ihrem Glück gezwungen werden sollen.
Das kann einerseits zu einer autoritären Staatslehre, deren Extremfall der Führerstaat ist, und andererseits zur radikalen Demokratie, deren Extremfall wiederum die kommunistische Diktatur darstellt, führen.
Auch bei der Konkurrenztheorie verfügt die jeweilige Mehrheit zwischen den Wahlterminen über einen großen Spielraum, der mißbraucht werden kann. Mill plädiert deshalb für eine be- grenzte Amtsdauer zwischen zwei und fünf Jahren. Dieser Zeitraum scheint Mill angemessen, damit der Abgeordnete nicht das öffentliche Wohl vergißt, aber auch Gestaltungschancen hat. Auch wenn der Abgeordnete den Volkswillen in angemessener Weise repräsentiert, können fehlende plebiszitäre Elemente zur Resignation innerhalb der Bevölkerung führen, weil diese das Gefühl hat, nicht am politischen Entscheidungsprozeß teilnehmen zu können.
Außerdem ist es im Fall der Konkurrenztheorie möglich, daß die Mehrheit sich auf Kosten des einzelnen verselbständigt und so demokratische Spielregeln angetastet und unveräußerliche Menschenrechte verletzt werden. Gegen die „Tyrannei der Mehrheit“ weiß Mill ein einfaches Prinzip: „Der einzige Zweck, der die Menschen, individuell oder kollektiv, berechtigt, in die Handlungsweise eines der ihren einzugreifen, ist Selbstschutz. Die einzige Absicht, um derentwillen Macht rechtmäßig über irgendein Mitglied der zivilisierten Gemeinschaft gegen seinen Willen ausgeübt werden kann, ist die, eine Schädigung anderer zu verhindern. Sein eigenes physisches oder moralisches Wohl ist kein ausreichender Grund.“ Leider ist dieses „Prinzip“ nicht so einfach in die Realität umzusetzen.
Ein weiterer Schwachpunkt der Identitätstheorie ist eine mögliche Usurpation bzw. widerrechtliche Aneignung der Macht durch Parteioligarchie.
Aber auch bei der Konkurrenztheorie kann es zu einem Elitenpluralismus kommen, denn bestimmte gesellschaftliche Gruppen haben immer weit mehr Macht und Chancen, an der staatlichen Herrschaft teilzunehmen als andere. Zur Zeit Mills hatte z.B. das Bildungsbürgertum weit mehr Einfluß als die Armen. Noch heute können bestimmte gesellschaftliche Gruppen ihre Interessen kaum oder gar nicht im politischen Prozeß zum Ausdruck bringen und durchsetzen, weil sie diese nicht organisieren können.
Die Identitätsdemokratie kann zudem zu einer Erziehungsdiktatur führen, weil sie den Men- schen bestimmte Werte aufzwingt. Die Konkurrenzdemokratie muß sich dagegen den Vor- wurf des reinen Pragmatismus gefallen lassen, weil ihr Werte fehlen. Darüber hinaus nimmt sie den status quo einfach hin. Im Gegensatz zur Identitätsdemokratie mangelt es ihr deshalb vielleicht an Illusionen, die nötig sind, um eine Gesellschaftsordnung wirklich verändern zu können.
Die zwanghafte Gemeinwohlorientierung ist auch ein Kritikpunkt der Identitätstheorie. Die Volkssouveränität wird verabsolutiert; es gibt kein Individualrecht mehr. In der Konkur- renztheorie ist dagegen das Vorherrschen von Privatinteressen, die das Allgemeinwohl ein- schränken können, kritikwürdig. Interessenkonflikte stärken zwar den kompetitiven und kon-fliktorischen Charakter der Politik, aber in manchen Fällen kann das auch destabilisierend wirken.
Da in der Identitätstheorie keine Sonderinteressen akzeptiert werden, gibt es folglich auch keinen Minderheitenschutz. Auch die Konkurrenztheorie besitzt häufig nicht die Fähigkeit, Minderheiten zu integrieren.
Zu Rousseaus Fehlleistungen gehört fernerhin, daß er vom Vorbild der griechischen Stadtstaaten in der Antike und der Schweizer Kantone im Spätmittelalter ausgeht. Diese Vorbilder waren kleinräumige Staatswesen, und auch dort konnte nur ein Teil der Bevölkerung - die Vollbürgerschaft - politische Entscheidungen treffen. Nur dort waren die Bürger fähig, einigermaßen sachkundig über die Politik ihres Staates zu entscheiden, nur dort konnten Volksversammlungen und -abstimmungen fast permanent stattfinden. Zu Rousseaus Zeiten sind solche idealen Zustände bereits illusorisch.
Mill geht hingegen davon aus, daß die Bevölkerung eines Flächenstaates aufgrund ihrer Größe und Verschiedenheit nicht in der Lage ist, qualifizierte politische Entscheidungen zu treffen.
Er entwickelt ein höchst exklusives, nach Würdigkeit gestaffeltes Wahlrecht, weil das Reprä- sentativsystem „eine Tendenz zur kollektiven Mittelmäßigkeit [hat], die durch jede Herabset- zung der Wahlrechtsvoraussetzungen und jede Erweiterung des Wahlrechts noch verstärkt wird, da diese Maßnahmen darauf hinauslaufen, die Staatsgewalt zunehmend in die Hände von Klassen zu legen, die weit unter dem optimalen Bildungsstand der Gesellschaft stehen“.
Außerdem befürwortet Mill die öffentliche Stimmabgabe. Heute hat sich das Argument durchgesetzt, daß die geheime Wahl eine von Fremdeinwirkungen unbeeinflußte Stimmab- gabe gewährleistet. Die Wahlen sind allgemein, gleich, frei, geheim und direkt. So viele Kritikpunkte die Identitäts- und Konkurrenztheorie auch aufweisen, entscheidend ist am Ende ihre Praktikabilität. Dazu läßt sich sagen: In den Industrieländern (z.B. Frankreich, Großbritannien, USA, Australien) ist die Konkurrenztheorie noch heute weitverbreitet. Die Identitätstheorie diente und dient noch in die Gegenwart faschistischen Diktaturen und totali- tären Demokratien zur Rechtfertigung. Sie ist nie wirklich umgesetzt worden. Tatsache ist, daß sich Rousseau in seinen Verfassungsvorschlägen für Korsika (1764) und Polen (1772) ziemlich weit von seiner Theorie entfernte.
Literatur:
Beck, Reinhart: Sachwörterbuch der Politik. 1. Auflage. Stuttgart: Kröner, 1977.
Grundwissen Politik. 3. Auflage. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. Informationen zur politischen Bildung (1992): Demokratie. Bonn, 1992. Lieber, Hans-Joachim (Hrsg.): Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart.
2. Auflage. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1993.
Mantl, Wolfgang: Repräsentation und Identität. 1. Auflage. Wien: Springer 1975.
Rüther, Günther (Hrsg.): Repräsentative oder plebiszitäre Demokratie - eine Alternative?
1. Auflage. Baden-Baden: Nomos, 1966.
Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien. 2. Auflage. Opladen: Leske + Budrich, 1997. Waschkuhn, Arno: Demokratietheorien. München: Oldenbourg, 1998.
- Arbeit zitieren
- Adina Herde (Autor:in), 1998, Jean-Jacques Rousseau und John Stuart Mill: Identitäts- und Konkurrenztheorie der Demokratie im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104255
Kostenlos Autor werden


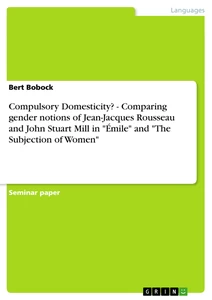
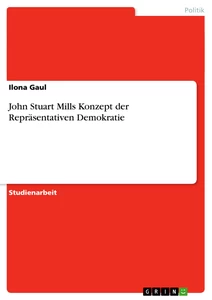




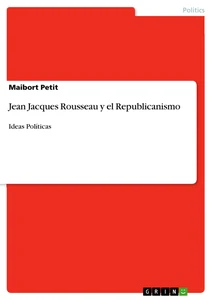













Kommentare