Leseprobe
Inhalt
1. Vorrede S
2. Erstes Buch
Treffen mit Raphael Hythlodeus
Kardinal Morton Episode
Berater am Hof
Der ideale Führungsstil
Neuerungen sind nicht durchsetzbar
3. Zweites Buch S Die Form
3.1. Von den Städten, namentlich von Amaurotum
3.2. Von den Obrigen
3.3. Von den Handwerken Freizeit
3.4. Vom Verkehr der Utopier untereinander Kolonien
3.5. Von den Reisen der Utopier
Produktionsüberschüsse
Wertlose Edelmetalle
Philosophie und religiöse Grundsätze
Vergnügen
Offen für Neuerungen
3.6. Von den Sklaven
Euthanasie
Heirat
Verbrechen und ihre Bestrafung
3.7. Vom Kriegswesen
Taktik
3.8. Von den religiösen Anschauungen der Utopier
Religionsfreiheit
Umgang mit Verstorbenen Die Priester
Tempel und Feiertage
Raphael und Thomas resümieren
Anhang Holzschnitt von Holbein
1. Vorrede
Thomas Morus bittet Peter Aegid in diesem Brief, einige Detailfragen an den Aufzeichnun- gen der gemeinsam gehörten Schilderungen des Raphael Hythlodeus zu berichtigen, denn er wolle auf keinen Fall unrichtiges Veröffentlichen. Auch bei der Publikationsfrage hofft Morus auf einen Rat von Aegid, denn hier ist er sich äußerst unschlüssig.
2. Erstes Buch
Das erste Buch und das zweite Buch enthalten, die in der Vorrede, dem Brief an Aegid, besprochene Unterha ltung zwische n Thomas Morus und seinem Freund Peter Aegid und dessen Freund Raphael Hythlodeus.
Morus schildert die Umstände, die ihn nach Antwerpen und damit zu den Treffen mit seinem Freund Peter und dem fremden Raphael führten. Raphael ist ein portugiesischer Philosoph, der Amerigo Vespucci auf drei seiner vier Weltreisen begleitete.
Nachdem sich die drei in Morus’ Wohnung begeben hatten, begann Raphael von seinen Re i- sen zu erzählen. Seine Zuhörer interessierten sich dabei vor allem für politische Praktiken anderer Völker.
Peter fragt Raphael, warum er denn mit all seiner Erfahrung und seinem Wissen nicht in den Dienst eines Königs trete, das sei zu seinem und zum Vorteil der Allgemeinheit. Raphael liebt seine Freiheit zu sehr und hält darüber hinaus zu wenig von einer Anstellung bei Hofe. Denn königliche Berater seien viel zu egoistisch und eitel um im öffentlichen Interesse und nach jemandes Rat zu handeln. Er führt England als Beispiel an. Bei einem Besuch dort traf er auch einmal Johannes Morton, Erzbischof von Canterbury, Kardinal und damals Lordkanzler von England, einen allgemein geehrten und respektierten Mann. Als Raphael bei ihm zur Tafel saß, löste ein Jurist, der den Brauch des Hängens von Dieben lobte, eine Diskussion über die angemessene Bestrafung dieses Verbrechens aus. Raphael verurteilt das englische Rechtssys- tem als zu streng und uneffektiv. Er gibt zu bedenken, dass viele Diebe keinem Beruf nach- kommen könnten, da sie häufig verstümmelt aus Kriegen heimkehrten und nun arbeitsunfä- hig, ihren alten Beruf nicht mehr ausüben könnten und für einen neuen zu alt seien. Deshalb bliebe ihnen nur der Diebstahl um ihre Existenz zu sichern und aus diesem Grund wirke die Todesstrafe auch nicht abschreckend.
Eine weitere und nicht unwesentliche Ursache für Diebstahl seien Englands Schafe, diese seien so gefräßig und wild geworden, dass sie ganze Länder und Städte verwüsten. Denn gie- rige Edelleute und Standespersonen vertreiben Bauern durch List und Gewalt von ihrem Pachtland, um es in Weidefläche für die wollegebenden Schafe zu verwandeln. Aus dem Ver- kauf ihres Hausrats erzielen die Vertriebenen kaum Erlös, sie sind also gezwungen zu stehlen. Wo früher viele Menschen nötig waren, um das Land zu bewirtschaften, reiche jetzt ein einzi- ger Schäfer. Wegen einer Viehseuche seien die Lebensmittelpreise gestiegen, aber trotz stei- gender Schafspopulation halte die Nobilität die Preise künstlich hoch. So treibe die unbarm- herzige Habgier Weniger das englische Volk ins Verderben. Schließlich formuliert Raphael seine Forderungen, als Konsequenzen aus diesen Missständen: er verlangt Gesetze, die Ver- mögende in ihren Landkäufen einschränken, und die Wiederbelebung der Landwirtschaft. Als der Rechtsgelehrte zu seiner Antwort ansetzen will, wird er von Kardinal Morton unter- brochen und auf ein nächstes Treffen vertröstet. Denn er möchte von Raphael wissen, warum er mit der Todesstrafe nicht einverstanden sei und welche Alternativen er sehe. Raphael legt dar, dass eine Bestrafung stets dem Unrecht entsprechen sollte dies sei bei Dieb- stahl nicht der Fall, denn menschliches Leben sei sehr viel gewichtiger als Eigentum. Und darüber hinaus verbiete schon Gottes Gebot den Mord, d.h. menschliches Recht dürfe nicht über göttliche Gebote gestellt werden, täte man dies, könne man auch Ehebruch und Meineid erlauben. Außerdem sei es unklug keine Unterscheidung bei der Bestrafung von Dieben und Mördern zu machen und schon die äußerste Bestrafung bei einem vergleichsweise geringen Verbrechen heranzuziehen. Raphael beric htet von seinen Erlebnissen bei den Polyleriten und schildert deren Umgang mit Dieben, diese würden zu Zwangsarbeit verurteilt, nachdem sie den Bestohlenen ihr Eigentum zurückgegeben haben. In leichten Fällen werden sie fessellos zu öffentlichen Arbeiten herangezogen, sie können aber auch von Privatpersonen gemietet werden. Die Gefangenen sind Sklaven und einheitlich gekleidet und haben eine Ohrmuschel gestutzt. Sie würden human behandelt, können aber mit dem Tod bestraft werden, sollten sie in den Besitz von Geld oder Waffen kommen, hingerichtet würden sie auch bei misslungenem und geplanten Fluchtversuch. Belohnung bzw. Freiheit aber erwarte den Freien oder Mitge- fangenen, der diese Verstöße zur Anzeige bringt. Raphael lobt diese Rechtsordnung, sie sei praktisch und menschlich, denn sie verhindere Verbrechen dadurch, dass sie die Menschen dazu zwinge sich richtig zu verhalten, ohne dass jemand getötet werde. Als Raphael vo r- schlägt dieses Verfahren auch in England einzuführen, fällt ihm der Jurist, heftig widerspre- chend ins Wort. Der Kardinal hätte nichts gegen einen Versuch dieser Methode, denn dem Staat entstünde kein Schaden, die Verurteilten könne man bei einem eventuellen Sche itern immer noch hinrichten. Damit schließt Raphael seine Schilderungen vom Besuch bei Kardinal Morton.
Morus wiederholt abermals die Vorteile für die Öffentlichkeit, die Raphaels Dienste unter einem Herrscher mit sich brächten, es sei „die Pflicht eines braven Mannes“1, und verweist auf Plato. Gerade Plato, erwidert Raphael, belege aber die Sinnlosigkeit, denn Herrscher ne i- gen dazu gute Ratschläge zu ignorieren.
Er stellt sich nun vor, ein Berater unter vielen am französischen Hof zu sein: die Ratgeber empfehlen dem König verschiedene politische Schritte, die helfen sollen seine Macht zu stär- ken und auszudehnen. Raphael ist überzeugt, er würde der einzige sein, der sich gegen sol- cherlei Vorhaben ausspräche und deshalb auch, als einziger unter vielen, wenig bedeuten. Als warnendes Beispiel führt er die Achorier an, deren König hatte ein anderes Reich erobert und sei nun in Schwierigkeiten es zu halten, denn die Unterworfenen lehnten sich auf und die folgenden Kämpfe führten zum Verfall auch des eigenen Landes und als Folge der Kriege, ein Verfall der Moral im Besonderen. Durch die Größe seines neuen Einflussbereiches ergab sich aber auch ein gleichmäßiges Sinken der Intensität seiner Zuwendung, und er war gezwungen sich für eines der Reiche zu entscheiden.
Raphael erklärt daraufhin den idealen Führungsstil, der solle friedlich nach Außen und mild nach Innen sein, notwendig dazu sei eine Konzentration allein auf das eigene Land. Morus gibt zu, dass Raphaels Erfahrungen und Vorschläge bei König und Beratern kaum zu einem Meinungsumschwung führen würden.
Er stellt sich nun einen Hof vor, an dem beraten werde, wie sich die Einnahmen in die Staats- kasse steigern ließen: es werde vorgeschlagen, den Geldwert nach Bedarf des Königs zu er- höhen oder zu senken, einen Krieg vorzutäuschen, vergessene Gesetze wiederzubeleben, um die Bußgelder bei Verstößen gegen diese einzunehmen, Privilegien zu verkaufen und die Richter zu bestechen. Die Vorschläge rühren von der Überzeugung der Berater her, dass dem König ohnehin alles Eigentum aller Untertanen und auch sie selbst ihm gehören. Sie empfeh- len das Volk arm zu halten, denn das mache es weniger anfällig für Aufruhr und das wieder- um sichere Macht. Raphael widerspricht hier, er glaubt, diese Art des Vorgehens sei eines Königs nicht nur unwürdig, sondern fatal, dennersei vom Volke abhängig, das seinen König ganz eigennützig wählt, denn es hoffe auf ein ungestörtes und gewaltfreies Leben. Armut und Unzufriedenheit aber bergen ein großes Konfliktpotential. Darüber hinaus sei es für einen König auch sehr viel ehrbarer, ein glückliches und wohlhabendes Volk zu regieren.
Raphael fährt fort mit den Schilderungen seiner Kenntnisse von den Verfassungsbestimmungen der Makarenser, deren König müsse bei seiner Thronbesteigung schwören, nie mehr als tausend Pfund Gold in seinen Kassen zu haben. Diese Bestimmung solle einen gesunden Geldverkehr im Volke siche rstellen, genügen um sich gegen Feinde zu verteidigen aber für selbstinitiierte Übergriffe auf andere Staaten nicht ausreichen.
Morus muss abermals feststellen, dass Raphaels Ausführungen sicher keinerlei Eindruck auf einen königlichen Berater mache n würden. Es sei völlig aussichtslos, Zustimmung bei Perso- nen zu finden, die völlig gegensätzlicher Überzeugung sind. Beide sind sich einig, dass sich Philosophie und Für stenhöfe nicht vereinbaren lassen können. Morus aber schränkt ein und stellt fest, dass die Philosophie zur rechten Zeit doch etwas auszurichten vermag. Morus meint, es sei Prinzip der Staatsführung, Dinge, die sich nicht zum Guten wenden ließen, zu- mindest weniger schlecht zu machen, dabei aber nie zu resignieren und den Staat aufzugeben. Raphael weist Morus’ Argumente zurück, denn er wolle die Wahrheit sprechen und nicht je- mandem gefallen, mit dem was er sage. Was Plato im „Staat“ beschreibt und was die Utopier praktizieren, würde in England als seltsam empfunden werden, obwohl es besser sei, denn dort gebe es, anders als hier, keinen Privatbesitz. Aber man könne nicht alles was einem selt- sam erscheint beiseite legen, täte man dies müsse man auch einen grossteil der christlichen Lehren ignorieren aber Christus verbat dies. Die Prediger aber passen seine Lehren zu sehr an bereits vorhandene Sitten an. Würde er sich, wie sie, im Rat eines Fürsten unter anderen Bera- tern verhalten, würde er zum Mittäter ihres Irrsinns. Plato habe Recht gehabt, als er sagte, dass die Weisen sich aus Staatsgeschäften heraushalten sollten. Raphael ist überzeugt, dass Privatbesitz das Grundübel sei, erst ohne Eigentum sei Gerechtigkeit und Glück möglich. Im Staat Utopia sei dieses Übel beseitigt, dort sei der Besitz gleichmäßig verteilt, Gleichheit im Besitz verhindere Mangel und Entbehrung für alle. Raphael Feststellung beruht auf der Ein- sicht, dass persönliche Besitzzuwächse nur möglich seien, wenn man anderen etwas von ih- rem Eigentum nehme.
Morus bezweifelt die Möglichkeit einer funktionierenden Lebensordnung in einer Gütergemeinschaft, er glaubt es müsse den Arbeitern an Motivation fehlen, denn es fehle doch auch die Entlohnung. Raphael aber verweist auf seine eigenen Erfahrungen in Utopia und behauptet: „nirgends anderswo ein wohl regiertes Volk gesehen zu haben außer dort“1. An diesem Punkt schaltet sich ein äußerst skeptischer Peter Aegid wieder in die Unterhaltung ein, er glaube nicht, dass es anderswo ein Volk in einem besseren Staat geben könne, denn das Alter der Kultur Englands mache dies schon schwierig. Er wird von Raphael berichtigt, dort habe es schon sehr viel früher Zivilisation gegeben als hier und außerdem sei man dort viel wissbegieriger, fleißiger und auch offener für Unbekanntes und Neues. Schiffbrüchige und deren Wissen werde auf ihren Nutzen für den Staat geprüft und bei Praktikabilität ohne Zögern angenommen. Dies mache ihr Staatswesen klüger und ihre Menschen glücklicher.
Morus wird neugierig und bittet Raphael ausführlichst über diese Insel zu berichten. Da gibt Raphael zu bedenken, dass dies eine Zeit dauern könne, man wird sich daher schnell einig, vorher noch etwas zu essen, um danach ungestört Raphaels Rede hören zu können.
3. Zweites Buch
Das zweite Buch enthält eine detaillierte Beschreibung Utopias und ihrer Bewohner. Die Insel (s. Abb. im Anhang) hat die Form eines zunehmenden Mondes, mit einem Durchmesser von etwa zweihundert Meilen, sie besitzt eine breite und durch natürliche Hindernisse, für Feinde gefährliche Bucht, auch der Rest der Insel ist durch diese Hindernisse für Fremde so gut wie nicht zugänglich. Die Insel erhielt ihren Namen von ihrem Eroberer, König Utopus. Er ließ die ehemalige Halbinsel vom Festland trennen.
3.1. Von den Städten, namentlich von Amaurotum
Auf der Insel gibt es vierundfünfzig Städte, die sich in Aussehen, Einrichtungen etc. alle gle i- chen. Ihre landwirtschaftliche Nutzfläche ist jeder Stadt planmäßig zugeteilt. Nach zwei Jah- ren in der Landwirtschaft dürfen die Bauern zurück in die Städte und werden von anderen Städtern im Ackerbau ersetzt. Die Stadt stellt alle benötigten Geräte und auch zusätzliche Ern- tehelfer.
Amaurotum liegt in der Mitte des Landes und genießt als Hauptstadt und Residenz des Senats das größte Ansehen. Dort beraten einmal im Jahr die drei Ältesten jeder Stadt über die Belan- ge der Insel. Die Häuser, deren Türen nicht verschließbar sind, werden alle zehn Jahre ge- wechselt, dabei entscheidet das Los. Jedes Haus ist dreistöckig, aus Stein und hübsch. Die Utopier haben viel Erfolg und Freude an der Kleingärtnerei, in der es auch einen gewissen Wettstreit untereinander gibt.
3.2. Von den Obrigen
Je dreißig Haushalte wählen einmal im Jahr einen Vorsteher, den Phylarchen (Syphogranten), je zehn Phylarchen, ist ein Tranibore (Protophylarch) vorgesetzt. Alle Phylarchen wählen aus vier vom Volk bestimmten Kandidaten, geheim, einen Fürsten auf Lebenszeit. Der Fürst berät sich regelmäßig und bei Bedarf mit den Traniboren über Staatsangelegenheiten. Bei diesen Sitzungen sind stets auch jedes Mal zwei andere Phylarchen zugegen. Außerdem sind Mechanismen installiert, die Tyrannei durch Fürst und Traniboren vorbeugen sollen.
Politische Entscheidungen werden erst nach gründlicher Beratung, im Senat, getroffen. Er debattiert erst einen Tag nach Einbringung des Antrages über diesen, um voreiligen und un- überlegten Beschlüssen vorzubeugen, die von menschlichen Charakterschwächen ausgehen.
3.3. Von den Handwerken
Alle Männer und Frauen werden schon in der Kindheit an die Landwirtschaft herangeführt. Später erlernt dann jeder, einen meist handwerklichen Beruf, die Frauen in leichter und die Männer in schwererer Arbeit. In der Regel wird das väterliche Handwerk angenommen. Möchte jemand einen anderen, als den vom Vater ausgeführten Beruf ergreifen, wechselt er in eine Familie, in der dieser Beruf ausgeübt wird. Es besteht die Möglichkeit mehr als einen Beruf zu erlernen, dann muss aber dem von der Stadt dringender benötigten nachgegangen werden.
Es wird nicht mehr als sechs Stunden täglich gearbeitet, drei am Vor- und drei am Nachmittag, unterbrochen von Schlafens-, Essens- und Freizeit. Letztere muss sinnvoll, z.B. zum Studium oder Fortbildung, d.h. auf keinen Fall zum Faullenzen genutzt werden. Viele Personen, aller Stände nehmen aus eigenem Interesse und nicht, weil sie als Wissenschaftler dazu gezwungen sind, freiwillig an Vorlesungen teil.
Gegessen wird miteinander, in öffentlichen Hallen, in denen man seine Freizeit, auch, z.B. mit Musik, Sport, Gesprächen oder tugendfördernden Spielen verbringen kann. Trotz des kur- zen Arbeitstages wird mehr produziert als verbraucht wird, denn die gesamte Bevölkerung arbeitet, es gibt keine untätigen Priester und Adligen, also keine Verbraucher, die nichts pro- duzieren. Außerdem gibt es keine Luxusgüter, alles, so auch die Kleidung, ist vor allem zweckmäßig und einheitlich.
Von körperlicher Arbeit ausgenommen sind allein die Phylarchen und Personen, die zu Studienzwecken befreit wurden, sie wurden oft schon in der Kindheit als begabt erkannt und gefördert. Ein Aufstieg in die Intellektuellenklasse ist jedem Arbeiter grundsätzlich möglich, der sich in seiner Freizeit fleißig fortgebildet hat. Und vom Intellektuellen kann man zum Gesandten, Priester, Traniboren und schließlich zum Fürst aufsteigen.
Ziel des Staates und Sinn dieser Wirtschaftspolitik ist es, den Bürgern soviel Freizeit wie möglich zu gewähren, denn in ihr glauben sie, liege das wahre Glück.
3.4. Vom Verkehr der Utopier untereinander
Es wird versucht die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Sollte sie aber doch zu stark an- wachsen, werden Kolonien auf dem Festland gegründet, um die Hauptinsel zu entlasten, sie werden nach heimischen Vorbild angelegt. Sollten sich die Festländer weigern, das von den Utopiern ausgesuchte Land freizugeben, führen sie Krieg, der, davon sind sie überzeugt ge- recht sei, denn sie beanspruche n nur Nutzland, das von den eigentlichen Eigentümern unbe- wirtschaftet ist, auf das sie aber angewiesen sind. Die Kolonien erfüllen aber noch eine andere wichtige Funktion, nämlich den Rückfluss auf die Insel bei Bevölkerungsrückgängen, denn die Insel und ihre Städte haben Priorität. Das Familienoberhaupt ist der Älteste, danach folgt der Mann, dann die Frau und das Kind, das seinen Eltern untergeordnet ist.
Auf dem Markt der Stadt fordert der Älteste aus einem Speicher an, was er für seine Familie braucht und erhält es, ohne Gegenleistung.
Vieh wird von Sklaven geschlachtet und verwertet, um die Bürger vor Verrohung zu bewah- ren, sie besorgen auch alle anderen schmutzigen und mühsamen Arbeiten. Es wird zu festen Zeiten, in großen Gemeinschaftshallen zu Mittag und zu Abend gegessen. Besonders die Abendessen sind große soziale Ereignisse, weshalb auch kaum jemand zu Hau- se isst. Bei den Abendessen wird vorgelesen, musiziert und sich unterhalten. Die Erfahrenen halten Reden und, um sich ein Bild von ihren Fähigkeiten zu machen, fordern sie auch die Jungen auf zu reden. Alles in allem ist die Stimmung fröhlich ausgelassen, man ist heiter, gesellig und vergnügt.
3.5. Von den Reisen der Utopier
Es ist problemlos möglich Urlaub zu bekommen. Ein Wagen und ein Sklave, für die Reise werden gestellt, abgesehen davon wird nichts weiter mitgenommen, denn alles Nötige steht am Reiseziel zur Verfügung, denn auch am Urlaubsort und an den Reisestationen geht der Urlauber seinem Gewerbe nach. Es wird nicht allein und schon gar nicht ohne fürstlichen Urlaubsschein gereist, Verstöße ziehen schlimme Strafen nach sich. Spaziergänge dagegen sind schon mit Erlaubnis des Hausvaters gestattet.
Die großen, absichtlich erwirtschafteten Produktionsüberschüsse begründen sich mit der Unmöglichkeit zu faulenzen und seine Zeit gewissermaßen zu verschwenden. Über die Verwendung dieser Überschüsse der Bezirke, wird alljährlich beraten und beschlossen, um damit gegebenenfalls den Bedarf anderer Bezirke auszugleichen. Es werden für zwei Jahre Vorräte gespeichert, was davon immer noch überschüssig ist, wird im Ausland, den Armen geschenkt und preiswert verkauft. Mit den Gewinnen aus diesen Verkäufen wird vor allem Eisen importiert, denn daran herrscht der größte Mangel.
Gold und Silber gelten bei ihnen als wertlos, denn sie sind, anders als Eisen, entbehrbar. Sie glauben, da diese Edelmetalle, durch die Natur, so schwer zugänglich sind, seien sie auch nicht unbedingt nötig zum Leben. Um die Bürger davon abzuhalten, gefallen an diesen Metal- len zu finden, werden aus ihnen Nachttöpfe u.Ä. hergestellt. Außerdem werden Verbrecher am ganzen Körper mit Gold „geschmückt“ und ihnen goldene Ketten angelegt. So gilt Gold nicht nur als unnötig, sondern auch als Metall der Schande und Verachtung. Perlen, Diaman- ten u.dgl., werden Kindern zum Spielen gegeben, die prahlen zwar damit, legen sie aber schandvoll mit dem Alter wieder ab. Daher ist es ihnen unbegreiflich, warum Gold und Edel- steinen im Rest der Welt, so großer Wert beigemessen wird. Sie verstehen auch nicht, wie man zu großen Ehren und Ansehen gelangen kann, bloß weil man zufällig viel Geld besitzt.
Unabhängig von der Alten Welt, haben die Utopier in der Musiktheorie, der Dialektik, der Astrologie und im Zählen und Messen die selben Entdeckungen gemacht und sind etwa auf dem gleichen Stand. In der modernen Dialektik, liegen sie aber weit zurück. Sie machen sich auch Gedanken über die Ursachen verschiedener Naturereignisse, über das Entstehen der Welt, über Vorgänge in der Natur usw., können aber auch keine befriedigenden Erklärungen vorweisen. Sie suchen auch nach den Lösungen der selben philosophischen Probleme, z.B. nach den Gütern der Seele und des Körpers, dem Wesen von Tugend und Vergnügen, außer- dem fließen in ihre philosophischen Betrachtungen immer auch folgende religiöse Grundsätze mit ein: die Unsterblichkeit der Seele, Belohnung und Bestrafung für gute bzw. schlechte Ta- ten, nach dem Leben. Diese Grundsätze sind zwar religiöser Natur, entspringen aber der Ver- nunft, denn anders ließen sich die Freuden und Schmerzen im Leben nicht begründen. Vor allem aber versuchen sie die Ursachen der menschlichen Glückseeligkeit zu erforschen, ihr wesentlichster Bestandteil sei das tugendhafte Vergnügen. Tugendhaft handeln, heißt natur- gemäß handeln, heißt vernünftig handeln. Den Menschen, mit denen man in natürlicher Ge- meinschaft lebt, bringe man aufgrund eigener Glückseeligkeit, Nächstenliebe und Mensch- lichkeit entgegen.
Es gibt zwei Arten von vergnügtem, angenehmen Leben, zum einen das moralische, das man so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen sollte, und zum anderen das unmorali- sche, von dem man sich und andere fern halten sollte. Das moralische Vergnügen müsse na- turgemäß Ziel aller Handlungen sein. Teilung der Lebensgüter, sei die materielle Grundlage des Vergnügens, gesetzlich erlassen, von einem wohlgesinnten Für sten oder von einem freien Volk beschlossen. Es sei klug für sich selbst zu sorgen, Pflicht sei es anderen zu helfen. Es sei Unrecht, das eigene Vergnügen vor das anderer zu stellen, Güte und Menschlichkeit aber ge- bieten, das Vergnügen anderer, vor das eigene zu stellen. Daraus könne man, durch die Be- friedigung Gutes getan zu haben, außerdem, große Freude und Vergnügen für sich selbst zie- hen. Vergnügen, sei alles, was von Natur aus, Körper und Seele in einen beha glichen Zustand zu versetzen vermag, das schließe Ungerechtigkeit, Mühe und Arbeit aus. Ausgeschlossen seien ebenfalls unnatürliche Vergnügen, sie würden die Glückseeligkeit verhindern, es seien Scheinvergnügen, dazu zählen: Eitelkeit, Überheblichkeit und Arroganz. Beispiel hierfür sei- en Personen, die sich aufgrund ihrer Kleidung, der Fülle ihrer materiellen Güter wegen oder sich angesichts ihrer Abstammung, für bessere Menschen hielten (der Adel). Ansonsten sind auch Glücksspiel und Jagen Scheinve rgnügen. Die Jagd sei so verabscheuungswürdig, da zum
Vergnügen und nicht aus Notwendigkeit getötet werde, dies sei gegen die menschliche Natur, denn nichts sei menschlicher als Mitleid. An all diesen Vergnügen sei von Natur aus nichts erfreuliches, sie entsprängen verkehrten Gewohnheiten der Menschen.
Die echten Vergnügen werden unterschieden, in die der Seele und die des Körpers. Seelische Vergnügen sind die Wahrheit und die Hoffnung auf das künftige Heil. Körperliche Vergnü- gen sind Essen, Trinken, Leeren von Blase und Darm, Geschlechtsverkehr, sich Kratzen, Mu- sik, Sinneswahrnehmungen, Schmerzfreiheit und ganz besonders wichtig, weil Vo raussetzung von Vergnügen: die Gesundheit. Die wichtigeren Vergnügen seien aber die seelischen, denn sie entsprängen der Tugend und Rechtschaffenheit, die körperlichen dagegen, müssten nur die Gesundheit aufrechterhalten. Nirgends gebe es ein fleißigeres und gesünderes Volk und nir- gends einen glücklicheren Staat und niemand sei agrarwirtschaftlich so erfolgreich.
Ihre große Auffassungsgabe und Interesse zeigten sich, als man sie mit der griechischen Lite- ratur vertraut machte, sie lernten fleißig, schnell und leicht. Raphael stattete die Insel mit den Standartwerken der griechischen Literatur aus. Sie schätzen diese Bücher sehr. Außerdem hat er zwei technische Erfindungen auf die Insel gebracht: den Buchdruck und die Papierherstel- lung. Be ides konnte Raphael den Utopiern nur im Ansatz vermitteln, sie schlossen dann aber von selbst auf die Verfahren. Und von beidem wird sehr stark Nutzen gemacht, Bücher wer- den in hohen Auflagen gedruckt.
Die Insulaner sind sehr offen für Besucher und deren Wissen, durch ihren Handel, besuchen sie auch andere Völker, die sie hoffen besser kennen zu lernen.
3.6. Von den Sklaven
Fremde können als Kriegsgefangene zu Sklaven werden, falls ihr Volk, den Krieg angefangen hat oder auch zum Tode verurteilte anderer Staaten. Utopier, die nach einem Verbrechen zur Sklaverei verurteilt wurden, erfahren die härteste Behandlung, denn ihnen wird vorgeworfen, sich trotz bester äußerer Voraussetzungen eines Verbrechens schuldig gemacht zu haben. Knechte anderer Völker, die sich freiwillig in die Sklaverei begeben, werden hingegen äußerst human behandelt, ihnen steht es auch frei, jederzeit wieder zu gehen. Das Sklaventum wird nicht an die Nachkommen vererbt.
Die Kranken werden aufopfernd und mitfühlend gepflegt, es wird alles für ihr Wiedergenesen getan. Unheilbar Kranken wird von Priestern und Senat zur Sterbehilfe geraten, denn sie seien nur noch eine Last für die Anderen und auch für sich selbst, ihren beruflichen Pflichten könnten sie auch nicht mehr nachgehen. Es wird aber niemand gezwungen sich durch Fasten oder Medikamente umzubringen oder umbringen zu la ssen. Suizid, d.h. Tod ohne Zustimmung von Priestern und Senat ist verpönt, die Suizidenten bleiben unbegraben.
Frauen heiraten nicht vor dem achtzehnten, Männer nicht vor dem zweiundzwanzigsten Le- bensjahr. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist verboten und wird mit einem Eheschließungs- verbot bestraft. Um eine Heirat mit einem körperlich mangelhaften Partner auszuschließen, begutachten sich die zukünftigen Eheleute nackt. Geschieden werden Ehen, für gewöhnlich, nur vom Tod, sonst sind Scheidungen nur mit Erlaubnis des Senats möglich. Begründet wer- den muss der Scheidungswunsch mit Charakterfehlern des Partners, bei Inkompatibilität bei- der, dürfen sie, wenn beide neue Gefährten gefunden haben, mit diesen eine neue Ehe einge- hen.
Ehebruch wird mit Sklaverei bestraft, geht aber der oder die Betrogene, aus immer noch wäh- render Liebe, freiwillig mit in die Sklaverei, so könnten sie eventuell, aus Mitleid, vom Für s- ten begnadigt werden. Sollte der Ehebrecher aber rückfällig werden, so wird er zum Tode verurteilt.
Für andere Verbrechen sind keine bestimmten Strafen festgesetzt, der Senat entscheidet in jedem einzelnen Fall über die Schwere der Strafe, die der Schwere des Verbrechens angepasst ist. Die Höchststrafe ist die Sklaverei, die, der Todesstrafe, aufgrund ihres Nutzens für den Staat (Arbeitskraft) und, wegen ihres abschreckenden Beispiels, vorzuziehen ist. Delinque n- ten, die sich gegen den Vollzug der Strafe sträuben, werden totgeschlagen, alle anderen haben Hoffnung auf Begnadigung durch den Fürsten, sofern sie Reue für ihre Taten zeigen. Nicht nur durch Bestrafung, sondern auch durch die Aussicht auf Ehrung, wird versucht, die Bevöl- kerung von Vergehen abzuhalten und zur Tugend hinzuführen. Es gibt kaum Gesetze und die, die sie haben sind leicht verständlich und werden immer grob ausgelegt, denn dies sei die richtigste Auslegung. Vor Gericht vertritt sich jeder Beklagte selbst, Anwälte sind nicht zuge- lassen, man glaubt, ohne ihre Spitzfindigkeiten gelange man schneller an die Wahrheit, und das sei es schließlich, was man vor Gericht bezwecken wolle. Sie werden sogar von Nachbar- völkern gebeten, sie bei ihrer Staatsführung zu unterstützen, denn auch sie wissen, dass „Heil und Verderben des Staates von dem Betragen der Obrigkeiten abhängt“1, die Utopier sind nämlich zu tugendhaft, um sich bestechen zu lassen und zu unbefa ngen, denn sie sind fremd, um sich beeinflussen zu lassen. Sie schließen mit keinem Volk Bündnisse, denn sie glauben, dass die menschliche Natur als bindende Gemeinsamkeit genüge, sie sei darüber hinaus sogar noch fester und wirksamer.
3.7. Vom Kriegswesen
Die Utopier verabscheuen zwar den Krieg, Kriegsgründe wären aber: der Schutz ihrer Gren- zen, die Verteidigung ihrer Freunde, Befreiung eines von einem Tyrannen unterdrückten Vo l- kes, aus Mitleid und Menschenliebe, um sich und befreundete Staaten zu rächen und, um Un- recht, das Freunden in Fremden Staaten angetan wurde zu korrigieren, letzteres tun sie sehr engagiert. Ihnen selbst angetanes Unrecht, rächen sie mit dem Abbruch der Handelsbeziehungen, zum entsprechenden Volk, wenn sie nur materiellen Schaden erlitten haben, denn sie halten es für grausam, diese Art Schaden physisch zu sühnen.
Wird einem ihrer Staatsangehörigen im Ausland ein körperlicher Schaden zugefügt oder sogar das Leben genommen, verlangen sie nach Prüfung des Falles, die Auslieferung der Schuldigen, um sie mit dem Tod oder mit der Sklaverei zu bestrafen.
Aufgrund ihrer Friedfertigkeit, versuchen sie, die Opfer im Krieg auf beiden Seiten so gering wie möglich zu halten. Daher legen sie größtes Gewicht auf die Taktik, d.h. in ihrem Fall, Terrorismus: sie spielen gegnerische Fürstenhäuser gegeneinander aus, setzen hohe Kopfge l- der auf die gegnerischen Fürsten und ihre Feinde aus, und versprechen Straflosigkeit für Ü- berlä ufer. Sinn dieser Taktik sei die Einschüchterung und Verunsicherung des Feindes, dies verkürze den Krieg und schone das unschuldige Leben des einfachen Volkes, das nur Spie l- ball ihrer Fürsten sei. Mit ihrem riesigen Vermögen heuern sie Söldner an, die anstatt ihrer Landsleute in den Krieg ziehen. Für den Notfall haben sie aber noch ihr gesamtes Volk, das bedeutet, sowohl Männer als auch Frauen, als Reservisten, die regelmäßig für den Erns tfall trainieren. Aber bevor sie ihre eigenen Bürger einziehen, rufen sie erst Söldner und dann Truppen befreundeter Staaten zu den Waffen. Niemand wird zum Kriegsdienst außerhalb U- topias gezwungen. Die Utopier kämpfen mutig, entschlossen, taktisch, weitsichtig, vorsichtig und hinterhältig. Erkennen sie ihre Unterlegenheit, ziehen sie sich zurück. Geschlossener Waffenstillstand wird von ihnen niemals gebrochen. Auch wird feindliches Land von ihnen nicht zerstört und eroberte Städte nicht geplündert. Wehrlose und Zivilisten werden nicht ge- tötet, Anführer und Verteidiger dagegen schon. Deren Vermögen wird an die Hilfstruppen und an Bürger, die zur Kapitulation rieten verschenkt, denn die Utopier begehren keine Beute. Von den Besiegten fordern sie Reparationen und Land, das sie dort verwalten. Einen Krieg im eigenen Land versuchen sie um jeden Preis zu verhindern.
3.8. Von den religiösen Anschauungen der Utopier
Man ist sich darüber einig, dass ein höchstes Wesen, Mythras, für die Schöpfung und Vorse- hung verantwortlich sei, darüber hinaus bestehen aber Glaubensunterschiede. Die Mehrheit, der „vernünftigste Teil“1, glaubt an ein mit dem menschlichen Verstand schwer fassbares, immaterielles Wesen. Nach dem Kontakt mit dem Christentum und seinen Lehren, traten vie- le hierzu über.
Jeder darf seine Religion frei wählen, auch Bekehrungen sind erlaubt. Es ist allerdings verbo- ten, da es zu Aufregung im Volk führt, andere Religionen herabzusetzen und die eigene über andere zu stellen. Endgültig wurde aber über die Religion nichts bestimmt, da man auf Utopia glaubt, Gott wolle auf die verschiedensten Weisen verehrt werden.
Alle Religionen müssen auf folgenden Grundsätzen fußen: die menschliche Seele lebt nach dem Tod weiter, göttliche Vorsehung, im Jenseits wird über das Leben im Diesseits gerichtet, d.h. Bestrafung für Sünden und Belohnung für Tugendhaftigkeit. Wer das Gegenteil glaubt, wird nicht mehr zu den Menschen gezählt, denn er selbst verneine die Einzigartigkeit und Überlegenheit der menschlichen Seele über das tierische Dasein. Daraus schließt man auf Utopia., außerdem eine Ablehnung aller bürgerlichen Einrichtungen und moralischen Grund- sätze, dieser Person. Da man ihr nicht traut und sie verachtet, wird sie auch für kein öffentli- ches Amt besetzt. Ein Ablehnen der religiösen Grundsätze, zieht aber keine Bestrafung nach sich, „weil die Utopier überzeugt sind, daß es niemand in der Hand hat, zu glauben, was ihm beliebt“1Es ist aber verboten diese Ansichten öffentlich zu äußern, im kleinen Kreis, vor Priestern und Intellektuellen, wird man dagegen geradezu hierzu aufgefordert, um eine Ein- sicht des Ungläubigen zu erreichen.
Der Umgang mit einem Verstorbenen nach seinem Ableben, ist davon abhängig, auf welche Weise er aus dem Leben tritt, tut er dies widerwillig und ängstlich, wird er schweigend und trauernd begraben, da man glaubt, er habe schon eine drohende Bestrafung im Jenseits erahnt. Stirbt aber jemand fröhlich, ohne sich an das Leben zu klammern, wird er ohne betrauert zu werden verbrannt. Die Bestattung ist festlich und freudvoll, auf seinem Grab wird ein Denkmal errichtet. Danach wird sich lange und ausgiebig an den Verstorbenen erinnert. Diese Art des Verfahrens mit den Toten soll die Lebenden dazu bewegen, tugendhaft zu handeln. Sie glauben, und das hält sie von heimlichen Untaten ab, dass die Toten unter den Lebenden umherwandeln, um in der Nähe ihrer lebendigen Freunde zu sein.
In jeder Stadt gibt es dreizehn Priester, pro Kirche einen, sie sind außerordentlich fromm, der Oberpriester ist allen anderen vorgesetzt. Sie (auch Frauen) werden, in geheimer Wahl vom Volk gewählt. Sie leiten den Gottesdienst, organisieren das religiöse Leben und sind als Sit- tenwächter aktiv. Kinder werden von Priestern in Moral und Wissenschaft unterrichtet, denn Tugend helfe die Staatsverfassung zu stabilisieren. Ihre Priester sind auch im Ausland hoch angesehen. Sieben der dreizehn pro Stadt, begleiten die Armee in den Krieg, während der Schlacht beten sie in der Nähe des Schlachtfeldes für Frieden und Sieg für ihr Volk. Wer sie von den Feinden sieht und ihnen zuruft, der wird ve rschont, wer sie berührt, der rettet damit auch sein Eigentum. Sie konnten die Kämpfe schon oft mildern und unterbrechen, um einen, für beide Parteien gerechten, Frieden herbeizuführen. Die wenigen Tempel, die schön und groß sind, sind Gotteshäuser für alle unterschiedlichen Religionsformen gleichzeitig, d.h. sie sind in ihrer Ausstattung auf die Grundbedürfnisse, die allen Religionen gleich sind, reduziert, besondere Bedürfnisse werden privat befriedigt. Auch die Gebete gehen inhaltlich nicht über die Themen, die Basis aller Religionen sind, hinaus, um keinen Anhänger einer Glaubensrich- tung auszuschließen.
Der Tempel ist an den Feiertagen, dem letzten und ersten Tag jedes Monats und Jahres, Ort von Festen, die in dieser Zeit bega ngen werden, es wird um Glück und Wohlergehen gebeten. Vor Betreten des Gotteshauses wir im Familienkreis gebeichtet, um unbelastet am Gottes- dienst teilnehmen zu können. Innerhalb der Kirche, wird aufgrund einer durchdachten Sitz- ordnung, sichergestellt, dass die Kinder aufmerksam und diszipliniert ble iben, um ihnen die „fromme Furcht vor dem Himmlischen einzuprägen, die der stärkste, ja fast der einzige An- sporn zur Tugend ist“1. Die Utopier opfern keine Tiere, denn sie glauben, es sei Gottes Wille, dass sie leben und sie opfern, wäre ein Verstoß gegen diesen. Der Ablauf des Gottesdienstes ist festgelegt, es wird Gottes Lob gesungen, gebetet, Gott für seine Güte und Wohltaten ge- dankt und um eine Aufnahme in das Himmelreich gebeten. Der Tag wird mit Spielen und militärischen Übungen beschlossen.
Damit schließt Raphael seine Schilderungen und lobt Utopias Staatsform, als die beste, da sie als einzige wirklich am Allgemeinwohl interessiert sei und die größten Sorgen und Nöte weg- fielen, die finanziellen nämlich. Er beklagt die Ungerechtigkeit der gegenwärtigen Umstände, in denen nützliche Arbeit, nicht gewürdigt, sondern mit schlechtem Verdienst und rentenlo- sem Alter bestraft werde. Aber ohnehin reiche Leute, deren Tätigkeit im Grunde nutzlos sei, lebten auf deren Kosten, sorgenfrei und im Überfluss, dies sei eine große Ungerechtigkeit und Missstand. Raphael beklagt außerdem die Machtkonzentration auf die reichen Bürger und vermutet eine Verschwörung, um ihr Eigentum zu halten und zu vergrößern und die Armen auszubeuten. Dem könne man nur mit der Abschaffung des Geldes begegnen und damit Ar- mut, Kummer und Sorgen beseitigen. Hochmut aber habe eine Verbreitung und Anwendung der utopischen Gesetze verhindert. Der utopische Staat, sei, weil so überaus stabil, von ewiger Dauer. Morus lobt die Verfassung der Utopier und Raphaels Erzählung, betont aber abschlie- ßend, dass er nicht allem zustimmen kann, aber einiges in seinem Staat gern umgesetzt sehen würde, aber an der Möglichkeit eines realen Versuchs einer Umsetzung, leider nicht glaube.
aus: Morus, Thomas: Utopia, Altsprachliche Ausgabe, Heft 16, hg. und bearb. von Dr. Joachim Klowski, 4.Aufl. 1991, Cornelsen Verlag Hirschgraben, Frankfurt a.M., S.104
Quellen:
Morus, Thomas:Utopia. 1999, Stuttgart
Morus, Thomas: Utopia, Altsprachliche Ausgabe, Heft 16, hg. und bearb. von Dr. Joachim Klowski, 4.Aufl. 1991, Cornelsen Verlag Hirschgraben, Frankfurt a.M
www.humanities.ualberta.ca/emls/iemls/work/chapters/utopsum.html
[...]
1Morus, Thomas:Utopia. 1999, Stuttgart, S. 41
1ebd. S.55
1ebd. S.113
1ebd. S.127
1ebd. S.131
1ebd. S.139
- Arbeit zitieren
- PAN (Autor:in), 2001, Utopia - Eine Zusammenfassung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103982
Kostenlos Autor werden
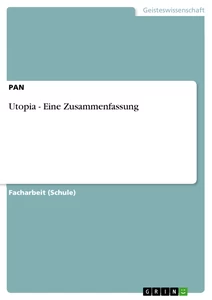








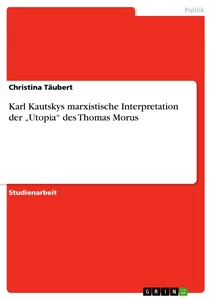








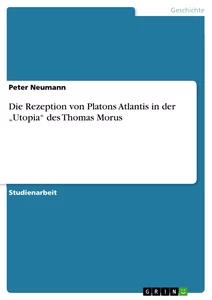

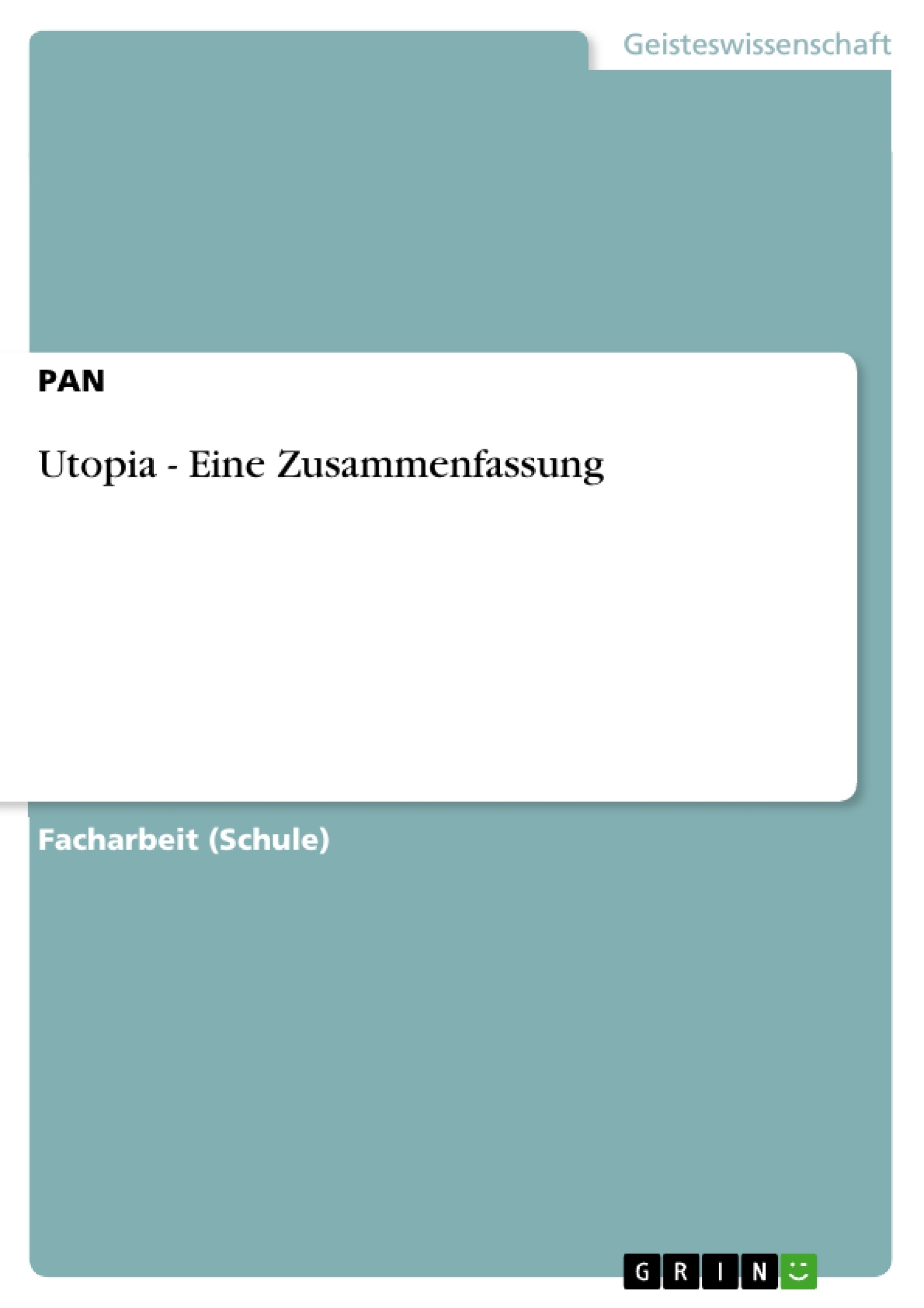

Kommentare
Utopia - Eine Zusammenfassung.
JUHU!! Da mir einfach nach 100 Seiten Nicht-Verstehens die Motivation fehlte, dieses Buch zu Ende zu lesen, habe ich das ganze Internet nach einer brauchbaren Zusammenfassung durchsucht. Endlich habe ich sie gefunden!
Dank an den Autor!!
Karin