Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Sprachwissenschaft im Umgang mit den neuen Medien
3. Alles spricht „ nur die einzig mögliche Sprache: die Sprache Gottes “
4. Anglizismen und ihr Einfluß auf die deutsche Sprache
5. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Mit dem neuen Browser bin ich zur coolen Homepage eines Providers gesurft, habe dann von einem ftp-Server ein bißchen Shareware gesaugt und mich über ein paar Links zur Site eines Modemherstellers weitergehangelt, mir dort noch ein paar aktuelle Treiber heruntergeladen und dem Webmaster eine E- Mail geschickt.“ (FAZ 5.12. 1988)
So lautet das Zitat am Anfang des Artikels „Schöne Grüße von Webmaster und Sysop“ in der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), in dem über den Einfluß der neuen Medien auf die Sprache berichtet wird. Computer, Internet und die deutsche Sprache sind längst zum Thema der Berichterstattung in den Medien geworden.
Stötzel zufolge kann der öffentliche Sprachgebrauch als prägend für private Sprecher angesehen werden. Die Presse dokumentiert, „welche Themenbereiche in einer Gesellschaft problematisch sind, bietet es zugleich dem Leser die Möglichkeit der Parteinahme und dem Sprachwissenschaftler die Grundlage für die Analyse der impliziten sprachlichen Bedingungen solcher Parteinahme.“ (1980: 40) Diese sprachlichen Bedingungen bestehen u.a. aus einem expliziten „Streit um Worte“ (S. 41), aus dem Gebrauch eines bestimmten Wortschatzes, der unterschiedliche Interpretationen eines Problemverhaltens und damit positive oder negative Bewertungen dieses Problemverhaltens zum Ausdruck bringen kann (die sog. semantischen Kämpfe [S. 42-43]), aus bestimmten Redestrategien, wodurch ein „manipulatives Sprechen“ (S. 44) entstehen könnte, aus der Zusammenstellung unterschiedlicher Bewertungsausdrücke von Sprechergruppen, damit der Leser den betreffenden Sachverhalt selbst interpretiert (S. 45), oder nur aus der Lieferung von Material für eine mögliche Thematisierung (S. 46). Dies zeigt eine pragmatische Richtung der Linguistik, in der Sprache nicht als bloß abstraktes Zeichensystem betrachtet wird sondern als Handeln. Sprachliche Handlungen sind Teil der intentional gesteuerten Interaktion, hängen mit konkreten Voraussetzungen der Lebenswelt der Sprecher zusammen und werden von sozialen Konventionen bestimmt (vgl. Stötzel, 1980: 39).
Nach Stötzel (1990) sind semantische Kämpfe in der Presse „wichtige Symptome für Orientierungskonflikte in einer Gesellschaft.“ (S. 45) „Im öffentlichen Sprachgebrauch kommen die Intentionen und Interpretationen gesellschaftlich wirksamer Kräfte zum Ausdruck, unabhängig davon, ob diese Kräfte bewußt den Sprachgebrauch zu beeinflussen versuchen.“ (Stötzel, 1995: 1) In der Öffentlichkeit wird mit Absicht versucht, „mit Hilfe des Wortgebrauchs und mit Hilfe bestimmter Argumentationen Handlungsorientierungen zu erzeugen.“ (S. 1)
Gestützt auf diese These und auf die oben genannte Information sind die folgenden Fragen in dieser Arbeit zu beantworten: Wie wird das Verhältnis zwischen Sprache und neuen Medien in Zeitungsartikeln thematisiert? Welche konkurrierende Interpretationsvokabeln entstehen in bezug auf dieses Thema? Welche Konzeptualisierungen kann man durch diese konkurrierenden Interpretationsvokabeln identifizieren? Inwiefern verdeutlichen bestimmte Redestrategien die Ideologie- und Interessengebundenheit der Autoren von den untersuchten Zeitungsartikeln? Wie werden bestimmte Bezeichnungen in den Artikeln auf- und abgewertet? Welche unterschiedliche Bewertungsausdrücke werden in jedem Zeitungsartikel zusammengestellt, damit der Leser die betreffende Tatsache selbst interpretieren kann? Was für Neologismen und Gelegenheitskomposita werden als Indiz für die Aktualität des Problems über Sprache und neue Medien oder als Ausdruck neuer Konzeptualisierungen und Verhaltensorientierungen erläutert?
Die rasante Entwicklung des Computers und Internet soll als geschichtlicher Hintergrund zur Erläuterung dieses sprachkritischen Themas dienen.1 Im Laufe der Analyse wird sich herausstellen, wie andere sprachkritische Themen wie etwa Fremdwort- oder Anglizismenkritik oder Klagen über Sprachverfall u.a. mit sprachkritischen Äußerungen über Computer, Internet und die deutsche Sprache in den untersuchten Artikeln verbunden sind.
Als Untersuchungsmaterial wurden sieben Artikel aus verschiedenen Zeitungen ausgewählt: „High-Tech-Deutsch: Ist die Gegenwartssprache noch »unser«?“ (Stuttgarter Zeitung [StZ], 26.03. 1994); „Begegnung mit dem Deutsch von morgen“ (Die Zeit, 19.05. 1995); „Am Computer kann man so richtig reden“ (Badische Zeitung [BadZ], 05.03. 1996); „Spracherkennungsdienste: Der ganz ‚Große Lauschangriff‘ der Computer“ (Süddeutsche Zeitung [SZ], 11.03. 1997); „Schöne Grüße von Webmaster und Sysop: Booten, scannen und chatten: Computer, Internet und die deutsche Sprache“ (FAZ, 05.12. 1998); „Die schriftliche Mündlichkeit: Mannheimer Tagung zum Thema ‚Sprache und neue Medien‘“ (StZ, 20.03. 1999); „Flockig mit Faustkeil oder PC: Wissenschaftler streiten sich um die Veränderung der Sprache durch die neuen Medien“ (SZ, 27.03. 1999).
Der Ausgangspunkt für die Textauswahl war vor allem die explizite Thematisierung von Sprache in diesen Artikeln. Die Analyse von nur sieben Zeitungsartikeln mag unzureichend sein. Es soll damit lediglich einen Einblick über die Auseinandersetzung in der Presse mit dem Thema Sprache und neuen Medien geben.
2. Die Sprachwissenschaft im Umgang mit den neuen Medien
Die 18. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, die 1996 in Freiburg stattfand, gab Anlaß zum Artikel „Am Computer kann man so richtig reden“ (BadZ, 05.03. 1996). Die Autorin, Bettina Schulte, berichtet über die Ergebnisse der Teilnehmer in Bezug auf das Thema der Tagung „Sprache und Schrift“, und von Anfang an scheint der Bericht „objektiv“ zu sein. Es lassen sich aber einige sprachkritische Äußerungen im Artikel identifizieren.
Der Satz in der Einleitung des Artikels „Wie kaum eine andere Wissenschaft muß sich die Linguistik losreißen vom alltäglichen Selbstverständlichen, um es aus der Entfernung betrachten zu können.“ (Z. 2-6) entspricht dem, was Stötzel (1980) als „realistische Diktion“ definiert:
Das bedeutet, daß in Aussageweisen wie „Das ist Berufsverbot“ der Benennungsakt, mit dem wir einen Wahrheitsanspruch und somit einen Anspruch bezüglich der Legitimität der Prädikation zum Ausdruck bringen, aufgrund des Fehlens reflexiver Ausdrücke (wie in: „Das nenne ich Berufsverbot“) nicht explizit bewußt gehalten wird. Diese Nichtpräsenz des Bewußtseins der Sprachvermitteltheit kann manipulativ im Sinne eines Sprachrealismus ausgenutzt werden. [...] Mit dieser Art der Bestimmung von manipulativem Sprechen wird eine psychologisch-intentionale Definition vermieden und „Manipulation“ an den Merkmalen der Redeweise und der Kommunikationssituation festgemacht. (S. 44)
Ein weiteres Beispiel dazu findet man an anderer Stelle des Artikels: „Die tiefgreifenden Unterschiede zwischen Sprechen und Schreiben liegen in der Tat auf der Hand: Die Rede fließt, die Schrift bestimmt sich aus den Zwischenräumen, den Leerstellen zwischen den Zeichen; [...] Rede ist analog, Schrift ist Digital.“ (Z. 34-43). Durch beide Beispiele werden die Ergebnisse der Berliner Philosophin Sybille Krämer, „daß das Geschriebene mit dem Gesprochenen so gut wie nichts zu tun hat. Denn das, was den mündlichen Vortrag mit ausmacht, Gestik, Mimik, Betonung, kommt in den Buchstaben nicht vor“ (Z. 26-31), mittels einer „realistischen“ Redeweise widersprochen und somit der Vorwurf gemacht, daß die andere Seite, die von Sybille Krämer, falsch berichtet. So scheint die Autorin, im Besitz der Wahrheit zu sein.
Bettina Schultes Stellungnahme gegen die Berliner Philosophin läßt sich im Artikel durch andere sprachliche Mittel erkennen, nämlich durch die Auf- und Abwertung bestimmter Bezeichnungen und die Distanzierung von einem bestimmten Sprachgebrauch. Sybille Krämer, die den Eröffnungsvortrag hielt, stellte eine „waghalsige These“ auf (Z. 26); „Als Advocata diaboli mit Blick von außen“ machte sie der Linguistik Vorwürfe (Z. 43-45), „Aber nicht nur das“ (Z. 48-49); „Die von der Philosophin kategorial eingeforderte scharfe Trennung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit scheint ... zu verschwimmen.“ (Z. 78- 84). Im Gegensatz dazu gab Friedrich Kronenberg (Osnabrück) „einen - zumindest für Nicht- Freaks - spannenden Einblick in die ‚Gesprächs’gepflogenheiten im Internet.“ (Z. 93-96) Außerdem wird über die Ergebnisse der Soziolinguistin Uta Quasthoff gewissermaßen „neutral“ d.h. ohne bestimmte Auf- oder Abwertungen berichtet. Vom Sprachgebrauch der Philosophin Krämer distanziert sich die Autorin mehrmals im Text: Krämer warf der Linguistik vor, „nur Systeme mit Lautbezug als Sprache ‚zuzulassen‘ [...]“ (Z. 43-46); im folgenden Beispiel wird diese Distanzierung noch deutlicher, indem in einem Zitat in indirekter Rede ein Begriff in Anführungszeichen eingeführt wird: „Die Flüchtigkeit des Mündlichen werde bei wissenschaftlicher Betrachtung zwangsläufig in ein schriftähnliches Objekt verwandelt, in einen Untersuchungsgegenstand, der mit dem ‚lebensweltlichen Phänomen‘ des Sprechens nicht viel zu tun habe.“ (Z. 49-56) Die Ergebnisse der anderen Tagungsteilnehmer, außer denen von Sybille Krämer, scheinen konkreter zu sein: Friedrich Kronenberg untersuchte Chatgespräche, Uta Quasthoff Faxe und E-Mails, und „der Freiburger Romanist Wolfgang Raible [machte] in seinen Überlegungen zum Verhältnis von Schrift und Sprachwandel deutlich, [...] daß es auch (oder muß man sogar sagen: vorzüglich) die Schrift mit ihren etwa ganz anderen syntaktischen Anforderungen ist, die die Sprache verändert.“ (Z. 144-161)
Ganz abgesehen davon, ob die Stellungnahme der Autorin die richtige ist oder nicht, ist ihr Kommentar: „Hier die Rede, da die Schrift, hier weiß, da schwarz: von dieser Dichotomie scheint sich die Sprachwissenschaft nicht nur auf dem weiten (und künftig immer bedeutsameren) Feld der neuen Medien verabschieden zu müssen.“ (Z. 138-144) m.E. vollkommen richtig. Viel interessanter scheint mir, daß sie mit Hilfe dieser unterschiedlichen sprachlichen Mitteln versucht, bestimmte Handlungsorientierungen beim Leser zu erzeugen, nämlich die Identifizierung mit ihrer Stellungnahme.
In den Artikeln von Heike Marx „Die schriftliche Mündlichkeit“ (StZ, 20.03. 1999) und von Hermann Unterstöger „Flockig mit Faustkeil oder PC“ (SZ, 27.03.99) wird ebenfalls über eine andere Tagung berichtet, die 35. Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache (IDS) in Mannheim zum Thema „Sprache und neue Medien“. Typische Ausdrücke, die bezüglich des Einflusses der neuen Medien auf die Sprache immer wieder in der Presseberichterstattung vorkommen, sind etwa „der Schwund der Schriftkultur“, „der Verfall der Sprache“, „die Bedrohung der Jugend“ und „die Zerrüttung der Gesellschaft“. Am Anfang des Artikels von Heike Max werden sie explizit thematisiert (vgl. Z. 12-14) und im Laufe der Berichterstattung von der Autorin teilweise wieder behandelt und erklärt. Die Nennung solcher Ausdrücke ohne die allgemein üblichen distanzierenden Anführungszeichen bedeutet keineswegs eine identifizierende Übernahme seitens der Autorin, wie es anschließend gezeigt wird, sondern eine Identifizierung seitens „viele[r] Zeitgenossen“ (Z. 10), die sich darum Sorgen machen. Sie spricht von der Entstehung einer Art neuen Schriftkultur wegen des schnellen und unkomplizierten Zugriffs auf weltweite Kommunikation. Diese neue Schriftkultur ist „sozusagen eine schriftliche Mündlichkeit“ (Z. 64-65). Was man chattet, macht man „so sorglos und unreflektiert wie im mündlichen Gespräch. Der Computer macht Leute zu Vielschreibern, die sich früher nicht nennenswert schriftlich geäußert haben.“ (Z. 67-71) Mit dieser Äußerung widerspricht die Autorin der These vom „Schwund der Schriftkultur“ durch die neuen Medien. Eine ähnliche Erklärung darüber gibt Bettina Schulte im Artikel „Am Computer kann man so richtig reden“ (BadZ, 05.03.96): „Seine Schnelligkeit rückt das elektronische Medium der mündlichen Mitteilung näher als der schriftlichen.“ (Z. 113-116) An anderer Stelle sagt Heike Marx Folgendes:
Wohin die sprachliche Entwicklung allerdings gehen wird, ist ungewiß. Gewiß ist: die Internet- Sprache ist geprägt von Anglizismen und einer neuen Lockerheit im Sprachgebrauch. [...] [Das Internet ist] zu einem seriösen Arbeitsinstrument geworden, mit dessen Hilfe die Leistungsfähigkeit der natürlichen Sprache optimiert wird. Und wer im Internet die klassischen Felder unseres Berufsalltags durchkämmt, wird dort keinen bemerkenswerten Sprachwandel feststellen“ (Z. 57-61, 94-98).
Dies verdeutlicht ihre Meinung gegen die These vom „Sprachverfall“. Gleichzeitig werden hier Anglizismen und Sprachwandel explizit thematisiert.
Über das Thema „Bedrohung der Jugend“ stützt sich die Autorin auf die These Harmut Günthers von der Universität Köln: „Der Erwerb der Lautsprache vollziehe sich durch die situative Einbindung des Kindes in sein Umfeld. Der Erwerb der Schriftsprache verlaufe ähnlich, jedoch weniger störungsfrei, weil ihm die Erlebnissituation fehle. Diese Situation böten die neuen Medien.“ (Z. 76-81) Somit wird im Artikel die Meinung über die Bedrohung der Jugend durch Computer verneint. Über die Zerrüttung der Gesellschaft sagt Heike Marx, daß man vom Telefon - genauso wie heute vom Computer und Internet - die Zerstörung von Persönlichkeit und Gesellschaft befürchtet hat (Z. 54-57), was wirklich nicht passiert ist. Daraus kann der Leser schließen, daß die neuen Medien zu keiner Zerrüttung oder Zerstörung der Gesellschaft führen werden.
Über die Stellungnahme der Tagungsteilnehmer zu den oben genannten Themen berichtet die Autorin Folgendes: „In diesem Chor wollte das Institut für deutsche Sprache in Mannheim (IDS) nicht einstimmen, [...] dabei handele es sich nicht etwa um besorgte Sprachhüter, welche die Hände rängen, weil die Sprache angeblich im Internet verkomme, [...]“ (Z. 15-23). Anschließend wird der Institutsdirektor Gerhard Stickel zitiert: „‘Mit Spannung beobachten wir, was an Neuem passiert und was man dabei an Altem entdeckt.‘“ (Z. 24-26) Von Ludwig Jäger erwähnt Heike Marx, daß er im Sprach- und Zeichenvermögen eine „‘anthropologisch grundlegende Gattungseigenschaft des Menschen‘“ sieht, wobei hier die Anführungszeichen eine implizite Distanzierung der Autorin von seinem Sprachgebrauch bedeuten könnte. Weiterhin wird die folgende Äußerung von ihm in indirekter Rede zitiert:
Schrittweise habe der Mensch daraus seine Kulturtechniken entwickelt. Die erste Revolution sei die Erfindung der Schrift gewesen, die zweite der Buchdruck. Mit den neuen Medien seien wir in eine weitere Revolution eingetreten, die sich von den vorangegangenen dadurch unterscheide, daß sie atemraubend schnell verlaufe und von Anfang an unter ständiger Beobachtung der Wissenschaftler stehe. (Z. 36-45)
Die Zitierung beider Aussagen, nämlich die von Gerhard Stickel und Ludwig Jäger, geschieht prinzipiell, ohne sprachliche Bezeichnung selbst zum Thema zu machen. Sie steht aber voraussichtlich im Gegensatz zu dem, was Heike Marx mittels einer „realistischen“ Redeweise im Artikel sagt: „Daß die Sprache sich dabei verändert, ist klar, so klar wie beim Aufkommen der elektronischen Medien Telegraph und Telefon im neunzehnten Jahrhundert.“ (Z. 50-54) (vgl. auch Zitat oben, S. 7, Z. 57-61, 94-101) Und somit entsteht hier eine indirekte Thematisierung über eine mögliche negative Rolle der Linguistik im Umgang mit den neuen Medien: die von den beobachtenden Linguisten sprachlichen Veränderungen durch die neuen Medien sind klar und nichts Neues. Diese Einstellung gegen die Rolle der Linguistik wird von der Autorin im letzten Abschnitt des Artikels durch dieselbe „realistische Diktion“ und in ironischer Weise weiter erläutert:
Für die Linguistik sind Computer und Internet wichtige Hilfsmittel. [...] Die vom Mannheimer Sprachinstitut entwickelten Programme auf CD-Rom und im Internet (Lexxis, Grammis, Cosmas und andere) sind gefragte Serviceleistungen. Das Institut besitzt siebenhundert Seiten im Internet und notiert achtzigtausend Zugriffe pro Monat. Zur heißen Phase der Rechtschreibreform waren es hundertzwanzigtausend. Im nächsten Jahr beschäftigt sich die Tagung mit dem „Aktuellen lexikalischen Sprachwandel“. (Z. 102-117)
Der Name der nächsten Jahrestagung mag wahrscheinlich kontrovers sein, wenn man es mit den Aussagen der Autorin vergleicht: man wird im Internet „keinen bemerkenswerten Sprachwandel feststellen - im Gegensatz natürlich zu Chatgroups, deren Teilnehmer durchaus zu Neuschöpfungen neigen.“ (Z. 98-101)
Es lohnt sich hier, das Beispiel am Anfang des Artikels über einen Professor und seine Tochter im Umgang mit dem PC sowie die Aussage Harmut Günthers zitiert zu werden: „Der Professor sucht am PC eine schöne übersichtliche Liste und stößt auf ‚dämliche Bildchen‘, die ihn als schriftfixierten Menschen ärgern. ‚Bist du dumm!‘ sagt daraufhin seine Tochter, ‚mit den Bildern geht es doch viel besser.‘“ (Z. 1-6) „‘Kinder surfen im Netz‘, so Günther, ‚und finden, was ihnen Spaß macht. Ältere finden oft nicht, was sie suchen.‘“ (Z. 82-84) Beide Zitate könnten dem Leser ein Bild von der Auseinandersetzung zwischen Altem und Neuem geben. Dieses Bild könnte man auf das von Heike Marx implizit erläuterte Verhältnis zwischen Sprachwissenschaft und neuen Medien übertragen, und daraus könnte man auch den Abschluß ziehen, daß, ähnlich wie der Professor im Umgang mit seinem PC, sich die Linguistik den Verhältnissen der neuen Medien nicht richtig angepaßt hat: die Linguisten beobachten, was an Neuem passiert, aber, daß „die Sprache sich dabei verändert, ist klar, so klar wie beim Aufkommen der elektronischen Medien Telegraph und Telefon im neunzehnten Jahrhundert.“ (Z. 50-54)
Die mangelnde Einigkeit in der Sprachwissenschaft über den Prozeß des Sprachwandels durch die neuen Medien wird zu einer der Tatsachen, die im Artikel von Hermann Unterstöger „Flockig mit Faustkeil oder PC“ (SZ, 27.03. 1999) explizit thematisiert wird.
Darüber äußert sich der Autor bereits von Anfang an des Artikels mittels realistischer Diktion sowie eines Zitates des Philosophen Heraklit: „Alles fließt, sagt Heraklit, fragt sich nur, warum und wie und wohin. Daß die Sprache einem ständigen Fluß und damit Wandel unterliegt, bestreitet kein Mensch; weit weniger Einigkeit herrscht über die Details dieses Prozesses.“ (Z. 1-7)
Unterschiedliche Bewertungsausdrücke zu diesem Thema werden im Artikel zusammengestellt, und somit wird die geringe Einigkeit zwischen den Tagungsteilnehmern in Mannheim und anderen Sprachwissenschaftlern über den Prozeß des Sprachwandels verdeutlicht. Der Düsseldorfer Anglist Dieter Stein machte vor zwei Jahren die folgende Äußerung, die im Artikel in indirekter Rede zitiert wird: „Die geschriebene Sprache vermündliche sich, entwickle sich also hin zum oralen Schreiben, dessen Hauptmerkmal eine gewisse Lässigkeit in Sachen Syntax, Grammatik und Ausdruck sei, vom legeren Umgang mit den ohnedies schwankenden Regeln der Orthographie nicht zu reden.“ (Z. 41-49) Und Mitte Dezember 1998 setzte der Hannoveraner Germanist Peter Schlobinski „eine völlig gegenteilige Meldung in die Welt. ‚Es gibt keine neue Sprache im Internet‘“. (Z. 58-60)
Weiterhin wird von ihm die folgende Äußerung in indirekter Rede zitiert: „Die virtuelle Welt verhalte sich, was die sprachliche Variabilität angehe, nicht viel anders als die reale, wenn Jugendliche flockiger und flapsiger als Erwachsene redeten, dann machten sie das im Internet genau so wie auch sonst.“ (Z. 63-69) Diesbezüglich sagte der IDS-Direktor Gerhard Stickel, daß beide Thesen richtig sind. „Entweder heißt es, daß man nichts Genaues wissen könne; oder, daß man erst noch sammeln und beobachten müsse“ (Z. 74-77). Die etwa 400 Tagungsteilnehmer erkundigten sich nach diversen text- oder sprachverarbeitenden Systemen; Karlheinz Jakob von der TU Dresden erinnerte an die sprachliche Aneignung neuer Medien mit Texten der Vergangenheit; von den Ergebnissen Werner Hollys und Stephan Habscheids (TU Chemnitz) wird Folgendes gesagt:
[Sie] berichteten von der sprachlichen Aneignung neuer Medien in der Gegenwart. Jeder hat die dabei übliche Anthropomorphisierung der Maschine selbst schon vorgenommen und zum PC etwa dies gesagt: „Verdammte Scheißkiste, willst du die Datei ausspucken!“ Ähnlich - im Ton, nicht in der Sache - mag ein Jäger der Frühzeit mit seinem defekten Steinkeil kommuniziert haben. (Z. 160-176)
Und von daher auch der Titel des Artikels: „Flockig mit Faustkeil oder PC“. Über die Berliner Philosophin Sybille Krämer berichtet Hermann Unterstöger: „Ihrer Theorie zufolge nehmen an der schriftbasierten Kommunikation im Internet eh keine Personen mehr teil sondern nur noch personae im Sinn von Masken, was zu einer depersonalisierten Modalität der Kommunikation führt.“ (Z. 195-200) Außerdem hat sich der Germanist Ludwig Jäger (TU Aachen) „die ‚Sprachvergessenheit der Medientheorie‘ vorgenommen und dabei kritisiert, daß beim Diskurs um die computergenerierte Simulation virtueller Welten die sprachvermittelten Weltbilder Gefahr liefen, ausgeschaltet zu werden.“ (Z. 207-213)
Eine implizite Distanzierung des Autors vom Sprachgebrauch der Tagungsteilnehmer läßt sich an verschiedenen Stellen des Artikels identifizieren. So wird ein Ausdruck in Mitten eines Zitates in indirekter Rede in Anführungszeichen eingeführt: „Anstoß ist diesmal die Einführung elektronischer Medien, deren Auswirkungen nicht annähernd so überschaubar seien wie ‚die sprachlich-kommunikative Aneignung und Nutzung‘ anderer technischer Medien, des Telephons etwa oder des Fernsehens.“ (Z. 26-33) Über ein sprachverarbeitendes System berichtet der Autor Folgendes: „In COSMAS kann man nicht nur einfache Wortformen samt Kontext aufspüren, sondern auch ‚morphosyntaktische Annotationen‘“ (Z. 123-126). „Sybille Krämer sprach in dem Zusammenhang von ‚Chiffrenexistenzen‘.“ (Z. 201- 202) Ein Teil der Äußerungen von Ludwig Jäger wird mit Anführungszeichen zitiert und anschließend vom Autor erklärt: „‘Ohne seine Fähigkeit zur interaktiven Semantisierung von Lauten, Gebärden und graphematischen Strukturen‘, vulgo: ohne sein Talent zum Quatschen, hätte es der Mensch nie vermocht, sich ‚als ein Ich zu konstituieren‘. Alle anderen Formen medialer Aktivität sind nur kulturelle Ausdifferenzierungen.“ (Z. 217-225) Diese implizite Distanzierung von einem bestimmten Sprachgebrauch mag dem Leser zeigen, daß sich der Autor mit den Aussagen der Teilnehmer nicht vollkommen identifiziert.
Weiterhin wird seine Stellungnahme gegen die Ergebnisse der Sprachwissenschaft durch unterschiedliche Sprachvermittlung bewußt. Sein Kommentar über die Antwort Gerhard Stickels nach der Frage, welche von den Thesen, die von Stein oder die von Schlobinski, die richtig ist, lautet:
[...] daß es im Haus der Wissenschaft viele voneinander gut abgeschottete Wohnungen gibt; oder aber, daß tatsächlich beide Professoren recht haben und sich dank Computer und Internet einerseits wohl sprachliche beziehungsweise kommunikative Änderungen vollziehen, andererseits aber nicht gleich eine neue Sprache entsteht. Das IDS jedenfalls übt sich in Gelassenheit. (Z. 77-87)
Über die Ergebnisse Hollys und Habscheids kommentiert Unterstöger: „Nichts Neues also unter der Sonne, außer daß solch einseitige Sprach-Interaktionen an Menge, Fülle und Ausgefinkeltheit gewaltig zugenommen haben.“ (Z. 176-179) Der Ausdruck von Sybille Krämer „Chiffrenexistenzen“ wird von ihm ebenfalls abgewertet: „Das klang - in Laienohren wiederum - einigermaßen deprimierend“ (Z. 202-204). Und „die sprachliche Aneignung neuer Medien ist heutzutage in aller Regel ein zwischen technischen Details, englischen Fetzen und Zukunftseuphorie schier besinnungslos einhertaumelnder Prozeß.“ (Z. 134-138)
Im Gegensatz zu Heike Marx vertritt Hermann Unterstöger die These vom Verfall der Sprache. Mittels einer realistischen Redeweise wird das von Anfang an des Artikels deutlich: „[...] weil nicht wenige Leute die Sprache derzeit auf einer abschüssigen Bahn sehen, einer Rutschbahn, die mit Schmiermitteln wie Rechtschreibreform, Anglisierung und Computerschlamperei ausgelegt ist uns stante pede in den Verfall führt.“ (Z. 9-15) Die Verwendung dieser Begriffe ohne die distanzierenden Anführungsstriche verdeutlicht eine identifizierende Übernahme seitens des Autors, daß es ein Prozeß des Sprachverfalls gibt und daß dieser Prozeß durch die bereits genannten Elemente beeinflußt wird. Der Autor bewertet diese Elemente als fatal (Z. 19), und aufgrund dieser Stellungnahme macht er der Linguistik und den Sprachwissenschaftlern gleichfalls durch eine realistische Diktion die folgenden Vorwürfe:
Will die Sprachwissenschaft dem Wandel ihres Sujets auf die Schliche kommen, ist sie auf penible Registrierung dessen angewiesen, was der Alltag sprachlich-kommunikativ hergibt. Daß die Ergebnisse nicht immer berauschend sind, auf den ersten Blick jedenfalls, leuchtet ein. [...] Je offener die Frage ist, ob sich im Gefolge der neuen Medien ein qualitativ beachtlicher Sprachwandel begibt, desto inniger vertieft sich die Zunft in die Wonne des Definierens und der Terminologie. (Z. 158-165, 180-185)
Damit kommt eine explizite Thematisierung über die negative Rolle der Sprachwissenschaft im Umgang mit den neuen Medien zum Ausdruck. Ähnlich wie im Artikel von Heike Marx, kommentiert der Autor die Äußerung vom IDS-Direktor Gerhard Stickel „‘Wir sorgen uns nicht um die Sprache‘ [...] ‚doch wollen wir wissen, was hier Neues passiert.‘“ mit den folgenden Wörtern:
Dieses Neue ist vergleichsweise leicht zu fassen, wo es um die technisch-handwerkliche Wechselwirkung zwischen Sprache und neuen Medien geht. Daß Computer und Internet der germanistischen Wissenschaft, wie jeder anderen ja auch, eine unendliche Ausweitung des Sammelns, Forschens, Belegens, Kommunizierens und Publizierens bieten, bedarf keiner Erläuterung. (Z. 90-99)
In Bezug auf das Thema Sprachwandel werden die Fragen warum, wohin und wie alles fließt, im Laufe des Artikels vom Autor zum Teil beantwortet. Die Antwort auf die Frage warum lautet in der Einleitung des Artikels deutlich: weil die Sprache derzeit auf einer „abschüssigen“ Bahn steht, „die mit Schmiermitteln wie Rechtschreibreform, Anglisierung und Computerschlamperei ausgelegt ist“ (Z. 11-14); die Frage wohin wird so beantwortet: „in den Verfall“ (Z. 15). Durch die Zusammenstellung unterschiedlicher Bewertungsausdrücke zum Thema, die nicht immer übereinstimmen, sowie durch unterschiedliche Sprachvermittlung und Redestrategien seitens des Autors kann der Leser an verschiedenen Stellen im Artikel implizit eine Antwort auf die Frage wie finden: Die Linguistik kümmert sich nicht um die Sprache, „vertieft sich in die Wonnen des Definierens und der Terminologie.“ (Z. 183-185) Daraus zieht man ebenfalls den Schluß, daß mehr sprachkritische als sprachwissenschaftliche Äußerungen Unterstöger von der Linguistik fordert. Die Linguistik geht „flockig“ mit den Wechselwirkungen zwischen Sprache und neuen Medien um.
Kann man aber die Stellung des Autors über einen vermeintlichen Sprachverfall rechtfertigen? Schiewe (1998) zufolge bewegt sich derjenige, der davon spricht, „in einem Rahmen von Urteilen, die sich großer Beliebtheit erfreuen.“ (S. 252) Die Basis für solche
Kritik müßte
im Ursprung der Sprache selbst liegen, also in einem Zustand, von dem wir keine Ahnung, geschweige denn ein Wissen haben. Psychologisch betrachtet aber ist es offenbar der Sprachbesitz, die Sprachfähigkeit der jeweils Urteilenden und Kritisierenden selbst, der den Maßstab abgibt. Die eigene Sprache, die man beherrscht und für gut hält, wird in Relation gesetzt zur Sprache der anderen, zu einer anderen Sprache, die man nicht beherrscht und die man auch nicht beherrschen will, weil sie für schlecht erachtet wird. So sind es immer die anderen, die zum Verfall der Sprache beitragen. (Schiewe, 1998: 253)
Im Fall vom Unterstögers Zeitungsartikel tragen die Sprachwissenschaftler, die nichts gegen die Rechtschreibreform und den Gebrauch von Anglizismen unternehmen, die Verantwortung für die „Bedrohung“ der Sprache. Dieser Stellungnahme über den Verfall der Sprache kann man die folgende Feststellung entgegensetzen:
Wenn Sprachen «feinstrukturierte Sozialgebilde» sind, dann verfällt die Sprache nicht, sondern sie verändert sich - nein, sie wird verändert, von den Menschen, die sie sprechen. Ob zum Guten oder zum Schlechten, muß von Fall zu Fall durch Abwägung der Vor- und Nachteile, des <Leistungsgewinns> und <Leistungsverlusts >, entschieden werden. Wohin auch <die Sprache> geht, stets gehen die Sprecher voran. Sie bestimmen - die einen mehr, die anderen weniger - ihren Weg und tragen, wenn man genau ist, mit jedem Wort zum Sprachwandel bei. Jeder Mensch trägt, wie in jeder sozialen Einrichtung, Verantwortung für sich selbst und für das Ganze, also auch für seine Sprachgebrauch und für die Sprache. (Schiewe, 1998: 255)
3. Alles spricht „ nur die einzig mögliche Sprache: die Sprache Gottes “
Dieses Zitat entspricht dem Artikel von Bernd Graff „Spracherkennungsdienste: Der ganz ‚Große Lauschangriff‘ der Computer“ (SZ, 11. 03. 1997). Hier wird es prinzipiell über ein Spracherkennungssystem für den Computer berichtet, nämlich über Voice Type 3.0 von IBM, das mittels einer Standard gehörenden Soundkarte und eines Spracherkennungsmoduls „gesprochene Sprache unmittelbar in Schrift“ transformiert. (Z. 15-17). Anläßlich dieses Systems und aus seiner kulturpessimistischen Sichtweise äußert sich der Autor in einer realistischen Redeweise über „die Zukunft der Sprache“:
Die Zukunft der Sprache wird immateriell sein. Kein Sprecher mehr, nur noch Töne, Materie und Energie, Thermodynamik und flottierende Zeichen. Fast schon ist es soweit. Das Universum beginnt, sich im Raunen der Differenzen aufzuheben. Es macht den Weg frei für den unendlichen, zentrumslosen Text, dem keine logozentristische Verblendung, keine Metaphysik, kein Prinzip mehr innewohnt - außer einem mathematischen der Wahrscheinlichkeit. (Z. 1-12)
Der Autor, Bernd Graff, greift auf ein Beispiel von dem Arzt Paracelsus im 16. Jahrhundert zurück, „Gott [habe] die Geheimnisse der Welt zwar gut versteckt, aber nicht unbezeichnet gelassen [...]‚zu gleicher weis als einer, der ein schaz eingrebt, in auch nicht unbezeichnet laßt mit auswendigen zeichen, damit er in selb wiser finden könne.‘“ (Z. 59-65). Graff fügt noch hinzu, daß im göttlich induzierten Kosmos - erkannt oder unerkannt - alles mit allem zusammenhängt. Die Zeichen der Sprache wie die der Tiere, der Pflanzen und der Sterne sind so verwoben, daß jedes Element, sowohl Hinweis wie Rätsel, Frage wie Antwort bedeuten kann. (vgl. Z. 65-73) „Und doch spricht alles nur die einzig mögliche Sprache: die Sprache Gottes.“ (Z. 74-75) Hier läßt sich ein Zusammenhang zwischen der Sprachauffassung des Autors und der von Johann Georg Hamann im 18. Jahrhundert identifizieren. Schiewe (1998) zufolge ist sich heute die Forschung über das enge Verhältnis vom Hamanns Sprachdenken zu seinem religiösen Denken einig. Hamann bezieht Sprache immer auf die Offenbarung Gottes (S. 115). Das kann man mit dem vergleichen, was Bernd Graff sagt: „Die Sprache der Menschen ist so der erste Indikator dafür, daß die Zeichen zugleich das Licht der Offenbarung, wie das Brandmal einer gottfernen Nacht tragen.“ (Z. 84-88) Die sprachkritischen Äußerungen des Autors sind hier religiöser Natur. Für Hamann hat das Wort Gottes „Vorbildcharakter und zeigt dem Menschen den Weg zum Verständnis der Natur.“ (Schiewe, 1998: 116) Weiterhin wird das Folgende behauptet: „Je rationaler und abstrakter, je stärker gefügt und grammatisch geordnet die Sprache wurde, desto schwieriger wurde es, Gottes Wort in ihr aufzusuchen. [...] Er wendet sich gegen den Rationalismus in der Sprache“ (S. 118); und als Beispiel davon wird die von den Grammatikern geplante und normierte Schriftsprache genannt. Ähnlicherweise kritisiert Graff dieses Spracherkennungssystem, wodurch dem Text keine Metaphysik, „kein Prinzip mehr innewohnt - außer einem mathematischen der Wahrscheinlichkeit.“ (Z. 11-12) Der wahrscheinlich einzige Unterschied zwischen Hamann und Graff ist, daß Hamanns Sprachkritik sich nicht auf eine Einzelsprache wie das Deutsche bezieht (vgl. Schiewe, 1998: 118). Graffs Auffassung widerspricht sich selbst, indem er im Artikel Paracelsus zitiert. Der Sprachbegriff Paracelsus steht im Gegensatz zu dem Hamanns und ebenfalls zur Sprachauffassung Graffs. Nach Schiewe (1998) haben Uwe Pörksen und andere Paracelsus-Interpreten starke Argumente dafür, daß sich die Sprachauffassung Paracelsus auf den Nominalismus stützte, in dem es keine notwendige oder natürliche Beziehung zwischen Wort und Ding gibt (vgl. S. 58).
Graff berichtet in seinem Artikel ebenfalls über Jacques Derrida und seine dekonstruktive Überbietung des Strukturalismus. Nach Derrida entwickeln sich alle Wissensformen des Abendlandes immer nach der ersten Geschichte der Metaphysik, in der eine Größe absolut in der Mitte steht. Dieser Größe wurden viele Namen gegeben, sie bezeichnen aber ein Zentrum, auf das alle Erkenntnisse bezogen sind. Nach der Frage, wo diese Größe angetroffen werden soll, da sie als Richtmaß aller Aussagen wirkt, antwortet Derrida, daß es nur eine Verkettung von Bestimmungen des Zentrums existiert (vgl. Z. 94- 147). „‘Die Geschichte der Metaphysik wie die Geschichte des Abendlandes wäre die Geschichte dieser Metaphern und Metonymien.‘ [...] ‚Wir verfügen über keine Sprache, die nicht an dieser Geschichte beteiligt wäre.‘“ (Z. 147-159) Zu diesem Zitat von Derrida macht der Autor die folgende Äußerung: „Wir nicht, vielleicht aber der Computer. Voraussetzung für die Erkennung von Sprache ist hier, daß der Sprecher seine Sätze ‚diskret‘, das heißt als Folge einzeln gesprochener Worte diktiert.“ (Z. 161-165) Ist diese Äußerung des Autors richtig? Haben die Wörter keinen Kontext mehr, indem sie durch dieses Spracherkennungssystem auf dem Bildschirm erscheinen,? Bernd Graff fügt noch hinzu, daß der Computer das schier Undenkbare realisiert: „die plausible Verkettung leerer Signifikation. Zeichen, denen das Bezeichnende abhanden gekommen ist.“ (Z. 218-221) Ist den Zeichen das Bezeichnende wirklich verlorengegangen, sobald sie auf dem Bildschirm auftauchen?
Das Problem liegt teilweise in der Sprachauffassung des Autors. Der Prozeß, wodurch der Computer die Sprache erkennt, wird so erklärt:
In erster Näherung registriert der Computer ein Wort also das akustische Signal, das zwischen zwei Pausen (von je einer Zehntel Sekunde) eingeht. Dieses Signal wird in Einzelfrequenzen zerlegt, quasi zu akustischem Staub zerblasen, um jedem Partikel eine spezifische Position in einem imaginären Koordinatensystem zuweisen zu können. Die Verteilung dieser Referenzen im Raum erfolgt nicht zufällig, sondern - gemäß der möglichen Laute innerhalb einer Sprache - prototypisch. (Z. 165-177)
Und dieser rationale und mathematische Prozeß steht im Widerspruch zum Sprachbegriff von Graff. Nach ihm tragen die Zeichen der menschlichen Sprache „das Licht der Offenbarung“ (Z. 86-87). Außerdem wird hier der Computer mit „menschlichen“ Zügen ausgestattet: „Jeder kann seinen Computer verbal steuern und zum stets fehlerfreien Diktat bitten. Er schweigt und notiert - im Tempo einer professionellen Schreibkraft mit 80 bis 100 Wörtern pro Minute.“ (Z. 24-28); „Das Programm ist lernfähig“ (Z. 32); das Folgende wirkt seitens des Autors ironisch: „der lauschende Computer [...] transformiert, was nach den Zeichentheorien, den Semiologien, doch eigentlich nur sprachbegabten Menschen vorbehalten blieb: das süße Nichts des Schalls zur Schrift.“ (Z. 45-52) Fast am Ende des Artikels behauptet er mittels einer realistischen Redeweise Folgendes:
Zugegeben, es läßt sich einwenden, daß der Sprecher, indem er ihn kontrolliert, seinem Text ein metaphysisches Skelett anlegt. Dann wird man aber auch zugeben müssen, daß die Kontrolle eher dem Erstaunen darüber weicht, wie genau seine Sprache erfaßt wird. Doch letztlich verschwinden alle diese erdfernen Reflexionen angesichts der rohen Tatsache, daß der „Große Lauschangriff“ von nun an in maschineller Autonomie, ganz ohne Wachhabenden - auf jedes abgepaßte Stichwort hin - wird stattfinden können. (Z. 232-244)
Es sieht so aus, als ob der Computer die Funktionen einer Sekretärin vollständig übernommen hätte: „maschinelle Autonomie, ganz ohne Wachhabenden.“ Einzuwenden ist, daß die Person, die das Programm benutzt, den Text selbst kontrollieren und darauf achten kann, wie es erfaßt wird. Also gibt es noch Wachhabende.
Ein weiterer Widerspruch zum Artikel ist die folgende Feststellung des Autors: „Die Sprache wird unabhängig vom jeweiligen Sprecher“ (Z. 35-36). Durch dieses Spracherkennungsprogramm wird aber dasselbe gemacht, wenn eine Person im Computer einen Text schreibt. Der einzige Unterschied: hier kann man die Sätze diktieren, statt selbst zu schreiben. Was geschrieben oder in diesen Fall verschriftet wird, hängt natürlich vom jeweiligen Sprecher ab. Die Wörter haben einen bestimmten Kontext und das Bezeichnende geht nicht verloren. Durch dieses Programm wird das Geschriebene mittels gesprochener Worte realisiert. Medial ist das trotzdem schriftlich, und konzeptionell kann man es je nach der Kommunikationssituation als mündlich, schriftlich oder als ein Kontinuum zwischen beiden Punkten betrachten (vgl. Koch/ Oesterreicher: , 587).
Aufgrund seiner Stellungnahme zum Verhältnis zwischen Sprache und neuen Medien, kann man behaupten, daß Graff ebenfalls die These des Sprachverfalls vertritt. Obwohl das im Text nicht explizit erläutert wird, läßt es sich durch seine pessimistischen Äußerungen über „die Zukunft der Sprache“ sowie durch das Beispiel über die Prophezeiung vom Ende Babylons erkennen: „ [...] Mene mene tekel, ufarsin [...] Belsazar, so der Prophet Daniel, habe die Worte jedoch nicht beachtet, da er in ihnen nicht die Prophezeiung vom Ende Babylons erkannte.“ (Z. 250-255) Insofern mag der Leser die Wörter des Autors beachten und als eine Prophezeiung vom Sprachverfall interpretieren.
4. Anglizismen und ihr Einfluß auf die deutsche Sprache
Im Artikel „High-Tech-Deutsch: Ist die Gegenwartssprache noch »unser«?“ (StZ, 26.03. 1994) werden Anglizismen und ihr Einfluß auf die Alltagssprache explizit thematisiert. Diesbezüglich vertritt der Autor auch die These vom Sprachverfall. Mittels realistischer Diktion äußert er sich darüber: „Unsere Muttersprache verfleckt sich, sie schrumpft.“ (Z. 30- 31); „Erst heute droht sie, vollgeschoppt mit den spreaded terms einer totalitär sich in Szene setzenden High-Tech-Welt, an ihrem Vokabular zu ersticken. Anglizismen: kein Vorrecht mehr von Minderheiten - sondern Zwang für uns alle.“ (Z. 55-61); Über diesen Einfluß gibt er am Anfang des Artikels ein passendes Beispiel:
Der neue Fun-Stadtwagen? Swatch. Und wenn Sie mit dem Zug fahren? BahnCard First. Im Raucherabteil eine Zigarette, Marke „Come together! Share the taste!“, und am Ankunftsort ein Tip vom Großhotel: „Fragen Sie einfach nach dem ‚Global-Business-Options‘-Programm“. Warum? Antwort, damit Sie beim Check-in das „Upgrade in eine Junior- oder One-bedroom-Suite“ mitbuchen können. [...] Sie sehen Talk-Shows, studieren Last-minute-Offerten, treiben Homebanking, online, verfolgen die Top news vom olympischen Free-Style-Rekord [...] (Z. 1-19).
Weiterhin werden Anglizismen an verschiedenen Stellen im Artikel thematisiert: „Comfort Communication“, „Voice Mail Service“, „Backspace-Taste“, „Free- und Shareware“, „Laptop“, „Sub-Notebook“, „Power Control“, „Short Message Service“ (Z. 103-117); oder „Hardcores“, „Software“, „Surfbrett“, „Escape“, „Display“ (Z. 138-146). Sie werden ohne distanzierende Anführungszeichen im Artikel eingeführt. Die Anglizismen in Anführungsstrichen sind Zitate und bedeuten keine Distanzierung. Dies muß aber nicht als eine identifizierende Übernahme seitens des Autors von diesem Sprachgebrauch sondern als eine auffällige Anwendung satirischer Mittel verstanden werden. Er baut das Kritisierte in seinem Artikel ein, indem er nicht nur seine Stellungnahme gegen den Einfluß von Anglizismen auf die Alltagssprache eindeutlich zeigt, sondern diese kritisierten Anglizismen selbst im Text benutzt. Folgendermaßen wird seine Kritik anschaulich und nachvollziehbar: „wissen Sie auch, daß Deutsch irgendwie out ist? Down und weak: die System Control stimmt nicht mehr.“ (Z. 27-30); „[...] mit den spreaded terms einer totalitär sich in Szene setzenden High-Tech-Welt“ (Z. 35-37); „Natürlich braucht die Pop-Jugend ihre Events, genau wie der Cashmere-Pullover-Fabrikant seine Corporate identity.“ (Z. 64-67); „den Mobiltelefonisten, Datenbankern, Infotainment-Cracks, CompuServern, Telekommunarden - ist die Sprache ganz schnurz, zumindest die deutsche.“ (Z. 84-88)
Ein negativer Einfluß der Linguistik in bezug auf die neuen Medien wird hier ebenfalls kurz thematisiert. Durch realistische Diktion macht der Autor die folgende Feststellung:
Die Sprachwissenschaftler können es nicht, die haben ja keinen Begriff vom technologischen Fortschritt, von der Zukunft der Kommunikationsgesellschaft. [...] die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, gar die Duden-Redaktion - alle zucken die Achseln, es geht sie nichts an. Beistrichregeln, ja schon; aber Computerdeutsch? (Z. 80-83, 129-133)
Mit den selben sprachlichen Mitteln spricht er vom volkswirtschaftlichen Schaden. Dieser Schaden, „welcher entsteht, indem arbeitswillige Leute stundenlang hinbrüten über den Unbegreiflichen moderner, US-sprachlich durchfleckter Manuals, ist schwer zu ermitteln.“ (Z. 118-123)
Mit diesen Redestrategien und dem Gebrauch eines bestimmten Wortschatzes versucht der Autor bestimmte Handlungsorientierungen beim Leser zu erzeugen. Für ihn sind Anglizismen eine Bedrohung, sie sind „Zwang für uns alle“ (Z.61) und dringen in die Gesellschaft ein. Er behauptet, daß Anglizismen Teil „einer totalitär sich in Szene setzenden High-Tech-Welt“ (Z.56-57) sind. Sein Wortschatz im Text wirkt totalitär, zum Bereich des Militärischen gehörend. Die folgenden Beispiele verdeutlichen diese Behauptung. Als Vorbild im „Kampf“ gegen Anglizismen werden die Franzosen im Text präsentiert. Sie schafften, „sogar den Terminus Computer aus ihrer Wortwelt zu verbannen“ (Z. 97-99); im Gegensatz dazu „scheinen die Deutschen für die Zukunft schlecht gerüstet zu sein“ (Z. 100-101); die Franzosen sind „besser gewappnet: sie kommen der Zukunft mit ihrer eigenen Sprache bei“ (Z. 142-144); „Ganze Hundertschaften von Linguisten überlegen in Paris, wie man Software, Surfbrett, Escape, Display französisch benennt, tagaus, tagein erfinden die Sprachexperten der Délégation Générale à la Langue Française neue Wörter - eine Übung, welche die Deutschen schon lange verlernten.“ (Z. 144-151) Somit plädiert der Autor auch für eine Sprachregelung nach französischem Muster. Außerdem werden diese Ereignisse in Frankreich im Präsens mitgeteilt und so dargestellt, als hätten sie gerade erst stattgefunden. Die Präsentation der Ereignisse auf diese Weise ähnelt der Struktur einer Reportage und gibt dem Leser ein Gefühl des Dabeiseins und des emotionalen Miterlebens (vgl. Lüger, 1995: 115). Und genau dies ist die Absicht des Autors, daß der Leser sich mit diesen Ereignissen und seiner Stellungnahme identifiziert. Er schließt dem Leser in seine eigene Meinung und Behauptungen ein, indem er auch sagt: „Unsere Muttersprache ...“ (Z.30), „unser liebtrautes Fenster“ (Z. 39), Anglizismen sind „Zwang für uns alle“ (Z. 61), „Unsere Kultusminister ...“ (Z. 129). Somit wird der Leser implizit gefordert, etwas gegen Anglizismen zu tun.
Der Schlußkommentar des Autors lautet: „In Fahrt kommt alles, nur eins nicht: Verständnis. Das Begreifen erlahmt im High-Tech-Deutsch“ (Z. 166-168), wobei man hier den Begriff „High-Tech-Deutsch“ als kontrovers betrachten könnte; dieser wird vom Autor benutzt, um die Unverständlichkeit durch Anglizismen zu erläutern. Er fordert Allgemeinverständlichkeit. Schiewe (1998) zufolge verfehlt eine Sprachkritik, die Allgemeinverständlichkeit fordert, in unseren Tagen ihr Ziel, wenn sie, wie noch Campe mit einer gewissen Berechtigung vor zweihundert Jahren, lediglich Fremdwörter als unverständliche Wörter innerhalb der öffentlichen Umgangssprache kritisiert. Sie trifft schon eher das Ziel, wenn sie als Gegenstand ihrer Kritik den seine ursprüngliche Sphäre überwuchernden Fachwortschatz, der zum Teil - aber nur zum Teil - die Fremdwörter mit einschließt, in den Blick nimmt. (S. 256)
Daß letzteres aber nicht der Fall in diesem Zeitungsartikel ist, macht die folgende Äußerung des Autors noch deutlicher: „Aber was auf die Gesellschaft eindringt, ist mehr als bloß das Protzvokabular bestimmter hochmögender Kreise. Es geht nicht länger um Fachsprachen, Modeausdrücke, Schickimicki-Vokabeln - das sind, mit Verlaub, peanuts. Jetzt ist Herr Jedermann dran, ob er will oder nicht.“ (Z. 67-74) Der Begriff „Herr Jedermann“ mag hier auf alle deutschsprachigen Leute bezogen sein.
Die deutsche Übersetzung eines Softwarehandbuches gibt Anlaß zur Besprechung unterschiedlicher Themen im Artikel von Dieter Zimmer „Begegnung mit dem Deutsch von morgen“ (Die Zeit, 19.05. 1995). Die folgenden sprachkritischen Äußerungen sind von Anfang an des Artikels zu finden: Die Übersetzung „wirkt nur noch etwas eigen. Es ist nämlich das Deutsch von morgen.“ (Z. 25-26); „Das Programm, welches dieses Handbuch erläutern soll, heißt UNINSTALLER und ist eine Art Reinigungsmittel (es hütet sich, seinen Namen mit ENTKLEMPNER zu übersetzen)“ (Z. 27-31). Von beiden Begriffen distanziert sich der Autor, indem er eine andere Schriftart benutzt. Weiterhin macht Dieter Zimmer die folgenden Bewertungen:
Wenn es so mühelos wie versprochen nicht gelingt, dann auch darum, weil man sich zunächst durch das Handbuch zu beißen hat, das in dem lobenswerten Bemühen, alles idiotensicher zu erklären, erst einmal noch das Klarste verunklärt. [...] Das Deutsch von morgen, das der Übersetzer auf seine Leser losläßt, hat er nicht selber erfunden, wie man sogleich sehen wird; er hat nur demonstrativ verdichtet, was schon vielerorts zu hören und zu lesen ist. (Z. 34-40, 67-72)
Insofern spricht er von den zehn wichtigsten sprachlichen Neuerungen: gelegentliche Übersetzung englischer Wörter, Unverständlichkeit mancher Übersetzungen, getrennte Schreibung von Komposita, keine Deklination von Adjektiven, Großschreibung einzelner Elemente im Wortinnern, Gebrauch des sächsischen Genitivs, Kommasetzung nach dem Zufallsprinzip, Veränderungen in der deutschen Idiomatik, deutsche Syntax nach englischer Art und Großschreibung von Adjektiven. Damit werden jeweils Neologismen und Gelegenheitskomposita im Artikel auch explizit thematisiert und der Ausdruck „Das Deutsch von morgen“ benutzt, um diese sprachlichen Neuerungen zu bezeichnen. Mittels einer realistischen Redeweise macht der Autor die folgenden Bemerkungen über die gelegentliche Übersetzung englischer Wörter:
Englisches wird manchmal übersetzt, manchmal naturbelassen. Wann das eine geschieht und wann das andere, entscheidet das Los. Keinesfalls wird dabei berücksichtigt, wieviel Widerstand ein englischer Begriff etwa seiner Übersetzung entgegenbringt. Daß sich zum Beispiel Back up & Restore wunderbar übersetzen ließe (Sichern + Wiederherstellen), heißt nicht, daß es auch übersetzt wird; lieber plagt man sich mit hoffnungslosen Fällen wie SmartDecoy (das zu „ Köder “Kopie wird). (Z. 74-85)
An anderen Stellen im Artikel läßt sich auch das gleiche sprachliche Mittel identifizieren. Über die Zusammenschreibung von Komposita behauptet Zimmer: „Es gab bisher nur zwei Arten, solche Komposita zu schreiben: zusammen oder mit Bindestrich(en). Diesem Zustand macht das Deutsch von morgen ein Ende“ (Z. 116-117), und gibt folgende Beispiele: Shell Verweis, Windows Anfänger, Support Datei (Z. 120-121). Er fügt noch hinzu:
Dabei beschränkt es sich keineswegs auf solche Fälle, in denen englische Elemente in die Zusammensetzung, die nun keine mehr ist, aufgenommen werden. Auch wo sämtliche Elemente der deutschen Sprache entstammen, wird es so gemacht: Notizblock Anwendung, Raster Schriftart, System Säuberung Eigenschaft ( was immer die ist). [...] Das Fugen-s verhindert solche Trennungen keineswegs, auch wenn da nun ein abenteuerlicher neuer Genitiv entstanden zu sein scheint: Eliminations Prozeß, Technische Unterstützungs Abteilung. Nur manchmal taucht noch eine vage Erinnerung an die alte Art und Weise auf; dann wird, wiederum nach dem Zufallsprinzip, ein Bindestrich irgendwohin gesetzt: Datei-Lösch Sekretär. (Z. 121-129, 134-143)
In bezug auf die Deklination von Adjektiven, den Gebrauch des sächsischen Genitivs, die Kommasetzung und syntaktische Änderungen behauptet der Autor ebenfalls durch eine realistische Diktion das Folgende: „So wie die Nebeneinanderstellung flexionsloser Wortstämme im Englischen zuweilen die Grenze zwischen Adjektiv und Substantiv verwischt [...], geschieht es praktischerweise auch im Deutsch von morgen“ (Z. 153-161); „Das Deutsch von morgen erfreut mit dem sächsischen Genitiv, nicht nur bei Eigennamen (Norton ’ s), auch sonst (Manager ’ s)“ (Z. 203-206); „Kommas werden im Deutsch von morgen ebenfalls nach dem Zufallsprinzip über den Text verstreut [...] Trennfehler gibt es nicht mehr: Auch wenn am rechten Seitenrand noch so große Lücken klaffen - Worttrennungen sind völlig abgeschafft“ (Z. 219-225). Außerdem sagt Dieter Zimmer, daß die deutsche Idiomatik bereichert wird, „und zwar um Redewendungen, die geradewegs aus dem Englischen übersetzt wurden [...] Auch hier setzt das Deutsch von morgen jedoch nur fort, was ihm das Deutsch von heute längst vorgemacht hat“ (Z. 232-239); „Während sich die Anglisierung des Deutschen im allgemeinen auf den Wortschatz beschränkt hat und die Syntax unangetastet ließ, wird das Deutsch von morgen hier erste Einbrüche erzielen.“ (Z. 243-252)
Parallel zu den Neologismen aus dem Computerbereich nennt der Autor auch entsprechende Beispiele aus der Alltagssprache. Im Fall der getrennten Schreibung von Komposita werden diese Wörter explizit thematisiert: Sonnen Studio, Folklore Boutique und der neue Stern am Pianisten Himmel (Z. 150-152). Über flexionslose Adjektive gibt der Autor die folgenden Beispiele aus dem Computerbereich bzw. der Alltagssprache: der original Programmdateiname, der standard Treiber, der modern Jargon, ein klasse Eis (Z. 161-172). Die Großschreibung im Wortinnern findet Zimmer nur im Wort DoppelFinder aus dem Computerwortschatz vertreten (Z. 178). Dagegen sind solche Art Neologismen im alltäglichen Sprachgebrauch zu finden: HiFi, LandesBank, InterCityTreff, InHausPost, TeleBanking, PrickNadelTest, WirtschaftsWoche (Z. 178-185). Bezüglich des Gebrauchs vom sächsischen Genitiv sind die folgenden Wörter, in der satirischen Zeitschrift Titanic gesammelt, explizit thematisiert: Anne ’ s Lädchen, Ossi ’ s Grill, Jörg ’ s Backstube, Rudi ’ s Fundgrube, Dino ’ s Getränkemarkt, Museum ’ s Caf é und Mac ’ s Snack ’ s (Z. 208-213). Der Ausdruck Für, in den Shell installierte Objekte (Z.221-222) entspricht dem vom Autor genannten Fall von Kommasetzungen nach dem Zufallsprinzip. Beispiele von Redewendungen, die aus dem Englischen direkt übersetzt werden, sind hier auch dargestellt: „ danke für diese Anweisungen statt dank dieser Anweisungen, das ist so, da ... statt das liegt daran, daß ... “ (Z. 233-236). Nach dem Autor sind andere Redewendungen ihnen vorangegangen, nämlich „ eine gute Zeit haben oder Sinn machen oder kein Problem! “ (Z. 237-241). Schließlich sind einige Beispiele im Artikel über syntaktische Veränderungen vom Autor genannt: das ist mehr interessant, die Protests und Fliegen Sie Delta? (Z. 254-256), „ der Kohl-Besuch statt Kohls Besuch, der Handke-Roman statt Handkes Roman, die Schmidt- Villa statt die Villa von Familie Schmidt.“ (Z. 263-266)
In allen Fällen distanziert sich der Autor durch eine kursive Druckschrift von diesem Sprachgebrauch. Der Begriff „das Deutsch von morgen“ ist als kontrovers zu betrachten, denn er taucht fast jedesmal auf, wenn der Autor eine Bewertung gibt, oder wenn er über die sprachlichen Neuerungen spricht.
Wie im Artikel „High-Tech-Deutsch“ (StZ, 26.03. 1994) fällt die Anwendung satirischer Mittel auf. Zimmer baut das Kritisierte an verschiedenen Stellen seines Artikels umsichtig ein. Als Vorwegnahme für das später explizit behandelte Thema (Deklination von Adjektiven und Substantiven) behauptet der Autor: „Es gab bisher nur zwei Arten, solche Komposita zu schreiben: zusammen oder mit Bindestrich(en)“ (Z. 113-115), wobei die Endung „-en“ in Klammern bedeutet, daß das Wort in der Zukunft wohl nicht mehr dekliniert wird. Bezüglich der Schreibung von Komposita macht Zimmer die folgende Äußerung: „Wer es einmal begriffen hat, merkt bald, daß Hilfe Sekretär kein Hilferuf (künftig: Hilfe Ruf) sein soll“ (Z. 130-132); hier kritisiert er die Unverständlichkeit solcher Wörter, die gegen die bereits etablierten Rechtschreibregeln verstoßen, und infolgedessen ihre Bedeutung nicht klar sein kann. Für die folgenden Beispiele beschränke ich mich auf die Aussagen des Autors, da es seine Kritik hier anschaulich und nachvollziehbar ist: „Eine geradezu charmante Neuerung, von der der ‚Duden‘ noch nichts ahnt, ist die Sitte, Komposita übersichtlicher zu machen, indem man einzelne Elemente im WortInnern großschreibt“ (Z. 173-177); die schon früher erläuterten Beispiele über den Gebrauch des sächsischen Genitivs legen den Verdacht nahe, „beim deutschen sächsischen Genitiv sei der Apostroph gar kein Auslassungs- und gar kein Genitivzeichen, es gehe viel mehr um die neue deutsche Leidenschaft, einfach ‚ein Zeichen zu setzen‘, Bedeutung: ‚Kuck mal!‘“ (Z. 213-218); das „Deutsch von morgen“ setzt fort, „was ihm das Deutsch von heute längst vorgemacht hat, wenn es eine gute Zeit haben oder Sinn machen oder Kein Problem! sagt, ist das nicht so? Wir sehen uns noch.“ (Z. 238-242); und noch dazu: „die konsequente Großschreibung von Adjektiven in titelartigen Zeilen ist es bestimmt. Gelegentlich führt zwar auch sie zu Große Verständni’s Probleme“ (Z. 284-287).
An einer anderen Stelle im Artikel findet man Beispiele über die Unverständlichkeit mancher Übersetzungen. Diesbezüglich behauptet Zimmer:
Wo ein übersetzungsbedürftiges englisches Wort ein irgendwie ähnliches deutsches Gegenstück hat, okkupiert es dessen Bedeutung, auch wenn die Leute zunächst einmal nichts mehr verstehen: Das Restaurieren einer Sicherheitskopie geschieht automatisch. Was verschlägt es, daß restaurieren gar nicht dasselbe wie restore bedeutet, wiederherstellen ? Das wird es bald schon tun; Wörter wie kontrollieren und realisieren und konfrontieren (er konfrontierte seinen Schöpfer) und Droge und Zerealie und Option und Integrität (früher Anständigkeit, heute auch Vollständigkeit) und Studie (früher nur eine Vorarbeit, heute jede wissenschaftliche Untersuchung) und viele andere sind ihm vorangegangen. (Z. 86-102)
Durch diese Behauptung Zimmers könnte man auf die These Uwe Pörksens (1988) über die sog. „Plastikwörter“ zurückgreifen. Ihm zufolge sind die Merkmale dieser Art von Wörtern (hier werden nur zwei von denen skizziert) die folgenden:
- Ihr Gebrauch hebt den Sprecher ab von der unscheinbaren Alltagswelt und erhöht sein soziales Prestige; sie dienen ihm als Sprosse auf der sozialen Leiter.
- Diese Wörter Bilden die Brücke zur Welt der Experten. Ihr Inhalt ist u.U. nicht mehr als ein weißer Fleck, aber sie vermitteln die >Aura< einer Welt, in der man über ihn Auskunft zu geben weiß. Sie verankern das Bedürfnis nach expertenhafter Hilfe in der Umgangssprache. Sie sind geldträchtig: Ressourcen. (Pörksen, 1988: 120-121) Er macht ebenfalls eine Prognose für die Auswirkung des Computers: „Unsere Umgangssprache ist für seine Aufnahme prädisponiert und wird sich, nach seinem universellen Einsatz, über den weitgehend entschieden ist, in der eingeschlagenen Richtung vermutlich weiter verändern.“ (S. 116)
Die von Pörksen (1988) oben genannten Merkmale von „Plastikwörten“ entsprechen wahrscheinlich den Wörtern, die in Zimmers Artikel erwähnt werden. Möglicherweise erhöht der Gebrauch dieser Wörter in der Umgangssprache und im Computerkreis das soziale Prestige des Sprechers, verankern sie das Bedürfnis nach expertenhafter Hilfe, und, wie es Zimmer behauptet, sind einige von denen dem heutigen Wortschatz aus dem Computerbereich vorangegangen. In ihren Untersuchungen von drei Zeitschriften aus dem Computerbereich sind Diem, Groumas und Jeske (1997) zu dem Ergebnis gekommen, daß u.a. ein Aspekt von Usertalk 2 sein kann, „speziell die Bezeichnungen zu benutzen, die in diesem Zusammenhang als unüblich empfunden werden, um sich den Anschein eines Experten zu geben. Usertalk kann also zu einer bewußten Verkomplizierung beitragen, vor allem aufgrund seiner lexikalischen Nähe zum Englischen.“ (S. 163)
Zimmers kritisierte Wörter (kontrollieren, realisieren, Droge, Zerealie, Option, Integrität und Studie, und aus dem Computerbereich: restaurieren) sind Entlehnung aus anderen Sprachen, meistens aus dem Latein, und auch aus Französischem und Englischem, sie haben sich aber längst im Deutschen durchgesetzt. Ein Blick in die Wörterbücher zeigt, daß das Wort restaurieren keine direkte Übersetzung aus dem Englischen ist. Es kommt aus dem lateinischen restaurare und bedeutet dasselbe wie restore: wiederherstellen (vgl. u.a. Wahrig, 1997).
Im Sinne von Peter von Polenz (1991) könnte man behaupten, daß Zimmers Sprachkritik eine Mischung von sprachkonservativer und sprachpuristischer Haltung ist3. Das läßt sich nicht nur durch seine Kritik über unverständliche Übersetzungen beweisen, sondern auch durch seine unterschiedlichen Bewertungen mittels einer realistischen Redeweise und die Anwendung satirischer Mittel. Trotz seiner Prognose, daß die im Artikel explizit erläuterten Anglizismen aus dem Computerbereich bald alltäglich sein werden, zeigt er auch entsprechende Beispiele aus dem Alltag, in denen solche Veränderungen stattgefunden haben, behauptet, daß diese Veränderungen schon vielerorts zu hören und zu lesen sind, und macht außerdem diese Bewertungen: „In den letzten Jahren sind alle Dämme gebrochen“ (Z. 148- 149), „Aber das Deutsch von morgen soll ja auch keineswegs ein einfacheres, klareres sein.“ (Z. 291-292) Damit wird auch von ihm, wie vom Autor des Artikels „High-Tech-Deutsch“ (StZ, 26.03. 1994), Allgemeinverständlichkeit gefordert, und die Entstehung neuer, differenzierter Ausdrucksmittel nicht akzeptiert.
Seine Haltung unterscheidet sich von Pörksens Kritik in vielen Aspekten. Schiewe (1998) zufolge taucht mit Pörksens Kritik über Plastikwörter „eine neue Dimension in der sprachkritischen Beurteilung von Wörtern und ihre Verständlichkeit auf.“ (S. 281)
Nicht das tatsächliche, durch Bildungsunterschiede hervorgerufene Verstehen oder Nicht-Verstehen von Wörtern ist hier einer der wichtigsten Gegenstände von Sprachkritik, sondern das vermeintliche Verstandenhaben jener gar nicht so zahlreichen Wörter, die heute dazu benutzt werden, eine die Welt verändernde Politik zu betreiben. Macht und Herrschaft nämlich bedienen sich im Zeitalter der ungehemmten Öffentlichkeit nicht mehr des Mittels der Sprachentrennung, des Ausschlusses bestimmter Bevölkerungsschichten aus bestimmten Wissens- und Kommunikationsbereichen. Sie vereinigen sich vielmehr mit den Beherrschten in einer gemeinsamen Sprache, in demokratisch scheinenden, aber diktatorisch wirkenden Wörtern. (S. 281)
Pörksen nimmt als Gegenstand seiner Kritik den Fachwortschatz, der nur zum Teil die Fremdwörter mit einschließt. Im Gegensatz dazu kritisiert Zimmer nur Anglizismen im Computerwortschatz. Infolgedessen verfehlt seine Sprachkritik hierzu ihr Ziel (vgl. Schiewe, 1998, S. 256). Zuletzt möchte ich einen Teil der Ergebnisse von Diem/ Groumas/ Jeske (1997) zeigen, da hier viele der Behauptungen von Dieter Zimmer deutlich widersprochen werden. Nach den Autoren stellt die Sprache von Usern sicherlich keine eigene Sprachform dar, da es in ihr an einer spezifischen einheitlichen Syntax und einer einheitlich abweichenden Stilistik mangelt. Eine Einfärbung - indem der Substantivwortschatz der Computerbegriffe den alltagssprachlichen ersetzt - in Richtung Usertalk ist theoretisch bei jeder Sprachform denkbar, tatsächlich findet sie in der Handelssprache statt. (S. 166)
Im Artikel von Josef Oehrlein „Schöne Grüße von Webmaster und Sysop“ (FAZ, 05.12. 1998) werden Anglizismen im Computer und Internet und ihr Einfluß auf die Alltagssprache ebenfalls explizit thematisiert. Seine sprachkritische Haltung weicht aber von den zwei letzten untersuchten Zeitungsartikeln eindeutig ab. Sie betrifft die Veranschaulichung von negativ bewertet und als für die deutsche Sprache unnötig oder schädlich aufgefaßt. (von Polenz, 1991, S. 12- 14)“
Sprachverschiedenheiten im Zusammenhang mit den neuen Medien, meistens kommentierend. Am Anfang seines Artikels spricht Oehrlein von der starken Veränderung der Sprache durch die Entwicklung der Computer- und Online-Welt:
Die rasante Entwicklung des Computerwesens und des weltweiten Datenaustausches über das Internet hat innerhalb weniger Jahre die Kommunikation über das Medium der Sprache so stark verändert wie kein anderer Vorgang in der Geschichte der Menschheit, von der Erfindung der Buchdruckerkunst abgesehen. (Z. 12-20)
Er behauptet, daß nicht nur ein Fachjargon für Spezialisten entstanden ist, die Alltagssprache und Personen, die noch nicht direkt mit den neuen Medien in Berührung gekommen sind, „werden immer stärker beeinflußt. Und kaum eine Sprache bleibt verschont. Am augenfälligsten ist das unaufhaltsame Vordringen des Englischen in die meisten anderen Sprachen, das Englische ist längst die lingua franca in der Computerwelt geworden.“ (Z. 25- 31) Das Computer- und Internet-Englisch folgt ganz eigenen Regeln und „verändert auch das Alltags-Englisch selbst.“ (Z. 34-35)
Nichtsdestoweniger spricht er von dem bisher äußerst kreativen und phantasievollen Prozeß in der Erfindung neuer Begriffe und der Anreicherung seit langem benutzter Wörter mit neuen Bedeutungen (vgl. Z. 35-40). Insofern werden die Wörter Browser, cool, Site, und surfen thematisiert, vom Autor erklärt und manchmal auf- oder abgewertet: der Begriff Browser hat sich durchgesetzt. Man könnte im Deutschen den phonetischen, aber nicht direkt inhaltlich entsprechenden Begriff „Brauser“ verwenden, „weil man im Internet innerhalb von Sekundenbruchteilen von einem Rechner zum anderen ‚braust‘, aber das hat sich nicht durchgesetzt, es klingt ja auch ein bißchen lächerlich.“ (Z. 62-66) Das Wort cool erhält durch die Kommunikation im Internet eine völlig neue Bedeutung: „Cool ist alles, was dort irgendwie originell, witzig und interessant ist.“ (Z. 69-71) Der englische Begriff Site wird in der englischen Originalform benutzt, oder man verwendet die deutsche phonetische analoge Seite, „was eigentlich falsch ist, denn eine ‚Web Site‘, also ein virtueller Ort im Internet bei einer bestimmten Adresse, besteht meist aus mehreren Seiten.“ (Z. 77-81) Trotz der Abwertung des Begriffes Seite wird es vom Autor ohne distanzierende Anführungszeichen wieder benutzt, was ein Zeichen von Objektivität seinerseits bedeuten könnte: „Manche Internet-Seiten werden regelrecht als virtuelle ‚Surfbretter‘ bezeichnet, [...] damit man von dort aus zu anderen Sites oder Seiten weitersurfen kann.“ (Z. 92-98) Die Entstehung des Verbs surfen wird vom Autor durch die phonetische Ähnlichkeit mit den Wörtern serv und surf erklärt. „Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zu Sprachspielen.“ (Z. 90-91) Weiterhin werden die Begriffe Webmaster und Sysop vom Autor erläutert: „Der Webmaster schließlich ist der Gestalter oder der Verantwortliche für eine Web Site, [...] und im Internet ist der Sysop, der System Operator, der die Aufgaben eines Überwachers, Animators, Koordinators oder Unterhalters übernimmt.“ (Z. 99-108) Anschließend macht Oehrlein die folgende aufwertende Äußerung: „Die bisher genannten Beispiele mögen zwar zeigen, auf welch originelle Weise im Englischen für neuartige, durch den technischen Fortschritt entstandene Sachverhalte oder Vorgänge neue Wörter gefunden, gebildet, umgedeutet werden, [...]“ (Z. 109-114).
Dabei beschränkt er sich nicht nur auf englische Wörter. Einerseits nennt er die in deutschsprachigen Computerprogrammen und Handbüchern regelmäßig benutzten Begriffe Hardware, Software, Diskette, booten, scannen, chatten, „die ohne Umschweife aus dem Englischen übernommen wurden und sich meist zu ‚ordentlichen‘ Neologismen mit deutschen Deklinations- oder Konjugationsformen entwickelt haben“ (Z. 120-125), wobei hier das Adjektiv in Anführungszeichen eine implizite Stellungnahme des Autors dazu bedeuten könnte. Er distanziert sich selbst von diesen Neologismen aber nicht, und damit wird ihre Durchsetzung im Sprachgebrauch anerkannt. Andererseits lobt Oehrlein die Funktion der Übersetzer und deutschen Programmierer bei der Adaption der englischsprachigen Computerprogramme: sie widmen sich „fast immer mit sprachlichem Feingefühl, sogar mit Phantasie und Witz ihrer Aufgabe“ (Z. 135-137). Er nennt eine Reihe von Begriffen aus der englischen Computerterminologie, „für die im Deutschen einleuchtende und treffende Entsprechungen gefunden wurden“ (Z. 146-148) und erklärt sie:
Dazu zählt Maus, die Bezeichnung für jenes Zeigegerät, das die Bedienung von Computern erheblich erleichtert und das den Namen seiner Form verdankt. Mit dem Wort Maus wurden im Deutschen einige Komposita geschaffen [...] Mauszeiger, Maustaste, Mausklick. Für die englischen Begriffe file und folder haben sich in deutschen Programmen Datei und Verzeichnis eingebürgert, womit ein unter einem einheitlichen Namen im Computer gespeichertes Datenkonvolut und die mehrere Dateien zusammenfassende übergeordnete Speichereinheit bezeichnet werden; neuerdings setzt sich statt Verzeichnis der Begriff Ordner durch, ein virtuelles Analogon zum realen Büro-Ordner. (Z. 149-167)
Damit wird die Frage, ob die Anglizismen im Computerbereich die Ohnmacht des Deutschen gegenüber dem schier übermächtigen Englischen zu belegen scheint (vgl. Z. 114- 117), vom Autor selbst beantwortet. Außerdem behauptet der Autor, daß das Betriebssystem Windows und das Textverarbeitungsprogramm Word wegen ihrer Reichweite sprachliche Standards setzen und sprachbildend in allen Idiomen wirken. In den jeweiligen anderssprachigen Versionen tragen sie auch den englischen Originalnamen, „wohl des internationalen Marketing-Effekts wegen.“ (Z. 180-181) An anderen Stellen im Artikel werden die englischen Begriffen Bugs und Cookies sowie das Wort Men ü, die Anrede im Internet mit Du oder Sie und die Entstehung neuer Textsorten, etwa Liesmich-Programme kommentiert.
Über die Notwendigkeit, für immer neue technische Vorgänge neue Begriffe zu erfinden, äußert sich der Autor teilweise abwertend: „Dabei sind auch im Deutschen bizarre sprachliche Kreationen entstanden, die sich längst zu allgemein gebräuchlichen Termini gewandelt haben. Treiber zum Beispiel.“ (Z. 248-253) Weiterhin macht Oehrlein den folgenden abwertenden Kommentar:
Die Geschwindigkeit, mit der der Datenaustausch vonstatten geht, verführt ihn zu immer größerer Oberflächlichkeit in der Benutzung der Schriftsprache. Das läßt sich etwa in den „Chat-Kanälen“ beobachten, virtuellen „Räumen“, in denen Internet-Benutzer in aller Welt zeitgleich über die Computer- Tastatur schriftliche Nachrichten austauschen können, oder in den „Newsgroups“, den virtuellen Schwarzen Brettern im Internet. Die Sprache wird dort einem gewaltigen Martyrium ausgesetzt, das allerdings auch in unerbittlicher Deutlichkeit Defizite in der schulischen Spracherziehung der Benutzer offenbart. (Z. 411-426)
Dagegen ist einzuwenden, das es eine Menge Aspekte der kommunikativen Situation in Chats und Newsgroups gibt, die vom Autor nicht berücksichtigt werden. Die Geschwindigkeit des Datenaustausches in den Chat-Kanälen führt zu einer anderen Form in der Benutzung der Schriftsprache, die keinesfalls oberflächlich ist und mit keinen Defiziten der schulischen Spracherziehung zusammenhängt. Im Chat findet z.B. eine „Hybridisierung von Kommunikationsformen gesprochener und geschriebener Sprache zwischen den Polen medialer und konzeptueller Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ statt (Runkehl/ Schlobinski/ Siever, 1998, S. 84). Emoticons, Abkürzungen und Verbstämme haben eine expressiv- emotive Funktion und können aufgrund ihrer Kommunikativen Funktionen „als eine Kompensationsstrategie für den Gebrauch verbaler und non-verbaler Merkmale in der gesprochenen Sprache begriffen werden.“ (S. 99) „Orthographic reduction and omission of pronouns, etc. also resembles phonological reduction and elipsis in rapid, informal speech, rendering Chat exchanges „speech-like“ in their degree of informality as well.“ (Werry, 1996, S. 56) In Newsgroups weist der Sprachgebrauch viele Merkmale gesprochener Sprache auf, und wird „sehr stark von der Kommunikationssituation des Dialoges beeinflußt [...] In ihrer Struktur ähneln die Artikel der traditionellen Briefform, es werden jedoch sprachliche Mittel verwendet, die durch das elektronische Medium unterstützt werden.“ (Feldweg/ Kibiger/ Thielen, 1995, S. 150)4
Es werden Aspekte des Datenaustausches im Internet in anderen kommunikativen Situationen von Oehrlein aufgewertet:
Eine für die Sprache positive Folge des weltweiten Datenverkehrs über Computer ist aber, daß überhaupt wieder mehr geschrieben wird. Das dem Post- und selbst dem Fax-System in Konfort und Geschwindigkeit überlegene E-Mail-Verfahren - der Versand von elektronischen Briefen über das Internet - hat dem schriftlichen Gedanken- und Informationsaustausch wieder unerwarteten Auftrieb gegeben. (Z. 427-437)
Oehrleins sprachkritische Haltung unterscheidet sich von der der Autoren in „High-Tech- Deutsch“ (StZ, 26.03. 1994) und „Begegnung mit dem Deutsch von morgen“ (Die Zeit, 19.05. 1995), indem er keine Allgemeinverständlichkeit wegen Anglizismen fordert. Er scheint gewissermaßen „objektiv“ zu sein, da er die Computerbegriffe jedesmal erklärt, wenn sie im Artikel angeführt werden. Ein paar Beispiele dazu: „[...] seit es eine einheitlich im Internet benutzte, Computern verständliche Norm (HTML) gibt, die den Austausch nicht nur von Texten, sondern auch graphischen und akustischen Elementen ermöglicht“ (Z. 54-59); oder: Ein Menü ist „zu einem der wichtigsten Hilfsmittel geworden, um ein Programm überhaupt zu bedienen: eine Folge von Befehlen, die man mit der Maus anklicken und so aktivieren kann.“ (Z. 183-187) Bezüglich des Einflusses der neuen Medien behauptet er:
In welche Richtung sich die deutsche Sprache durch den Einfluß der Computerwelt weiter entwickeln wird, läßt sich nur schwer erahnen. Sie muß ja nicht nur immer wieder neue Wörter aufnehmen; viele Begriffe, die sich mit einer populären Neuerung eingebürgert hatten, verschwinden auch wieder, sobald die einstige Neuentwicklung überholt ist und in Vergessenheit gerät. Auf diese Weise sind sogar ganze Unter-„Sprachen“ wieder untergegangen, wie etwa einige Programmiersprachen der Computer-Frühzeit mit all ihren Fachbegriffen. (Z. 438-451)
Trotz einiger Abwertungen vertritt der Autor keinesfalls die These vom Sprachverfall. Das läßt sich am besten durch seinen Kommentar am Ende des Artikels beweisen:
Sich darob zu entrüsten, daß wir nicht mehr das Deutsch Goethes sprechen, ist müßig. Wer gelassen die Dinge betrachtet, entdeckt neben einigen nicht allzu gravierenden Fehlentwicklungen ganz normale, gesunde Reaktionen der deutschen Sprache auf die Herausforderung durch die technische CyberRevolution. In seiner Substanz ist das Deutsche nicht gefährdet. Es wird durch die aus der Computersphäre stammenden Neologismen ja nicht nur belastet, sondern auch bereichert. Zahlreiche Wörter aus der Computer-Cyberwelt haben überdies längst den Weg in die Alltagssprache gefunden. Auch wer nicht mit Rechnern und Internet zu tun hat, benutzt inzwischen unbekümmert Begriffe wie Schnittstelle oder Hotline. Und ein zeitgemäßes Kompliment für eine schöne Frau mag es sein, wenn ein Computermensch sagt: „Die hat eine tolle Hardware.“ (Z. 452-473)
5. Zusammenfassung
Die hier untersuchten Zeitungsartikel sollen zeigen, in welcher Weise sich die Autoren mit dem Thema Computer, Internet und der deutschen Sprache auseinandersetzen. Ein gemeinsamer Punkt, der in den meisten Artikeln besprochen aber unterschiedlich behandelt wird, ist die Frage, wohin die sprachliche Entwicklung durch die neuen Medien gehen wird. Für einige ist sie ungewiß oder läßt sich schwer erahnen, für andere führt sie in den Verfall der deutschen Sprache oder in die Unverständlichkeit. Die These vom Sprachverfall und die Forderung nach Allgemeinverständlichkeit ist vorherrschend. Dabei sind einige kontroverse Begriffe entstanden, um diesen Prozeß des Sprachverfalls oder der Unverständlichkeit aufzuzeigen, nämlich „High-Tech-Deutsch“ (StZ, 26.03. 1994), das „Deutsch von morgen“
(Die Zeit, 19.05. 1995), „die Zukunft der Sprache“ (SZ, 11.03. 1997) und „flockig mit PC“ (SZ, 27.03. 1999). Jung (1995) zufolge hat die Klage gegen Fremdwörter in den achtziger Jahren aber noch eine neue Dimension angenommen, die direkt mit der Stellung des Englischen innerhalb des deutschen Wortschatzes zu tun hat: Angesichts der technisch- wissenschaftlichen Dominanz der USA wird auch die Fachterminologie, insbesondere in neuen Technikbereichen, immer stärker von Amerikanismen beherrscht (prominentes Beispiel: EDV). (S. 265)
Die Untersuchung von nur sieben Zeitungsartikeln kann nicht als repräsentativ betrachtet werden. Trotzdem, und gestützt auf die Ergebnisse, scheint diese Klage gegen Fremdwörter, insbesondere im Bereich des Computers und Internet, in den neunziger Jahren in einigen der untersuchten Zeitungsartikeln weiter zu geschehen. Jung (1995) spricht auch von der seltenen Thematisierung der „Unübersichtlichkeit“ beim tatsächlichen Fremdwörtergebrauch. Das Thema wird trotzdem in zwei der Artikel behandelt, nämlich in „High-Tech-Deutsch“ (StZ, 26.03. 1994) und „Begegnung mit dem Deutsch von morgen“ (Die Zeit, 19.05. 1995) Das bedeutet aber nicht, daß das die Tendenz ist. Weiterhin stellt Jung (1995) die folgende Frage: „Wird die sprachliche Anglisierung als kulturelle Amerikanisierung empfunden und ist als solche erwünscht [...], oder wird sie abgelehnt?“ (S. 279) In den oben genannten Artikeln („High-Tech-Deutsch“ (StZ, 26.03. 1994), „Begegnung mit dem Deutsch von morgen“ (Die Zeit, 19.05. 1995) und „Flockig mit Faustkeil oder PC“ (SZ, 27.03. 1999)) werden Anglizismen als kulturelle Amerikanisierung empfunden und infolgedessen abgelehnt.
Die Rolle der Sprachwissenschaft im Umgang mit den neuen Medien wird in den Artikeln, in denen es überhaupt thematisiert wird, als negativ bezeichnet. Und die Rolle der Übersetzer bei der Adaption der englischsprachigen Computerprogramme wird einmal gelobt: sie widmen sich ihrer Aufgabe „fast immer mit sprachlichem Feingefühl, sogar mit Phantasie und Witz“ (FAZ, 05.12. 1998) und ein anderes Mal abgewertet: es wird „erst einmal noch das Klarste verunklärt.“ (Die Zeit, 19.05. 1995). Bei einigem stimmen zwei der Autoren überein: es wird wieder mehr geschrieben (FAZ, 05.12. 1998/ StZ, 20.03. 1999). Über die Untersuchung von E-Mails, Chats und Newsgroups werden die Ergebnisse einiger Sprachwissenschaftler dargestellt oder sie von den Autoren der Zeitungsartikel meistens knapp kommentiert.
In der Zeitschrift Focus (32, 9.08. 99) wird die folgende Äußerung gemacht: „Die Welt spaltet sich wieder - nicht in Arm und Reich, sondern in Menschen mit Internet-Zugang und ohne. Gehören Sie zur Generation @?“ Bilder von Kindern und Jugendlichen werden ebenfalls beigefügt. Eine Grafik mit dem Titel „Die Welt im Online-Fieber“ wird im Spiegel (11, 15.03. 1999) dargestellt. Es wird die Gesamtzahl der im Internet verbundenen Rechner gezeigt, die in den letzten 6 Jahren von 1,3 bis 43,2 Millionen aufgestiegen ist. Dabei wird die
Gesamtzahl der Internet-Nutzer in der Welt auf 163,3 Millionen geschätzt. Diese Bilder und Grafiken sind mit dem verbunden, was Pörksen (1998) als Visiotype definiert:
Die Visiotype sind inzwischen eine ganze Zeichenwelt. Mit dem Ausdruck ist zweierlei gemeint: ein Denkstil und ein global wirksames Zeichen. Auf der einen Seite denke ich an eine bestimmte Art des visuellen Zugriffs auf die Realität, an einen Typus standardisierter Veranschaulichung. Es gibt da eine breite Skala von typischen Formen, Zahlenbilder oder Instrumentenbilder oder Figuren zu präsentieren: >Visiotype< im allgemeineren Sinn. (S. 13)
Weiterhin kommentiert er, daß Visiotype „zu Sozialwerkzeugen, zu Handlungsträgern von Weltwirkung“ werden können (S. 22). Einige Fragen, die zu beantworten wären, sind: wie werden Bilder über Computer und das Internet mit bestimmten Wörtern in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen assoziiert? Welche gedankliche Größe entsteht durch diese Assoziationen? Welche Handlungen werden dadurch beim Leser erzeugt? Diese Fragen könnten einen Umriß für eine weitere Forschung auf diesem Gebiet abgeben.
Literaturverzeichnis
Diem, Christoph; Groumas, Helen; Jeske, Karin (1997). „Usertalk. Beobachtungen und Überlegungen zu einer Sprache über den Computer“. In: Muttersprache 2, 149-167.
Feldweg, Helmut; Kibiger, Ralf; Thielen, Christine (1995). „Zum Sprachgebrauch in deutschen Newsgruppen“. In: Schmitz, Ulrich (Hg.). Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie (OBST). Bd. 50. Oldenburg, 143-154.
Graff, Bernd (1997). „Spracherkennungsdienste. Der ganz ‚Große Lauschangriff‘ der Computer“. In: Süddeutsche Zeitung, 11.03. 1997
Hartmann, Elke (1999). „Die Generation @“. In: Focus 32, 09.08 1999
_____________ (1994). „High-Tech-Deutsch. Ist die Gegenwartssprache noch »unser«?“. In: Stuttgarter Zeitung, 26.03. 1994
Jung, Mattias (1995). „Amerikanismen, ausländische Wörter, Deutsch in der Welt. Sprachdiskussionen als Bewältigung der Vergangenheit und Gegenwart“. In: Stötzel, Georg; Wengeler, Martin. Kontroverse Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, New York, 245-283.
Knei, Ansbert (1999). „Ein Dorf namens Babylon“. In: Spiegel 11, 15.03. 1999
Koch, Peter; Oesterreicher, Wulf (1994). „Schriftlichkeit und Sprache“. In: Günther, Harmut; Ludwig, Otto (Hg.). Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. HSK 10.1. Berlin, New York, 587-603.
Lenke, Nils; Schmitz, Peter (1995). „Geschwätz im ‚Globalen Dorf‘ - Kommunikation im Internet“. In: Schmitz, Ulrich (Hg.). Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie (OBST). Bd. 50. Oldenburg, 117-141.
Lüger, Heinz-Helmut (1995). Pressesprache. Tübingen.
Marx, Heike (1999). „Die schriftliche Mündlichkeit. Mannheimer Tagung zum Thema ‚Sprache und neue Medien‘“. In: Stuttgarter Zeitung, 20.03. 1999
Oehrlein, Josef (1998). „Schöne Grüße von Webmaster und Sysop. Booten, scannen und chatten: Computer, Internet und die deutsche Sprache“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.12. 1998
Polenz, Peter von (1991). Deutsche Sprachgeschichte. Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1. Berlin, New York.
Pörksen, Uwe (1988). Plastikwörter. Die Sprache einer internationalen Diktatur. Stuttgart.
Pörksen, Uwe (1998). Logos, Kurven, Visiotype . Leipzig.
Runkehl, Jens; Schlobinski, Peter; Siever, Torsten (1998). Sprache und Kommunikation im Internet. Überblick und Analysen. Opladen, Wiesbaden.
Schiewe, Jürgen (1998). Die Macht der Sprache . Eine Geschichte de r Sprachkritik von der Antike bis zur Gegenwart. München.
Schütz, Rüdiger (1995). „Nachts in Cyberspace“. In: Schmitz, Ulrich (Hg.). Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie (OBST). Bd. 50. Oldenburg, 107-115.
Schulte, Bettina (1996). „Am Computer kann man so richtig reden“. In: Badische Zeitung, 05.03. 1996
Stötzel, Georg (1980). „Konkurrierender Sprachgebrauch in der deutschen Presse. Sprachwissenschaftliche Textinterpretationen zum Verhältnis von Sprachbewußtsein und Gegenwartskonstitution“. In: Wirkendes Wort 30, 39-53.
Stötzel, Georg (1990). „Semantische Kämpfe im öffentlichen Sprachgebrauch“. In: Stickel, Gerhard (Hg.). Deutsche Gegenwartssprache . Tendenzen und Perspektiven. Berlin, New York, 45-65.
Stötzel, Georg; Wengeler, Martin (1995). Kontroverse Begriffe. Geschichte des öffentlichen Sprachgebrauchs in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, New York.
Unterstöger, Hermann (1999). „Flockig mit Faustkeil oder PC. Wissenschaftler streiten sich um die Veränderung der Sprache durch die neuen Medien“. In: Süddeutsche Zeitung, 27.03. 1999
Wahrig, Gerhard (1997). Deutsches Wörterbuch. (6. neu bearb. Aufl.). Gütersloh. Weingarten, Rüdiger (Hg.). (1997). Sprachwandel durch Computer. Opladen.
Werry, Christopher C. (1996). „Linguistic and Interactional Features on Internet Relay Chat“. In: Herring, Susan C. (Hg.). Computer-mediated Communication. Linguistic, Social and Cross-cultural perspectives. Amsterdam, 47-63.
Zimmer, Dieter (1995). „Begegnung mit dem Deutsch von morgen“. In: Die Zeit, 19.05. 1995
[...]
1 Hier orientiert sich dieser Geschichtsbegriff an dem Ansatz von Schiewe (1998): „Geschichte wird hier begriffen als Produkt menschlicher Sprechtätigkeit in historisch wirksamen Situationen. [...] Nur das erscheint relevant für eine Geschichte der Sprachkritik, was in irgendeiner Weise auf die Entwicklung der Sprache und auf das Denken über Sprache Einfluß genommen hat.“ (S. 23-24)
2 Der Begriff wird von Anfang an des Aufsatzes von den Autoren benutzt und so definiert: „Dem Ausdruck, dem sich diese Arbeit nähert, ist das sprachliche Äquivalent jener computer literacy, [...] Diese Sprachform, der Usertalk, ist jedenfalls auf dem besten Wege, die Sprache der Alphabetisierten des digitalen Zeitalters zu werden. [...] Usertalk [...] bezeichnet die Kommunikation zwischen Benutzer und Benutzer, in der Regel mit dem einzigen gemeinsamen Referenzobjekt »Computer«.“ (Diem/ Groumas/ Jeske, 1997: 150, 165)
3 „Die sprachkonservative Haltung: Veränderungen im Sprachgebrauch wird einseitig nur als Verlust eines alten, positiv bewerteten Sprachzustandes gesehen (Sprachverfall, Sprachverderb, Sprachzerstörung). Dabei werden die Veränderungen der gesellschaftlichen Kommunikationsbedürfnisse und die Entstehung neuer, differenzierterer Ausdrucksmittel ignoriert oder nicht akzeptiert. [...] Die sprachpuristische Haltung: Aus anderen Sprachen entlehnte Wörter und Wendungen werden pauschal als Fremdwörter, Eindringlinge, Anglizismen usw.
4 An dieser Stelle werde ich auf das Thema Chat und Newsgroups nicht mehr eingehen. Für eine ausführlichere Detaillierung vgl. außer der oben zitierten Literatur u.a. Schütz (1995), Lenke/ Scmitz (1995) und Weingarten (1997).
- Arbeit zitieren
- Gabriel Dorta Méndez (Autor:in), 1999, Computer, Internet und Deutsch. Sprachkritische Äußerungen über den Einfluß der neuen Medien auf die deutsche Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103397
Kostenlos Autor werden













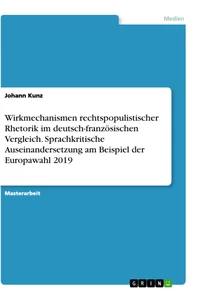





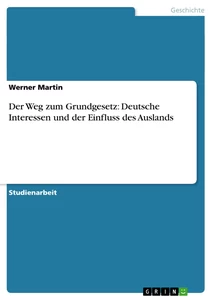


Kommentare