Leseprobe
Warum das tugendhafte Leben des Einzelnen bei Platon Voraussetzung für die Verwirklichung eines gerechten Staates ist
Die Philosophie Platons gehört mit anderen Griechischen Philosophien aus der Antike zu denen, deren Ethik - neben der des Christentums - „zum zweiten Grundpfeiler der abendländischen Kultur“1 wurden und deshalb unsere westliche Gesellschaft bis heute nachhaltig geprägt haben. Und obwohl sie bereits über 2000 Jahre alt ist, ist sie meiner Meinung nach immer noch von faszinierender Modernität.
Ich möchte mich im Folgenden mit dem Dialog „Thrasymachos“ beschäftigen, der in der Politeia I zu finden ist, wobei ich im Besonderen auf den dort entwickelten Begriff der Ge- rechtigkeit eingehen werde, sowie der Frage, inwiefern das tugendhafte Leben des Einzelnen zur Verwirklichung eines gerechten Staates beitragen kann, weniger aber auf den in den Büchern II bis X entwickelten Staatsbegriff. Ursprünglich, darin sind sich die Platonforscher weitge hend einig, war dieser Dialog vermutlich aus der frühen Periode Platons, welcher ihn erst später der Politeia, quasi als eine Art Einleitung voranstellte. Wie der Charmides die Besonnenheit, der Euthyphron die Frömmigkeit, der Laches die Mannheit und der Protagoras - in dem alle fünf menschlichen Tugenden zu einem System vereinigt sind - die Weisheit, behandelt der Thrasymachos einen zentralen Aspekt der menschlichen „arete“ (Bestheit, Tugend).
Um den in der Politeia Buch I entwickelten Gerechtigkeitsbegriff verstehen zu können, halte ich es zunächst einmal für notwendig, eine kurze Zusammenfassung des Textes zu geben. Dabei werde ich mich an die Übersetzung Schleiermachers halten und bei Zitaten auch die allgemein bekannte Nummerierung der Dialoge verwenden.
Der Thrasymachos-Dialog
Auch dieser Dialog hat, wie alle platonischen Dialoge einen „alltäglichen“ Hintergrund, d.h. er entspringet einer Szenerie, die sich auc h im Leben jedes anderen Menschen so ereignen könnte, darin liegt meiner Meinung nach auch der große praktische Bezug der Philosophie Platons - nicht zuletzt mag das auch an der Art gelegen haben, wie Sokrates seine Philosophie betrieben hat; wie die Sophisten zog er durchs Land und suchte den Kontakt zu den Menschen im Gespräch, nur dass er nicht vordergründig den Anspruch hatte, die Leute zu belehren und dafür womöglich noch Geld zu nehmen, wie die Sophisten dies taten, sondern stets nur auf der Suche nach der Wahrheit war. Dies unterschied ihn dann auch von den Letzteren, und wie sein Schüler Platon - der die Sophistik sogar bekämpft und zu überwinden trachtet2 - legte er großen Wert auf diese Unterscheidung.
Der Ausgangspunkt bzw. Hintergrund für diesen Dialog ist folgender: Sokrates ist mit Glaukon, einem Bruder Platons auf einem Fest zu Ehren der Göttin Bendis im Peiraieus gewesen und ist gerade im Begriff, dieses zu verlassen, als Polemarchos, der Sohn des Kepha- los einen Boten schickt, dem er selb st und einige andere kurz darauf folgen, um Sokrates zu bewegen, wieder mit ihnen zum Fest zurückzukehren. Es gelingt ihnen, Sokrates und Glaukon zu überreden, noch eine Weile mit ihnen auf dem Fest zu bleiben, da am Abend noch sehens- werte „Happenings“ stattfinden werden. Aus dieser Situation heraus entwic kelt sich im Hause Kephalos - ein reicher alter Mann aus Syrakus - ein Gespräch mit selbigem über das Alter, wie dieser jenes wohl empfinde. Kephalos meint, die Meisten seines Alters würden stets „den Vergnügungen der Jugend sehnsüchtig gedenken“ (329a) und deren Verlust beklagen; außer- dem beschwerten sich viele, dass ihre Angehörigen sie nun, aufgrund ihres Alters schlechter behandelten. Kephalos hingegen genießt die Ruhe vor diesen Dingen und den Vergnügen der Jugend und empfindet keine Ungerechtigkeit, die ihm wegen seines Alters zuteil würde. So- krates erwidert darauf, dass die Leute sagen, Kephalos hätte Vorteile im Alter wegen seines Reichtums, und nach einem kurzen Diskurs, ob Kephalos sein Vermö gen ererbt oder selbst verdient hätte, fragt Sokrates ihn, was der größte Vorteil sei, den Kephalos durch sein großes Vermögen gehabt hätte. Nach Kephalos ist der größte Vorteil des Reichtums, dass dem Wohlgesinnten (und nur ihm) der Reichtum nützlich ist, weil er von diesem Geld alle seine „irdischen“ Schulden bezahlen kann, was er auch als Gerechtigkeit bzw. als gerecht sein emp- findet, und nicht schlechten Gewissens und daher voller Furcht vor der Unterwelt seinem Le- bensende entgegen tritt. Hierauf folgt Sokrates´ Frage, ob das Wesen der Gerechtigkeit sei, dass man die Wahrheit spricht und anderen nichts schuldig bleibt. Sokrates findet zu dieser Theorie eine Menge Gegenbeispiele, wenn jemand nämlich von einem Freund „der ganz bei besonnenem Mute war“ (331c) Waffen erhalten hat, und dieser Freund die Waffen, „im Wahnsinn“ (ebd.), zurückfordert, täte man alles andere als Recht tun. Polemarchos argumen- tiert, dass es nach Simonides, einem bekannten Dichter aus Keos dennoch so sei, dass Ge- rechtigkeit „einem jeden das Schuldige zu leisten“ (331e) ist. Da sich hierzu aber das bereits erwähnte Gegenbeispiel finden lässt stellt sich die Frage, wie die These des Simonides also zu verstehen ist. Polemarchos antwortet: „Freunden ... seien Freunde schuldig, Gutes zu tun, Bö- ses aber nicht“ (332a), während man den Feinden alles zurückgeben sollte, zumal man Fein- den meistens eh nur Übles schuldig sei. Ist Gerechtigkeit also, den Freunden Gutes zu tun und den Feinden Böses? Das würde heißen, Gerechtigkeit ist die Kunst, jedem das Gebührende abzugeben, und dies würde man dann das Schuldige nennen, woraus sich wiederum die Frage ergibt, wer oder was es ist, dem die Kunst der Gerechtigkeit das Gebührende abgibt. Polemar- chos antwortet, der Kriegsführung und Bundesgenossenschaft gibt die Kunst der Gerechtig- keit das ihnen Gebührende ab, so wie die Kochkunst den Speisen das Schmackhafte als das ihnen Gebührende abgibt, oder die Heilkunst die dem Leibe Arznei als das ihm Gebührende abgebende Kunst ist. Sokrates argumentieret weiter, dass die Gerechtigkeit aber auch im Frie- den nützlich ist, was ist es also, zu dem sie auch im Frieden nützlich ist? Die Antwort des Polemarchos ist, zu Verhandlungen bei denen es um Geldsachen geht, jedoch zeigt Sokrates, dass im Geldsachen, wie z.B. im Anlegen desselben - und das scheint das Einzige zu sein, wozu das Geld im Frieden der Gemeinschaft nützlich ist - die jeweiligen Sachverständigen mehr Ahnung haben als der Gerechte. Polemarchos weicht aus, indem er sagt, dass er vom Zurücklegen von Geld sprach, darauf Sokrates: „Also wenn das Geld unnütz ist, dann ist die Gerechtigkeit nützlich dazu?“ Verhält es sich mit allen anderen Dingen, wie z.B. der Hippe, der Leier oder dem Schwert genauso, dass ihnen, wenn sie nicht benutzt werden die Gerech- tigkeit nützlich sei, wenn sie benutzt werden aber die ihnen jeweils zugehörige Kunst? Wenn dem so ist, wäre die Gerechtigkeit wohl kaum etwas sehr Wichtiges, das hieße nämlich, dass sie nur in Bezug auf das Unnütze nützlich sei.
Geht man dennoch davo n aus, dass der Gerechte gut ist im Hüten von Geld, so liegt es auf der Hand, dass er auch gut darin ist, es zu stehlen bzw. zu unterschlagen, also ist der Gerechte gleichzeitig ein Listiger. Demnach sieht es so aus, als sei die Gerechtigkeit die Überlistung zum Nutzen der Freunde und zum Schaden der Feinde. Polemarchos ist verwirrt, hält aber daran fest, dass Gerechtigkeit den Freunden nutzt, den Feinden aber schadet. Was also sind Freunde und Feinde, fragt Sokrates, viele Menschen irren sich in ihrer Ansicht, wer ihnen Freund und wer Feind ist, da sie glauben, Freund ihrer sei, wer sich ihnen gegenüber gut ver- hält, und Feind der, der sich bösartig verhält, dabei sei es doch in der Realität oft umgekehrt. Da nun aber, wie sich aus dem vorher Gesagten ergibt, die Freunde die Guten und damit die Gerechten sind, kann es also sein, dass man ihnen Unrecht tut, weil man sie für die Bösarti- gen, die Feinde hält, und dies wäre danach gerecht. Polemarchos entwickelt darauf eine neue These: Den Ungerechten zu schaden, den Gerechten zu nutzen ist gerecht. Im Falle aber des sich Verstellenden, also des eigentlichen Feindes, der gut und gerecht erscheint und dem man daher nutzt, oder dem eigentlichen Freund, der bösartig und ungerecht erscheint, und dem man daher schadet, erreicht man dann genau das Gegenteil. Nun macht Polemarchos sich daran, Freund und Feind noch einmal ganz genau zu bestimmen. Freund ist der, der nicht nur gutartig scheint, sondern es auch ist, Feind der, der nicht nur bösartig scheint, sondern es auch ist. Es ist legitim, ersterem zu nutzen, zweitem aber zu schaden. Ist es aber gerecht, auch nur irgendeinem Menschen zu schaden? Wenn man Menschen schadet, werden sie schlechter in Bezug auf ihre Tüchtigkeit und Tugend, so wie Pferde schlechter werden in Bezug auf ihre Tüchtigkeit, wenn man ihnen schadet. Die Gerechtigkeit aber ist eine menschliche Tugend, Menschen werden also ungerechter, wenn man ihnen schadet. Wie aber der Tonkünstler durch seine Tonkunst andere nicht untonkünstlerisch machen kann, so kann auch der Gerechte durch seine Gerechtigkeit andere nicht ungerecht machen, sondern nur das Gegenteil! Es ist also in keiner Weise Sache der Gerechtigkeit, auch nur irgendjemand zu schaden, auch den Feinden nicht. Die Ausgangsthese des Simonides ist somit widerlegt, Gerechtigkeit kann nicht sein, jedem das ihm Schuldige abzugeben, sofern man damit meint, den wahren Freun- den schulde man Nutzen und den wahren Feinden Schaden. Wieder sind Sokrates und die anderen bei ihrer Ausgangsfrage, was das Wesen der Gerechtigkeit nun ausmache. An dieser Stelle erfährt der Dialog einen Bruch, als Thrasymachos im Geschehen auftaucht und unver- mittelt Aggression und Dynamik in den Dialog bringt; die besonnen Ruhe des bisherigen Ge- sprächs weicht einer Unruhe, da Thrasymachos ein ziemlich aggressives Verhalten Sokrates und Polemarchos gegenüber an den Tag legt. Er wirft Sokrates „leeres Geschwätz“ (336b) vor, „und was für Albernheiten treibt ihr miteinander, indem ihr euch immer nur schmiegt und biegt einer vor dem andern? “ (336c) fragt er sie. Thrasymachos verurteilt Sokrates´ Dialog- führung, dieser frage stets nur, und widerlege dann die Antworten des anderen, was leichter sei, als selbst Antworten zu geben. Weiterhin stellt er Sokrates zur Rede, was Gerechtigkeit denn jetzt ist, und er solle nicht sagen, es sei das Pflichtmäßige oder das Nützliche oder das Zweckmäßige oder das Vorteilhafte oder das Zuträgliche, „sondern deutlich und genau sage, was du davon sagst“ (336d). Sokrates ist erschrocken, verzagt und sogar etwas eingeschüch- tert von Thrasymachos´ aufgebrachter Rede, er bedauert, nichts „Handfestes“ als Ergebnis der Untersuchung gefunden zu haben und hält es für angebrachter, ihn und Polemarchos zu be- mitleiden, anstatt ihrer zu zürnen, worauf Thrasymachos ihm die für ihn doch angeblich so bekannte Verstellung vorwirft. Ich kann mich an dieser Stelle des Eindrucks nicht erwehren, dass Sokrates hier ziemlich ironisch, wenn nicht sogar sarkastisch wird, da er sich Thrasyma- chos´ unbeherrschter Art gegenüber überlegen fühlt. Dieses Verhalten des Sokrates dem Thrasymachos gegenüber verwundert nicht weiter, wenn man bedenkt, dass Thrasymachos im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Athen als Sophist tätig war und Sokrates, wie schon erwähnt nicht besonders viel von diesen hielt und sich bewusst von ihnen abgrenzte. Meines Erachtens macht Sokrates sich nun über Thrasymachos lustig (337b, „du Wunderba- rer“), was man ihm auch nicht verdenken kann angesichts des verbalen Angriffs, den er ge- rade über sich erge hen lassen musste, und ist dennoch im Begriff, mit dem zu antworten, was Thrasymachos ihm „verboten“ hat. Jetzt kündigt Thrasymachos eine Antwort auf die Frage nach der Gerechtigkeit an. Sokrates behauptet, er möchte gern von Thrasymachos lernen, was Gerechtigkeit sei, letzterer verlangt dafür jedoch Geld. Da Sokrates kein Geld hat, bietet Glaukon ihm finanzielle Hilfe an. Sokrates ist sehr gespannt auf Thrasymachos Antwort, da er selbst keine Antwort auf die Frage weiß und auch nicht behauptet, eine zu wissen; Thrasyma- chos brüstet sich und ist stolz, antworten zu dürfen, möchte aber auch durchsetzen, dass So- krates der Antwortende ist und nicht der Fragende wie ge wöhnlich. Schließlich sieht Thrasy- machos aber ein, dass dies „eben die Weisheit des Sokrates [ist]: Selbst will er nichts lehren, aber bei andern geht er umher, um zu lernen, und weiß es ihnen dann nicht einmal Dank.“ (338b). Sokrates ist der Ansicht, Thrasymachos tue ihm im 2. Punkt unrecht, denn er bedanke sich wohl, jedoch mit Lob und nicht mit Geld, da er solches nicht habe.
Die These des Thrasymachos lautet dann also: Das Gerechte ist das dem Stärkeren Zuträg- liche. Das sich darauf einstellende Unverständnis des Sokrates, was dies zu bedeuten habe, legt Thrasymachos als Bosheit aus: „[Du] fasst die Rede so auf, wie du sie am übelsten zu- richten kannst“ (338d), und erläutert seine These am Beispiel von Staaten. Jede Regierung erlässt Gesetze nach dem, was ihr zuträglich ist, die Demokratie demokratische, die Tyrannei tyrannische oder die Aristokratie aristokratische. Diese Gesetze sind die für die Regierung nützlichsten und geben sich in ihrem jeweiligen System als gerecht für die Regierten aus, auch wenn sie das in einem anderen System vielleicht nicht wären. Derjenige, welcher die Gesetze übertritt wird als unrecht handelnd angesehen und bestraft. Es bestimmt also die je- weilige Regierung, was gerecht ist und was nicht, und diese wird immer das ihr Zuträgliche wählen; da die Regierung aber auch der Stärkere ist, ist das Gerechte das dem Stärkeren Zu- trägliche.
Sokrates versteht das Gemeinte zwar, gibt aber zu bedenken, dass Thrasymachos eine der Antworten gewählt hat, die ihm, Sokrates untersagt worden sind, nämlich, das Gerechte sei das Zuträgliche nur mit dem Zusatz „das dem Stärkeren“. Thrasymachos sträubt sich gegen diese Behauptung, seiner Ansicht nach ist dieser Zusatz das Entscheidende, worauf Sokrates meint, dies müsse erst einer Prüfung unterzogen werden: Den Regierenden gehorchen gilt als gerecht, aber die Regierenden sind fehlbar, das gesteht auch Thrasymachos ein. Dies führt dazu, dass einige der Gesetze, die sie erlassen richtig, andere aber falsch sind. Richtig ist da- bei das ihnen Zuträgliche, falsch das ihnen Unzuträgliche. Fehlen sie also, erlassen sie aus Versehen Gesetze, die ihnen unzuträglich sind, und diese gelten dennoch als gerecht nach der Definition, da der Regierende ja glaubt, es sei ihm zuträglich. Polemarchos wirft ein, Thrasy- machos meint, das für den Stärkeren Zuträgliche sei das, was dieser für zuträglich hält, Thra- symachos aber verneint dieses und fragt: „Meinst du denn, ich nenne den Stärkeren den, der sich irrt, eben wenn er sich irrt?“ (340c) Sokrates hat es wohl genauso aufgefasst, worauf Thrasymachos ihn erneut „ein Verdreher in Reden“ nennt. Thrasymachos meint nämlich, auch ein Arzt ist nicht ein richtiger Arzt, wenn er sich oft irren würde. Ein wirklicher Arzt fehlt niemals, kein Meister fehlt jemals, denn wenn ihn seine Wissenschaft im Stich lässt, fehlt er, weil er eben kein wirklicher Meister ist. Gleiches gilt für den Regierenden, er wird, sofern er ein wirklicher Regierender ist, niemals fehlen und stets das für ihn Beste festsetzen. Hierauf folgt erneut ein kurzer Wortwechsel zwischen Thrasymachos und Sokrates, in dem Thrasymachos meint, Sokrates hätte wieder versucht, zu verfälschen und verdrehen, es sei ihm aber nicht gelungen. Nach Thrasymachos ist der wahrhafte Regent (Regierende) der, der sich nie irrt. Sokrates möchte dagegen gar nichts einwenden, „du meinst also wohl, ..., ich könnte so unsinnig sein, dass ich versuchte, eine Löwen zu scheren oder den Thrasymachos in Reden zu übervorteilen?“ (341b/c) - an diesem Ausspruch kann man meines Empfindens nach wieder die Ironie beobachten, die Sokrates Thrasymachos entgegenbringt.
Sokrates stellt eine neue These auf: Da in keiner wahrhaften Kunst Schlechtigkeit oder Fehler zu finden sind, bedarf die wahrhafte Kunst - mit Kunst ist hier auch Fähigkeit oder Fertigkeit gemeint - auch nicht einer anderen um das ihr Zuträgliche zu besorgen, da sie selbst vollkommen ist als die Kunst, die sie ist. Wie die Reitkunst nicht das der Reitkunst Zuträgliche besorgt, sondern das den Pferden, so regieren alle Künste und haben Gewalt über jenes, dessen Künste sie sind, woraus folgt, dass „keine Wissenschaft ... das dem Herrschen- den Zuträgliche [besorgt und befiehlt], sondern das dem Schwächeren und von ihr selbst be- herrschten“ (342 c/d). Der Arzt z.B. sieht nie auf das dem Arzt Zuträgliche, sondern auf das dem Kranken. Jeder Regierende, auch der Herrscher, wird es so ha ndhaben, dass er nicht auf das ihm als Stärkeren Zuträgliche schaut, sondern auf das dem Schwächeren, denn das ist die einzige Aufgabe seiner Kunst. Hierauf setzt Thrasymachos zu einem Gegenschlag an: Schäfer und Hirten kümmern sich nicht um die Schafe und Rinder um derentwillen, wenn sie sie füt- tern und hüten, sondern um ihrer selbst willen, da sie die Tiere zu ihrem Lebensunterhalt und Broterwerb züchten. Gleiches gelte wohl für die Herrschenden in den Städten, die nur darauf bedacht sind, „wie sie sich selbst den meisten Vorteil schaffen können“ (343 b/c). Hieran an- knüpfend argumentiert Thrasymachos weiter, „dass der Gerechte überall schlechter daran ist als der Ungerechte“ (343 d), z.B. in Geldgeschäften: Der Gerechte wird am Ende nie mehr haben als der Ungerechte, sondern weniger - wer sich also die Ungerechtigkeit nicht zu sei- nem Vorteil zu Nutze macht, wird am Ende leer ausgehen. Selbiges Prinzip lässt sich auch auf Staatsämter anwenden, der Gerechte wird nie einen Vorteil haben, eben weil sein Prinzip die Gerechtigkeit ist, während der Ungerechte immer einen Vorteil haben wird, weil er überhaupt kein Prinzip hat. Thrasymachos versteht unter dem Ungerechten jemand, „welcher im Großen zu übervorteilen versteht“ (344 a) und bringt als Beispiel der „vollendeten Ungerechtigkeit“ (ebd.), die Tyrannei: der, der Unrecht getan hat ist der Glücklichste, der Tyrann, die, die Un- recht erlitten haben sind die Unglücklichsten. Wenn jemand sozusagen „im ganz großen Stil“ Ungerechtigkeit betreibt, wie der Tyrann, wird er am Ende sogar noch glückselig und preis- würdig genannt. „Denn nicht aus Furcht, Ungerechtes zu tun, sondern es zu leiden, schmäht die Ungerechtigkeit, wer die schmäht. Auf diese Art, o Sokrates, ist die Ungerechtigkeit vor- nehmer als die Gerecht igkeit, wenn man sie im Großen treibt; und wie ich von Anfang an sagte, das dem Stärkeren Zuträgliche ist das Gerechte, das Ungerechte aber ist das jedem selbst Vorteilhafte und Zuträgliche“ (344 c). Nach dieser Rede schickt Thrasymachos sich an, die Anwesenden zu verlassen, wird jedoch überredet, zu bleiben, um weiterhin Rede und Antwort zu stehen.
Sokrates und die anderen halten den Gegenstand der Rede Thrasymachos´, die Frage nach Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit für extrem wichtig, da es in dieser Frage darum geht, wie jeder von ihnen sich in diesem Punkt verhalten muss, um das beste, zweckmäßigste Leben zu leben. Trotz der langen Rede Thrasymachos´ ist Sokrates weiterhin davon überzeugt, dass die Gerechtigkeit vorteilhafter ist als die Ungerechtigkeit und mehr Gewinn bringe als diese. Sokrates fordert Thrasymachos dazu auf, ihn und die anderen doch vom Gegenteil zu überzeugen, worauf Thrasymachos entgegnet, er habe doch schon alles in seiner Macht stehende getan, um Sokrates und die anderen zu überzeugen, er könne ja nicht dem Sokrates „die Rede in die Seele hineintragen, und sie dort festmachen“ (345 b).
Sokrates erhebt jetzt erste Einwände gegen die Rede; Thrasymachos habe nicht vom wahr- haften Hirten nach der vorher gegebenen Definition gesprochen, dessen Aufgabe es ist, auf das Wohl der Schafe zu sehen, vielmehr scheint es so, als achte der Hirte nach Thrasymachos „auf den Kaufpreis [des Schafs] wie ein Handelsmann und nicht wie ein Hirt“ (345 d). Eigent- licher Zweck der Hirtenkunst sei es aber doch, für das, worüber sie gesetzt ist, das Beste zu erreichen. Gleiches gilt für jede Regierung; sofern sie Regierung ist, achtet sie nur auf das Wohl der Regierten. Sokrates´ nächstes Argument gegen Thrasymachos ist, dass niemand gern ein Regiment nur um des Führens willen führt, stets fordert derjenige auch Lohn dafür, weil nicht die Herrscher, sondern die Beherrschten einen Vorteil aus dem Herrschen haben. Jede Kunst ist verschieden von einer anderen, so auch die Lohndienerei. Man wird wohl kaum von Heilkunst sprechen, wenn jemand beim Lohndienst gesund ist, also kann man auch nicht die Heilkunst als Lohnkunst bezeichnen, wenn jemand für das Heilen Geld nimmt. Der Nut- zen, also der Erwerb des Lohns für den die Kunst Anwendenden ist dieser also nicht eigen, viel-mehr ist es so, dass die Heilkunst die Gesundheit und die lohndienerische Kunst den Lohn bewirkt. Wenn aber kein Lohn für jede Kunst anstehen würde, hätte der Meister, der sie ausübt auch keinen Vorteil von ihr, denn den Vorteil haben ja immer diejenigen, über welche die Künste regieren. So auch die Kunst des Regierens - würde der Herrscher keinen Lohn für seine Tätigkeit erhalten, ginge ihm aus dieser auch kein Vorteil hervor, denn den Vorteil haben ja die Schwächeren, die Beherrschten, da sie diejenigen sind, auf deren Vorteil die Kunst des Regierens abzielt. „Derjenige, welcher seine Kunst gut ausüben will, [besorgt] niemals sein eigenes Bestes, wo er nach seiner Kunst etwas anordnet, sondern dessen, was er regiert; weshalb denn, wie einleuchtet, Lohn da sein muss für die, welche sollen regieren wollen, sei es nun Geld oder Ehre, oder eine Strafe, falls sie es nicht tun.“ (346e/347a)
Glaukon wirft ein, er habe den letzten Punkt nicht verstanden, da er nicht weiß, was für eine Strafe das ist, die Sokrates als Lohn anrechnet. Da das Streben nach Geld und Ehre schändlich ist, und die Guten weder des Einen noch des Anderen wegen regieren, glaubt So- krates, die größte Strafe für einen potentiellen Regierenden ist es, „von Schlechteren regiert zu werden, wenn einer nicht selbst regieren will; und aus Furcht vor dieser scheinen mir die Rechtschaffenen zu regieren“ (347c). Und weil es weder bessere gibt als sie, noch gleiche, die regieren könnten, ist es quasi eine Art Zwang für die Guten, das Regierungsamt selbst anzutreten, um größeren Schaden zu vermeiden, was Sokrates wieder zu seiner Ausgangs- these führt, dass der wahrhafte Regierende nicht wegen seines eigenen Vorteils - sei es Geld, Ruhm oder Macht - regiert, sondern aus reiner Selbstlosigkeit heraus, um den Beherrschten den größten Vorteil zu verschaffen bzw. das ihnen Zuträgliche zu gewährleisten. Sokrates fragt Glaukon nun, was dieser von Thrasymachos´ Rede hält, dass des Ungerechten Leben besser sei als das des Gerechten. Glaukon ist der Meinung, das Leben des Gerechten sei zweckmäßiger, also scheint dieser Punkt einer Diskussion zu bedürfen, jedoch legt Sokrates dabei Wert darauf, nicht gegenseitig die Güter zu zählen und messen zu müssen, die jeder dem anderen vorhält, denn dazu bräuchte man einen Richter, der letztendlich entscheidet, welches der beiden Leben aufgrund größerer Vorteile vorzuziehen sei. Vielmehr hält Sokrates es für angebracht, seien bisherigen Weg fortzusetzen, und sich gegenseitig zum Eingeständnis zu bringen, in diesem Falle nämlich wäre man Richter und Redner zugleich, worauf Glaukon zustimmt.
Thrasymachos behauptet, die vollkommene Ungerechtigkeit sei förderlicher als die vollkommene Gerechtigkeit, er nennt die Ungerechtigkeit Klugheit und die Gerechtigkeit gutartige Einfalt, d.h. er stellt erstere auf die Seite der Weisheit und Tugend, letztere aber auf die des Lasters und der Unvernunft, während Sokrates es genau andersherum hand hat. Sokrates sieht ein, dass er es jetzt schwer hat, gibt aber dennoch nicht auf.
Thrasymachos nun gibt zu, dass, da ein Gerechter ja gutmütig und einfältig ist, dieser nicht daran interessiert ist, anderen Gerechten etwas vorauszuhaben, wohl aber den Ungerechten. Der Ungerechte hingegen möchte sowohl dem anderen Ungerechten, als auch dem Gerechten etwas voraus haben, da er ja stets auf seinen größtmöglichen Vorteil bedacht ist. Sokrates bringt dies dann auf die Formel: „Der Gerechte will vor dem Ähnlichen nichts voraushaben, aber vor dem Unähnlichen; der Ungerechte hingegen vor dem Ähnlichen und dem Unähnli- chen.“ (349 c/d). Nach Thrasymachos ist also der Ungerechte der Verständige und Gute. So- krates argumentiert, dass ein Wissender bzw. Kundiger einem anderen Wissenden nie etwas voraushaben will, wohl aber einem Unwissenden, Der Unwissende dage gen möchte sowohl anderen Unwissenden etwas voraushaben, als auch den Wissenden. Thrasymachos gesteht ein, dass der Kundige/Wissende der Weise ist, der Unwissende aber der Törichte. Da der Gute und weise aber vor dem Ähnlichen nichts voraushaben will, wohl aber vor dem Unähnlichen und Entgegengesetzten, und Thrasymachos vorher gesagt hatte, der Gerechte sei derjenige, der dem Ähnlichen nichts, dem Unähnlichen aber schon etwas voraushaben wolle, zeigt es sich, dass hiernach der Gerechte auch der Gute und Weise sein muss, der Ungerechte aber nicht, da er vor dem Ähnlichen und Unähnlichen etwas voraushaben will, dies aber nur das charakteristische Verhalten des Unkundigen ist, den Thrasymachos selbst den Törichten nennt. Also ist der Gerechte der Weise und Gute, der Ungerechte der Törichte und Schlechte. „Thrasymachos nun gestand dies zwar alles ein, aber ... nur dazu gezogen und mit Mühe und unter gewaltigem Schweiß“ (350 c/d); es ist ihm peinlich, dass seine These so logisch wider- legt worden ist, er errötet. Sokrates schließt weiter, dass die Gerechtigkeit, wo sie doch schon Weisheit und Tugend ist, auch stärker sein muss, als die Ungerechtigkeit, und erläutert seine These am Beispiel der Stadt, die ungerecht handelt und andere Städte unterwirft. Wenn sie aber erst einmal so weit gekommen ist, dass andere Städte ihr untergeben sind, wie wird sie diese dann weiterregieren, mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Thrasymachos antwortet: „Wenn ... wie du eben sagtest, die Gerechtigkeit Weisheit ist, dann mit Gerechtigkeit; wenn es aber ist, wie ich sagte, mit Ungerechtigkeit“ (351 b/c). Sokrates ist sichtlich erfreut über diese Antwort, und erläutert Thrasymachos, dass es unmöglich für die Ungerechten ist, etwas gemeinschaftlich zu bewirken, wenn sie auch untereina nder ungerecht sind, da dies Zwie- tracht und Hass unter ihnen zur Folge hätte, was dazu führte, dass sie ohnmächtig wären, was das Handeln anbelangt, und sie einander genauso feind wären wie den Gerechten gegenüber. So verhält es sich aber bei jeder Einheit, in der die Ungerechtigkeit wohnt, sei es eine Stadt, ein Geschlecht oder auch nur eine einzelne Person. Diese würde unweigerlich mit sich selbst in Zwietracht und Uneinigkeit sein, und schließlich nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit allen anderen verfeindet sein.
Hiermit wäre ich dann auch beim eigentlichen (Kern-)Thema meiner Arbeit angelangt, nämlich inwiefern jemand, der mit sich selbst ungerecht und „nicht im Reinen“ ist, unfähig ist, im Umgang mit anderen Menschen gerecht zu sein und gerecht zu handeln. Daher ist es nach Platon notwendig, ein tugendhaftes Leben zu führen, die Eudämonie als Ziel allen Han- delns und letztes Ziel des Lebens, da dies zu innerer Ausgeglichenheit und damit Gerechtig- keit führt! Am Schlimmsten ist es nun, wenn ein Herrscher von Ungerechtigkeit „befallen“ ist - er wird stets in jedem anderen einen Feind sehen und diesen bestrafen wollen, sich ständig hintergangen und untervorteilt fühlen, was sich alsbald in seiner Art zu regieren aus drücken wird.
Ungerecht Handelnde, die z.B. eine Stadt unterwerfen, handeln, indem sie gemeinschaftlich handeln, nie vollkommen ungerecht, da sich ja gezeigt hat, dass die vollkommen Ungerechten nicht in der Lage sind, irgendetwas gemeinsam auszurichten, da sie in Streit und Zwietracht verfallen. Daraus folgt, dass noch etwas Gerechtigkeit in ihnen sein muss, Sokrates bezeich- net sie auch als „Halbschlechte“ (352 c). Er möchte jedoch noch zeigen, dass die Gerechten auch besser und glücklicher leben als die Ungerechten, obwohl das aus dem oben Gesagten schon hervorgehen dürfte. Exemplarisch beweist er dies am Beispiel der Augen und Ohren: Jedes hat seine eigene Aufgabe/Fähigkeit, ihr eigenes „Geschäft“, das sie als einziges am al- lerbesten ausüben kann, und mit diesem Geschäft verbunden auch ihre eigene Tugend. Wenn diese Dinge anstelle ihrer Tugend Schlechtigkeit hätten, könnten sie ihre Aufgabe nicht be- werkstelligen. So verhält es sich auch mit der Seele, auch sie hat ihr eigentümliches, ganz spezielles Geschäft, und eine Tugend, die sie dieses Aufgabe (gut) verrichten lässt. Geschäfte der Seele sind z.B. „besorgen, beherrschen, beraten und alles dieser Art“ (353 d), aber auch die Art, wie man lebt. „Wird also jemals, o Thrasymachos, die Seele ihre Geschäfte gut ver- richten können, wenn sie ihrer eigentümlichen Tugend beraubt ist? Oder ist das unmöglich? - Unmöglich. - Eine schlechte Seele also wird notwendig auch schlecht beherrschen und be- sorgen, die gute aber alles dieses gut verrichten? - Notwendig. - Nun aber sind wir doch übereingekommen, die Tugend der Seele sei Gerechtigkeit, ihre Schlechtigkeit aber sei die Unge rechtigkeit? - Darin sind wir übereingekommen. - Die gerechte Seele also und der ge- rechte Mann wird gut leben, schlecht aber der Ungerechte. - Das geht wohl hervor, sprach er aus deiner Rede. - Und wer wohl lebt, ist der nicht preiswürdig und glückselig, wer aber nicht, das Gegenteil? - Wie könnte es anders sein! - Der Gerechte also ist glückselig und der Unge rechte elend. - Das mögen sie sein, sagte er. - Elend sein aber fördert nicht, sondern glückselig sein. - Das versteht sich. - Niemals also, o vortrefflicher Thrasymachos, ist die Ungerechtigkeit förderlicher als die Gerechtigkeit.“ (353 e/354 a) Damit hat Sokrates Thra- symachos bewiesen, was er beweisen wollte, allerdings gibt er zu bedenken, dass er mit der Methode, nach der dieses geschah, nicht so ganz zufrieden ist: „... so komme ich mir auch vor als ob ich, ehe noch gefunden war, was wir zuerst suchten, nämlich, was doch das Gerechte sei, von diesem abgelassen und mich zu jenem gewendet habe, zu der Untersuchung, ob es wohl eine Schlechtigkeit ist und eine Torheit oder eine Weisheit und Tugend; und als hernach wieder eine andere Rede dazwischenfiel, dass die Ungerechtigkeit vorteilhafter sei als die Gerechtigkeit, konnte ich mich nicht enthalten, auch gleich wieder von jener zu dieser zu ge- hen. So dass ich jetzt durch das ganze Gespräch doch nichts gelernt habe. Denn solange ich nicht weiß, was das Gerechte ist, hat es gute Wege, dass ich wissen sollte, ob es eine Tugend ist oder nicht und ob der, welcher es an sich hat, nicht glückselig ist oder glückselig.“(354b/c)
Warum gerecht leben?
Es versteht sich von selbst, dass nur das gerechte Leben des Einzelnen wie hier in 351e bis 352c beschrieben zur Verwirklichung eines gerechten Staates beitragen kann, weil niemand den anderen zu übervorteilen versucht, und so auch niemand, der es nur auf seinen eigenen Vorteil abgesehen hat, an die Regierung kommen wird, um den anderen seinen Willen aufzu- zwingen.
Festzustellen ist, dass die politischen Ansichten und damit verbunden auch die gesamte Le- benseinstellung, die hier von Sokrates und Thrasymachos vertreten werden, vollkommen un- terschiedlich sind. Thrasymachos ist der Ansicht, die Person eines Herrschers ist stets nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, ist deshalb auch Herrscher geworden und regiert nun, ohne auch nur im Geringsten auf das Wohl der Regierten zu achten, welche wiederum selbst nicht in der Lage sind, Einfluss auf das Regierungsgeschehen nehmen zu können (Prinzip der Ty- rannei oder Diktatur). Dieses „Weltbild“ lässt sich meiner Meinung nach auch in unserer Zeit noch häufig finden, es wird auch mit dem Begriff „Politikverdrossenheit“ bezeichnet: Die Menschen glauben, dass diejenigen, die an der Regierung sitzen, nicht daran interessiert sind, wie es „denen da unten“ ergeht, sondern lediglich daran, wie sie selbst sich am schnellsten bereichern können, man könnte auch sagen, solche Menschen haben den Glauben in die Poli- tik verloren. An dieser Stelle zeigt sich wieder einmal, dass die Platonische Philosophie aktu- ellere Fragen behandelt, als man allgemein annimmt.
Während Thrasymachos also eher ein fatalistisches Weltbild zu haben scheint, wie aus dem eben Gesagten hervorgehen dürfte, glaubt Sokrates, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich selbst zu bestimmen. Hinter dieser Möglichkeit steht natürlich auch immer eine enorme Verantwortung, der man eben dadurch gerecht werden soll, dass man den fünf Tugenden, Ge- rechtigkeit, Besonnenheit, Frömmigkeit, Mannheit und als oberstes natürlich Weisheit bzw. Erkenntnis entsprechend handelt, und hierbei natürlich auch dem Gerechtigkeitsideal entspre- chend erst einmal gerecht mit sich selber umgeht, und zweitens anderen gegenüber gerecht ist. Nur ein solches, tugendhaftes Leben kann nach Platon zur vollständigen Glückseligkeit eines Menschen führen, welche sowohl bei Platon und Sokrates, als auch bei Aristoteles der Grund- begriff der Ethik ist3.
Das Prinzip der Verantwortung findet man später auch in Kants Kategorischem Imperativ wieder, in dem es heißt: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“4 Dies besagt im Grunde das Gleiche, und ein solches Handeln ist immer mit dem Prinzip der Verantwortung des Einzelnen gegenüber allen anderen verbunden.
Auch den oben erwähnten Selbstbestimmungsgedanken, wie ich ihn interpretiere kennen wir noch in unserer Zeit, als westliche Nationen haben wir ihn in unsere Verfassungen mitintegriert, z.B. im Grundgesetz der Bundesrepublik in den Artikeln 1, 2, 4 und 5.
In gewisser Weise wird der Kampf, den Thrasymachos und Sokrates führen, heute immer noch geführt, nämlich von denjenigen, die behaupten, die Demokratie, die der Staat vertritt wie wir ihn haben, sei die vollendetste aller Staatsformen, und denjenigen, die ich vorhin als „Politikverdrossene“ bezeichnet habe. Interessanterweise haben sich nur die Rollen verdreht, letztere glauben nämlich nicht wie Thrasymachos, dass man, weil die Regierung ungerecht handelt, selbst auch ungerecht handeln muss, im Gegenteil: Oftmals ist mit der Politikver- drossenheit der Wunsch nach mehr Bürgereinfluss, also mehr Selbstbestimmung verbunden.
Auch zu seiner damaligen Zeit versuchte Sokrates - und mit ihm Platon, denn schließlich ist man sich bis heute nicht sicher, wieviel von dem, was Sokrates sagt auf ihn selbst zurück- geht und inwiefern Platon ihn (als Figur) benutzt, um Eigenes auszudrücken - die Menschen aufzuklären: Während des gesamten Dialoges versucht Sokrates nichts anderes, als die Defi- nition des althergebrachten Rechtsbegriffs in Frage zu stellen und einen neuen Rechtsbegriff zu definieren. Dieser Versuch ist die Fortführung der „Geschichte der Entmythologisierung des Rechts, die durch die Physis-Nomos-Debatte der Sophisten eingeleitet worden war“5. Recht hieß bisher, das Ziemliche, das Gebührende zu tun, „das Schuldige zu leisten“6. Im Dialog selbst ist Kephalos ein Vertreter dieser Rechtsauffassung, und nicht zufällig verlässt er die Anwesenden, um zu opfern, denn wie alle denen „die vorgegebene Sitte eindeutig sagt, was sich gehört“7 hält er es nicht für nötig, zu hinterfragen, wodurch diese Rechtsauffassung ihre Legitimation erhält und wäre wahrscheinlich auch nicht in der Lage, dies zu erörtern. Der Soziologe Max Weber hat in einem solchen Fall davon gesprochen, dass die Legitimation, die einer Ordnung (auch der Rechtsordnung) von den Handelnden zugeschrieben wird, kraft der Tradition, der „Geltung des immer Gewesenen“ herrührt8. Dieser Rechtsauffassung nun möchte Sokrates widersprechen. Damit verbunden erkennt er auch die Autorität des Simoni- des, auf die Kephalos´ Sohn Polemarchos sich zu berufen versucht, nicht an. Sokrates erklärt sich auch mit dessen These, die zu seiner Zeit vor allem bei den Sophisten Zuspruch fand, nicht einverstanden, dass Gerechtigkeit bedeute, jedem das Schuldige zu leisten, denn dies lässt darauf schließen, dass man Freunden nutzen und Feinden schaden soll, dabei ist es nach Sokrates´ Auffassung doch so, dass Gerechtigkeit nicht beinhalten kann, auch nur irgendwem zu schaden oder einem anderen gegenüber einen Vorteil haben zu wollen. Letztendlich gipfelt Sokrates´ Argumentation ja dann auch in der These, dass Ungerechtigkeit Zwietracht schafft und im Zustand der Zwietracht Glückseligkeit nicht möglich ist. Mir hat sich an dieser, wie auch an einigen anderen Stellen die Frage gestellt, wie Platon dies belegen kann. Damit möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich anderer Meinung bin, dennoch ist es so, dass Platon seinen ganzen Argumentationsstrang in den Dialogen sehr streng logisch aufbaut, und eine Schlussfolgerung Vorraussetzung für die nächste bzw. Resultat der Vorhergehenden ist, und in diesem Argumentationsstrang gibt es eben immer wieder Argumente, die einfach als Tatsachen hingestellt werden, ohne dass sie einer weiteren Untersuchung zu bedürfen schei- nen. In diesem Dialog gibt es noch eine andere, in dieser Art ähnliche Stelle. Noch bevor Thrasymachos zu den anderen stößt, als Sokrates noch mit Polemarchos spricht, sagt er in 334c, dass Freunde diejenigen sind, welche einem „gutartig“ erscheinen oder es sind. Was aber bedeutet gutartig in diesem Zusammenhang? Kurz davor, in 334a benutzt er den Begriff „gut“ noch im Sinne von könnend, oder geeignet, wenn er sagt: „Auch im Lager ist derselbe gut als Wächter, der auch gut ist, die Ratschläge und anderen Handlungen der Feinde auszu- kundschaften?“, und kurz darauf spricht er schon von „den Guten“ und „den Schlechten“ (334c) und davon, dass „die Guten“ die Gerechten sind und „die Schlechten“ die Bösen. Pla- ton ordnet den Begriffen gut und schlecht an dieser Stelle bereits eine moralische Dimension zu, ohne dies näher zu begründen. Die Werte „gut“ und „schlecht“ werden hier mit gerecht und ungerecht gleichgesetzt, obwohl die eigentliche Klärung und vor allem auch die Begrün- dung dieser Frage, warum das Gerechte das Gute und das Ungerechte das Schlechte ist, über- haupt noch nicht erfolgt ist und erst im folgenden Gespräch mit Thrasymachos eine Rolle spielt. Natürlich möchte ich, wie schon gesagt, nicht bestreiten, dass die Gerechten „die Gu- ten“ und die Ungerechten „die Schlechten“ sind, dennoch halte ich es an dieser Stelle für ver- früht, diese Wertzuschreibung zu fällen. Vermutlich ist es ein Trick in der Gesprächsführung des Sokrates, diese moralische Dimension hier hereinzubringen, um Polemarchos leichter zu überzeugen, dass die These des Simonides falsch ist. Noch bemerkenswerter ist es, dass So- krates, nachdem er mit den Begriffen gut und schlecht in diesem Zusammenhang schon seit einiger Zeit im Gespräch operiert, Polemarchos die Frage stellt: „Und der Gerechte ist doch gut?“ Natürlich bleibt Polemarchos hier gar nichts anderes übrig, als auf diese Frage mit ja zu antworten, da er ja schon die ganze Zeit mit diesem Begriff und dessen impliziter moralischer Bewertung argumentiert. Dass es auch anders geht, zeigt später schließlich Thrasymachos, indem er die These aufstellt, das der Ungerechte der Gute, oder zumindest der Schlaue sei.
Sokrates´ Idealismus
Eine andere, mir erörternswert erscheinende Sache ist, was ich „den Glauben Platons an das Gute im Menschen“ nennen möchte. Sokrates ist der Ansicht, dass der wahre Herrscher nicht etwa regiert weil er Macht ausüben oder andere unterdrücken und ihnen seinen Willen auf- zwängen will, auch nicht, weil er geldgierig ist und sich finanziell bereichern will - für So- krates gibt es nur einen Grund, warum die Rechtschaffensten regieren, der ist die Angst der Selbigen, von Schlechteren als sie selbst es sind regiert zu werden. Er geht sogar soweit, dass er von einer Strafe spricht, die den Guten dadurch auferlegt ist, dass sie von Schlechteren re- giert werden, und dass es deshalb ein Zwang für sie ist, selbst an die Regierung zu gehen. Somit ist es eine Notwendigkeit für den Regent, sein Amt anzutreten, da „niemand gern daran gehe, etwas zu regieren, und es über sich nehme, fremdes Übel wieder in Ordnung zu brin- gen“ (346e). Aus diesem wiederum leitet er ab, dass ein Herrscher nicht auf sein eigenes Wohl, sondern auf das der Regierten bedacht ist. Die Regierenden regieren also aus purer Selbstlosigkeit heraus. Diese These halte ich für sehr idealistisch, und ich glaube nicht, dass es sich in der Realität (auch in Athen) so verhält. Viel eher denke ich, dass der Antrieb für die meisten Regierenden das Geld, die Macht und der Ruhm ist. Angenommen, dem wäre nicht so, und Platon hätte recht, dann wäre doch alles bereits perfekt, wozu wäre es also noch nötig, ein Werk wie die Poleteia zu verfassen, in dem es ausschließlich darum geht, wie der voll- kommene Staat auszusehen hat, wie dies zu verwirklichen ist und welche Schlüsselrolle die Philosophie dabei spielt?
Ich kann nur spekulieren, wie die Antwort auf diese Frage lautet, aber da man sich ja weit- gehend einig zu sein scheint, dass der Thrasymachos-Dialog ursprünglich zu den frühen Werken Platons zählte, könnte ich mir vorstellen, das diese These seinem „jugendlichen Idealismus“ entspringt, und er erst später, mit der Politeia näher darauf eingeht, wie so etwas überhaupt zu realisieren wäre. Oder handelt es sich hierbei lediglich um eine Art „Vorgriff“? Paul Friedländer deutet diese Stelle genau so. Er glaubt, dass Platon diese Stelle nachträglich eingearbeitet haben muss und dass mit dem Ausspruch „wenn ein Staat vollkommener Men- schen entstünde“ von fern angedeutet wird, wie Platons Staat, den er in den Büchern II bis X erläutert, aussieht: „Aber wie fern auch immer, nur an dieser Stelle des Ersten Buches taucht gleichsam wie eine Luftspiegelung gegenüber dem Preise der Tyrannis der wahre Staat eben auf, um sofort wieder zu verschwinden. Ihn für einen Augenblick wenn auch mehr als Rätsel und Fragezeichen hinzustellen, das war Platons Absicht“9 Mit dieser Erklärung möchte ich mich jedoch nicht zufrieden geben, denn es erscheint paradox, eine These, deren Erörterung und Beweis Aufgabe eines ganzes Werks war, am Anfang des Selbigen bereits als festste- hende, in die Argumentation miteinbezogene Tatsache zu behandeln.
Auch Babara Zehnpfennig stellt sich in ihrer Platon-Darstellung die Frage, was „denn eigentlich die Rede vom wahrhaften Regenten [soll], wenn doch ein Blick in die alltägliche politische Praxis genügt, um zu erkennen, dass man einem solchen bestenfalls in Utopia begegnen kann“10. Sie interpretiert diese Stelle so, dass Sokrates kein Ideal fordert, sondern aufzeigt, „dass das Alltagsdenken noch in der Leugnung des Ideals, der Tugend, Tugend voraussetzt“11. Dies greift ihrer Meinung nach auf die Ideenlehre voraus, denn obwohl Thrasymachos leidenschaftlicher Vertreter des Prinzips Unge rechtigkeit ist, kommt er in seiner Argumentation nicht ohne eine (unbewusste) Idee des Begriffs Gerechtigkeit aus.
Sokrates´ Absicht besteht also darin, dem Dialogpartner zu zeigen, dass ihm diese Gerech- tigkeitsidee seit jeher innewohnt, und daher die einzig wahre Gerechtigkeit sein muss. Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf den direkten Gesprächspartner, hier Thrasymachos. Viel- mehr geht Platon noch eine Ebene weiter, und spricht so auch immer den Leser mit an. Somit hätte man auch eine Erklärung für diese Stelle, der Leser verfolgt beim Lesen den Argumen- tationsstrang beider Gesprächsteilnehmer mit und stellt sich dann die Frage, ob Sokrates hier nicht zu idealistisch denkt, um letztendlich darauf verwiesen zu werden, dass auch ihm die Gerechtigkeitsidee bereits innewohnt. Verhält es sich mit den Ideen aber nicht vielmehr so, dass sie - soziologisch gesehen - Werte sind, die ein jeder Mensch von frühester Kindheit an internalisiert und die deswegen jederzeit präsent sind? Diese Frage zu beantworten soll hier jedoch nicht meine Aufgabe sein.
Festzuhalten bleibt, dass die Platonische Philosophie auf diese Weise einen Erziehungsan- spruch erhält, der auf drei Ebenen aktiv wird. Die erste Ebene ist die allgemeine, auf der die Frage nach dem richtigen Handeln erst einmal generell thematisiert wird, hier in der Form, dass gefragt wird, was überhaupt Gerechtigkeit ist. Die zweite Ebene ist dann das Bemühen Sokrates´- wissentlich oder unwissentlich - , die direkten Gesprächsteilnehmer, hier Thrasy- machos, Polema rchos und Kephalos zu erziehen, indem er die Frage nach der Gerechtigkeit mit ihnen diskutiert. Die dritte Ebene ist nun der schon erwähnte „Schritt in die Praxis“, der auf den Leser bezogene Erziehungsanspruch, der durch das Nachvollziehen der Argumenta- tion selbst erzogen wird, sofern er dies zulässt. Hier würde der Kreis zu dem von mir vermu- teten Selbstbestimmungs- und -verantwortungsprinzip des Sokrates, auf das ich weiter oben schon eingegangen bin, geschlossen: Der Mensch wird als Individuum auf sich selbst verwie- sen, er sollte die Platonischen Dialoge mit dem Hintergrund lesen, was er für sich selbst in- haltlich und vor Allem moralisch aus ihnen ziehen kann mit dem Ziel, mit Hilfe der daraus gewonnenen Selbsterkenntnis ein tugendhafteres Leben zu führen, was letztendlich zur Ver- wirklichung einer gerechteren Gesellschaft beiträgt. Nicht zuletzt hat Platon die Dialogform gewählt, um dem Leser den Bezug der Philosophie zum wirklichen Leben zu verdeutlichen, er möchte zeigen, dass Philosophie eigentlich „aus dem Leben kommt“ und für das Leben da ist.
Sokrates´ Glaube an das Gute im Menschen (im Herrscher) und das Gegenbeispiel im Alkibiades
Die Frage, warum Platon von einem solchen Idealbild des Menschen - hier des Herrschers - ausgeht, wäre somit vo rerst geklärt. Dass Platon selbst weiß oder vielmehr wissen muss, dass es sich in der Realität anders verhält, beweist der Alkibiades-Dialog. Alkibiades, ein junger Mann und Liebhaber Sokrates´, strebt danach, ein großer Staatsmann zu werden, obwohl er, allem Anschein nach nicht über das dafür benötigte Wissen verfügt. Er behauptet, in Kriegs- und Friedensangelegenheiten sei immer „das Bessere“ dasjenige, was zu tun sei, aber es stellt sich heraus, dass Alkibiades gar nicht weiß, was das Bessere ist. Sokrates überzeugt ihn schließlich davon, dass das Gerechtere gleichzeitig auch immer das Bessere ist. Alkibiades behaup tet, er wisse Bescheid über das, was gerecht ist und was nicht, weil er es durch alltägliche Erfahrung gelernt hat. Auch dies stellt sich schon bald wieder als Irrtum heraus, denn die Menschen, von denen Alkibiades gelernt haben will, was gerecht ist und was nicht, sind sich selber so uneinig darüber, dass sie aus diesem Grund auch nicht als Lehrer dafür taugen, da eine gute Lehre immer Einigkeit der Lehrenden über den gelehrten Stoff erfordert.
Es zeigt sich also, dass Alkibiades nicht die geringsten Anforderungen, die das von ihm angestrebte Amt verlangt, erfüllt. Aber nicht nur das: Sokrates behauptet, es reiche nicht für ein Staatsamt, dass man selber nur weise ist, man muss auch andere weise machen können. Alkibiades beschließt deshalb, so weise und geschickt wie möglich zu werden und Sokrates soll ihn dabei unterstützen. Letzterer lenkt das Gespräch jetzt in die Richtung, dass Alkibiades auf sich selbst Sorgfalt wenden muss, indem er für sich selbst sorgt und fragt ihn, wie er dies wohl tun möge. Es zeigt sich bald, dass wenn der Mensch für „das Seinige“ sorgt, er noch lange nicht auch für sich selbst sorgt, denn sich um das Seinige kümmern heißt, sich um die Sachen kümmern, die dem selbst „gehören“, also nur um Äußerlichkeiten. Alkibiades sieht also ein, dass er, um ein vortrefflicher Staatsmann zu werden, nicht für das Seinige, sondern für sich selbst sorgen muss, wobei Sokrates ihn darauf aufmerksam macht, dass es notwendig ist, sich selbst zu kennen, bevor man für sich sorgen kann. Hierauf folgt ein kurzer Abschnitt, dass Selbsterkenntnis nur möglich ist, wenn man auch andere kennt, d.h. durch die Abgren- zung des eigenen Ichs zu anderen Individuen wird man zu diesen in eine bestimmte Relation gesetzt und vermag, sich selbst klarer zu erkennen; durch den Kontakt mit anderen Menschen grenzt man sich gegen diese ab und erhält so ein Bild der eigenen Person. Wer sich selbst nicht kennt, kennt also auch das Seinige nicht und versteht sich nicht darauf. Wer sich aber auf das Seinige nicht versteht, kann sich auch auf das der Anderen nicht verstehen, schon gar nicht auf das des Staates. Jemand, der sich nicht kennt kann also nicht Staatsmann werden, da er weder über das nötige Wissen über sich selbst, noch über andere verfügt, seine Staatsge- schäfte werden schlecht sein und sowohl die anderen wie auch ihn unglücklich machen. Nicht der reiche oder der mächtige, sondern nur der besonnene Herrscher kann demnach ein guter Herrscher sein. „Also nicht Mauern und Kriegsschiffe und Werfte brauchen die Städte, o Al- kibiades, wenn es ihnen wohlergehen soll, noch auch Volksmenge oder Größe ohne Tugend.“ (134b). Alkibiades muss sich also tugendhaft, besonnen und gerecht machen, wenn er gut über die Stadt herrschen will, und er beschließt, diesen Vorsatz mit Sokrates´ Hilfe in die Tat umzusetzen. Leider scheint ihm das nicht gelungen zu sein, denn wie man weiß, erweist Alki- biades sich später als äußerst listig, machtgierig und selbstsüchtig.
Das Thema ist hier das Gleiche wie im Thrasymachos, ein guter Herrscher muss gerecht und tugendhaft sein, um gut regieren zu können.
Mir ging es jedoch darum, zu zeigen, dass Sokrates´ These, dass die Regierenden nur des- halb regieren, weil sie sonst befürchten, von Schlechteren als sie selbst es sind regiert zu wer- den, und der Herrscher nicht sein eigenes Wohl, sondern das der Regierten im Auge hat, nicht der Wahrheit entspricht. Man sieht ja am Alkibiades, dass es nicht so ist, schließlich möchte er nicht regieren, weil er Angst hat, von Schlechteren regiert zu werden, sondern um anderer Dinge willen. Was aber sind das für Dinge? Ich denke, es sind Geld, Macht und Ruhm, die sowohl Alkibiades wie auch alle andern Herrscher dazu motivieren, ein Staatsamt anzutreten, also Dinge, die vordergründig dem eigenen Wohl dienen. Das weiß auch Sokrates, sonst wäre das Gespräch nicht notwendig gewesen.
Das Alkibiades-Beispiel zeigt auch, dass diese Motive stärker sind als die bessere Einsicht, denn obwohl Alkibiades diese bessere Einsicht hatte, setzt er sie nicht um, er lebt nicht nach ihr; im Gegenteil er wird die Art von Staatsmann, den Thrasymachos die ganze Zeit propa- giert, ein Tyrann.
Somit bleibt als einzige Erklärung, warum Sokrates dieses Idealbild des Herrschers immer wieder anführt, der Erziehungsanspruch, der Versuch, die Menschen zu besserer Einsicht zu bringen, „denn nur, wer das Unmögliche fordert, wird das Mögliche erreichen“.
Literatur
Primärliteratur:
Platon. 1994. Sämtliche Werke, Band 1. (Hrsg. Ursula Wolf) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Platon. 1994. Sämtliche Werke, Band 2. (Hrsg. Ursula Wolf) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Sekundärliteratur
Brockhaus Enzyklopädie, 24 Bände. 198619. 1. Band. Mannheim: Brockhaus. Friedländer, Paul. 19643. Platon, Band 2. Berlin: Walter de Gruyter & Co.. Friedländer, Paul. 19753. Platon, Band 3. Berlin: Walter de Gruyter & Co..
Kant, Immanuel. 19962. Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. (Hrsg. Wilhelm Weischedel) Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft.
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. 1991. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Berlin.
Pleger, Wolfgang H.. 1998. Sokrates, der Beginn des philosophischen Dialoges. (Hrsg. Burghard König) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Störig, Hans Joachim. 198713. Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
Weber, Max. 19473. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Sozialökonomik. 1. Bd. Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Zehnpfennig, Barbara. 1997. Platon zur Einführung. Hamburg: Junius.
[...]
1 Störig, Hans Joachim, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, S.125
2 ebd., S.160
3 Pleger, Wolfgang H., Sokrates. Der Beginn des philosophischen Dialoges, S.156
4 Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten S.51
5 vgl. Pleger, Wolfgang H., Sokrates, der Beginn des philosophischen Dialoges, S.155
6 ebd.
7 ebd.
8 Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Sozialökonomik.1. Bd. S. 28
9 Friedländer, Paul, Platon, 1.Bd., S.59
10 Zehnpfennig, Barbara, Platon zu Einführung, S.50
11 Zehnpfennig, Barbara, Platon zu Einführung, S.50
- Arbeit zitieren
- Claudia Hoppe (Autor:in), 1999, Warum das tugendhafte Leben des Einzelnen bei Platon Voraussetzung für die Verwirklichung eines gerechten Staates ist, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102149
Kostenlos Autor werden
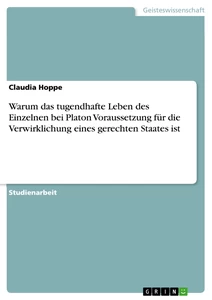



















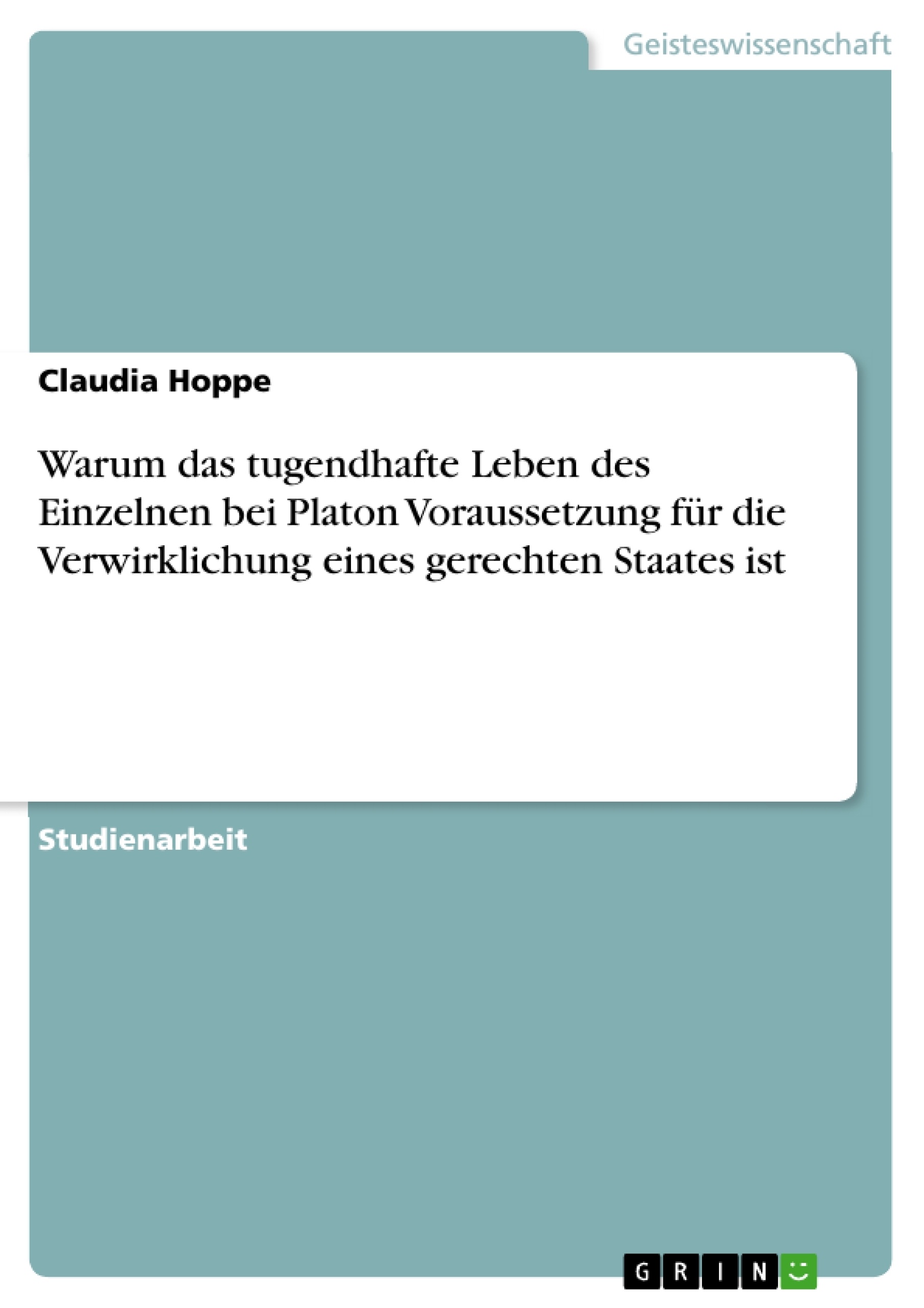

Kommentare